
Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild (High Romantasy von der SPIEGEL-Bestsellerautorin von "One True Queen") Hörbuch
Jennifer Benkau
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Reich der Schatten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
So episch, herzzerreißend und atemberaubend wie "One True Queen" Band 2 der romantischen High-Fantasy-Reihe von Bestsellerautorin Jennifer Benkau Wer aus dem Reich der Schatten entkommen will, muss ein Opfer bringen – das hat Laire auf grausame Weise erfahren. Ihre folgenschwere Entscheidung im Palast des dunklen Lords hat Alaric für immer von ihr getrennt. Verflucht und halb wahnsinnig schwört Alaric all jenen tödliche Rache, die ihn verraten haben. Als Laires Heimat im Chaos versinkt, erkennt sie, dass sie nur eine Chance hat, die Menschen, die sie liebt, zu beschützen: Sie muss sich dem Schicksal selbst entgegenstellen … Jennifer Benkaus Romantasy-Reihen "One True Queen", "Das Reich der Schatten" und "The Lost Crown" spielen in derselben Fantasy-Welt, können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Sie sind in dieser Reihenfolge erschienen: One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet New-Adult-Romance von Jennifer Benkau: A Reason To Stay (Liverpool-Reihe 1) A Reason To Hope (Liverpool-Reihe 2)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2021
Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
© 2021 Ravensburger Verlag
Copyright © 2021 by Jennifer Benkau
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Lektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de)
Umschlaggestaltung und Vorsatzkarte: Carolin Liepins
Verwendete Bilder von © Aleshyn Andrei, © Ironika, © BestPhotoStudio, © Bokeh Blur Background und © Ukki Studio, alle von Shutterstock
Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-47148-5
www.ravensburger.de
Nach all den Träumen bin ich es, die über mein Schicksal entscheidet.
INTERMEZZO
Nemija war nicht vorbereitet.
Es war ein milder Frühsommerabend, und auf den Weiden im Tal und den Auen in den Bergen trocknete der letzte Regen und kroch in Nebelschwaden gemächlich die Anhöhen hinauf, verfing sich in Senken und schimmerte im Licht der untergehenden Sonne. Das Land hüllte sich in einen Schein von Frieden in diesen Stunden, da alle Scharten, Ecken und Kanten unsichtbar wurden.
Niemand konnte ahnen, was weit fern und zugleich ganz nah in diesen Augenblicken geschah. Nicht einmal den betenden Priestern in ihren Tempeln kam eine böse Vorahnung. Die Winde schwiegen, und die Berge würden nie verraten, ob sie blind waren, ahnungslos oder gleichgültig.
Der Lord der Daema fiel, und mit ihm stürzten alle Grenzen zum namenlosen Reich der Schatten ein.
Da brachen die Daema ohne eine Warnung aus den Rissen hervor. Sie kamen aus heiterem Himmel. In Scharen strömten sie aus den Wäldern. Es war den Menschen von Nemija, als fielen sie wie Regen aus den Wolken, als kämen sie aus den Wasserquellen, als kröchen sie aus den Feuerstellen.
Sie kamen aus den Bergen, rissen nieder, was sie auf ihren Wegen ins Tal fanden, und töteten, als triebe sie die reine Mordlust. Kaum einer unter den Nema begriff, was sie begehrten – begriff, dass es Hass war, der sie trieb. Der Hass auf die Menschen, die sie einst verflucht hatten. Die Daema selbst hatten keine Vorstellung davon, dass jene Menschen oftmals schon seit tausend Jahren tot und begraben waren, und hätten sie sie gehabt, wäre es ihnen gleich gewesen. Sie gierten nach Rache, ihr Durst war alt und ewig, und in ihrem Wahn metzelten sie nieder, wen sie sahen.
Die Garde Nemijas war schnell und furchtlos, doch die Daema hatten sich längst verteilt, verbargen sich zwischen Felsen und in den Tiefen der Wälder, krochen die Berge hoch und flüchteten durch jede Klamm. Ihre Zahl war zu groß, um sie alle zu erschlagen, egal wie scharf die Klingen der Nema waren, egal wie schnell ihre Pferde, egal wie entschlossen ihre Herzen. Mehr und mehr Daema gelangten über die offen stehenden Grenzen. Mehr und mehr Blut von Nemija rann über die Felsen und sickerte in den Boden. Mehr und mehr Seelen gingen mit den Winden in die Arme von Lyaskye.
Nemija war dem Untergang geweiht.
Niemand konnte ahnen, was weit fern und zugleich ganz nah in diesen Augenblicken geschah. Nicht einmal den betenden Priestern in ihren Tempeln kam eine gute Vorahnung. Die Winde schwiegen, und die Berge würden nie verraten, ob sie blind waren, ahnungslos oder gleichgültig.
Eine Zauberin, die alle Magie beim Namen kannte, rief zu sich, was ihr Erbe war, und wob einen Fluch aus Dunkelheit und Macht und Magie.
Sie krönte einen neuen Lord über die Daema.
Und der Lord schloss die Grenzen aus Schatten, sodass keine weitere Daema ins Reich der Menschen einfallen konnte – nicht eine mehr.
Wie alle Geschichten, die wahr sind, erzählte auch diese niemand weiter. Denn wer glaubt schon eine Wahrheit, wenn ihr Lügen gegenüberstehen?
Wunden schwelen, Gefangene werden vernichtet, und aus jedem Verlust wächst neuer Hass heran.
Das Land, dessen Volk die Berge seine Familie nennt und die Winde seine Freunde, sollte nie erfahren, dass es weder die Regierung noch die Garde war, die es vor dem Untergang bewahrte.
Nemija blieb ahnungslos, wen es für sein Leid bestrafte.
KAPITEL 1
LAIRE
Wie schwer und bedrohlich die Burg meiner Vorfahren über mir aufragte. Vor wenigen Jahren noch war sie mein Zuhause gewesen. Dann beraubte man mich meines Namens und vertrieb mich. Ebnete mir schließlich einen Weg zurück. Und als ich glaubte, dass nun alles gut würde, weil ich über mich hinausgewachsen war, waren ihre Mauern zum Ort meiner schlimmsten Albträume geworden.
Hätte ich es nicht früher ahnen müssen? Warum hatte nichts mich gewarnt vor dem, was geschehen würde? Oder hatte es diese Warnungen gegeben? Als ein Flüstern im Wind, als ein Raunen in den Bergen, das ich nur nicht hatte wahrnehmen wollen?
Ich zwang mich auf die Zugbrücke zu, die über die achthundert Meter tiefe Schlucht in den Hof der Burg es Retneya führte. Früher war die Brücke über Jahre nicht ein einziges Mal hochgezogen worden und so dick mit dem Sand der Bergstraßen bedeckt gewesen, dass es nur noch am dumpfen Klang zu erkennen gewesen war, wenn man über sie hinwegtrat. Inzwischen rollten die Räder der Fuhrwerke direkt über die Holzbalken, und wenn ich den Blick auf meine Füße senkte, konnte ich durch die Ritzen das Dunkel der bodenlosen Tiefe erahnen. Die Burg schützte sich nun jede Nacht vor den übrigen herumstreunenden Daema, indem die Gardisten die Brücke hochzogen. Auf der einen Seite wachte die Schlucht, auf der anderen hundert bewaffnete Wachen auf den Wehrgängen. Sie standen dort, wo die Gemäuer in den Berg übergingen, sodass man kaum erkennen konnte, wo die Burg es Retneya aufhörte und der mächtige Westberg Volarian begann.
Im Senketaldorf schützten meine Mutter und mich nur unsere letzten beiden wachsamen Gänse. Die anderen hatten die Daema allesamt gerissen und den Großteil der Kadaver liegen gelassen.
Doch es war nicht der Neid auf den Schutz der Burgbewohner, der meinen Magen krampfen ließ, wann immer ich herkam.
Es war das Grauen, das mich auf dem Rückweg ins Dorf zerriss, jedes verdammte Mal, wenn ich die Burg verlassen musste, weil ich Mutter nicht so lange allein lassen konnte. Wenn ich mir nichts vormachte, hätte ich ihr keine Sekunde lang von der Seite weichen dürfen. Doch ich machte mir etwas vor. Viel zu viel sogar. In erster Linie, etwas ändern zu können.
Es war das Grauen, das ich auf es Retneya zurückließ.
Und es war das Grauen, das mich bei jeder Rückkehr erwartete, sobald ich die ersten Häuser, Mauern und Türme passierte und sie den Blick freigaben auf die Frontseite des Palas mit all seinen prunkvollen Buntglasfenstern, auf denen die Berge und die Macht der Winde abgebildet waren, als könnte irgendwer hier sie auch nur einen Moment lang vergessen.
Eines der Fenster, schräg links über dem Haupteingang, in etwa sechs Metern Höhe, hatte mein Vater der neusten Demonstration seiner Macht geopfert.
Oder der Demonstration seiner Ahnungslosigkeit.
Der Demonstration meiner schrecklichen Schuld.
Ich war über mich hinausgewachsen, fürwahr. Früher hatte ich jene, die meine Freunde waren, in Gefahr gebracht. Heute vernichtete ich, wen ich liebte.
Das Fenster hatte bis vor wenigen Wochen die Myr gezeigt, den Nordwind, wie sie Seite an Seite mit Männern der Nemagarde gegen ein überdimensionales blutrünstiges Säbelhorn kämpfte.
Nun waren Männer, Säbelhorn und Myr verschwunden. Sie hatten das bunte Glas herausgeschlagen und von innen zugemauert sowie einen Sims ans untere Ende des Bogens gebaut, gerade breit genug, dass Füße darauf Platz fanden.
An dem Tag, als ich es zum ersten Mal gesehen hatte, war meine Hoffnung noch lebendig gewesen. Laut, kraftvoll und zäh wie ein Herzschlag.
»Er kommt frei«, hatte ich zu Vika, Desmond und Cadyz gesagt und jedes Wort so gemeint. »Es sind nur Ketten. Er sprengt die Glieder, er reißt sie aus dem Stein. Er ist doch …«
Vikas Augen waren klar und tief und voller Schuldgefühle gewesen, als sie erwidert hatte: »Er steht dort seit acht Tagen, Laire. Er hat versucht, sich loszureißen, immer wieder. Aber er schafft es nicht.«
An der Stelle, wo mein Herz gewesen war, hatte sich ein Stein gebildet. Ein eiskalter, schwerer Stein mit scharfen Kanten, an denen ich mich schnitt, wann immer ein Gefühl ihn zaghaft berührte.
Aus den Tagen waren mehr als drei Wochen geworden, und er stand noch immer dort. Die Arme in geschmiedeten Schellen über dem Kopf, der Körper nur von einer halb zerrissenen Hose und den Fetzen einer fadenscheinigen Mowlee geschützt. Sie hatten ihn zum Sterben dort auf dem Sims festgeschmiedet, unwissend, dass der Lord der Daema zwar bluten und Schmerzen leiden, aber weder an Hunger noch an Durst oder Demütigung sterben konnte.
Er hatte schon sehr lange nicht mehr versucht, sich zu befreien.
Nun aber schlug seit einigen Tagen wieder so etwas wie die Erinnerung eines vorsichtigen Herzschlags in meiner Brust. Denn wir hatten einen Plan.
Ich wich einem Händler aus, der seinen Esel so hoch beladen hatte, dass das arme Tier bei jeder Windbö schwankte. Dadurch sah ich Vika erst, als sie mich fast erreicht hatte.
»Laire! Laire, hier bin ich!« Sie eilte auf mich zu, umarmte mich zur Begrüßung und hakte sich bei mir unter. Seit unserer Reise nach Alsjana Daera, bei der ihre Haut im Kampf von einem Narbengeflecht überzogen worden war, trug sie ihre weizenblonden Locken, die sie früher immer praktisch an den Kopf geflochten hatte, nur noch offen und ließ sie sich so weit wie möglich ins Gesicht fallen. Natürlich erkannte man sie trotzdem, dafür sorgten allein die beiden Leibwachen, die ihre Eltern an Vikas Fersen geheftet hatten. Wenigstens hatten sie nicht erfahren, dass Vika damals mit mir gereist war. Andernfalls hätten wir uns nicht mehr treffen dürfen. So aber nahmen sie es hin. Es war schließlich kein Geheimnis mehr, dass ich die künftige Gemahlin von Desmond es Yafanna war und damit wieder ein angemessener Umgang für ihre Tochter. Sie wussten ja weder, was wir gemeinsam erlebt hatten, noch was wir besprachen, wenn wir uns mit Desmond trafen.
Heute erschien mir Vika nervöser als sonst. Sie zog mich in eine Seitengasse, in der sich Schillingsmädchen in den Türeingängen herumtrieben und uns misstrauisch beäugten. Frauen nahmen nie diesen Weg, und taten sie es doch, bedeutete es nichts Gutes für die Mädchen.
»Ist etwas passiert?«, raunte ich Vika zu. Ich war pünktlich und normalerweise besuchten wir das Gasthaus erst am frühen Abend, weil wir unter den vielen Leuten, die dann ein- und ausgingen, weniger auffielen. Doch seit Jero nicht mehr da war, wollte ich zum Abend wieder im Dorf sein, um es zu beschützen.
»Nein«, sagte Vika, aber das Wort kam zu schnell. »Ich habe da nur eine Bekannte gesehen und wollte nicht, dass sie uns mit ihrem unsinnigen Getratsche aufhält.« Sie strich sich aus alter Gewohnheit eine Haarsträhne zurück und schüttelte sie sogleich wieder in die alte Position. »Wie geht es deiner Mutter? Und den anderen im Dorf?«
Sie meinte es nur gut, und ich zwang mich zu einem Lächeln. Ich hatte ihr nie verraten, dass ich mir fürchterliche Sorgen machte, wann immer ich das Dorf verließ. Jero war lange geblieben und hatte geholfen, die durch den Wald im Senketal streifenden Daema zu bekämpfen. Seit er aufgebrochen war, um seine Familie zu finden, war ich eine der wenigen, die das Dorf noch schützen konnten. Die Daema hatten viele Leben gekostet, und die Überlebenden, zu denen – aller Dank an die Berge – meine Mutter gehörte, litten unter dem Umstand, dass der Großteil des Viehs gerissen und die Ernte auf den Feldern zertrampelt worden war. Die Hilfe des Fürsten konnte man bestenfalls als überschaubar bezeichnen, und selbst das sagten nur die Speichellecker und Duckmäuser.
»Mutter ist tapfer«, antwortete ich ausweichend. »Es geht ihr immer etwas besser, wenn es warm wird.«
Vika drückte meinen Arm. »Bis der Herbst kommt, hat sie ein Zimmer mit Kamin in der Burg.«
Aber erneut waren ihre Worte mir eher Schrecken als Trost. In dieser Burg, wo sie Alaric Tag und Nacht quälten, sollte ich leben?
»Bis dahin haben wir ihn befreit«, flüsterte Vika. Sie musste gespürt haben, dass mir der Schweiß am Rücken ausbrach. »Cadyz und Desmond haben gute Neuigkeiten.«
»Und wenn ich keine habe?« Ich musste die Magie zurückgewinnen, die ganze Kraft über die Magie. Doch seit der Nacht, in der ich Alaric mithilfe aller Magie von Alsjana Daera sowie meiner eigenen zum Daemalord gemacht hatte, schien sie sich vor mir zu fürchten und zu verstecken. Ich spürte ihre Schwingungen noch, roch und schmeckte sie, hörte ihre Melodien. Aber wollte ich sie nutzen – sie wirken –, fühlte ich mich hilflos, als verlangte man von einem Kind, zu lesen und zu schreiben, ohne dass es je einen einzigen Buchstaben gelernt hatte.
Ich griff nach den Enden der Magie, versuchte, sie mit meinem Geist zu verflechten, aber sie riss sich von mir los oder folgte meinem Willen nur gezwungen, um sich so schnell sie konnte wieder von mir zu lösen.
Zu Anfang war ich fast dankbar darum gewesen. Vielleicht, dachte ich, hatte ich meine Aufgaben erfüllt. Nemija war gerettet und Alaric zwar für mich verloren, aber diesmal in einem Schicksal gefangen, das er wenigstens selbst gewählt hatte. Er hatte beschlossen, Lord der Daema zu werden, um uns alle zu beschützen.
Vielleicht musste ich es akzeptieren und irgendwann erkennen, dass uns diese Trennung vorherbestimmt gewesen war. Wozu brauchte ich noch die Magie?
Ich bezweifelte, dass sich das Schicksal weiter für mein Herz interessierte. Was waren schon ein oder zwei gebrochene Herzen für die Sicherheit eines gesamten Volkes?
Doch dann, als mein Verstand endlich so weit war, diese Ordnung als gegeben hinzunehmen, als die kontrollierte Nema in mir endlich wieder die Oberhand gewann und ich fest daran glaubte, dieses verdammt schmerzende Herz würde ein weiteres Mal durchhalten, war der Bote ins Senketaldorf gekommen.
Er trug die Farben der Familie es Retneya, und es versetzte mir einen Stich, dass er mich inmitten der anderen Dörfler keines Blickes würdigte – und dies nie tun würde. Mein Vater würde nie erfahren, dass ich sehr wohl die Erbin es Retneya war. Außer mir und einem Lügner, über dessen Identität ich nichts wusste, hätte nur ein Mann die Wahrheit über mich verlauten lassen können: Alaric Cole. Doch der regierte inzwischen ein Land aus wilder Furcht und Wünschen.
Ungeduldig kordelte ich mein Haar zu einem Knoten zusammen und blickte zu dem Boten, der sich auf seinem staubbedeckten Pferd mittig auf dem Marktplatz aufgestellt hatte. »Worauf wartet Ihr noch, Ser?«
Der Mann sah auf mich herab. Wie alle anderen war ich bewaffnet zum Marktplatz gekommen, wo seit der Nacht der Daema kein Handel und kein Fest mehr stattgefunden hatte. Wir huschten nur noch für die nötigsten Besorgungen aus unseren Hütten und erledigten alles, was möglich war, hinter dem Hauch von Schutz, den uns Holzwände und Türen boten. In den letzten Wochen waren es deutlich weniger Daema geworden, aber niemand wollte unvorbereitet einer der übrigen begegnen. Wir schliefen sogar mit den Mistgabeln, Sensen und Messern in den Händen, aus Angst, im Schlaf von ihnen überrascht zu werden.
Alaric hatte sein Versprechen gehalten und die Grenzen geschlossen. Doch wie viele der Monster bereits auf unserer Seite des Landes waren, würde wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Ich wusste nur, dass es zu viele waren.
Der Bote räusperte sich lautstark. »Ich hatte nach allen Bewohnern dieses Dorfes verlangt. Wo sind eure Leute?«
»Wollt Ihr uns verspotten?« Es war nicht meine Aufgabe, für das Dorf zu sprechen. Aber wir hatten keine Stimme des Dorfes mehr. Lyrass, die Apothekerin und Theobos Mutter, war im Kampf gegen die Daema gefallen, und bislang hatten wir anderes zu tun gehabt, als eine neue Stimme zu wählen. Wir hatten es ja nicht mal geschafft, alle Toten angemessen zu bestatten.
Meine Hände ballten sich unweigerlich zu Fäusten. Ich trug eine schreckliche Mitschuld am Ausbruch der Daema, aber der Gedanke musste tief in mir vergraben bleiben. Kam er erst in seiner ganzen Brutalität in mir hoch, war ich meinem Dorf keine Hilfe mehr. Und sie brauchten mich doch. Ich war eine der wenigen, die nicht in Panik gerieten, wenn Kreaturen durchs Unterholz der Wälder schlichen. Ich war eine von denen, die den Kampf nicht scheuten und den Menschen Mut schenkten, indem ich ihnen bewies, dass auch Daema aus Fleisch und Blut bestanden. Dass wir sie töten konnten, wenn sie kamen, um uns zu holen.
»Das hier, Stimme der Burg es Retneya, sind alle Männer und Frauen des Senketaldorfes«, rief ich, denn außer zwei oder drei Erwachsenen fehlten nur ein paar Kinder, die Kranken und jene, die zu alt waren, um zum Markt zu kommen. Und Jero natürlich. Aber dass der Paladin ohne Hand in Nemija war, wusste niemand in der Burg. Er bewachte das Haus meiner Mutter, solange ich hier war, und hielt sich im Verborgenen. Immerhin hatte man ihn vor vielen Jahren ins Exil verbannt.
»Sagt, was Ihr zu sagen habt, und dann reitet wieder fort. Die Zeit, in der wir die Waffen von es Retneya gebraucht hätten, ist vorüber!«
Gemurmel erhob sich. Ein paar Frauen reagierten empört auf meine brüsken Worte, weil sie sich Hilfe aus der Burg erwarteten. Sie wussten nicht, dass man uns diese Hilfe nicht einmal dann gewähren würde, wenn wir auf Knien darum flehten.
Andere stimmten mir zu. Jeder hier hatte jemanden verloren – einen Elternteil, eine Liebste, einen Bruder oder ein Kind –, und ihr Kummer hing noch immer wie beißender Brandrauch über dem Platz. Sie verhüllten ihre Enttäuschung nicht länger.
»Jetzt brauchen wir die Hilfe des Fürsten nicht mehr!«, brüllte der Schmied über das summende Gemurmel der anderen hinweg. »Schert Euch zum Daemalord, Stimme von es Retneya! Und nehmt Eure herausgeputzten Gecken mit! Wir füttern weder Euch noch Eure Gäule auch nur einen Tag lang durch.«
»Wir haben doch selbst nichts mehr!«, bestätigte eine alte Frau mit rauer Stimme.
Rufe erklangen, und das Pferd des Boten wich ein paar Tritte zurück, als einige der Männer sich ihm drohend näherten.
Mir wurde flau. Wenn nun die Stimmung kippte und die Menschen in ihrer Verzweiflung den Boten angriffen, gab es weiteres Blutvergießen. Das durfte keinesfalls geschehen. Mein Dorf hatte genug gelitten!
»Lasst ihn doch reden!«, rief ich und sprang auf einen großen Stein, um besser gesehen zu werden. »Ich will wissen, was der Fürst uns zurufen will aus seiner sicheren Festung hoch im Berg!« Ich erwartete, ihren Zorn auf mich zu lenken, doch der Schmied warf mir über die Köpfe der anderen Leute einen Blick zu und nickte dann entschlossen.
»Lasst ihn reden!«, wiederholte er meine Worte mit seiner dröhnenden Stimme. »Das Mädchen mit der Myr hat ein Recht darauf, seine Antworten zu kriegen!«
Mädchen mit der Myr. Sie meinten meine traditionelle gebogene Nemaklinge, den Myrodem, den ich, nachdem die Daema das Dorf angegriffen hatten, nicht mehr länger hatte verstecken können. Niemand hatte gefragt, warum ich ihn noch besaß, war es mir doch seit meiner Verbannung nicht mehr gestattet, eine solche Waffe zu tragen. Die Dörfler scherten sich jedoch nicht um die Regeln des Fürstenhauses. Sie waren dankbar, dass ich den Myrodem zu führen wusste.
»Euer Fürst bringt euch gute Kunde ins Senketal«, rief der Bote. Er wirkte ein wenig verunsichert, ich merkte es daran, wie kurz er die Zügel seines Wallachs hielt und wie nah er ihn an die Pferde seiner Eskorte lenkte. Unruhig trat der Fuchs vor und zurück. Seine Mähne flog im Ostwind, der Tanell, die warm war, aber im Sommer selten weich. Auch heute kam sie in wilden, hitzigen Böen. »Euer Fürst lässt euch wissen, dass er um eure schwere Zeit weiß und gnädig sein wird. Er ist gewillt, euch für den nächsten Herbst sämtliche Steuerabgaben zu erlassen.«
Eine Frau begann lautstark zu lachen. »Da er ja ohnehin weiß, dass bei uns nichts mehr zu holen ist! So ist es doch!«
»So und nicht anders!«, rief ein junger Mann. Ich erkannte die kurzen, weißblonden Locken von Theobo, dem jungen Apotheker. »Reitet zurück zu Eurem Fürsten, Ser, und sagt ihm, wir sterben ihm noch weg vor lauter Dankbarkeit für diese Großzügigkeit! Allerdings denke ich, Ser, dass ihn unser Sterben nicht besonders interessieren wird. Ist es nicht so?«
Rufe der Zustimmung wurden laut, und die Ersten wandten sich schon ab und wollten nach Hause gehen.
Der Bote war allerdings noch nicht fertig. »Euer Fürst lässt euch außerdem wissen, dass das Unheil, welches euch aus dem Reich der Schatten droht, nun am Ende seiner Kräfte angelangt ist.«
Jäh besaß er die volle Aufmerksamkeit aller. Denn mit einem solchen Versprechen hatte keiner von uns gerechnet.
Einzig der Schmied schwieg nicht. »Will er uns erzählen, alle Daema wären ausgemerzt? Dann war er noch nicht in den Tiefen unserer Wälder.«
»Es ist nur eine Frage der Zeit«, sagte der Bote. Nun, da sich alle ruhig verhielten, brauchte er nicht mehr zu schreien. Er klopfte sich Staub von der Jacke, bevor er fortfuhr. »Unser Fürst hat den Lord der Daema überwältigt und hält ihn gefangen.«
Nein.
Eine heiße Tanell-Böe erwischte mich, ich schwankte auf dem Stein, musste nach der Schulter eines Mannes greifen, um nicht zu stürzen.
Nein!
In die Dörfler kam sofort wieder Bewegung, einige wenige jubelten, andere wirkten entsetzt.
»Alles in Ordnung, Laire?«, fragte mich der Mann, der mich gestützt hatte. Ich kannte ihn flüchtig, er arbeitete in der Tischlerei. »Du bist bleich wie ein Kreidefelsen. Geht es dir gut?«
Ich erkämpfte mir das Gleichgewicht zurück, nickte und reckte den Kopf, um nicht alles zu versäumen, was der Bote berichtete, obgleich ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte.
Es konnte nicht wahr sein, oder? Mein Vater hatte eine Daema in seiner Gewalt, die er fälschlicherweise für den Lord hielt. So musste es sein. Er hätte doch niemals Alaric überwältigen können!
»Und er denkt, wir würden das glauben?«, brüllte der Schmied.
Seine Frau klammerte sich an seinen Arm, sie wirkte entsetzt von der bloßen Vorstellung. »Selbst wenn es nur eine Lüge ist – er wird sich rächen. Der Lord wird jedes Vergehen rächen! Und wen trifft es, wenn er seine Kreaturen schickt? Das hohe Volk versteckt sich in der Burg und wird von der Garde geschützt. Doch wer schützt uns?«
Der Bote ließ sein Pferd tänzeln. »Kommt zur Burg, wenn ihr nicht glaubt, dass euer Fürst obsiegt hat! Das, was einst Lord der Daema war, wird dort zur Schau gestellt, damit die Menschen von Nemija mit eigenen Augen sehen, dass ihr Fürst stärker ist als ein uralter Fluch!«
Das, was einst Lord der Daema war …
Die Furcht, diese Worte könnten bedeuten, dass er tot war, schlug mir hart ins Gesicht. Ich musste einen Schrei unterdrücken und presste mir beide Hände vor den Mund.
»Er ist nichts weiter als ein Gefangener. All seine Macht liegt in Ketten. Wandert zur Burg, Leute, und seht es selbst!«
Bei seinen Worten wurden mir die Knie weich. Alaric schien zu leben. Den Bergen sei gedankt, wenigstens das. Ich versuchte, vom Stein zu klettern, doch es war mir nur mit der Hilfe der Umstehenden möglich.
»Mich besorgt das auch«, sprach eine Frau zu mir. »Das wird die Daema schwer erzürnen. Dieser Krieg ist nicht vorbei. Er hat gerade erst begonnen.«
Ich schob mich an ihr vorbei und zwang mich, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Eilig, aber ohne zu rennen. Musste mit eigenen Augen sehen, was mit dem geschah, den ich liebte.
Und ich hatte es gesehen. Hatte Woche um Woche seine Qualen beobachtet. Bis ich endlich begriff, dass er sich tatsächlich nicht selbst würde befreien können.
Dass ich es war, die ihn retten musste.
KAPITEL 2
CALEJA
Das Gestell, in dem Vater zur Flamme werden würde, wie es dem Fürsten von Keppoch zustand, stand seit der letzten Nacht bereit. Es war wohl nur noch eine Frage weniger Tage, bis er dahinscheiden würde, und Caleja erfüllte eine aufgeregte und zugleich beängstigende Erwartung angesichts des Erbes, das vor ihr lag.
Sie stand auf dem obersten Absatz der breiten Portaltreppe, die zum Hof herabführte, auf dem sich zu festlichen Anlässen die Menschen versammelten. Vor mehr als zweiundzwanzig Jahren war sie hier der Menge präsentiert worden – nackt, blutbeschmiert und aus vollem Halse brüllend in der linken Hand ihres Vaters, während alle Blicke dem Säugling in seiner Rechten galten. Dem Sohn, der dem Volk in seinem Land nicht einmal Schreie entgegenwarf, sondern jämmerlich still geblieben war wie ein Welpe, den man aus Gnade besser sofort unter Wasser gedrückt hätte.
Bald würde sie erneut mit Vater hier oben stehen, das Jubeln der Menge in den Ohren, die traditionellen Symbole im Gesicht, das letzte und höchste aller Ehrenzeichen in die Haut gebrannt. In ihre Haut. Vater würde diese Welt verlassen und zur Flamme werden.
Und sie zur Fürstin. Zur ersten Fürstin ihrer Heimat.
Orange und golden flammte der Morgen über Keppoch hinweg und vertrieb das Grau der Nacht in die hintersten Winkel. Es leuchtete in Phönixfarben, das Land, das bald schon ihres sein würde. Sie schwor sich ihm im Stillen, es nicht zu enttäuschen.
»Euer Pferd ist bereit, Mylady«, sagte der Stalljunge. »Sämtliches Gepäck verladen. Sobald Ihr bereit zum Aufbruch seid, kann die Reise beginnen.« Er wartete, bis sie an ihm vorbeigetreten und die geschwungene Seitentreppe hinabgelaufen war, wo ein Weg zum Stalltrakt führte. Sie war mehr als nur bereit. Seit Wochen wartete sie darauf, ihre Überraschung zu präsentieren. Zunächst dem Korpskommandanten und dann, sobald dieser seine Arbeit tat und das Heer in die Schlacht führte, ihrem Volk.
Der Korpskommandant, ein ernster, ruhiger Mann mit dunklem, kurzem Bart, in dem erste graue Haare schimmerten, saß bereits auf seinem Pferd, als sie herantrat; eine Frechheit, die sie ihm heute noch verzieh. Bald nicht mehr. Mit seinen mehr als dreißig Wintern war Callahan Brock deutlich älter, als die meisten anderen in seiner Position wurden, was bewies, dass er gut war. Leider hatte er noch immer keinen Erben für sein Amt gezeugt, was sich langsam zum Problem entwickelte. So schwer konnte es doch kaum sein, eine Frau zu schwängern, zumal sie sich um ihn rissen.
Calejas knielange Mowlee schwang über Nars glänzend schwarzen Rücken, als sie aufsaß und die Stofffalten richtete: den vorderen Teil über die linke Pferdeschulter, den hinteren über die rechte Flanke, sodass die linke, wo das Schwertgehänge angebracht war, frei blieb. Ihr Nicken gab das Signal. Von vierzehn Kriegern und einem halben Dutzend Dienern begleitet, ritten sie in gesetztem Galopp Richtung Süden.
Der Sommer hatte das Land hart gemacht und klebte schwer an den Hufen der Pferde. Mit Vernunft betrachtet, war es zu heiß zum schnellen Reisen, doch Caleja wusste, wann sie sich Unvernunft erlauben musste. Nar war in bester Form, um ihn musste sie sich nicht sorgen. Die nächste Schlacht sollte vorbereitet sein, der Angriff bereits anrollen, wenn Vater starb. So konnte sie sich die Emotionen ihres Volkes zunutze machen. Es würde das Heer zu Höchstleistungen gegen Eshrian anfeuern!
Für eine glühende neue Fürstin würden die Soldaten wie wilde Tiere kämpfen. Und das war nötig.
Der Vergessene Wald lag wie ein Friedhof zu ihren Füßen, vertrocknet und verbrannt, sodass die Erde Risse bildete und die Hitze zwischen den kurzen Baumstümpfen flirrte. Die Aufforstung war mühsam und dauerte zu lange. Ihre Eltern und Großeltern hatten Keppoch ausgebeutet und würden Caleja und das Volk – ihr Volk – nun ohne den Funken eines schlechten Gewissens zurücklassen. In einer Welt, in der alle Öfen kalt bleiben würden, wenn sie nicht vor der Wahren Königin bat und bettelte, sodass Lyaskye ihr neuen Brennstoff schickte.
Aber nie, zumindest nicht zu Calejas Lebzeiten, würde Keppoch vor Lyaskye betteln. Hätte ihr Vater diesen Weg gehen wollen, hätte er Alaric unterstützen und zu seinem Erben machen müssen. Alaric hätte gebettelt. Aber nicht sie.
Nach zehn Tagen Ritt durch den Vergessenen Wald erreichten sie die Ausläufer des Niemandslandes, ödes Geröllland, wo die Erde nichts außer neuen Steinen ausspie und nur Kakteen, Echsen und Schlangen lebten. Besser als hier, wo niemand freiwillig herkam, konnte man eine neu gegründete Stadt nicht verstecken.
Der Staub war allgegenwärtig, legte sich auf Haut und Haar, verklumpte in der Nase und ließ die Pferde hart schnauben. Das steinige Land forderte Tribut und bekam ihn. Innerhalb von nur zwei Tagen hatten sie drei gute Tiere verloren, und ein Mann wurde so schwer verletzt, dass sie ihn hatten zurücklassen müssen.
Dann erreichten sie die schattige Ortschaft, die Caleja in einer felsigen Schlucht, in der es eine Quelle gab, geschaffen hatte. Ihre Leute hatten sie nach ihr benannt. Caya Caleja.
Sie passierten ein paar Wohnbaracken und Paddocks, in denen Pferde, Zugochsen und Ziegen für die Nahrungsversorgung in der Hitze dösten. Danach folgten die Schmieden, wo der Geruch der Feuer und des eingeschmolzenen Eisens aus Nemija den Kopf schwindelig machte. Caleja liebte diesen Geruch. Wo die Feuer brannten und Schwerter geschmiedet wurden, da stand Keppoch in voller Kraft.
Danke, Bruder, dachte sie nicht zum ersten Mal, auch wenn ein Schatten über dem ironischen Gedanken schwebte. Das Opfer war groß gewesen, bitter und quälend. Aber es würde sich lohnen. Es musste. Für Keppoch war es nötig gewesen.
Eine Sichtung. So hatte der Korpskommandant genannt, was nun anstand. Sie schmunzelte in sich hinein. Er wusste noch nichts über die Anzahl der neuen Kräfte, die an diesem Tag gesichtet werden würden. Vor allem aber wusste er noch nicht, dass ein ganz besonderer Bonus auf ihn persönlich wartete. Sie würde ihm später erzählen, dass für ihn die Zeit der Familienplanung gekommen war. So ein tauglicher Mann sollte nicht sterben dürfen, bevor er Erben gezeugt hatte – Söhne und Töchter, in denen seine Fähigkeiten weiterbrannten.
Sie behielt den Korpskommandanten aus dem Augenwinkel im Blick, während sie sich dem Truppenübungsplatz näherten, und genoss das mühsam unterdrückte Erstaunen in seinem Gesicht. Mit dieser Zahl an Menschen hatte er nicht gerechnet. Er nicht und auch sonst niemand.
Caleja liebte Überraschungen.
»Mylady«, gab er von sich, als sie die Pferde am Rande des Platzes durchparierten. Dann musste er zunächst den Staub von seinen Lippen wischen. Sein Blick schwebte über die Männer und Frauen, die Aufstellung genommen hatten, die Köpfe erhoben, die Blicke gehorsam nach vorn gerichtet. Man hatte ihnen ärmellose Hemden gegeben, um zu zeigen, dass sie sich kräftige Schultern und muskulöse Arme bewahrt hatten, waren sie im Ganzen auch etwas mager und erschöpft von dem harten Weg durch die Berge von Nemija sowie dem wochenlangen Marsch bis hierher in die neue Stadt Caya Caleja.
Trotz aller Entbehrungen waren diese Männer und Frauen bereit, Keppoch zwei Jahre lang bedingungslos zu dienen. Dienen, so nannte der Fürst es Retneya das, was Caleja als Sklavendienst bezeichnete. Es war der Preis, den die Leute dafür zahlten, dass ihre Kinder, Frauen, Alten und Kranken Asyl zwischen Nemijas Bergen erhielten. Schutz, den ihre verlotternde Heimat Eshrian ihnen schon lange nicht mehr bot. Dass vor einem halben Jahr Horden von Daema durch Nemija gezogen waren, hatte die Bereitschaft der Menschen, für eine sichere Kammer im Inneren der Berge ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, noch erhöht. Der Fürst es Retneya von Nemija mochte ein Kleingeist sein, in ihm brannte kein Feuer, und dafür verachtete Caleja ihn. Aber er wusste wie kaum einer sonst, wie man Menschen unter Druck setzte. Nur eine Närrin hätte sein Talent nicht für sich genutzt.
»Mylady.« Der Korpskommandant schien sich nur langsam zu fangen. »Das sind Eshrianer.«
Sie nickte zufrieden. »Achthundert an der Zahl.«
»Es ist womöglich ein wenig riskant, mit Eshrianern in Eshrian einzufallen.«
Sie zog die Brauen zusammen und musterte den Kommandanten ihrer Streitkraft. »Höre ich Kritik an meinem Plan, bevor Ihr ihn kennt?«
»Selbstredend nicht, Mylady.«
»Gut.« Ein heißer Wind trieb Caleja das Haar ins Gesicht. Sie neigte den Kopf, damit die nächste Böe ihr die Locken wieder hinter ihre Schulter strich. »Am Hof von Eshrian ist man viel zu sehr mit kleinlichen Familienfehden beschäftigt, um sich um die Nöte der einfachen Leute zu kümmern.« Es war ein Verbrechen, das eigene Volk aus Unfähigkeit derart im Stich zu lassen, und ein unverzeihliches, an der Macht festzuhalten, wenn man von ihr überfordert war. »Der Hass auf die Fürstenfamilie Eshrians schwelt in diesen Menschen hier bereits. Wir müssen ihm nur etwas Zunder geben.«
»Das klingt erfolgversprechend …«
»Ah, ah, ah, ich bin nicht fertig. Natürlich ist es erfolgversprechend, aber ebenso ist mir bewusst, dass ein einzelner Sklave mit einem Funken Verrat in seinem Herzen in der Lage ist, großen Schaden anzurichten. Schaden, den ich nicht hinzunehmen gewillt bin. Diese Arbeiter hier werden keine Waffen tragen. Kein Schwert, keinen Pfeil, kein Feuer.«
Der Korpskommandant rieb sich den Bart, den Blick auf Caleja gerichtet, als könnte er sie drängen, schneller zu sprechen. Der Mann hatte kluge graue Augen, denen nichts zu entgehen schien.
Caleja musterte ihn aufmerksam. Sie sollte besser ein wenig Vorsicht walten lassen, was sie ihm anvertraute.
Sie nahm ihre Wasserflasche vom Gurt und trank in aller Ruh, bevor sie weitersprach. »Sie werden von Kriegern von Keppoch geleitet, selbst aber nichts als Äxte und Sägen tragen. Sie bekommen keine Pferde, sondern Ochsenkarren, um das Holz zu transportieren, das sie schlagen werden.«
Denn darum ging es; damit würde Keppoch die Jahre überbrücken, bis das gerodete Land selbst wieder genug Holz hergab: mit den Wäldern von Eshrian.
»Wir werden von Norden kommend in Eshrian einfallen. Gleich an der Grenze von Lyaskye. Die Königin wird das akzeptieren. Sie schuldet meinem Vater einen Gefallen, seit er an bedeutsamer Stelle dazu beitrug, ihren Bruder vom Thron zu stoßen. Vielleicht gefällt es ihr sogar. Denn in Eshrian, heißt es, verbergen sich noch Clanmagier, die sich den Gesetzen nach in die Dienste der Wahren Königin zu begeben haben. Aber Eshrians Herzog zeigt sich nicht besonders engagiert darin, diese Clanmagier auszuliefern. Die Königin wird daher in keinem Fall gegen uns agieren, eher wird sie mir danken.«
Der Kommandant nickte. »In besagter Region halten wir längst zentrale Wegepunkte besetzt. Es wird ein Leichtes sein, wenn die Männer schnell arbeiten und das Holz eilends abtransportieren. Wir könnten uns ganz Eshrian ein für alle Mal einverleiben.«
Caleja hatte darüber nachgedacht, es allerdings wieder verworfen. »Und uns Feinde schaffen, die wir nicht haben müssen? Das wäre unklug. Die Wahre Königin steht in unserer Schuld, seit mein Vater ihr einmal mit Streitkräften zu Hilfe kam, aber es wäre dumm, sie herauszufordern, indem wir zu gierig vorgehen. Ich will nur den nördlichen Teil Eshrians. Die Wälder von Amisas Grenze bis zum südlichsten Punkt des Salzsees. Glaubt mir, Brock. Das wird mehr als genug sein, und Eshrian wird uns dankbar die Stiefel lecken, wenn wir ihm im Anschluss die Gnade erweisen, an dieser Stelle die Grenzen neu zu stecken, sodass sie das Geisterhaus, das sie ihre Burg nennen, behalten dürfen.«
»Ihr beeindruckt mich«, gab ihr Gegenüber offen zu. »Ihr seid wahrlich Eures Vaters Tochter.«
Oh, ich bin viel mehr als das, dachte sie und ließ es den Mann in einem milden Lächeln wissen.
»Aber eins verratet mir, Lady Caleja. Was habt Ihr Nemija geboten, dass sie Euch Arbeitskräfte in dieser Zahl schicken? Ich hatte mit hundert oder zweihundert Männern gerechnet. Doch das hier …«
Es war zutiefst befriedigend, Callahan Brock sprachlos zu erleben, der sein halbes Leben lang für ihren Vater gearbeitet und sich dabei nie beeindruckt gegeben hatte.
»Es sind nicht nur Männer und Frauen.« Caleja blickte über die vielen Hundert Köpfe hinweg zu den Fuhrwerken hinter dem Sammelplatz, von denen die ersten bereits wieder loszogen, um ihre Fracht zu den Brennöfen zu transportieren, wo sie weiterverarbeitet werden konnte. »Wir bekommen zudem hundert Fass Eisenerz sowie hundert Fass Steinkohle.«
Der Korpskommandant gab sich größte Mühe, sich nicht anmerken zu lassen, dass er zwischen Erschrecken und Erstaunen schwebte – aber Caleja las in Menschen wie in Büchern. Ohne diese Gabe wäre sie nie so weit gekommen. »Was habt Ihr es Retneya dafür gegeben?«
Nichts weiter als ihren Bruder. Sie spielte mit dem Gedanken, es auszusprechen, nur um den Kommandanten ein weiteres Mal zu beeindrucken. Doch das würde zu Fragen führen, für die ihr heute die Geduld fehlte. Sie war hungrig und sehnte sich nach einem Bad und einem Zelt für sich allein mit einem Bett voll weicher Kissen.
»Ich wurde weise beraten«, erwiderte sie mit dem Gedanken an ihre neue Verbündete, eine geheimnisvolle Frau, die überall und nirgends zu sein schien und deren kleinem, aber kampfstarkem Heer sich sogar Kreaturen angeschlossen hatten, die aus der Hölle zu kommen schienen. »Ich habe die größte Angst der Nema in Ketten gelegt und diese Ketten ihrem Fürsten in die Hände gegeben.«
KAPITEL 3
LAIRE
Wie immer, wenn wir in das Gasthaus kamen, tranken Vika und ich zuerst ein dünnes Ale, gingen dann gemeinsam zum Abort und schlüpften auf dem Rückweg durch die Tür mit dem Schild »Kein Zutritt«. Es wäre zu auffällig gewesen, gleich in das Hinterzimmer zu stolzieren, das Desmond für unsere Treffen beim Wirt mietete, mit dem er befreundet war.
Ich hatte stets gedacht, Desmond gut zu kennen, doch inzwischen war mir klar, dass kaum jemand so viele Geheimnisse hütete wie er. Cadyz war vielleicht sein größtes gewesen, mit Sicherheit aber sein schönstes. Seit Desmonds Vater ihn mit einem Fluch belegt hatte, waren die beiden noch vorsichtiger geworden, in jeder nur erdenklichen Hinsicht. Denn es war anzunehmen, dass der Oberste Minister es nicht bei dem einen Mordversuch an seinem eigenen Sohn belassen würde.
Desmond selbst betrat den Raum stets durch den zweiten Zugang, der durch die Privatzimmer der Wirtsfamilie führte, und Cadyz stieg über die Burgmauer, auf der er in seiner Gardetracht unter den Patrouillen nicht auffiel. Vom Wehrgang aus gelangte er übers Dach des Gasthauses zum Fenster.
Man merkte den beiden an, wie geübt sie darin waren, sich zu verstecken; wie selbstverständlich es Teil ihres Alltags war. Vika und mir dagegen pochten noch immer jedes Mal die Herzen.
»Ich hab den Schlüssel«, sagte Cadyz, ließ sich geschmeidig wie eine große Katze neben Desmond auf die Bank gleiten und legte einen faustdicken Klumpen aus bräunlich durchscheinendem Harz vor uns auf den Tisch. »Zumindest einen Abdruck. Und das war schon schwer genug.«
Ich fuhr die Linien des Schlüsselbartes mit der Fingerspitze nach. »Unser Schmied kann einen Schlüssel daraus herstellen. Er wird keine Fragen stellen.« Zumindest hoffte ich, er würde mir inzwischen hinreichend vertrauen. Der Schlüssel, den wir mit diesem Abdruck reproduzieren wollten, öffnete die schmale Eisenluke zu dem Fenstersims, auf dem Alaric an die Wand gekettet war. Ich musste schließlich nah an ihn heran, um die Ketten mit Magie zu lösen. Was uns zu unserem größten Problem führte.
Der Plan stand und fiel mit meiner Magie.
Desmond lehnte sich vor und stützte die Ellbogen auf den Tisch. »Die Minenarbeiter wollen am Tag des Sonnenkusses vor dem Flügel des Obersten Ministers gegen die verschärften Arbeitsbedingungen protestieren. Das ist unsere Chance auf Ablenkung. Die Zeit des Wartens ist vorbei.«
Unweigerlich bildete sich ein Knoten in meinen Eingeweiden. Der Tag des Sonnenkusses war in etwas mehr als einer Woche. Ein paar Tage, die Alaric noch durchhalten musste, Tag und Nacht im Stehen angekettet ohne einen Augenblick der Erholung. Ein paar Tage, in denen das Volk Steine nach ihm warf und manchmal sogar einen Pfeil auf ihn anlegte. Ein paar Tage, dort, wo jeder Atemzug zu viel war? Mir wurde übel.
Ein paar Tage, in denen es mir gelingen musste, meine Magie so gezielt wirken zu können, dass ich damit Schellen zu lösen vermochte, die aus mächtigem Zauber geschmiedet waren. Fesseln, denen selbst Alaric nichts entgegenzusetzen hatte.
Es war zu viel Zeit. Und zu wenig. Ich fühlte mich schrecklich hilflos. Die Verantwortung erschlug mich.
Unter dem Tisch griff Vika nach meiner Hand, und erst unter ihrem leichten Druck spürte ich, wie kalt und schweißnass meine war.
»Ich habe mit meinem Vertrauten gesprochen«, fuhr Cadyz fort. »Es wird uns ein Leichtes sein, die Proteste hochzuschaukeln, sodass es zu Aufständen und Randale kommt. Die Stimmung unter den Arbeitern ist so aufgeheizt, dass ein einziges Wort ausreicht, um den Kessel explodieren zu lassen. Sämtliche Wachen werden dann damit beschäftigt sein, die Aufständischen zurückzudrängen, um zu verhindern, dass die Städter allzu viel mitbekommen. Das Notfallprotokoll sieht vor, die Menschen in verschiedene Richtungen zu treiben. Das braucht viele Gardisten, dadurch gewinnen wir, was wir brauchen, um Laire zu Alaric zu bringen: ein paar unbeobachtete Momente. Und etwas Zeit.«
Desmonds grüne Augen blickten mich an. Doch das eben noch enthusiastische Leuchten darin verlosch, als er erkannte, dass ich nur Angst und Ratlosigkeit zu bieten hatte.
»Laire.« Desmond griff mit beiden Händen über den Tisch und umfasste meine Schultern. »Du darfst jetzt nicht an dir zweifeln. Es hängt an dir, ob wir …«
»Setz sie doch nicht so unter Druck!« Vika sprang auf, ihr Stuhl rutschte knarzend über den Boden, und sie lief aufgebracht ein paar Schritte im Raum auf und ab. »Der ganze Plan ist doch lächerlich. Er hängt immer noch allein an dem Umstand, dass Laire …«, sie senkte die Stimme zu einem Flüstern, »dass Laire dieses Eisen aufbiegt. Mit nichts als ihrem puren Willen.«
»Mit Magie«, korrigierte Cadyz ruhig. »Ich würde meinen, da gäbe es einen kleinen Unterschied.«
In Desmonds Gesicht zuckte ein Muskel. Es beeindruckte ihn sicher nicht weniger als mich, wie gelassen Cadyz damit umging, dass wir sein Weltbild umgeschubst hatten, als wäre es ein Haus aus Elementa-Spielkarten. Noch vor wenigen Wochen hatte er Magie gefürchtet und verabscheut, so wie jeder anständig erzogene Nema.
»Aber was, wenn Laires Magie nicht ausreicht?«, stellte Vika die Frage, die in meinem Kopf hämmerte. »Wenn das, was Alaric gefangen hält, stärker ist als Laire?«
»Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, und diese Furcht wäre genau das. Resignation.« Alles an Cadyz war sanft. Seine Stimme, seine hellbraunen, lockigen Haare und seine ausdrucksstarken Augen, die je nach Lichteinfall grün oder braun aussahen. Trotzdem konnte er sein Gegenüber mit einem einzigen ruhigen Wort tief treffen. Ich hatte ihn früher nie richtig kennengelernt und für oberflächlich gehalten. Inzwischen wusste ich, dass er bloß vermochte, niemandem wirklich aufzufallen. Er war schlau wie sein Schutzberg Ista, und ich widersprach ihm äußerst ungern. Doch in diesem Punkt wusste ich, dass ich recht hatte.
»Diese Furcht zu ignorieren, wäre Dummheit. Ich bin gerade mal dazu in der Lage, einen Draht mit Magie zu verbiegen. Es wäre Wahnsinn, zu glauben, ich könnte in ein paar Tagen eine massive Bannschmiedearbeit von Alarics Körper lösen.«
Desmond stützte die Stirn auf seine Faust. »Und wenn du bis zum Tag des Sonnenkusses noch mehr übst? Eine solche Gelegenheit, die Garde abzulenken, bekommen wir so schnell nicht wieder.«
Ich schüttelte den Kopf. »Magie ist keine Kampftechnik, Desmond. Magie ist wie die Zeit. Sie entsteht aus weiterer Magie. Und wenn sie aufgebraucht ist, ist es vorbei.«
»Dann solltest du dich ab sofort ausruhen«, sagte Cadyz. »Und nicht mehr üben. Sammle so viel Magie, wie du nur kannst.«
Und wenn es nicht reichte?
Ich musste die Frage nicht aussprechen, meine Freunde spürten sie in der Luft um mich herum flirren.
»Du hast bloß Angst«, sagte Desmond. »Ich verstehe das. Jeder hätte Angst.«
Er hatte keine Ahnung. Natürlich hatte ich Angst, aber daran war ich gewöhnt. Ich hatte doch immer Angst, mein ganzes Leben bestand aus Angst und Überwindung, Angst und Überwindung, jeden Morgen, an dem ich die Augen öffnete und Laire war. Laire mit der Magie in ihrem Inneren. Angst und Überwindung.
Aber nun kamen tonnenschwere Schuldgefühle hinzu, nicht nur Alaric und meinen Freunden gegenüber, sondern auch den Minenarbeitern. Die Garde würde den längst überfälligen Protest, den wir als Ablenkungsmanöver nutzen wollten, sicherlich nicht mit freundlichen Worten beenden. Sollte es Festnahmen oder Verletzte geben, war das unsere Schuld. Die Arbeiter konnten am wenigsten dafür. Wer waren wir, dass wir sie genauso ausnutzten, wie der Fürst und der Oberste Minister es taten?
Doch Alaric war in dieser Hinsicht ebenso unschuldig. Er hatte sein Leben und seine Freiheit geopfert, um Nemija vor den Daema zu retten. Nemija, das ihn nun an seine Burgmauern kettete, folterte und verhöhnte.
»Ich fürchte, wir machen einen Fehler«, sagte ich leise.
»Woran denkst du?« Desmond ließ einen lauernden Unterton in seiner Stimme mitklingen. Er wusste die Antwort doch längst. Er kannte mich gut, und im Gegensatz zu Vika hatte er keinerlei Hemmungen, mich das wissen zu lassen. »Und fang nun nicht wieder damit ein, deinem Vater die Wahrheit erzählen zu wollen.«
»Desmond – wenn uns nur jemand glauben würde …«
Krachend schlug Desmond beide Fäuste auf den Tisch, und ich wich erschrocken zurück. »Du wirst kein Wort sagen! Hörst du mich, Laire? Kein – verdammtes – Wort!«
Fast warf ich den Stuhl um, als ich aufsprang und Richtung Tür lief. Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Diese Untätigkeit. Diese Aussichtslosigkeit. Die Weigerung meiner Freunde zu akzeptieren, dass ihr Plan nur scheitern konnte. Und zwar an mir.
Doch bevor ich die Tür erreichte, hatte Desmond mir schon den Weg versperrt und fasste mich an den Schultern. »Laire, bitte. Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken. Es tut mir leid.«
»Lass mich los!« Ich stieß ihn gegen die Brust, versuchte, ihn wegzuschieben, aber er hielt mich fest.
»Laire, er hat recht«, murmelte Vika in meinem Rücken, aber ich wollte das nicht hören und schlug mit den Fäusten auf meinen besten Freund ein, der die Prügel stoisch hinnahm, obwohl er vor Schmerz das Gesicht verzog. Irgendwann wurde es ihm zu viel, und er presste mich einfach nur an sich, sodass ich allenfalls noch hilflos mit den Händen wedeln konnte.
»Beruhige dich«, sagte Desmond, wiederholte es unzählige Male. »Beruhige dich, Laire.«
Aber wie sollte ich? Sie konnten es vielleicht ertragen, was man Alaric antat. Sie konnten sich einreden, er wäre so stark und magisch, dass nichts und niemand ihn zu brechen vermochte. Aber sie irrten sich. Sie irrten sich so sehr. Sie hatten keine Vorstellung, wer Alaric wirklich war. Sie wussten nicht, wie leicht es war, ihm wehzutun. Hatten keine Ahnung, wie viele Schwachstellen er hinter seinen Scherzen versteckte. Dass er nicht einmal eine kleine Daema hatte töten können, obwohl wir alle sie zu dem Zeitpunkt als Bedrohung wahrnahmen. Dass er als Kind sein ganzes Leben zehnmal aufgegeben hatte für die winzig kleine Chance, seine Schwester zu retten. Wann immer ich an ihn dachte, dachte ich auch an sie. An Caleja.
In meiner Vorstellung war sie wie er, eine zarte junge Frau mit schwarzrotem Haar und blauen Augen. Ob sie Spuren ihrer Gefangenschaft am Körper trug? Und wie viel mochte sie von ihrer Seele bewahrt haben?
Ich hatte versagt, Alarics letztes Schuldholz zu brechen. Auch Caleja war immer noch irgendwo, in der Hand von irgendwem – und Alaric musste auch dieses Leid weiter mit sich herumtragen, solange mein Vater ihn festhielt und für Dinge bestrafte, die er nicht zu verantworten hatte.
Als ich nur noch schwer atmete, meine Stirn an Desmonds Schulter, sein Hemd ganz nass von meinen Tränen, schob er mich zurück zum Tisch und drückte mich auf die Bank. Cadyz stellte mir einen Becher hin und schenkte aus einem Tonkrug Wasser ein, an dem ich nur nippen konnte. Mein Inneres war wie zugeschnürt, und mein Körper fühlte sich an, als würde ich hilflos im Wasser treiben, ohne schwimmen zu können.
»Ich muss irgendetwas tun«, flüsterte ich. »Alaric hält das nicht mehr lange aus.«
Desmond nahm meine Hände und suchte meinen Blick, bis ich in der Lage war, ihn zu halten. »Er ist der Lord der Daema. Was, denkst du, kann ihm das da draußen schon anhaben?«
Hätte ich Desmonds Worten doch nur glauben können. Aber ich hatte Alaric gesehen, wie er in seinen Ketten hing und sich kaum noch auf den Füßen halten konnte. Ich kannte die Magie, die er nun in sich trug. Sie gab keine Kraft, sondern kostete welche. »Wie auch immer sie ihn nennen«, erwiderte ich schwach. »Er ist Alaric. Aber wie lange wird er das noch sein?«
»Und genau deshalb darfst du bei allem Schutz, den uns die Berge bieten, auf gar keinen Fall eine Dummheit begehen. Du hilfst Alaric nicht, indem du dich selbst festnehmen und am Ende töten lässt. Doch genau das würde passieren, wenn dein Vater erfährt, was im Reich der Daema wirklich geschehen ist. Du glaubst doch nicht, er würde Gnade mit dir zeigen.«
Cadyz setzte sich wieder neben Desmond. »Des hat recht, Laire. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht versucht, dem Fürsten zu erklären, dass der neue Daemalord alles andere als das Monstrum ist, für den sie ihn halten. Es ist ihm egal. Er kann ihn benutzen, um seine Überlegenheit zu demonstrieren und seine wankende Macht wieder zu stabilisieren. Alles andere interessiert ihn nicht.«
Desmond nickte bitter. »Dein Vater schert sich nicht um die Wahrheit. Ebenso wenig wie meiner. Sie würden Alaric Cole trotz allen Wissens weiter benutzen, solange er ihnen von Nutzen ist.«
Cadyz legte Desmond eine Hand auf die Schulter, und der verkrampfte Zug um seinen Mund lockerte sich ein wenig. Er warf ihm sogar ein winziges, dankbares Lächeln zu.
Seit unserer Rückkehr fragte ich mich immer wieder, wie ich diese gewaltigen Gefühle zwischen ihnen je hatte übersehen können. Selbst wenn sie nur im gleichen Raum waren, flackerte die Luft.
»Euer beider Väter«, sagte Cadyz und blickte von Des zu mir und wieder zurück, »würden alles und jeden benutzen, solange es ihnen von Vorteil ist. Und das Volk von Nemija glaubt ihnen.«
Desmonds Vater hatte Cadyz selbst ins Reich der Daema geschickt, um vor dem Lord Desmonds Freilassung zu verlangen. Dies war zumindest die Wahrheit, die Nemija zu hören bekam. Dass der Oberste Minister selbst es gewesen war, der den Fluch über seinen Sohn gesprochen hatte, wusste niemand außer uns. Und Desmond wollte, dass das so blieb. Denn wer würde uns schon glauben? Festnehmen würden sie uns, sollten wir den Verdacht verlauten lassen.
Alles war ohnehin ganz anders gekommen, als Desmonds Vater es geplant hatte, da die Femarshall Sana Phylles den Lord Rian Cira getötet und damit die Grenzen von Alsjana Daera weit geöffnet hatte, um die Daema auf ihren schrecklichen Rachefeldzug zu schicken. Am Ende hatten wir Nemija und den übrigen Kontinent nur retten können, indem ich einen neuen Lord gekrönt hatte, der die Grenzen wieder errichten konnte. Doch all das durfte diesseits dieser Grenzen niemand erfahren. Es gab viele Regeln und Gesetze in Nemija, aber nichts wurde so erbarmungslos bestraft wie das Wirken von Magie.
Des und Cadyz hatten recht. Man würde uns kein Wort glauben, mich aber mit dem Tod unter Steinen bestrafen, da ich Magie in mir trug. Meine Schuldgefühle wogen längst so schwer, dass ich meinen Tod klaglos hingenommen und akzeptiert hätte, solange er Alaric nur das Geringste genützt hätte.
»Wenn du dich opferst«, sagte Desmond, als hätte er meinen Gedanken gelauscht, »würde das Alaric tatsächlich brechen, Laire. Nimm ihm nicht die Hoffnung. Er glaubt an dich und ist bereit, zu warten, solange es eben dauert.«
Mir kamen die Tränen. »Hat er das gesagt?« Desmond und Cadyz gelang es hin und wieder, ihm ein paar Worte durch die eiserne Klappe zuzurufen, und hin und wieder antwortete er ihnen.
»Er hält durch«, sagte Cadyz ausweichend.
Mein Blick suchte Vikas. Sie war blass geworden, blass und still. Es gefiel mir nicht, sie so furchtsam zu sehen. So war sie nie gewesen, und so sollte sie nicht werden. Vika war das Mädchen mit dem Schwert – die Kriegerin, die geschworen hatte, den Krieg über die Berge zurückzujagen, sollte er jemals zu uns kommen. Jedes Wort Wahrheit, das ich verkünden würde, brächte auch sie in Gefahr. Offiziell war sie nie ins Daemareich gegangen, sondern auf einer Reise nach Lyaskye gewesen, um die Tempel zu besichtigen. Sie hatte behauptet, dort in einen giftigen Strauch gestürzt zu sein, um das feine Narbengeflecht zu erklären, das ihr gesamtes Gesicht, ihren Hals und ihre Hände überzog. Man würde auch ihr weitere Fragen – gefährliche Fragen – stellen, sollte irgendjemand misstrauisch werden. Und kam erst heraus, dass ich, ihre beste Freundin, mich mit Magie eingelassen hatte, würde das mehr als bloß Misstrauen wecken.
»Ihr habt recht. Ich weiß es ja.« Ich hielt mich an dem Becher fest. Winzige Wellen glitten über die Wasseroberfläche, weil meine Hände bebten.
»Die Magie wird zu dir kommen, wenn es nötig ist«, ermutigte mich Cadyz. »Das war in der Burg des Lords doch nicht anders. Sie kam, als du sie brauchtest.«
Ich musste daran denken, was Alaric mir gesagt hatte, nachdem ich alle Zeit aus seinem Zeitmesser verbraucht hatte.
›Zeit entsteht nicht aus dem Nichts. Sie vermehrt sich aus anderer Zeit heraus. Wenn die Zeit einmal aufgebraucht ist, ist es vorbei.‹
Das Leben war der Zeit sehr ähnlich. Die Magie aber womöglich auch.
KAPITEL 4
ALARIC
Von allen Fesseln, allen Ketten, war Unsterblichkeit die schlimmste.
Alles andere hatte irgendwann ein Ende. Aber die Zeit? Seine Zeit? Wie lange mochte er in der Lage sein, die Zeit und ihren Verlauf wahrzunehmen? Und was würde danach geschehen? Den Verstand zu verlieren, klang verlockend. Aber was blieb übrig, wenn der Verstand erst verloren war? Und verloren sich mit dem Verstand auch die Empfindungen, um die es ihm eigentlich ging?
Der körperliche Schmerz war zu vernachlässigen. Von Momenten ihrer Brutalität abgesehen, konnte er ausblenden, dass das Bannschmiedeeisen ihm in die Unterarme schnitt, dass die Kanten seine Haut aufscheuerten und seine Schultern nur noch von Krämpfen zusammengehalten wurden.
Die Sache mit den Schwingen war brachial gewesen, aber auch erleichternd, denn für einen kurzen, gnädigen Moment hatte er gedacht, es würde ihn umbringen. Seitdem … Nun, er hatte erkennen müssen, dass auch das offenbar nicht reichte, um ihn zu töten. Diese Erkenntnis schmerzte womöglich mehr als Alarics Körper.
Noch immer brannte die Sonne in seinen Augen und brachte sie zum Tränen, bis Blut kam, weil sein Körper zu ausgedörrt war. Ebenso beharrlich brannten Gefühle in seinem Inneren, wurden mehr, Tag für Tag für Tag für …
Sie wurden mehr, obgleich doch alles weniger wurde. Die Menschen, die ihm Verwünschungen zubrüllten und ihm ihren Hass oder faustgroße Steine entgegenschleuderten. Die ihn begafften, johlten oder über ihn lachten, wenn er von niedersten Trieben gezwungen Regentropfen von der Steinwand leckte. Doch sie gewöhnten sich an seinen Anblick und würden ihn bald schon vergessen haben, ihn nur noch als einen Teil der Burg betrachten, einen verhassten Beweis ihrer Überlegenheit, der sich hin und wieder unter leisem Ächzen bewegte.
Er hatte angenommen, die Scham würde dem Zorn weichen. Aber der Zorn kam bloß dazu, gesellte sich an die Seite der Scham, wenn es ihm die Beine herablief und zu stinken begann.
Er hatte gedacht, die Angst würde Hass weichen. Aber der Hass schmiegte sich bloß an die Seite der Angst.
Hatte geglaubt, er würde es nicht ewig vermissen, von irgendeinem Menschen mit etwas anderem als Verachtung angesehen zu werden. Von etwas anderem berührt zu werden als langen Stangen und Knüppeln und geworfenen faulen Rüben. Doch die Rachsucht fraß die Sehnsucht nach etwas Trost nicht auf, sondern befeuerte sie nur.
Die Tage und Nächte wurden länger und länger, als verlöre die Magie, die die Sonne über den Himmel zog, ihre Kraft wie ein altersschwaches Zugpferd. Oder wurden bloß seine Gedanken schneller, sodass mehr von ihnen in jeden Moment passten? Er hasste sie, die Gedanken, er wünschte, er könnte sie auslöschen. Die Hoffnung gleich mit. Er wünschte, er könnte die Augen geschlossen lassen und nicht immer wieder über diesen Marktplatz blinzeln für die kurzen Momente, in denen er einen Auftrieb erlebte, weil Laire auf dem Marktplatz stand.
Er konnte die Träume nicht auslöschen. Die, in denen sie ihm ein Lächeln schenkte, das sagte, alles würde gut werden, irgendwann.
Nur dass Laire im wahren Leben niemals lächelte, wenn sie kam.
KAPITEL 5
LAIRE
»Laire. Lass uns heute nicht zum Marktplatz gehen.«
Ich blieb abrupt stehen, und um ein Haar hätte mich ein mit Früchten beladener Karren gerammt, weil die beiden Frauen, die ihn schwitzend über das Kopfsteinpflaster wuchteten, so schnell nicht bremsen konnten.
»Warum nicht?«
Vika trat von einem Bein aufs andere und betrachtete ihre Füße dabei.
»Vika! Was ist passiert?« Nur deshalb war ich doch auch heute wieder den ganzen langen Weg hoch zur Burg gelaufen! Unsere Planungen hätten genauso gut auch außerhalb von es Retneya stattfinden können. Vermutlich wäre das sogar sicherer gewesen. Ich wollte so oft wie nur möglich herkommen, um Alaric zu sehen, auch wenn sein Anblick mich jede Nacht bis in meine Träume verfolgte. Doch das war nichts im Vergleich zu dem, was er durchmachte, und solange ich mir vorstellen konnte, dass mein Kommen ihm nur ein bisschen Trost schenkte, einen Hauch von Hoffnung und eine Erinnerung daran, dass ich ihn nicht vergaß, musste ich herkommen.
»Nichts«, sagte Vika. »Es nimmt dich nur jedes Mal so mit, ihn zu sehen. Was, wenn dein Kummer die Magie hemmt? Was, wenn du nur etwas Ruhe brauchst, sie dir aber einfach nicht gestattest?«
Als hätte ich im Dorf je Ruhe gehabt. Doch ich wollte nicht, dass Vika sich Sorgen machte. Darum erzählte ich ihr nie, wie oft wir noch Probleme mit wildernden Daema hatten.
Ich blickte zum blauen Himmel, der zeigte, dass der Mittag langsam in den Nachmittag verlief. Viel Zeit hatte ich nicht mehr, wenn ich vor Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause sein wollte.
»Junge Damen, junge Damen!« Ein Mann schob sich zwischen Vika und mich. Er war im Begriff, uns die Hände auf den Rücken zu legen, doch als er meinen misstrauischen Blick und Vikas Narben bemerkte, entschied er sich rasch anders. »Ah, die Lady Vika. Und Laire, die künftige Braut. Schön, euch zu sehen. Hungrig seht ihr aus. Darf ich euch meine Pasteten empfehlen?«
»Verschwinde, Cal«, sagte Vika. »Und halt deine diebischen Pfoten bei dir. Zum Taschendieb taugst du noch weniger als zum Koch.«
»Und deine Pasteten sind wirklich sehr schlecht«, unterstützte ich Vika mehr aus Gewohnheit, als dass der Kerl mich ernsthaft geärgert hätte. Er versuchte seit Jahren, uns zu beklauen. Vielleicht war es für ihn zum Spiel geworden, seit er bemerkt hatte, dass wir ihn nie an die Garde verrieten.
Wir gingen weiter, und Cal zog mit seinem Korb voll staubtrockener Pasteten schmollend in die andere Richtung.
»Laire, es gibt da noch etwas, wovon ich dir erzählen möchte. Meine Träume …« Vika brach unschlüssig ab und sprach dann doch weiter, als purzelten ihr die Worte ungewollt aus dem Mund. »Sie haben sich verändert, Laire. Sie fühlen sich nicht mehr an wie Träume, seit wir im Reich der Daema waren.«
Ich sah mich verstohlen um, aber in unserer Nähe waren so viele umhereilende Menschen, um Schillinge streitende Paare, nach Kindern rufende Mütter und laut ihre Waren feilbietende Händler, dass niemand mitbekommen konnte, was wir sprachen. Vermutlich hätte Geflüster eher ihre Neugierde geweckt. Daher gab ich in ganz normaler Lautstärke zurück: »Was meinst du damit?« Beinah wäre mir herausgerutscht, dass es uns schon einmal fast das Leben gekostet hätte, als sie nicht bereit gewesen war, sich mir anzuvertrauen. Aber das war nun nicht mehr zu ändern, und sie machte sich deswegen schon genug Vorwürfe.
»In meinen Träumen sehe ich nichts, nur Dunkelheit. Aber ich habe das zeitlose Gefühl, das ich im Reich der Daema hatte.« Sie berührte ihre Wange. »Meine Haut prickelt, als würde das, was mich entstellt hat, noch in mir arbeiten. Und dann ist da diese Stimme. Eine Männerstimme.« Ein Hauch von Röte flog über Vikas Wangen. »Er verspottet mich, dieser Fremde, aber ich werde im Traum nicht wütend. Erst später, wenn ich wach bin.«
»Kannst du dich erinnern, was er sagt?«
»An jedes Wort. Das unterscheidet diese Träume von allen, die ich jemals hatte. Er gibt mir die Schuld an seinem Tod. Und er nennt mich Narbenprinzessin.«
Was gerade noch weniger ein Verdacht als eine flüchtige Intuition war, fand in diesem Wort seine Bestätigung. Ich biss mir auf die Unterlippe. Was mochte es bedeuten, dass …
»Du weißt, von wem ich träume, nicht wahr?«, fragte Vika, der vermutlich keine Regung meiner Miene entgangen war.
Aus irgendeinem Grund musste ich lächeln. »Ich habe dieses Wort nur einmal gehört. Von einem Mann, dessen Spott mich bis ins Mark verängstigt, aber ebenfalls nicht wütend gemacht hat. Rian Cira hat es gesagt. Der letzte Daemalord, ganz kurz vor seinem Tod. Und ja, er meinte dich damit.«
»Was bedeutet das?« War mir Vika eben noch verwirrt und ängstlich erschienen, überwog nun wieder der alte Teil von ihr – der starke Teil. Sie ballte die Fäuste, ihr Blick wurde angriffslustig. »Was hat der tote Daemalord in meinen Träumen zu suchen? Wie kommt er dorthin? Und was will er?«
Ich zog sie durch ein aus großen Steinbrocken gemauertes bogenförmiges Tor in einen Hofeingang, wo wir allein waren. Die Geräusche der Stadt wurden leiser, dafür schnatterten uns Gänse hinter einem Zaun an. Auf einem Misthaufen brummten und summten die Insekten.
»Ich habe keine Ahnung. Nur eine Idee, warum er mit dir kommunizieren kann.«

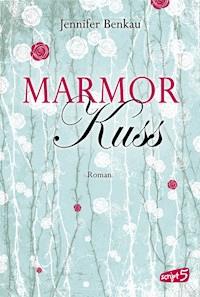









![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)

![Die Seelenpferde von Ventusia. Sturmmädchen [Band 3 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5301e0aef492f4b62003660f83fe52a5/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)


![Die Seelenpferde von Ventusia. Himmelskind [Band 4 (ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/087e99c10449973fcfa015c2c26ac9e5/w200_u90.jpg)











