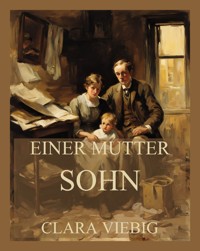Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Deutschland steht mitten im Ersten Weltkrieg. Alle Menschen, alle Familien sind betroffen. Die Bertholdis, die in einem der schönen Vororte im Westen Berlins leben, beobachten voller Mitgefühl die Menschen in ihrer Umgebung, die bereits Opfer an der Front zu betrauern haben. An ihnen und den Schwiegertöchtern ihrer beiden Söhne Rudolf und Heinz ist dieser Kelch bisher vorbeigegangen. Bis Vater Bertholdi eines Tages eine Depesche aus Frankreich erreicht: Sohn Rudolf ist bei Reims gefallen. Wie gehen die Eltern Bertholdi damit um, und wie Annemarie, die jetzt jung zur Witwe geworden ist? Und was ist mit Heinz, der als erfolgreicher Flieger im Feld steht? Es ist eine Zeit großer Herausforderungen und Entbehrungen, die einem Höhepunkt zuzustreben scheint, als im November 1918 ein Meer roter Fahnen Berlin zu überflutet. Einfühlsam beschreibt die Autorin diese insbesondere für die Frauen zu Hause unsagbar schwierige Zeit.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Das rote Meer
Roman
Saga
I
Den Sommermittag, den Akazien- und Lindenduft süss umschmeichelt, durchgellt ein Misston. Woher kommt er?
Die Leute, die über die Strasse des Vororts im Westen von Berlin gingen, merkten auf. Sie blieben stehen, drehten sich nach rechts, nach links, streckten den Kopf vor und horchten. Man war schon an vieles gewöhnt: an das auf dem Bahnstrang ewig-gleiche Dahinrasseln der Züge, die dem Krieg immer neuen Frass in den Rachen schütten — an das unheimliche Heulen der Feuerwehrsirene, die das Eintreffen der Verwundetentransporte ankündet — an die dumpfen Klänge einer Musik, die an immer neuen Gräbern zum Poltern der Schollen aufspielt — einen Laut wie diesen hatte man nicht vernommen. Was war das? Man erschrak. Man war schreckhaft geworden im dritten Kriegsjahr. Klang es nicht wie ein Hilferuf, wie eine Mark und Bein durchschrillende Klage? Ein Schrei ohne Worte; ein Jammer, aber nicht aus Menschenmund. So brüllt auch kein Tier auf unterm Beil des Schlächters. Es war etwas Übernatürliches, Furchtbares. Ein Schauer überlief die Hörer. Und alle hörten; nicht nur in den Strassen des Vororts, in den grünumbuschten Villen und Gärten, die Sommerluft nahm den Schrei auf ihre Flügel und trug ihn weit hinaus über Äcker und Felder, trug ihn durchs ganze Land.
Unwillkürlich hob Frau Hedwig Bertholdi, die am Tor ihres Villengartens stand, den Blick zum unbewölkten Himmel: ging ein Riss durch sein festes Blau, ballten sich finstere Wolken zusammen? Ihr war seltsam bang. Aber klar leuchtete oben das ruhige Blau, und die Erde prangte freundlich in Gartengrün. Rosen blühten, es war ein schöner Tag.
Sie wischte sich die Stirn; die Luft dünkte sie plötzlich schwer. Spähend sah sie nach dem kleinen weissen Wagen aus, in dem die Wärterin das Kindchen ihres Sohnes Rudolf ausgefahren hatte.
Ihre Nachbarin, die Witwe Krüger, kam vorbei. Hedwig hatte die Frau lange nicht gesehen; sie erschrak: war die alt geworden. Das Gesicht der Krüger, das früher breit gewesen war, schien ihr heute ganz schmal gehutzelt, von hundert Falten zusammen-geschnurrt. Die alte Frau führte einen kleinen Knaben an der Hand. Das war wohl das Kind ihres Sohnes, des Gustav Krüger, der schon seit Herbst vierzehn vermisst wurde? Ob die Mutter wohl immer noch auf Nachricht von ihm wartete?
Hedwig gab der Nachbarin die Hand. „Wie geht es Ihnen, Frau Krüger? Ist das der Kleine?“
Die Grossmutter strahlte auf: „Nu hab ich’n ganz. Die Hieselhahn“ — sie verbesserte sich rasch — „die Mutter von dem Kind is jetzt bei der Kriegswirtschaftsstelle in Berlin — annehmen tut se ja nischt von mir für sich selber —, da hat se zu wenig Zeit für das Jungchen. Zweimal die Woche kommt se abends raus, und denn den ganzen Sonntag. Aber er is gerne bei Grossmuttern, nich wahr?“ Sie bückte sich tief zu dem Kinde hinunter.
„Wie heisst du?“ Frau Bertholdi strich dem Kleinen über das glänzend blonde Haar.
Die dunkel bewimperten grossen grauen Augen sahen sie furchtlos an. „Jungchen.“
„Nur Jungchen?“ Hedwig musste lächeln.
„Er hat die Augen von meinem Gustav, die schönen grossen Augen. Da haben mich die Leute immer früher drauf angeredt, als ich ’n noch auf’m Arm trug. Und Gustav heisst er auch, wie sein Vater. Ich ruf ’n aber nur ‚Jungchen‘. Weil ich so viel mit meinem Gustav rede, weiss er ja sonst nich, wen ich meine: Vatern oder ihn.“
Die Krüger mochte ein gewisses Befremden in dem Gesicht der andern lesen, sie setzte rasch hinzu: „Verrückt bin ich nich, das brauchen Se nich zu denken, gnädige Frau, wenn’s die Leute vielleicht auch sagen. Ich hab noch alle meine Fünfe zusammen. Aber ich kann nich mehr leben, ohne mit Gustaven zu reden. Ich weiss ja nu, dass er nich mehr lebt. Die Hieselhahn“ — sie verbesserte wieder — „die Trude, die hat mir zuliebe keine Ruhe gegeben, nach Graudenz is se gefahren, wo sein Stammregiment stand.“
„Haben Sie denn da etwas Bestimmtes erfahren?“
Die Krüger nickte: „Se hat da einen getroffen, der ausgerückt war aus der russischen Gefangenschaft, ’nen Kamerad vom Gustav. Der is dabeigewesen, wie ’ne Granate meinem Gustav den Leib aufgerissen hat — seinen armen Leib! ‚Lebt wohl‘, hat er noch gerufen. Dann war’s aus. Bei Lodz ’rum. Ach, er war ja gar nich bei Dixmuiden, gar nich in Frankreich, wie ich immer gemeint hab; da hab ich ihn all die Zeit vergebens gesucht.“ Ein wehmütiges Lächeln ging über ihr verfurchtes Gesicht. „Wissen Se noch, Frau Bertholdi, wie ich mit dem Bild aus der Zeitung zu Ihnen gerannt kam, Sommer vor zwei Jahren? ‚Deutsche Gefangene auf Korsika‘ — da meint’ ich sicher, er wär’ drunter. Und er war in Russland, in dem grossen kalten Russland! Mich friert, wenn ich dran denke.“
Erregt zog sie das wollene Tuch, das sie um die hageren Schultern trug, dichter um sich. Dann aber fasste sie das Händchen des Kindes fester und sagte gelassen: „Nu friert er nich mehr. Se haben ihn da begraben; ’n Grab für sich allein, ’n Kreuz ha’m se draufgesetzt, aus Birkenstämmchen, wie se’s so machen in Russland. ‚Gustav Krüger‘ schön eingeschnitzt, und den Datum vom Tag. Der Kamerad hat’s ganz genau alles beschrieben. Die Hieselhahn hat ihm gegeben, was se bei sich hatte, der arme Mensch hatte ja keinen Pfennig. Se hat ihn gehörig ausgefragt. Also erst, wenn man rauskommt bei dem Dorf — se hat sich den Namen aufgeschrieben — denn kommt Heide, lauter ödes Land, ’n paar Kiefernstumpen drauf und kleene Birken und Gräben, lauter Gräben und tiefe Kulen von all dem Schiessen. Da geht man immer gradeaus. Denn kommt ’n grosser Sumpf, und denn biegt man rechts ab, wo Wald anfängt. Da steht ’n Heiligenbild in ’nem gemauerten Häuschen. An dem Kreuz hängt Christus; das Häuschen is halb zerschossen, eigentlich nur noch ’n paar Steine, aber das Kreuz steht hoch in den Himmel, und der Christus hängt dran noch ganz unversehrt. Und dahinter is so ’ne Art Buchte, hinter Buschwerk ’n bisschen geschützt, da haben se ’n begraben. Da werd ich ihn finden, wenn ich ihn suche. Wir fahren hin.“
„Hinfahren?!“
Die Krüger nickte.
Dachte die Frau im Ernst daran, nach solch unbestimmter Beschreibung das Grab zu finden? Hedwig schüttelte den Kopf: unmöglich. Ein so winziges Grab in einer so ungeheueren Weite; in einer Wildnis von Baumstümpfen und Moor. Und sicher war jetzt dort schon alles anders, der Krieg wandelt das Antlitz der Erde ja rascher um in Augenblicken, wie Jahre das Gesicht des Menschen. „Sie können nicht hin, das geht nicht!“
„O doch!“ Die Frau blieb hartnäckig.
„Sie denken sich das leichter.“
„Ich denke mir gar nischt.“ Die Krüger reckte sich, es kam etwas von der früheren Strammheit in ihre Gestalt. „Wir fahren. Wir haben schon ’ne Eingabe gemacht. Die Frau General von Voigt nimmt sich unser an; der ihr Mann steht im Osten, nach dem fragen wir. Dann gibt der uns einen mit, und der führt uns.“
Hedwig sagte kein Wort mehr; das klang alles so bestimmt, so selbstverständlich.
Die Krüger sprach weiter, es schien ihr ein Bedürfnis, davon zu reden. „Im Herbst kriegt die Hieselhahn vierzehn Tage Urlaub, denn fahren wir.“ Sie blickte fast spöttisch in das besorgte Gesicht der anderen: „Wir sind ja nich so verwöhnt. Was man muss, das kann man auch; besonders jetzt. Wenn Sie wüssten, wie ich mich drauf freue, denn würden Sie vielleicht denken: die Krüger is doch verrückt.“ Sie lächelte und trat Frau Bertholdi leise, fast heimlich sprechend, näher: „Wenn ich früher was hatte, was mich quälte — solange man lebt, hat man ja nu mal Unruh und Verdruss — denn ging ich abends immer an Gustaven sein Bett. Denn guckte ich mir den Jungen an, wie er so ruhig schlief, und denn wurd ich auch ruhig. Nu geh ich wieder an sein Bett und streich mit der Hand drüber hin, und denn bin ich auch ruhig, ganz ruhig.“
Frau Bertholdi fuhr zusammen. Es dröhnte plötzlich wieder durch die Luft. Wieder wie vorhin. Was war das für ein seltsamer, unerklärlicher Klang? „Was mag das nur sein?“
„Weiss nich.“ Interesselos zuckte die Krüger die Achseln.
Da bog ein Arbeiter in die Strasse ein. Er lachte. „Haben Se’s gehört? Die wehrt sich!“
Das Lachen erschien ihr roh, und doch fragte Hedwig: „Wer denn?“
„Na, die grosse Glocke. Injeschmolzen soll se werden; Munition draus gemacht. Hat sich mächtig jewehrt, die Olle. Einmal hatten wir ihr schon eins versetzt, da ging se noch nich kaputt. Jetzt is se aber in Stücke. Wir kriegen se ja sonst nich runter aus’n Turm. Eigentlich schade drum.“ Der Mann wurde ernsthaft, er sagte verbissen: „Sie sollten mal lieber all die Standbilder von die Herrscher und die Militärs kaputtschlagen, die wären jrade jut vor’t Inschmelzen. Die taugen doch sonst zu nischt.“
Der Arbeiter war längst vorüber, auch die Krüger mit ihrem Enkelkind weitergegangen, Frau Bertholdi stand noch immer an der Gartenpforte. Starr hing ihr Blick an dem Kirchturm, der schlank und spitz zwischen den dichten Wipfeln der Bäume durchlugte. Also daher der erschreckende Ton! War es schon so weit gekommen, dass man die Glocken einschmelzen musste? In der Zeitung war diese Idee einmal erörtert worden, aber nur als eine allzuweit vorausdenkende und gänzlich unnötige Vorsicht. Und wozu auch? Sie läuteten ja so viele Siege. Der Friede konnte nicht mehr fern sein. Was die Feinde in diesem Winter nicht hatten annehmen wollen, das Angebot des Friedens, das würde man ihnen, vielleicht in diesem Herbst noch, aufzwingen.
Und doch fühlte Hedwig ihr Herz seltsam erbeben. Das schöne alte Kupfergerät, von Mutter und Grossmutter ererbt, hatte man gern hergegeben — mochten sie auch die Kupferdächer der Stadt abdecken — aber die Glocken, die Glocken! Sollten sie denn nicht mehr Siege einläuten, mit erzenen Stimmen von der Erde hinauf zum Himmel rufen?! Es durchschauerte die Frau. Gab es denn nichts, gar nichts mehr, was diesem Kriege heilig war?
Es fehlten nur wenige Wochen noch bis zu dem Tage, an dem vor drei Jahren die beiden Bertholdi schen Söhne hinausgeeilt waren. Noch lebten sie — aber wenn der Krieg noch länger dauerte?!
Immer furchtbarer wurde er. Die französische Offensive an der Aisne, in der Champagne war gescheitert, bei Arras hatten die Engländer ungeheure Verluste erlitten, deutsche Luftangriffe bedrohten das Inselreich, viele, viele tausend Tonnen Schiffsraum versenkte der uneingeschränkte U-Bootkrieg, und doch — woher kam es, dass die Gemüter sich noch immer nicht wieder neu belebten?! Man las, wie niedergeschlagen die Stimmung der Franzosen sei — sie hatten ja auch alle Ursache dazu —, aber warum hing der Deutsche den Kopf? Russland war doch nicht mehr zu fürchten, es hatte jetzt mit sich selber zu tun; und noch war kein Fussbreit besetzten Landes irgendwo wieder verlorengegangen.
Geduld! Hoffnung! Mut! Zuversicht! Die Frau lehnte sich gegen das Gartengitter. Nicht um die Söhne zitterte heut ihr Herz, kleinmütiges Bangen, angstvolle Ungeduld verlernte sich nach und nach. Wenn die Briefe ausblieben, nun, dann wartete man, bis sie kamen. Und kamen sie noch immer nicht, dann wartete man wieder. Wartete weiter und immer weiter. Tage gingen hin, Wochen, Monate, für die Ungeduld krochen sie langsam, der Ergebung vergingen sie schneller. Aber die Glocken, die Glocken! Ein kaltes Grauen fröstelte plötzlich durch den warmen Tag. Im Hellen Licht der freundlichen Strasse stand etwas wie ein Gespenst.
Gewaltsam schüttelte Hedwig Bertholdi schwere Gedanken ab: was nicht der Klageruf der sterbenden Glocke alles heraufbeschworen hatte! Sie atmete auf: ah, da kam endlich der kleine weisse Wagen mit dem kleinen weissen Kind.
Unter den duftigen Vorhängen schlief Rudolf Bertholdis Knabe. Als die Grossmutter sich jetzt über den Wagen neigte, noch anmutig, jugendlich schlank, hätte man sie für die Mutter halten können. Ein zärtliches Lächeln machte sie noch jugendlicher; aber nun verlor es sich plötzlich: sie sah zum ersten Male, wie sehr das Kind seiner Mutter glich.
Annemarie von Lossberg war nun schon zwei Jahre Rudolf Bertholdis Frau, aber die Mutter hatte sich mit der übereilten Heirat des Sohnes, mit seiner stürmischen Kriegstrauung noch immer nicht ganz aussöhnen können. Und Herr Bertholdi, der sich dem Reiz des schönen Mädchens nicht verschlossen hatte, war nicht mehr derselbe. Mit einer gewissen Verbitterung war er heimgekommen; sein Rheumatismus hatte sich zu stark gemeldet, im Felde hatte er nicht bleiben können. „Bloss Etappenschwein — nein, dafür danke ich!“ Leicht gereizt, missverstand er jetzt oft Annemaries sorgloses Wesen: machte sich die Schwiegertochter denn gar keine Gedanken, was einmal werden konnte? Hedwig zwang sich dazu, zu begütigen: „Lass sie doch lachen.“ Sie war so jung, so leichtblütig und lebenshungrig, man konnte von ihr nicht den Ernst verlangen, den die Jetztzeit erforderte. Wenn Annemarie Rudolf nur so liebte, wie die Mutter den Sohn geliebt wissen wollte.
Die beiden waren wie die Kinder miteinander; sie lachten, sie tollten, sie genossen in vollen Zügen. Merkwürdig, dass einer, der von draussen kam, so schnell alles vergessen konnte! Die Bilder des Grauens, das ewige Sterbensehen, die eigene stete Todesgefahr. Rudolf Bertholdi war unersättlich im Vergnügen, die jungen Leute waren gar nicht zu sich selber gekommen während des letzten Urlaubs. Täglich fuhren sie nach Berlin.
Der Urlaub fiel in den Vorfrühling, noch spielten alle Theater, überall Konzerte; Cafés und Kinos glänzten in Lichtfülle und wurden gestürmt. Hätte man nicht gewusst, es ist Krieg, man hätte daran gezweifelt in jenen Stunden vor Dunkelwerden, in denen eine schaulustige Menge durch die Strassen wogte. Die Damen elegant, in seidenen Kleidern, auf hohen Absätzen trippelnd. Noch Männer genug, die nicht in Feldgrau waren. Die Schaufenster noch voll von bunten Sammeten und Seiden und hauchfeinen Schleiergeweben, von Hüten neuester Mode und kostbaren Blumen. In den Dielen und den grossen Hotels zum Fünfuhrtee noch prickelnde Rhythmen; überall schnellpulsierendes Leben. Das Antlitz der grossen Stadt zeigte in diesen Stunden nicht die Schrunden und Risse, die ihm der bittere Ernst dreier Kriegsjahre eingegraben hatte. Und doch, wer näher zusah, entdeckte sie. All das war nicht das freie, frohe Treiben einer unbekümmerten Grossstadt mehr, das war ein ängstliches Sich-Anklammern an Vergangenes. Ein Kampf um Verlorenes. Ein aufgeregtes Die-Zeit-Hinbringen.
Rudolf Bertholdi zweifelte keinen Augenblick daran, dass der Sieg auf deutscher Seite sein würde. „Wir draussen könnten es sonst wahrhaftig nicht mehr aushalten.“ Er war dazu ausersehen, immer gerade da zu sein, wo es am gefährdetsten stand. Seit einem Jahr war er Leutnant; er hatte es nun in vielem besser als damals, da er als gemeiner Kriegsfreiwilliger auszog; dafür lastete jetzt um so mehr Verantwortlichkeit auf ihm. Ob er sie leicht, ob er sie schwer nahm?
Die Eltern wussten nicht viel von ihm, er sprach selten von draussen. Einen einzigen Abend nur von den drei Wochen des Urlaubs war er allein bei den Eltern gewesen. Seine junge Frau war müde von allem Vergnügen, sie war früh zu Bett gegangen, nun sass der Sohn zwischen den Eltern, und die Mutter hielt seine Hand leicht gefasst. Sie war glücklich, dass sie ihren Jüngsten nun einmal für sich hatte. Sie sah ihn an wie eine Liebende: hübsch war er geworden und kräftig und männlich. War das wirklich noch der einst so zarte Knabe mit der überempfindsamen Seele, der weinte, wenn man von Kindern sprach, die keine Mutter mehr hatten, der sich schluchzend an ihr Kleid klammerte, als er zum ersten Male in die Schule musste, der sich vor jedem Hund fürchtete? Zärtlich streichelte sie seine Hand. Sie hätte bitten mögen: erzähle! Erzähle, wie es gekommen ist, dass du so geworden bist, wie du jetzt bist! Aber ihre Liebe hielt sie zurück: warum an vielleicht Schreckliches erinnere, ihn in diesen frohen Tagen stören?
„Was wohl wird, wenn der Krieg mal zu Ende ist?“ sagte Rudolf plötzlich. „Ich“ — er sagte es stockend — „ich habe Angst davor.“
Stieg eine Ahnung in ihm auf, dass ein Urlaub von drei Wochen nichts anderes ist als ein einziger hingetaumelter Festtag? Und dass von diesem Taumel nichts bleibt, wenn erst die staubigen Alltagswochen eines Lebens wiederkommen, in das man sich eingewöhnen muss wie in etwas Fremdgewordenes. Aber Angst, warum Angst? Rudolf brauchte doch keine Angst zu haben? Er liebte, wurde wiedergeliebt, wenn er zurückkehrte, kam er in die gleichen wohlgeordneten Verhältnisse des Elternhauses, er hatte bei seiner Jugend noch nicht allzuviel versäumt, er konnte jeden Beruf ergreifen, zu dem er Lust hatte. Die Eltern waren förmlich bestürzt: Rudolf war nervös, er brauchte doch wahrlich nicht Angst zu haben.
„Es ist schauderhaft,“ fuhr der junge Mann wie zu sich selber sprechend fort, „für so kurz draussen abzubauen und drinnen aufzubauen. Kaum hat man sich ein bisschen gefunden, muss man drinnen schon wieder abbauen und draussen wieder aufbauen. Man bekommt etwas so Unruhiges davon. Das beste wäre, man käme überhaupt nicht auf Urlaub. Du wirst mich vielleicht verstehen, Mutter!“ Er sah ihr besorgtes Gesicht. „Man wird der Heimat fremd, und die Heimat wird einem fremd; es macht Mühe, sich zurückzufinden, auch in die Allerliebsten.“
„Lass das nur deine Frau nicht hören,“ sagte der Vater, „das könnte sie mit Recht übelnehmen.“
Der Sohn versuchte ein Lächeln; er sah plötzlich abgespannt aus. „Ach, Annemarie denkt da nicht weiter viel drüber nach.“
An dieses Gespräch hatte Hedwig oft denken müssen. Dämmerte bereits eine Ahnung in ihrem Rudolf, dass die junge Frau, die er hatte, doch nicht die Frau seines Lebens war? „Gebe Gott, dass er glücklich bleibt!“ Es war der Mutter heimliches Gebet.
II
Annemarie Bertholdi, geborene von Lossberg, stand in ihrem Ankleidezimmer. Sie liess sich ein neues Kleid anprobieren. Man sah es, sie hatte geweint. Am Morgen war ein Brief von Rudolf gekommen. Es musste schrecklich sein am Winterberg. Wenn er so kurz schrieb, so kurz und ernst, dann stand ihm immer Schweres bevor.
Die junge Frau hatte sich die Kriegskarte geholt. Anfangs hatte sie da immer kleine Fähnchen gesteckt — das Vorrücken ging so rasch, man musste die fast jeden Tag ein bisschen weiter herausstecken — nun aber blieben sie schon eine lange Weile immer auf derselben Linie. Die Franzosen waren hartnäckig. Ach, ihr armer Rudolf! Annemarie waren die Tränen gekommen. Nun aber blickte ihr Auge voller Interesse auf die Hände des Fräuleins, das vor ihr am Boden kniete und von unten herauf den Saum des duftigen Kleides anblinzelte.
„Wird es mich auch nicht zu stark machen, wenn der Rock noch kürzer ist? Ich möchte ihn ja gern so kurz haben, es ist viel moderner, aber —!“ Die hübsche Frau blickte bedenklich. Seit des Knaben Geburt drohte sie etwas sehr üppig zu werden. Dick, das war ihr ein angstvoller Gedanke.
„Gnädige Frau haben eine prachtvolle Figur,“ versicherte das Fräulein, nahm Nadel um Nadel von dem Kissen, das, gestachelt wie ein Igel, neben ihr am Boden lag, und steckte den Saum noch kürzer um. „Und gnädige Frau haben ein hübsches Füsschen — und dann das elegante Schuhwerk!“ Bewunderung und Neid waren in dem Blick, mit dem die blasse Person das tadellose Schuhwerk der Dame musterte. Sie erhob sich und stand mit verriesterten Schuhen auf schiefgelaufenen Absätzen. „Es ist schrecklich; wenn man auch einen Bezugsschein hat, Schuhe kriegt man darum doch nicht. Und man braucht doch welche. Man zerreisst so viel bei dem ewigen Rumstehen und Laufen.“
Die junge Frau lächelte zerstreut, sie musterte sich im Spiegel; dann vertiefte sie sich mit der Schneiderin in die Vorzüge und Nachteile des kurzen Rocks. —
Annemarie hatte Freude an schönen Kleidern, gerade weil sie als arme Offizierstochter früher immer hatte plundrig gehen müssen. Ihre Fähnchen durften nicht viel kosten. Die Brüder hatten es besser gehabt, die kamen in des Königs Rock, der sah immer nach was aus. Es war jetzt für die junge Frau Bertholdi das grösste Vergnügen, von Laden zu Laden zu ziehen und Sammete und Seiden zu durchmustern. Erstaunlich, was für schöne Stoffe noch vorhanden waren, freilich kosteten sie ein Vermögen. Wollstoffe waren kaum noch aufzutreiben; das war weiter nicht schlimm, dann trug man eben Seide.
Ein Glück für Annemarie, dass heute diese Zerstreuung gekommen war. Der ernste kurze Brief ihres Mannes hatte sie schon verstimmt, ein Brief ihrer Mutter hatte ein übriges getan. Deren Briefe waren immer wenig erfreulich.
Frau Oberst von Lossberg hatte nicht die Absicht, der Tochter zu klagen — sie klagte auch nie über die drückend engen Verhältnisse, in denen sie nach dem Tode ihres Mannes, des Obersten, in dem kleinen Städtchen an der Lahn lebte, — aber sie konnte die Herzensangst nicht verbergen, unter der sie jetzt ständig litt. Nicht den beiden Jüngsten, die bei Annemaries Hochzeit noch Kadetten gewesen, jetzt auch schon an der Front waren, galt diese Angst. Es war ihr selbstverständlich, dass die beiden Jungen bei der langen Dauer des Krieges auch noch drankamen. Frau von Lossbergs Klagen galten dem ältesten Sohne, dem ‚schönen‘ Lossberg, wie er im Regiment hiess. Von seinem Krankenlager in Sofia hatte sich der Leutnant ein Anhängsel mitgebracht, das die Mutter in Kummer und Empörung versetzte: eine Abenteurerin, eine ganz unmögliche Person! Die Krankenschwester, die den Typhuskranken dort gepflegt hatte, war ihm gefolgt; zuerst in die Heimat, wo er sie in seiner Nähe unterbrachte, dann an die flandrische Front. Sie pflegte da in einem Feldlazarett, sie sollte sogar eine ausgezeichnete Pflegerin sein, für Frau von Lossberg blieb sie die Abenteurerin. Dass ein Offizier, ein Lossberg, sich mit solchem Weib kompromittierte! Dann noch lieber Schulden. Diese Person war aus einer Sphäre, die sie an und für sich schon unmöglich machte. Eine Rabbinerstochter aus dem Posenschen. Jochen würde doch um Gottes willen nicht auf den Gedanken kommen, sie zu heiraten?!
Die beiden jüngeren Brüder waren auch empört. Zufällig waren sie vor einiger Zeit in die Nähe des Älteren gekommen; sie fragten sich durch zu ihm, glücklich, ihn zu überraschen. Sie fanden ihn in einem halbzerschossenen Hause, das als Kasino eingerichtet war, in einem Kreis von Offizieren und mit — jener Person. Die sass in ihrer Tracht — schwarzes Kopftuch, weisser Streifen mit rot eingestickten Kreuzen, blauweisses Leinenkleid, weisse, im Rücken gekreuzte Schürze — auf einem Tisch und baumelte mit den Beinen. Die Herren standen lachend um sie herum, sie gab gerade ein paar Schwänke aus ihrem Leben zum besten.
Im heutigen Brief flehte Frau von Lossberg die Tochter an: vielleicht war es ihr, der Schwester, die der ältere Bruder immer sehr geliebt hatte, möglich, ihn von dieser Person abzubringen? ‚Wenn der Vater das wüsste! Er bringt Schimpf und Schande über unsere Familie.‘
Zu dumm von Jochen, der Mutter die ganze Geschichte auf die Nase zu binden! Die junge Frau wurde rot vor Ärger. Erzählt hatte er’s geradeheraus, gelacht, als er das Entsetzen der Mutter sah: was war denn da Schlimmes, man hatte sich lieb, jetzt war Krieg, das Weitere würde sich schon finden. Schneid hatte der Jochen, das musste man ihm lassen, und dass er ein bisschen leichtsinnig war — lieber Gott! Annemarie legte den hübschen Kopf auf die Seite: war das denn so schlimm? Sie sah mit blinzelnden Augen hinaus in den heissen Garten und träumte. Dann gähnte sie. Es war hart, sehr hart, so allein zu sein. Herr Gott, wie langweilig!
Es gab für Annemarie nichts im Hause zu tun. Noch immer waren die gleichen Dienstboten da. Selbst das Hausmädchen, die Emilie, hatte die Schwiegermutter behalten. Emiliens Bräutigam war im Krieg, ihr Kind hatte sie in Pflege gegeben, erst wenn Friede war, würde sie heiraten. Den kleinen Rudi versorgte die Wärterin. Die junge Frau gähnte wieder: ach, wie langweilig! Sie hätte lieber ihr Hauswesen für sich allein gehabt, aber davon wollte Rudolf nichts wissen. Gut aufgehoben war sie ja hier. Sie hatte sich nur längst an all das, was sie als Mädchen, aus bescheidenen Verhältnissen kommend, bejubelt hatte, gewöhnt. Ihre Freundin Lili hatte es viel angenehmer, die war gänzlich ihr eigener Herr. Die war ja auch schon Witwe, hatte mit ihren fünfundzwanzig Jahren bereits etwas hinter sich. Lili hatte ein paar Jahre in Italien gelebt, als Frau des italienischen Leutnants Rossi, und war dann, seit der im ersten Kriegsjahr bei den Kämpfen in Tirol gefallen war, hierher zurückgekommen. Ihre Mutter, die Generalin von Voigt, redete ihr in nichts hinein.
Annemarie runzelte die Stirn: redete man denn ihr in etwas hinein? Selbst wenn sie sich auf ihren Besorgungswegen in der Stadt verspätet hatte und nicht zur Zeit zum Essen da war, verlor der Schwiegervater kein Wort, er, der selber von einer unheimlichen Pünktlichkeit war, besonders bei den Mahlzeiten. Auch die Schwiegermutter sagte nichts weiter, als: „Aber nun iss auch, mein Kind. Wir möchten auch gern bald aufstehen.“ Nun, mochten sie doch aufstehen! Es schmeckte Annemarie genau so vorzüglich, wenn sie allein am Tische sass.
Es ärgerte Annemarie, dass die Schwiegermutter so wenig Interesse für ihre Besorgungen, für schöne Kleider mehr zeigte. Früher war die ganz anders gewesen, eine so elegante Frau! Auch bei Lili Rossi fand Annemarie nicht den gehofften Widerhall. Trotzdem hatten sich die beiden jungen Frauen befreundet. Das war so gegeben, sie würden ja über kurz oder lang Schwägerinnen werden.
Lili von Voigt trug keine Trauerkleider mehr um ihren Mann, den Leutnant Rossi. Wenn sie in ihrem lichten Sommerkleid durch die Gartenstrassen ging, leichten Fusses, ohne Hut, Gesicht und Nacken unbekümmert der deutschen Sonne preisgebend, erkannte man in ihr die Frau nicht mehr, die im Frühjahr fünfzehn heimgekehrt war wie eine Flüchtende. Die dann bald in Trauerkleidern schlich. Jetzt ging sie nicht mehr gesenkten Kopfes, auf stolzem Nacken trug sie ihn aufrecht. Lili von Voigt hatte ganz vergessen, dass sie durch ihre Heirat eigentlich Italienerin war; nur dass sie sich als Ausländerin wöchentlich auf dem Amt melden musste, erinnerte sie schmerzlich daran. Doch auch das wurde ihr bald erlassen. Sie fühlte sich wieder ganz als Deutsche; eine ungeheuere Genugtuung erfüllte sie über Deutschlands Siege und — über Heinz Bertholdi. „Ich bin stolz auf ihn,“ sagte sie ihrer Mutter, „so stolz!“ —
Frau von Voigt hatte nicht an das Herzensgeheimnis der Tochter gerührt, ganz von selber sprach Lili; sie war zu erfüllt davon, ihre Lippen konnten es nicht länger verschliessen. In einer tiefen Bewegung schloss die Mutter sie in die Arme: Gott sei Dank, Lili hatte sich ganz zurückgefunden. Und wenn sie nach dem Kriege dieses Mannes Frau wurde, eines deutschen Mannes, dann konnten die Eltern beruhigt über das Schicksal des einzigen Kindes sein.
Hermine von Voigt fühlte sich jetzt oft seltsam müde. Drei Jahre des Krieges zählen nicht nur doppelt, nein, drei- und vierfach. Besonders für den, der sie erlebte, wie sie sie erlebte. Sie hatte gebangt und gejubelt, angstvoll gezweifelt und stolz wieder geglaubt; in alle Tiefen war sie mit hinabgestürzt, auf alle Höhen mit hinaufgeklommen: ja, sie glaubte an Deutschlands Unsterblichkeit.
Die General-Offensive der Feinde war ermattet; Spätsommer war’s, ein paar Monate noch, und Eis und Schnee legte den Kämpfen Fesseln an. Wer weiss, ob dann das Friedensangebot, das im vorigen Winter schnöde abgewiesen worden war, nicht gern angenommen wurde? Die Generalin teilte die Ansicht ängstlicher Gemüter, dass Amerika der Entente doch noch den Sieg gewinnen würde, nicht. Amerika hatte freilich Hilfsmittel zur Verfügung, wie sie kein anderes Land besass, aber ein Brief ihres Mannes hatte sie beruhigt. ‚Ein Land, das kein stehendes Heer hat wie wir seit Menschengedenken, ist für uns nicht zu fürchten‘, schrieb der General. ‚Ein Heer lässt sich nicht in der Geschwindigkeit heranbilden. Wie will Amerika überdies Truppen in Masse herüberschaffen? Das verhindern unsere Tauchboote‘ — — — —
Heute ging Hermine von Voigt mit einem Lächeln nach der Villa Bertholdi. Sie wollte gratulieren. Gestern abend hatte sie im Heeresbericht gelesen: ‚Leutnant Bertholdi besiegte seinen fünfzehnten Gegner im Luftkampf. Er wurde ausgezeichnet mit dem Pour le mérite.‘
Glückliche Mutter! Wie musste der zumute sein, die einen Helden geboren hatte?! Wieder fühlte Hermine von Voigt den gleichen Taumel, jenes trunkene Glück, das sie bei dem ersten Siege wie auf goldener Wolke erhoben hatte. Lange hatte sie nicht mehr so empfunden. Man war doch stumpf geworden durch die Dauer des Krieges, man weinte nicht mehr so bitterlich, man freute sich nicht mehr so stürmisch, man hasste nicht mehr so glühend. Es war, als ob nicht nur der Seele, nein, auch dem Körper die Kraft dazu genommen wäre. Heute aber war wieder etwas von der alten begeisterten Freudigkeit in der Frau. Oh, wenn sie doch auch solch einen Sohn hätte! Die Hände würde sie ihm unterbreiten, ihrem Helden, ihn mehr lieben, als je ein Sohn auf Erden geliebt wurde. Gott sei Dank, dass Deutschland solche Söhne hatte! Sie waren Gnadengeschenke, helle Sterne in der Finsternis. Waren der Feinde noch so viele, waren sie auch noch so tapfer, deutsches Blut, deutscher Heldenmut stürmte voran. Das Siegesreis in der erhobenen Hand, voran, immer voran. Und bräche am Ziel der Held zusammen, dann nicht klagen. Gibt es denn etwas Höheres? Stolze, glückliche Mutter!
Hermine von Voigt fühlte es wie einen Trost: auch ihr wurde teil an solchem Sohn, wenn sie ihn gleich nicht selber geboren hatte, Heinz Bertholdi wurde Lilis Mann. Bertholdis waren ebenso glücklich über diese Aussicht, wie sie es war. Von einem Verlöbnis war noch nicht die Rede, die beiden hatten noch nichts Bindendes gesprochen, aber es war ein stillschweigendes Übereinkommen. Lili besuchte täglich das Bertholdische Haus, Frau Bertholdi zeigte es deutlich, dass ihr keine Schwiegertochter willkommener sein könnte, und Lili hing mit Zärtlichkeit an der Mutter des geliebten Mannes. Mitten aus dem wilden Meer des Krieges hob sich wie ein seliges Eiland dieses werdende Glück.
Hermine von Voigt sah sich mit leuchtenden Augen um: die Sonne noch so sommerwarm, glanzvoll strahlend. Es war heiss; sogar dürr und heiss, man hatte darunter zu leiden. Nicht nur Mensch und Vieh, auch die Felder. Wie eine Walstatt, zerfetzt und zerstochen von den Strahlenschwertern der roten Sonne, standen die Äcker. Die Blätter der Futterrüben welk, die Kohlköpfe klein und von Ungeziefer grau überlaufen; nichts Saftiges, nichts Frisches. Das Kartoffelkraut braun, dürr vor der Zeit, man konnte es zwischen den Fingern zu Pulver zerreiben. Um Gottes willen, man würde doch nicht wieder einen ganzen langen Winter Kohlrüben essen müssen anstatt der Kartoffeln?! Was den Kartoffeln der vorige Sommer an Nässe zuviel getan, das schadete ihnen jetzt die Trockenheit. Niedrig hatte das Korn gestanden und dünn im Stroh; nirgends eine schwere Ähre. Notreif musste man es einfahren, am liebsten gleich draussen ausdreschen, man hatte es ja so nötig. Zudem, wer Pferde sparen konnte, der sparte sie, schier brachen die alten Mähren zusammen. Was tauglich war, das war an der Front, Pferde wie Menschen.
Aber dem Obst tat dieser Sommer gut. Frau von Voigt sah mit erfreutem Blick die beladenen Bäume rechts und links in den Gärten. Die brachen fast unter ihrer Last. Ein reicher Obstsegen überall. Freilich, ob man viel davon spüren würde? Marmelade, Marmelade, alles zu Marmelade. Die war mit Sacharin gesüsst, das verdarb den Geschmack; Zucker gab’s nicht. Und ob man noch Marmelade reichlich bekommen würde? Immer hiess es: es ist alles da, und doch bekam der einzelne nichts. Wo blieben denn all die Lebensmittel? Fürs Heer, fürs Heer! Für das Heer, für die draussen wollte jeder gern entbehren — aber bekam das Heer denn alles?!
Bei ihrem Amt im Lebensmittelverkauf der Gemeinde hörte Frau von Voigt die Frauen sprechen. Sie drängten sich vor den Verkaufstischen, standen in langen Reihen, und die hinteren glaubten sich unbelauscht. Aber die Stimmen der anfänglich nur Flüsternden wurden oft erregt laut, man konnte die Ohren nicht verschliessen, zu hören.
„Mein Mann schreibt: ‚Seit drei Wochen kaum warmes Essen, oft bloss ’n Salzhering. Und keine Kartoffeln dazu.‘ Keene Kartoffeln, det ist’t Schlimmste.“
„Ja, aber die Offiziere, die schlagen sich ’n Bauch voll. Die wer’n sich bedanken, so zu hungern. Abends Bratkartoffeln, det der schöne Jeruch bis in’n vordersten Iraben zieht.“
„Un da soll einer noch Lust haben, sich dotschiessen zu lassen?“ Eine Blasse mit hungrigen Augen krächzte und hustete. „Ich habe meinen Mann aber ooch jeschrieben: wenn se dir nich jeben, denn nimm dir; un wenn de det nich kannst, denn schmeiss hin. Die Franzosen sind ooch Menschen, un die ha’m noch wat, lauf bei die rüber. Bei die Engländer un Amerikaner jiebt’s erst recht wat Fettes.“
„Aber denn sind se doch gefangen,“ sagte zittrig ein altes Mütterchen. Ihr zahnloser Mund war blass, sie war schwach von dem langen Stehen auf geschwollenen Füssen, eingekeilt in der sich drängenden Menge der Käuferinnen. „Mein Sohn is in Gefangenschaft, das is mir fast schlimmer als tot.“
„Quatsch!“ Eine grosse vierschrötige Person stiess sie in die Seite. „Ha’m Se sich bloss nich so. Uns machen Se doch nischt vor. Wenn man satt hat, so satt, wie wir seit Jahr und Dag nich mehr werden, denn kann et einem janz ejal sein, ob französch oder englisch oder amerikansch. Meinetwejen russisch, oder jelb wie de Affen, die Japanesen.“
„Nein, nein,“ die Alte war hartnäckig, „ich will deutsch bleiben und deutsch sterben.“
Die Vierschrötige lachte auf. „Deutsch sterben?!“ Sie mass die jämmerlich Zusammengeschrumpfte mit spöttischem und zugleich mitleidigem Blick. „Na, det kann Ihnen leicht passieren.“
„Will ich auch,“ murmelte die Greisin. „Was soll ich noch hier? Mein Junge gefangen, wer weiss, ob er je wiederkommt — meine Tochter hat die Schwindsucht, ‚unterernährt,‘ sagt der Doktor. ‚Butter, Eier, Milch —‘ lieber Gott, wo soll man die herkriegen?!“
Ein Murmeln ging um. „Ja, ’n Attest kann man schon kriegen vom Doktor.“
„Kost’ aber jedesmal vier Mark.“
„Un ob man die Milch denn immer kriegt, oder ’n Iries oder die Haferflocken oder ’t weisse Brot, det is noch sehr die Frage.“
„Alles fürs Heer!“ Ein heimliches, aber nicht zu unterdrückendes Gelächter erhob sich.
Oh, es war nicht erfreulich, diese Unterhaltungen mit anzuhören! Frau von Voigts Stirn umdüsterte sich; manches Mal hatte sie sehr darunter gelitten. Aber nein, sich nicht niederziehen lassen von den Erbärmlichkeiten des Alltags! Was bedeutet ein einzelnes Menschendasein gegenüber dem Leben des Vaterlandes? Sie war sich darüber klar, es war schwer, sich nicht umwerfen zu lassen von einer plötzlichen Schwäche. Man durfte eben nicht vergessen, dass nichts erreicht wird ohne Opfer. Jetzt war für alle die Zeit der Opfer. Und es wurden Opfer gebracht, so ungeheure, dass es einem schwindelte: Männer, Söhne, das ganze Familienglück, die eigene Gesundheit, Wohlleben, Behagen, alle Bequemlichkeit.
Die Frau holte Luft, als sei ihr der Atem knapp geworden. Gott sei Dank, dass noch Stunden des Stolzes, der Genugtuung kamen, eine Stunde wie die heutige, in der sie ging, um sich mit der Mutter des jungen Helden zu freuen!
Die hohe Gestalt der Generalin schritt aufrecht dahin. Die Leute grüssten sie; es kannte sie hier fast ein jeder. Es gab welche, die sich über sie ärgerten: ‚militärfromm, königstreu‘ — aber die Achtung versagte ihr keiner. Sie wussten: die hatte trotz allem Verständnis fürs Volk und ein Herz für die Armen. Als die Dombrowski, die hübsche, lebenslustige Frau, damals bei dem Unglück auf dem Bahngeleise, unter die Räder des Fernzuges kam, der in die Arbeiterinnenkolonne hineinfuhr, nahm sich die Generalin der zurückgebliebenen Kinder an. Der Vater war im Feld und kümmerte sich nicht um die, liess gar nichts mehr von sich hören, man wusste nicht, war er tot oder gefangen. Die Kinder sollten in das Waisenhaus, aber das kleine Mädchen, das noch um die Mutter jammerte, klammerte sich an den Bruder und schrie sich heiser. Da hatte sich denn die Generalin erbarmt und die Kinder zu einer Frau Müller in Pflege getan und bezahlte für sie. Dombrowski konnte sich bedanken, wenn er noch mal wiederkommen sollte, der Junge war längst nicht mehr so ein Strolch, das Mädchen wurde immer niedlicher.
Es wäre Hermine von Voigts grösster Wunsch gewesen, Verwundete zu pflegen; aber sie fühlte, dazu war sie nicht jung genug mehr; sie hatte nicht die Kräfte, Tag für Tag in aller Frühe ins Lazarett zu gehen und dort auf den Füssen zu bleiben bis zum Abend. Es war ein schmerzliches Bescheiden. Ach, wer das noch leisten konnte, der war am glücklichsten daran. Blut und Wunden wird man gewöhnt, und haben sich die Pforten des Lazaretts einmal geschlossen, so ist man in einer Welt für sich. Mit dem Stundenschlag geht die Pflichterfüllung, eigene Gedanken sind ausgeschaltet, man hat zu ihnen nicht Zeit. In die hohen Krankensäle mit den dichtgereihten Betten tritt das nicht ein, was das Leben vor den Pforten so schwer macht — alle Angst vor der Zukunft bleibt draussen. Hier ängstigt man sich nur um die nächste Stunde: glückt die Operation? Wie wird der Kranke erwachen? Man fragt nicht: wie wird Deutschlands Schicksal sein? Wird das deutsche Volk auch durchhalten? Hier fragt man nur: wird dieses junge Blut genesen?
Hermine von Voigt konnte es nicht verstehen, dass Lili und Annemarie sich solche Freuden entgehen liessen; die waren doch jung und kräftig genug. Sie hatte es von der Tochter anders erwartet, die aber lächelte träumerisch:
„Ich kann nicht, Mutter. Wenn ich unglücklich wäre, dann ja, dann würde ich gern pflegen. Aber jetzt — ich bin zu glücklich!“ Sie sah rührend schön aus mit dem verklärten Lächeln. „Vielleicht, dass ich auch all meine Kräfte sparen muss, dass ich die alle noch brauche.“
Unter den grossen Linden im Vordergarten stolperte der kleine Rudi Bertholdi an der Hand der Wärterin herum; im Zimmer ging es besser, da lief er schon flink von Stuhl zu Stuhl, hier bohrten sich seine kleinen Fussspitzen ungeschickt in den hohen Kies. Hinter dem hübschen Kind mit den braunen Ringellöckchen ging lachend die hübsche Mutter. Sie hatte sich in den Arm von Lili Rossi gehängt.
Es war wie lauter Heiterkeit: das freundliche Haus, der gepflegte Garten, das Kind im weissen Röckchen, die beiden jungen Frauen in lichten Kleidern. Leute, die am Gatter vorübergingen, staunten: die dadrin merkten noch nichts vom Krieg. Das Kind hatte ja Bäckchen wie ein Apfel; wenn man dagegen die anderen Kinder ansah: alle blass, welk. Wovon sollten die auch dicke Backen haben? Nur die ganz kleinen bekamen noch ihre Milch, für die anderen gab es keine. Und wie fein die Damen angezogen waren!
Annemarie lachte übermütig. Sie war heute fast ausgelassen vergnügt: das war grossartig, Schwager Heinz den Pour le mérite bekommen! Schade, dass Rudolf nicht auch Flieger war, es war da viel leichter, ausgezeichnet zu werden. „Er muss mal ’ne ordentliche Heldentat vollbringen, ich warte immer aufs Kreuz Erster; sonst schäme ich mich ja!“ Ihr klangvolles rheinisches Lachen schallte bis in die Veranda, wo Hedwig und Frau von Voigt am Teetisch sassen.
Die beiden hatten lange und vertrauensvoll miteinander gesprochen; es war das erste Mal, dass sie die Zukunft ihrer Kinder berührten. Hedwig schloss die Augen wie geblendet — Heinz, ihr Sohn, ein so berühmter Flieger? „Es ist mir wie ein Traum. Oft frage ich mich: ist das der Junge, der in der Schule nicht lernen wollte? Er hat mich oft Tränen gekostet. Rudolf nie. Aber er — o weh, die Zensuren! Ich habe manches Mal darüber geweint.“
„Nun haben Sie doppelte Freude an ihm,“ sagte die Generalin herzlich.
Hedwig nickte: „Grosse Freude.“ Sie war den ganzen Tag schon blass vor innerer Erregung. Es war etwas Übermächtiges auf sie eingestürmt, als sie gestern im Abendbericht von der Auszeichnung ihres Sohnes las. „Du bist ordentlich grösser geworden,“ neckte sie ihr Mann. Ach nein, nicht den Kopf zu hoch tragen! Fast ängstlich wehrte Hedwig alle Glückwünsche ab. ‚Bist du aber mal komisch,‘ sagte Annemarie; sie ärgerte sich über die Schwiegermutter: warum sich denn nicht mal so recht freuen?
In Hedwigs Seele war ein Bangen: Heinz hatte zuviel Glück, erst diese Erfolge, und dann —! Ihr zärtlicher Blick flog die Stufen der Veranda hinab in den Garten. Da stand Lili mitten im Licht, um ihr blondes Haupt wob die Sonne einen Strahlenkranz. „Ich hoffe sehr, dass Heinz bald auf Urlaub kommen kann.“