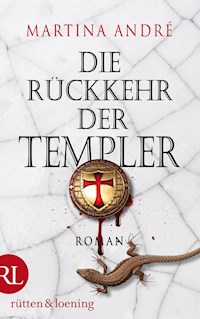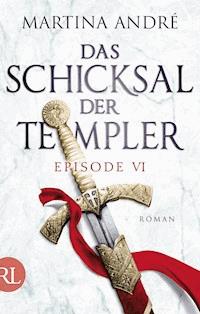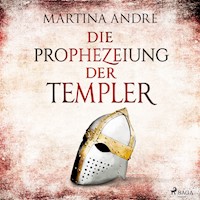9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gero von Breydenbach
- Sprache: Deutsch
Denn Liebe wird die Zeit überwinden.
Eifel, 1315. Gero und seine Frau Hannah sind am Ort ihrer Träume angelangt und hoffen auf ein friedliches Leben. Doch ihr Glück währt nur für kurze Zeit: Die Truppen der Heiligen Inquisition sind Gero auf der Spur und verlangen seine Auslieferung. Doch nicht nur sein Leben ist in Gefahr, sondern auch das machtvolle Geheimnis der Templer scheint nicht mehr sicher. Seine Entdeckung droht die Menschheit an den Abgrund zu führen. Aber kann Gero den Schatz der Templer schützen, ohne alles zu verlieren, was ihm wichtig ist?
Eine packende Zeitreisegeschichte und die spektakuläre Jagd nach dem machtvollsten Geheimnis der Templer. Für alle Fans der TV-Serien "Knightfall" und "Outlander".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1551
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Informationen zum Buch
Denn Liebe wird die Zeit überwinden
Eifel, 1315. Gero und seine Frau Hannah sind am Ort ihrer Träume angelangt und hoffen auf ein friedliches Leben. Doch ihr Glück währt nur für kurze Zeit: Die Truppen der Heiligen Inquisition sind Gero auf der Spur und verlangen seine Auslieferung. Doch nicht nur sein Leben ist in Gefahr, sondern auch das machtvolle Geheimnis der Templer scheint nicht mehr sicher. Seine Entdeckung droht die Menschheit an den Abgrund zu führen. Aber kann Gero den Schatz der Templer schützen, ohne alles zu verlieren, was ihm wichtig ist?
Eine packende Zeitreisegeschichte und die spektakuläre Jagd nach dem machtvollsten Geheimnis der Templer.
Martina André
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Episode I – Verborgene Schätze
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Episode II – Alte Feinde
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Episode III – Gefährliche Allianzen
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Episode IV – Geheime Bruderschaft
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Episode V – Tödliche Sünden
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Episode VI – Neue Welten
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Nachwort/Danksagung
Über Martina André
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Für Mairi und George St Clair –Danke für eure Freundschaft
EPISODE I
Verborgene Schätze
»Erkenne, was vor dir ist,und was dir verborgen ist, wird dir enthüllt werden.Denn es gibt nichts Verborgenes,was nicht offenbar werden wird.«
(Thomas-Evangelium)
PROLOG
»Du erschaffst,was du denkst«
(Kabbala)
HERBST 1315BALANTRODOCH/LOTHIAN/SCHOTTLAND
Zuflucht des Kriegers
»Bruder Walter!«, rief eine energische Stimme, und wie ein Berserker rüttelte jemand unablässig an Sir Walter of Cliftons hagerer Schulter. Für einen Moment glaubte er, schlecht zu träumen, und entschloss sich, einfach auf seinem halbwegs bequemen Lager aus Stroh und Kaninchenfellen liegen zu bleiben und den lästigen Dämon, der seinen ohnehin unruhigen Schlaf störte, ganz einfach zu ignorieren. Doch die Stimme gab nicht nach. »Walter, ich bin’s!«, rief der Quälgeist nun mit Nachdruck. Dabei schüttelte er ihn erneut.
»Steh auf, Bruder, wir müssen uns beeilen!«
»Verdammt!«, murmelte Walter und drehte sich verärgert dem spärlich brennenden Torffeuer zu, das von einem großen Schatten verdeckt wurde.
»Na endlich«, knurrte der Störenfried und redete ohne Unterlass weiter… »Es hat Brian of Locton erwischt. Sie haben ihn vorgestern in Maryculter verhaftet und nach Holyrood Abbey verschleppt. Dort wird er seit gestern von einem englischen Inquisitor gefoltert. Wie man mir sagte, ist der Kerl kein Kirchenmann, sondern wie üblich ein Menschenschinder. Die Folterknechte haben Brian so furchtbar zugerichtet, dass er dem Tod inzwischen näher ist als dem Leben. Wir müssen ihn dort rausholen und das heilige Kreuz zur Hilfe nehmen, um seine Haut zu retten, sonst ist er bei Sonnenaufgang so mausetot wie meine Großmutter.«
Es dauerte einen Moment, bis Walter im dürftigen Licht einer Ölfunzel, die er aus reiner Gewohnheit die ganze Nacht brennen ließ, seinen Ordensbruder Thomas of Thoraldby, genannt Totty, erkannte. Er gehörte wie Walter zur geheimen Bruderschaft des Heiligen Andreas und trug das gleiche graue Ordensgewand wie er selbst. Anders als sein Spitzname vermuten ließ, war der fünfunddreißigjährige Thomas groß und athletisch. Mit seinem rostbraunen zerzausten Schopf und dem geschärften Blick eines Jägers, dem nichts in seiner Umgebung entgeht, wirkte er wie ein furchteinflößender Krieger und nicht wie ein harmloser Mönch. Eine Eigenschaft, die den meisten Templern, die hatten fliehen können, zu eigen war und die es ihnen schwer machte, sich in der neu gegründeten Bruderschaft als gewöhnliche Ordensbrüder zu tarnen.
Tottys Vorfahren stammten aus Wales, aber Walter war aufgrund seines Aussehens davon überzeugt, dass sich unter ihnen auch einige Nordmänner befanden. Als der Orden noch Bestand hatte, war er Commander der Templer von Garway gewesen, im Südwesten von England. Ähnlich wie Walter, der in England geboren und aufgewachsen war und bis zum Jahre des Herrn 1309 seinen Dienst als Commander von Balantrodoch, dem Hauptsitz der Templer in Schottland, versehen hatte, war Thomas nach der Vernichtung des Ordens den Schergen der Inquisition in die Hände gefallen und hatte längere Zeit unter der Folter den unablässigen Verhören getrotzt, was ihn wie die meisten Brüder fürs restliche Leben gezeichnet hatte.
»Zur Hölle, verdammt!«, zischte Walter und bekreuzigte sich hastig, während er sich, in eine schmuddelige Mönchskutte gehüllt, von seiner provisorischen Bettstatt erhob. »Woher weißt du das alles?«
»Von der Verhaftung habe ich gestern Morgen durch einen Hospitaliter in Maryculter erfahren«, erklärte Totty beunruhigt. »Er sagte mir auch, dass man Brian zum Verhör nach Edinburgh bringen wollte. Ich bin die ganze Nacht von Aberdeenshire aus durchgeritten«, fügte er mit gehetzter Stimme hinzu. »Auf dem Weg hierher habe ich Roger, Michael, Ralph und Peter Bescheid gegeben, außerdem habe ich ihnen aufgetragen, Edmund und William zu informieren, damit wir auch genug Männer sind, um Brian notfalls mit Waffengewalt aus dem Kerker befreien zu können. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wir es ohne die Unterstützung des Kreuzes schaffen werden.«
Die anderen Brüder hatten sich zur gleichen Zeit in Saint Andrews und Dumfries aufgehalten, was Totty – wie auch Sir Walters Aufenthalt in dessen abgeschotteter Einsiedlerklause – einem verschlüsselten Plan entnehmen konnte, der einmal im Monat an ständig wechselnden Orten in einer Generalversammlung der Bruderschaft festgelegt wurde. Mehr durch Zufall hatte er von einem Bruder der Hospitaliter erfahren, dass Bruder Brian of Locton am vergangenen Dienstag von Schergen der Heiligen Inquisition unter dem Verdacht der Ketzerei und schwarzen Magie abgeholt worden war. Brian of Locton, ein irischer Templer, war vor drei Jahren, nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft, unter dem Zwang der Inquisition den Ordensrittern von St. John in Maryculter beigetreten, die das dortige Ordenshaus nach der Auflösung des Templerordens übernehmen durften. Aber in Wahrheit fühlte er sich der Bruderschaft des Heiligen Andreas verpflichtet und spionierte bei den Hospitalitern für Walter und seine Leute.
»Es hieß«, fuhr Totty wutschnaubend fort, »der Engländer würde Brian mit Zustimmung des schottischen Königs die Folterinstrumente zeigen. Dass es nicht beim Zeigen geblieben ist, habe ich am frühen Nachmittag über einen weiteren Mittelsmann direkt aus Holyrood Abbey erfahren. Ich hatte ihn sofort kontaktiert, nachdem die Brüder und ich mit der Fähre den Abhainn Dhubh überquert hatten.«
»Da stimmt was nicht«, raunte Sir Walter und fuhr sich mit seinen rauen Händen übers Gesicht. »Er hat sich seit dem Prozess, in dem er von der Ketzerei freigesprochen wurde, nichts zu Schulden kommen lassen, und bei unseren Treffen haben wir stets darauf geachtet, nicht zusammen gesehen zu werden. Es muss einen Grund haben, warum man ausgerechnet ihn ausgesucht hat.« Mit grimmigem Blick und in dem sicheren Wissen darum, dass die Sache bis zum Himmel stank, schlüpfte er mitsamt seinen Filzsocken in die abgetragenen Sandalen.
»Natürlich stimmt da was nicht«, belehrte ihn Totty aufgebracht. »Es sei denn, du findest es richtig, dass soeben einer von unseren Leuten – wohlgemerkt ohne Prozess – auf der Streckbank gemeuchelt wird.«
»Das meine ich nicht.« Widerstrebend schüttelte Sir Walter sein graues langhaariges Haupt, das ihn zusammen mit dem weißen Bart, der ihm bis auf die Brust reichte, wie einen Druiden des alten Glaubens aussehen ließ. »Ein englischer Inquisitor macht mit dem schottischen König gemeinsame Sache?« Er hob eine buschige Braue und warf Totty einen scharfen Blick zu. »Sehr merkwürdig, findest du nicht?«, murmelte er und stand auf, um nach seinem Wanderstab zu suchen. »Bist du sicher, dass der Hinweis der Wahrheit entspricht?«
»Der Mann, den ich gefragt habe, gehört zu den Hausdienern von Holyrood Abbey und ist absolut zuverlässig«, fügte Totty beinah beleidigt hinzu. »Ich habe vor ein paar Monaten für die Genesung seiner Schwester gebetet, die am Antoniusfeuer erkrankt war. Nachdem ich ihm dazu ein paar Anweisungen gegeben hatte, zukünftig keine schwarzen Körner zu essen und das Mehl selbst zu mahlen, ist sie wie durch ein Wunder genesen. Allein dafür wird er mir auf ewig dankbar sein.«
»Nun gut«, sagte Walter, »wenn es so ist, wird es wohl richtig sein. Wo sind die anderen?«
»Sie warten bei Saint Mary auf uns. Bruder Ralph hat uns im Hafen von Leith sechs Pferde gemietet, damit wir schneller vorankommen und keine Rückschlüsse auf die Brandzeichen möglich sind, falls uns jemand bemerkt.«
Zusammen mit Totty hastete Sir Walter wenig später durch den Wald von Rosslyn, dem Gebiet des Henry St Clair of Rosslyn. Dieser hatte im letzten Jahr als Verbündeter von König Robert the Bruce eine Rotte von geflohenen Templerbrüdern in der siegreichen Schlacht von Bannockburn zusammen mit den schottischen Kriegern gegen die Engländer angeführt und dafür von der schottischen Krone das hiesige Gebiet rund um die Pentlands erhalten. Eine Moorlandschaft, von Flüssen und Bächen durchzogen, wenig ertragreich, aber von dichten Eichenwäldern umgeben. Sir Henrys Onkel war einer der letzten Großmeister des Ordens gewesen, und obwohl er auch deshalb den Templern zugetan war, gehörte er nicht zu den Eingeweihten des Hohen Rates. Walter und seine Bruderschaft des Heiligen Andreas, die sich ausschließlich aus Nachfolgemitgliedern des Hohen Rates der Templer zusammensetzte, hatten sich unter Angabe einer Reihe von oberflächlichen Gründen aus den Kampfhandlungen gegen die Engländer herausgehalten, und taten es noch immer. Denn sie operierten in geheimer Mission, um unerkannt den größten Schatz des Ordens – Das Geheimnis des Glaubens – zu schützen. Keine Reliquie, sondern ein Heiligtum, das sogar den legendären Heiligen Gral in den Schatten stellte, und von dessen Existenz nicht einmal so hochgestellte Persönlichkeiten wie Sir Henry etwas ahnten. Der umtriebige Lord hatte sich mit Sir Walters Bekenntnis zufriedengeben müssen, dass sie als ehemalige inhaftierte Brüder nun unter einem neu gegründeten Bettelorden zwar gern auf seine Unterstützung zählten, zugleich aber jegliche Gewalt ablehnten und im Angesicht Gottes fortan die Waffe nur noch zur Verteidigung ihres eigenen Lebens führten. Stattdessen wollten sie inkognito durch die Lande ziehen, um Gutes zu tun und Alte und Kranke zu pflegen.
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sir Henry und der Clan der St Clairs diese Geschichte gefressen haben«, bemerkte Totty lakonisch. »Schließlich steht ihr Oberhaupt dem Orden näher als irgendein Adliger sonst in Schottland.«
»Jacques de Molay hat auch nicht alles gewusst«, gab Walter mit einem Schulterzucken zu bedenken. »Was nicht weiter verwunderlich ist. Schließlich hat der Hohe Rat nur die Fähigsten für seine Aufgaben ausgesucht und nicht die Mächtigsten. Oder hast du schon einen König erlebt, der schlauer ist, als sein Geheimdienst?«
»Nein, eher nicht«, erwiderte Totty und grinste matt. »Ansonsten wären Sir Henry und der König uns längst auf die Pelle gerückt.«
»Ich weiß, dass ich nicht weiß, sagte schon Sokrates«, belehrte ihn Walter. »Menschen an der Spitze der Macht verlieren oft den Blick für das Wesentliche und haben keinen Ehrgeiz mehr, den Dingen selbst auf den Grund zu gehen, wie es die griechischen Gelehrten taten. Sie verlassen sich auf das Urteil ihrer Spitzel und Speichellecker, die sie engagieren, um ihre Wissenslücken zu füllen. Das schafft einen fruchtbaren Boden für raffinierte Günstlinge, bei denen es selbst dem cleversten Anführer schwer fallen dürfte, Freund von Feind zu unterscheiden. Deshalb hat der Hohe Rat der Templer sich schon früh entschieden, die wahren Lenker des Ordens geheim zu halten, und mit unscheinbaren Ämtern zu tarnen. Damit sie nicht stolz werden und faul, und niemand auf die Idee kommt, sich bei ihnen anzubiedern, um ihr Wissen auszuhorchen. Molay fungierte, wie so viele andere auch, lediglich als Schachfigur. Dass er seinen Kopf für uns hingehalten hat, um unsere Ehre zu retten, ist allemal löblich und tragisch zugleich. Aber man hat ja gesehen, wie hilflos er war, als man ihn auf Chinon festgesetzt hatte, und wie lange es gedauert hat, bis er an seinem unrühmlichen Ende zu einer akzeptablen Haltung fand, die dem Orden das Ansehen zurückgegeben hat, die ihm gebührt. Zugleich hat er unserer Organisation damit einen harmlosen Anstrich verliehen und den Feind, was das Aufspüren unserer Mysterien betrifft, mit Verwirrung gestraft.«
»Dann bedeutet das, wir agieren mit dem Verhalten eines Jacques de Molay, um unsere Feinde zu täuschen. Sehe ich das richtig?«, fragte Totty, während er mit Walter mitzuhalten versuchte.
»Nicht, um sie zu verwirren«, gab Walter zurück, »sondern, um sie gar nicht erst auf uns aufmerksam zu machen. Schon allein deshalb alarmiert mich der Umstand, dass Brian of Locton trotz aller Vorsicht nun offenbar ins Visier unserer Widersacher geraten ist.«
Ihr Ziel war die Ruine einer ehemaligen Templerkapelle, die vor Jahren dem Verwüstungswahn englischer Truppen zum Opfer gefallen war. Henry St Clair hatte bei der Landübergabe durch den König zwar davon gesprochen, sie wieder aufbauen zu lassen, größer und schöner als je zuvor, doch nun benötigte er das Geld wohl eher, um unweit entfernt ein neues Schloss zu errichten.
Nur von einer spärlich brennenden Fackel geleitet, folgte Sir Walter in fast völliger Dunkelheit seinem ausgezeichneten Orientierungssinn. Die Ruine der alten Templerkapelle befand sich, wie auch seine Höhle, im Tal des North Esk, an einem breiten, an dieser Stelle rauschenden Bachlauf, der sich kurz vor Edinburgh mit dem South Esk zu einem einzigen Fluss verband. Beide Gewässer stellten eine Verbindung zwischen Walters ehemaliger Wirkungsstätte in Balantrodoch, wo er als Nachfolger von John of Husflete seinen Dienst als Commander Templer versehen hatte, und jenem Ort her, der ihm seit seiner Entlassung aus den Fängen der Inquisition als Refugium diente.
Wie bei fast allen festgesetzten Templern hatte man auch bei Walter während seiner Gefangenschaft in der Holyrood Abbey unter der Folter Beweise über die Vergehen des Ordens hinsichtlich Ketzerei, Blasphemie und weiterer schwerwiegender Verfehlungen wie Unzucht und schwarzer Magie herauszupressen versucht. Jedoch stets ohne Ergebnis. Dank des Allmächtigen hatte er Hunger und Durst und dem glühenden Eisen getrotzt, mit dem man ihn mehrmals täglich traktiert hatte. Eher wäre er gestorben als seinen Häschern den geringsten Hinweis zu geben, wie tief er mit den Mysterien des Ordens vertraut war, geschweige denn seine Zugehörigkeit zum inneren Kreis der Templer zu verraten. Am Ende war er zu schwach gewesen, um überhaupt noch eine Antwort geben zu können. In der sicheren Überzeugung, dass er ohnehin bald sterben würde, hatte William de Lamberton, Bischof von Saint Andrews und den umliegenden Gebieten, Gnade vor Recht ergehen lassen und die Entlassung Walters aus den Kerkern der Inquisition beim schottischen und englischen Klerus erbeten.
Mit der Auflage, das Land nicht verlassen zu dürfen und sich für die verbleibende Zeit ganz und gar Gott und einem asketischen Dasein zu widmen, hatte man ihm erlaubt, sich in eine Einsiedelei zurückzuziehen.
Bald darauf hatte John of Husflete ihn zu seinem Nachfolger als Oberhaupt der geheimen Bruderschaft berufen, deren Ziel es war, wenigstens den inneren Kern des Ordens zu erhalten und damit das größte Geheimnis der Christenheit vor dem Angriff des Teufels zu bewahren. Hugues de Payens, Herr von Montigny-Lagesse und die übrigen Begründer des Templerordens hatten das mächtigste Mysterium der Christenheit vor fast zweihundert Jahren mehr zufällig unter dem Tempelberg in Jerusalem entdeckt, als sie auf der Suche nach dem Heiligen Gral waren. Aufgrund der Brisanz dieses Fundes, der ihre Vorstellungen von einem Abendmahlkelch bei weitem überstieg, hatten sie den Hohen Rat gegründet. Einen eingeweihten Kreis verschworener Ordensbrüder, die von da an die Verantwortung für den respekteinflößenden Fund übernahmen und ihn stets und an verschiedenen Orten vor dem gemeinen Volk und sämtlichen Widersachern versteckt gehalten hatten.
In aller Eile hatte man nach der Vernichtung des Ordens den unscheinbaren Sarkophag, in dem sich das Heiligtum befand, von Franzien kommend auf eine Insel inmitten von Loch Obha geschafft und dort unter den Ruinen einer ehemaligen Wikingerfestung vergraben. Doch es wäre naiv gewesen, zu glauben, ein Mysterium von solch ungeahntem Ausmaß auf Dauer an einem allgemein zugänglichen Ort versteckt halten zu können.
»Das Geheimnis des Glaubens ist fähig, die gesamte Christenheit in ein einziges Chaos zu stürzen und ein Höllenfeuer heraufzubeschwören, das nicht mehr gelöscht werden kann, wenn die Macht, die in ihm steckt, in die falschen Hände gerät«, hatte John of Husflete seinen Männern in geradezu beschwörender Weise verkündet. Deshalb war Meister John, wie ihn alle nannten, mit einem Segelschiff des Ordens und einem Vorkommando von ehemaligen Templern an Bord auf Routen der Wikinger in eine ferne Welt aufgebrochen, um herauszufinden, ob das ihnen anvertraute Mysterium dort sicherer verborgen werden könnte als unter dem Einfluss der hiesigen Könige, die in seinen Augen allesamt von der Machtgier des Teufels besessen waren.
Sobald er den passenden Ort entdeckt und alle Vorkehrungen getroffen hatte, wollte er zurückkehren, um den Sarkophag mitsamt seinem brisanten Inhalt bis in alle Ewigkeit in Sicherheit zu bringen.
Bis es soweit war, hatte er alle Last der Verantwortung auf die Schultern seines Nachfolgers geladen. Nicht nur für den kostbarsten Besitz des Ordens, sondern auch für den Schutz der verbliebenen Brüder. Zugleich hatte er Sir Walter die Aufgabe erteilt, weitere untergetauchte Templer zu rekrutieren, die ihm vertrauenswürdig genug erschienen, um sie bei ihrer schwierigen Mission zu unterstützen. Als neu gewähltes Oberhaupt der geheimen Bruderschaft musste Walter schon bald eine Entscheidung treffen, die er lieber hinausgezögert hätte. Denn offenbar gab es immer noch genug unselige Teufel, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, ihn und seine Mitbrüder aufzuspüren und zu jagen, um ihr geheimes Wissen an sich zu reißen.
In dem Bewusstsein, dass es mit Bruder Brian nun tatsächlich einen der ihren erwischt hatte, rannte Walter die verfallenen Stufen der Krypta von Saint Mary hinab, wo er völlig außer Atem die anderen Templer, die dort bereits auf sie warteten, kurz begrüßte. Seine Mitstreiter setzten sich ausnahmslos aus ehemaligen Kommandeuren zusammen, die in früheren Zeiten einem Ordenshaus der Templer vorgestanden hatten und nun in der Anonymität seines Bettelordens untergetaucht waren.
»Es gibt ja keine Zufälle«, murmelte Sir Walter und ging vor den anwesenden Männern im Schein der Fackel auf die Knie, aber nicht, um ihnen zu huldigen, sondern um eine fingerdicke Staubschicht auf dem Boden der Krypta mit dem Ärmel seines Gewands beiseite zu wischen, bis ein paar lose daliegende Eichenbohlen sichtbar wurden, die er sorgsam zur Seite räumte.
Das Geräusch hallte von den Mauern der Ruinen wider und Walter kniff ärgerlich seine buschigen Brauen zusammen. »Roger, Michael!«, rief er verhalten und schaute zu Roger of Stowe und zu Michael of Baskerville auf, die wie er und noch einige mehr einst einen Kommandeursposten im Orden bekleidet hatten. »Geht nach oben und haltet die Umgebung im Blick. Wir können hier beim besten Willen keine ungebetenen Besucher gebrauchen.« Die beiden Angesprochenen schienen ein bisschen enttäuscht, weil sie, wie die übrigen Brüder auch, das hier versteckte magische Artefakt noch nicht zu Gesicht bekommen hatten. Trotzdem begaben sie sich augenblicklich mit gezückten Schwertern zum Ausgang und Walter spürte, wie er ruhiger wurde und besonnener zu Werke ging. Das steinerne Kreuz, das er hier versteckt hielt, war nur ein Teil des sagenumwobenen Templerschatzes, aber ein nicht unwesentlicher, verkörperte es doch, wenn auch in wesentlich schwächerer Form, die eigentliche Wirkung des Heiligtums. Genaugenommen war es ein schlichtes, handtellergroßes Kreuz, gefertigt aus einem Gestein, das wie Das Geheimnis des Glaubens einer verborgenen Höhle unterhalb des Berges Horeb auf dem Sinai entstammte. Es strahlte eine gewisse Hitze ab, aber nur wenn man es anfasste, und verursachte Brandblasen auf der Haut, wenn man es ohne Gedanken an seine Wirkung in den Händen hielt. Bei genauer Betrachtung zeigte sich dem Beobachter eine Aura der Abstrahlung, die das Kreuz wie eine etwa fingerbreite Hitzespiegelung umhüllte, ähnlich einer Fata Morgana. Nachdem er ein paar Steinplatten aus dem Boden gelöst hatte, kam eine kreisrunde Öffnung im Untergrund zum Vorschein, gerade groß genug, dass ein ausgewachsener Mann hindurchpasste. Darunter befand sich ein weiterer Hohlraum, der früher einmal von außen begehbar gewesen war, nach einem Erdrutsch jedoch nur noch mithilfe eines Seils und mindestens zweier starker Männer, die einen Eindringling sieben Fuß in die Tiefe hinablassen mussten. Ralph, ein schwarzhaariger Templer aus Wiltshire in England, übernahm zusammen mit dem irischen Bruder Peter of Malvern die Muskelarbeit. Mit äußerster Vorsicht ließen sie Walter und Totty nacheinander hinunter. Ein schwacher Widerhall zeigte das Aufkommen Walters auf dem staubigen Boden an. Totty tat es ihm nach und fing, kaum unten angekommen, geschickt die brennende Fackel auf, die Bruder Ralph durch das Loch zu ihnen hinabwarf. Voller Neugier leuchtete er den spartanisch eingerichteten Raum aus, den er bisher noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Indes fiel Walters Blick auf den monströsen Altar, der, wie er ihnen zuvor erklärt hatte, einer keltischen Opferstätte gleich, aus vier massiv gemauerten Säulen und einer mächtigen Marmorplatte bestand.
Nachdem Walter den Opferstein einmal umrundet hatte, machte er sich an einer Wand aus hellem Kalksandstein zu schaffen und löste am Fuß der Mauer mehrere Steine heraus. Aus einem darunterliegenden Hohlraum brachte er eine schlichte Eichenholzkiste zutage, die kaum größer war als die Heilige Schrift.
»Geh zur Seite«, warnte er Totty, während er die unscheinbare Kiste auf Händen zum Altartisch balancierte, »das Ding ist gefährlich. Du wärst nicht der Erste, den die Strahlung des Kreuzes ohne Vorwarnung trifft, weil die Kiste sich versehentlich öffnet.«
»Und was ist mit dir, Bruder Walter?«, fragte Totty, über so viel Misstrauen sichtlich enttäuscht. »Warum kannst du das Kreuz anfassen und wir nicht?«
»Weil ich reinen Herzens bin«, belehrte ihn Walter mit einem Seufzen, »und darüber hinaus imstande, meine Gedanken zu kontrollieren. Dazu bedarf es jahrelanger Übung. Wenn du einmal mit der Macht dieses Kreuzes in Berührung gekommen bist, entwickelst du ein Gespür für das viel größere Geheimnis des Glaubens, dessen Einflussnahme auf seine Umgebung tausendmal stärker ist.«
Totty ahnte, wie gefährlich das eigentliche Mysterium war, das sie am Loch Obha versteckt hielten, mit dem er aber noch nie in Berührung gekommen war. Nur die Meister des Hohen Rates hatten es bisher zu Gesicht bekommen. Es hieß, es sei das größte Vermächtnis der Christenheit, auch wenn es in Wahrheit den Juden gehörte. Gern hätte er weitere Fragen gestellt, doch er hielt sich zurück.
»Nachdem du das brennende Kreuz einmal in der Hand gehalten hast«, erklärte ihm Walter nüchtern, »kannst du dir lebhaft vorstellen, was dir blüht, wenn du den Deckel des Sarkophags öffnest. Nur wenn du deine Gedanken zu einhundert Prozent beherrschst, hast du eine Chance, nicht auf der Stelle den Verstand zu verlieren.« Um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen, legte er behutsam die Hand auf die Schulter seines Kameraden. »Selbst erfahrene Templerbrüder können der Macht, die von seinem Inhalt ausgeht, nur kurze Zeit widerstehen. Wenn er in die falschen Hände gerät, könnte das nicht nur unser aller Ende bedeuten, darüber hinaus wäre auch die Wiederkehr unseres Erlösers in Gefahr.«
Sir Walter of Clifton ließ die unscheinbare Kiste, die im Innern mit Blei und Gold beschichtet war, um die Wirkung des Kreuzes nicht nach außen dringen zu lassen, in einer Seitentasche seines abgetragenen Eremitenumhangs verschwinden und wies dann mit einem Wink den ehemaligen walisischen Kommandeur an, den Brüdern weiter oben den Befehl zu erteilen, sie hochzuziehen. Er selbst verwischte unterdessen ihre Spuren.
»Warum ziehst du keine schützenden Handschuhe an, wenn du das Kreuz berührst?« fragte Totty, nachdem sie oben in der Krypta angekommen waren. »Ich meine, wenn es so heiß wird, dass man sich die Finger verbrennt«.
»Das würde nichts nützen. Die Macht verbindet sich mit meinen Gedanken, und nur bei direkter Berührung des Kreuzes kann ich sie besser in die gewünschte Richtung steuern«, antwortete ihm Walter. »Die Verbrennungen treten im Übrigen nur dann auf, wenn man die Macht des Kreuzes nicht zur Gänze beherrscht. Und ich will nicht behaupten, dass ich schon so perfekt darin wäre, wie John of Husflete es war.«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht, was du meinst«, sagte Totty und senkte beschämt den Kopf.
»Mach dir nichts draus, Bruder«, tröstete ihn Walter. »Solange du nicht gezwungen bist, vorzeitig meine Nachfolge anzutreten, ist es nicht nötig, dieses Mysterium vollkommen zu durchblicken. Und bis dahin hat uns Bruder John hoffentlich einen neuen Befehl zukommen lassen und erlöst uns von dieser schweren Bürde.«
Während Bruder Ralph am späten Nachmittag in Leith die Pferde besorgt hatte, war Roger of Stowe nach Edinburgh geritten und hatte dort gegen ein kleines Bestechungsgeld den Dienstplan der Stadtwachen inspiziert. Er erhielt die Information, dass in den frühen Morgenstunden ein Wachwechsel vorgesehen sei. Diesen konnten sie nutzen, um sich unbemerkt den Klostermauern zu nähern. Holyrood Abbey lag außerhalb der Stadtmauern und war somit leicht über den davorliegenden Àrd-thir Suidhe zu erreichen, einem weithin sichtbaren Hügel, auf dessen Höhe eine weitere Mönchsklause beheimatet war. Falls jemand auf die Idee kam, sie mitten in der Nacht zu kontrollieren, konnten sie als Mönche getarnt durchaus angeben, auf der Durchreise zu sein, um die dortigen Brüder zu besuchen. Auf diese Weise würden sie den Kerkermauern von Holyrood Abbey nahe genug kommen, ohne verdächtig zu erscheinen.
Nur mit einer einzigen Fackel versehen ritten sie durch die feuchtkalte Nacht, bis sie die Feuerkörbe auf den Stadtmauern von Edinburgh ausmachen konnten.
Die Wege rund um die Festung waren menschenleer und doch verspürte Sir Walter eine hartnäckige Anspannung. Mehr als vier Jahre waren vergangen, seit John of Husflete ihm bei seinem Abschied als Vertreter des Hohen Rates nicht nur Das Geheimnis des Glaubens, sondern auch das Artefakt des brennenden Kreuzes anvertraut hatte, zusammen mit dem Befehl, beides mit seinem Leben zu schützen und das Kreuz nur im äußersten Notfall und für Zwecke des Ordens zu nutzen. Seitdem hatte er das Kreuz erst einmal zum Einsatz gebracht, und dabei gleich gegen Bruder Johns Befehl verstoßen, als er einer jungen Frau zu Hilfe geeilt war. Sie sollte wegen eines Laibs Brot, den sie gestohlen hatte, im Nor Loch, einem See unterhalb der königlichen Festung von Edinburgh, ertränkt werden. Nicht etwa wegen des Diebstahls, sondern weil sie versucht hatte, dem Pranger zu entkommen, indem sie davongelaufen war, was die Todesstrafe bedeutete, wenn man wieder eingefangen wurde. Auf dem Weg von A’ Ghualainn, einer ehemaligen Templerkomturei östlich von Edinburgh, zu seiner Höhle, um das Kreuz an einen neuen, sicheren Ort in der Nähe seiner Eremitage zu verstecken, hatte Walter aus gebührender Entfernung die Vollstreckung des Urteils beobachtet und sich sogleich gefragt, ob und wie er der Frau helfen könnte. Er hatte sofort an das Kreuz gedacht, aber zu diesem Zeitpunkt war er mit dessen Wirkungsweise noch längst nicht bis in alle Einzelheiten vertraut gewesen. Und das, obwohl er vor den bereits eingeweihten Brüdern des Hohen Rates etliche Prüfungen hatte bestehen müssen, bis er das Kreuz das erste Mal in Händen hatte halten dürfen. Vor allem die Fähigkeit zur Kontemplation war von Bedeutung gewesen. Er hatte unter Beweis stellen müssen, dass er die Unterdrückung seiner Gedanken beherrschte und sich weder von Angst noch von Überschwang leiten ließ. Erst danach war es möglich, sich eine klare Vorstellung von dem zu verschaffen, was als Nächstes geschehen sollte, um die bestehende Wirklichkeit entsprechend zu beeinflussen.
Während Walter das grausige Spektakel am Ufer des Sees beobachtete, fielen ihm außer der johlenden Menschenmenge ein paar Kinder verschiedenen Alters auf, die völlig verstört am Ufer saßen. Blass und mit angstvollen Gesichtern verfolgten sie, wie die Verurteilte gefesselt und geknebelt an einen dicken Stecken gebunden von zwei starken Männern in die schmutzige Brühe getaucht und unter Wasser gehalten wurde. Dann zogen sie die Frau wieder hoch. Sie rührte sich nicht mehr. Die Kinder begannen zu weinen und wollten zu ihrer Mutter laufen. Doch der Henker hielt sie zurück.
Sir Walter war vor Ort geblieben, nachdem man den leblosen Körper der Frau der grölenden Menge überlassen hatte, die sich mit Fußtritten und anderen Handgreiflichkeiten persönlich davon überzeugte, dass sie auch tatsächlich tot war. Als sie sich nicht rührte, verlor der Pöbel das Interesse an ihr, und auch die Gerichtsbarkeit machte sich zu Sir Walters Überraschung kurze Zeit später davon. Den regungslosen Körper der Frau ließen sie einfach am Ufer des Lochs zurück. Vielleicht, um ihn den Angehörigen zur Beerdigung zu überlassen – oder den Schaulustigen zur Warnung.
Die völlig verstörten Kinder starrten derweil fassungslos auf den blau angelaufenen Leib ihrer Mutter.
Kaum, dass die Schergen und Gaffer verschwunden waren, machte Walter sich auf und untersuchte die Frau unter den Augen ihrer weinenden Kinder auf ein verbliebenes Lebenszeichen. Zu seiner großen Erleichterung wurde er fündig. Auch wenn sie nicht mehr atmete, so glaubte er doch unter seinen ausgestreckten Fingerkuppen ein schwaches Pulsieren ihrer Adern zu spüren. Er wusste, er würde mit dem, was er vorhatte, gegen alle Regeln verstoßen, aber er war überzeugt, ein gütiger Gott würde nichts anderes von ihm erwarten. Und so barg er den kalten Leib der Frau unter einem gewaltigen Busch, auf dem normalerweise die Wäscherinnen ihre Laken ausbreiteten. Noch einmal vergewisserte er sich, dass außer ihm und den Kindern niemand in der Nähe war, der ihn beobachten konnte. Dem ältesten Kind, einem schwarz gelockten Jungen, drückte er rasch ein paar Münzen in die Hand, mit der Bitte, er solle sich und seinen Geschwistern in der Stadt etwas zu Essen kaufen und danach nahe der Stadtmauer auf ihn warten. »So Gott der Allmächtige es zulässt, werde ich eure Mutter wohlbehalten zu euch zurückbringen«, erklärte er ihm, »aber ihr dürft mit niemandem darüber sprechen, verstanden?« Der Junge nickte wie betäubt und machte sich sogleich mit seinen Geschwistern davon.
Ein waghalsiges Versprechen, dachte Walter, während er ihnen für einen Moment hinterhersah, doch er hegte keinen Zweifel, dass die Macht, die er hütete, größer war als die Herzlosigkeit jener Menschen, die den Tod dieser Frau zu verantworten hatten.
Hastig befreite er das magische Artefakt aus seinem goldenen Käfig. Im ersten Moment brannten seine Handinnenflächen, als er es ans Tageslicht holte, wie zu Zeiten seiner Einweisung, doch je mehr er sich auf seine Gedanken konzentrierte und auf Gott vertraute, desto geringer empfand er den Schmerz. Behutsam berührte er mit dem Kreuz die Stirn der vermeintlich Toten und stellte sich mit geschlossenen Augen vor, wie sie zum Leben erwachte. Von einer mächtigen Kraft durchflutet, fuhr er mit dem Kreuz am leblosen Leib der Frau entlang und berührte sie an mehreren Stellen, den Kopf, die Brust und den Unterleib, in dem der Hort des Lebens beheimatet war. Immer wieder stellte er sich vor, wie das Blut durch ihre Adern pulsierte, denn im Gegensatz zu den meisten Zeitgenossen war ihm die Anatomie eines Menschen bis ins Kleinste vertraut. Walter betete inbrünstig zu Gott, dem Allmächtigen, wobei er seine Vorstellung, dass die Frau von neuem Leben durchflutet wurde, verstärkte. Ein plötzliches Husten und Würgen riss ihn aus seiner Trance und verursachte ihm heftige Schmerzen, die seine Brust durchzogen, und ihn krampfhaft nach Luft ringen ließen. Es zischte und es roch nach verbranntem Fleisch, als das Kreuz vor seinen Augen zu Boden fiel. Verdammt, er hatte sich unbeabsichtigt mit ihrem Geist verbunden, dabei seine Achtsamkeit verloren und sich ein weiteres Mal verbrannt. Doch das war zu vernachlässigen, weil die Frau inzwischen die Augen aufgeschlagen hatte und ihn immer noch hustend mit ihren blassblauen Iriden anstarrte, als ob er der Leibhaftige persönlich wäre. Noch bevor sie zu schreien begann, hielt er sie nieder und drückte ihr mit seinem versengten Handballen den Mund zu.
»Sch…«, machte er. »Ihr seid in Sicherheit und alles ist gut.«
»Seid Ihr der Teufel?«, krächzte sie panisch.
»Nein, bin ich nicht, und ich bin auch kein Engel, falls Ihr das meint«, versicherte er ihr mit rauer Stimme.
»Wo bin ich dann und wo sind meine Kinder?«, wisperte sie und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Kopf, während sie noch einmal stark hustete.
»Noch immer am Nor Loch und Ihr lebt. Und das habt Ihr nicht mir, sondern einzig Gott, dem Allmächtigen, zu verdanken.« Walter hätte am liebsten geschrien vor Glück. Doch stattdessen ließ er das Kreuz mit spitzen Fingern möglichst unauffällig in der Kiste verschwinden, damit die Frau von dessen Wirkung nicht beeinträchtigt wurde.
»Euer ältester Sohn wartet mit den anderen Kindern auf Euch, oben in der Stadt«, erklärte er der Frau mit einem zuversichtlichen Lächeln. »Ich habe ihnen ein paar Münzen gegeben, damit sie sich etwas zu essen kaufen können.«
»Dann seid Ihr doch ein Engel!«, bemerkte die Frau ehrfurchtsvoll.
»Nein«, sagte Walter und senkte bescheiden den Kopf. »Nur ein Mann, der im Auftrag des Herrn unterwegs ist.« Er räusperte sich, um das Gefühl der Enge in seiner Brust loszuwerden, das von seiner Verschmelzung mit dem Geist der Frau übrig geblieben war. »Was ist mit Euren Händen geschehen?«, fragte sie unvermittelt und starrte auf die purpurroten Brandblasen in seinen Handinnenflächen.
»Nichts«, antwortete er dumpf und half ihr trotz der anhaltenden Schmerzen auf. Denn es war nichts im Verhältnis zu der Dankbarkeit, die er empfand, den Kindern ihre Mutter zurückgeben zu können.
Ob er bei der Befreiung von Brian of Locton einen ähnlichen Erfolg haben würde, musste sich erst noch zeigen. Aber von seinen Vorgängern wusste er, dass Zweifeln nicht erlaubt war. Das Kreuz würde seine Gedanken verstärken, ganz gleich aus welcher Richtung sie kamen. Doch zunächst musste er es schaffen, allein mit seiner Vorstellungskraft eine meterdicke Mauer zu durchdringen. Denn nur dann war es ihnen möglich, den irischen Bruder aus den Fängen seiner Folterknechte zu befreien und seine Wunden zu heilen.
An einem Schwanenteich unterhalb der Klause machten er und seine Kameraden die Pferde an einer uralten Eiche fest. Die dort lebenden Wasservögel waren zum großen Teil bereits in den Süden aufgebrochen, wodurch sie unbehelligt und ohne warnendes Geschnatter in Richtung Abtei schleichen konnten. Der Nebel hatte sich zudem in der Nähe des Meeres gelichtet und eine aufgerissene Wolkendecke machte einem großen runden Vollmond Platz, der ihnen gnädig den Weg ausleuchtete.
»Besser könnte es gar nicht laufen«, bemerkte Totty leise, der dazu auserkoren worden war, Walter zu Fuß bis zu den südlichen Außenmauern der Abtei zu begleiten. Die anderen hielten derweil zwischen den Bäumen Wache.
»Wir sind noch nicht drin«, raunte Walter, der ahnte, was ihnen noch alles in die Quere kommen konnte, bevor sie Brian aus dieser Hölle befreit hatten.
Als sie die Mauer erreichten, hinter der Walter aufgrund seiner früheren Kerkerhaft Bruder Brian vermutete, befahl er Totty, zehn Schritte zurückzubleiben und die Umgebung im Auge zu behalten.
Im Innern der Abtei brannten mehrere Kerzen, deren Schein die bunten Glasfenster der Kapelle erhellte. Es war vollkommen still, nicht mal ein Hund bellte, als Walter im spärlichen Mondlicht die kleine Eichenholzkiste öffnete, und das Kreuz zum Vorschein kam. Die plötzliche Einflussnahme des Artefakts auf seinen Geist, die dem halb geöffneten Deckel entwich, fuhr ihm unvermittelt in die Glieder und ließ nicht nur ihn aufstöhnen, sondern auch Totty, der sich in einiger Entfernung den Kopf hielt. »Jesus Christus«, stöhnte er leise, »was ist das? Mir platzt gleich der Schädel!«
»Geh weg!«, zischte Walter und nahm allen Mut zusammen, um den Deckel gänzlich zu öffnen und das steinerne Kreuz aus der Kiste zu nehmen. Kaum hielt er es in der Hand, verschwamm die Umgebung vor seinen Augen zu einer wabernden Masse, während die Innenflächen seiner Rechten wie beim letzten Mal brannten, als ob er ein glühendes Eisen gefasst hielt. Sein Atem ging vor lauter Schmerz nur noch stoßweise und er hatte Mühe, sich ganz auf sein Vorhaben zu konzentrieren. Zugleich ergriff die gewaltige Macht des Gesteins gänzlich von seinem Bewusstsein Besitz. Nur unter größter Anstrengung gelang es ihm, sich zu konzentrieren. Sein starrer Blick fixierte das steinerne Mauerwerk und er stellte sich vor, wie es zur Seite wich. Unvermittelt verwandelte sich der harte Fels in eine wabernde Oberfläche, die sich wellenförmig bewegte, als ob man einen Stein ins Wasser geworfen hätte. Die Rotation wurde stärker und ein Durchbruch tat sich vor ihm auf, der ihm einen Einblick in das Innere der dahinter liegenden Kammer gewährte und ihm groß genug erschien, um hindurchschlüpfen zu können. Mutig wankte er mit dem Kreuz in der Hand voran, nicht einen Moment daran zweifelnd, dass der von ihm erzeugte Zustand der Mauer unverändert blieb. Nachdem er das Mauerwerk auf so wundersame Weise bezwungen hatte, trat er in den dahinter vermuteten Kerker ein, in dem er selbst einst wohlüberlegte Folterungen hatte ertragen müssen. Auf einer Pritsche im hintersten Winkel der entsprechend ausgerüsteten Kammer fand er Brian of Locton, bei dem nicht sicher gewesen war, ob man ihn tatsächlich hierher gebracht hatte. Halbnackt und seltsam verrenkt, lag er blutüberströmt auf einer Pritsche. In völlig zerfetzte Lumpen gehüllt, war er selbst bei näherer Betrachtung kaum wiederzuerkennen. Die Folterknechte hatten ihn furchtbar entstellt. Seine Beine und Arme standen merkwürdig vom Körper ab und sein Gesicht war so zertrümmert, dass er nur noch wenig mit dem Mann gemein hatte, den er seit Jahren gut kannte. Fast zeitgleich wurde Walter von einem gewaltigen Schmerz überrollt, als er sich in die Vorstellung vertiefte, den sterbenden Bruder unverzüglich heilen zu wollen und er ihn dafür mit dem Kreuz an den geschundensten Stellen berührte. Vergeblich kämpfte Walter gegen die grausigen Erinnerungen des irischen Bruders an, die sich ihm förmlich aufdrängten, als sein Geist sich wie von selbst mit dem seinen verband. Knochen knackten und Muskeln und Sehnen zerrissen, während die Folterknechte vergeblich versuchten, ihn auf der Streckbank zum Sprechen zu bringen. Dann tauchte schemenhaft ein blassblonder Inquisitor vor Walters geistigem Auge auf, der Brian mit gestelztem englischen Akzent der Gotteslästerung, des Verrats und der Zauberei bezichtigt hatte und die Herausgabe seines geheimen Wissens forderte.
Walter sammelte noch einmal seine geballte Aufmerksamkeit, um die Kontrolle über das Kreuz zu behalten. Ihm blieb nicht viel Zeit, den sterbenden Bruder ins Leben zurückzuholen. Zumal, wenn er von den ständig patrouillierenden Schergen der Inquisition nicht entdeckt werden wollte. Denn so viel wusste er bereits: Auch das Böse fühlte sich von der unglaublichen Kraft des Steins magisch angezogen.
Er betete so inbrünstig zu Gott, wie er es selten getan hatte, und konzentrierte sich, während er mit dem ausgestreckten Kreuz am zertrümmerten Nasenbein und den kaum erkennbaren Lippen des halbtoten Templers entlangfuhr, auf das frühere Aussehen des Bruders. Von Walters Entschlossenheit und der Kraft des Kreuzes durchflutet, verschoben sich Zähne und Knochen des geschundenen Bruders an ihre ursprünglichen Stellen, Muskeln und Haut regenerierten sich, die Lippen erblühten, Augen und Lider schwollen ab und fanden wie von Zauberhand in ihre frühere Form zurück. Gliedmaßen, Schulter und Hüftgelenke sprangen in ihre ursprünglichen Positionen und obwohl die unsäglichen Schmerzen des Mannes immer wieder bis zu seinem Bewusstsein vordrangen und die Haut an seinen Händen die bereits bekannten Brandblasen zeigte, fiel es Walter nicht leicht, den Überschwang seiner Gefühle zu unterdrücken. Doch er besann sich auf seine Fähigkeiten und sammelte seine Gedanken erneut, um die Mission erfolgreich zu Ende zu bringen. Erst recht, als Bruder Brian die Augen aufschlug, die so grün waren wie ein Lindenblatt und ihn entgegen allem Triumph anstarrten, als ob er ein fleischgewordener Albtraum wäre. »W…was…«, stotterte der gerettete Bruder.
»Wir müssen weg hier«, zischte Walter, für einen Moment abgelenkt.
»Wohin?«, fragte Brian nun verwundert und erhob sich schwankend, wobei er sich stöhnend den Kopf hielt und sein ungläubiger Blick auf all das Blut fiel, das seinen halbnackten Leib und die spärliche Kleidung bedeckte.
Auf dem Gang waren indessen schwere Schritte zu hören. »Wer da?«, brüllte eine laute Stimme, deren dumpfes Echo von den kahlen Wänden widerhallte. Walter fuhr herum, als die eisenbeschlagene Tür aufflog. Immer noch das Kreuz in der Hand sah er sich zwei düster dreinblickenden Gestalten gegenüber, die ihm mit gezogenen Schwertern entgegenstürmten. Instinktiv hielt er ihnen das Kreuz entgegen und versuchte die beiden aus seiner Vorstellung zu bannen. Doch stattdessen brach seine Konzentration vollkommen ab und er spürte, wie sein Geist von einer Welle dunkler Macht gestreift wurde, die von den beiden Widersachern ausging und durch das Kreuz nur noch verstärkt wurde. Er spürte, wie sich in seinem Geist eine unselige Blutrünstigkeit breit machte. Das war der Moment, vor dem er sich immer gefürchtet hatte. Nun würde sich beweisen, wie stark er im Glauben war. Falls er seine Konzentration nicht wiederherstellen und aufrechterhalten konnte, würden seine Gegner im Angesicht der Reliquie ebenso erstarken und die Oberhand über seine Gedankenwelt gewinnen. Er bemühte seine Erinnerungen an die Frau im Nor Loch und stellte sich vor, dass die Männer auf der Stelle ertranken, und tatsächlich begannen sie zu röcheln, wobei ihre Augen unnatürlich weit aus den Höhlen hervortraten, und ihre Zungen so weit hervorquollen, bis sie förmlich daran erstickten. Augenblicklich wurde Walter zusammen mit den Männern, zu deren Vorstellungswelt er offenbar eine unfreiwillige Verbindung hielt, in einen dunklen Tunnel gerissen, aus dem es kein Entrinnen zu geben schien. Er spürte, wie das Leben aus ihm hinauswich, in der gleichen Geschwindigkeit, wie es offenbar bei den beiden Schergen der Fall war. Er rang verzweifelt nach Luft und ging röchelnd zu Boden. Plötzlich bemerkte er eine Hand an seinem Arm, die ihn regelrecht ins Licht zerrte. Es war Brian, der ihm im Fallen das Kreuz aus der Hand gerissen hatte und es nun mit nur einer Hand fest umklammerte, seinerseits zu Tode erstarrt. Walter nahm all seine Kraft zusammen und sprang auf. Dabei nahm er Bruder Brian das Kreuz ab, was den jüngeren sofort aus seiner Erstarrung löste und gleichzeitig aufschreien ließ, weil er sich inzwischen bis aufs rohe Fleisch die Hände verbrannt hatte.
Ein kurzer Blick auf die beiden am Boden liegenden Wachen bestätigte Walter, dass die Männer tatsächlich tot waren. Rasch fing er sich wieder, packte seinen jüngeren Ordensbruder bei der Schulter und stieß ihn zurück zur Mauer, die sich unglücklicherweise inzwischen wieder geschlossen hatte.
»Wir kommen hier nicht raus«, stöhnte Brian und sah sich angsterfüllt um.
Davon unbeeindruckt konzentrierte sich Walter gedanklich auf einen sich öffnenden Durchgang, durch den sie beide entkommen konnten. Es kam ihm vor wie eine Ewigkeit, bis sich das Gestein vor seinen Augen endlich verflüssigte und einem Wasserstrudel gleich um eine kreisrunde Öffnung zu rotieren begann.
Ungläubig glotzte Brian auf das vor ihm stattfindende Geschehen, doch Walter ließ sich nicht irritieren und hielt seine Vorstellung aufrecht.
Seine Zuversicht wurde prompt belohnt, als das Loch in der Mauer so groß wurde, dass sie beide bequem hindurchschlüpfen konnten. »Geh!«, brüllte er dem völlig verdutzten Brian zu, der noch zögerte, weil er es offenbar nicht fassen konnte. Schließlich zog Walter ihn einfach mit sich und so stolperten sie gemeinsam durch den wabernden Durchgang hinaus in die kalte Nacht.
Draußen angekommen, warf Totty Brian unverzüglich einen schwarzen Umhang über und führte ihn im Dunkeln zu den Pferden. Mit letzter Kraft sorgte Walter dafür, dass sich das Loch in der Mauer wieder schloss und bettete dann das Kreuz mit einem tiefen Atemzug der Erleichterung zurück in die Kiste. Danach fiel er taumelnd ins feuchte Gras und blieb einen Moment lang keuchend liegen. Gierig sog er die kühle Meeresluft in seine Lungen und genoss den Geruch nach Fisch und Salz und der frischen Gischt des Wassers. Die verbrannten Handflächen krallte er in die feuchtkalten Halme der Wiese, was seinen Schmerzen ein wenig Linderung verschaffte. Als er endlich zu seinen Kameraden zurückkehrte und sah, wie Totty dem befreiten Bruder die Hände verband und ihm beruhigend auf den Rücken klopfte, unterdrückte Walter, von seinen Gefühlen überwältigt, vergeblich ein paar Tränen und fiel vor seinen überrascht dreinblickenden Kameraden auf die Knie, um zur Gottesmutter Maria für das Wunder zu beten, das ihm und seinen Brüdern soeben widerfahren war.
»Wir sollten längst weg sein«, mahnte Totty seinen Meister weitaus weniger beeindruckt, während er auch ihm die Hände mit sauberem Leinen umwickelte.
»Du hast recht«, sagte Walter und verzieh ihm den schroffen Ton, hatte er doch das meiste, was im Kerker geschehen war, im sicheren Abstand dazu nicht mitbekommen.
»Würde ich auch sagen«, fügte Ralph drängend hinzu. »In der Abtei ist es inzwischen verdammt lebendig geworden.«
Nach einem schnellen Ritt durch die Nacht verstaute Walter das Kreuz sorgfältig in jenem Versteck, aus dem er es hervorgeholt hatte.
Danach führte er die Brüder samt ihren Pferden wortlos zu seiner Einsiedelei.
Auf ein paar ausgebreiteten Ziegenfellen bat er die Männer Platz zu nehmen und schürte unter der gut zehn Fuß hohen Felsdecke ein kleines Feuer gegen die Kälte, aber auch, um den Kameraden einen heißen Wein anbieten zu können. Diesen goss er mit seinen verbundenen Händen aus einem Holzfässchen in einen gusseisernen Kessel und erwärmte ihn schließlich über den lodernden Flammen. Mit einem hölzernen Schöpflöffel füllte er die dampfende Flüssigkeit in Becher und kredenzte sie seinen Brüdern mit etwas Brot und Dörrfleisch.
»Auf dich Walter«, stimmte Totty eine Lobeshymne an »und deinen unerschrockenen Glauben.«
»Auf dich!«, prosteten die Männer im Chor.
Walter schüttelte den Kopf und hob nun seinerseits den Becher mit den Worten: »Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam! – Nicht uns o Herr, nicht uns, sondern dir gebührt die Ehre«.
Die Männer hoben ihre Becher erneut und wiederholten die uralte Templerlosung, die sie in den glorreichen Zeiten des Ordens gerufen hatten, um ihre Gemeinschaft und Kampfkraft zu stärken. Die Besorgnis verschwand nur langsam aus ihren Gesichtern. Besonders Bruder Brian war noch immer auffällig still, während Totty von den unerwarteten Möglichkeiten des Kreuzes zu schwärmen begann.
Demonstrativ hob Walter seine verbundenen Hände. »Halt ein, Bruder«, mahnte er, »wir dürfen das Kreuz nicht für unsere Zwecke missbrauchen. Die Geschehnisse heute waren eine Ausnahme.« Seine Hände waren stumme Zeugen der Gefährlichkeit dieser Gabe. Es würde mindestens eine Woche dauern, bis er wieder ein Schwert halten konnte.
»Eins verstehe ich nicht«, warf Totty beinahe trotzig ein. »Brian war halbtot und sieht nach der Behandlung mit dem Kreuz aus wie das blühende Leben, und doch trägt er wie du noch immer die Spuren der Verbrennung an den Händen.«
»Unser Herr Jesus hat auch den Menschen das Heil gebracht und selbst die Zeichen der Kreuzigung behalten«, lautete Walters kryptische Erklärung. »Es ist wohl der Preis dafür, dass wir uns mit Kräften einlassen, die wir nicht verstehen und denen wir in Wahrheit gar nicht gewachsen sind. Deshalb darf das Kreuz auch nur von jenen berührt werden, die es zu benutzen wissen. Ich wäre heute fast mit draufgegangen, als ich die beiden Wächter getötet habe.«
»Du hast das Kreuz benutzt, um jemanden zu töten?«, fragte Ralph erschrocken, und blickte zu ihm auf, wobei seine schwarze Mähne das halbe Gesicht verdeckte. »Wie hast du das denn gemacht? Du hattest doch kein Schwert in der Hand?«
»In meiner Vorstellung habe ich die Männer vor meinen Augen ertrinken lassen«, erklärte Walter leise und mit einem abwesenden Blick ins Feuer. »Und dann sind sie tatsächlich vor meinen Augen erstickt.«
»Beim Allmächtigen!«, rief der grauhaarige Roger und bekreuzigte sich. »Und was ist danach geschehen?«
Walter ließ die grausige Erinnerung noch einmal vor seinem geistigen Auge ablaufen und erschauerte. »Als sie starben, war ich mit ihnen im Geiste verbunden und hatte das Gefühl, mit ihnen in einen finsteren Abgrund gerissen zu werden«, erklärte er tonlos. »Wenn Brian nicht gewesen wäre und mir das Kreuz aus den Händen gerissen hätte, würde ich jetzt wohl in der gleichen Hölle schmoren wie die Folterknechte.«
»Hat Brian sich deshalb die Hände verbrannt?«, fragte der blasse Bruder Peter arglos.
»Ich wäre beinahe genauso gestorben«, brach der irische Bruder nun sein Schweigen. »Weil ich Bruder Walter das Kreuz abgenommen hatte und dann in den gleichen Abgrund gezogen wurde. Er hat mir ein zweites Mal das Leben gerettet, als er es wieder an sich genommen hat.«
»Wie kann das sein?«, wollte Totty wissen und fixierte Sir Walter mit seinen grünblauen Augen, deren Pupillen im Schein des Feuers nun groß und dunkel schimmerten.
»Der Stein verstärkt unsere Vorstellungskraft«, erklärte Sir Walter für alle. »Wer das Kreuz in Händen hält, verfügt nicht nur über die größte Macht, er ist auch gnadenlos dessen Einfluss ausgeliefert. Darüber hinaus bestimmt die Größe des Steins seine Wirkung. Er stellt nicht nur eine Brücke zu unseren innersten Wünschen her, er gibt uns außerdem die Fähigkeit, unsere Gedanken zu verwirklichen. Da diese bei gewöhnlichen Menschen normalerweise ziemlich unkontrolliert umherschwirren, bricht nicht nur in den uneingeweihten Köpfen das Chaos aus, sondern auch in deren Umgebung. Für jemanden, der nicht Herr seiner Gedanken ist oder fähig, seine Gefühle zu beherrschen, kann das ziemlich gefährlich werden. Aber auch für jene, die plötzlich unter dem Einfluss seiner kruden Vorstellungen stehen. Dass es dabei schnell zu Tod und Verdammnis kommen kann, wenn man sich nicht ausreichend konzentriert und seinen Verstand im Griff behält, habe ich heute Nacht am eigenen Leib erfahren müssen. Das ist der Grund, warum nur jene das Kreuz in die Hand nehmen dürfen, die reinen Herzens sind und sich als würdig erweisen.« Walter warf einen strengen Blick in die Runde und kniff die Lippen zusammen.
»Und nun zu dir, Bruder Brian«, begann er unvermittelt, »hast du eine Ahnung, warum die Schergen der Inquisition ausgerechnet dich ins Verhör genommen haben?«
»Nein, ich weiß es nicht, leider«, antwortete der irische Templer und nahm noch einen hastigen Schluck aus seinem Becher. Dabei schaute er immer noch ungläubig auf seine verbundenen Hände, die man ihm während der Folter mehrmals gebrochen hatte: weder spürte er etwas davon, noch dass die Verletzungen zu sehen waren. »Aber ich habe einen Verdacht. Der englische Inquisitor hat mich anhand einer Namensliste zu verschiedenen Brüdern befragt.«
»Was für eine Liste?« Walter schaute ihn abwartend an.
»Eine Liste von Brüdern, denen angeblich im Herbst 1307 aus unerklärlichen Gründen die Flucht aus der Festung von Chinon geglückt ist.«
Walter zog eine Braue hoch und atmete tief durch. »Wer sollte das sein, und wieso fragen sie ausgerechnet dich nach diesen Männern? Du warst doch seit Jahren nicht mehr in Franzien und auch nicht in Chinon inhaftiert, wenn ich es richtig verstanden habe.«
»Ich kannte diese Männer«, sagte er leise und führte langsam seinen Becher zum Mund, als wollte er Zeit gewinnen. »Nur wusste ich nicht, was aus ihnen geworden ist. Ich hielt es für möglich, dass sie alle umgekommen sind. Allein in Franzien haben mehr als fünfhundert Templer bei Folterungen ihr Leben gelassen. Woher hätte ich wissen sollen, dass sie nicht dabei waren?«
»Woher kanntest du sie?«, wollte Totty wissen, der vor Ungeduld seinen leeren Becher von einer Hand in die andere jonglierte.
»Mit einigen von ihnen habe ich im Jahre des Herrn 1301 meine Zeit als Novize auf Zypern verlebt. Gerard von Breydenbach, der an der Grenze zu Lothringen zu Hause war, Struan MacDhughaill, der von den schwarzen MacDhughaills of Islay abstammt und dessen Vater im vergangenen Jahr auf Seiten der Engländer in Bannockburn gefallen ist, Arnaud de Mirepaux, dessen Familie einen Herrschaftssitz im Langue d’oc besitzt«, zählte er auf. »Wir alle wurden nach knapp einem Jahr in Nikosia im Beisein von Jacques de Molay zu Templern auf Lebenszeit geweiht. Später haben wir an der Küste von Syrien gemeinsam gegen die Heiden gekämpft und im Herbst 1302 ist uns mit nur wenigen die Flucht von Antarados geglückt. Im Frühjahr 1303 wurden wir nach Bar-sur-Aube versetzt und haben unter Henri d’Our unseren Dienst verrichtet. Dort sind dann Bruder Johan und Bruder Stephano hinzugekommen, die allem Anschein nach auch in Chinon eingekerkert waren, wie auch d’Our selbst, der ebenso als verschwunden gilt.«
»Henri d’Our«, wiederholte Sir Walter leise und pfiff anerkennend durch die Zähne. »Er war einer von uns, wusstet ihr das?«
»Er gehörte zum Hohen Rat?«, fragte Totty erstaunt. »Welche Position hatte er inne?«
»Er war ein Turm. Wie ihr wisst, hat der Hohe Rat seine Mitglieder und deren Aufgaben mit Schachfiguren verglichen. Ich war lange Jahre ein Läufer, weil ich unsere geheimen Treffen organisiert und den Kontakt zwischen den Brüdern aufrechterhalten habe.«
»Und wer war der König?«, wollte Totty nun wissen.
»Jesus Christus«, antwortete Walter wie selbstverständlich. »Aber der kommt erst ins Spiel, wenn der Jüngste Tag bevorsteht und wir ihm Das Geheimnis des Glaubens übergeben. Die Dame hingegen ist für die Heilige Jungfrau Maria reserviert, auf deren Gnade der Orden stets angewiesen war. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.« Walter hielt einen Moment inne und nippte an seinem Wein.
»Und was war nun mit d’Our?« Michael sah ihn unverwandt an.
»Als verantwortlicher Komtur einer Ausbildungseinheit in der Champagne reiste d’Our mit seinen Ordensrittern kreuz und quer durch die Lande, um die Verbindung zu den in- und ausländischen Komtureien zu halten, aber auch, um den Papst auf seinen Reisen in Franzien zu schützen – eine Aufgabe, die ihm wahrlich nicht gedankt worden ist«, fügte Walter resigniert hinzu. »Dabei hatte er stets Kontakt zu den geheimen Mitgliedern des Hohen Rates. Soweit mir bekannt ist, hatte er eine ganz besondere Funktion. Er hütete das Schlüsselwort zum Haupt der Weisheit, das er einem weiteren Mittelsmann überbringen sollte, falls dessen Einsatz zum Schutz des Ordens erforderlich werden würde.«
»Also gab es das Haupt wirklich und d’Our hat seine Aufgabe offenbar vernachlässigt«, warf Totty verärgert dazwischen, der sich unter dem Begriff Haupt der Weisheit nicht viel vorstellen konnte, ihn aber durchaus schon gehört hatte. »Ansonsten hätten König Philipp und sein verängstigter Papst den Kampf nicht gewonnen und der Orden würde noch bestehen, oder sehe ich das falsch?«, fragte er Walter.
»Möglich«, bekannte dieser gedehnt, nicht sicher, ob er sich über ein weiteres Geheimnis des Ordens auslassen sollte, das er selbst nie zu Gesicht bekommen hatte. »Aber sicher weiß ich es nicht.« Gerüchteweise hatte er immer wieder etwas über das Haupt der Weisheit gehört, und in den Vernehmungen der Inquisition war er ständig nach einem kleinen silbernen Kopf gefragt worden, der angeblich sprechen konnte, aber selbst unter schlimmster Folter hätte er nichts darüber berichten können. Nicht nur, weil er es nicht gedurft hätte, sondern auch, weil er nichts Genaues wusste.
»Das bedeutet, du warst in die Sache nicht eingeweiht?« Michael starrte ihn ungläubig an. »Wie kann das sein, du warst doch ein Mitglied des Hohen Rates?«
»Sagen wir es mal so: Ich bin erst später in den Hohen Rat berufen worden und ich wusste darum, aber nichts darüber«, antwortete Walter wahrheitsgemäß. »Der Orden der Templer ist immer nach dem Prinzip verfahren, und tut es noch, nur diejenigen in Kenntnis zu setzen, die unmittelbar mit dem entsprechenden Mysterium befasst sind. Auch der Hohe Rat machte da keine Ausnahme.«
»Aber könnte es nicht sein, dass Totty recht hat?«, wandte Ralph mit verbitterter Miene ein.
»Wenn d’Our mit dem ominösen Haupt alles richtig gemacht hätte, wäre der Orden vielleicht heute noch existent?«
»Für uns gab es gute Gründe Das Geheimnis des Glaubens ebenfalls nicht zur Anwendung zu bringen, obwohl es sehr mächtig ist. Zu mächtig, um es ohne ein gewaltiges Risiko einzusetzen. Solange wir also nicht wissen, was wirklich hinter dem Begriff Haupt der Weisheit steht und wir nicht sicher sind, was genau geschehen ist, wäre es nicht fair, sich ein Urteil zu bilden«, erklärte ihm Walter geduldig. »Ich weiß nur, dass ein gewisser Bruder Rowan, der d’Ours Auftrag weiterführen sollte, nie von seiner Mission zurückgekehrt ist. Und von dem Haupt hat man seither auch nichts mehr gehört.«
»Welche Eigenschaften wurden diesem seltsamen Haupt denn zugesprochen?«, wollte Totty nun wissen.
Walter atmete tief ein, nicht sicher, ob er den unbestätigten Gerüchten, die bereits unter den Eingeweihten kursierten, ein weiteres hinzufügen sollte.
»Angeblich konnte man damit Raum und Zeit überwinden«, antwortete er beinahe gleichgültig, ganz so, als ob diese Eigenschaft nichts Besonderes wäre. »Aber ich habe es selbst noch nicht zu Gesicht bekommen und inzwischen gilt es ebenso als verschollen wie Henri d’Our und all seine Ordensritter. Von daher erscheint es mir mehr als brisant, dass der Inquisitor ausgerechnet an den von Brian genannten Männern interessiert ist.«
»Vielleicht sind sie mitsamt dem Haupt von der Festung entkommen«, bemerkte Bruder Peter. Er schien inzwischen so gut wie nichts mehr für unmöglich zu halten.
»Das Haupt befand sich zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr in Franzien«, erklärte Walter und deutete damit an, vielleicht doch mehr zu wissen, als er preisgeben wollte.
»Vielleicht sind sie auch alle nur tot«, fügte Bruder Michael ernüchtert hinzu. »Und dieses ominöse Haupt und seine angeblichen Wächter existieren nur noch in der Fantasie unserer habgierigen Feinde.«
»Aber was für ein Interesse sollte der englische Inquisitor an ein paar vermeintlich getöteten oder entkommenen Templern haben, wenn sonst nichts dahintersteckt?«, fragte Totty an Brian gerichtet. »Hat er noch irgendetwas anderes vorgebracht, außer der Liste?«
»Vielleicht sollte ich den Namen des englischen Inquisitors noch mal erwähnen«, fügte Brian sichtbar erschöpft hinzu, »Sir Gilbert of Gislingham. Er fragte mich gleich zu Beginn, als man mich auf die Streckbank gebunden hat, ob ich seinen Bruder gekannt hätte, Sir Guy of Gislingham. Er war wohl derjenige, der im Auftrag von Guillaume Imbert für die Folterungen der Templer auf der Festung von Chinon zuständig war. Er gilt seit dem Herbst 1307 ebenfalls als verschwunden. Offenbar wollte Sir Gilbert aus mir herausprügeln lassen, wer für das Verschwinden seines Bruders verantwortlich sein könnte. Guy war für eine Weile als Templer in Bar-sur-Aube, wie er mir erklärte. Aber ich konnte mich beim besten Willen nicht an ihn erinnern. Das muss nach meiner Zeit gewesen sein. Somit war ich vollkommen ratlos und schon allein aufgrund der anhaltenden Qualen nicht einmal in der Lage, etwas erfinden zu können.«
»Ich kenne Guy of Gislingham aus meiner Zeit im Tempel von London«, warf Walter verächtlich ein. »Damals war er just zum Tempelritter geweiht worden. Ein junger, arroganter Finsterling, dem alles Schottische zuwider war.«
»Und woher wusste dessen Bruder die Namen der gesuchten Brüder?« Totty versah Brian mit einem misstrauischen Blick.
»Aus Protokollen, die auf der Festung darüber Auskunft gaben, wer sich wann und zu welchem Zweck dort aufgehalten hat«, versicherte ihm Brian. »Ich nehme an, Sir Gilbert hat sie alle studiert, nachdem sein Bruder verschwunden blieb.«
»So, wie es aussieht, war Guy of Gislingham also nicht nur ein Spitzel des franzischen Königs, sondern auch ein Spion der Engländer«, gab Walter mit einem Schnauben zu bedenken. »Was nichts heißen will«, wandte Totty wenig überzeugt ein.
»Die Frage bleibt nur«, fügte Bruder Ralph an Brian gerichtet hinzu, »welche Verbindung es zwischen deinem Aufenthalt auf Antarados und dem Verschwinden der Brüder in Chinon gibt. Ich meine, da muss es doch irgendeinen nachvollziehbaren Hintergrund geben. Du warst nicht in Chinon, und auch nicht lange genug in Bar-sur-Aube, um in die dort gehüteten Geheimnisse eingeweiht zu werden. Wer auch immer es auf dich abgesehen hatte, musste wissen, dass du die verschwundenen Brüder gekannt hast.«
»Gab es etwas, das die Folterknechte über die Namensliste hinaus wissen wollten?« Roger spielte gedankenabwesend mit seinem Rosenkranz, während er Brian einen fragenden Blick zuwarf.
»Natürlich wollten sie in Erfahrung bringen, ob ich irgendetwas über einen Templerschatz weiß, der von einer geheimen Bruderschaft gehütet wird.«
»Und was hast du gesagt?« Bruder Michael schaute ihn auffordernd an.
»Sie hätten mich wohl kaum so zugerichtet«, antwortete Brian aufgebracht, »wenn ich ihnen irgendetwas verraten hätte.«
»Wer auch immer es auf dich abgesehen hatte, weiß etwas, das wir nicht wissen«, schob Sir Walter besorgt hinterher. »Wir müssen so bald wie möglich handeln. Nicht nur, weil unser weiteres Schicksal als Templer auf dem Spiel steht, sondern auch, weil das Schicksal der ganzen Welt in unseren Händen liegt.«
»Was wäre, wenn wir das verschollene Haupt suchten?«, schlug Bruder Peter wenig hilfreich vor. »Dann könnten wir den Sarkophag mit dem Geheimnis des Glaubens in einer Zeit verstecken, in der sein Inhalt sicherer wäre.«
»Abgesehen davon, dass niemand weiß, wo sich das Haupt derzeit befindet, sind das reine Spekulationen«, belehrte ihn Walter von neuem. »Bevor wir uns in fantastischen Geschichten verlieren, sollte uns etwas Brauchbares einfallen, um die Mysterien des Ordens zu schützen. Wenn Sir John nicht bis zum Jahresende zurückkehrt oder einen Boten schickt, werden wir seiner Route folgen, ohne seine Befehle abzuwarten. Wir können uns und das Versteck unseres Geheimnisses hier nicht mehr lange halten. Doch dafür benötigen wir weitaus mehr seetüchtige Templerbrüder, die uns bei den Vorbereitungen helfen, die es aber erst noch zu finden gilt.«
»Und wie gehen wir vor?« Totty schaute ihn ratlos an.
»Wir machen uns auf die Suche nach den Brüdern, die sich auf dieser ominösen Liste befinden«, entschied Sir Walter kurzerhand. »Du, Bruder Totty, machst dich auf und suchst die Familie des Struan MacDhughaill, um dort in Erfahrung zu bringen, ob er überhaupt noch lebt und wenn ja, wo er sich aufhalten könnte. Ich reise mit Bruder Brian in die deutschen Lande nach Köln. Zum einen, um unseren irischen Bruder für eine Weile aus der Schusslinie der schottisch-englischen Inquisition zu nehmen, zum anderen, um die dortigen Brüder für unser Vorhaben zu gewinnen. Ganz nebenbei fahnde ich nach Johan van Elk und Gero von Breydenbach. Bruder Ralph, du entsendest einen vertrauenswürdigen Boten ins Langue d’oc. Er soll eine Depesche ins Herrschaftsgebiet der Grafen von Mirepaux bringen, in der Bruder Arnaud eine Anlaufstelle in Schottland genannt wird. Dort kann er sich melden, falls er noch lebt und sich dort versteckt hält.«
Sir Walter stand auf und goss den Brüdern dampfenden Wein nach. Dann erhob er seinen Becher, um ihren gemeinsamen Auftrag zu besiegeln. »Auf die Heilige Jungfrau Maria«, sagte er mit heiserer Stimme. »Sie möge uns an allen Tagen beschützen und mit uns das Gute in dieser Welt.«
KAPITEL 1
HERBST 2005