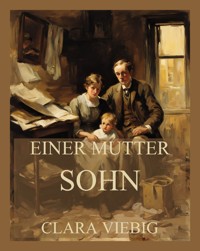Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts. Preußen besitzt an seiner damaligen Ostgrenze große vor allem von Polen besiedelte Gebiete, die nun "germanisiert" werden sollen. Bauer Peter Bräuer wandert, von den staatlichen Versprechen angelockt, vom Rheinland in jene Grenzgau aus. Während seine Frau und seine Tochter sich leicht in der neuen Heimat einleben und Sohn Valentin danach trachtet, sich durch die Heirat mit einer schönen Polin in der neuen Heimat zu verwurzeln, bleiben Peter Bräuer Land und Leute fremd. Und die Hochzeit des Sohnes bietet neuen Zündstoff ... Viebigs sozialkritischer und alles andere als deutschnationaler Roman, der den polnischen Landarbeitern und ihrem Konflikt mit dem Deutschen Reich viel Sympathie entgegenbringt, erntete von den deutschen Zeitgenossen heftige Kritik. Heute gilt es ein (fast) vergessenes Meisterwerk wiederzuentdecken.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Das schlafende Heer
Roman
Saga
Erstes Kapitel
Wie im Backofen die Brote, so bräunten sich jetzt die Landarbeiter in der glühenden, vor Hitze flimmernden Sommerluft. Auf den Hütten der Gutshörigen, die sich hinter den Steinwall duckten, lastete die Sonne. Heiss, unerträglich heiss war’s schon in der Frühe um vier; kein Tau war gefallen, der die Erde erquickt hätte. Dreist spiegelte sich das runde, tiefgelbe Sonnengesicht in den blanken Sensen und leckte mit seiner gierigen Zunge über das flache, schier endlos eintönige Land; über meilenweite Kornfelder, die schwer ihre reifenden Ähren neigten — über dunkelschollige Äcker, in deren fettem Boden, Pflanze an Pflanze gereiht, die Zuckerrübe wächst — über verstreute Herrenhöfe, die sich, durch Baumtrüppchen markiert, aus dem Meer der Felder herausheben — über wenige, dünnen Adern gleichende Strassen, die durchs ewig sich wiederholende staubige Grün der Rüben und staubige Gelb der Weizenfluren ziehen.
Von der Kreisstadt her, deren Strassen, kaum dass man sie verlassen hat, schon verschlungen sind von der Übermacht des Ackers, und deren Dom allein, als einziges Wahrzeichen, noch eine Weile über die Getreidewellen ragt, kam ein Gefährt. Eine kleine Britschka, mehr einem Karren als einem Wagen gleichend, überpackt mit Menschen. Und dahinter, in langsamerer, schwer-ratternder Fahrt, ein Leiterwagen, mit allem möglichen Haus- und Ackergerät belastet.
Der Mann auf dem Vordersitz der Britschka stiess jetzt den Kutscher, der, ihm vor den Füssen hockend, sehr geschickt auf der Deichselstange balancierte, fast hinab, so hastig drehte er sich um. Ihm war, als hätte hinten im Korbwagen jemand aufgeschluchzt. Was, fing die Frau schon jetzt mit Heulen an?!
„Kettchen!“ Er sagte es halb barsch, halb mitleidig, es war etwas Eigenes in dem Ton, der streng sein wollte und doch eine gewisse Bangigkeit in sich trug. Peter Bräuer fühlte selber ein seltsames Kribbeln in den Augen, die ihn schmerzten vom Sonnenbrand.
Zum Donnerwetter, dass auch hier gar kein Schatten war! Warum bepflanzten sie denn nicht die Chaussee mit Bäumen? Chaussee — hoppla, hat sich was mit Chaussee! Au, war das ein Stoss!
Verdriesslich schob Bräuer die Mütze, die ihm vom gewaltigen Ruck über einen Stein ganz auf den Hinterkopf gerutscht war, wieder nach vorn.
„Nennt ihr dat hierzuland en Chaussee? En ganz miserablen Landweg is dat ja“, brummte er und stiess den vor ihm Kauernden mit dem Knie in den Rücken.
Kein Muskel in dem stumpfen Gesicht des Kutschers regte sich. Er hob nur die Peitsche und liess sie mechanisch auf den grau bestaubten breiten Rücken des Braunen niederschwippen:
„Huj, het!“
„Peter“, bat jetzt die Frau in der Britschka, „sag ihm doch, er soll wat ruhiger fahren. Mer is dat gar nit so gewöhnt. Mir tun als so schon alle Knochen weh von dem lange Eisenbahnfahren. Sei so gut, sag et ihm doch!“
„Fahrt langsamer, fahrt langsamer!“
„Huj, huj, het!“ Der Kutscher hieb wie toll auf das sowieso schon unruhige, von Stechfliegen gepeinigte Pferd ein.
„Hört Ihr denn nit? Langsamer!“ schrie Peter Bräuer und fasste ihm über die Schulter in die Zügel. Hinter sich hörte er sein Weib und seine Kinder laut aufkreischen und sein Jüngstes, das der heftige Ruck beim jähen Anziehen des Pferdes aus dem Schlafe geschreckt, jämmerlich weinen. Der Zorn kam ihn an: der Esel mit seinem einfältigen Huihet!
Unsanft packte er den Kutscher an: „He, Polack, habt Ihr denn keine Ohren?“
Der zuckte nur stumm die Achseln und spuckte aus.
Weiter ging es wie bisher, über Steine und durch Löcher.
Die Sonne sengte. Noch war nicht das erste Dorf in Sicht, und zwei Dörfer musste man passieren, bis ganz hinten auf der Fläche, wie winziges Spielzeug unterm riesenweiten Horizont, die Häuschen der Ansiedlung auftauchen würden, mit ihren Zäunen von unbehauenen Fichtenstämmchen, mit ihren Äckerchen rundum, die noch nicht teilhatten an der Fülle des Sommers.
Peter Bräuer schob sich die Mütze auf dem Kopfe hin und her und rutschte unruhig auf seinem Sitz. Hm, was die Frau wohl dazu sagen würde? Ach je! Er war nicht ohne Besorgnis. Und merkwürdig, so weit und unbequem war ihm der Weg von der Bahnstation bis zur Ansiedlung noch nie erschienen! Und er hatte ihn doch schon ein paarmal gemacht in den acht Tagen, die er nun hier war. Das erstemal, als der Herr Gutsverwalter selber ihn von der Kreisstadt abgeholt und ihn hinausgefahren hatte, ihm die schriftlich erstandene Stelle zu weisen, hatte ihn Neugier beseelt, eine schier freudige Erregung; da war es ihm gewesen, als führe ihn der, der ihm so klar alle Vorteile des Ankaufs auseinandersetzte, in ein gelobtes Land. Es schien ihm sicher: mit Fleiss und Arbeit musste es hier gelingen, der Boden würde schon wiederzahlen, was man hineinsteckte an Kraft. Natürlich, das war ja ausser aller Frage!
Peter Bräuer reckte sich in seiner ganzen Stattlichkeit, und dann klopfte er, wie prüfend, seinen gewölbten Brustkasten: hei, er war doch noch ein Tüchtiger, trotz seiner Fünfzig, er nahm’s noch mit jedem von hierzuland, und war der auch zwanzig Jahre jünger, leicht auf!
Kritisch betrachtete er den halb eingeduselten Kutscher: hatte wohl Schnaps gesoffen, Wudka — wie sie den puren Kartoffelfusel nennen —, dass er am hellichten Tage schlief?! Ein verächtliches Lächeln zog des starken Mannes Mundwinkel herab, aber gleich wurde sein Gesicht wieder ernst: ’s war doch keine Kleinigkeit, mit fünfzig Jahren noch einmal von vorn anzufangen, noch dazu im fremden Land!
Was ihn vor acht Tagen, an der Seite seines beredten Führers, freundlich angesehn, dünkte ihn jetzt gewandelt. Blitzte ihn nicht der Himmel, der sich wolkenlos, stahlblau, ehern ob der hartgebrannten Erde spannte, so grimmig an, dass er die Blicke senken musste?
Bah — er rieb sich ungeduldig die Augen — nur nicht zag! Warum denn bange sein? Es hatte ihn ja auch bisher noch kein banger Gedanke beschlichen, auch nicht, als er zum zweitenmal allein dieses Weges gekommen. Da war er sogar die vier Stunden zu Fuss hinausgewandert und hatte sich, obwohl ermüdet, gleich ans Werk gemacht, hatte seine Stelle abgeschritten und sich den passendsten Platz zum Bau des Gehöfts ausgesucht. Ein Brunnen war schon vorhanden; aber dass er sich nicht auch das Haus von der Kommission hatte herstellen lassen, das reute ihn nicht. Nein, eines, akkurat so wie alle andern, so eine viereckige Dose, in die man Käfer sperrt — oder gar Stall und Scheune mit unter einem Dach —, so eines stand ihm denn doch nicht an! Und kein Baum, kein Strauch, kein Garten dabei, nicht einmal eine grüne Bleiche, auf der die Hausfrau das Leinen spreiten konnte, das passte ihm auch nicht! Nein, ein hübsches rheinisches Bauernhaus sollte es werden — ob weiss, ob wasserblau oder rosenrot getüncht, darüber war er sich noch nicht schlüssig —, ein Rebstock musste am Giebel sein, der sich bis zum Dachfensterchen reckte, dass man droben wie aus einem grünen Rahmen schauen konnte, hin zu den Sieben-Bergen jenseits des Stromes.
Ach, die Sieben-Berge — ein weicherer Ausdruck glitt über des Auswanderers hartes Gesicht —, die würde man nun freilich hier nicht zu sehen kriegen! Aber ein Gärtchen wenigstens würde da sein mit einer Laube, um die das Geissblatt am warmen Abend duftete; und Pflaumenbäume würden wachsen und Aprikosen am Spalier, dass die Frau was einzukochen hatte zum Schmierchen für die Kinder.
„Och, sieh ens, Peter! Kein einziger Apfelbaum steht hier im Feld“, sagte die Frau jetzt hinter ihm. Da schreckte er zusammen.
Frau Bräuer stellte sich aufrecht, mit beiden Händen stützte sie sich auf ihres Mannes Schultern, um so einen Halt zu haben im hin und her schleudernden Gefährt. Halb neugierige, halb ängstliche Blicke liess sie über die sonnenflimmernde Ebene schweifen. „Schöne Felder! Jesus, wat en Korn! So’n Felder gibt es bei uns zu Haus doch nit. Sag, wem gehören die?“
Er zuckte die Achseln: „Weiss ich nit!“
„Och Gott!“ — wie in einem plötzlichen Schmerz zog das Weib die Brauen zusammen — „dat weiss mer nit? Och ja, wat is dat doch all so — so — keine Häusches, keine Dörfches — Jesus, wat is dat all so leer!“
„No, dat kannste doch wahrhaftig nit sagen!“ Er versuchte ein heiteres Auflachen. „Sperr doch deine Augen auf! Du hast et ja selber gesagt: haste je so viel Korn auf einem Haufen gesehen? Kuck emal da, hier rechts, den Schlag Weizen! Kotzdonner, mindestens hundert Morgen sind dat — immerfort Weizen, un so schön von Farb! Als ganz dunkelgoldig. Et is en Staat! Hier links hat Roggen gestanden, den haben sie als geschnitten. Kuck einer an, den Staatsklee drunter! Brrr!“
Er fasste wieder über den Kutscher weg nach den Zügeln und war dann mit einem Plumps vom Wagen. Schon trappste er jenseits des tiefen Grabens in die Stoppel. Und jetzt stand er wieder bei seiner Frau und hielt ihr eine Faust hastig ausgerupften Klees unter die Nase.
„En Mass Vierblätter drunter! Und so fett! Wart, wann wir erst so ’ne haben! Dann biste auch vergnügt, gelt, Kettchen?!“
„Ja, och ja!“ Hastig nickte sie, aber sie vermied seinen Blick, der fragend den ihren suchte. Sie hatte ihren Mann nicht ansehen können; Tränen füllten ihre Augen, der strahlende Tag im wolkenlosen Mittagsglanz war ihr verdunkelt. Sie war froh, als Peter sich wieder vorn auf den Sitz schwang.
Und weiter ging die Fahrt, immer weiter durch die Endlosigkeit der reifenden Felder. Da stand Gerste, da Hafer — hoher, reichbesetzter Hafer, wie schwere Tränen hingen die Körner an der sich bleichenden Fahne — aber meist Weizen, Weizen so weit, dass dem Auge das tiefe Gold sich im gläsernen Blau des Himmels zu verlieren schien.
Hier musste bald geschnitten werden! Bräuer hielt prüfend Umschau: Herrgott, was war hier zu schaffen! Unwillkürlich wischte er sich den Schweiss von der Stirn. Es reichten Tausende von Händen nicht zu, all dieses Korn zu schneiden, zu binden, aufzusetzen, zu verladen, heimzuführen in die Scheunen. Und hier gab’s auch riesige Rübenfelder. Wenn deren Ernte auch noch lange ausstand: behackt will die Rübe auch sein, bepflügt und behäufelt.
„Frau, Kettchen“, rief er ganz aufgeregt, „siehste all die Zuckerrüben? Hierzuland kannste billig Zucker in deinen Kaffee tun! Donnerwetter, is da aber en Unkraut zwischen. Da müssten mal so en Stücker hundert Arbeiter ’erein. Hau, is dat noch en Arbeit!“
„Mer sieht ja hier gar kein Leut“, sagte die Frau leise; ihre Stimme klang gepresst. Die Hand über die Augen haltend, spähte sie in die Ferne mit einem unruhig suchenden Blick. Kam die Ansiedlung denn noch nicht?! So weit waren sie nun schon gefahren! Doppelt weit kam ihr diese Wagenfahrt vor; nun sie dem Ziele so nahe, deuchten sie diese letzten paar Stunden schier länger als die ganzen Tage der Eisenbahnfahrt vom fernen Rhein bis in die östliche Provinz.
Wie mochte Pociecha aussehen? Gab’s da Wälder, Berge, einen Fluss? Nein, aber Bäume würden dort sein. Peter hatte gesagt, dass ein Dorf ganz nah sei, ein altes Dorf; es gab da sicher Gärten mit alten, breiten, vielästigen Obstbäumen. Eine wahre Sehnsucht nach Schatten, nach Bäumerauschen ergriff die in Hitze und Seelenunruhe fiebernde Frau.
Wohin führte der Peter sie? So weit in die Fremde! Und wie würden die Kinder sich schicken? Voll zärtlicher Sorge wendete die Mutter ihre Augen auf die Kinder — lauter Blondköpfe waren es, zehn, acht, sieben und zwei Jahre alt — Settchen, Maria, Lena und das kleine Stinchen. Frau Kettchen hielt nicht viel vom Studieren, aber schön schreiben und auch richtig schreiben mussten sie doch lernen und hell singen und brav beten. Ob sie das hier auch alles lernen konnten?!
Der Mutter Blick suchte den Himmel: ach, der sah so verschlossen, so eisern aus wie ein blanker Schild, an dem selbst die Gebete, gestammelt von der Unschuldigen Mund, abprallen! Mit leicht zitternder Hand fuhr sie über einen lieben Kopf nach dem andern.
Schlaftrunken, übermüdet rekelten sich die Kinder. Ihre blonden Häuptchen hingen matt und nickten willenlos hin und her wie schwere Ähren im Wind. Beim nächsten heftigen Rädergerumpel rutschten alle vier vom unbequemen Sitz; da lagen sie zusammen auf einem Häufchen am Boden der Britschka.
Die armen Kinder! Frau Kettchen suchte sie zu ermuntern, aber dann gab sie’s auf: es war das beste, sie schliefen; zu sehen gab’s doch immer nur dieselbe gleiche, eintönige Weite! Ein Gefühl unendlicher Vereinsamung durchschauerte sie plötzlich, fast überlaut stiess sie heraus: „Peter, Peter!“
„Wat denn, Kettchen?“ Er drehte sich rasch nach ihr um, ihre Stimme hatte so verängstigt geklungen. „Is dir wat, Kettchen?“
„Och nix!“ Sie schämte sich. Sie hätte es ihm ja auch gar nicht beschreiben können, wie ihr zumute war, nun sie immer weiter und weiter fortkamen von der Station, wo doch wenigstens die Lokomotive schnaufte und dampfte, die sie der Heimat entführt, die sie aber wieder dorthin bringen konnte, dorthin, wo der Rhein fliesst. War ihr nicht jetzt so, als läge die Welt und alles, was gut und schön und glücklich war, hundert Millionen Meilen weit hinter ihr? Sie schwebte in einem ungeheuren Raum, in dem ihr tastender Fuss keinen Boden, ihre suchende Seele keinen Halt fand.
„Peter, sind wir denn noch nit bald da?!“
„Nur noch en klein Stund!“ tröstete er. „Dat erste Dorf kömmt jetzt gleich. Siehste, da is als Mais!“ Er wies ihr die hohen, tiefgrünen Maisstauden, deren Fruchtkolben noch von weisslichen, löffelförmigen Blättern verhüllt waren, mit deren seidenfädigen Schweifen, die im Sonnenlicht wie silbernes Haar glänzten, aber das heisse Sommerlüftchen winkend wehte.
„Da dervon bauen wir uns auch wat an für die Hühner“, sagte er, „da legen sie gut nach. Un für die Schwein is dat überhaupt ’ne Leckerbissen. Du sollst emal sehen, wat du für Eier nach der Stadt verkaufen kannst!“
„Och“ — ein wehmütiges Lächeln spielte um ihren Mund — „dat is doch nit wie bei uns zu Haus? Wie soll ich denn hier nach der Stadt kommen? Die is ja viel zu weit!“
Aber gleich darauf machten sie doch miteinander Pläne: wenn sie erst Pferd und Wagen hatten, dann ging das doch! Oder noch besser, wenn erst die Eisenbahn fuhr — in einem oder spätestens zwei Jahren hatte man die ja, schon war die Strecke abgesteckt, Peter hatte es selber gesehen —, dann konnte der Valentin leicht, immer regelmässig zweimal die Woche, nach der Stadt fahren. Wo steckte übrigens der Junge? Bis vor kurzem noch war der Leiterwagen immer in Sicht gewesen, nun war er auf einmal ganz zurückgeblieben.
Besorgt schaute der Vater aus. Aber sosehr er auch spähte, nichts war zu sehen als das Wogen goldenen Korns und das Sonnengeflimmer zwischen Erde und Himmel. Dem Jungen würde doch kein Malheur passiert sein?! Er war an solche Wege nicht gewöhnt und auch nicht an diese Rackers von Pferden. Bräuer machte sich Vorwürfe: hätte er doch lieber in der Stadt einen Kutscher auch für den Leiterwagen gedungen, anstatt auf den Valentin zu hören, der gemeint hatte, fahren könne er noch leicht so gut wie hier einer. Nun war bei der verdammten Rumpelei gewiss eine Speiche gebrochen, oder der Wagen war in einem Loch steckengeblieben, lag vielleicht gar zur Seite in einem tiefen Graben?! ’s war hier keine so glatte Chaussee wie daheim längs des Rheins, auf der die Gäule nur immer so von selber dahintrabten, als machte es auch ihnen ein heilloses Pläsier.
Das konnte eine schöne Bescherung geben! Nun, vorderhand musste man erst noch mal geduldig ein wenig warten!
Auf den Ruf, den der Vater zurückschickte, kam keine Antwort. Die Britschka hielt an. Die Sonne prallte.
„Fahr ein bissken im Schatten“, bat die Frau.
Schatten, wo war der?! Kein Baum, kein Gebüsch, nichts Ragendes in der ganzen Runde.
Doch, halt, dort in der Biegung des Seitenwegs, was war das?!
„Peter, och, kuck da!“ Fast jubelnd streckte die Frau beide Hände aus.
Da stand ein Heiligenhäuschen, frisch getüncht, mitten im goldenen Korn; die Ähren streichelten seine rissigen Mauern. Wie ein Backofen sah sich’s an in seiner rund gewölbten Buckelform; aber wo man sonst die Brote einschiebt, standen hier drei Steinpüppchen in der Nische, nicht mehr erkenntlich, Steinklümpchen gleich, die tausend Jahre im Acker gelegen. Ein Pflüger hatte sie wohl aufgepflügt, und jetzt standen sie am Sonnenlicht in der Nische, und des gläubigen Volkes Hände hatten die Heiligen mit Flittern und Papierrosen, mit welkenden Sträusschen von Mohn und Kornblumen geehrt.
„Och, Peter, kuck, kuck!“ Die Frau strebte vom Wagen, der Mann musste ihr herunterhelfen. Es zog sie allmächtig zu jener Nische — ach, wenigstens etwas war hier so wie daheim!
Auf die Knie sinkend, sich bekreuzend und fromm die Hände hebend zum Himmel, der ihr nun auf einmal doch nicht verschlossen schien, murmelte sie jenes Gebet, das sie daheim vielhundertmal gebetet:
„Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnaden …“
Und die Kinder, aufgeweckt von vertrauten Klängen, falteten auch ihre Händchen und stammelten mit.
Vom polnischen Dorf, vergraben hinter Kornwellen, kam jetzt dünnes Mittagsgeläut. Der Kutscher zog den runden Hut und bekreuzte sich, sich so tief dabei verneigend, als strebe er mit der Stirn zur Erde.
Peter Bräuer stand dabei und guckte ein wenig verdutzt von seiner Frau zum Kutscher und von diesem wieder hin zu jener: Sieh mal einer an, der Polack betete ja auch!
Und plötzlich zog es auch ihn hin zu der kleinen Nische — eine Hand hatte ihn berührt, die reichte vom fernen West bis zum fernen Ost. Rasch neben seine Frau tretend, beugte er das Haupt.
Peitschengeknall und ein heller Pfiff schreckte die gläubig Versunkenen auf. Mit Gerassel und Gepolter kam der Leiterwagen angefahren. Valentin stand aufrecht darin und hieb lustig auf die schnaubenden Gäule.
„He, Vater!“
„Endlich, Jung! Ich kriegt et als mit der Angst!“
Peter Bräuer stiess einen erleichterten Seufzer aus: Gott sei Dank, da war kein Malheur passiert! Die kleinen Schwestern in der Britschka erhoben ein helles Jubelgeschrei, als sie den grossen Bruder sahen.
„No, wat denn?“ Der hübsche Bursche, dem eine noch unvertragene Soldatenmütze verwegen auf dem Krauskopf sass, zeigte lachend seine gesunden Zähne. „Habt ihr als gedacht, ich wär verlorengegangen? Nee — haha — so rasch nit!“
„Nee, aber man is doch hier fremd“, entschuldigte Frau Kettchen und sah ihren grossen Stiefsohn freundlich an. „Ich glaub, der Vater hatt’ als Angst, du hättst Malör gehabt!“
Valentin lachte wieder. „Dat hätt’ ich auch leicht gekonnt. Ich denk an nix, auf einmal machen die Pferd ’ne Satz, dat se mir die Zügel aus der Hand reissen. Rechts aus dem Korn springen der Mädchen Stücker zehn, zwölf — wie ’n Volk Rebhühner — husch — über die Strass in ’t Rübenfeld links. Ich glaub, se hatten ihr Mittagsschläfchen gehalten im hohen Korn. Ich schimpf — sie lachen. Mutter, du glaubst et gar nit, wie die so frech waren! In eins fort gelacht, und sowie ich wat gesagt hab, haben se noch viel mehr gelacht!“ Jetzt schmunzelte der junge Mensch behaglich in sich hinein. „Un dann haben se mir Kusshändches geschmissen un allerlei gerufen, wat ich nit verstehen könnt. ‚Demibuschi‘ un so wat! Weisste, Vater, polnisch müsste mer hier eigentlich doch können!“
„Unsinn, no, auch noch!“ Bräuer konnte sich ordentlich ärgern. „Lass se doch deutsch sprechen! Un nu voran!“
Staubwolken wirbelten, Hunde kläfften; Kinder, die, nur mit einem Hemdchen bekleidet, halbnackt zwischen den Schweinen auf der Strasse herumwuselten, schrien gellend hinter den Wagen drein, die das Dorf passierten.
Frau Kettchen machte grosse Augen: gepflastert war hier nicht! O weh, wenn’s hier regnete, tunkte man ja ein bis über die Knöchel! Unwillkürlich fasste sie nach ihren sauberen Röcken.
Im grossen Pfuhl, den die durstige Sommersonne halb ausgetrocknet hatte, wuschen Weiber ihre Wäsche zwischen dem grünschleimigen Entengries. Überm blanken Hemd nur einen kurzen Kattunrock, aber alle das anliegende Mützchen fest um die Ohren gebunden, schauten sie wenig freundlich den rasselnden Gefährten nach: Aha, wieder neue!
Bräuers Kinder quälten die Eltern mit Fragen: War das ein Dorf? Doch nicht das Dorf, wo sie hinsollten?! Kam das denn noch immer, noch immer nicht?
Aber als die letzte der aus grauem Lehm zusammengepatzten niedrigen Hütten mit ihrem, dem Staub der Strasse ähnelnden, graubraunen Strohdach verschwunden war, schloss ihnen die gleissende Monotonie der Felder bald wieder den Mund.
Frau Kettchens Gemüt, das sich noch eben im Gebet aufgerichtet hatte, wurde wieder niedergedrückt — also das war ein Dorf?! Die Hände im Schoss verschlingend, starrte sie trübe vor sich hin.
Die Stimme ihres Mannes schreckte sie auf. Peter Bräuer rief seinen Sohn an. Ein Zug nahte aus östlicher Richtung. Buntgescheckt, wie aus allerlei Flicken zusammengelappt, schob er sich heran durchs sonnige Gelb.
Frau Kettchen reckte den Hals: Wer waren die Männer im roten Hemd, Sensen auf der Schulter? Woher kamen die Weiber, müde dahinzockelnd, wie Lasttiere beladen mit Sack und Pack? Waren das etwa Zigeuner? Ängstlich sah sie auf ihre Blondköpfe — Zigeuner sollten doch Kinder stehlen — und dann nach ihrem Leiterwagen, der das erste unentbehrlichste Gerät enthielt.
„Wanderarbeiter“, sagte Peter Bräuer und beschattete die Augen mit der Hand, um besser ausschauen zu können. „Die kommen ’rüber von Russisch-Polen. Gott bewahr uns, sind denn noch nit genug Polacken hier?! So’n Gesindel! Aber, ich hab’t gehört, selbst der deutsche Herr in Przyborowo soll ihrer welche zum Schnitt gedungen haben!“
„Och, die Weiber, wat die sich abschleppen!“ Frau Kettchens Stimme klang mitleidig, und als sie ein paar Halbwüchsige sah, die ins Korn liefen, Ähren abrupften und gierig Körner daraus assen, fing sie an, im Körbchen, das ihr zu Füssen stand, zu kramen. „Die sind hungrig, mer könnt ihnen doch wat zu essen geben! Uns’ Kinder sind ja als satt.“
Aber ihr Mann verwies es ihr: „Lass dich mit denen nit ein. Die arbeiten im Akkord, die verdienen genug. Im Winter tun se alles verjuxen!“
Doch sie konnte den Blick nicht wenden.
Näher und näher kam der Trupp, langsamen, aber durch seine Stetigkeit unaufhaltsam fördernden Schrittes. All die stumpfen Gesichter mit den breiten Backenknochen glänzten braunrot vom Sonnenbrand.
Am hölzernen Weiser, der dort, wo der breite Fahrweg sich in noch drei andere fahrbare Strassen verzweigt, seine Kreuzesarme reckt, stiessen die Wanderer zusammen.
Der stumme Kutscher der Britschka hielt an. Der vorderste der Sensenmänner war vor den Wagen getreten; den Hut bis zur Erde ziehend, schien er nach dem Weg zu fragen.
Bräuer wunderte sich: konnte er denn nicht lesen? Da stand’s doch gross und breit, deutlich an jedem Kreuzesarm, wohin!
„Chwaliborczyce“, belehrte der jetzt plötzlich lebhaft gewordene Kutscher, und wies nach rechts — und dann ein wenig nach links: „Niemczyce“ — und dann ganz nach links: „Przyborowo!“
„Przyborowo — Przyborowo!“ Mit einem Aufatmen der Erleichterung wiederholte das die ganze Schar.
Mochten die müde sein! Frau Kettchens blaue Augen musterten die braunen Weiber: ach je, die waren ja alle noch ganz jung, nur eine Alte war dabei.
Die Weiber wiederum musterten sie. Plötzlich trat eine der Braunen, der das rote Kopftuch in einer spitzen Falte über die Stirn vorstand, dicht an die Britschka, haschte nach dem Kleid der darin Aufrechtstehenden und drückte es demütig an die Lippen. Aus dem an den vier Zipfeln zusammengebundenen Leintuch, das ihr schwer auf dem Rücken hing und ihre Schultern vordrückte, guckte neben dem irdenen Zwillingstopf zum Essentragen, neben einer Kesseltülle, einer Hacke und einem Löffelstiel, in ein Bettkissen eingebündelt ein Kinderköpfchen. Allen Strahlen der Sonne preisgegeben, schlief der Säugling, beperlt von Schweiss.
Begehrlich funkelten die Augen der jungen Mutter. Hastig langte Frau Kettchen nach ihrem Körbchen: ach, wie mochte der Armen zumute sein! Und sie teilte aus in die ausgestreckten Hände, denn auch die andern Weiber hatten sich hinzugedrängt. Alle Müdigkeit schien plötzlich von den erschöpften Gestalten gewichen, die bei der Anstrengung des Wanderns zusammengepressten Lippen hatten sich, glückselig lachend, geteilt; Dankesbeteuerungen und Segnungen, von denen die deutsche Frau nichts verstand, rauschten nur so dahin.
Peter Bräuer hatte seine Frau gewähren lassen; ihn interessierten die Männer, diese untersetzten, muskulösen, sehnigen Gestalten. Also so sahen die aus?! Hm! Sahen schon aus, als ob sie arbeiten könnten. Aber in Arbeit nehmen durfte man die drum doch nicht — nur nicht! Es war eine Gefahr, dass die sich hier festsetzten.
Die Herren hatten schon ganz recht, in der Zeitung, die man ihm zugestellt hatte, zu schreiben: ‚Weg mit ihnen, deutsche Arbeiter her! Nur dann wird man deutsches Land haben, und alles‘ — — — —
„No, wat is denn?“ Ein Zetergeschrei hatte Bräuers Betrachtungen gestört.
Die Halbwüchsigen, die sich im Korn verloren hatten, kamen schreiend angerannt: „Poludnica, poludnica!“ Und die Weiber griffen den Schreckensruf auf und gaben sämtlich Fersengeld.
Die Männer blieben zwar stehen, aber auch sie blickten beunruhigt: war da etwa das Mittagsgespenst, die Poludnica, die, wenn die Sonne hoch steht, durchs Korn streicht, um darin herumstreifende Kinder zu fangen?
Gen Niemczyce zu schlug das Korn im heissen Wind Wellen. Wie flutendes Wasser schwappte und wogte der goldene Schwall, und die scheitelrechte Sonne goss noch einen goldenen Strom vom Himmel dazu nieder. Mitten in diesem Meer, im blendenden Mittagszauber der Ähren war plötzlich eine Gestalt aufgetaucht, hell der Hut und das Gewand, hell das Gesicht, und die Flechten wie reifer Weizen.
„Hu, poludnica.“ Noch einmal kreischten die Weiber laut auf.
Selbst die Bräuers waren erschrocken, hatten sie doch niemand kommen gehört noch gesehen. Im wogenden Getreide war jene sacht dahergewandelt gekommen, auf kaum kenntlichen Fusspfädchen. Verdutzt starrten sie in das helle Gesicht.
Aber der Kutscher war blitzschnell von der Deichsel gesprungen; den Hut bis zur Erde reissend, wie vorhin bei dem Heiligen-Häuschen, grüsste er ehrfurchtsvoll, untertänig.
Da zog auch Peter Bräuer den Hut — die schien aber mal eine vornehme Dame!
Ein rascher Blick aus den hellen Augen der blonden Frau streifte ihn, dann nickte sie ihm freundlich zu: „Guten Tag!“
Horch, was war das? War das Musik? Glockenklang aus heimischem Land? Oder kam’s vom Himmel herab?!
Frau Kettchen war auf den Sitz zurückgesunken, ihre Lippen fingen plötzlich an zu zucken; heiss schoss es ihr in die Augen, jähe Tränen der Sehnsucht begannen über ihre Wangen zu rinnen. Aber es waren auch Tränen der Hoffnung. Einen Nebel legten sie wohl vor ihre Augen, doch der Nebel war nicht grau wie die Schleier des Abends, golden durchleuchtete ihn Licht des Morgens, denn mitten in ihm stand eine freundliche Gestalt, die Frau mit blonden Flechten und hellen Augen, und — die sprach deutsch.
„Guten Tag“, schrien die Kinder; es klang jubelnd.
„Guten Tag, gnädige Frau“, rief Valentin keck.
„Guten Tag“, sprach auch bedächtig und respektvoll der alte Bräuer. Und sein Weib stammelte — es konnte nicht laut sprechen vorm heftigen Klopfen des gerührten Herzens — leise nach:
„Guten Tag!“
Zweites Kapitel
Auf Niemczyce-Deutschau stand die Gutsherrin, Helene von Doleschal, am Fenster ihres Zimmers und schaute, beide Hände auf die Brüstung gestützt, hinunter in den Garten. Die Terrassen abwärts, unten am See, von wo die leichte Brise wehte, spielten ihre Knaben; sie hörte die hellen Stimmen zu sich heraufschallen. Sie wartete auf ihren Mann; der war gleich nach dem Mittagessen wieder aufs Feld geritten. Kam er jetzt bald?! Sie neigte sich weiter hinaus; zwischen den Blumenbeeten herauf führte das Pfädchen, das er gern einschlug, wenn er, ungeduldig abkürzend, den Braunen allein zum Hof traben liess und sich selber durchs Seitenpförtchen in den Garten stahl.
Helene blickte über die Hängerosen unterm Fenster, die die Glocken ihrer Kronen auf den samtig geschorenen Rasen niederstülpten, hinüber zum Hügel. Jenseits des Sees ragte der sandige Gipfel, der, mit einer einzigen Kiefer beflaggt, fast wie ein Berg in der Ebene erschien. Dort hinter jenem Berg lag Kolonie Augenweide! Der Weg dahin war weit, und Hanns-Martin hatte versprochen, heute noch mit ihr hinzufahren. Neue Kolonisten bauten ein Haus — ob das die Leute waren, denen sie neulich an der Grenze begegnet war, als sie mit ratterndem Leiterwagen und müden Kindern einzogen?!
Wenn Hanns-Martin doch bald käme! Schon legte sich ein Schatten über die blanke Metallplatte des Sees; die Schwäne, die zur Zeit der hohen Sonne im Schwanenhäuschen unter der alten Silberpappel der Insel Zuflucht gesucht, ruderten jetzt langsam über die mild beleuchtete Fläche, ihr Bild mit den schön gewölbten Flügelbogen schneeig im tiefen Wasser spiegelnd. Von den Blumenkissen der Terrassen stiegen verstärkte Wohlgerüche auf; die Heliotrope, Levkojen und Reseden, die um Mittag schlaff gehangen, standen jetzt erfrischt. Die waldigen Ausläufer des Parks, bis zum sandigen Hügel hin von beiden Seiten den See umschliessend, zeigten um ihre Kronen schon weicheren Flimmer.
Nun kam er wohl nicht mehr zur Zeit!
Enttäuscht wollte Helene vom Fenster zurücktreten, da hörte sie seine Stimme. Die Gruppen der Kannas und Musen verdeckten noch seine Gestalt, aber jetzt — jetzt war er zu sehen! Eiligen Schrittes stürmte er den kleinen Pfad herauf. Die Knaben hatten ihn entdeckt; ausgelassen umsprangen ihn die vier grossen, den kleinen Kurt liess er auf der Schulter reiten. Das Kindermädchen folgte, während wiederum hinter diesem, zeternd vor Besorgnis um ihres Herrn Küchlein, die alte Pelasia dreinhumpelte.
Die Knaben jauchzten: hurra, nun rannte Väterchen auch über den Rasen, und der Gärtner durfte doch nicht schelten!
„Helene!“ Schon war er unter ihrem Fenster. Die weisse Mütze aus der erhitzten Stirn zurückschiebend, schaute er zu ihr hinauf. „Endlich! Entschuldige! Meine liebe Frau! Ich musste noch aufs Vorwerk, Scheftel aus Miasteczko war da wegen der Milchkälber. Der Vogt wusste sich nicht zu helfen, der Kuhschweizer will sich immer von keinem Stück trennen. Sie zankten. Ich musste ein Machtwort sprechen.“
„Wie du dich um alles kümmerst“, sagte sie zärtlich. „Hast du gut verkauft an Löb Scheftel?“
„Es geht. Na“ — er klopfte sich mit der Gerte den Staub aus den enganliegenden Reithosen — „lassen wir das! Ich werde mich erst ein bisschen menschlich machen, und dann fahren wir.“
Sie lächelte ihn an. „Komm herein, trink nur erst Kaffee! Die Mamsell hat schon sechsmal fragen lassen, ob sie die frischen Waffeln heraufschicken dürfte.“
Weniges später fuhren die Doleschals auf dem leichten Korbwägelchen fort. Kein Diener sass hinten auf. Er kutschierte selber, ein Zungenschlag trieb das gut eingefahrene Pferd an. Der schlichte Schleier, den Helene als einzigen Schmuck um den Hut trug, wehte im Sommerwind.
Dem Park zur Linken, immer am hohen Drahtzaun entlang, führte zuerst die Strasse, dann trat sie näher zum See; mühselig knirschten die Räder durch tiefen Sand und dann noch mühseliger die Hügelsteigung hinan. Aber von oben herab lohnte ein herrlicher Blick auf den glatten See mit seiner bebuschten Insel, und auf das weisse Herrenhaus jenseits, mit den Blumenbeeten davor, von den grünen Wipfeln des Parkes wie ein freundliches Bildchen eingerahmt.
Noch ein paar Räderumdrehungen, und rasch ging es jetzt wieder bergab. Der Sandbuckel mit der einsamen Kiefer schob sich wie ein Schutzband vor die Oase von Deutschau. Nichts begrenzte nun mehr den Blick. Felder, Felder, Felder. Einzig in der Ferne, hinter Chwaliborczyce, ein paar Waldlinien; aber sie erschienen heut noch ferner als sonst, der staubige Dunst, der über der reifen Ebene lagerte, hatte das Blau des Kiefernforstes verhängt.
Überall wurde Weizen gehauen. Auf Deutschauer Land waren die Hemden der Schnitter alle weiss. Die Leute schafften schwer. Jeder Mann hatte ein Weib hinter sich, oft ein kaum erwachsenes Mädchen, das mit keuchender Brust, in unablässig gebückter Stellung hinter ihm drein schritt und die Schwaden raffte, die unter der blanken Sense fielen.
„Wir hätten Schnaps für sie mitnehmen können“, sagte Helene, „bei dem Staub tut’s ihnen not!“
„Schnaps?! Du weisst, ich bin nicht für Schnaps. Die Vögte sind angewiesen, Kaffee auszuteilen. Aber wie das Volk so ist! Kaffee wollen sie nicht, dann trinken sie lieber gar nichts.“
„Sie sind eben mal Schnaps gewöhnt“, entschuldigte sie. „Bei uns zu Hause gab es auch immer Schnaps in der Ernte. Mutter mischte ihn selber: ein Liter Kartoffelspiritus, ein Liter Wasser und ein bisschen Himbeersaft dazu. Weisst du, es war für mich das grösste Vergnügen, wenn ich mit meinem Pony herumfahren durfte, ihn austeilen. Und wir waren doch ganz deutsch!“
„Nein, Fusel nicht“, sagte er fast eigensinnig, und eine Falte der Verstimmung trat ihm zwischen die Brauen.
Sie schwieg, kannte sie doch ihren Mann viel zu genau, um in solchen Momenten dagegenzureden.
Noch hatten sie Deutschauer Land zu beiden Seiten, aber ein Zipfel von Chwaliborczyce schob sich wie ein Keil von links her, mitten hinein, und aus der Weite zur Rechten tauchten jetzt die Akazien von Przyborowo auf. Auf Chwaliborczycer Land gab’s rote Hemden; ihre blutige Farbe, grellleuchtend im staubfarbenen Erntedunst, überschrie jede andre.
Alle Schnitter kannten das Gefährt von Niemczyce, aber nicht alle grüssten. Wenige nur; viele grinsten höhnisch: aha, der Niemczycer! Dass ihn der Donner erschlage! Die Arbeiter sollten nicht Schnaps bekommen? Haha, mochte er dann sehen, wo er noch Arbeiter herkriegte!
Der Chwaliborczycer Inspektor, Herr Szulc, der auf tänzelndem Braunen in der Nähe seiner Schnitter hielt und, mit der verknoteten, vielschwänzigen Lederpeitsche hier- und dorthin weisend, Befehle schrie, tippte mit dieser nachlässig an seinen Hut.
Das sollte ein Gruss sein?! Unverschämt, dieser Schulz! Helene warf einen schnellen, ängstlichen Seitenblick auf ihren Mann.
Aber die Lider halb über die Augen sinken lassend, ignorierte der Freiherr den Inspektor vollständig. Nur eine feine Röte überzog flüchtig sein blassbräunliches Gesicht. „Sieh mal, Chwaliborczycer Weizen!“ Er zeigte mit der Peitsche.
„Aber er ist lange nicht so schwer wie der unsre“, stiess sie hastig heraus; es drängte sie förmlich, ihm rasch etwas Angenehmes zu sagen.
„Du irrst dich, Kind, er ist ebenso wie der unsre. Er könnte sogar besser sein, denn Deutschau hat längst nicht den famosen Weizenboden wie Chwaliborczyce. Aber Garczyński will eben nichts mehr hineinstecken. Ich denke, er wird verkaufen.“
„Was — Garczyński verkauft?! An wen denn? An die Kommission?“ Helene blickte ganz entsetzt. „Sein schönes Gut! Über vierhundert Jahre in der Familie — wenigstens sagt er so! Muss er verkaufen? Schrecklich! Sag, Hanns-Martin, geht’s ihm denn so schlecht?“
„Ach, bewahre!“ Doleschal lachte. „Das verstehst du nicht, Kind! Warum soll es ihm denn schlecht gehen? Das nicht! Aber vielleicht auch, dass er dabei an die Erziehung seines Sohnes denkt — er hat nur den einzigen Jungen —, und seine Frau kann sich absolut nicht entschliessen, sich von dem zu trennen, wie er erzählt. Und auf die Dauer geht das doch nicht: nur der Unterricht beim Vikar. Ich bitte dich, so ein katholischer Geistlicher — nur Seminarbildung —, was kann der Junge da lernen? Aber vor allem, wenn es einem so bequem geboten wird wie jetzt! Er kann sich glänzend rangieren. Er geniert sich nur ein bisschen. Die Grosspolen und die Volkspartei werden es ihm ordentlich anstreichen, wenn er an die Ansiedlung verkauft. Das halftert ihm auch seine Zeitung, der ‚Kuryer Poznański‘, nicht ab!“
„Ich mag ihn nicht“, sagte die junge Frau heftig, „ich mag ihn ganz und gar nicht. Wie kann er ohne zwingende Not verkaufen? Würdest du je Deutschau verkaufen, Hanns-Martin?“
„Da sei Gott vor — nie!“ Sein Gesicht wurde sehr ernst. „Ich würde mich ja versündigen am Andenken meiner Vorfahren. Der Grossvater und dann mein Vater haben Deutschau gehalten, mit vielen Opfern. Nun halte ich’s!“
Sie lachte fröhlich. „Grade so denk’ ich. Und die Jungens sollen auch so denken. Weisst du, und dann werden wir im Erbbegräbnis, das der alte Grossvater so schön im Park angelegt hat, alle miteinander schlafen. Es muss einem im Grabe noch ein angenehmes Gefühl sein: du liegst im eigenen Grund und Boden.“
Er nickte. „Natürlich! Aber sprich nicht so etwas, Helene, wir sind noch zu jung dazu. Und wir haben ja noch soviel vor uns! So vieles zu schaffen, zu bessern! Wenn die Zeit nur reicht. Übrigens, wenn Garczyński verkauft, soll mir’s recht sein. Dann bekommen wir noch mehr Ansiedler her — hoffentlich rein Deutsche und recht viele! Kleine Leute, die machen das Volk aus. Siehst du“ — er hob die Peitsche und wies geradeaus, wo einzelne kleine Häuschen, wie ängstlich auf der weiten Fläche, sich zusammenduckten — „da haben wir Ansiedlung ‚Augenweide‘!“
„Ach, und da ist der Kirchturm von Pociecha-Dorf! Sie haben ihn gerade im Rücken. Wie guckt er schwarz!“
„Lass ihn! Siehst du“ — er hielt das Pferd an — „da, selbst der Grenzstein ist schwarzweiss! Holla, wer trampelt denn darauf herum? Ist das nicht der Chwaliborczycer Schäfer?“
Auf dem Grenzstein, der auf schwarzgeteertem Grund in weithin leuchtenden weissen Buchstaben ‚Ansiedlung Augenweide‘ wies, stand Dudek, der Schäfer.
Schwer stützte er sich, um oben auf dem schmalen, scharfgekanteten Stein die Balance zu halten, auf seinen langen Hirtenstab, der mit der eisengekrümmten Spitze wohl gewichtig genug war, einen Wolf niederzuschlagen. Der blaue Strumpf, an dem er sonst unermüdlich strickte, lag achtlos am Boden. Die vielen hundert Schafe, des Schäfers Obhut anvertraut, hatten sich von Chwaliborczycer Roggenstoppel längst hinüberverloren auf Nachbarland. Auch der Hütejunge war davongeschlichen und träumte im Grenzgraben unterm Dornenbusch einen schönen Traum.
Dudek, der Alte, hatte des alles nicht acht. Er stand ganz versunken, ragend wie ein dürrer, blattloser Baum unterm gläsernen Himmel und starrte vom Grenzstein hinab auf die kleinen Häuschen, ängstlich in der grossen Weite zusammengeschart. Er seufzte: was wollten die hier? Früher, als sein, Kuba Dudeks, Vater noch jung gewesen, da war hier nichts gewesen als der Himmel und die Länder des polnischen Herrn, nichts als die Hütten seiner Hörigen. Da konnte der Schlachcic, der Edelmann, reiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang — alles war sein. Und als er, Kuba Dudek, noch jung gewesen, da hatten alle gesprochen in der Sprache, die Gott der Herr spricht, darinnen die heilige Mutter zum Sohne spricht.
Die da — „psia krew!“ Energisch hob der Hirt das mit Lappen und Schnüren umwickelte Bein und stampfte mit dem Bastschuh den Grenzstein. Sein Mund, dessen Lippen durchs Alter so schmal geworden, dass sie ganz in der verschrumpften Kinn- und Backenhaut verschwanden, murmelten den Fluch: „Möge sie der feurige Blitz zerschmettern!“ Konnten sie nicht bleiben, wo sie geboren worden — jeder soll bleiben, wo ihn die Mutter geboren —, was mussten sie hierherkommen?! Trugen sie keine Scheu, so dicht zu nahen dem Nest des weissen Adlers?
Drohend hob Dudek den schweren Stock, die geballte Faust schüttelte er gegen die Kolonie. Da waren ihrer wieder neue hinzugekommen — weisse Eindringlinge mit gelben Haaren — sie bauten ein Haus.
Noch schimmerten die unbedeckten Dachsparren wie die Rippen eines Skeletts, aber geschäftig eilten die Männer beim Bau; man sah ihre Gestalten sich richten und bücken, sich drehen und wenden in emsiger Bewegung, wie unruhige Zwerge auf dem Teller der grossen Ebene.
„Sie bauen, sie bauen“, rief Helene erfreut und klatschte in die Hände.
Da drehte sich der Alte um. Er hatte den Wagen nicht herankommen hören, sein Ohr war nicht mehr scharf, aber sein Auge noch. Ohne Übereilung, schwerfällig stieg er nieder vom Grenzstein und zog, das Knie beugend, den Hut.
Freundlich grüsste ihn Helene, war doch seine Frau die Schwester von ihres Mannes einstiger Amme, der alten Pelasia.
„Tag, Dudek, wie geht’s? Kommt Ihr nicht auf einen Sonntag die Pelasia besuchen? Sie beklagt sich, dass niemand nach ihr sieht.“
„Wenn sie sich sehnt nach ihren Eigenen, soll sie kommen!“
„Ihr seid viel rüstiger als sie, Dudek, und Eure Frau ist auch wohl noch besser zu Fuss. Sagt, was machen denn Eure Enkel, der Jendrek und die Michalina? Dass ich’s Pelasia erzählen kann!“
„Hat der Jendrek bei Soldaten gemusst. Haben sie ihn geschickt weit, sehr weit, wo niemand versteht ihn. Is die Michalina zu Herrschaft gezogen, is sich auch Amme geworden bei fremdes Kind.“
„Nun, Dudek, und was machen Eure Schafe? Ich sehe schon, sie sind gut imstande. Sie sind gewaschen, sind ja weiss wie Schnee!“
„Mutterschafe sind sich gewaschen; aber wie lange noch werden Lämmer seinige sein? Alles nimmt sich Fremder, alles!“ In einer resignierten Melancholie liess der alte Mann den Kopf auf die Brust sinken.
„Wieviel Schafe habt Ihr jetzt?“ fragte Doleschal.
Nun hörte Dudek auf einmal gar nicht mehr. Mit weit ausholenden Schritten in die Roggenstoppel stapfend, schrie er schimpfend nach seiner Herde und dem lässigen Hütejungen. Der wolfsähnliche Hund, der bis jetzt träg am Stein geblinzelt, jagte mit wütendem Gekläff vor ihm her.
Vergebens rief Helene: „Soll ich Pelasia grüssen?“ Keine Antwort mehr. Taub war der Schäfer, aber auch blind, denn er suchte seine Herde, wo diese gar nicht zu finden war. Ein heisser Wind, der plötzlich mit Kraft über die Ebene schnob, lüftete seinen Schafpelz und warf die weissen Haare, die ihm langsträhnig unterm Hut vorhingen, wild durcheinander.
Als Helene nach einer Weile zurückblickte, stand Kuba Dudek wieder auf dem Grenzstein; unbeweglich, wie der Weiser an der Wegscheide, reckte sich sein Arm. —
In der Kolonie war nicht die muntere Geschäftigkeit, die man in der Ferne zu sehen vermeint. Nur die Bräuers waren beim Hausbau; von den andern Ansiedlern liess sich niemand blicken. Helene war einigermassen enttäuscht, hatte sie doch geglaubt, die Frauen auf den Türschwellen sitzend zu finden, schwatzend beim Kartoffelschälen, wie sie die Frauen vielhundertmal gesehen hatte im deutschen Dorf beim elterlichen Gut.
Aber Doleschal war sehr befriedigt: noch war nicht Feierabend gemacht. Drüben in Pociecha-Dorf stiegen schon Rauchsäulen aus den zusammengesunkenen Schlöten der grün vermoosten Strohdächer, hier schafften noch alle fleissig auf dem Felde.
„Soll ich dich mal über die Äcker fahren?“ fragte er seine Frau. „Viel zu sehen wird freilich noch nicht sein. Aber sie haben ja die Freijahre, die sind eine riesig kulante Einrichtung.“
Wohlgefällig schaute er sich um: „Sieh mal, wie nett, wie sauber! Wie aus der Spielschachtel! Unsre Ansiedlung ist von allen die vielversprechendste. Erinnerst du dich noch, vor fünf Jahren, als sie hier das Gut parzellierten? Wie heruntergewirtschaftet das war?! Und wie sieht es jetzt aus! Freilich, es wird noch eine Weile dauern, bis der ausgesogene Boden sich wieder erholt hat. Aber unter tüchtigen Arbeitshänden — da, sieh mal!“ Sich unterbrechend, zeigte er auf eine kreisrunde mächtige Scheune: „Wie ein Zirkus! Ein bisschen gross, aber, na — die hat sich ein Amerikaner gebaut. Famoses Ding, was? Links das niedliche Gehöft gehört einem Schwaben. Ach, sieh mal an, hat sich der Mann neben den Obstbäumen auch Rebstöcke gepflanzt — ist das nicht rührend? Da hinten sitzen die Kolonisten aus der hiesigen Provinz alle zusammen. Und hier sind wir bei den Rheinländern.“
Sie waren die ungepflasterte Strasse, an der die Häuschen und Scheunen sich rechts und links verteilten, ein paarmal auf und nieder gefahren. Nun hielten sie bei dem Neubau an.
Peter Bräuer und sein Sohn sägten gerade an einem Balken. Die Säge war stumpf geworden, widrig klang ihr Gequietsch, und widerwillig nur gab der Balken nach. Mit einer gewissen Verdrossenheit arbeiteten beide Männer; sie blickten auch kaum auf, als Doleschal vom Wagen absprang und seiner Frau die Zügel übergab.
Er trat zu den Arbeitenden und sagte: „Nun, wie steht’s mit dem Bau?“
„Tag!“ Vater Bräuer fasste nur an die Mütze, während der Sohn die seine wohl heruntertat, aber sogleich wieder aufsetzte. „Könnt besser sein. Mer kömmt nit voran. Hätt ich dat gewusst!“
„Wieso — hätten Sie was gewusst?“ fragte Doleschal lebhaft. „Über was haben Sie sich zu beklagen?!“
„Der Herr ist wohl auch einer von der Kommission?“ sagte Peter misstrauisch und wechselte einen Blick mit seinem Sohne.
„Nein.“ Doleschal hatte den Blick aufgefangen. „Aber Sie können mir ruhig sagen, was Ihnen nicht behagt. Ich interessiere mich für die Kolonisation. Ich bin auch Deutscher. Hier in der Nachbarschaft ansässig — Doleschal auf Deutschau!“
„Ah, Sie sind der Doleschal?! So, no dann“ — Peter Bräuer streckte treuherzig die Hand hin — „dann is dat wat andres. Ich hab als von Ihnen gehört. Un dat is Ihr Frau?“ Er grüsste mit einer ungelenken Verbeugung nach dem Wagen hin. „Ja, wissen Se, Herr von Doleschal, Se müssen mir dat nit übelnehmen, aber man wird ganz misstrauisch. Sie haben einem dat doch alles ganz anders vorgestellt — oder ob ich mir nur dat so anders gedacht hab!? Ich weiss et nit. Jedenfalls hätt ich, wenn ich früher gewusst hätt, dat mer hier so schlecht Arbeitskräft kriegt — ich weiss nit, sind ihrer wirklich kein da oder wollen se nur nit —, mir dat Haus vom Bauamt baue lassen. Sie hatten mir dat angeboten, aber ich dacht, et käm so billiger. Ja, un wenn ich dal all ganz genau gewusst hätt, wär ich gar nit hier hingekommen, da hätt ich doch ebensogut nach Amerika auswandern können.“
„Das dürfen Sie nicht sagen!“ Doleschal warf einen wohlgefälligen Blick auf den jungen Mann, der zu den Worten des Vaters beistimmend nickte. „Sie müssen doch Ihre Kinder, Ihren Sohn da, dem Vaterland erhalten!“
„Och, wat dat anbelangt, de kann in Amerika ebensogut deutsch bleiben wie hier! Un hier muss mer sich plagen, genauso wie woanders — ne, noch viel mehr!“
Es tat dem Mann augenscheinlich gut, sein Herz zu entlasten. Da hatte ihm wohl die Kommission fast alles, was zum Hausbauen gehörig, prompt und nicht zu teuer zur Stelle geliefert: Mauer-, Ziegel-, Firststeine, Feldsteine zum Fundament und auch Bauholz. Auch hatte er für sich und seine Familie derweilen drüben in der Holzbaracke die erste Unterkunft gefunden. Aber nun würde der Bau doch doppelt solange dauern als vorausgesehen, denn aus Miasteczko der Zimmermann mit seinen Gesellen war nur zwei Tage erschienen, dann nicht mehr; und der Maurer drüben aus dem Dorf, der sich, gegen hohen Tagelohn, für die ganze Zeit verpflichtet hatte, war nach einer halben Woche auch nicht mehr gekommen. Als der Valentin hingegangen, ihn zur Rede zu stellen, hatten sie sich durchaus nicht verständigen können; ein wüstes Gezänke war’s geworden. Aber wer konnte es dem Jungen verdenken, dass er mit der Faust auf den Tisch geschlagen? War er denn nicht in seinem guten Recht?! Doch das Gesindel war in lautes Hallo ausgebrochen, und die Frau hatte drohend nach dem Wasserkessel gegriffen, der auf dem Herd sprudelnd kochte. Und niemand, niemand anders war zur Hilfe aufzutreiben gewesen! Ganz allein waren sie sitzengeblieben mit aller Arbeit! Ein Glück noch, dass sie etwas davon verstanden — aber freilich, ’s war nur ein Stall gewesen, den sie dazumal allein gebaut hatten, und noch dazu war’s zu Hause gewesen, am Rhein!
Der Gutsverwalter auf dem Restgut, an den man sich doch mit allen Anliegen wenden sollte, hatte die Achseln gezuckt bei seinen Klagen: ja, warum musste denn durchaus selber gebaut sein?! Mit den Leuten hierzulande müsste man eben in Frieden auskommen, er könnte auch gar nichts dabei machen.
Unwirsch fuhr sich der Ansiedler durch die Haare:
„Et geht so langsam, viel zu langsam! Un dat Kettchen jammert in der Barack — kein Ordnung, kein Reinlichkeit is mögelich — un da sind gestern ihrer noch welche zugekommen — se sagen, se wären deutsch, de Mann spricht auch deutsch, aber die Weibsleut schnattern polacksch. Un mit den Weibsmenschern soll nun mein Frau in einem Raum schlafen?! Denken Se an! — Un wie lang dauert et noch, un et is hier schon Herbst! Die Tag sind so heiss, aber die Nächt sind als kühl. Bei uns zu Haus is dat ganz anders, da blühen Allerheiligen die Rosen noch. Och, hätt ich dat gewusst! Ne, ich sag schon — wie krieg ich dat Haus trocken?!“
Eine tief-innere Angst lag unter diesen Worten, Doleschal fühlte sie heraus.
„Ich werde Ihnen meinen Stellmacher zu Hilfe schicken“, sagte er. „Der Mann hat zwar noch kein Haus gebaut, aber er wird Ihnen doch jedenfalls von Nutzen sein. Und er ist deutsch.“
„Dat — dat wollen Sie tun?“ Ein Ausdruck freudigster Erleichterung erhellte des Ansiedlers bekümmertes Gesicht. „Den Stellmacher — Donnerschlag! Valentin, Jung, hörste, wir kriegen Hilf!“
Der Sohn hatte die Mütze vom Kopf gerissen, sein ganzes hübsches Gesicht lachte. Unverfrorene Herzlichkeit lag in der Bewegung, mit der er nun rasch auf den Herrn zutrat; man sah’s, er hätte dem gern die Hand geschüttelt, aber der beim Militär anerzogene Drill hielt ihn zurück.
Er nahm die Hacken zusammen: „Besten Dank, Herr Baron!“
Wohlgefällig musterte Doleschal den stattlichen Menschen. „Garde, was?“
„Nein, Herr Baron, Deutzer Kürassier!“
„So, so. Ich bin Rittmeister bei den Gardekürassieren!“
Valentin schlug wieder die Hacken zusammen. Er murmelte etwas von ‚grosser Ehre‘, und eine helle Röte stieg ihm dabei ins Gesicht; man hörte seiner Stimme die Freude an. Eine Verbindung war plötzlich vorhanden, zwischen ihm und jenem vornehmen Herrn da.
Auch Doleschal sagte: „Wir müssen zusammenhalten hier!“ Die Leute gefielen ihm, der Alte war recht ein knorriger Stamm, der dem Wetter trotzte, und der Junge, nun — unwillkürlich verglich er zwischen sich und dem krausköpfigen Burschen — der war fast noch schlanker als er selber und elastisch in jeder Bewegung wie ein Trainierter. Die Leute mussten unterstützt werden, nach Kräften!
„Ich werde Ihnen morgen meinen Stellmacher herschicken“, wiederholte er noch einmal, „und auch noch den Schmied.“
Helene sass schon lange wartend auf dem Wagen. Sie hatte ihren Mann, der, einen Fuss auf den Balken stützend und die Hand mit der Peitsche in die Seite stemmend, den Leuten zuhörte, beobachtet; nun waren alle drei miteinander hinterm Neubau verschwunden.
Sie wartete noch eine Weile ganz geduldig, aber als sie noch immer nicht zurückkehrten, schlang sie die Zügel um den Haken am Kutschbock und sprang vom Wagen. Der Traber stand auch so.
Über den gläsernen Himmel, leicht angegraut vom mehligen Dunst der Felder, kroch schon ein Abendrot. Im Schleier der sich mählich ankündenden Dämmerung wurde alles milder. Noch lag viel Glanz über der Flur, aber kein grausamer mehr, der den Augen weh tat; er wurde friedlich. Aus einem Tümpel, den man nicht sah, stieg Fröschesang, wie im Schlaf, ganz traumhaft. Und — horch! — war das nicht schon die Wachtel, die zu Abend im Kornfeld rief?
Die junge Frau lächelte: sieh da, ganz dicht hinter jener Ansiedlerscheune kam jetzt ein Rebhuhn aus dem Acker spaziert! Als wüsste es, dass die Jagd noch nicht drohe, trippelte es, vertrauensselig wie eine gute Henne auf dem Hühnerhof, über die Strasse, in den Acker jenseits, und die jungen Hühnchen folgten unbefangen.
Langsam glitt das Abendrot weiter und weiter über die Himmelsglocke, während das kolossale Rund des Sonnenballs ungehindert, von überall frei zu sehen, mehr und mehr hinabrutschte gegen ihren Rand. Wie schön war das!
In einem Gefühl, das sie manchmal überwältigte, angesichts dieses weiten Himmels, der wie ein Meer über dem Meer der Felder schwimmt, ohne Ufer, ohne Begrenzung, schauerte die Einsame. Am wirklichen Meer war sie gewesen, die mächtigen Wogen der Nordsee hatte sie aufgewühlt im Sturm gesehen und auch wieder glatt. Ihr Mann hatte sie auf Schweizergipfel geführt — sie standen auf einem sehr hohen Berg und sahen unter sich alle Schätze der Natur und ihre Herrlichkeit; im sich teilenden Grau der Morgennebel glänzte die Weite der Welt zu ihnen herauf, und sie selber waren ein junges Paar im ersten Rausche nicht endenden Glücks gewesen — aber nie, nie war ihr die ewige Unendlichkeit so klargeworden wie hier.
Starren Auges schaute sie. Da, gradaus, Pociecha-Dorf, der Turm der schwarzen Holzkirche zeigte es weithin! Dort Chwaliborczyce! Ganz auf der andern Seite: Przyborowo mit Miasteczko, dem kleinen Landstädtchen, im Rücken. Und dort grüsste der Deutschauer Berg. ‚Lysa Góra‘, Kahler Berg, wie ihn die Leute nannten. Jeden Gutskomplex — eine Insel im Meer — wusste sie zu benennen; wusste, wieviel Pappeln die dünne Allee von Chwaliborczyce zählt, hatte achtmal schon die dornigen Akazien von Przyborowo blühen und sich entblättern gesehen, war so glücklich hier, und doch — sie fühlte die Nebel der Niederung, die um Sonnenuntergang plötzlich schauerten, durchs leichte Sommerkleid kalt auf der Haut.
„Hanns-Martin“, rief sie fröstelnd, „Hanns-Martin, wo bist du?!“
Ihr Ruf hallte. Aus der Holzbaracke, unweit des Neubaus, trat eine Frau, und die Kinder drängten sich ihr nach; sie schauten alle neugierig zu der fremden Frau hinüber.
Helene erkannte die Frau: es war dieselbe, die sie letzthin bei den einziehenden Kolonisten gesehen hatte, aber das Gesicht sah jetzt älter aus, als seien nicht erst vier Wochen seit jener Begegnung am Kreuzweg verstrichen.
„Wünscht die Dame wat?“ fragte die Frau höflich.
Helene trat rasch auf sie zu. „Mein Mann ist, glaube ich, mit Ihrem Mann fortgegangen, sonst hätte er mich gehört. Ich werde hier bei Ihnen warten.“ Sie hatte das Bedürfnis, nicht länger allein zu sein.
„Settchen, hol der Madam rasch ’ne Stuhl heraus“, wies Frau Kettchen ihr ältestes Töchterchen an. Und als die Kleine einen Schemel brachte, wischte sie, wie entschuldigend, mit der Schürze darüber hin: „Nehmen Sie vorlieb! Wir sind et auch besser gewöhnt, Madam! Aber mer muss sich als jetzt in alles schicken, sagt mein Mann.“ Sie seufzte. „Mer darf den Mut nit verlieren, und — sagt der Peter — die Kommission hat uns hierhin gebracht, die hat nun auch für uns aufzukommen. Sie sind wohl auch nit von hier, Madam?“
Augenscheinlich erkannte die Frau die Dame nicht wieder. Als Helene sie an ihre erste Begegnung erinnerte, schossen ihr plötzlich die Tränen in die Augen.
„Och, wie wir zugezogen sind — dat waren Sie? Och herrje!“ Geschwind fasste sie nach Helenes Hand: „Dat freut mich aber, dat ich Ihnen danken kann. Dat erste ‚Guten Tag‘ — ne, Madam, dat hab ich nit vergessen! Och, Madam, entschuldigen Sie“, — sie fuhr mit der Schürze über die Augen — „bei uns zu Haus bin ich gar nit so, aber hier muss ich immer weinen!“
Helene tröstete: „Das ist nur im Anfang so, der Anfang ist ja überall schwer. Passen Sie mal auf, nächstes Jahr wissen Sie nichts mehr von Heimweh; da lachen Sie drüber. Es ist hier auch schön!“
„Meinen Se?“ Zweifelnd schüttelte die Frau den Kopf. „No, wenn Sie ’t sagen, dann soll et wohl wahr sein!“
Vertrauend schaute Kettchen zu der hochgewachsenen Dame auf, und dann lächelte sie hoffnungsvoll: „Wenn et so kömmt, wie Sie sagen, Madam, dat et uns gut geht hier, dann will ich auch wallfahren gehen nächst Jahr. Sicher un gewiss, dat gelob ich. Hier kann mer doch wallfahren gehen, gelt, Madam?“
„O ja!“ Eine leichte Zurückhaltung lag plötzlich in Frau von Doleschals Ton — wie schade, diese nette Frau war nicht protestantisch?!
Und als ob die andre instinktiv diese Enttäuschung fühle, hielt auch sie sich mehr zurück.
Schweigend blickten beide hinaus auf die Ebene, in den lastenden Horizont, den flammende Abendröte wie mit blutigen Schwertern zerfetzte.
Als Helene jetzt ihren Mann sehr eilig zwischen den Ansiedlern daherkommen sah, unterdrückte sie nicht einen Vorwurf: „Aber Hanns-Martin — endlich!“
„Verzeih! Ungeduldig geworden, mein Herz? Bitte, verzeih! Es hatte mich so interessiert. Herr Bräuer hat mir seine ganze Stelle, seinen Bau, seinen Acker, kurz, alles, was drum und dran, gezeigt!“ Doleschal war angenehm erregt und reichte beiden Männern die Hand zum Abschied: „Es wird jetzt schon werden, wird ganz famos werden! Auf Wiedersehen!“
„Du“, sagte Helene leise, als sie am Arm ihres Mannes zum Wagen schritt, „die sind ja katholisch. Und ich dachte doch, hier sollten nur Evangelische her?“ Es klang bedauernd: „So nette Leute!“
„Ja, das lässt sich nun doch nicht ganz streng durchführen, diese Sonderung der Konfessionen. Aber was macht’s? Es sind doch wenigstens Deutsche!“
Der Traber, der bis dahin lammfromm gestanden, stutzte plötzlich, nun sie einsteigen wollten.
Unruhig zog er an, stieg wild und prallte dann zur Seite, gerade noch, dass Doleschal ihn vom Graben zurückriss. Eine Staubwolke kam vom Dorf her über die Felder geflogen, und in der Staubwolke war Peitschengeknall, Pferdegetrappel und Hundegebell.
„Ach, die Garczyńskis!“ Nicht angenehm überrascht, fasste Helene nach dem Arm ihres Mannes.
Da war auch schon der hochrädrige Jagdwagen, glänzend lackiert, mit viel Rot an den Rädern, und innen die Sitze hell ausgeschlagen.
„Atrappiert, meine Herrschaften! He — halt!“
Auf einen Ruck standen die vier jungen Pferde neben dem Korbwägelchen, mit schnaubenden Nüstern, noch zitternd vor Erregung, und schäumten ins Gebiss. Zwei englische Doggen, riesige Tiere mit Stachelhalsbändern, schnackten ihnen dumpf bellend nach den Mäulern.
Der Lenker hoch oben auf dem Bock grüsste galant mit der Peitsche: „Ich lege mich Ihnen zu Füssen, gnädigste Baronin — das nenne ich Glück, Ihnen hier zu begegnen! Ihr Diener, Doleschal! Ihr Weizen ist grossartig! Sehr erfreut, wie steht das Befinden?“
Herr von Garczyński hatte viel von einem Pariser oder Wiener an sich. Gewandt schwang er sich vom hohen Sitz herunter, dem Diener, der hintenauf hockte und nun beflissen herbeieilte, die Zügel zuwerfend. An Helenes Seite tretend, führte er ihre Hand an die Lippen.
Die Doleschals mussten halten bleiben.
Im Chwaliborczycer Jagdwagen sassen, gegenüber von Frau von Garczyńska, ihr einziger Sohn, ein vornehm aussehender Junge, und der Vikar Górka.
Frau von Garczyńska hatte sich den Sitz auf der seitlichen Bank noch durch eine Menge von seidenen Kissen bequemer machen lassen; sie lag zurückgelehnt, und der Schirm, den eine blonde junge Person, halb Dame, halb Dienerin, zum Schutz zwischen sie und die feurig untergehende Sonne hielt, liess warmrosige Schatten auf ihr blasses Gesicht fallen.
„Gnädigste Baronin haben sich wohl Neues in der Kolonie angesehen?“ fragte Garczyński. „Sehr erfreuliche Fortschritte, nicht wahr? Wir haben unsern hochverehrten Herrn Vikar ein wenig entführt — die Herrschaften kennen sich? Ah, nur vom Hörensagen. Gestatten Sie!“ Er stellte vor, und dann verwickelte er, den Arm auf die Lehne des Korbwägelchens gelegt, Helene in ein längeres Gespräch. Eingehend fragte er nach ihren Kindern.
Es blieb Doleschal nichts übrig, als sich mit Frau von Garczyńska zu beschäftigen. Sie winkte ihn zu sich herüber. Mit dem zärtlich-wehmütigen Lächeln, das ihr Gesicht so sehr anziehend machte, lächelte sie ihn an, als er zu ihrem Wagenschlag trat.
Ob diese Frau glücklich war? Doleschal legte sich im Augenblick, als ihn ihr Lächeln traf, diese Frage vor, die sich schon viele vor ihm vorgelegt hatten. Kam der feuchte Flimmer in diesen schönen Augen von Tränen? Und was suchte dieser starr verlorene Blick in weiter Ferne?
Als Doleschal die weiche Hand bei der Begrüssung in die seine nahm, fühlte er einen kurzen, festen Druck, den er den zarten Fingern kaum zugetraut.
„Ich werde zu Ihnen hinüberkommen“, sagte sie. „Ich setze mich in Ihr Korbwägelchen, es ist ganz reizend. Ja, ich will“, setzte sie im Tone eines verzogenen Kindes hinzu, als er etwas von ‚unbequem‘ und ‚eigentlich nur zwei Sitzen‘ murmelte. „Ihre Gattin wird mit Garczyński auf dem Throne sitzen. Alexander“, rief sie ihrem Mann in elegantem Polnisch zu, „wir fahren gleich weiter, ich bin müde. Die Kolonie interessiert mich zu wenig — ein andermal! Nimm die Baronin auf deinen Bock; ich fahre mit Doleschal. Wir fahren über Niemczyce nach Hause zurück!“
Plötzlich lebhaft geworden, drückte sie ihrem Gegenüber, dem priesterlichen Herrn, ein paar der weichen Kissen in die Arme. „Hier, Herr von Górka, seien Sie auch einmal galant! Bitte, tragen Sie mir die dort hinüber. Herr von Doleschal, bitte!“ Ganz hilflos streckte sie beide Arme aus. „Der Wagen ist abscheulich hoch, ich traue mich nie allein herunter. Ah — ah —!“
Leicht flog sie durch die Luft; als Doleschal sie herunterhob, fühlte er ihre ganze Grazie. Ihr ein wenig verschobenes Kleid zurechtzupfend, lachte sie jetzt und klatschte lachend in die Hände: „Scharmant, ganz scharmant! Changez les dames, changez!“
‚Muss ich?‘ schien Helenes Blick ihren Mann zu fragen, als Herr von Garczyński ihr die Hand zum Umsteigen bot. Doleschal senkte die Lider — sie verstand diese stumme Bejahung; es lag ihm nun einmal daran, mit den Nachbarn, wenn auch nur in rein äusserlich aufrechterhaltenen, guten Beziehungen zu stehen. So schickte sie sich darein; aber ihre Bewegungen waren steif, ihre Miene abgemessen.
Mit liebenswürdigen Lobpreisungen nestelte sich Frau von Garczyńska auf dem kleinen Korbwägelchen ein: sie war noch nie so niedlich gefahren, hier war’s ja tausendmal bequemer als auf dem grossen Jagdwagen! Als der junge Vikar ihr die gewünschten Kissen in den Rücken schob, dankte sie ihm mit dem zärtlichsten Lächeln; aber die Kissen wies sie gleich wieder zurück: die hatte sie hier ja gar nicht nötig!
Mit einer stummen Verbeugung trat er zurück. Er hatte sich ebensogut in der Zucht, wie seinen Schüler. Sie hatten beide noch kein Wort gesprochen.
Auch die blonde Zofe, die sich anschickte, mit dem Schirm hinter ihre Herrin zu klettern, wurde abgewiesen. „Ich brauche dich nicht, Stasia! — Wie herrlich ist die Sonne! Wie wunderbar gefärbt die Wolken sind!“ Frau Jadwigas Augen schwammen. „Fahren Sie, Baron, he, voran!“ Ihre Brust hob sich, als wollte sie springen im Übermass der Empfindung. „Ich bin entzückt. Fahren Sie, fahren Sie — schneller in die Sonne hinein, schneller!“
Der Traber strengte sich an. Mit ausgezeichneter Kunst die vier wilden Pferde, die der Diener inzwischen kaum hatte zügeln können, zu langsamem Tempo zwingend, fuhr Garczyński nach.
Im Jagdwagen lachte plötzlich die Zofe halblaut auf, und dann, wie erschrocken über ihr Lachen, warf sie von unten her einen verstohlenen, schielenden Blick auf Lehrer und Schüler. Der Vikar hatte ein Büchlein herausgezogen, in das er mit ernster Miene vertieft war; das junge Herrchen dagegen merkte auf. Ein Aufflackern seines Auges begegnete dem leicht schielenden Blick der Blonden. Da lächelte sie merklich, aber weiche Grübchen kamen dabei in ihre jungen Wangen; sie lehnte sich ein wenig hintenüber, liess die Wimpern über die Augen fallen und spielte am Schirmgriff ihrer Herrin.
Der Traber, durch die vier Pferde, die hinter ihm schnaubten, und durch das Gebell der Doggen, die wie rasend zwischen beiden Wagen hin und her sprangen, nervös gemacht, schoss dahin wie ein Vogel auf fliehendem Flug. Das Viergespann ihm nach. Sich verfolgende Schatten, durch steigende Nebel vergrössert, jagten über die rasch dunkel werdende Ebene.
Dudek, der Schäfer, schlug ein Kreuz: Wer war das? Fliegende Pferde, fliegende Wagen und fliegende Hunde! Heilige Mutter, hilf, das war Myśliwy pan, der Nachtjäger, auf wilder Fahrt!
Scheu pfiff er die Hunde und trieb eilig die Schafe zusammen. Dass die Heilige Mutter sie hüte! Auch über ihnen machte er fromme Zeichen.