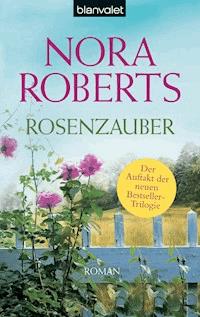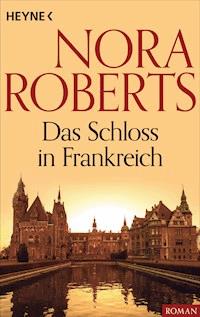
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Monate nach dem Tod ihrer Eltern erfährt Shirley überraschend, dass die Mutter ihrer Mutter noch lebt. Die junge Malerin besucht ihre Großmutter auf einem beeindruckenden Anwesen in Frankreich, obwohl sie damit ihre Beziehung zu ihrem Verlobten auf’s Spiel setzt. Nach einigen Tagen in der Bretagne erfährt sie von einem Familiengeheimnis, das sie nicht glauben kann. Sie muss die Ehre ihrer Eltern retten. Welche Rolle spielt dabei der anziehende und doch abweisende Christophe, der dem Gut vorsteht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Nora Roberts
Das Schloss in Frankreich
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Chris Gatz
Wilhelm Heyne Verlag München
I. KAPITEL
Die Bahnfahrt schien nicht enden zu wollen, und Shirley war erschöpft. Die letzte Auseinandersetzung mit Tony bedrückte sie. Hinzu kamen der lange Flug von Washington nach Paris und die beschwerlichen Stunden in dem stickigen Zug. Sie musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut aufzustöhnen. Ich bin schlimm dran, fand sie.
Diese Reise hatte sie nach einem der häufigen Wortgefechte mit Tony angetreten, denn ihre Beziehung war ohnehin schon wochenlang getrübt gewesen. Sie hatte darauf beharrt, sich keine Ehe aufzwingen zu lassen, und so war es immer wieder zu kleinen Streitereien gekommen. Doch Tony hatte auf einer Heirat bestanden, und seine Geduld war nahezu unerschöpflich. Als sie ihn allerdings von ihren Reiseplänen unterrichtet hatte, war der Konflikt zwischen ihnen offen ausgebrochen.
»Du kannst dich doch nicht einfach nach Frankreich davonmachen, um irgendeine mutmaßliche Großmutter zu besuchen, von deren Existenz du bis vor wenigen Wochen nicht die leiseste Ahnung hattest.« Tony schritt auf und ab. Erregt fuhr er sich mit der Hand durch das wellige blonde Haar.
»Es handelt sich um die Bretagne«, belehrte Shirley ihn. »Und es spielt überhaupt keine Rolle, wann ich ein Lebenszeichen von meiner Großmutter erhielt. Wichtig ist nur, dass sie mir geschrieben hat.«
»Diese alte Dame teilt dir also mit, dass sie mit dir verwandt sei und dich kennen lernen möchte, und gleich machst du dich auf die Reise.« Er war außer sich.
Trotz ihrer Angriffslust widersetzte sie sich seinen Vernunftgründen mit einer ruhigen Antwort: »Tony, vergiss nicht, dass sie die Mutter meiner Mutter ist. Die einzige lebende Verwandte. Ich möchte sie unbedingt sehen.«
»Die alte Frau lässt vierundzwanzig Jahre nichts von sich hören, und nun plötzlich diese feierliche Einladung.« Tony durchquerte weiter das große Zimmer mit der hohen Decke, ehe er sich zu Shirley umdrehte. »Weshalb, um alles in der Welt, haben deine Eltern nie von ihr gesprochen? Und warum hat sie erst deren Tod abgewartet, bevor sie sich mit dir in Verbindung setzte?«
Shirley wusste, dass er sie nicht verletzen wollte, das lag nicht in seiner Natur. Als Rechtsanwalt, der ständig mit Fakten und Zahlen umging, ließ er sich eher von seinem Verstand leiten. Darüber hinaus ahnte er nichts von dem bohrenden Schmerz, der sie seit dem plötzlichen Tod ihrer Eltern vor zwei Monaten unablässig quälte. Obwohl ihr klar war, dass er ihr nicht zu nahe treten wollte, wurde sie wütend. Ein Wort gab das andere, bis Tony aus dem Zimmer stürmte und sie zornig zurückließ.
Während der Zug durch die Bretagne fuhr, gestand Shirley sich ihre Zweifel ein. Warum hatte ihre Großmutter, diese unbekannte Gräfin Frangoise de Kergallen, sich fast ein Vierteljahrhundert in Schweigen gehüllt? Weshalb hatte ihre bezaubernde, faszinierende Mutter niemals Angehörige in der entlegenen Bretagne erwähnt? Selbst ihr freimütiger, offenherziger Vater hatte die verwandtschaftliche Beziehung jenseits des Atlantiks verschwiegen.
Shirley ließ ihre Gedanken zurückwandern. Sie und ihre Eltern waren einander so nahe und hatten viel gemeinsam unternommen. Bereits im Kindesalter begleitete sie ihre Eltern auf Empfänge bei Senatoren, Kongressabgeordneten und Botschaftern.
Ihr Vater, Jonathan Smith, war ein gefragter Künstler. Seine erlesenen Porträts bereicherten den Privatbesitz der Washingtoner Gesellschaft, die sein Talent mehr als zwanzig Jahre lang beanspruchte. Als Mensch wie auch als Künstler war er sehr beliebt, und der sanfte, graziöse Charme seiner Frau Gabrielle trug dazu bei, dass das Ehepaar hohe gesellschaftliche Anerkennung in der Hauptstadt genoss.
Als Shirley heranwuchs, zeichnete sich auch ihre natürliche künstlerische Begabung ab. Ihr Vater war grenzenlos stolz. Sie malten gemeinsam, zunächst als Lehrer und Schülerin, später als ebenbürtige Partner. Ihre gegenseitige Freude an der Kunst brachte sie einander immer näher.
Die kleine Familie lebte idyllisch in einem eleganten Bürgerhaus in Georgetown, bis Shirleys fröhliche Welt auseinander brach, denn das Flugzeug, das ihre Eltern nach Kalifornien bringen sollte, stürzte ab. Der Gedanke, dass sie tot waren und sie selbst noch lebte, war kaum erträglich. Die hohen Räume würden nie mehr widerhallen von der dröhnenden Stimme ihres Vaters und dem sanften Lachen ihrer Mutter. Das Haus war leer und barg nur noch Schatten der Erinnerung.
Während der ersten Wochen konnte Shirley den Anblick von Leinwand und Pinsel nicht ertragen, und sie mied das Atelier in der dritten Etage, wo sie und ihr Vater so viele Stunden verbracht hatten und ihre Mutter sie daran zu erinnern pflegte, dass selbst Künstler essen müssten.
Als sie schließlich allen Mut zusammennahm und den sonnendurchfluteten Raum betrat, empfand sie anstelle unerträglichen Kummers einen seltsam versöhnlichen Frieden. Das Tageslicht erfüllte den Raum mit Wärme, und die Erinnerung an ihr glückliches Leben von früher schien hier noch wach. Sie besann sich wieder auf ihr Dasein und die Malerei. Tony war ihr auf liebenswürdige Weise behilflich, die Leere auszufüllen. Dann kam jener Brief.
Inzwischen hatte sie Georgetown und Tony verlassen, auf der Suche nach der unbekannten Familie in der Bretagne. Der ungewöhnliche, formelle Brief, der sie aus der vertrauten Umgebung von Washingtons pulsierenden Straßen in die ungewohnte bretonische Landschaft geleitete, war sicher in der weichen Ledertasche an ihrer Seite verstaut. Diese Zeilen drückten keinerlei Zuneigung aus, sondern lediglich Tatsachen und eine Einladung, die eher einem königlichen Befehl glich.
Shirley lächelte leicht verstimmt darüber. Doch ihre Neugier auf nähere Informationen über ihre Familie war größer als ihr Verdruss über den Kommandoton. Impulsiv und zugleich wohl überlegt arrangierte sie die Reise, verschloss das geliebte Haus in Georgetown und ließ Tony hinter sich.
Protestierend schrillte der Zug, während er die Station Lannion erreichte. Prickelnde Erregung verscheuchte die Reisemüdigkeit, als Shirley ihr Handgepäck nahm und auf den Bahnsteig hinaustrat. Zum ersten Mal sah sie das Geburtsland ihrer Mutter. Fasziniert blickte sie um sich und nahm die herbe Schönheit und die weichen, schmelzenden Farben der Bretagne in sich auf.
Ein Mann beobachtete, wie sie konzentriert und lächelnd um sich schaute. Überrascht hob er die dunklen Augenbrauen. Er nahm sich Zeit, Shirley zu betrachten: Sie war groß, ihre Figur gertenschlank, und sie trug ein tiefblaues Reisekostüm. Der flauschige Rock umschmeichelte die schönen langen Beine. Eine weiche Brise glitt sanft durch ihr sonnenhelles Haar und über das schmale ovale Gesicht. Er bemerkte die großen bernsteinfarbenen Augen, die von dichten dunklen Wimpern eingerahmt waren. Ihre Haut wirkte unbeschreiblich geschmeidig, glatt wie Alabaster, empfindlich wie eine zarte Orchidee. Er würde sehr bald feststellen, dass Erscheinungsbilder dieser Art häufig trügerisch sind.
Er näherte sich ihr langsam, beinahe widerstrebend. »Sind Sie Mademoiselle Shirley Smith?« Er sprach englisch mit einem leichten französischen Akzent.
Shirley zuckte bei dem Klang seiner Stimme zusammen. Sie war so in das Landschaftsbild versunken, dass sie seine Anwesenheit nicht bemerkt hatte. Sie strich eine Haarlocke aus dem Gesicht, wandte den Kopf und sah in die dunkelbraunen Augen des ungewöhnlich großen Mannes.
»Ja.« Sie wunderte sich über die eigenartige Anziehungskraft seines Blicks. »Kommen Sie von Schloss Kergallen?«
Er zog eine Braue hoch. »Allerdings. Ich bin Christophe de Kergallen. Die Gräfin beauftragte mich, Sie abzuholen.«
»De Kergallen?« wiederholte sie erstaunt. »Also noch ein weiterer geheimnisvoller Verwandter?«
Seine vollen sinnlichen Lippen bogen sich kaum merklich. »Mademoiselle, wir sind sozusagen Cousin und Cousine.«
»Verwandte also.«
Sie schätzten einander ab wie zwei Degenfechter vor dem ersten Gang.
Tiefschwarzes Haar fiel auf seinen Kragen, und die unbewegten Augen hoben sich fast ebenso dunkel von seiner bronzefarbenen Haut ab. Seine Gesichtszüge waren wie gemeißelt. Seine aristokratische Ausstrahlung wirkte gleichermaßen anziehend und abstoßend auf Shirley. Am liebsten hätte sie ihn sofort mit einem Bleistift auf einem Zeichenblock festgehalten.
Er ließ sich von ihrem langen prüfenden Blick nicht beirren und hielt ihm mit kühlen, reservierten Augen stand. »Ihre Koffer werden später ins Schloss gebracht.« Er nahm ihr Handgepäck vom Bahnsteig auf. »Kommen Sie jetzt mit mir. Die Gräfin wartet bereits auf Sie.«
Er führte sie zu einer schimmernden schwarzen Limousine, half ihr auf den Beifahrersitz und verstaute ihre Taschen im Kofferraum. Dabei verhielt er sich so kühl und unpersönlich, dass Shirley gleichzeitig verärgert und neugierig war. Schweigend fuhr er los, während sie sich zur Seite wandte und ihn betrachtete.
»Und wie kommt es, dass wir Cousin und Cousine sind?« Sie fragte sich, wie sie ihn nennen sollte. Monsieur? Christophe?
»Ihr Großvater, der Gatte der Gräfin, starb, als Ihre Mutter noch ein Kind war.« Sein Ton klang so höflich und leicht gelangweilt, dass sie ihm am liebsten geraten hätte, sich nur ja nicht zu überanstrengen. »Einige Jahre später heiratete die Gräfin meinen Großvater, den Grafen de Kergallen, dessen Frau gestorben war und ihm einen Sohn hinterlassen hatte. Das war mein Vater.« Er wandte den Kopf und warf ihr einen kurzen Blick zu. »Ihre Mutter und mein Vater wuchsen wie Geschwister im Schloss auf. Als mein Großvater starb, heiratete mein Vater, erlebte noch meine Geburt und kam dann bei einem Jagdunfall ums Leben. Meine Mutter grämte sich drei Jahre lang um ihn, bis auch sie starb.«
Seine Erzählung klang so unbeteiligt, dass Shirley nur wenig Mitgefühl für das früh verwaiste Kind empfand. Sie beobachtete erneut sein falkenähnliches Profil.
»Somit wären Sie der derzeitige Graf de Kergallen und mein angeheirateter Cousin.«
Wiederum ein kurzer nachlässiger Blick: »So ist es.«
»Diese beiden Tatsachen beeindrucken mich maßlos«, erwiderte sie sarkastisch.
Seine Braue hob sich erneut, als er Shirley anschaute, und einen Moment lang glaubte sie, dass seine kühlen dunklen Augen lachten. Doch dann verwarf sie den Gedanken, weil dieser Mann neben ihr bestimmt niemals lachte.
»Kannten Sie meine Mutter?« fragte sie, um das Schweigen zu beenden.
»Ja. Ich war acht Jahre alt, als sie das Schloss verließ.«
»Warum ist sie fortgegangen?«
Er blickte sie klar und unnachgiebig an, ehe er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße lenkte.
»Die Gräfin wird Ihnen berichten, was sie für notwendig hält.«
»Was sie für notwendig hält?« sprudelte Shirley hervor, verärgert über die Zurechtweisung. »Damit wir uns recht verstehen, Cousin: Ich beabsichtige, herauszufinden, warum meine Mutter die Bretagne verließ und mir zeit meines Lebens die Existenz meiner Großmutter vorenthalten hat.«
Langsam zündete Christophe sich ein Zigarillo an und ließ den Rauch gelassen ausströmen. »Ich kann Ihnen nichts weiter dazu sagen.«
»Das heißt, Sie wollen mir nichts weiter sagen.«
Er hob die breiten Schultern, und sie schaute wieder durch die Windschutzscheibe. Dabei entging ihr sein leicht amüsiertes Lächeln.
Der Graf und Shirley setzten die Fahrt überwiegend schweigsam fort. Gelegentlich erkundigte Shirley sich nach der Landschaft, durch die sie fuhren, und Christophe antwortete einsilbig, wenn auch höflich, ohne die geringste Absicht, die Konversation weiter auszudehnen. Die goldene Sonne und ein klarer Himmel genügten, um sie die Anstrengung der Reise vergessen zu lassen, aber seine Zurückhaltung forderte sie heraus.
Nachdem er sie wieder einmal mit zwei Silben beehrt hatte, bemerkte sie betont liebenswürdig: »Als bretonischer Graf sprechen Sie ein erstaunlich gutes Englisch.«
Gönnerhaft entgegnete er: »Auch die Gräfin beherrscht die englische Sprache, Mademoiselle. Die Dienstboten sprechen jedoch nur Französisch oder Bretonisch. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, werden die Gräfin oder ich Ihnen behilflich sein.«
Shirley blickte ihn von der Seite an, hochmütig und geringschätzig. »Das ist nicht notwendig, Graf. Ich spreche fließend Französisch.«
»Bon, umso besser. Das vereinfacht Ihren Aufenthalt.«
»Ist es noch weit bis zum Schloss?« Shirley fühlte sich erhitzt, zerknittert und müde. Die endlose Reise und die Zeitverschiebung gaben ihr das Gefühl, tagelang in einem schaukelnden Fuhrwerk verbracht zu haben, und sie sehnte sich nach einer soliden Badewanne mit warm schäumendem Wasser.
»Wir befinden uns schon seit geraumer Zeit auf Kergallen, Mademoiselle. Das Schloss ist nicht mehr weit entfernt.«
Das Auto fuhr langsam auf eine Anhöhe zu. Shirley schloss die Augen wegen des drückenden Kopfwehs und wünschte sehnlichst, dass ihre mysteriöse Großmutter in einem weniger komplizierten Ort lebte, zum Beispiel in Idaho oder New Jersey. Als sie die Augen wieder öffnete, lösten sich Schmerzen und Müdigkeit wie Nebel in heißer Sonne auf.
»Halten Sie an«, rief sie und legte unwillkürlich eine Hand auf Christophes Arm.
Das Schloss stand hoch, stolz und einsam auf der Anhöhe: ein weitläufiges steinernes Gebäude aus einem früheren Jahrhundert, mit Wachtürmen, Schießscharten und einem spitz zulaufenden Ziegeldach, das sich warm und grau vom hellblauen Himmel abhob. Die unzähligen hohen Fenster standen dicht beieinander und reflektierten das Sonnenlicht in allen nur erdenklichen Farben. Shirley verliebte sich auf Anhieb in das Vertrauen erweckende alte Schloss.
Christophe beobachtete, wie sich Überraschung und Freude in ihrem offenen Gesicht abwechselten, während ihre Hand noch immer weich und leicht auf seinem Arm lag. Eine einzelne Locke war ihr in die Stirn gefallen. Er wollte sie zurückstreichen, unterließ es dann aber.
Shirley war in den Anblick des Schlosses versunken. Sie malte sich schon die Winkel aus, die sie zeichnerisch festhalten würde. Dabei stellte sie sich den Festungsgraben vor, der einst wahrscheinlich das Schloss umgeben hatte.
»Es ist traumhaft«, sagte sie schließlich und sah ihren Begleiter an. Hastig zog sie ihre Hand von seinem Arm zurück. »Wie im Märchen. Ich höre die Trompetenklänge, sehe die Ritter in ihren Rüstungen und die Damen in schwebenden Gewändern und hohen, spitzen Hüten. Gibt es hier auch einen Drachen?« Sie lächelte ihn an.
»Höchstens Marie, die Köchin.« Einen Augenblick lang fiel seine kühle, höfliche Maske ab. Mit einem schnellen Blick erfasste sie das entwaffnende Lächeln, das ihn jünger und zugänglicher machte.
Er ist also doch ein wenig menschlich, entschied sie. Als ihr Puls sich beschleunigte, gestand sie sich ein, dass er, wenn schon menschlich, umso gefährlicher war. Ihre Augen trafen sich, und sie hatte das eigenartige Gefühl, völlig allein mit ihm zu sein. Georgetown schien am Ende der Welt zu liegen.
Doch der charmante Begleiter fiel gleich wieder in die Rolle des förmlichen Fremden zurück: Christophe setzte die Fahrt schweigend fort, verschlossen und kühl nach dem kurzen, freundlichen Zwischenspiel.
Sei vorsichtig, ermahnte Shirley sich. Deine Fantasie spielt dir einen Streich. Dieser Mann ist nicht für dich geschaffen. Aus irgendeinem unbekannten Grund mag er dich nicht einmal, und trotz eines einzigen flüchtigen Lächelns bleibt er ein gefühlloser, herablassender Aristokrat.
Christophe brachte das Auto an einer weiten, gewundenen Auffahrt zum Stehen. Sie bogen in einen gepflasterten Hof ein, an dessen Mauern Phlox wucherte. Schwungvoll verließ er den Wagen, und Shirley tat es ihm gleich, ehe er ihr behilflich sein konnte. Sie war so entzückt von der märchenhaften Umgebung, dass sie sein Stirnrunzeln über ihre Eigenmächtigkeit überhaupt nicht bemerkte.
Er nahm ihren Arm und führte sie die Steinstufen hinauf zu einer schweren Eichentür. Er zog an dem schimmernden Griff, neigte leicht den Kopf und forderte sie auf, einzutreten.
Der Fußboden der riesigen Eingangshalle war spiegelglänzend poliert und mit erlesenen handgeknüpften Teppichen belegt. An den getäfelten Wänden hingen farbenfrohe, unglaublich alte Tapisserien. Die Balkendecke und ein Jagdtisch aus Eichenholz waren mit anheimelnder Alterspatina überzogen. Eichenstühle mit handgearbeiteten Sitzen und der Duft frischer Blumen belebten den Raum, der ihr merkwürdig bekannt vorkam. Ihr schien, als hätte sie gewusst, was sie beim Betreten dieses Schlosses erwartete, und die Halle hieß sie willkommen.
»Ist irgendetwas nicht in Ordnung?« Christophe bemerkte ihren verwirrten Gesichtsausdruck.
Sie schüttelte den Kopf. »Seltsam, es ist, als hätte ich dies alles schon einmal gesehen, und zwar mit Ihnen.« Sie atmete tief und bewegte unruhig die Schultern. »Es ist wirklich sehr eigentümlich.«
»Also hast du sie endlich hierher gebracht, Christophe.«
Shirley sah, wie ihre Großmutter auf sie zukam.
Die Gräfin de Kergallen war groß und fast ebenso schmal wie Shirley. Ihr Haar leuchtete weiß und umrahmte das scharfe, kantige Gesicht, dessen Haut den Altersfältchen trotzte. Die Augen unter den wunderschön geschwungenen Brauen waren stechend blau. Sie hielt sich königlich aufrecht wie eine Frau, die weiß, dass sechzig Lebensjahre ihre Schönheit nicht zu schmälern vermochten.
Diese Dame ist eine Gräfin vom Scheitel bis zur Sohle, dachte Shirley.
Die Gräfin betrachtete Shirley bedächtig und intensiv, und nach einem kurzen Aufleuchten war das Gesicht gleich wieder unbeweglich und beherrscht. Sie streckte ihre schön geformte, mit Ringen geschmückte Hand aus.
»Willkommen im Schloss Kergallen, Shirley Smith. Ich bin Gräfin Frangoise de Kergallen.«
Shirley umfasste die Hand und fragte sich absonderlicherweise, ob sie sie küssen und einen Knicks machen müsste. Der Handschlag war kurz und formell: keine liebevolle Umarmung, kein Willkommenslächeln. Sie verbarg ihre Enttäuschung und entgegnete ebenso zurückhaltend: »Danke, Madame. Ich freue mich, hier zu sein.«
»Sie sind sicherlich erschöpft nach Ihrer Reise. Ich werde Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Wahrscheinlich möchten Sie sich ausruhen, ehe Sie sich zum Abendessen umkleiden.«
Shirley folgte ihr eine breite, geschwungene Treppe hinauf. Auf dem Absatz blickte sie sich nach Christophe um, der sie beobachtete. Er dachte überhaupt nicht daran, den Blick von ihr abzuwenden. Shirley drehte sich schnell um und eilte der Gräfin hinterher.
Sie gingen einen langen, engen Flur hinunter. Messingleuchter waren in regelmäßigen Abständen in die Wände eingelassen, anstelle von ehemaligen Fackeln, vermutete Shirley. Als die Gräfin vor einer Tür anhielt, sah sie sich noch einmal um, nickte kurz, öffnete die Tür und bat Shirley, einzutreten.
Das Zimmer war weiträumig, doch trotzdem anheimelnd. Die Kirschholzmöbel glänzten. Ein Himmelbett dominierte in diesem Raum, der seidene Überwurf erzählte eine lange Geschichte von Zeit raubenden Nadelstichen. Ein steinerner Kamin befand sich dem Bett gegenüber. Sein dekorativ ziseliertes Sims war mit Dresdner Porzellanfiguren verziert, die der große gerahmte Spiegel darüber zurückwarf. Das Ende des Raums war gerundet und verglast. Ein gepolsterter Sessel am Fenster lud zu einer Ruhepause und zu einem Blick auf die atemberaubende Aussicht ein.
Shirley war von diesem Zimmer und seiner besonderen Atmosphäre fasziniert. »Es gehörte meiner Mutter, nicht wahr?«
Wiederum leuchteten die Augen der Gräfin kurz auf, wie eine verlöschende Kerze. »Ja. Gabrielle richtete es ein, als sie eben erst sechzehn Jahre alt war.«
»Ich danke Ihnen, dass Sie es mir überlassen haben, Madame.« Selbst die kühle Antwort beeinträchtigte nicht die Wärme des Raums. Shirley lächelte: »Ich werde meiner Mutter während meines Aufenthalts hier sehr nahe sein.«
Die Gräfin nickte nur und drückte einen kleinen Knopf in der Nähe des Bettes. »Catherine wird Ihnen das Bad bereiten. Ihre Koffer werden bald ankommen, und dann wird sie sich um das Auspacken kümmern. Wir speisen um acht Uhr, es sei denn, Sie wollen jetzt eine kleine Erfrischung zu sich nehmen.«
»Nein, danke, Gräfin«, erwiderte Shirley und fühlte sich wie ein Logiergast in einem sehr gut geführten Hotel. »Acht Uhr ist gerade recht.«
Die Gräfin wandte sich zur Tür. »Catherine wird Ihnen den Salon zeigen, sobald Sie sich etwas ausgeruht haben. Um halb acht werden Cocktails serviert. Wenn Sie etwas benötigen, brauchen Sie nur zu läuten.«
Nachdem die Tür sich hinter der Gräfin geschlossen hatte, atmete Shirley tief ein und ließ sich auf das Bett fallen.
Warum bin ich nur hierher gekommen? Sie schloss die Augen und fühlte sich plötzlich sehr einsam. Ich hätte in Georgetown bleiben sollen, bei Tony, in der vertrauten Umgebung. Was suche ich eigentlich hier? Sie seufzte tief auf, kämpfte gegen die aufkeimende Niedergeschlagenheit an und sah sich erneut in dem Raum um. Das Zimmer meiner Mutter, erinnerte sie sich und glaubte, ihre besänftigenden Hände zu spüren. Wenigstens dies hier begreife ich.
Shirley trat ans Fenster und beobachtete, wie sich der Tag im Zwielicht auflöste. Die Sonne blitzte ein letztes Mal auf, ehe sie unterging. Eine Brise bewegte die Luft und vereinzelte Wolken, die träge über den dunkelnden Himmel zogen.
Ein Schloss auf einem Hügel in der Bretagne. Bei dem Gedanken daran schüttelte sie den Kopf, kniete sich auf den Fenstersessel und beobachtete den Anbruch des Abends. Wie passte Shirley Smith hierher? Wo war ihr Platz? Sie zog die Stirn kraus über die plötzliche Erkenntnis: Irgendwie gehöre ich hierher, zumindest ein Teil von mir. Ich fühlte es in dem Augenblick, als ich die überwältigenden Steinmauern sah, und dann wieder in der Eingangshalle. Sie unterdrückte ihre Gefühle und dachte über ihre Großmutter nach.
Sie war nicht gerade angetan von der Begegnung, entschied Shirley kläglich. Oder vielleicht beruhte ihr kaltes, distanziertes Verhalten nur auf europäischer Förmlichkeit. Vermutlich hätte sie mich nicht eingeladen, wenn sie mich nicht auch wirklich kennen lernen wollte. Wahrscheinlich erwartete ich mehr, weil ich mir etwas anderes vorgestellt hatte. Geduld war noch nie meine Stärke, und so muss ich mich jetzt wohl dazu zwingen. Wäre die Begrüßung am Bahnhof doch nur etwas zuvorkommender verlaufen. Beklommen dachte sie erneut an Christophes Benehmen.
Ich könnte schwören, dass er mich am liebsten gleich wieder mit dem Zug zurückgeschickt hätte, als er mich sah. Und dann die verletzende Unterhaltung im Wagen. Was für ein enttäuschender Mann, das Abbild eines bretonischen Grafen. Vielleicht liegt es daran, dass er mich so sehr beeindruckt hat. Er unterscheidet sich in allem von den Männern, die ich vorher kannte: elegant und gleichzeitig vital. Seine Kultiviertheit verbirgt Kraft und Männlichkeit. Stärke, das Wort blitzte in ihren Gedanken auf, und sie zog die Brauen dichter zusammen. Ja, er ist stark und selbstbewusst, gestand sie sich widerwillig ein.
Für einen Künstler wäre er ein ideales Modell. Er interessiert mich als Malerin, redete sie sich ein, nicht als Frau. Eine Frau müsste verrückt sein, um sich gefühlsmäßig von solch einem Mann beeindrucken zu lassen. Völlig von Sinnen, bestärkte sie sich innerlich.
2. KAPITEL
Der goldgerahmte frei stehende Spiegel reflektierte Shirleys Ebenbild: eine schlanke blonde Frau. Das fließende, hochgeschlossene Gewand aus altrosa Seide ließ Arme und Schultern frei und unterstrich die zarte Hautfarbe. Shirley betrachtete ihre Bernsteinaugen und seufzte auf. Gleich musste sie hinuntergehen, um erneut ihrer Großmutter und ihrem Cousin zu begegnen: der aristokratisch zurückhaltenden Gräfin und dem förmlichen, merkwürdig feindseligen Grafen.
Ihre Koffer waren angekommen, während sie das Bad genoss, das das dunkelhaarige bretonische Zimmermädchen eingelassen hatte. Catherine packte die Kleider aus, zunächst etwas scheu, doch dann hell begeistert über die schönen Sachen. Sie brachte sie in dem breiten Kleiderschrank und in einer antiken Kommode unter. Ihr natürliches, freundliches Wesen unterschied sich auffällig von den Umgangsformen ihrer Herrschaft.
Shirleys Versuch, sich in den kühlen Leinenlaken des großen Himmelbetts auszuruhen, scheiterte an ihrer inneren Unruhe. Die seltsame Vertrautheit des Schlosses, der steife, formelle Empfang der Großmutter und die Anziehungskraft des abweisenden Grafen machten sie nervös und unsicher. Hätte sie sich doch nur von Tony überzeugen lassen, dann wäre sie in der vertrauten Umgebung geblieben.
Sie atmete tief, reckte die Schultern und hob das Kinn. Schließlich war sie kein naives Schulmädchen mehr, das sich von Schlössern und übertriebenen Förmlichkeiten einschüchtern ließ. Sie war Shirley Smith, die Tochter von Jonathan und Gabrielle Smith, und sie würde den Kopf hochhalten und es mit Grafen und Gräfinnen aufnehmen.
Catherine klopfte leise an die Tür, und Shirley folgte ihr in gespieltem Selbstvertrauen den langen Gang entlang und die gewundene Treppe hinunter.
»Guten Abend, Mademoiselle Smith.« Christophe begrüßte sie am Fuß der Treppe mit der gewohnten Förmlichkeit. Catherine zog sich schnell und bescheiden zurück.
»Guten Abend, Graf«, erwiderte Shirley ebenso unpersönlich, als sie sich erneut gegenüberstanden.
Der schwarze Abendanzug verlieh seinen adlerhaften Zügen ein geheimnisvolles Aussehen. Die dunklen Augen leuchteten beinahe pechschwarz, und die bronzefarbene Haut hob sich glänzend von dem schwarzen Stoff und dem blendend weißen Hemd ab. Sollte er von Piraten abstammen, dann hatten sie jedenfalls viel Geschmack besessen und mussten bei ihren seeräuberischen Unternehmungen über die Maßen erfolgreich gewesen sein, vermutete Shirley, als er sie lange ansah.
»Die Gräfin erwartet uns im Salon.« Unerwartet charmant bot er ihr den Arm.
Die Gräfin beobachtete sie, als sie das Zimmer betraten: den hoch gewachsenen stolzen Mann und die schlanke goldhaarige Frau an seiner Seite. Ein auffallend schönes Paar, überlegte sie. Jedermann würde sich nach ihnen umdrehen. »Guten Abend, Shirley und Christophe.« Sie trug ein königliches saphirblaues Gewand und ein funkelndes Diamantkollier. »Meinen Aperitif, bitte, Christophe. Und was trinken Sie, Shirley?«
»Wermut, wenn ich bitten darf, Madame«, lächelte sie verbindlich.
»Ich hoffe, Sie haben sich gut ausgeruht«, bemerkte die Gräfin, als Christophe ihr das kleine Kristallglas reichte.
»Wirklich sehr gut, Madame.« Sie wandte sich ein wenig ab, um den Dessertwein entgegenzunehmen. »Ich ...« Sie verschluckte die geistlosen Worte, die sie sich zurechtgelegt hatte, weil ihr Blick von einem Porträt gefesselt wurde. Sie drehte sich vollends um und betrachtete es.
Eine hellblonde Frau mit zarter Hautfarbe schaute sie an. Das Gesicht war ihr eigenes Ebenbild. Abgesehen von der Länge des goldenen Haars, das bis auf die Schultern fiel, und den tiefblauen statt bernsteinfarbenen Augen gab das Porträt Shirley wieder: das ovale Gesicht, feinfühlig, mit geheimnisvollen Linien, der volle, geschwungene Mund und die zerbrechliche, fliehende Schönheit ihrer Mutter, in Ölfarben vor einem Vierteljahrhundert festgehalten.
Das war das Werk ihres Vaters. Shirley erkannte es sofort. Da war kein Irrtum möglich. Pinselführung und Farbgebung verrieten die individuelle Technik von Jonathan Smith so sicher wie die kleine Signatur am unteren Rand. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, doch sie unterdrückte den bedrohlichen Schleier. Beim Anblick des Porträts fühlte sie einen Augenblick lang die Gegenwart ihrer Eltern, die Wärme und Zuneigung, auf die sie mittlerweile zu verzichten gelernt hatte.
Sie betrachtete das Gemälde eingehend, um sich noch mehr mit dem Werk ihres Vaters auseinander zu setzen: die Falten des perlmutthellen Gewands, die Rubine an den Ohren, ein scharfer Farbkontrast, der sich in dem Ring auf ihrem Finger wiederholte.
»Ihre Mutter war eine sehr schöne Frau«, bemerkte die Gräfin nach geraumer Zeit, und Shirley antwortete wie abwesend, noch gefangen von den Augen ihrer Mutter, die Liebe und Glück ausstrahlten.
»Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie wenig sie sich verändert hat, seitdem mein Vater dieses Bild malte. Wie alt war sie damals?«
»Kaum zwanzig«, erwiderte die Gräfin knapp. »Sie haben die Arbeit Ihres Vaters also sofort erkannt.«
»Aber selbstverständlich.« Shirley wandte sich um und lächelte herzlich und aufrichtig. »Als seine Tochter und Kunstgefährtin erkenne ich seine Werke ebenso schnell wie seine Handschrift.«
Sie betrachtete das Porträt noch einmal und bewegte lebhaft die feingliedrige Hand. »Das Bild entstand vor fünfundzwanzig Jahren, und es erfüllt diesen Raum hier immer noch mit Wärme und Leben.«
»Die Ähnlichkeit mit Ihrer Mutter ist in der Tat stark ausgeprägt«, bemerkte Christophe. Er stand dicht beim Kaminsims, nahm einen Schluck aus seinem Glas und fesselte ihre Aufmerksamkeit, als wollte er ihre Hände ergreifen. »Ich war ganz überwältigt, als Sie aus dem Zug stiegen.«
»Nur die Augen unterscheiden sich voneinander«, konstatierte die Gräfin, ehe Shirley eine passende Bemerkung einflechten konnte. »Sie hat die Augen ihres Vaters geerbt.«
Ihre Stimme klang bitter, daran bestand kein Zweifel. Shirley drehte sich zu ihr um: »Ja, Madame, ich habe die Augen meines Vaters. Macht Ihnen das etwas aus?«
Die Gräfin hob abweisend die ausdrucksvollen Schultern und nippte an ihrem Glas, ohne die Frage zu beantworten.
»Sind meine Eltern sich hier im Schloss begegnet?« Shirley bemühte sich um Geduld. »Warum sind sie fortgegangen und nie wieder zurückgekehrt? Weshalb haben sie mir nie etwas von Ihnen erzählt?« Sie blickte von ihrer Großmutter zu Christophe: in zwei kühle, ausdruckslose Gesichter. Die Gräfin hatte eine Barriere errichtet, und Shirley wusste, dass Christophe sie nicht einreißen durfte. Er würde ihr nichts von dem sagen, was sie wissen wollte. Nur die Frau könnte ihre Fragen beantworten. Sie wollte noch etwas sagen, doch eine Bewegung der ringgeschmückten Hand schnitt ihr das Wort ab.
»Darüber werden wir später sprechen.« Es klang wie eine königliche Verordnung. Die Gräfin erhob sich: »Jetzt werden wir erst einmal zu Abend essen.«