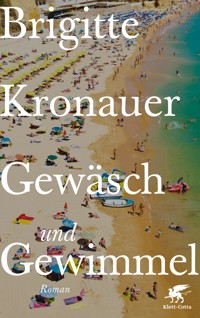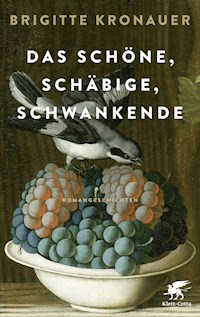
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Dieses Buch … ist die Summe ihres Schaffens. Sie war wirklich eine der besten und wichtigsten Autorinnen, die wir hatten.« Volker Weidermann, ZDF – Das Literarische Quartett, 09.08.2019 Im Haus eines Ornithologen geht eine Schriftstellerin den Abgründen der Schriftstellerei auf den Grund. Es geht ihr dabei ums Ganze. Denn ihre zutiefst eigene Symphonie des Schreibens ist bedroht. Vogellaute und geflügelte Wesen gehören zum vielstimmigen Orchester dieses sprachmächtigen neuen Romans von Brigitte Kronauer, in dem Kunst und Schicksal eine einzigartige Symbiose eingehen. Ein Haus im Wald mit blauen Schlagläden. An den Wänden Schautafeln, über und über mit Vögeln bedeckt, im lichten Geäst der Stämme Vogelgezwitscher. Der Schriftstellerin, die vorübergehend im Haus des Ornithologen lebt, will mit ihrem Roman nicht recht vorankommen. Stattdessen drängen sich ihr die Vögel des Waldes auf, und bald schon schälen sich aus ihnen die Gesichter von Freunden und deren Geschichten: die Schönen, die Schäbigen und die Schwankenden. Unbehelligt verfasst sie eine Geschichte nach der anderen, bis es eines Nachts an die blauen Schlagläden klopft und der Ornithologe sein Haus zurückfordert. Befand sich die Schriftstellerin gerade noch in einer magischen Parallelwelt, führt dieser Umbruch zu einer radikalen Hinterfragung der eigenen Existenz. Filigran und machtvoll webt Brigitte Kronauer ein engmaschiges Netz bedrohter Subjekte und stellt als dessen Höhepunkt das Schriftstellerleben selbst auf den Prüfstand. »Brigitte Kronauer leuchtet tief in die Sedimentschichten hinein, aus der die beiden großen Sphären der Welt bestehen, die menschliche Innenwelt und die weite Landschaft, und blendet sie ineinander.« Nico Bleutge, Neue Zürcher Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 908
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Brigitte Kronauer
Das Schöne, Schäbige, Schwankende
Romangeschichten
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP
Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von
© Fine Art Images – ARTOTHEK
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96412-7
E-Book: ISBN 978-3-608-19158-5
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
1
Das Schöne, Schäbige, Schwankende
2
Die Vögel
3
Sonst bürste ich dir die Lippen blutig
4
Die Jahre mit Katja
5
Grünewald
1
Das Schöne, Schäbige, Schwankende
Wie sollte ich ahnen, daß die beiden schon nach sieben Wochen zu Tode erschöpft in der Nacht wie Verfolgte an die Schlagläden klopfen würden! Mir war auch ohne sie verrückt genug zumute.
Kürzlich konnte ich einige Zeit in ihrem Häuschen mit den blauen Schlagläden verbringen, um dort zurückgezogen an einem Romanmanuskript zu arbeiten. Das kam mir sehr entgegen, weil in unserem eigenen kleinen, schon achtzig Jahre alten Haus alle Leitungen erneuert werden mußten. Mein Mann Paul würde die Arbeiten beaufsichtigen. Ich durfte entwischen.
Das Manuskript trug den vorläufigen Titel »Glamouröse Handlungen«, der ein bißchen aggressiv gemeint war, denn solange ich veröffentliche, hat man mir vorgeworfen, mal grob, mal mit sanftem Kopfschütteln, vom sogenannten Plot nichts zu verstehen. Im Klartext heißt das, man unterstellt mir narrative Impotenz. Weiß ich etwa nicht, daß die Welt von sogenannten Handlungen und Ereignissen zwischen Mikro- und Makrokosmos geradezu birst und Heerscharen von Autoren ihnen nachhetzen auf Teufel komm raus? Ich hoffte, diesmal den Stier nach meinem Gusto bei den Hörnern packen zu können. Irgendwelche Leute sollten sich schwer wundern.
Das Haus ist nur durch ein schütteres Wäldchen von der Autobahn getrennt, die einerseits nach Berlin, andererseits nach Frankfurt an der Oder führt. Davon merkt man aber nichts, und die vielen Vögel der Umgebung stört es kaum. Das ist wichtig, weil hier normalerweise, wenn er sich nicht in der Stadt aufhält, ein Ornithologe wohnt, den ich, als ich ihn und seine Frau kennenlernte, nicht recht leiden mochte. In den Bücherschränken finden sich die herrlichsten Kompendien. An den Wänden hängen Fotografien, Schautafeln, Zeichnungen, auf denen das geflügelte Tierreich prächtig und in Überfülle präsentiert ist, vom Eisvogel bis zum Östlichen Waldpiwi, vom Federhelm-Turako bis zum Schwarzstirnwürger. Ein gefiedertes Volk, in dem jeder in der Lage ist, sich dann, wenn es ihm in Erdnähe zu lästig wird, in die Lüfte zu schwingen. Besonders in dem winzigen Raum, in dem ich schlief, waren sie dicht um mich versammelt und sahen mich an, sobald ich die Augen öffnete, und wenn ich sie schloß, spürte ich ihre Blicke erst recht. Beim Einschlafen glaubte ich, mich in einem italienischen Café zu befinden, in Verona war’s, und es hieß Café Dante, ganz gefüllt mit alten Leuten, die in großer Fröhlichkeit unermüdlich durcheinanderzwitscherten. Keiner hörte dem anderen zu. Darauf kam es nicht an, nur auf die jauchzende Meldung, am Leben zu sein. So war es auch in dem Haus des Vogelkundlers. Seine zweidimensionalen Genossen jubilierten und schrien aber nicht aus der Kehle heraus wie an einem frühen, noch hellgrauen Frühlingsmorgen, sondern aus Leibeskräften mit der in mir nachhallenden Farbenleidenschaft ihres Gefieders. Dann wieder schwiegen sie still, äugten nur und lauerten zu mir hin. Ich nahm in diesen Momenten ihre Schnäbel wahr, die nicht selten, wäre man ihr Opfer, zu tödlichen Instrumenten werden. So ist es von der Natur vorgesehen.
Davon hatte der Ornithologe gelegentlich erzählt. Er war mit seiner Frau, obschon beide längst ein weißhaariges Paar sind (er mit langem Bart, sie mit langem Zopf, beides ein bißchen melodramatisch alternativ), für drei Monate in Costa Rica auf Forschungsreise. Innerhalb dieses Zeitraums durfte ich, so ihr Angebot, in dem Haus wohnen. Ich hatte hocherfreut angenommen und mich auf die Frist eingerichtet, vielleicht allerdings die Wirkung ungewohnter, strikter Einsamkeit unterschätzt.
Wie sollte ich ahnen, daß sie schon, wie gesagt, nach sieben Wochen zu Tode erschöpft in der Nacht wie Verfolgte an die Schlagläden klopfen würden! Die Frau war von einem schweren, wenn auch dilettantisch durchgeführten Raubüberfall gezeichnet. Man hatte sie, als sie dieses eine Mal allein unterwegs war, vom Straßenrand weg in ein Auto gezerrt und sie später ohne ihre Expeditionskleidung, nur in der Unterwäsche, ohne Geld und Papiere, ansonsten unbeschädigt, weit außerhalb der Zivilisation in einer glühenden Steinlandschaft ausgesetzt. Zu Menschen fand sie erst nach stundenlangem Marsch durch Sonne und Staub zurück, froh immerhin, nicht wegen einer Lösegeldforderung entführt worden zu sein, die leicht mörderisch hätte enden können. Die zerlumpten, noch sehr jungen Banditen hatten sie mit einer reichen Unternehmerin aus der Schweiz verwechselt und sie, nachdem ihnen ihr Irrtum klar geworden war, unter Flüchen geplündert laufen lassen.
Ihren Mann sah sie als Patienten im Krankenhaus wieder. Er war während ihrer Abwesenheit beim Fotografieren in einer unachtsamen Sekunde von einer sehr kleinen, aber berüchtigten Schlange gebissen worden. Wem in einem solchen Fall nicht innerhalb kurzer Zeit ein Gegengift gespritzt werden kann, der muß unter kaum zu ertragenden Schmerzen sterben. Soviel Unglück reichte den beiden, zumal sich ihr fortgeschrittenes Alter, das sie bisher nicht gespürt hatten, in einer plötzlichen, ihnen bisher unbekannten Nervenschwäche und Mutlosigkeit bemerkbar machte.
Trotzdem riefen sie in jener überraschenden Ankunftsnacht abwechselnd zwischen der Schilderung von Attacken eines nach wie vor panischen Schreckens immer wieder und das zu Recht: »Wie haben wir doch alle beide großes Glück gehabt!«
Ich selbst hatte natürlich das Pech, umgehend ausziehen zu müssen aus dem grünen Idyll, einem Idyll allerdings, das in nächster Nähe Brachland mit trostlosen Schuppen, verwahrlosten Häusern und demolierten Garagen aufwies, nach denen sich das Fernsehen im Bemühen, geeignete Locations für Verbrecherisches zu entdecken, die Finger geleckt hätte. Man mußte mir nicht sagen, was zu tun war. Der Anstand gebot es leider. Dabei war ich mit meinem Roman »Glamouröse Handlungen« noch kein Stück weiter. Es mußte an den Vogelabbildungen liegen, die mich, begünstigt durch meine Abgeschiedenheit, von früh bis spät so feurig und hartnäckig umdrängten und auf ganz andere Gedanken brachten. Erinnerungen und Phantasien umstellten mich, wenn ich zwischen den heruntergekommenen Feldern wanderte, von bedrohlichen Hunden erschreckt, von anderen willkommen geheißen an einem schön gewundenen Bachlauf mit mehreren Autowracks, das Blech verrottend, die Vegetation triumphierend aus den Ritzen schießend, wenn ich im verholzten Gestrüpp zwischen den alten Fruchtständen des Sauerampfers auf ausrangierte Waschmaschinen stieß, auf verstoßene Kühlschränke und auf ein paar magere Pferde, eng umzäunt, in unmittelbarer Nachbarschaft von viel leerem Weideland, das ihnen ohne Sinn, Verstand und Mitgefühl vorenthalten wurde.
Die Vögel formierten sich auf diesen Gängen zu einer imaginären Tapete. Richtig, sie tapezierten zunehmend die Wiesen, musterten unverschämt die Wolken und starrten mich herausfordernd an. Hätte ich vor ihnen ins Freie flüchten wollen, wäre es also vergeblich gewesen. Sie warteten dort draußen schon. Mir war ihre Dauerbegleitung nicht unangenehm. Mich amüsierte nämlich etwas dabei. Wie man, jeder hat es schon erlebt, in Mauerrissen, alten Kartoffeln und Felszacken manchmal den suggestiven Zauber von Menschengesichtern entdeckt, so daß man Mühe hat, überhaupt den wirklichen Gegenstand wahrzunehmen, so zwangen mir die Vögel, von Tag zu Tag beherrschender, im Haus und draußen ihre Ähnlichkeit mit Personen auf, mit Freunden, flüchtigen und alten Bekannten.
Schließlich waren es nicht mehr die Geflügelten, die über mich regierten, es waren die Menschen, die durch sie hindurchstarrten und die sich jetzt unbedingt entfalten wollten. Dafür benötigten sie Platz, wischten ohne Rücksicht Vögel und »Handlung« beiseite und beehrten mich, den offenbar geeigneten Landeplatz für ihre Ausuferungen, voller Beschwerden, Wichtigtuereien und Ticks, rund um die Uhr mit ihrer Anwesenheit, die ich meines Berufs wegen schriftlich beglaubigen sollte.
Ich fand, um es kurz zu machen, Geschmack daran, und es war ja noch sehr die Frage, wer eigentlich Herr der Situation bleiben würde. Machten sie sich her über mich oder war ich es, die sie dorthin lenkte, wo ich sie hin haben wollte bis zum letzten Satz?
Angesichts ihrer Aufdringlichkeit rettete ich mich, vor allem weil ich nicht gedachte, mir etwas von der Bande diktieren zu lassen, durch eine bürokratische Aufteilung. Neununddreißig Porträts sollten zu je dreizehn nach drei Kategorien geordnet werden. Sie lauteten:
Das Schöne,
das Schäbige,
das Schwankende.
Das spann ich, durch die barsche, strohige, oft chaotische Landschaft stapfend, weiter aus, dabei Auge in Auge mit den Vogelgesichtern, wohin mein Blick auch fiel. Ich wollte es inzwischen gar nicht mehr anders. Mich trieb und beflügelte eine Besessenheit. Drei Entwicklungsstufen hätten die Figuren zu durchlaufen, mit sehr unterschiedlichem Erfolg, je nach Abteilung.
Die Schäbigen würden in einen stetigen Fall geraten, von akzeptabler Plattform aus wäre es ein Sturz ins immer Unerfreulichere ohne Aufenthalt.
Die Schönen müßten so beginnen, daß man ihre herausragende Eigenschaft zunächst nicht bemerkt. Erst allmählich, aber kontinuierlich, würde sich ihr Aufstieg abzeichnen aus der normalen Lebenstrübnis zur lichten Offenbarung.
Die Schwankenden, so hatte ich es geplant, sollten weder ausdrücklich so noch so beginnen, vielmehr durchmischt, unentschieden anfangen, dann zu einem glänzenden Moment aufsteigen und von dort aus wieder absinkend, in der Weise gezähmt, wie sie es jeweils verdienten.
Das alles auf gedrängtem Raum. Die Reihenfolge der Gruppen wollte ich noch offen lasssen.
Ich stolperte oft beim Gehen, nicht nur wegen des schwierigen Geländes, auch, weil ich in meine Zuordnungen versunken war. Einmal rutschte ich mit dem ganzen Körper in den Matsch einer Wagenspur. Glücklicherweise war ich bei dem lächerlichen Schauspiel allein. Mag sein, daß die Vögel grinsten. Es half ihnen nicht. Ich hatte, wie es sich gehört, sie und die Personen in meiner Gewalt.
Es ging gut voran. Dann kam die Nacht, in der das Paar an die blauen Schlagläden klopfte. Etwas Merkwürdiges passierte. Das völlig unerwartete Auftauchen der beiden Weißköpfe in meiner Einöde versetzte der sorgfältig geordneten Welt meiner Skizzen und Pläne einen brutalen Stoß. Plötzlich trudelten die Rubriken durcheinander, die Figuren glitten aus ihren Umzäunungen ins Nachbarfeld, richtiger wäre zu sagen, die Linien verwischten sich, alles verlor den sortierenden Halt, alles zwitscherte durcheinander wie die Alten im Café Dante und freute sich seiner Freiheit, die ich ihnen nicht gönnte. Trotzdem ließ ich sie in meiner Ratlosigkeit gewähren.
Nur ein paar Lieblinge gibt es unter ihnen, die unangefochten für den, der sehen kann, ihr Prachtgefieder entfalten. Niemand rühre sie an!
2
Die Vögel
Die Prächtige
Kaum hatte ich, ganz zerzaust aus dem stürmischen Wetter geflüchtet, oben im Dünenrestaurant Platz genommen, setzte sich mir die Prächtige gegenüber und versperrte den Blick. Zumindest unterbrach sie ihn. Gut, kein anderer Tisch war frei, das entschuldigte sie vielleicht, änderte aber nichts daran, daß sie mich um die ungehemmte Sicht nach draußen brachte. Ich sah sie nicht weiter an, diese Person im Gegenlicht, die zwangsläufig der Brandung den Rücken zuwandte und die ich keinesfalls durch Augenkontakt zum Sprechen ermutigen wollte. Es ging nämlich, ich spürte es gleich, ein unverkennbar kontaktfreudiges Ruckeln aus von der Frau. Typisch für einsam lebende Menschen, besonders für weibliche, mit einem Redestau mangels Gesprächspartner.
War ich denn, Herrgott nochmal, nicht bereits in eine komplizierte Unterhaltung vertieft? Es ging darum, das Wichtigste auf die berühmteste Inselpostkarte zu kriegen. Ich meine natürlich die, auf der die rote Lokomotive mit ihrer Waggonreihe über den Hindenburgdamm vor der Verfolgung durch die hinter dem Zug riesig aufgetürmten und auch schon blendend weiß aufschäumenden Wassermassen Reißaus zu nehmen versucht. Donnernd werden die Wellen (besonders die am steilsten aufragende freut sich darauf), im nächsten Moment über den Scheinsiegen der Technik zusammenbrechen. Man hört das Jauchzen doch bereits im Voraus!
Ein historisches Foto, dem man besser keinen lammfrommen Glauben schenkt. Ich wollte es unbedingt an Paul schicken, den ich mit meinen Reiseberichten, wenn ich ohne ihn unterwegs sein muß, so gern verwöhne. Was aber waren die persönlichsten Nachrichten für die knapp bemessene Fläche auf der Rückseite im Kontrast zu der allen Leuten zugänglichen Vorderansicht? Da würde ich streng auswählen müssen beim Imponieren, Renommieren, beim, ja, warum nicht, Paradieren mit meinen Eindrücken. Das Zucken der Fremden vis à vis durfte mich keinesfalls ablenken.
Was also war für die Karte am besten geeignet? Die Erwähnung der durch und durch verkehrten Meeresoberfläche, oben, im äußersten Norden der Insel, wo zwei Strömungen gegeneinander wüten, rund um die Uhr, samt dem teuflischen Sog von Wirbeln und Strudeln, eine klassische Einladung zum Ertrinken? Oder das sausende Schilfrohr der grau glänzenden Wattseite, eine See aus kreiselnden Halmen mit den mimischen Experimenten eines tückischen Gesichts?
Der uralte Duft feuchter Rosen, überall aus den Gebüschen, und nach wie vor die dunkelroten Hagebutten, bei denen du mich damals zum Abendgeschrei der Vögel und den herzüberflutenden, aber auch seelenlosen kleinen Wattwellen im Regen für immer angesprochen hast?
Der kleine Junge, der, ohne sich zu rühren, mit den Händen an der Hosennaht und offenem Mund vor der Brandung strammstand, minutenlang, fassungslos, ich ein Stück hinter ihm, weil ich mich nicht von seinem Anblick losreißen konnte?
Alles Quatsch, alles Quark, sagte ich mir, runzelte dabei vermutlich die Stirn und wollte gerade in einem einzigen Satz mitteilen, wie glücklich ich sei, völlig überraschend zum ersten Mal nach vielen Jahren (Kindheit! Jugend!) vom Meer wieder bis in die Fingerspitzen, bis auf den Grund erregt zu werden, da flüsterte die Frau: »Jaja!«
Ich sah unwillkürlich oder notgedrungen auf, nahm sie wahr vor der Helligkeit des Fensters in ihrer beinahe ein wenig außerirdisch gelackten, sehr blonden Pracht, der das wüste Wetter da draußen, aus dem sie hereingekommen war, unbegreiflicherweise nichts hatte anhaben, kein Härchen hatte krümmen können.
Dunkel schimmernde Augen, wahrhaftig hagebuttenrote Lippen lächelten mich an: »Jaja.« Es klang nach einem verschwörerischen Seufzer, ein bißchen amüsiert außerdem. Ein kleines Schnauben war es auch. Ich nickte dieser hübschen, zur Not noch blühenden Frau kurz zu, gespielt zerstreut, als hätte ich das Geräusch für das Knistern beim Hantieren mit den Milchtöpfchen gehalten. Sie blieb hart und sagte jetzt laut, jetzt schon signalstark: »Jaja!!«
Nur nach außen verärgert, denn ihr mildes Lächeln wurde unwiderstehlich, fragte ich nach: »Was ›Jaja!‹?« Engelhaft, kaum in Gefahr, jemals schrill zu werden, antwortete sie auf meine Unfreundlichkeit: »Verzeihen Sie, bitte verzeihen Sie, ich habe aus Versehen die Anrede ›Lieber Paul‹ gelesen und beobachte, daß Sie nicht recht weiterkommen. ›Lieber Paul‹! Wir schreiben offenbar beide an unsere Männer? Stimmt’s? Das ist nicht immer leicht. Meiner heißt übrigens Moritz. Wie lustig, wenn Ihrer Max heißen würde! Max und Moritz.«
Wie indiskret! Aber was für ein lindes Lächeln, dazu draußen der Sturm.
Wäre die Stimme nicht von so unvergleichlicher, kaum angestrengter, kaum künstlicher Sanftmut, wäre ihr Kleid nicht so kühn in Grüntönen gefärbt, an den Schultern mit ein bißchen frechem Rot betreßt gewesen (eine wahre Gelbstirnamazone, und das ausgerechnet in der ruppigen Nordseeumgebung), hätte mich todsicher so viel Aufdringlichkeit abgestoßen. So aber, mit den Brandungswellen in der Ferne zur Rechten und Linken ihres Kopfes, fesselte, nein, bezauberte sie mich. Bei ihr mußte man die einzelnen Geschmacklosigkeiten anders verstehen, selbst die übertriebene Menge von Gold an Hals, Ohren, Fingern. Sie fühlt sich, sagte ich mir, heimisch im Gehäuse von Putz und Pracht. Das lästige Gerucke von eben hatte sie aufgegeben. Es erübrigte sich inzwischen. Sie hatte ihr Ziel erreicht: Ich hörte ihr zu.
»Sehen Sie nur«, sagte sie, und es klang überzeugend warmherzig, während sie mir das Bild eines Paares in alpiner Tracht zuschob, das vor bemalten Schlagläden auf einer geschnitzten Bank saß, »das will ich meinem Mann schicken. Da staunen Sie, daß es keine Inselkarte von hier ist? Sie kennen meinen Moritz nicht. Gerade das hier wird ihn interessieren, mehr als jeder Sonnenuntergang am Meer. Brennend interessieren. Das könnte ich schwören.«
Wieder lächelte sie, diesmal eine Spur verschmitzter als vorher, aber so reizend, daß ich die Grüße an meinen Paul verschob. So sehr eilte es ja nicht. Die hohe Welle hinter der Lokomotive würde solange den Atem anhalten.
»Sicherlich ebenfalls ein historisches Foto«, stellte ich also, um zugänglich zu erscheinen, angesichts der altertümlichen, streng genommen jedoch jugendlichen Leute in ihrer wunderlichen Bekleidung fest.
»Das nun nicht im Geringsten!« Die Prächtige lachte von Herzen, vielleicht weil ich auf den Augenschein hereingefallen war. »Es ist erst kürzlich geschossen worden, in Oberbayern nämlich. Ein echter Schnappschuß.«
»Tatsächlich? Laufen denn richtige Menschen dort in den Bergen noch heutzutage so altbacken, ich muß schon sagen: gewandet, herum?«, erkundigte ich mich. Mein ungläubiges Gesicht freute sie sehr.
»Allenfalls zu Festtagen. Aber sie sitzen dann nicht so idyllisch vor ihren Häusern. Das machen sie nur für Touristen, so wie Heidelberger Studenten für die Asiaten in ihren Kneipen alte Burschenherrlichkeit von anno dazumal spielen, gegen Stundenlohn und Freibier. Man kann sich als Fremder auch Trachten ausleihen samt malerischem Jungbauern und sich fotografieren lassen als alt-oberbayrische Bäuerin. Touristenscherze eben, ziemlich beliebt, allerdings nicht umsonst.«
Hier betrachtete sie mich so gespannt und nachdrücklich, klopfte auch auf das zwischen uns liegende Bild, daß ich eine Pointe ahnte: »Sie müssen es genauer studieren. Na? Sie stutzen? Nein? Fällt Ihnen denn gar nichts auf außer Mieder und Lederhose?«
Ich gab mir alle Mühe, etwas Besonderes zu erkennen. Ihr Finger wanderte zum Gesicht der Frau: »Kommt sie Ihnen gar nicht, kein bißchen bekannt vor?« Auf dem leicht verschwommenen Foto zeigte sie dem Betrachter das Profil. Ein hübsches allerdings, und ein lächelndes. Was ins Auge sprang, waren die schwarzen, hochgesteckten, mit bunten Perlen geschmückten Locken. Der Mann sah in ihre Richtung. Sie schienen beide den Fotografen nicht zu bemerken. Der Gelbstirnamazone platzte der Kragen: »Die sitzt Ihnen nun schon ein Weilchen gegenüber. Na? Na? Keine Verblüffung? Aber das bin doch ich, ich leibhaftig! Sie sind wirklich, nehmen Sie’s mir nicht übel, keine scharfe Beobachterin. Kann man nicht lernen. Das ist man oder man ist es nicht.«
»Sie sind diese Trachtenfrau? Sie?«, stammelte ich einigermaßen verdutzt.
»Da fallen Sie aus allen Wolken? Freilich bin ich das, ist noch nicht lange her. Sie dürfen sich nicht durch die Haarfarbe und die Frisur verwirren lassen. Man kann eine Perücke mieten, das verändert natürlich. Eine Perücke und das komische Hütchen, dieser Strohteller mit dem kleinen Federbuschen wie ein Blitzableiter oder eine Antenne, nicht wahr, der ist fix und fertig daran festgeklebt. Was meinen Sie, wie Sie selbst in der Aufmachung wirken würden. Stellen Sie sich das nur mal vor! Da müßte Ihr Max, entschuldigen Sie, Paul, schon gründlich hinschauen.«
Ich drehte meine Karte mit der Anrede, die sie nicht mehr lesen sollte, sofort um, obschon es längst zu spät war. Innerhalb weniger Minuten hatte die Person es geschafft, die Macht an sich zu reißen. Die aufgetürmte Riesenwoge erwartete, mittlerweile gemächlich schmunzelnd, einen späteren Auftritt.
»Und der Mann? Ist das etwa Ihr Moritz?«
Sie bemerkte die Ironie, fand sie offenbar doppelt komisch und kicherte in sich hinein. »Wo denken Sie hin! Warum sollte ich ihm das Foto dann schicken? Nein, meine Liebe, der fesche Alpenmensch ist vom Tourismusbüro zusammen mit der Tracht für das Foto gemietet. Allerdings haben wir in dem Ort damals, vor vielen Jahren, Moritz und ich, unsere Flitterwochen verbracht und in dem Hotel im Hintergrund gewohnt.«
Erst daraufhin führte ich mir das Paar richtig zu Gemüte. Ich äußerte nichts, benötigte einige Zeit, wurde immer verblüffter währenddessen und schlug dann als Resultat meiner Prüfung innerlich die Hände über dem Kopf zusammen.
Die Frau hielt mein Schweigen nicht aus. In ihrer Ungeduld begann sie wieder mit dem albernen Ruckeln.
Schließlich sagte ich, ohne meine Entgeisterung über die alarmierende Botschaft zu verbergen: »Und das wollen Sie Ihrem Mann schicken?«
Na klar wolle sie das, warum denn nicht, wie gesagt, es würde Moritz bestimmt interessieren. Sie sei doch recht nett getroffen, und ihr Mann liebe sie über alles. Er sei stolz auf sie, und wenn er auch im Moment nicht bei ihr sein könne, da er als Ingenieur viel reisen müsse, bis hin nach Indonesien, jetzt nur Brüssel, könne sie ihn mit dieser kleinen Katastrophe, Verzeihung, sie meine: Kostprobe, sicher aufheitern in seiner Einsamkeit. Sie lachte wie schon vorher einige Male. Ich horchte auf den Ton, der nun eine geringfügige Schärfe aufwies.
»Ich würde das nicht tun. Tun Sie das lieber nicht, Ihr Mann liebt Sie, wie Sie behaupten? Werfen Sie das verräterische Bild, wenn Sie ihn nicht mit vollem Risiko eifersüchtig machen wollen, sofort weg. Ab in den Mülleimer. Vorher zerreißen!«
Die Prächtige lehnte sich zurück. Ihr Gesicht bekam den Ausdruck von Wachsamkeit und unverhohlener Zuneigung. Eine solche Mischung hatte ich bisher noch nicht erlebt. Sie starrte das Foto an. Jetzt war sie die Schweigsame. Endlich flüsterte sie: »Und warum bitte ein so unsinniger Rat?«
»Sie müssen es genauer studieren. Na, fällt Ihnen denn gar nichts auf?«, äffte ich die leichtsinnige Person nach, die auf einmal in großer Anspannung nicht das Paar, sondern mich fixierte. »Helfen Sie mir! Was gibt es Ungewöhnliches herauszufinden auf meinem Bild?« Sie murmelte das, nuschelte es, denn sie hatte begonnen, an ihren Fingernägeln zu kauen.
Sollte ich ihrer Einfalt Glauben schenken? Ich entschloß mich halbwegs dazu, gegen den Verdacht, sie wolle mich vielleicht nur veräppeln aus Lust an Zerstreuung bei stürmischem Seewetter hinter den Scheiben: »Die pure Elektrizität! Sie müßten es selbst am besten wissen, auch wenn Sie Ihre Hände so sittsam über dem Schoß und der weißen Trachtenschürze falten. Wenn Sie schon mich, eine vollkommen Unbekannte, nicht täuschen können über das, was hier passiert, werden Sie das bei Ihrem Mann noch weniger schaffen. Die so einladend ins Mieder gestopften Blumen mögen durch dörfliche Bräuche zu entschuldigen sein, aber dieses neckische, scheinbar schamhafte und doch hocherfreute Abwenden Ihres Kopfes! Das spricht doch Bände!«
Natürlich hätte sie sich längst meine Vorwürfe verbitten müssen. Sie tat es aber nicht. Im Gegenteil. Sie lauschte begierig, als würde ihr wohltun, daß ich ihr Vorhaltungen machte. Ich warf ihr ja allerdings nicht das Flirten vor. Mich erboste nur die Dummheit dieser bisher so sanft lächelnden Person, das Foto ausgerechnet dem sie liebenden Ehemann schicken zu wollen, falls sie, noch schlimmer, ihn nicht aus Tücke zu bekümmern plante. Was mochte das überhaupt für ein Mann sein, dieser Moritz, mit einer Frau, die sich seiner Zuneigung so sicher war und damit prahlte und sie nun so aufs Spiel setzte! Oder sie auf Herz und Nieren zu prüfen beabsichtigte? Ich geriet in Fahrt.
»Sie verlangen ein offenes Wort. Sie nehmen es mir nicht übel?«
»Ich bitte Sie ausdrücklich darum«, sagte sie leise, die Augen nun wieder auf das Bild gesenkt.
»Gut! Noch ist es nicht zu spät. Säßen Sie allein auf der Bank, würde man meinen, ein Unsichtbarer kitzelte Sie an der Hüfte oder was weiß ich wo, und Sie hätten das ausgesprochen gern. Es bliebe ein Geheimnis. Aber ein sehr Sichtbarer, entschuldigen Sie, ein sich brüstend Sichtbarer befindet sich an Ihrer Seite und bedrängt Sie, nicht zu übersehen, mit seinem nackten Oberschenkel.« Es riß mich hin: »Eine erotische Brandungswelle ist das! Die Lederhose bedeckt nicht viel, stellt die Muskeln geradezu protzend aus, wobei das linke Bein zur Hälfte bei Ihrem scheinheilig langen Trachtenrock, der sich keineswegs dagegen wehrt, Unterschlupf sucht. Dort bereits verschwindet, wäre richtiger zu sagen. Schämen Sie sich!«
Hier lachte sie ohne Übergang grell auf, kein schöner Laut, schlug mit der flachen Hand auf den fotografierten Schenkel des Mannes und zog sich dann wieder schnell in ihre stille Haltung zurück, nickte mir auch zu, ich solle weitermachen. Sie biß sich dabei, etwas blasser mittlerweile, auf die Lippen.
Ich wartete auf eine Empörung oder wenigstens Verteidigung von ihrer Seite. Sie blieb stumm, lächelte schwach. Reumütig? Nein, das nicht, weh, verwehend eventuell, noch bleicher als eben. Ich begriff sie nicht. Etwas reizte mich, meine Strafpredigt um einige Grade zu forcieren, wenn ich schon die Kartengrüße an meinen Paul ihretwegen nicht schreiben konnte.
»Fällt Ihnen nicht auf, wie kokett Sie unter den gesenkten Lidern zu dem Naturburschen, diesem stattlichen Mannsbild rüberschielen? Ihre ganze Gestalt ist ein einziges Willkommenssignal für den keineswegs begriffsstutzigen Kerl mit seinem Jägerhütchen und nun dem Frauenzimmer als sicherer Beute. Mein Gott, was funkelt das Schlitzohr Sie siegesgewiß an, was zeigt er die Raubtierzähne unter dem Schnauzbart! Ein breitbeiniger, selbstgefälliger Eroberer von Touristinnen! Schnappschuß, sagen Sie? Richtig, ein um so verräterischerer, einer, bei dem jedes Detail sprechend ist, der Ihre Affäre rausposaunt. Ich wiederhole: Sofort wegschmeißen das Ding, wenn Sie kein irreparables Unheil anrichten wollen.«
Ich wunderte mich über mich selbst. Je mehr die einfältige Gelbstirnamazone verblich, desto heftiger redete ich mich in Zorn. Dieses Ereifern bewirkte, daß ich die neuerliche Veränderung der Frau erst mit einiger Verzögerung bemerkte. Deshalb versäumte ich auch, ihrem verzagten Sätzchen: »Es steht doch gar nicht in meiner Macht«, nachzuhorchen.
»Und schubst er Sie nicht an mit seinem linken Arm, zum Zeichen, daß Sie beide handelseinig sind? Berührt ein offizieller Angestellter des Fremdenverkehrsbüros so respektlos seine Kundin vor dem Fotografen?«
Die Frau hatte ihre Blässe verloren, das Blut kehrte in die Wangen, der Glanz, nun ein wütender aber, in ihre Augen zurück. Sollte ich lieber schweigen, falls sich der Unwille auf mich bezog? An diesem Punkt schaffte ich es nicht, mich selbst zurückzupfeifen von der Fährte:
»Und erst die Hände des Kerls! Beim Fotografiertwerden kriegten Sie das nicht mit, aber jetzt doch wohl! Wie lässig er in den zupackenden Arbeiterfingern seine Zigarette hält! Kämpfen muß er ja nicht mehr, und die andere Hand verbirgt, ich sage es frei heraus, vermutlich aus guten Gründen sein ›Sie wissen schon‹ zwischen den Schenkeln. Jedem, auch dem größten Trottel, müßte klar sein, welche Szene zwangsläufig dieser hier vorausgegangen und gefolgt ist. Sie sind durchschaut. Da gibt es kein Vertun. Machen Sie sich keine Illusion. Wenn Sie das Ding an Ihren Mann schicken, ist es das Eingeständnis des Ehebruchs.«
Die Frau bebte. Alle Schönheit war in Zorn und Bitternis mit dem Lächeln und der, wie ich anfangs dachte, überzeugenden Sanftmut dahingeschwunden.
»Gerade deshalb werde ich es ihm schicken«, zischte sie. Sie loderte. »Und Sie hier haben den schlagenden Beweis geliefert, haben es mir klipp und klar, unparteiisch, ohne es zu ahnen, bewiesen. Sie waren meine Testperson. Einwandfrei Ehebruch! Keine Einbildung! Ich bin ja nicht die Frau auf der Bank, nur in etwa der Typ. Sie haben sich täuschen lassen von mir. Der elende Schuft im Trachtenkostüm ist Moritz, mein eigener Mann, kostümiert natürlich. Nicht in London oder Hongkong, sondern in einem ganz bestimmten oberbayrischen Dorf. Er hat mich auch mit dem Aufenthaltsort hintergangen. Die Person daneben kenne ich nicht, die hat er sich angelacht. Das Foto wurde mir anonym zugeschickt. Womöglich von dieser Dirndlperson da, die nun triumphiert.« Sie begann zu ächzen und zu stöhnen: »Ich wollte mich hier auf der Insel beruhigen. Es geht aber nicht. Bisher hoffte ich noch auf ein Mißverständnis, Sie waren es, Sie Wohltäterin, die mir klargemacht hat«, sie starrte mich in ihrer Verwirrung böse an, »daß ich mich nicht irre. Geben Sie her. Ich werde es ohne Kommentar, aber mit meinem Namen an ihn weiterschicken. Als endgültig letzte Post meinerseits.«
Der prächtige Vogel war in die Mauser gekommen. Ein großer Jammer brach in Tränen, in flattrigen Bewegungen aus der Betrogenen hervor. Dann steckte sie das Foto ein, legte etwas Geld auf den Tisch und sprang auf. Dabei wischte sie die historische Postkarte zu Boden. Sie rutschte unter einen Stuhl in die Pfütze von nassen Schuhen. Beim Versuch, mit ihrem Regenschirm danach zu angeln, stieß sie die Spitze mitten in die Riesenwelle.
»Die können Sie nun nicht mehr verschicken. Gott sei Dank ist sie noch nicht frankiert«, rief sie mir von der Tür aus, schon im Mantel, krächzend zu, denn der Wind blies sofort ins Lokal und riß ihr die Schluchzer vom Mund weg.
Ich sah sie noch am Fenster vorüberlaufen, sah sie vorübertreiben als zerfledderte Krähe, als vom Sturm zerfetzter schwarzer Schirm.
Die Sicht aufs Meer war wieder frei. Hinter den Scheiben erkannte ich die gelassene, unsinnige Arbeit, die schneeweißen Lineale, die Zollstöcke der aus der Entfernung scheinbar bewegungslosen Brandung am Rand einer grenzenlosen dunklen Flut.
Der rote Lukas
»Mechatroniker. Du weißt ja, von meiner ersten Ausbildung her Mechatroniker. Der Beruf gefiel mir. Maschinen interessierten mich von klein auf, nur habe ich es nach ein paar Jahren körperlich nicht mehr gebracht. Der Job war für mich nicht leidensgerecht. So nennen die das heute. Jetzt, als Pfleger, eigentlich wegen des lädierten Rückgrats eher als Betreuer, sieht die Sache auch nicht schlecht aus, sogar besser vielleicht.«
Er hatte noch immer die Angewohnheit, vor jedem Satz ein Weilchen abschmeckend zu schmunzeln, bevor er ihn aussprach: »Kürzlich war ich mit einem Trupp alter Männer unterwegs. Wir standen an einer Haltestelle, als aus dem offenen Hotelfenster gegenüber im ersten Stock ein Lustgebrüll losbrach. Marke Urschrei beim Höhepunkt. Sex! Du hättest sehen sollen, wie mein kalkweißes Völkchen mit offenem Mund unter dem plötzlichen Blitz und Donner zusammenzuckte und den Rollator losließ. Ganz verzagt standen sie da. Die erschrockenen Greise erinnerten sich. Die wußten noch genau, trotz ihrer Klapprigkeit, jede Wette, weshalb da oben die Hölle los war.
Ich habe einen Neunzigjährigen vorrätig, der den größten Teil des Tages seine rechte Hand studiert, von morgens bis abends die fünf Finger abzählt, ob sie noch alle da sind. Schön und gut. Vorgestern hat er die Ulrike, unsere hübscheste Pflegerin, gefragt, ob er ihr ein einziges Mal in den Ausschnitt fassen darf.«
Lukas, ganz der alte Rotkopfspecht von früher, ließ sich von seinem GPS – natürlich in einer Spezialversion – beschimpfen und fuhr, um das Ding zu reizen, abwegige Kurven. Es freute ihn, wenn er von dem Apparat »Dummkopf« genannt wurde. Er gab ordentlich Contra. »Meine Patienten fürchten sich vor allem Digitalen. Ich nenne unsere Leute mal Kunden, mal Patienten. Ihre Krankheit? Das Alter, unheilbar. Das Internet fesselt und ängstigt sie. Da sind sie ganz demütig. Dabei wissen die meisten mehr davon als mein Schwager. Wie der durch die Gegenwart kommt, ist ein Rätsel. Unterrichtet Latein und Griechisch. Der findet wohl immer einen Schutzengel, der ihn vor Zusammenstößen mit der bösen Computerwelt bewahrt. Der Bruder meiner Beate, die schwer in Ordnung ist.« Eine Weile schwieg er. Dann ergänzte er: »Sie hält vom gepflegten Fußboden mehr als vom raffinierten Würzen des Essens, ist aber schwer in Ordnung. Ein guter Mensch.«
Wieder sagte er eine Weile nichts, nachdem er anfangs zu meiner Erleichterung viel am Stück geredet hatte. »Bei mir ist das Technische schon immer eine Leidenschaft gewesen.« Wir lachten beide herzlich, da wir seine Kindheit kannten, und zwar besonders unter diesem Aspekt.
Zwischendurch nahm er ohne hinzusehen aus einer aufgeschnittenen Tüte neben dem Fahrersitz bunte Gummifrüchte, ein selbstverständlicher Griff im Zweiminutentakt, fraß das Zeug maschinell in sich rein.
Ob er deshalb ziemlich dick geworden war, der ursprünglich spindeldünne Kerl mit der wegen seiner enormen Länge schon früh schlechten Körperhaltung? Beide Arme waren, soweit das Camouflagehemd sie freiließ, tätowiert. Er trug trotz der Hitze eine olivgrüne Schirmmütze und zumindest an der mir zugewandten Seite einen Ring im Ohr. Das alles wirkte bei ihm sympathisch und mochte seinen »Patienten« Vertrauen einflößen, weil es nichts Ärztliches an sich hatte. Nur seine Augen schienen mir merkwürdig unklar, geradezu verschwiemelt. Das konnten seine Medikamente verursacht haben, die starken Schmerzmittel, die er gelegentlich brauchte.
»Frau Bingelklein, meine Kundin und keusche Trockenpflaume, machte mir am meisten Spaß. Sie hat wohl früher viel in ihrer Pfarrei geholfen. Bei uns im Heim, immer wenn sie auf dem Klo saß, hörte man sie beim Drücken keuchen: ›Herr, laß Dein Angesicht über uns leuchten.‹ Trotzdem waren ihre letzten Worte vor dem Tod: ›Die Hemden bei dreißig Grad waschen.‹ Solche Menschen hinterlassen eine Lücke. Sie fehlt mir regelrecht. Ihre Freundin, eine Frau Schlupf, hat heimlich getrunken und geraucht. Eines Tages lag sie im Bett, hat gegrinst und war tot. War trotzdem die beste Freundin von Frau Bingelklein, unserer frommen Taube.«
Wir nannten ihn den roten Lukas, zur Unterscheidung. Es gab nämlich in der Familie noch einen zweiten Lukas, ein blasses Bürschchen, das nicht weiter auffiel. Der rote Lukas befand sich fast immer im Zustand einer Erregung, mal der Begeisterung, mal der Wut. Deshalb schien die Farbe seiner Locken auf die runden Bäckchen abzufärben. Glühen war sein Dauerzustand. Außerdem besaß der Kleine einen roten Strickanzug, von dem er sich jedesmal nur unter Protest trennte. Ein schwieriges Kind, der Schrecken seiner Tanten, bei denen er die Wohnung in Windeseile, sofern es sich um technische Geräte handelte, in Stücke zerlegte, aus reiner Neugier auf das Innere von Apparaturen. Er dachte sich nichts Schlechtes dabei. Es war die reine Freude an allem Technischen und dessen ausführlicher Untersuchung. Das wußte man. Was half es? Reparieren konnte er die zerstörten Dinge nicht, und so verhielt man sich dem hübschen roten Teufel gegenüber reserviert.
Das galt nicht für seine Mutter, die, kein Kunststück, jeder ins Herz geschlossen hatte, eine sanfte, feenhafte Person, die das, was der Sohn anrichtete, nach Kräften wieder gutzumachen versuchte und manchmal, wenn es nicht gelang, einfach in Tränen ausbrach. Niemand war darüber unglücklicher als ihr wilder Sprößling, denn er liebte seine Mutter nicht weniger als sie ihn. Er besuchte schon die erste Klasse der Grundschule, als er immer noch seine Schmusestunden mit ihr forderte, die sie ihm mit zärtlichem, ein bißchen verstohlenem Lächeln wohl allzu gern gewährte. Dabei hatte sie nicht nur, das eben doch, seinetwegen unvermeidlichen Ärger mit Schwestern und Schwägerinnen zu ertragen, auch im Kindergarten schaffte man es nicht, ihren ungebärdigen Lukas zu zügeln oder gar einzuschüchtern. Was vielleicht niemand sonst tat, sie verzieh ihrem Zappelphilipp alles und streichelte ihn bereits, noch während sie sich Mühe gab, streng die Stirn zu runzeln. Sie lebten in diesen ersten Jahren beide im Glück. Sicher auch, weil eine stets lauernde Angst vor dem Vater, der Beppo, dem ockerfarbenen Mischlingshund von Lukas, häufig unter Lachen die Ohren umdrehte und sich am Ducken, dem unterwürfigen Zittern des Tieres ergötzte, beide zusätzlich einigte.
Später erzählte Lukas oft von der königlichen Stunde, wenn die Mutter am Samstag, nachdem alle Hausarbeit für das Wochenende erledigt war, eine frische, duftende Schürze umband und noch einmal die Küche ausfegte, während er auf seinem Stuhl die Beine hochzog und alle ihre gleitenden Bewegungen in der neuen Reinlichkeit andächtig beobachtete, angesteckt von ihrem Frieden, ohne irgendetwas kaputt zu machen.
Er war erst sechs, als sie an einem heißen Sommertag während einer eigentlich unkomplizierten Operation starb. Das Entsetzen des Kindes muß viel zu groß für den kleinen Burschen gewesen sein. Es machte Lukas nicht stiller, sondern lauter. Panisch suchte er bei den Tanten, indem er sich an deren weiche Busen preßte, nach einer Ersatzmutter. Keine der Frauen, zwischen Mitleid und Befürchtungen, war bereit, diese Rolle zu übernehmen. Der hilflose Vater griff schließlich zum äußersten Mittel. Er steckte den Jungen in ein Waisenhaus. Beschwichtigend wurde gesagt, es sei nur vorübergehend.
Wir hörten ab und zu von seinen Tobsuchtsanfällen und den Bestrafungen dort. Stundenlang mußte er, um seinen Willen zu brechen, in einem Winkel stehen, bei besonders schweren Vergehen wurde er in den Keller gesperrt. Merkwürdigerweise beklagte er sich nicht, als wäre seine Hoffnungslosigkeit schon zu weit fortgeschritten oder seine Scham zu groß. Erst als verheirateter Mann sprach er darüber.
Ich bilde mir ein, er hätte diese ganze Zeit über den roten, eine Weile mit ihm wachsenden Kleinkinder-Strickanzug getragen.
Der Vater wußte keinen Rat und wurde schwermütig. Auf Drängen wohlmeinender Bekannter heiratete er schließlich eine Kindergärtnerin. Die würde sicher dem Sohn und ihm selbst eine warme Heimstatt bieten. Die strammen Körperformen dafür hatte sie und war diesbezüglich nicht mit seiner zierlichen ersten Frau zu verwechseln, auch in keiner anderen Hinsicht, wie sich bald herausstellte. Zunächst aber waren Vater und Kind guter Hoffnung.
»Ein Hintern wie ein Achtzig-Taler-Pferd. Bei so einem Gesäß hatte mein Vater nach der Enthaltsamkeit für seine Pratzen ordentlich was zu packen. Mich zog es eher zum großen, vielversprechenden Busen meiner Stiefmutter. Auch wenn mir ihr Geruch nicht gefiel, mein jämmerliches Bedürfnis nach weiblicher Liebe war stärker«, sagte Lukas und kaute freundlich grinsend ein Gummitier. »Die Erwartungen meines Vaters wurden anfangs offenbar erfüllt. Er zeugte mit ihr rasch hintereinander zwei Söhne. Ich störte, ich war überflüssig. Schlimm für mich, ziemlich schlimm.«
Wieder schwieg er lange. Sein GPS war ausgestellt. Er hatte es ja auch bloß zum Spaß benutzt.
»Ich durfte, was ich zuerst so gern getan hätte, nicht ›Mutter‹ zu ihr sagen. Diese Anrede war für die eigene Nachkommenschaft von vornherein reserviert. Sie umarmte mich nie. Mein Vater, in dem neuen Haushalt, verschloß die Augen vor ihrer Härte, obschon man sie kaum übersehen konnte. Er wollte unbedingt glücklich sein, wenigstens in Frieden leben. Im Zweifelsfall hielt er deshalb immer zu ihr. Jetzt war er nicht mehr der starke Mann wie früher. Sie hatte ihn schnell klein gekriegt. Er kuschte. Die Drohung, mich wieder ins Waisenhaus zu schicken, stand bei allem im Hintergrund. Ich wurde dadurch nicht, sagen wir mal: umgänglicher. Ist ja klar.«
Er schmunzelte gegen die Windschutzscheibe und schüttelte den Kopf wie in Erinnerung an seine verzweifelten Streiche. Was er mir sagte, war für mich kaum Neues. Ich hatte es nur noch nicht von ihm selbst gehört. Sein Vater sprach damals bei Besuchen davon, wenn er ein bißchen getrunken hatte. Dabei starrte er trübsinnig vor sich hin und wiederholte einige Male: »Kein Vergleich zu meiner Maria, kein Vergleich. Was war meine Erste nur für ein Engel!«
Zu späte Reue offenbar, denn Lukas fuhr fort: »Am tollsten trieb sie es an einem Heiligabend, obschon gar nichts Besonderes vorgefallen war. Als die vier, Vater, Mutter und die beiden Prinzen im Wohnzimmer ihre Bescherung abhielten, durfte der Störenfried nicht dabei sein. Ein Grund dafür wurde mir gar nicht erst mitgeteilt. Sie machten es vorsorglich. Das war das Weihnachtsgeschenk für den Spielverderber: Ich wurde ausgesperrt vom Familienfest wie ein Fremder und bekam in mein kaltes Zimmer irgendwas zu essen geschoben, ich sehe es wieder, Rotkohl und Frikadelle, außerdem einen kleinen Werkzeugkasten. Ich hörte sie singen, die schönen Weihnachtslieder, zu denen uns früher meine Mutter auf dem Klavier begleitet hatte, meine schönen Weihnachtslieder, die sangen sie ohne mich. Jaja, ich hockte allein bei Rotkohl und Frikadelle und, durch die Wand hindurch, bei deren blödem Gesang. Als ich mit lautem Hämmern protestierte, wurde gelacht, nur mein Vater kam und strich mir mit traurigem Gesicht über den Kopf. Er gab mir einen kaputten Föhn und einen alten Schalter zum Auseinandernehmen, weil ich das gern tat. Dann ließ er mich wieder allein.«
Lukas blinzelte, wischte sich eifrig den unteren Wimpernrand. »Ein Tierchen im Auge«, brummte er.
»Er stand mir nicht bei, nie, um keinen Streit mit der Hexe vom Zaun zu brechen. Noch heute begreife ich nicht die Herzlosigkeit dieser Frau einem nicht mal zehnjährigen Jungen gegenüber. Inzwischen haßte ich sie. Mein Vater wußte sich nicht anders zu helfen, als ihre Machenschaften ohne Widerspruch zu dulden. Auf gut deutsch: Er ließ mich auch am Heiligabend wie immer im Stich. Aus Sehnsucht nach meiner echten Mutter und vor mich hin heulend und schniefend und schluchzend, begann ich in meiner Finsternis, die neuen Spielzeugwerkzeuge zu zertrümmern. Kein einziges Sternchen am Himmel für mich.«
Wieder schmunzelte er, diesmal allerdings bitter.
Was geht mir gerade durch den Kopf? Daß jemand, der die Menschen insgesamt als seine Feinde ansieht, auch erkennen muß, daß sie sich untereinander von Person zu Person genauso feind sind. Jeder Körper bedroht durch seine Existenz den anderen und kämpft, und sei es unter der Maske ausgesuchter Manieren, ja Menschenliebe, um sein Überleben. Das besiege, wer kann.
Das meiste wußte ich ja. Wie durch ein Wunder ging es nicht so unglücklich mit ihm weiter, obschon man in der Verwandtschaft die größten Befürchtungen gehabt hatte. War er nicht auf bestem Wege in die Kleinkriminalität? Vielleicht beschützte seine milde Mutter vom Himmel herab ihren kleinen Wüterich, oder ihre Sanftmut machte sich endlich als Hinterlassenschaft in ihm bemerkbar. Zumindest bewahrte ihn die Erinnerung an sie davor, sich als taumelnder junger Mensch vollständig in den Abgrund zu stürzen. Er lernte einen technischen Beruf und ein guter Meister bildete ihn zum Spezialisten für die Wartung von Aufzügen aus. Sobald wie möglich gründete er eine eigene Familie. Er besaß nun ein Nest.
Dann vermachte ihm eine reiche Tante, die sich kaum um ihn als unglückliches Kind gekümmert hatte, vom schlechten Gewissen geplagt, überraschend ihr großes Anwesen in bester Gegend mit allem Zubehör. Einen Teil des riesigen Gartens verkaufte er. Die Gästewohnung im Obergeschoß vermietete er, um die Unterhaltskosten zu decken, für gutes Geld an den Junggesellen Professor Schötle, mit dem er sich bald anfreundete und, bei Gegenleistung durch PC-Hilfe, Französisch und etwas Latein lernte. Im Haus selbst versuchte er heimisch zu werden, indem er die eleganten Salons ruckzuck umwandelte in praktische, mit technischen Schikanen ausgestattete Zimmer für Mann, Frau, Kinder.
Ein bißchen proletarisch gemütlich das alles, ein wenig geschmacklos vollgestopft, ohne Erinnerungen an die frühere Bewohnerin und ohne Bedenken gegenüber dem vornehmen Umfeld, das sicherlich über ihn die Nase rümpfte, ihn aber wegen seiner selbstverständlichen Hilfsbereitschaft doch ein wenig schätzte. Seinen Beruf übte er weiter gewissenhaft aus, klagte aber bald über Schmerzen des Rückgrats und der Gelenke. Nach einigen erfolglosen Operationen ließ er sich zum Betreuer ausbilden. Das war nun in der Tat ein Beruf, der noch weniger zu einer hochnäsigen Nachbarschaft paßte, deren Herablassung Lukas sehr wohl wahrnahm, jedoch freundlich ignorierte, was vielleicht mehr Seelenstärke von ihm verlangte, als ihm bewußt war.
Die Diskrepanz konnte man deutlich an den Hunden ablesen. Während man ringsum die teuren Renommierrassen ausführte, adoptierte Lukas einen verängstigten Straßenhund aus Istanbul. Ein Mischling, aber intelligenter als die Hundegesellschaft um ihn herum. Nichts war natürlicher für Lukas, als ihn Beppo zu nennen. Nur durfte niemand dem Tier mit böser oder spaßiger Absicht an die Ohren gehen!
Ich kenne kaum einen Menschen, der sich mit heißeren Gefühlen erinnerte als er. Die Jahre bis zum Tod seiner Mutter wurden, ohne Abschwächung durch die vergehende Zeit, für ihn zu einem Himmelreich mit all den warmen Quellen von Liebesströmen darinnen, die er danach so entbehren mußte. Jeder Gegenstand, jede Fotografie aus diesem Lebensabschnitt, die er in der Verwandtschaft aufstöberte, verehrte und beweihräucherte er, putzte sie auf zu Heimat, Heiligtum, Legende.
Sein Vater hatte sich zu der Zeit längst von der zweiten Frau getrennt, viel zu spät für den Sohn. Nicht nur die Stiefmutter, auch der eigene Vater waren dem Horizont von Lukas entrückt.
Wir waren bei ihm zu Hause angekommen. Ich machte mich gefaßt auf eine Welt voll blinkender Signale und akustischer Überraschungen vom Keller bis zum Dachgeschoß des Professors. Die gute Frau Beate, eine handfeste Person aus dem Ruhrgebiet mit Boskop-Wangen und festem Händedruck, legte gleich an der Tür den Finger auf den Mund. Dann ging sie uns voran in das, ich wußte es von früher, am schönsten gelegene Zimmer des Hauses. Eine Glaswand ließ bei jedem Wetter das gesamte Grün des Gartens, im Sommer berstend vor Lebenskraft, hereinbrechen.
Die vierte Person im Raum sah ich nicht sofort. Mir fiel nur auf, neben dem brodelnden Grün und dem gleichmütig freundlichen Gesicht Beates, wie sehr sich die Züge von Lukas weg von seinem gewohnheitsmäßigen Schmunzeln, das laufend Kompromisse mit der Welt schloß, verwandelten, besser: enthüllten, als würden sie eine Kruste oder Schutzschicht abwerfen. Was sie ausdrückten, war das schierste Glück, ein Seelenzustand, der den Dunst der Jahre wegwischt und uns vorübergehend kindlich macht. Vor mir stand der rote Lukas von damals, aber nun, jenseits allen Dräuens alter Zornesausbrüche, in den Frieden seiner stillen Betrachtung versunken.
Und nun entdeckte und erkannte ich den alten Mann, sorgsam in Decken gehüllt, in einem Rollstuhl sitzend und dort schlafend, dem ein wenig Speichel aus dem Mundwinkel lief, der leise schnarchte, dösend der Welt entrückt, und der, kein Zweifel, sein Vater war.
Rosetta
Wohl niemand hatte sich das Ende dieses Abends, als er sich für das Essen umzog, so vorgestellt, wie es sich schließlich ereignete, nicht einmal die Täterin selbst.
Vielleicht war bereits der eigentliche Beginn für die meisten der Anwesenden in dieser Form neu. Sie saßen, noch beim gewöhnlichen Vorspiel, jeweils zu viert, zwei Männer und zwei Frauen, um insgesamt sechs große runde Tische herum, auf deren Mitte ein Angebinde frischer Blumen stand. Die stark duftenden, letzten Freilandrosen des Jahres zwangen die Essenden, mit den unmittelbaren, nicht ausdrücklich miteinander bekannt gemachten Tischnachbarn Kontakt aufzunehmen, da der Strauß die Sicht auf die direkt gegenübersitzende Person minderte.
Ein einziger Platz war noch leer geblieben. Das fiel wahrscheinlich nur dem Gastgeber und den übrigen, dadurch etwas einsameren drei Leuten auf. Man hatte auf dem nobel gestalteten Flur im Stehen einen Apéritif nach Wahl zu sich genommen und beugte sich nun über die in Tassen gereichte Vorsuppe, eine doppelte Kraftbrühe, die das Mahl, an dem sich der Rang der Zusammenkunft, in Verbindung mit der zur Serviette gelegten, mit einem Namen versehenen Speisekarte bereits ahnen ließ, auf normale Weise eröffnete. Es würde sich um ein gediegenes Vier-Gänge-Menu handeln. Welche Art von Persönlichkeit neben welcher anderen saß, das galt es jeweils noch herauszufinden und würde die Qualität der nächsten Stunden bestimmen. Man hörte zu diesem Zeitpunkt nur ein allgemeines höfliches Murmeln, aber schon hatte sich ein Tisch rechts von der Tür durch vereinzeltes, ein wenig ostentativ lautes Kichern zum mutmaßlichen Trumpf der Veranstaltung herausgearbeitet. Diese eine Vierergruppe reklamierte etwas für sich. Sie würde, wenn sie so weitermachte, aller Voraussicht nach diejenige sein, zu der sich nach dem Dessert alle Mutigen aus der Förmlichkeit des brav absolvierten Dinners flüchteten: nach der bescheiden angenehmen Pflicht das Vergnügen, die Witze, der Klatsch, die Bosheiten, das Gelächter. Meist benutzte man auf solchen Empfängen den nicht formulierten, jedoch klar signalisierten und freundlich verziehenen Gang zur Toilette oder den Wunsch, draußen eine Zigarette zu rauchen, als rechtzeitigen Absprung für den Platzwechsel, ohne sich länger um den verwaisten Tisch zu kümmern, an dem schicklicherweise mindestens zwei Gäste zurückbleiben mußten.
Von dieser, bis auf zwei, drei Neulinge, die eine besonders routinierte Miene zur Schau trugen und sich dadurch verrieten, von dieser jedem der Gäste vertrauten Gepflogenheit war man noch weit entfernt, als das gedämpfte Eröffnungsplaudern schlagartig verstummte. Alle Köpfe schnellten hoch. Ein plötzliches Erwachen ringsum.
Sie betrat den Raum mit festem Schritt, schwingenden Hüften und einigen in ihr fülliges Haar gesteckten, steil aufragenden Federn, die von einem exotischen Vogel stammen mochten. Diese Frau wußte, wie man einen Raum erobert. Eine Schleppe von drei Männern folgte ihr auf dem Fuße, allesamt jung und gut gebaut. Sie entließ sie mit einer knappen Verbeugung (nein, keine Bodyguards, nur »gute Freunde, die mich sicher abliefern wollten«, erfuhren wir später) und steuerte ohne zu zögern auf den Tisch des Gastgebers zu, der ihr strahlend entgegenlächelte und sogleich aufsprang, als sie sich ihm näherte.
Wir alle starrten hingerissen. Das passierte, ob man wollte oder nicht, und ging gar nicht anders. Am größten war die Begeisterung, zumindest bei den beiden Männern, am Tisch mit dem leeren Platz. Nach der Begrüßung des Gastgebers mußte die umwerfende Rosetta – der Name verbreitete sich wie ein Lauffeuer – zu ihnen kommen. Sie konnten es am Schildchen ablesen: Rosetta, die Tochter des sehr prominenten, kürzlich verstorbenen Malers Ottokar Fettke. Wobei das Wissen von diesem familiären Umstand gewünscht, jedoch aus begreiflichen Gründen nicht wörtlich in Zusammenhang mit der Schönen gebracht werden sollte. Ich weiß nicht, wie viele der Anwesenden es ganz für sich doch einmal (eine Ungezogenheit!) ausprobierten: »Rosetta Fettke«.
Das Lächeln ringsum aber rührte nicht daher, sondern war eins der reinsten Bezauberung. Kunstinteressierte unter den Gästen erinnerten sich zweifellos, wenn auch nicht sehr deutlich, an Fettkes Werke, zumindest an seinen Ruf. In Deutschland war er immer nur als »Fettke« aufgetreten, machte es also gerade umgekehrt wie die Tochter. Bei ihm war der Vorname tabu. »Fettke«, auch seine Frau sprach so von ihm, paßte zu seinem Outfit diesseits der Alpen. Er gab sich als unrasierter Mann im Turnzeug und hatte damit in der Szene großen Erfolg. Jenseits der Alpen, am Comer See, wo seine Frau einen unmittelbar am Wasser gelegenen Palast besaß, hätte man ihn kaum wiedererkannt. Il professore spazierte, tadellos rasiert, in italienischen Sommeranzügen durch die Villen-Gesellschaft. Opportunismus? Aber nein. Der Spagat, ließ er verlauten, sei Teil seines radikalen Konzepts, das tief in seine Lebensweise eingreife. Jetzt war er aber tot.
Rosetta, von der es hieß, sie sei ausschließlich in der herrlichen Region der oberitalienischen Seen aufgewachsen, ein von allen verhätscheltes kleines, ein wegen seiner Schönheit und eines phantastischen Wesens zärtlich geliebtes junges Mädchen, kannten die meisten nur vom Hören und Sagen, das aber immerhin, auch weil die vom Glück überschwenglich Verwöhnte es unter anderem schon zweimal zu einer Fotostrecke in »Madame« und sogar in der »Vogue« gebracht hatte.
Noch immer stand sie mit dem Gastgeber an dessen Tisch. Ein Wort der Entschuldigung für das Verspäten ließ sich nicht hören. Stattdessen lachte sie ausgiebig über das Kompliment, das er ihr zu dem übermütigen Springbrunnen aus Federn auf ihrem Kopf machte, und bog sich in ihrem engen grünen Kleid ein wenig hin und her, ein leichtes Wogen, das ihren nicht allzu schlanken Körper durchlief. Nach wie vor setzten die Leute ihr Suppenessen nicht fort, bis auf den kichernden Tisch, der ahnte, daß er nicht mehr im Zentrum stehen würde, und nun aus Trotz angeblich unbeeindruckt die Täßchen leerte.
Noch also stand sie nach wie vor mit dem Gastgeber an dessen Tisch. Sie erklärte ihm etwas. Dabei hob sie die vollendet gebildeten, nackten Arme hoch empor. Nichts hätte die Formen ihres wohlgestalten Körpers bezaubernder ins Blickfeld rücken können. Sie aber schien nichts von der geheimen Erregung, die sie verursachte, zu ahnen, auch nicht auf den Gedanken zu kommen, sie könnte das Abendessen aufhalten. Schließlich erhob sich der zweite Mann am Ehrentisch und räumte mit notgedrungen galanter Geste das Feld in Richtung des einzigen leeren Platzes im Raum, den er mit resigniertem Schulterzucken einnahm. Rosetta nickte nur freundlich, denn was konnte selbstverständlicher sein. Die Enttäuschung am Dreiertisch nahm sie nicht wahr. Das Ungleichgewicht von männlich und weiblich an zwei Tischen schien plötzlich unerheblich, obschon eine so leuchtende Erscheinung wie Rosetta natürlich einen Tisch im umgekehrten Verhältnis, mit einer Frau (sie) und drei Männern, hätte beanspruchen können, um ihrer fraglosen Exklusivität zu huldigen.
Und weiß der Beelzebub, wie es dann auch dazu kam. Im Handumdrehen, als hätte der Hauptgang gar nicht stattgefunden, bildete sich genau das als feste Ordnung heraus, ohne daß Rosetta irgendwen vertrieben hätte. Es siegte einfach das natürliche Gesetz der Dinge: Rosetta, selber Inbild der sich selbst feiernden Natürlichkeit, saß am Tisch mit ihren Bewunderern (die restlichen Frauen hatte sie durch ihre wuchernde Weiblichkeit in Männer verwandelt), die dem verführerischen Italienisch der Blondine lauschten, wenn sie nicht gerade, aus Mitleid vielleicht, deutsch sprach. Die biederen Rosen in der Mitte hatte sie spornstreichs, als wären sie Konkurrentinnen, beiseite geräumt. Es kam ihr wohl darauf an, von allen angeschaut zu werden. Weg mit der Barriere! Allerdings hatte sie vorher an den Blüten gerochen, so weit vorgebeugt, daß den Herren angesichts der Aussicht auf ihre Brüste die Luft wegblieb. Als sie sich aufrichtete, lachte sie mit Sternenaugen, wohl wissend, was sie angestellt hatte.
Das machte wahrscheinlich überhaupt den größten Teil ihres Zaubers aus, jene glaubwürdige Naivität und offensichtliche Gerissenheit, wenn sie etwa von ländlichen Festen am Comer See erzählte, von den Speisen und Früchten, ganz kindlich zunächst. Dann wurden im Nu erotische, beinahe derbe Anspielungen daraus, flüchtige Anzüglichkeiten. Was bedeutete bei ihr »gute Freunde«? Abgelegte Bettgenossen? Selbstlose Bewunderer, Lakaien? Aber nein, das Entscheidende blieb der Mund Rosettas, die zwischendurch auch italienische Liedchen sang, ihre Tischnachbarinnen ein Häppchen von ihrem Teller probieren ließ und der zur Linken eins stahl. Sie war die unumschränkte Herrscherin einer willfährigen Gesellschaft, weil sie es überhaupt nicht in Frage stellte. Rosetta, Mittelpunkt von klein auf. Anders konnte es nicht sein. Es war ihre Weltordnung.
Gelegentlich sprang sie auf, um zu zeigen, wie sich ein Bauer, eine alte geliebte Köchin, ein Tier bewegte, wie ihr Vater gemalt hatte mit wüstem Pinselhieb. Dann wanderten alle Blicke über diesen sich großzügig dabei zur Schau stellenden Leib, und es wurde wieder fast so still wie zu Anfang, bis auf den rebellischen Vierertisch. Und weiter ging es mit der Schilderung ihrer, trotz Rosettas Jugend, für Eingeweihte legendären Inszenierungen am See, heitere Berauschungen mit Fackeln, Masken zu historischen Kostümen, mit künstlichem Orchideenregen, echten Landarbeitern und nächtlichen Bootsfahrten, bäuerlichen Mahlzeiten zu Mandolinenbegleitung, raffinierten Verwechslungsspielen, die laszive Folgen haben konnten. Sie erzählte so unschuldig, so anmutig, daß der Gastgeber angesichts des einfallslosen Essens, das er zu bieten hatte, nicht einmal vor Reue über seine Sparsamkeit im Boden versinken mußte.
War denn diese Einzigartige, durfte er sich schmeicheln, dieses Feuerwerk, dieses Füllhorn, dieser wahre Vesuv und dessen Gastspiel in einem sauertöpfischen Land nicht ausschließlich seiner Einladung zu verdanken? Verwandelte diese festliche junge Frau, die man sich schlechtgelaunt oder auch nur alltäglich gestimmt gar nicht denken konnte, nicht den Raum in ein Wunder aus Wein, Rosenduft und Rosetta? Erfüllte nicht durch sie, die durch den Entwurf eines opulent südlichen Daseins zwischen Musik, altem Gemäuer, Amore und »Früchte spiegelndem« See ihre schöne Existenz noch einmal verdoppelte, eine aromatische Wolke von Glück den Raum? So sollte das Leben eigentlich sein und alles andere war verfehlt! Gegen Sitte und Gewohnheit rückten die Gäste von ihren Tischplätzen weg an sie heran.
Aber der Mund!
Es war nur noch Rosetta, die sprach, und für sie die natürlichste Situation der Welt. Was uns an ihr behexte? Vielleicht das ungeheuer Erwartungsvolle, das mit ihr den Raum betreten hatte, eine Erwartung an jedermann, das Aufsaugende, als wäre sie ein feuchter, trotz ihrer Blondheit dunkler Trichter, der alles für sich verlangte, von jedem und von jeder Sekunde, um als Gegengeschenk eine schrankenlose Hingabe zu gewähren. Der kühlste Gast mochte sich fragen, ob sie eher zur Trophäe taugte oder heftige Leidenschaften erwecken könnte, wäre aber beim ersten tiefen Blick von ihr dahingeschmolzen, auch er.
Gut also, das Bewußtsein, die unerschütterliche Überzeugung von ihrer Singularität verlieh ihr die unwiderstehliche Ausstrahlung. Aber der Mund!
Auch der Mund schien für alle erreichbar zu sein. Er verwandelte die Luft, die uns umgab, in einen einzigen schwelgerischen Kuß. Er gestattete niemandem, angesichts von Rosetta nicht ans Küssen zu denken. Sogar die Frauen hätten mit Sicherheit in diesem einen Fall gern ausprobiert, welches Gefühl sich einstellen würde beim Berühren von Rosettas Lippenpolstern mit den eigenen, um ein wenig in sie einzusinken, mehr nicht. Er stand als dunkelrote Mohnblüte im hellen Feld ihres Gesichts. Und Rosetta wollte es! Sie hatte alles dafür getan, daß man den Mund als unausweichlich, als großes Verschlingen empfand, als Symbol, in dem sie vollkommen zusammengefaßt war.
Man sah seinem Blühen an, daß von Rosetta willig hingenommene und gierig genossene, unzählige Küsse sein Volumen und seine Kontur geformt hatten. Er sprach, vielmehr sang davon und forderte das Blut neuer Opfer, ein schwülstiges, ein wollüstiges Lied, aber wunderbarerweise auch taufrisch, wie gerade erst auf die Welt geschlüpft. Aller Wahrscheinlichkeit nach glaubte jeder, der sich Rosetta erotisch nähern durfte, ihr diese seine persönliche Entdeckung als erstes ins Ohr zu flüstern zu müssen, so inbrünstig für ihn bereitet, ihn ersehnend erschienen ihm gegen alle Vernunft diese Lippen. Man wußte es nicht, man dachte es sich, man war sich dessen sicher. Man malte es sich aus, während man ihr lauschte. Die unverblendeten, nicht ganz so betäubten Frauen natürlich erkannten auf den ersten Blick, daß Rosetta – gesegnet mit der Anlage zu einem überdimensional großen gurrenden Mund, das schon, das sei neidisch oder neidlos zugestanden – mit eventuell unnachahmlicher List sein Schwellen hervorhob mittels Stiften, Pinseln, geschickter Farbführung, Glanzlack und, das war nicht auszuschließen, künstlicheren Hilfsmitteln oder gar Eingriffen. Diesem phänomenalen Mund, der ihren zweiten, weiter unten gelegenen und verborgenen beschrieb, entkam jedenfalls keiner. Man glotzte ihn an, bis man sich aufrappelte zu zivilisierterem Betragen. Und wie betörend: Rosetta schien nichts und gleichzeitig alles darüber zu wissen.
Diesem verheißungsvollen, unablässig lockenden Mund also, der jedes Wort, das er entließ, in Schriftzüge aus purpurnem Samt verwandelte, hörten wir zu, gebannt von ihrem »Das liebe ich!«, »Das hasse ich!« und immer zustimmend wie benebelt.
Plötzlich sagte der Mund: »Putin und Assad, Sie alle kennen die beiden und ihre mörderischen Verbrechen. Und doch haben sie Gesichter wie wir alle, Augen, Nase, Mund, und waren einmal unschuldige Kinder!«
Ein Donnerschlag!
Es handelte sich um die erste von einer Handvoll Verlautbarungen in rascher Folge, mit denen uns Rosettas fahrlässig philosophischer Mund außer Fassung brachte und grausam ernüchterte. Man hörte nicht den geringsten Laut nach dem gewaltigen Lärm, den ihr Satz verursacht hatte. Sie nahm es wahr, es irritierte sie nicht. Für sie war es die Einstimmung auf das sich anschließende Bekenntnis. »Ich bin dabei, Künstlerin zu werden.«
Hatte sie erwartet, wir würden applaudieren? Mit dem Anflug einer winzigen Enttäuschung fuhr sie erläuternd fort: »Nicht wie mein Vater werde ich Künstler sein. Ich will das Ächzen, Keuchen, Schluchzen und Stammeln der stummen Dinge malen. Mit Pastellen oder Aquarellen werde ich nächsten Monat beginnen in meiner Einöde am See.«
Seidige Worte und zugleich ein Peitschenknall über unsere verdutzten Häupter hinweg.
Rosetta deutete unser Schweigen auf ihre Weise. Sie hielt unser böses Erwachen für begeisterte Zustimmung, ja für Erschütterung. Das las man in ihrer zufriedenen Miene. Sie war uns in entlegenere Sphären enteilt, um die allerhöchste, noch jenseits körperlicher Schönheit winkende Siegespalme zu erringen und erhob sich nach getanem Werk, nicht ohne den noch immer existierenden Körper, den das Kleid herrlich modellierte, trotz der neuen Perspektiven lieblich ins rechte Licht zu setzen.
»Ich muß mal für kleine Mädchen«, sagte der samtige Mund zu der, die ihr am nächsten saß. Einer zweiten raunte sie zu: »Ich muß mal Pippi. Bin gleich zurück.«
Unter wippenden Federn wogte sie davon. In genau einem Monat würde das triumphale Geschöpf Künstlerin sein. Aha! Zögernd sahen die Gäste einander an. Man nahm einen Schluck Wein, man räusperte sich. Da riskierte es ein Ungehöriger und meinte leise, aber hörbar für alle: »Jetzt zieht sich unsere Künstlerin sicher gerade das Höschen über die Pobacken.«
In diesem Moment, wie von der Bemerkung verursacht, drang aus dem Treppenhaus durch die geöffnete Saaltür ein schreckliches Stöhnen. Dann herrschte Stille, dann folgten Schreie vieler Menschen, denn es fanden in dem Hotel mehrere Empfänge gleichzeitig statt, Getöse, sehr schnell die Sirenen der Ambulanz und der Polizei. Wir saßen ungläubig, gebannt, waren schließlich alle aufgesprungen, einige drängten nach unten, andere standen voll böser Ahnungen beieinander, bis wir erfuhren, daß eine inzwischen gefaßte Frau unserer Rosetta auf dem Weg zur Toilette aufgelauert und sie von hinten mit mehreren Messerstichen getötet hatte. Am nächsten Tag konnte man lesen, es sei bei dem Mord an Rosetta Fettke, Tochter des berühmten Malers, zwar, wie gleich vermutet, um ein Eifersuchtsdrama gegangen, dabei aber um ein Mißverständnis, ein Versehen aufgrund eines exzentrischen, zur Zeit in eleganten Kreisen modischen Kopfschmucks aus den glänzenden Federn von Haushähnen. Von der versehentlich Ermordeten hatte die rasende Täterin, die ihr Opfer von vorn gar nicht zu Gesicht gekriegt, aber den Federputz für einmalig gehalten hatte, noch nie gehört. Ein Irrtum also.
Rosetta, mein Gott, eine schändliche Verwechslung mit der Einzigartigen durch die Schwanzfedern eines Hahns! Undankbare, geschmacklose Welt!
Rosita
Ich habe Rosita schon als Kind verehrt. Ihre süße, nie versäumte Stimme kam sonntags aus dem Radio.
Jetzt aber lag die Gefahr in der Müdigkeit. Sie hatte sich durch schnelle Schübe von Schweißausbrüchen angemeldet, noch bevor Rosita in den Zustand der Erschöpfung geraten war, der sich nun, ein paar Minuten vor dem Auftritt, in Apathie verwandelte.
Stürmisches Herzklopfen, Erregung bis zur Hysterie, als würde es nicht um das Singen einiger Liedchen gehen, sondern um Leben und Tod: Das kannte sie seit ihrem Debut. Die Welt brannte auf diesen einen Punkt zusammen, in dem sie gleich vollkommen ausgesetzt stehen würde (aber wie sollte sie die paar Schritte dorthin schaffen?). Sie wußte, daß es unerläßlich war für den anschließenden Triumph, der sich mit dem ersten Ton, der aus ihrer Kehle stieg, ankündigte, dann, wenn die Angst sich verflüchtigte, überging in die anschwellende Sicherheit des Siegens, in die sie eintauchte, in diesen immer reißenderen Strom bis zum rauschenden Beifall am Schluß. Manchmal hörte sie ihn, so überwältigend war seine Zwangsläufigkeit, bereits im Voraus. Die anschließende Wirklichkeit wetteiferte dann mit diesem Vor-Echo. Niemand ahnte etwas davon, wenn man ihr strahlendes Gesicht beim Verneigen sah: Es lachte! Es lachte über diesen Effekt, der sich mit jeder ihrer einzelnen Darbietungen verstärkte, wobei sie ihn geschickt zu modellieren verstand. Sie konnte den Beifall innig und tosend werden lassen, sentimental und jauchzend. Das winzige, kostbare, gelegentlich etwas größere Risiko, das jeden Abend begleitete, entzündete sie.