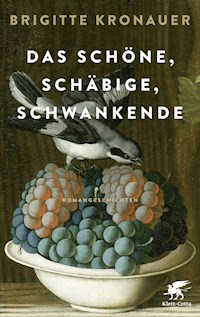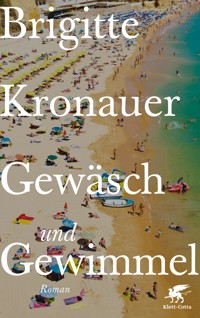15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Brigitte Kronauer, 1940 in Essen geboren, lebte als freie Schriftstellerin in Hamburg. Ihr schriftstellerisches Werk wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis der Stadt Berlin, mit dem Heinrich-Böll-Preis, dem Hubert-Fichte-Preis der Stadt Hamburg, dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Jean-Paul-Preis ausgezeichnet. 2005 wurde ihr von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung der Büchner-Preis verliehen. Brigitte Kronauer verstarb im Juli 2019. Die »Favoriten«: Georg Büchner, Joseph Conrad, William Faulkner, Hubert Fichte, Grimmelshausen, Knut Hamsun, Helmut Heißenbüttel, Eckhard Henscheid, Gerard Manley Hopkins, Victor Hugo, Herman Melville, Eduard Mörike, Hans Erich Nossack, Jean Paul, Wilhelm Raabe, Marie-Luise Scherer, Adalbert Stifter, Robert Walser, William Carlos Williams, Ror Wolf, Virginia Woolf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
BRIGITTE KRONAUER
FAVORITEN
AUFSÄTZE ZUR LITERATUR
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2013 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung von Illustrationen von Reinhard Kleist, Berlin
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93899-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10425-7
Das E-Book basiert auf der 1. Auflage 2010 der Printausgabe.
INHALT
DIE WIRKSAMKEIT AUF DER ZUNGE Vorbemerkung
REDSELIGES BOLLWERK Wilhelm Raabe – eine Entdeckung
DER ZEHNFÄLTIGE HAMSUN Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers
»ER MACHTE MICH UNSICHER« Zu Joseph Conrad
SKEPTISCHER RIESENGESANG Herman Melvilles Versepos Clarel
LOB DER NACHTIGALL Rede zum Grimmelshausen-Preis
MEINE MUTTER STAND FREMD UND FERN HINTER DER KASSE Vorwort zu einem Ror-Wolf-Lesebuch
»BUSSARD ABSEGELT PLANQUADRAT« Laudatio auf Helmut Heißenbüttel
PRACHTEXEMPLAR DES GERINGEN Büchner-Preis-Rede
»EIN ÄSTHET? DASS ICH NICHT LACHE!« Zu William Carlos Williams’ Autobiographie
WIE HAT ES DAS NATURSCHAUSPIEL MIR ANGETAN Zu Robert Walser
WOVOR MAN SCHEUT, WONACH MAN VERLANGT Eine Rede auf Eduard Mörike
DAS MEISTERWERK ALS KATASTROPHE Zu Victor Hugos Die Arbeiter des Meeres
DAS RICHTIGERE WORT Laudatio auf Marie-Luise Scherer
NIE IN DIE KARRIERE DESERTIERT Einige Sätze zu Hans Erich Nossack
DAS IDYLL DER BEGRIFFE Zu Adalbert Stifter (1978)
LEBEN; LONDON; DIESER JUNI-AUGENBLICK Notiz zu Mrs Dalloway von Virginia Woolf
GOTT, DAS ERZBESONDERE UND DER SPRUNGRHYTHMUS Zum 150. Geburtstag des englischen Lyrikers Gerard Manley Hopkins
GESELLSCHAFT IM WETTERLEUCHTEN William Faulkners Licht im August
ZAUBER UND ZAHL Kleiner Rückblick auf Hubert Fichte zu seinem 75. Geburtstag
HENSCHEIDS POESIEN Aspekte zu seinem Werk
DIE LERCHE IN DER LUFT UND IM NEST Zu Jean Paul
DIE WIRKSAMKEIT AUF DER ZUNGE
Vorbemerkung
»… ich beurteile doch nicht die Größe eines Mannes nach dem Umfang der Bewegung, die er hervorruft, ich beurteile ihn aus mir selbst heraus, aus dem Ermessen meines kleinen Gehirns, aus meinem seelischen Schätzungsvermögen heraus. Ich beurteile ihn sozusagen nach dem Geschmack, der mir von seiner Wirksamkeit auf der Zunge bleibt.«
Diese Äußerung Johan Nagels aus Mysterien, Knut Hamsuns zweitem Roman, ist eine gereizte Abwehr gegenüber den von kulturellen Meinungsmachern zu »großen Männern« ausgerufenen Dichtern, die dann folgsam von der bürgerlichen Gesellschaft akzeptiert werden. Die Passage gilt aber, andersherum, in ihrer entschiedenen Subjektivität nicht weniger für die Wertschätzung, die man seinen Favoriten entgegenbringt. Man liebt das Aroma ihrer Literatur wie eine angenehme Brise, egal, ob andere sie überhaupt wahrnehmen oder ablehnen. Man schmeckt seine Lieblinge, süß, bitter, am besten beides zugleich, und traut unbeirrt dieser Empfindung: hin und wieder bis zu glühender Parteilichkeit.
Dazu gehört durchaus, daß man mit dem Verstand kontrollieren will, was denn nun so bezirzend an jenen Ausgewählten ist, und zwar in der Absicht, seinen Eindruck zu objektivieren und für andere möglichst zwingend zu machen.
Die Zuneigung kann sich im einen Fall auf das Gesamtwerk, in einem anderen auf ein einzelnes Buch oder einen Werkabschnitt beziehen. Und natürlich ist sie wandelbar. Immer jedoch hat für mich das Œuvre im Vordergrund gestanden, schon aus Trotz gegenüber dem gängigen biographischen Tratsch, der allzugern als Substitut für die Beschäftigung mit dem Werk selbst fungiert. Dabei soll keineswegs geleugnet werden, wie wichtig die Folie der Lebensbedingungen ist, etwa die, daß Wilhelm Raabe, während seine Romane pessimistischer, aber formal immer neuartiger wurden, von Publikum, Kritik und Verlegern ziemlich im Stich gelassen, als freier Autor eine Familie mit sechs Kindern ernähren mußte, und daß jenes mythische »Nationalepos Amerikas« namens Moby Dick, dem so viele heutige, gefeierte Verfasser dicker US-Romane nacheifern, den endgültigen Absturz seines Autors Herman Melville in die berufliche und private Finsternis bedeutete, jahrzehntelang, bis hin zu seinem Tod.
Nein, solche publizistischen und wirtschaftlichen Debakel dürfen keinesfalls vergessen werden! Jedoch ein bißchen mehr zu vernachlässigen als zur Zeit Mode sind in diesem Zusammenhang die privaten Irrungen und Wirrungen der Autoren schon, da sie schließlich jede menschliche Existenz bestimmen. Das Erstaunliche ist eher, daß sie im Fall der Schriftsteller, wo sie nur scheinbar pikanter ausfallen, das Herausstemmen des – selbstverständlich von ihnen geprägten und künstlerisch formuliert erzählenden – Werks nicht verhindern konnten.
Da heftige Liebe meist von Eifersucht begleitet wird, tritt auch hier zu dem dringenden Bedürfnis, die erkorenen Bücher in den alten Massen und neuen Sturzfluten literarischer Erzeugnisse nach Kräften sichtbar und gegenwärtig zu halten, die Vorstellung, sie Unbefugten aus den Händen reißen zu müssen. Also beispielsweise zu glauben, besonders lauten, zudem selbstironiefesten Kollegen würde das Propagieren des besonders leisen, insgesamt eher bescheiden vom Erfolg gesegneten Robert Walser nicht zustehen und den auf explizit konventionelle Weise ihre Leserschaft betörenden Schriftstellern nicht das Bekenntnis zum explizit unkonventionellen Ror Wolf. Das mag kindisch, lächerlich, arrogant sein, gewiß. Die sporadische Anfechtung soll aber nicht verschwiegen werden.
Als anziehend stellt sich im Glücksfall bekanntermaßen nicht nur das uns Verwandte, sondern auch das stark Abweichende heraus. Um so wesentlicher erscheint dann, was konstantes Kriterium für Benachbartes und Entferntes bleibt.
Es ist bei mir vielleicht die Skepsis gegenüber dem, was Musil »primitive Epik« nannte, also die Abneigung gegen ein naives Operieren mit den Ordnung und Dramatik schaffenden Kunstgriffen (Setzen von Anfang, Ende, Höhepunkt usw.), als wäre es das Natürlichste von der Welt, ja, die Realität schlechthin und nicht bloß ein mühevolles oder spielerisches Streben nach Rundung, Ziel und Sinn. Vertrauenswürdig sind für mich Werke, in denen Extremes, Abschweifung, »Verwilderung« (Brentano) riskiert werden. Die Hersteller leisten sich den Gattungsungehorsam, weil sie sich auf ihre zumindest unterirdisch wirkenden Konstruktionsenergien verlassen. Die literarischen Mittel, die sie anwenden, fußen auf Beobachtung der Realität. Sie sind nie unüberprüft vom eigenen Erleben als sichere Tradition aus Lektüren ihrer Vorgänger übernommen. Ihre Gestalten verdanken sich nicht einer Schwäche für das Aparte. Vielmehr sind sie gerade aus Wirklichkeitstreue oft sogenannte Sonderlinge, da das persönlich Verrückte und eben privat Absonderliche hoffentlich in allen menschlichen Wesen steckt und unter dem Klischee des Gewöhnlichen freigelegt werden soll, auch wenn diejenigen, die sich eisern für normal halten, es meist von vornherein und vorsichtshalber in die Ecke des Skurrilen schieben und damit weit von sich weg.
Mit keinem Romancier habe ich mich vermutlich so oft beschäftigt wie mit dem englischen Polen Joseph Conrad. Das mag in der Hauptsache an der für mich unwiderstehlichen Verquickung von höchst melodramatischen Atmosphären, Umgebungen, Gemütszuständen und der kühlen Gefaßtheit liegen, mit der er seine flimmernden Figuren gegen die Gleichgültigkeit des Weltalls stellt. In dieser ostentativen, stets wiederholten Geste spiegelt sich eine andere, für alle meine mich bestärkenden, trostreichen Favoriten gültige. Ich meine das Pathos eines grundsätzlichen, überaus bewußten Aktes: den der Einschleusung einer Gestalt/Erscheinung des Lebens ins Reich der Literatur. Es handelt sich, ungeniert herausgesagt, um säkulare Transsubstantiation, um jene Umwandlung von O-Ton in literarische Artikulation, die niemals durch simples Überflutschen der Schwelle möglich ist.
Die vorliegenden Texte aus einem Zeitraum von über dreißig Jahren wurden nur gelegentlich leicht überarbeitet. Überschneidungen ließen sich nicht immer vermeiden, da ich die spezielle Dynamik der jeweiligen Aufsätze erhalten wollte. Einige mir wichtige Arbeiten (über Helmut Heißenbüttel, Eckhard Henscheid, Gerard Manley Hopkins, Jean Paul, Adalbert Stifter, William Carlos Williams), die bereits in kleinen Sammlungen erschienen waren, weshalb ich sie nicht in den Essay-Band Zweideutigkeit (2002) aufgenommen habe, sollten an diesem Ort, unter den Favoriten, nicht fehlen. Und natürlich spielt der Zufall, spielen von außen kommende Anlässe eine nicht unerhebliche Rolle. Wäre mir etwa der im Frühjahr 2010 in deutscher Übersetzung erschienene Roman Das Ende des Vandalismus – ein Glanzstück zeitgenössischer Literatur – des 1956 geborenen Amerikaners Tom Drury noch rechtzeitig in die Hände gefallen, hätte ich ihn hier gern ausführlich vorgestellt.
Ansonsten möge gelten, was der Schuster Unwirrsch in Raabes Hungerpastor sagt: »Was er las, verstand er meistens auch; und wenn er aus manchem den Sinn nicht herausfand, welchen der Autor hineingelegt hatte, so fand er einen anderen Sinn heraus oder legte ihn hinein, der ihm ganz allein gehörte, und mit welchem der Autor sehr oft zufrieden sein konnte.«
(Hamburg, 2010)
REDSELIGES BOLLWERK
Wilhelm Raabe – eine Entdeckung
Nicht ohne Hochmut habe ich um Wilhelm Raabe (1831–1910) lange Zeit einen Bogen gemacht, um diesen bis zur Mühseligkeit umständlichen Autor (so interpretierte ich die literarische Kolportage), von dem ich weder Feuer noch mich betreffende Erkenntnis erwartete. Endlich wollte ich den Fall per Stichprobe erledigen. Es ging schief, wie viele Jahre zuvor beim ersten Versuch mit dem dann später so verehrten Joseph Conrad, denn ich griff ausgerechnet zur Chronik der Sperlingsgasse. Was kümmerte mich, daß es sich um ein Jugendwerk handelt? Der drög-idyllische Raabe war durchgefallen, und dabei wollte ich es gern belassen.
Dann geriet mir, vom Sperrmüll mitgebracht – dieser Autor steht nicht mehr so selbstverständlich wie der im Vergleich viel sattere Thomas Mann und der viel weniger kratzige Theodor Fontane es tun, in jedem Lesehaushalt herum – der späte Roman Die Akten des Vogelsangs (glänzender Titel!) in die Hände. Diesmal ging es in einer von vornherein dialektisch aufgebauten Welt um die untergründige und desto schärfere Attacke auf eine Gesellschaft, die sich maßvollen Gemütswerten und handfester Karriere verschrieben hat, insofern anarchische Infektionen verabscheuen, jedenfalls scheuen muß. Sie wird verkörpert durch den Oberregierungsrat Karl Krumhardt. In der anderen Waagschale liegen Freiheit und Qual dessen, der sich außerhalb der Normalen stellt: der genialische, scheiternde Velten Andres.
Dessen seelische Katastrophe kulminiert in einer tief ins Fleisch familiärer Übereinkünfte schneidenden Szene. Velten, trotz aller Widerborstigkeit Inbild eines guten Sohnes, verschleudert die von seiner verwitweten Mutter für ihn mit Liebe und größter Sorgfalt aufbewahrten Möbel nach deren Tod unverzüglich in einer öffentlichen Zerstörungsorgie an Beliebige. Den Rest verbrennt er. Es ist sein höhnischer Kommentar zu einer in Immobilienwerten denkenden Umgebung, die ihre Begierden freilich feiner zu verbrämen wünscht und im selben Atemzug die desperate Offenlegung seiner, Veltens, innerer Verhältnisse.
Dem Zwiespalt zwischen Mehrheit und Außenseiter bin ich bei Raabe dann oft begegnet, und häufig treibt er ihn auf die Spitze, in dem er die bürgerliche Position zur einlullenden, im Laufe des Geschehens fatal unterlaufenen Erzählinstanz macht. Es sind die treuherzig Selbstgefälligen, die mit verständnislosen, bestenfalls irritierten Augen die flackernde Existenz der Abweichler verfolgen. Ihre prinzipielle Gutmütigkeit vertieft den Kontrast. Das Leiden der Widerständler aber beginnt bei Raabes Helden bereits in der Schulzeit, und so gern sich dieser Autor der unerschöpflichen Quellen seiner Kindheitserinnerungen bedient, so unerbittlich holen ihn dabei stets Erfahrungen des klassischen Einzelgängers mit dem hechelnden Rudel der Mitschüler ein. Das ist im frühen Hungerpastor nicht anders als im späten Stopfkuchen.
Vor Raabes riesigem Romanwerk steht man als Leser hilflos da. Ich langte, nachdem durch die Akten des Vogelsangs der Funke vehement übergesprungen war, eine Weile bewußt planlos zu. Schließlich hatte ich ja Vertrauen gefaßt. Dem Roman Stopfkuchen von 1891 wich ich absichtlich aus. Der abstoßende Titel, der einem von vornherein auf den Magen schlägt, weckte in mir die frühere Aversion. Schließlich brachte mich der beharrliche Zuspruch von ein, zwei Freunden, obschon ich innerlich weiter maulte, in den Bannkreis auch dieses Werks.
Heinrich Schaumann, seit Kindertagen »Stopfkuchen« genannt, ist fett, faul, gefräßig, ein krasser, doppelt verbarrikadierter Außenseiter. Das wuchernde Fleisch dient ihm als wehrhafte Schwarte gegen die Aggressionen einer engherzigen, opportunistischen Welt. Mit eisernem Charakter und empfindsamer Seele ausgestattet, obendrein, wie häufig die Protagonisten Raabes, humanistisch gebildet, und das mit hemmungslosem Vergnügen zur Schau stellend, spielt er in seiner Ehe den phlegmatischen Patriarchen. Es versteht sich, daß dieses Monstrum sich im Laufe seiner dreifachen, die eigene Kindheit, paläontologische Forschungen am Ort und einen alten Mordfall betreffenden Tiefenbohrungen in vielem als das Gegenteil von dem erweist, was die kleinstädtische Gesellschaft in ihm vermutet.
Aber Fettpanzer und Behäbigkeit sind nicht nur Camouflage. Mit beidem errichtet Heinrich eine um Nachrede unbesorgte Festung gegenüber einer Menschheit, die er, ohne ihr Feind zu sein, ausdrücklich und irreversibel meidet.
Man sähe diesen edlen Geist lieber von einigen Untugenden befreit. Raabe läßt sie jedoch ungemindert bestehen, und erst das macht Stopfkuchen, Mann und Roman, zu dem für eilige Vorlieben unzugänglichen, überaus imposanten Klotz. Weitschweifig, von der Zeitgeist-Figur des Erzählers wirkungssteigernd gerahmt, beherrscht Heinrich, der Retrospektive mit unbestechlichem Blick auf die Gegenwart, in den Wällen seiner »Roten Schanze« die Vergangenheit. Scharfäugig und anfechtbar trotzt dieses redselige Bollwerk dem, was die provinzielle (und neuerdings globale) Gesellschaft euphemistisch »Zukunft« nennt.
Und Raabe selbst? Unter Aufbietung all seiner grandiosen Fähigkeiten zu Komik, Witz und humorvoller Resignation kämpft er, durch seinen Helden hindurch, angesichts der rasenden Zerstörung landschaftlicher Natur und historischen Bewußtseins leidenschaftlich um Gelassenheit, manchmal geradezu bebend vor Anteilnahme. »Hier reuten sie sie allmählich überall aus, die Hecken. Da drunten um das Nest herum, in welchem wir jung geworden sind und grüne Jungen waren, haben sie sie alle glücklich durch ihre Gartenmauern, Eisengitter und Hausmauern ersetzt. Es ist wirklich, als könnten sie nichts Grünes mehr sehen!«
In seinem Roman Pfisters Mühle war die Verwüstung von Natur und Vergangenheit bereits der alles durchdringende Gedanke und Schmerz. Im unvollendet gebliebenen, letzten Roman Altershausen, der damit beginnt, daß der Erzähler am Morgen nach überstandenem siebzigsten Geburtstag im Bett mühsam sein Ich wieder zusammensucht, heißt die abschließende Konsequenz: »Es kam ihm zu Hause vor, als ob die Erdoberfläche von ›Uns‹, d. h. seinesgleichen, reichlich, überreichlich gefüllt und es durchaus nicht notwendig sei, daß er mit seiner Person, trotz aller vom Staat und von Privaten anerkannten Verdienste, das Gedränge darauf noch vermehre.«
Wen aber könnte wundern, daß Raabes Zuneigung unverbrüchlich den Armen, Bedrängten, den Tieren in Friedensund Kriegszeiten gilt? Sie offenbart sich in Kristallisationen, bei denen man des Epikers eigenen Herzschlag heiß zu spüren meint. »Und wer viel Umgang mit den Tieren gehabt hat, der weiß, wie wenig der Unterschied zwischen ihnen und den Menschen zu bedeuten hat in allen Dingen, die mit Erde, Wasser, Licht und Luft zusammenhängen«, räsoniert der Förster in der Erzählung Zum wilden Mann. Dabei klemmt der mit Raum-, Zeit-, Charakter-Kontrasten äußerst raffiniert jonglierende Konstrukteur Raabe seine intensiven Kurzbilder derart erbarmungslos zwischen entlegene lateinische Zitate, daß es einem Hören und Sehen attackiert. Ohne Bildungsrespekt aber müssen sich umgekehrt auch die antiken Weisheiten in der Zange der Gegenwart bewähren.
Neben den meist verdrängten Unergründlichkeiten, den »Finessen in sich selber in seinem Gemüte« und den »Bedenklichkeiten im Verkehr mit seinem Nächsten« (Prinzessin Fisch) ist wohl die totale Destruktion Hauptthema, besser: die Stunde der Wahrheit in Raabes Romanen. Irgendwann geht es immer an den Boden der Existenz, dahin muß der Leser zumindest für Augenblicke unweigerlich hinab, in Momente absoluter Zerstörung, ins Elend alles Kreatürlichen. Das geschieht anhand privater Schicksale wie auch gewaltiger Entwürfe der Schlachtfelder des 17. und 18. Jahrhunderts, samt Brutalisierung der Bevölkerung, wenn das überlieferte Menschenbild körperlich und metaphysisch in Schlamm und Blut zertreten wird. Unverbesserliche und frisch nachgewachsene Befürworter von Kriegen mögen dazu Höxter und Corvey, nein, das großartige Odfeld lesen und in sich gehen!
Die ruhige Stimme des Erzählers bricht selbst über solchen Schrecken nicht. Aber sie zittert und ringt um Fassung, und der desillusionierte Menschenfreund kennt angesichts von Abgrund und Vernichtung als einzige Hoffnung, als Ultima ratio das verzweifelte Klammern an Humanität, ja Liebe. Sie gelingt einzelnen, mühsam genug, vielleicht gerade den besonders Heimgesuchten. Das fragmentarisierte Individuum hat jedoch keine andere Wahl, als sich in einem, wenn auch möglichst ab und zu skeptisch kontrollierten, entschiedenen Horizont neu einzurichten.
Auf diesem streng geprüften Fundament stehen Raabes gemüthaft-gelehrte Fiktionen!
Die auffällige Hartnäckigkeit, mit der er in seinen späteren Werken, eigentlich bereits im Hungerpastor, das Geflecht seiner Motive und die Konstellation seiner Charaktere verdeutlicht, ist wohl als Ausdruck des Wunsches zu begreifen, von einem naturgemäß schwerfälligen Publikum besser verstanden zu werden. Verstanden in der Ambition, episch zu ergründen, wie wir wirklich und nicht laut Überlieferung erleben. Auch, wie wir uns an dieses Erlebte, vermischt mit Gelerntem, erinnern, nämlich nicht linear, nicht chronologisch, vielmehr in einem Zeit und Raum überspringenden, sich überlappenden Hin und Her, dabei Parteilichkeiten, Gegensätze, Parallelen bildend, um uns überhaupt zurechtzufinden. Und läßt sich der Vorwurf, Raabe rekapituliere immer dieselben Themen (mit dem seine Produktion im fortschreitenden Alter von den Redaktionen abgelehnt wurde), nicht dadurch entkräften, daß er seine ihm nach wie vor am Herzen liegenden Stoffe – ähnlich wie etwa Eichendorff eine schmale Palette lyrischer Reiz- und Reimwörter für seine Stimmungsräume – als fixe Bausteine für die jeweils originäre Architektur eines modernen poetischen Kosmos nutzte?
Wer diesen Autor liest, taucht ein, falls ihm seine Raabe-Stunde geschlagen hat, in eine befremdende Heimat mit beißendem Kartoffel- und Rauchfeuergeschmack. Zugleich wird er Zeuge und Teilhaber einer Welt, in der das baumeisterliche Vergnügen an den Funktionen epischer Artistik und der Schmerz über die zerstörerischen Energien der Menschennatur kein Widerspruch, sondern einander antreibende Kräfte sind.
DER ZEHNFÄLTIGE HAMSUN
Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers
»… jetzt mußte er sich mit der Unordnung und Verwirrung, die in der Welt seines Inneren herrschten, beschäftigen, und als es acht Uhr schlug, da hatte er längst erkannt, daß er sich nicht sogleich niedersetzen könne, um das Manuskript des Buches vom Hunger zu beginnen.«
Um den Hunger des Leibes soll es gehen und mehr noch um den nach Wissen, Entfaltung, Liebe, Erleuchtung, einen Hunger, von dem der Held hofft, er möge ihn sein Leben lang nicht verlassen. Trotz tapferer Anläufe führt Hans Unwirrsch, Sohn eines armen Schusters und Hauptfigur im Roman Der Hungerpastor (1864) des damals dreiunddreißigjährigen Wilhelm Raabe, seinen Plan schließlich doch nicht aus. Er wird statt dessen Seelsorger in der Pfarre Grunzenow am Ende der Welt.
Der große Autor Raabe hatte seinem Protagonisten Hans, als der in seiner Endstation am Meer landet, die Dichterarbeit durch eben diesen Roman ja längst abgenommen! In der angemessenen Glut erscheint das Sujet ein Vierteljahrhundert später im Debüt des einunddreißigjährigen Knut Hamsun. Dessen Werk Hunger nämlich ist nicht eins vom oder über den Hunger. Es ist Entbehrung, ist das gestaltgewordene Dürsten schlechthin. Abschnitt für Abschnitt, Zeile für Zeile.
Sehr unmetaphorischer Hunger zwingt einen angehenden, verzweifelt um Aufträge wie ums Überleben kämpfenden Schriftsteller, zur Beruhigung seiner leeren Eingeweide den eigenen Speichel zu schlucken, Holzspäne und von der Straße aufgelesene Apfelsinenschalen zu kauen, an Steinen zu lutschen, von Knochen, für einen angeblichen Hund erbettelt, die rohen Fleischfetzen abzunagen. Sein Magen ist normaler Speisen dermaßen entwöhnt, daß er alles, selbst das in einem Glücksmoment erworbene Beefsteak, unter Tränen der Wut erbricht. Fast könnte einem der heimliche Verdacht kommen, auch dieser Held wolle seinen Hunger im Grunde gar nicht loswerden, obschon er nahezu daran stirbt. Hamsun kennt sich mit der Materie bis in die winzigen Konkreta der Verwahrlosungsetappen aus. Jedes Detail wiegt schwer durch Erfahrung und blitzt noch in der Dunkelheit des Schmerzes vor Inspiration, grotesk, witzig, daß man in sich hineinweint und laut aus sich herauslacht, nicht nur bei den in höchster Not geschluchzten Gedankenkunststücken mit exotischen Wörtern und Papiertüten auf eisigen Parkbänken. Wer angesichts des Jammers sentimental werden möchte, den ruft, um das Wechselbad vollkommen zu machen, Hamsuns salziger Spott, der verhütet, daß etwas je im Bodenlosen versumpft, zur Ordnung. Es handelt sich weniger um Hungerphantasien, schon gar nicht um landläufige, als um phantastische Hungerempirie.
Von der Stadt Kristiania (dem späteren Oslo), wo der junge Held in äußerster Armut und Obdachlosigkeit existiert, bisweilen vegetiert, heißt es im Einleitungssatz, daß sie keiner verlasse, ohne von ihr gezeichnet zu sein. Man setze für den Namen der Stadt den von Hamsuns Erstling ein und hat die Wirkung, die dieses Buch, eine Feuersäule vor und in der Prosalandschaft des 20. Jahrhunderts, auf jeden Leser haben muß, der von Literatur zu versengen ist.
Die Reizbarkeit des polysensitiven Helden gegenüber Anblicken, Gerüchen, Geräuschen, die Befähigung zu Leiden, Hingerissensein und inständigem Ekel, zu Haß, innigstem Zartsinn, zu blasphemischen Eruptionen, zu Irrsinn und Frömmigkeit verwandelt das steinerne, sich ihm auf sämtlichen vitalen Ebenen verweigernde Kristiania in ein zuckendes Nervensystem. Die Stadt wird umgegraben in einer schrille Erzählvolten massenweise hervorbringenden Unduldsamkeit, wird umgepflügt von der flackernden, nichtsdestoweniger kristallinen Wahrnehmung dieses einen leidenschaftlich Darbenden, der sich tradierten Blicken und Literarisierungen bis in das Registrieren jedes Staubkorns widersetzt, der Hausmauern und Individuen in finstere und grelle Strudel reißt. All die Vermieterinnen, Pfandleiher, Polizisten, Mädchen aber ahnen nicht, daß sie samt ihren Behausungen zu vibrieren beginnen. Ungerührt zeigen sie auf den Wahnsinnigen, der unter der Droge des Hungers ihre Stadt aus den Fundamenten hebt und ihr eine neue Realität erschafft, die deren konventionelle Version tilgt.
Uns jedoch, die, satt oder ungesättigt, weder in Kristiania noch im neunzehnten Jahrhundert leben, uns versetzen Auge und Sprache des Norwegers in einen zugigen Korridor zwischen Himmel und Hölle, die verschleierten Extrempole irdischer Existenz.
Knut Hamsun wurde als Schneidersohn Knud Pedersen 1859 in Garmotraeet geboren. Er wuchs, Schafe hütend, bis zum achten Lebensjahr in ärmlich-bäuerlicher Umgebung auf. Es war die Zeit, die er später als die glücklichste seines Lebens bezeichnete. Die folgenden Jahre, die er aus finanziellen Gründen bei seinem Onkel, einem militärisch strengen Pfarrer, verbringen mußte, zählte er zu den schlimmsten. Aus der verträumten Freiheit des Hirtenlebens geriet er von einem Tag auf den anderen unter die Drillversuche des sektiererischen Theologen. Zum ersten Mal konfrontierte das Leben den Jungen mit dem Zusammenprall von Gegensätzen. Es war ein prägender Schock. Ein Foto des Halbwüchsigen zeigt unter zu Berge stehenden Haarbüscheln ein zorniges, tief verbittertes Kind. Mit vierzehn wurde er Kaufmannslehrling, dann fliegender Händler im Nordland, Schusterlehrling, Amtsgehilfe. Zweimal versuchte er erfolglos sein Glück in Amerika, der überdimensionalen Hoffnung aller Mittellosen jener Zeit. Die auf diesen Etappen erlebten Milieus bilden später das unverwüstliche Arsenal seiner Romane.
Schon hier kann man fragen: Kehrte der intellektuelle Bauer Hamsun, obschon er es hartnäckig, und gelegentlich als deren Apologet, mit der Landwirtschaft probierte, zum Leidwesen seiner Frau, der Schriftstellerin Marie Hamsun, und seiner fünf Kinder immer wieder ins sporadische Nomadenleben zurück, weil er der scheinbaren Einfalt heimatlicher Erde nicht ausdauernd traute?
Als Schriftsteller ist er Autodidakt wie der vierzig Jahre ältere Herman Melville und der nur zwei Jahre ältere Joseph Conrad. Mit den beiden, unterschiedlichen sozialen Milieus entstammenden Epikern verbindet ihn jedoch mehr als deren Seiteneinsteigertum, lange nach jeweils einschneidenden Kindheitsabbrüchen. Alle drei haben sich früh in eine ganz andere Welt als die heimische aufgemacht, wo sie sich, noch ohne es zu vermuten, in harter körperlicher Arbeit Erfahrungen und Vokabular für ihren Schriftstellerberuf verschafften. Alle drei schwankten in ihrem späteren Leben immer wieder, besonders während der zwischen Schreibräuschen und ehrgeizigen Höhenflügen stattfindenden Heimsuchung durch Schreibblockaden, ob ihre früheren, unkünstlerischen Berufe nicht die glücklichere Wahl für sie gewesen wären. Alle drei gründeten bürgerliche Familien und wurden, in wechselnder Stärke, bis zu ihrem Tod von Erfolgs- und Geldproblemen gepeinigt.
Die entscheidende Gemeinsamkeit ist eine andere.
»Was mich interessiert, ist die unendliche Beweglichkeit meines bißchens Seele … Es ist auch von der ersten bis zur letzten Seite nicht ein einziges Gefühl wiederholt worden, d. h. keines, keines ist dem vorhergehenden und dem nachfolgenden gleich«, verteidigte Hamsun nach Erscheinen von Hunger sein Werk gegenüber dem Literaturkritiker Georg Brandes. Das bedeutet nichts anderes, als daß jenes »bißchen Seele«, und mit ihr die Wirklichkeit, heterogen ist, über unzählige, rasant wechselnde, gegensätzliche Zustandsweisen verfügt, so, wie es Melville etwa in der Fabelfigur des Moby Dick und Conrad in Lord Jim zu einer in ihrer Ambivalenz pathetischen Gestalt komprimierten.
Auch bei Hamsun, der über einen einzigartigen Sinn für das Gleiten, für allerfeinste elektrische Ströme und Fintenschläge zwischen Menschen verfügt, handelt es sich nicht um die altbekannten zwei widersprüchlichen Seelen in der einen Brust, schon gar nicht um den wahren Kern unter dem Schein. Er nimmt Freiheit und Verhängnis von Mensch und Welt, mal dies, mal das, mal etwas Drittes und Viertes zu sein, also das rätselhaft Fragmentarische der Wesen, des eigenen Herzens und die meist unterschlagene, gefährliche Anzahl ihrer Möglichkeiten noch konsequenter zur Kenntnis. Er atomisiert, zerstört eben noch installierte Legenden und läßt sie vorübergehend neu erstehen. Homogenität ist eine Einbildung der Gesellschaft. Wehe, wenn er den Finger darauf legt! In Mysterien (1892) ist das Disparate im Verhalten des kreischend gelb gekleideten Helden bereits Methode, ist dessen persönlicher, höchst riskanter Stil, der ihn schließlich in Hysterie und Selbstzerstörung treibt.
Die junge Ehefrau Ane Maria aus dem Roman Landstreicher (1926) führt sich auf den ersten Seiten als die mitfühlendste Person des ganzen Dorfes ein, als sie, trotz der eigenen bescheidenen Verhältnisse, einem malträtierten Bettelmusikanten neue Socken schenkt. Einige Kapitel weiter sieht sie einem um Hilfe schreienden Mann beim stundenlangen Versinken im Moor zu. Sie könnte ihn retten, unterläßt es aber kalten Blutes. Aus flüchtig gekränkter Eitelkeit hat sie selbst ihn in die Falle gelockt. Zu Hause setzt sie mit verstörendem Geschick die gewohnten Tätigkeiten fort. Erst viel später rühren sich die Racheengel. Nach einem Anstaltsaufenthalt ist sie wieder ganz die alte, und auch in der Dorfgemeinschaft graust es, wie vor den Ehebrecherinnen und Kindsmörderinnen, keinen vor ihr. In einem vagen Fühlen wissen alle, daß die Grenzen zwischen Besser und Schlechter mäandernd verlaufen, und nicht nur die Härte ihres Lebens zwingt sie, heute brüderlich, morgen betrügerisch zu sein. Der Autor aber schlägt komische, herzzerreißende Geistesblitze aus dieser wackligen Disposition. Man nimmt, nach Katastrophen und Glückszufällen, den Faden des eigenen redlichen, armseligen, abergläubischen, gaunerischen Alltags wieder auf. Kriminelle Regungen, vor denen niemand sicher ist, tauchen ins Halbbewußte ab. Als unbezweifelbares Unrecht stellt sich etwas erst dann heraus, wenn das Gesetz es bestraft. Auch der späte Hamsun läßt die Menschen nicht ganz, aber er zerschmettert sie nicht vollständig. Stets ist ihr Glück bedroht, selten läßt ihre Tragik sie in endgültige Abgründe stürzen.
Das Gemeinwesen, zwischen Archaik und Fortschritt schwankend, bleibt wie die Landschaft niemals intakt. Umfeld und Hintergrund der Figuren bewegen sich, wie sie selbst, in einem unruhigen Auf und Ab von Erfolg und Mißerfolg, Aufbau, Zerstörung. Stärker noch als in dem Roman Segen der Erde, für den Hamsun 1920 den Nobelpreis erhielt, kann man in Landstreicher detailliert anhand eines Küstenortes, der vom jährlichen Fischfang bei den Lofot-Inseln lebt, die brutale Abhängigkeit von der Natur und die Folgen zivilisatorischer Einfälle studieren, was uns angesichts des Klimawandels schärfer einleuchtet als zu einer Zeit, wo man sogleich an das hier völlig deplazierte Blut-und-Boden-Klischee dachte. Hamsun benötigt die Fiktion vom schlichten Ödland-Menschen als Gegenpol zur Vieldeutigkeit und legt zugleich gerade in dessen angeblicher Urwüchsigkeit das »moderne« Zersplittern in zarte und wilde Gemütszustände frei, das Nebeneinander von Mörderischem und Humanem, das nuanciert Zusammengesetzte der Person und ihrer parallel existierenden Möglichkeiten ohne eine alles dominierende, zuverlässige Haupteigenschaft.