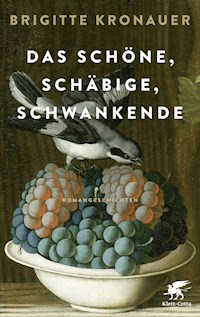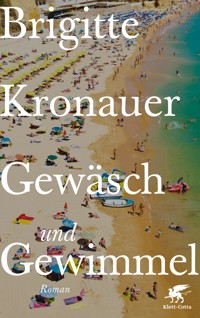
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man spaziert durch diesen Roman wie durch das Gewimmel einer Fußgängerzone. Manche Menschen sieht man öfter, an manche wird man sich kaum erinnern. So auch Elsas Lieblingspatientin Luise Wäns, die verliebt ist in Hans Scheffer, den Leiter eines Renaturierungsprojekts. Sie wünscht sich sehnlichst, mit ihm noch einmal in die Kindheit abzutauchen, ein kleines Arkadien zu schaffen gegen eine angeblich erwachsene Welt. Eine Welt, die großartig oder furchtbar ist wie die täglichen Nachrichten, die einen aber ständig überfordert. Und dennoch trotzen die Figuren dem Alltag stets aufs neue Bedeutung und Sinn ab. Auch in ihrem neuen Roman erfüllt die große Erzählerin Brigitte Kronauer unser unsterbliches Bedürfnis nach Geschichten und Anekdoten, nach Ernst und Komik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 847
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
BrigitteKronauer
Gewäsch
und
Gewimmel
Roman
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2013 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung eines Fotos von Getty Images/John Harper ©
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98006-6
E-Book: ISBN 978-3-608-10605-3
Dieses E-Book entspricht der 1. Auflage 2013 der Printausgabe
Erster Teil Elsas Klientel
Wartezimmer
Pratz, der Schwerenöter? Frau Wäns? Der gute Mensch und Plattfüßler Dillburg?
Elsa Gundlach hat zur Aufheiterung ihrer teilweise schwer geplagten Klienten für jeden Montagmorgen einen frischen Strauß in Auftrag gegeben. Pünktlich nach einer Woche ist er welk und wird weggeworfen. Immer passen die Blumenarrangements in der Moritzstraße 13 zur Jahreszeit. Die meisten der vielfach und variantenreich verbogenen Zeitgenossen wissen das zu schätzen, auch wenn sie sich oft nur ein paar Minuten gedulden müssen, bis ihnen Elsa, stets in rigorosem Weiß wie ihr Wartezimmer, mit Massagen und Turnübungen zu Leibe rückt. Des schönen Namens wegen würde Elsa es gern einmal mit der strategisch raffinierten Osterluzei versuchen, aber die Leute kennen die Pflanze nicht, und ohne das Wort nutzt sie ihnen nichts. Sie ist unansehnlich.
Für den, der den Zuspruch des Floralen nicht bemerkt, liegen natürlich die üblichen Illustrierten mit den unverwüstlichen Rätselecken in ordentlichen Stapeln bereit, allerdings nicht zuverlässig in den neuesten Ausgaben und manchmal mit verräterisch aufgequollenen Seiten. Den Männern würde die Vorstellung, daß die sommersprossige Elsa die Zeitschriften vorher in der Badewanne in den Händen gehalten hat, sehr gefallen.
Da die Therapeutin genaue Termine abmacht, befinden sich selten zwei Leute gleichzeitig im Raum. Für Elsa dagegen ist das Kabinettchen immer gefüllt. Sie sieht sie alle dasitzen, den noblen Herrn Brück und die kleine Ilse, Herrn Fritzle (Rosennarr, Schachspieler, auch ehemaliger Holzkaufmann, der im Ratzeburger Goldachter dabei war), Jan Sykowa mit dem großen Kopf, den fröhlichen Bergwanderer Herbert Wind, den tapfer kämpfenden Alex und die verschlossene Eva Wilkens, die rotzfreche Katja, Martha Bauer, Herrn Pratz, berühmt und launisch, und die anderen, deren Namen sie vergessen oder gerade nicht parat hat. Waren darunter nicht, ganz am Rande, eine etwas verrückte Frau Schroberer oder Schreiber, nein, Elisabeth Schneider und ein sporadischer Menschenhasser, der sich Graf Otto nannte? Elsa sieht sie vor sich mit ihren Verspannungen und Verkrampfungen, ob sie in Wirklichkeit längst geheilt sind oder nicht, ob sie noch hier wohnen oder seit Jahren in einer anderen Stadt. Sie zeigen sich mit Reifen und Theraband, auf dem großen Ball wie der Baron von Münchhausen durch den Raum hüpfend (etwa der Geistliche Clemens Dillburg) und auf dem Rücken, die gedehnten Arme rechtwinklig neben sich aufliegend, was einigen fast unerträgliche Schmerzen bereitet. Elsa sieht die Wehleidigen und die Ehrgeizigen, die, die durchhalten und die, die resignieren werden. Manche schmuddelig, manche immer frisch unter der Dusche weg, beides nicht schlimm. Zwei, drei verfügen nicht mal über einen eigenen Körpergeruch.
Ein besonderer Fall ist natürlich Luise Wäns, die Mutter der mürrischen Bankbeamtin Sabine. Frau Wäns ist die einzige Person, die Elsa zuhause, im Tristanweg 8 besucht, draußen, flußabwärts. Seit die gymnastischen Übungen nicht mehr notwendig sind, fährt Elsa manchmal zum Wandern hin. »Frau Wäns«, sagt Elsa ihrem Freund Henri, der bis auf die Wochenenden frühmorgens zur Arbeit fährt und meist spätabends wiederkommt, »wirkt von weitem wie eine Studentin von der wurschtigen Sorte. So zieht sie sich auch an, aber nicht, da bin ich sicher, um jünger zu erscheinen. Sie hat einfach nicht mitgekriegt, daß sie äußerlich älter geworden ist.«
Auch nachts, wenn Elsas Freund neben ihr liegt, tauchen die Gesichter und Körper auf. Zumindest in diesem Fall möchte sie die Klienten verscheuchen, aber die sind zäh. Elsa weckt dann, nicht allzu schuldbewußt, den sorglos atmenden Mann. Ihm sind die Leute, die ihn nichts angehen, deshalb schon lange vom Hörensagen vertraut. Hoffentlich reißt ihm nicht eines Tages der Geduldsfaden.
Warum aber immer in Weiß, schöne Elsa?
Die Patienten jedenfalls halten Weiß für die Hautfarbe rothaariger Engel. Unter Elsas professionellen Berührungen erschauern sie und geben, laut oder stumm, mehr von sich preis, als sie wissen, als Elsa wissen will, brauen sich zusammen vor ihr und dem unbarmherzig aus tiefem Schlaf gerüttelten Freund.
Alte Zeiten
Martha, eine Frau Martha Bauer mit gelegentlich starkem Schulterschmerz, Freundin einer gewissen Fränzi in Osnabrück, hatte im November vor fünfundzwanzig Jahren einer Bekannten, Elisabeth Schneider, ihren Dampfkochtopf geliehen. Ein Vierteljahrhundert später, am 16. November, hörten sie durch Zufall wieder voneinander, und zwar anläßlich einer telefonischen Nachforschung, bei der es natürlich um ganz anderes ging. Ohne sich lange bei der Überraschung aufzuhalten, sagte Martha, sie habe sich furchtbar geschämt, als sie damals den Topf von ihr, Elisabeth, zurückerhalten habe. Er sei so vorwurfsvoll poliert gewesen, poliert wie neuwertig, nein, wie nicht einmal beim Kauf.
»Aber nein, nein, um Gottes willen, nein und nein«, rief daraufhin Elisabeth, die den Vorfall vollständig vergessen hatte. »Du galtest als hundertprozentige Hausfrau, genannt ›Martha ohne Makel‹. Ich hatte bloß Angst, mich vor dir zu blamieren, vor dir und deinem kritischen Blick.«
Wie auch immer, sie vertieften, was sie bereits vor fünfundzwanzig Jahren unterlassen hatten, bei der neuen Gelegenheit, obschon mittlerweile geschieden oder verwitwet, jedenfalls einsam, die Bekanntschaft durchaus nicht. Es war ihnen, als würde sie ein unüberwindbarer Graben trennen, ein brenzliges Köcheln, ein unguter Dampf.
Im kalten Moskau aber erschlugen am Tag des Telefonats drei Obdachlose, arme Soldaten aus dem russischen Afghanistan-Krieg und jetzt für alle Zeit abgebrühte Veteranen, einen jungen, erst fünfundzwanzigjährigen Mann. Einen Teil der Leiche verspeisten sie gemeinsam, den Rest verkauften sie an den Besitzer einer Imbißbude, wo man ihn weiterverwertete, bevor man dem kannibalischen Trio auf die Schliche kam und sich über die Unmenschen entsetzte.
Rätsel
Was versteht man eigentlich unter translationaler (also nicht: transnationaler) Medizin? Und was ist eine Xenotransplantation? Weder Martha Bauer noch Elisabeth Schneider konnten auf die Frage, die in einer beliebten Zeitschrift auftauchte, eine Antwort geben. Die Frau eines gewissen, von seiner Sportverletzung geheilten, jedoch nicht mehr in seinen Beruf zurückgekehrten Erwin (eines Westfalen), mit deren Herz es seit zwei Jahren eine besondere Bewandtnis hat, die wüßte wenigstens ein bißchen darüber zu sagen, was angesichts ihrer medizinisch hochheiklen Situation ja auch kaum überrascht.
Blicke
Peter, gerade Vater geworden und Ehemann von Elsas Floristin, besuchte aus alter Anhänglichkeit und neuem Familienbewußtsein seine Großmutter in der Chamissostraße. »Als ich so frisch war wie du, Peter, da las ich in der Zeitschrift Kristall ›Perlon, das deutsche Nylon. Zwei verschiedene Kunstfasern – und doch miteinander verwandt‹. Das geht mir seit heute früh im Kopf herum, und prompt kommst du und besuchst mich!« Hatte sie nicht Tränen in den Augen, als sie da so allein in ihrem Sessel saß? »Wie lange ist das nur her! Ich bin nun eine Greisin und ganz verschrumpelt.«
Der dumme junge Vater erschrak in seinem Glück. Da fiel ihm etwas ein, was er einer alten Frau sicher schnell zum Abschied sagen konnte: »Ich glaube, für die Augen deines lieben Gottes bist du genauso reizend und faltenlos wie unser Kind, dein kleiner Urenkel Peter-Klaus, ja, das glaube ich.«
Welches unverhoffte Wunder geschah daraufhin?
Das Gesicht der Großmutter glättete und verjüngte sich unter den hingesprochenen Worten gewaltig. Für einen Moment verschwanden alle Runzeln, ganz so wie einige Zeit nach dessen Geburt bei dem winzigen Säugling Peter-Klaus, dort natürlich für länger.
Wie staunte der Enkel da über seine Macht!
Merkwürdiges Auspacken
Eine junge Frau, Eva Wilkens, begann am 16. November, sobald sie im Zug von Frankfurt nach Berlin an einem Vierertisch Platz genommen hatte, langsam wie ein Zweizehenfaultier, aus einer großen Tasche eine Saftflasche hervorzuholen, eine Tafel Schokolade, ein Buch, zwei Äpfel, eine Packung Müsliriegel, eine Sonnenbrille, eine Piccoloflasche Sekt und so weiter, man mochte schon gar nicht mehr mitzählen. Die Augen aller Umsitzenden, die schweigend staunten, überwachten Evas Treiben. Geduldig und unbeschleunigt packte sie alles nacheinander aus und stellte es auf den Tisch, der ihr von den anderen drei Reisenden ohne Einspruch überlassen wurde. Steckte in der ICE-Handlung mit ihren Einzelheiten nicht eine schöne, wenn auch unklare Feierlichkeit? Als die Tasche leer und der Tisch, Stück für Stück, beladen war, verließ sie, kurz vor Hannover, Platz und Dinge, kehrte aber bald mit einem dicken Stoß des saugfähigen Papiers zurück, das auf den Klos der Züge als Handtuch angeboten wird. Damit wischte sie nun, geduldig und unbeschleunigt, Saftflasche, Tafel Schokolade, Buch, zwei Äpfel, die Packung Müsliriegel, Sonnenbrille, Piccoloflasche usw. ab und brachte alles wieder in der Tasche unter. Es spielte sich wortlos in tiefem Frieden ab und wurde, wie das Auspacken, von denen, die stumme Zeugen sein durften, in jeder Bewegung gebannt verfolgt.
Etwas täuschte nun allerdings dabei. In »tiefem Frieden« befand sich Eva keineswegs. Sie tat nur so vor sich selbst, wollte es sich nur unbedingt einbilden, denn sie hatte doch am Abend vorher ihre große Liebe wegen überführter Untreue zum Teufel gejagt.
Nebel
Bereits eine ganze Weile, bevor Nachrufe auf ihn in den großen Tageszeitungen stehen würden, spürte Pratz, der noch immer hin und wieder in aller Munde war, bei dichtem Novembernebel, daß sein Herz nicht wie in schlimmen Fällen gegen ihn anwütete, sondern, viel ernster, still schlagend ruhte. Sosehr er die Erinnerungstaschen ausleerte und umstülpte: Keine heiße Liebe, kein göttliches Klavierkonzert, kein markerschütternder Erfolg und keine ehemals aufwühlende Landschaft brachten es mehr zum Erbeben. Er wußte plötzlich, daß selbst dann, wenn jetzt alles vor ihm stände und sich ereignete, sein Herz ungerührt weitermachen und nicht einmal im Schrecken über diese Ungerührtheit zusammenbrechen würde. Still schlagend ruhte es.
Stillstehen würde es, was er noch nicht ahnt, erst später, vermutlich, wenn er neben einem schwarzen Mann auf einem Sofa säße.
Untrost und Glück
Der Sohn von Frau Fendel, der in München wohnt, statt bei ihr hier in der Irenenstraße, was doch ein erheblicher Trost für sie wäre, da er unverheiratet ist und bisher nur lockere Verhältnisse eingeht, verlor durch einen Autounfall seinen Zwillingsbruder. Dieser Verlust traf ihn schwer. Warum widerfährt gerade mir ein so schneidender Schmerz? fragte sich der Mann, der zum ersten Mal bis in den Grund seiner Existenz spürte, daß der Tod ein Klaffen, ein Kläffen, kurz, der meisterlich glatte Schnitt ist, der die Welt trennt von einer Zwillingswelt.
Was er nicht wissen konnte: Drei Häuser weiter erlebte ein anderer Mann, Herr Schwarz nämlich, einen ähnlichen Kummer, mindestens so groß wie der von Herrn Fendel, denn hier handelte es sich um den Tod der sehr geliebten Ehefrau. Diesem Mann jedoch zeigte sich in seinem Leid etwas ganz anderes. Noch während er schluchzend am Grab stand, erkannte er (als alle Trauernden zum Imbiß vorausgegangen waren, ihm aber, während die Friedhofsarbeiter hinter den Gebüschen schon lauerten, die letzten Minuten mit der teuren Verstorbenen gönnten) das Gewebe zwischen Lebenden und Toten, die stille Post, die durch alles Existierende und jemals Existente läuft, unter der Erde und über ihr. Nichts war erklärbar ohne das Wirken und Vibrieren der Gestorbenen, die als feinste Partikel alles durchdrangen in verwandelter, unleugbarer Anwesenheit. Es traf ihn wie ein Blitz, Dolch, Pistolenschuß, packte ihn als rasendes Glück. Warum widerfährt mir nur eine solche Freude, fragte er sich und schenkte der Bettlerin am Friedhofsausgang alles Bargeld, das sich in seiner Brieftasche befand, nämlich vierzig Euro.
Mein Gott, vierzig Euro, dachte er am nächsten Tag, schüttelte den Kopf über sich, lächelte aber, ohne sich die Tränen abzuwischen, vierzig Euro! Hätte ich doch mehr dabeigehabt!
Blick und Kick
Die Krankentherapeutin Elsa, aus dem renovierten Haus am Ende der kurzen Moritzstraße, verabschiedete sich an einem kühlen Novembermorgen von ihrem Freund, der sie wie immer rechts und links von der Nase küßte, um dabei seine eigene bequem für einen Moment in ihre Augenhöhlen zu betten. Als in der Nacht, nachdem sie beide vom Fenster aus eine Weile die aus ihrem Inneren leuchtende Litfaßsäule mit dem Unterwäschenmädchen angesehen hatten, wenig später in der Nachbarwohnung die Toilettenspülung losrauschte, war er nackt aus dem Bett gesprungen, hatte gerufen: »Ein Beischlafhindernis!«, um dann in der Küche allein für sich zu rauchen.
Der zurückgelassenen Elsa aber fiel das wieder jungfräulich gewordene Bett und Schlafzimmer ihrer Mutter ein, nachdem der Mann gestorben und die vier Kinder ausgezogen waren. Wie genügsam und klösterlich adrett es vor ihr stand, als wäre niemals etwas darin vorgefallen! Es rührte sie plötzlich sehr. Aber auch Henri rührte sie, als sie daran dachte, wie sehnlich er immer einen Triumph seiner Fußballmannschaft, Sankt Pauli war’s wohl, erhoffte. Monatelang hatte er auf dem Weg zum Stadion jedem zweiten Bettler ein Almosen spendiert, weil er dachte: Dann werden wir siegen! Seine Leute siegten indessen oft trotzdem nicht. Endlich entschloß er sich zur Bestrafung. Er gab nur jedem vierten Bettler Geld.
Sie blieb, nach dem morgendlichen Abschied, noch eine Weile am Fenster stehen und forschte einer Empfindung nach. Schon als Kind wäre sie am liebsten den Leuten, wenn sie abends von der Arbeit nach Hause gingen, heimlich in ihre Wohnungen gefolgt, um dort zu beobachten, wie sie die Einkaufstaschen abstellten, in den Kühlschrank sahen, sich ausgiebig irgendwo kratzten, das alles. In dieser Nacht jedoch hatte sie die Wesen, die in dem Mietshaus schliefen, nicht nur beim Bedienen der Toilettenspülung, sondern beim Atmen gehört. Sie erwiesen sich als klopfende Pulse eines gewaltigen Organismus. Beim allgemeinen Klingeln der Wecker waren sie jedoch in fremde, förmliche, einander sogar feindliche Einzelstücke zersprungen.
Da wanderte ihr Blick zum Körper auf der Litfaßsäule, der mit winzigen Dessous bekleidet war und zu den Vorübergehenden in einer Sprechblase sagte: »Geben Sie Ihrem Leben einen Kick!« Zum ersten Mal wurde ihr bewußt, daß sie sich längst nicht mehr mit den Gesichtern solcher Wundergestalten verglich, nur noch mit deren Schultern, und nun, am hellen Tag, sah sie: Auch das sollte sie in Zukunft besser unterlassen. Wie prunkten die Blutjungen in den Illustrierten mit ihren Entblößungen und präsentierten sich als Opfer, voller Lust in prächtige, ihr Fleisch vergewaltigende Kleider gezwungen!
Schon wandte sie sich ab, als sie ein unförmiges Mädchen bemerkte. Es stand unter dem überlebensgroßen Foto und blickte zu ihm hoch. Elsa sah es von der Seite. Etwa im gleichen Alter hatte sie in ihren Sommerferien Kinder armer Leute drei Wochen lang jeden Tag ins Grüne geführt. Ein Sozialprojekt der Stadt, bei dem sie Geld für zwei Wochen Jugendherberge an der Nordsee verdient und scharf hatte aufpassen müssen, daß sie sich nicht genierte vor denen, die mit den Eltern an südliche Meere flogen.
Das hoffnungslos aufgequollene Mädchen blickte hoch zu den vollkommenen Gliedmaßen, hielt offenbar die Luft an, las den Spruch, nichts weiter. Es brauchte viel Zeit dafür, sehr viel Zeit, und rührte sich nicht von der Stelle, auch Elsa rührte sich nicht.
Und was war das? Fing die Plakatfigur nicht an zu beben und sich zu krümmen unter so schrecklich viel Gefühl?
Diese Person und eine zweite
Diese Person, deren Bruder Alex als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz für 5,11 Euro Stundenlohn beschäftigt ist, soll zeitweilig als besonders freundliche Verkäuferin bei einer Süßwarenkette gearbeitet haben, zum Erstaunen der Kundinnen plötzlich verschwunden, dann aber seelenruhig in der gleichen Funktion in einem Bettengeschäft aufgetaucht sein, später in einem kleinen Reformhaus, auch hier als angebliche Fachkraft, dann in der Annahmestelle einer Änderungsschneiderei und Reinigung. Martha Bauer will sie zwischendurch im offenen weißen Kittel entdeckt haben, in einer schwarz-weiß gekachelten Apotheke, als sie für einen naschhaften alten Herrn die Vor- und Nachteile von Erkältungsdragees abwog. Das zweifeln manche an.
Glauben geschenkt wird dagegen dem Gerücht, man habe sie am 20. November des laufenden Jahres überraschend in einer katholischen Kirche gesichtet, wo sie mirnichts, dirnichts mit dem lustigsten Gesicht lauter Centmünzen Stück für Stück in den zur Opferung herumgereichten Korb geworfen und, als sie feststellte, daß ein sehr unrasierter Mann neben ihr bei der Kommunion sein Butterbrot auspackte und zu essen begann, den Rest des Kleinstgeldes in dessen Manteltasche gestopft habe.
Elsa, die am Vortag durch Alex von dieser Person gehört hatte, wurde in Amsterdam nach Besuch vieler sehenswerter Lokalitäten beim Betreten ihres Hotels, während des Aufziehens der schweren Eingangstür, von hinten räuberisch angegriffen. Ob der Dieb ihr den zierlichen Lederrucksack von den Schultern reißen oder nur von oben in die Öffnung greifen wollte, blieb ungeklärt. Sie konnte behelligt, aber ungeschoren in die Hotelhalle entwischen, verlor auch kein Wort darüber. Am nächsten Morgen, sie wußte nicht, was sie dazu bewog, bettelte sie ganz unerwartet und ohne den Trieb unterdrücken zu können, kaum, daß sie ihr Hotel verlassen hatte, einen Vorübergehenden um einen Euro an. Dabei streckte sie ihm ihre hohle Hand nach uralter Sitte als Opferbehältnis entgegen und hatte Glück.
Wenn, wenn, wenn
Da, wo die Rennerstraße in die Unterführung übergeht, steht rechterhand ein Klinkerhaus, dessen Hochstammrosen schon jetzt, wie jedes Jahr, vorschriftsmäßig in Winterfolie eingewickelt sind. Herr Fritzle, der dort wohnt, äußerte gegenüber seinem Freund Heinz beim allwöchentlichen Schachspielabend, wenn sie beide im Sommer nur besser aufgepaßt hätten, dann wäre es dem Trübsinn und der Düsternis dieser Tage nicht gelungen, die Oberhand zu gewinnen. Mit ein bißchen mehr Wachsamkeit sei die Entwicklung zu verhindern gewesen. Auch beim Älterwerden müsse man, um es zu stoppen, diesbezüglich die Augen offenhalten. Dann schmunzelte er und zündete sich eine Zigarette an.
»Im Gegenteil«, antwortete Heinz, als er ein bißchen gegrübelt hatte, »ich habe das Anwachsen der Dunkelheit und das Altern wie ein Schießhund belauert und es gerade dadurch heraufbeschworen. Matt!«
Rätsel
Der Schriftsteller Pratz stellt in wechselndem kleinen Kreis zu vorgerückter Stunde gern folgendes Rätsel: »Welcher Kanzler hatte eine Art zu grienen, als würde er den Erinnerungen an ein Sittlichkeitsdelikt nachschmecken?«
»Welcher Kritiker mit demselben Anfangsbuchstaben trug dauerhaft ein Gesicht zur Schau, bei dem man seiner Ausübung des Geschlechtsverkehrs als Rülpsen des Unterleibs beizuwohnen glaubte?«
»In welchem Beruf (wieder derselbe Anfangsbuchstabe) kann es vorkommen, daß man sich tagtäglich die Unmassen der vorbeigeschleusten Waren in einem Riesenbauch vermengt vorstellt samt den anschließenden Stoffwechselprozessen, zuhause aber Gedichte schreibt?«
Liebe Herta!
Frankfurt a. M. Durch beruflichen Zufall hat es sich ergeben, ob Du es glaubst oder nicht: Innerhalb von zehn Tagen habe ich hintereinander im Rahmen der sogenannten professionellen Klimapflege mit drei wirklich wohlhabenden Männern beruflich zu Mittag gegessen, einer reicher als der andere. Große Verwöhnung in Spitzenrestaurants! Maßanzüge! Manieren! Ich habe natürlich trotz der Rückenschmerzen optisch alles aus mir rausgeholt und mich gefragt, ob die Kellner wohl wußten, über wieviel Geld diese Männer regieren. Sie lassen es sich ja nach außen nicht ohne weiteres anmerken. Vielleicht kannst auch Du Dir nicht vorstellen, um welches Ausmaß von Vermögen in nationalem, ja europäischem Maßstab es hier geht.
Aber man selbst ist und bleibt doch eine bescheidene Maus. Einmal habe ich durch eine schnelle Bewegung und ganz ahnungslos ein Zaunkönigspärchen in einer befreundeten, ach was, Gartenbude von Freunden, in Panik versetzt. Was sind die Wichte verzweifelt um mich rumgeflattert und fanden den Ausweg nicht! Beim Mittagessen mit den Männern habe ich nichts Besonderes empfunden, eigentlich gar nichts. Angesichts der Zaunkönige aber viel. Das kommt von den kleinen Verhältnissen.
Deine Ruth
Offenes Fenster
Obwohl es abends schon recht kühl wird, hat Elsas Floristin, seit kurzem Mutter des Säuglings Peter-Klaus, gestern nacht noch eine Weile am offenen Fenster gestanden, es war ja Vollmond. Schrecklich gut gefielen ihr nämlich die verrückten Schatten der Buchenäste auf dem hellen Boden. Da kam plötzlich aus der Dunkelheit ein grauenhaftes Knirschen, ein Kreischen, ein mehrfacher eisiger Schrei. Niemand war in der Nähe, den sie fragen konnte. Vielleicht hat nur sie die Laute gehört? Für sich allein? Für sie bestimmt?
Und wenn das Geräusch nicht von Mensch oder Tier herrührte, sondern von Wesen, die noch keiner, die niemand bisher kennt?
Trost von unverhoffter Seite
Ein Mann, Erwin, schwarzhaarig, ein Westfale im Grunde, äußerlich ein südländischer Typ, den man leicht für einen Römer nehmen könnte, beschwerte sich periodisch bei seiner Frau, daß die Menschen immer unnatürlicher, mechanischer, dümmer würden, es nirgendwo aushielten ohne Laptop, iPod, iPad usw., sich nicht schämten wegen dieser lachhaften Abhängigkeit und auch bei Sport und Gartenarbeit mit Haut und Haar dem technischen Ausrüstungswesen verfallen seien. Daß dagegen die Roboter, die Maschinen in sausender Geschwindigkeit intelligenter, menschenähnlicher würden und ihm ihre, der Frau, warme Nähe in der Nacht der einzige Schutz gegen solcherlei usurpatorische Alpträume sei.
»Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön!« summte die Frau währenddessen leise, ganz leise vor sich hin. Sie selbst konnte nur mit einem Auge sehen. Es wurde nicht bemerkt, aber wenn sie zum Erdtrabanten hochblickte, zeigten sich ihr zwei verschwommene Scheiben. Außerdem hatte man ihr ein neues Herz eingesetzt vor zwei Jahren. Keine Krisen, alles wunderbar mit Hilfe der Medizin gemeistert. Seitdem freute sie sich jeden Tag ihres Lebens, zu jeder Jahreszeit. Das Blitzen der Regentropfen, das Schimmern der Silberbestecke, die neuen Mikrofaserstaubtücher, der Duft der Holunderblüten! Wie schön war der Novembernebel, wenn alles verschwand und gegen Mittag kurz und wie werweißwas auftauchte! Was sollte sie ihrem klagenden Ehemann Erwin, ursprünglich erfolgreicher Unternehmer im Sanitärbereich, bloß antworten?
An diesem Morgen, einem Freitag, wurde ihr bei der Zeitschriftenlektüre in Elsas Wartezimmer ein Trost in die Hände gespielt, den sie auf der Stelle als solchen erkannte. Sie wußte nicht weshalb, aber sie war sich seiner wenigstens temporären Wirkung sicher.
»Erwin«, sagte sie, hochzufrieden mit ihrem Fund. »Hör dir das an! Man hat erforscht, daß Krähen, die ja intelligent wie alle Rabenvögel sind, bisher unvermutete Fähigkeiten besitzen. Sie nehmen die genaue Physiognomie menschlicher Gesichter wahr, vor allem: Sie merken sie sich! Noch nach Jahren identifizieren sie mit den kleinen schwarzen Knopfaugen Freund und Feind. Unsere guten und bösen Handlungen gegen sie sind aufgeschrieben, abrufbar im kleinen Vogelhirn.«
Da der Mann keine Miene verzog, fügte sie hinzu: »Besiegelt ist unser Untergang also, Erwin, begreif das doch, keineswegs.«
Ob Erwin das tatsächlich freute?
Herbert Wind
Als die Koffer gepackt sind, macht Herbert Wind wegen der Vorfreude und zur Beruhigung das Fernsehen an. Düstere Wirtschaftsprognose für das kommende Jahr, Ehrung zum Gedächtnis der Kriegstoten. Schön und gut! Aber die schnellen Schritte der jungen Frau draußen, tack tack, diese akustische Wonne, sich nähernd, nah, sich entfernend, in diesem Augenblick, wer achtet darauf? Wir sind betrogen um die winzige Spanne der Gegenwart, sagt sich Herbert, doch, das sind wir. Immer wird vorausgeeilt oder zurückgeblickt.
Morgen geht’s los. Herbert Wind besitzt eine kleine Wohnung in den Bergen. Ob sie, die Wohnung, schon ein bißchen zittert in Erwartung von Herbert? Ob sie spürt, wie er ihr entgegenwächst und -rast, über Brücken, durch Tunnel? Wie der Zug sich unaufhaltsam auf dem letzten, kurvenreichen Abschnitt höherschraubt? Wind stellt sich vor, daß sie schließlich erregt auf seine Schritte horcht. Zum Spaß ruft er am frühen Morgen dort an. Die menschenleere Wohnung geht nicht ans Telefon, soll aber in Vorlust durch das Klingeln zum Beben gebracht werden.
Wenn er wieder zurück ins Flachland fährt, wird sie ihm lange, lange nachträumen, auch ein wenig nachtrauern, bis sie ihn aus den Augen und Herbert sich in der Mannheimer Ebene verliert.
Nimmersatt Pratz
Der ohnehin verdammt Hochgeehrte soll, als er schon unter der Last seiner Orden und Verdienstkreuze fast zusammenbrach, so will ein Gerücht, um auch nach seinem Tod für Publikum und Wissenschaft lebendig zu bleiben, »geheime« Briefe, indiskrete Tagebuchnotizen überall in seiner Wohnung und seinen Ferienniederlassungen, auch bei angeblichen »Geliebten«, versteckt haben, und zwar mit dem schriftlichen Befehl: »Erst 20 Jahre nach meinem Ableben veröffentlichen!«, »Erst in 50 Jahren für die Öffentlichkeit bestimmt«, »Erst in 108 Jahren zugänglich machen!« In seinen reiferen Lebensjahren hat er offenbar ausschließlich an der vorsorglichen Konstruktion einer posthumen Enthüllungsgeschichte, seine Biographie und sein Wirken betreffend, gearbeitet, immer hinter verschlossenen Türen. Selten die Ehefrau, öfter die »Geliebten« hörten ihn manchmal jovial lachen und »köstlich!« rufen, durch die Wände hindurch. Auch anwesende Katzen spitzten anfangs die Ohren, waren es aber noch schneller als die anderen leid.
Unverstand
Die Studentin Katja, die mal brünett, mal blond, auch schwarzhaarig in Erscheinung tritt und über einen patzigen kleinen Mund und hübsche, leicht ins Glubschige gehende Augen verfügt, erfreut die Welt mit einem meist freizügigen Dekolleté, das zu den Brustspitzen hin milchweiß wird. Einmal war sie sechs Wochen in Kenia in der Entwicklungshilfe tätig, vielleicht gegen Aids, man weiß es nicht genau. Diese Katja rühmte vor vierzehn Tagen ihre Mutter, die eine schöne Frau gewesen sei, schon jetzt aber, reichlich früh, immer krummer werde. Anstatt darüber zu weinen, habe die Mutter fröhlich gesagt: »Es ist mein Schicksal, einen Buckel zu kriegen. Man kann nichts dagegen machen. Also gut, dann: Bückelchen, ich werde dich tragen und ertragen!«
Das, so Katja, sei doch ein anderes Format als das jener Weiber, denen ständig die Botschaft ins harte Gesicht geschrieben stehe: Ich habe noch das Anrecht, mich auszutoben! Oder diese andere Sorte, von denen ihr neulich eine im Warenhaus bei der Anprobe eines BHs sehr zwiespältig lachend ruckzuck in den Büstenhalter gegriffen habe, eine ältere Verkäuferin, die meinte, sie müsse ihr, Katja, zeigen, wie man solche Dinger trägt und die Brüste in den Körbchen wirkungsvoll plaziert. Auch gebe es ja diese Alten, die nach allzu sparsamem Leben immerwährend die fatale Parole auf den Lippen hätten: In den paar Jahren bis zum Tod wird gepraßt, was das Zeug hält!
Tief enttäuscht äußerte sich Katja nun aber darüber, daß ihre Mutter, eine allein lebende Witwe, ihr den letzten Sonntag telefonisch etwa so geschildert habe: »Vom frühen Morgen an, gleich nach dem Aufwachen, habe ich auf eine Meldung aus der Außenwelt gewartet. Einmal ging das Telefon. Ich schaffte es nicht rechtzeitig bis dorthin. Den ganzen Resttag bereute ich meine Langsamkeit und überlegte: Wer könnte es gewesen sein? Bei wem kann ich riskieren, ihn anzurufen und nachzufragen, einfach, um eine menschliche Stimme zu hören? Immer ging es in meinem Kopf: Wer mochte das gewesen sein? Am Abend läutete wieder das Telefon. Diesmal war ich schnell. Und was stellte sich heraus, Katja? Simple Nummernverwechslung! Es meldete sich ein unbekannter Mann, und zwar der, den ich am Morgen verpaßt hatte. Selbst das war also nichts, ich meine, nichts für mich. Und doch war es ein Glück. Immerhin hatte ich durch den Irrtum über den langen, langen Sonntag hinweg eine Aufregung und was zum Zergrübeln, Kind.«
»Hätte sie sich nicht aber«, meinte die Studentin ärgerlich, »über das Versehen amüsieren müssen, statt so sehr mit der Stimme zu zittern? Was jammert sie plötzlich? Spürt sie denn nicht, wie auch die stumme Luft voll geheimer Botschaften ist, auch voll sexueller Absprachen, und das nicht nur auf elektronischem Weg?«
Man muß ihr ein bißchen zugute halten, daß für Katja eine Liedzeile wie diese: »… bis an das kühle Grab« noch nichts weiter als die Vorstellung eines Erfrischungsgetränks an einem heißen Sommertag weckt. Auch steht ihrer Jugend die Überraschung, daß das ehern Unerbittliche des Todes ausgerechnet dasjenige irreal macht, was sie bis jetzt unbezweifelt für die Wirklichkeit hält, erst bevor.
Wien
»Im Mai«, erinnert sich Clemens Dillburg, der ein demütiger Mensch und Priester ist, »bin ich von Potsdam aus, wo es überall, besonders aber um die russische Kirche herum nach Akazien duftete, über Prag, das unter einer Wolke von Fliedergerüchen lag, nach Wien gefahren, um dort endlich und zum ersten Mal meinen Bruder zu besuchen, der mich durch den dort ansässigen, ich meine, hochberühmten Stephansdom führen sollte.
Wie, fragte ich mich unterwegs neugierig, so nebenbei, würde es wohl in Wien riechen?
Welche Überraschung: nach Moschus! Jedenfalls in der Wohnung meines Bruders, auch in den Straßen, denn ich spazierte ja immer neben ihm. Außerdem stellte sich heraus, daß ich den Dom viel besser kannte als er, obwohl ich nur in Büchern darüber gelesen hatte. Er war wohl noch niemals darin gewesen. Warum auch! Wien besitzt viele Kirchen. Allerdings lag der Fall bei ihm speziell. Er galt als Profi, als King in Wiener Zuhälterkreisen. Das entging mir bereits nach wenigen Tagen nicht. Als junger Mann, nachdem er ein frommes Kind gewesen war, ist er als Feuerschlucker aufgetreten. Damit war Schluß, als ihm einmal in einer fränkischen Stadt ein Jugendlicher fortlaufend die Fackeln mit Bierspritzern gelöscht hat. Es kam zu einer Rangelei, bei der mein Bruder schließlich dem anderen feuerspuckend das Gesicht verbrannte. »Ich selbst aber«, so der treue Priester, »frage und erforsche mich: Wieso, um Himmels willen, habe ich den Moschusgeruch, den seine Damen an ihm hinterlassen hatten, so sicher erkannt?«
Eine Weile später sagt er sich: »Weihrauch und Moschus! Das ist wieder so ein Fall. Vielleicht kommt es in unserem irdischen Leben vor allem darauf an, ob wir in den Erscheinungen eine Vorform, einen, und sei er noch so erbärmlich, Abglanz des Göttlichen erkennen oder ob wir in dem, was wir das Göttliche nennen, nur eine Sonderform unserer vulgären Triebe, Halluzinationen, Machenschaften sehen.«
Und noch etwas später fällt ihm wieder das Drehen der Windräder ein, das er vom Zug aus gesehen hat. In trägem Refrain wiesen die Flügel abwechselnd steil in die Unendlichkeit. Den Anfang der Erinnerungen hat er Frau Fendel erzählt, den Rest, ab Wien, nur teilweise.
Des Rätsels Lösung
Die Gesellschaft macht denjenigen, die ihren Hunden, Katzen, Pferden, die Tieren überhaupt sehr zugeneigt sind, sie mit großer Aufmerksamkeit in ihren Gemütsregungen beobachten und voll Hingabe zu beschützen suchen, schwere, auch höhnische Vorwürfe, als wären jene Zeitgenossen zwangsläufig durch ihre Tierliebe entartet und Menschenfeinde.
Dabei, durchfuhr es heute Herrn Brück anläßlich eines Besuchs in Berlin, ist es doch so, daß in den Tieren im Vergleich zu den Menschen das allgemeine Entwicklungsschicksal gestoppt wurde. Mitten im Zeitstrom hielt die Evolution sie damals an. Sie sind erstarrt – auch wenn sie rennen, auch wenn sie leiden – zu paradiesischen, in sich kreisenden Geheimnissen, als entkämen sie, ausgerechnet sie, der biologischen Tragik und der philosophischen Spekulation, jawohl!
Und trotzig führte Herr Brück seinen halblahmen und fast blinden Hund Rex Brück in den Zoo. Sie kehrten erst zurück, als die kompletten Passanten mit Tüten, Aktenkoffern und Sorgen auf den Straßen im Moorbraun des Abends versanken.
Ein ganzer Tag
Die Frau, die im gelben Eckhaus Schubertstraße/Beethovenstraße wohnt, eine Fotografin im 3. Stock, erinnerte sich, am Fenster stehend, noch vor dem Frühstück, mit den nackten Platanen vor Augen, an ihre verstorbenen Eltern, die sich so oft gestritten hatten. Wenigstens einmal in ihrer Ehe aber waren sie nach beider Auskunft glücklich gewesen, so richtig selig. Das passierte an jenem unvergleichlichen Abend in Berchtesgaden, als sie hoch über dem Tal zu kühlem Weißwein frische Forellen gegessen hatten. Noch jetzt freute sich die Tochter, mit Blick auf die Bäume, von Herzen daran. Wie es den Eltern geschmeckt hatte!
Während des Frühstücks allerdings las sie, daß einer der Chefplaner von Al-Qaida im Gefängnis von Guantanamo im März 2003 180mal durch simuliertes Ertränken gefoltert worden sein soll. Sechsmal am Tag Todesangst? Handelte es sich um einen Druckfehler? Und wer würde jene monströse Frau, die damalige Außenministerin C. Rice strafen, die in ihren pastellfarbenen Schneiderkostümen mit ungetümem Gebiß grimassierend, stets als Dame behandelt, schwere und schwerste Folter befürwortet hatte?
Am Abend aber spürte die Frau wieder, tief am Grund ihrer Empfindungen, daß es jemanden gab und daß er sie, die Fotografin, ins Herz geschlossen hatte. Er kratzte an ihr, er schnitt ihr erbarmungslos in Fleisch und Seele, und doch schien der vorläufig Unsichtbare sie insgeheim zu lieben, trotz seiner grausamen Streiche. Dabei wollte sie es fürs erste belassen. Ein schönes Gefühl, allerdings verging es dann wieder.
Diese Fotografin, die wie viele auf Elsas Künste schwört, heißt Roeland, Frau Roeland, genannt Babs.
Der Haken
Ich könnte, sagte sich der noch wenig erfolgreiche Komponist Hannes (eigentlich Hans) Keller am 20. November, als er die typischen Naßrasurgrimassen schnitt, viele sehr verschiedene Formen annehmen, beziehungsweise diverse Leben führen und Charaktere glaubwürdig darstellen. Jawohl, sehr viel Unterschiedliches an Tugend und Laster fühle ich in mir als Möglichkeit. Ich könnte, könnte sehr wohl, wenn ich nur wollte.
Früher hat er woanders gewohnt, mit einem in der dortigen Moritzstraße gut therapierten Rückenleiden. Hieß der rettende Engel von damals nicht Elsa? Haha, die bildschöne Elsa mit den roten Haaren! Man hatte unter ihren Händen gar kein Interesse, gesund zu werden.
»Tugend, vor allem Laster: Ich könnte, wenn ich wollte, Elsa, herrliches Weib, kein Problem. Nur habe ich, das ist der Haken, dafür keine Zeit, keine Zeit, selbst für dich nicht. Keine Ausnahme! Unerbittlich ruft die Musik.«
So macht er sich Mut.
Das Geheimnis der Jagdhütte
Herbert Wind lernte, so erzählte er es Elsa nach deren Arbeitsschluß, bei einem novemberlichen Aufenthalt in Graubünden einmal einen Mann kennen, der ihn, wenige Tage bevor man mit den ersten kräftigen Schneefällen rechnen mußte, in seine Jagdhütte hoch oben in der Bergwildnis einlud. Nach beschwerlicher, streckenweise gefährlicher Wanderung fand der nicht schwindelfreie Herbert tatsächlich die von dem Jäger gut beschriebene Hütte. Er wurde dort bereits von dem Mann und, zu seiner Überraschung, von zwei weiteren Gästen erwartet. Alle vier Männer konnten mit einer bescheidenen Schlafstelle rechnen und richteten sich gutgelaunt ein auf einen gemütlichen Abend mit Hirschgulasch, Wein und Kaminfeuer, umgeben von Abgründen und Einöde.
Pfeife, Zigarren, auch Zigaretten kamen nach dem Essen zum Einsatz. So plaudernd und tapfer rauchend in der felsigen Einsamkeit dazusitzen, empfanden sie als Streich gegen die Ehefrauen und den Rest der Welt. Ob sie in dieser Umgebung nicht Interesse hätten, etwas Volkstümliches, auch Volkskundliches, nämlich einige Sagen aus der Region zu hören, fragte der Jäger unmittelbar nach beendeter Mahlzeit. Kaum nickten die Gäste, begann er schon. Wobei er seltsamerweise, wie es schien, etwas nervös auf seine Armbanduhr sah, sie vom Handgelenk nahm und ohne Erklärung vor sich hinlegte.
»Mann und Frau«, begann er.
»In Litzirüti, nicht weit von Arosa, etwas unterhalb nur, lebten in einem Haus mit steiler Katzentreppe ein Mann und eine Frau. Von ihr sagten die Leute, während der hübsche Mund der Frau ganz arglos lachte, hinter ihrem Rücken immer öfter, sie könne wohl ein Gewisses mehr als bloß spinnen. Das betrübte den Mann und ängstigte ihn. Aus einem solchen Gerücht mochte leicht Schlimmes erwachsen! Er bemühte sich, den Verdacht der Dorfbewohner wenigstens vor der Frau zu verheimlichen. Denn was sonst sollte der Furchtsame tun?
Das Haus wird jetzt zum Verkauf angeboten.
Genauso ging es in einem anderen Fall in der Nähe von Peist zu, plessurabwärts, etwas näher dem alten Bischofssitz Chur. Nur war es dort so, daß der Mann, wenn er seine Frau besonders liebte, seine Zungenspitze in ihr linkes Ohr zu dem schwarzen Muttermal dort steckte und wenig später zufrieden flüsterte: ›Hexe!‹«
Hier holte der Jäger einen Stift hervor und ein Papier, auf das er einen Strich machte. Dann fuhr er ohne Pause fort:
»Die kleinen Gäste
Ein Mann aus dem Ruhrgebiet in Deutschland, wo es früher die kohlschwarzen Bergleute mit ihren Grubenlampen und ihrer Silikose gab, saß im Wartestübchen einer Bahnstation im Schanfigg. Saß dort am runden Tisch und sah auf die braunen Fußbodenkacheln und die Spitzendecke auf dem runden Tisch, trank einen Kaffee, den ihm die Kioskwirtin gebracht hatte und lachte mit ihr über einen etwas schütteren Clown namens Gottschalk im Fernsehen. Da ging die Tür auf, und herein kam ein schon recht gebrechliches, aber wohl noch immer treu verliebtes Pärchen, das wie in besonders teuren Erinnerungen vor sich hinlächelte. Die Wirtin berechnete ihnen den Wein, den sie munter tranken, nicht. Erst als die beiden gegangen waren, sagte sie vergnügt zu dem Deutschen: ›Das waren die Pestleutchen. Früher richteten sie großes Unheil in der Gegend an. Heute sind sie harmlos. Sie haben ihr Pulver verschossen.‹
Der Mann aus dem Ruhrgebiet aber fuhr mit einem plötzlich aufgetretenen, widerlichen Ekzem an geheimer Körperstelle nach Hause und ist es bis heute nicht losgeworden!«
Der Jäger machte nun wieder einen Strich auf den Zettel, nahm einen Schluck Wein, sah auf seine Uhr und fuhr fort:
»Frau Eggli
Die Frau Eggli, eine Frau, die die Gabe besaß, alle zu trösten, Frau Berta Eggli, deren beide Söhne in der Hauptstadt studiert und geheiratet hatten, diese Frau Eggli, die sich seit jeher weder vor den Tobelgeistern noch vor dem Totenvölkchen ängstigte und genau wußte, wo man das schwarze Kohlröschen, das Wintergrün und den schwarzroten Sitter findet, stieg, als ihr Mann zur Jagd auf Murmeltiere, Gemsen und Hirsche war, bis auf eine Höhe von 2004 Metern zu einer steinernen Schutzhütte auf, ganz allein. 2004 hieß auch das Jahr des Geschehens. Da kam ein Nebel, der alles auslöschte und schluckte. Es war die Stelle, wo sich einst der Hotelier Haldimann mitten im Juli im Schneesturm verirrte und auf allen vieren nach Hause kriechen mußte.
Sie kannte sich gut aus, aber nun war ja nichts mehr zum Erkennen da. Kein Wahrzeichen, überhaupt kein festes Ding. Frau Eggli sagte sich, obschon alle Gegenstände im Grau verschwunden waren, kalten Blutes: ›Das ist nicht für immer! Steh still und warte nur, es wird alles wieder auftauchen!‹ Und tatsächlich, Berta stand still, wartete, der Nebel wich, würgte nicht länger, und sie setzte kühn den Weg noch um 300 Höhenmeter fort, mitten hinein in die Verlassenheit von Geröll und Schutt. Das geschah im September.
Im November aber zerfiel ihr beim Wenden die Apfeltarte, die sie für ihre beiden großstädtischen Schwiegertöchter gebacken hatte. Das war Berta Eggli noch nie passiert. Bekümmert stand sie vor der Bescherung, und auch beim Kaffeetrinken angesichts des in letzter Minute noch glücklich reparierten Kuchens dachte sie insgeheim an nichts anderes als an ihr Mißgeschick.«
»Ja, ja, so sind die Frauen«, riefen die Zuhörer. Der Jäger schenkte nach, machte den Strich und fuhr fort:
»Der Berg
Ein ehemals frommer Mann aus Bergün, etwas oberhalb wohnhaft, der wie viele seinen Glauben an Gott verloren hatte, da er sich ihm nirgendwo zeigte, freute sich jeden Morgen an einem Berg, Piz Ela, der dicht vor dem Fenster seines Schlafzimmers auf ihn wartete. Leuchtend in Schnee und Eis, in dröhnendem Schweigen nach Sonnenuntergang, schwebend beim Morgengrauen unter dem verbleichenden Vollmond stand er da in Macht und Zartheit, dicht vor seinen Augen, immer derselbe und zu jeder Stunde wechselnd. Da sagte er sich, und es war an einem Donnerstag: Warum sollte ich nicht in ihm einfach Gott sehen, Gott wie das Wort ›Gott‹, als Bild, abgekürzt?
Aber es funktionierte dann doch nicht.«
Dem Jäger war die Pfeife ausgegangen. Er entzündete sie neu, machte seinen Strich, vergaß nicht den Blick auf die Uhr und setzte seine Erzählungen lächelnd fort:
»Die Tochter des Gesanges
In Tschiertschen, wo erst vor einigen Jahren die Straße nach Chur den Hang runterrutschte und zwei junge Burschen in ihrem Auto getötet hat, lebte vor langer Zeit, allein und für sich, eine schöne Frau, die den Leuten aber letzten Endes nicht geheuer war. Die Männer freuten sich, wenn sie durchs Dorf ging, und ereiferten sich, weil sie keinen von ihnen für ein Stündchen erhören wollte. Sie zu heiraten hätte sich niemand zugetraut. ›Die kann mehr als recht‹, flüsterten die Frauen, und: ›Die bringt uns Unglück!‹
Schließlich sagten sie es lauter und lauter, und am Ende wußten alle sicher, um was es sich hier handelte. Sie versammelten sich im Gemeindesaal, beschlossen Schreckliches und stürmten los zu der Frau, die, kein Wunder, meergrüne Augen und Sommersprossen hatte. Schon sahen sie das Zucken und Flackern und Flammen vor sich als etwas Köstliches und Süßes.
Man weiß nicht, um was es sich handelte, aber irgend etwas zwang sie, als sie vor dem Haus der Frau anlangten, leise zu sein, sich anzuschleichen für ihre Mordtat, nach der sie verlangten, Männer wie Frauen. Vielleicht verführte sie der sanfte Schein aus den Fenstern des Häuschens?
Erstaunlicherweise war die Haustür nicht verschlossen, nur angelehnt, als würden sie erwartet. Aus dem Inneren aber drang eine alte Musik, so herrlich, wie sie noch nie von ihnen gehört worden war, vielleicht aus dem Radio? Sie rührten sich nicht, sie drängten sich heran und lauschten den himmlischen Klängen. Da begriffen sie, daß kein Teufelsliebchen eine solche Schönheit ertragen würde. Wie gut war die Welt doch in Wirklichkeit! Einer von ihnen, der einige Semester in der Hauptstadt studiert hatte, sagte: ›Es ist die Cäcilienode, ich täusche mich nicht, die Cäcilienode, ganz gewiß!‹ Sie standen still und horchten. Dann gingen sie, ohne weitere Verständigung, nach Hause, jeder für sich, wo er hinmußte.
Am nächsten Tag zeigte sich, daß die Frau aus der Gegend verschwunden war. Sie kehrte nie wieder zurück. Die Leute von Tschiertschen aber dankten ihrem Gott, daß er sie davor bewahrt hatte, ein großes Verbrechen zu begehen.«
Wieder machte der Jäger seinen Strich und warf einen Blick auf die Uhr:
»Der gute Geist
Im Dorf Arosa hatte sich ein Mensch niedergelassen, über den sich schnell das Gerücht verbreitete, er wolle der Gegend Gutes tun, weil er sie wegen ihres Liebreizes (besonders dort, wo die Plessur durch den Müliboda fließt und wo, auf den Schwelli-See zu, die Kühe einander, wie er meinte, mit ihren Hälsen und Schwänzen so gutmütig wie anmutig umschmeicheln) sehr ins Herz geschlossen hatte. Auch hieß es, daß er über geheimnisvolle Mächte und Geldquellen verfüge. Im Gemeinderat rieb man sich die Hände, die Taxifahrer, die Skilehrer, die Hoteliers, die Busfahrer und die Burschen, die mit den schweren Pistenfahrzeugen im Winter umgehen, selbst die, die das Eis von den Straßen loshacken, sie alle erhofften sich ungeahnte Wohltaten. Der Mensch schritt auch bald zur Tat, und was er anpackte, war vielversprechend. Wie würde es zügig mit allem aufwärtsgehen!
Da erzählte ein dösiger Waldarbeiter eines Tages dem guten Geist, daß man den Bahnhof ursprünglich im Müliboda habe anlegen wollen. Wieso es dann nicht dazu gekommen sei, wisse er nicht, aber es sei einmütig beschlossene Sache gewesen. ›Einen Bahnhof mit Gebäuden, Lagerhallen, Schuppen und Zufahrtswegen, hier, in diesem kleinen Tal? Das haben die Einwohner geplant und gebilligt?‹ soll der Mensch erbleichend zurückgefragt und sich sofort bei amtlichen Stellen erkundigt haben. Das schon, wurde ihm diensteifrig mitgeteilt, aber es sei nun mal aus irgendwelchen Gründen nicht dazu gekommen, wie er sehe.
Man weiß nun nicht mit Sicherheit, was den Menschen bewogen hat, sofort abzureisen auf Nimmerwiedersehen. Kluge können es sich denken.«
Der Jäger machte den sechsten Strich und fragte seine Gäste noch immer nicht, ob sie eine Fortsetzung wünschten. Er redete einfach weiter:
»Esch bisch unkel
Ein Mann aus Molinis hatte ein Geheimnis. Er verriet es keinem. Da setzte man ihm Wein vor und lockte ihn, es auszuplaudern. Endlich, als er viel Gutes, ja Bestes getrunken hatte, sagte er: ›Esch bisch unkel, gront nit jet bissu.‹ Da war die Not groß, denn keiner verstand die Sprache.«
Der Jäger machte den siebten Strich und sah auf die Uhr:
»Hans Flasch
Damals ging Hans Flasch um. Man sah ihn bei schönem Winterwetter mal hier, mal da auf den Spitzen und Graten. Mit Riesenschritten turnte er in der Gegend herum, benutzte an einem einzigen Tag mehrfach Bergbahn, Zug, Skier, um sich damit gipfelauf und -abwärts zu schwingen. Manche sagen, er tat es aus eigener Kraft. Manche haben das Sausen seiner Bretter gehört, plötzlich kurz hinter ihnen in der vollkommenen Stille. Daß er irgendwo Schaden angerichtet hätte, ist nicht bekannt. Im Gegenteil, er soll hin und wieder zum Schutz der Heimat gewirkt haben, was aber nicht allen paßte, nicht denen, die aus der Fremde kamen, hier viel Geld verdienen wollten und wieder verschwanden. Wie eine Schwalbe mit aufgerissenem Schnabel die Insekten in den Schlund saugt, so hat Hans Flasch gierig den Raum verschlungen, durch Schluchten und Tobel fegend wie das Nachtvolk.
Auswärtigen ist er häufig als regulärer Skilehrer begegnet, anderen im dämonisch wandernden Licht auf den weißen Kuppeln in der Höhe. Er trat, falls leidlich hübsche Frauen bei den Fremden waren, zu ihnen, schnallte seine Felle ab, rollte sie sorgsam auf, zog seine Jacken aus bis auf ein weißes Hemdchen über golden glänzendem Oberkörper, den er kostenlos zur Schau stellte. Geschmückt war er mit Sternchen im Ohr und bestickter Mütze. ›Keine langen Pausen machen, wenig essen, ein bißchen Schokolade dann und wann‹, rief er den unkundigen Wanderern zu. Wie gemächlich war sein Rauf- und Runterziehen der glitzernden Reißverschlüsse! Dazwischen biß er in ein Butterbrot. Manche, die ihn so erlebten, behaupteten, er habe ihnen sehr eigentümliche Angebote gemacht. Andere sichteten ihn nur von weitem, nur von hinten. Wieder andere sehen ihn bis auf den heutigen Tag.
Frauen bringt er auf geheimnisvolle Weise Glück. Wenn deren Männer nur wüßten, wie! Die Frauen aber, die verraten es nicht und vergessen es nie. So leibt und lebt, falls nicht gestorben, noch heute: Hans Flasch.«
Der Jäger prüfte das Feuer, schenkte den Gästen nach, arbeitete an seiner Pfeife und begann die nächste Sage, nachdem er gewissenhaft einen Strich gemacht hatte:
»Der Hotelier
Der Hotelier Haldimann aus Davos, das war nun ein besonders furchtloser, saftiger Mann. Wenn den einer warnte: ›Achtung, nimm bloß nicht diese Richtung, da kommt einer einem in den Weg‹, da lachte er nur und ließ sich nicht beirren, nicht Haldimann, nicht er, da kannte man ihn schlecht! Stolz war er auf seine vielen Konkurrenten und Feinde und bot ihnen eine starke, gut gepanzerte Brust, an deren Prunken ihre Pfeile abprallten.
Einmal aber ging, gerade an seinem Geburtstag, die Tür auf. Herein kamen seine Gegner, diesmal allerdings, ach, wie schmerzlich, mit sanften Mienen. Als er in ihre Gesichter hineinblickte, die jetzt so ganz ohne Angriffslust und Neid waren, erschrak der kernige, gerissene Mann wie noch nie im Leben. Er forschte in ihnen, nein, kein Fünkchen Mißgunst stöberte er auf und hätte es so gern getan! In diesem Augenblick wußte er, daß er sterben mußte, ja schon im Sterben lag. Anders konnte es nicht sein, er erkannte die Zeichen.
So ging es in Erfüllung und kam so.«
Der Jäger machte den neunten Strich, sah, den Kopf hin- und herwiegend, auf die Uhr und rüstete sich sogleich, ohne Blick und Rücksicht auf seine Zuhörer, für seine nächste Geschichte:
»Von der törichten Lebensmittelhändlerin
Eine Frau, die in der Nähe von Klosters einen kleinen Lebensmittelladen unterhielt, eine empfindliche Person, die oftmals ihrem dann tröstlich brummelnden Mann gegenüber klagte, daß man gegen all die Butter und Käse kaufenden Menschen wie gegen Wände rede, unternahm an einem Morgen kurz vor Weihnachten eine Wanderung in den Schnee. Das Licht des späten Mondes und der halb verhüllten Sonne gespensterte über die Flanken, die Landschaft wurde ihr, als sie so allein ausschritt, als wunderbarer Frostpalast gezeigt. Geisterhaft zart, wie nur bei großer Eisigkeit, warf man ihr einzelne Schneeflocken, nein, Diamantstaub, einen glitzernden Funkenflug, entgegen. Immer ging es hin und her, das Licht schweifte, wehte und schwankte über die Bergkuppen, sie sah den Himmel dicht aufliegen in wildem Blau, sah ihn schwinden und sich wölben. Die dreimal verzauberten Eistücher traten in Falten aus den Felsen und hingen starr herab.
Sie aber dachte plötzlich an die Spiegeleier, die sie sich zuhause braten würde, dachte immer inständiger daran.
Es wurde ihr nicht angekreidet.
Auf einmal entdeckte sie an ihrem Zeigefinger einen gespaltenen Nagel. Nun konnte sie sich mit nichts anderem mehr beschäftigen.
Auch das wurde ihr verziehen.
Als sie aber zuhause ihrem Ehemann erzählte, einen herrlichen Kitsch habe sie da draußen erlebt, da wurde ihr das nicht vergeben. Nie wieder im Leben offenbarte sich ihr die Schönheit dieses einen, gekränkten Morgens. Sosehr sie auch, wenn sie eine Woche, ein Jahr mit Butter und Käse hinter sich gebracht hatte, danach Ausschau hielt: Es war umsonst.«
Der Jäger blinzelte, stocherte im Feuer, reichte die Flasche mit Hochprozentigem herum und fuhr fort, nachdem er den zehnten Strich gemacht und auf seine Uhr gesehen hatte:
»Die Puppe auf der Alp
Eine Frau in Maladers wurde alt. Sie hatte immer gedacht, zwischen den Dingen würden leere Zwischenräume sein, und hatte darauf vertraut und gebaut. Jetzt spürte sie, wie alles in Wahrheit angefüllt war mit Botschaften, verbunden durch Wellen, Schwingung, Strömungen. Es verwirrte ihr den Kopf. Mann und Kindern sagte sie besser nichts davon.
Gab es einen Schaden an den Hausmauern, an der Dachrinne, fühlte sie es neuerdings als Schmerz in den Zähnen, in den Haarspitzen, im Herzen. Am schlimmsten suchte sie aber ein anderes Gefühl heim, nämlich das: der Küchenstuhl, auf dem sie eben noch gesessen hatte, wäre, sobald sie draußen stand, nicht mehr vorhanden, und der Mensch, der ihr eben noch beim Holzhacken geholfen hatte, wäre, sobald er außer Sicht geriet, nicht mehr lebendig, es vielleicht auch nie gewesen. Andererseits empfand sie das Tote mächtig in seiner Wirklichkeit. An all dem erkannte sie: Es ist soweit. Ich werde alt.
Früher galt sie als eine sogenannte Interessante. Sie war eines Tages aufgetaucht und hatte den Männern den Sinn verdreht. Nur gut, daß jemand sie schnell heiratete und pünktlich die Kinder kamen, jedes Jahr gebar sie dem Mann eins, ohne Widerspruch, insgesamt siebenmal. Dafür quälte er sie nicht mit Fragen und beschützte sie gut.
Was hätte sie ihm auch über ihre Herkunft erzählen sollen? Sie erinnerte sich nicht mehr daran. Ihr erschien die Vergangenheit wie ausgelöscht. Ganz dunkel dämmerte ihr: Es war auch besser so!
Eines Tages, als sie über ihr Altwerden und die Merkmale grübelte, über das Rascheln und Knistern, über das Knacken und eigentümliche Verholzen in ihrem Körper und das Rucken in den Gelenken, hörte sie in der Kirche, als der Priester auf sich warten ließ, wie eine noch viel ältere Frau als sie selbst, vielleicht nur zum Zeitvertreib, flüsternd behauptete, oben auf der Alp habe im Sommer einmal ein Senner gehaust, dort mit seinen zwei Gehilfen aus Langeweile Stroh in einen Sack gefüllt und aus dem Balg eine Puppe geformt. Dieser Puppe schmierten sie Milch ums Maul und nahmen sie mit in ihr Bett, weil sie keine Frau da oben hatten. Als der Senn schließlich in seinem Übermut auf die Idee kam, das Geschöpf zu taufen und also Wasser über sie goß und dazu die heiligen Worte sprach, riß die Puppe die Augen auf! Sie befahl den Gehilfen, sogleich mit den Tieren die Alp zu verlassen und sich erst unten umzudrehen. Sie gehorchten schreckensbleich. Erst unten wandten sie sich um, wisperte die Greisin und schielte geduckt nach allen Seiten: Da hätten sie gesehen, wie die Puppe die blutige Haut des Senners auf dem Hüttendach zum Trocknen aufspannte.
Die Frau erkannte voller Entsetzen ihr altes Verbrechen. Sie sah ihm ins Auge. Niemand wußte etwas davon, kein Mensch würde sich rächen an ihr, aber ihr war nun die furchtbare Untat aufgeladen. Wie sollte sie sich davon befreien? Keine Sorge! Sie wurde erlöst. Wegen ihres geduldigen Lebens als Ehefrau wurde sie gerettet. Überall in ihrem Leib spürte sie die Verwandlung, nun noch viel stärker als in den letzten Monaten und Wochen.
Es ging schnell, jetzt, als sie wußte, worauf es hinauslaufen würde. Sie verkroch sich in einer Ecke der Scheune. Das Fleisch schwand ihr unter der runzligen Haut und von den Knochen. Die Knochen wurden dürr und splitterten. Als der Mann hinzukam, schlitzte er ahnungslos den dort liegenden, zerschlissenen Sack auf und verstreute das Stroh im Stall. Obwohl er und Männer des Dorfes überall nach der Frau suchten, fanden sie keine Spur von ihr, nur viel später in der Scheune den Ring.«
Der Jäger zog den elften Strich, setzte sich gerade hin, nahm nun die Uhr in die Hand und wandte keinen Blick von ihr, auch klang seine Stimme erregter als zuvor:
»Das Geheimnis der Jagdhütte
Ein Mann aus Graubünden, ein Arzt und Jäger, beobachtete, wie das ehemalige Haus seiner Familie aus dem 17. Jahrhundert, das älteste Wohnhaus des Ortes und Zeugnis seiner bäuerlich-armen Vergangenheit, in dem schon lange keiner mehr wohnte, immer mehr verfiel und jetzt sogar abgerissen werden sollte, weil der neue Eigentümer den Grund bebauen wollte. Nun war der große Wunsch dieses Mannes, das Haus zu retten, indem er es auf das eigene Land versetzte. Aber wie sollte das geschehen? Alle Fachleute meinten, die alte Wohnstatt, nicht viel mehr als eine brüchige Bauernholzhütte, sei, historisch wertvoll oder nicht, unmöglich zu restaurieren. Sie würde den Transport nicht überstehen und nie wieder bewohnbar sein.
Da ging eines Tages ein Wesen neben dem betrübten Mann und sagte, er solle sich nur trauen, ihm würde Hilfe zuteil. Nur dürfe er niemals, bei keiner der zu erwartenden Schwierigkeiten den Satz ›Das geht nicht‹ sagen.
Erfreut stimmte der Mann zu. Das Wesen nahm die Gestalt eines Architekten an. Jeder Balken wurde numeriert, ein Keller wurde an der neuen Stelle ausgehoben, das mußte sein, man besserte aus, reparierte, ergänzte, vergaß auch eine neuzeitliche Wärmedämmung nicht, und das Werk wurde vollendet, ohne daß jener verbotene Satz gefallen war.
Der Mann zog mit seiner Frau und den zwei Söhnen ein. Das Glück war groß.
Nun hatte der Mann aber eine große Leidenschaft für das Jagen, und wenn er davon sprach, wurden seine Augen wild. Hoch oben in den Bergen besaß er unter einem Felsvorsprung eine winzige Baracke, eine etwas größere Holzkiste nur, die ihm eines Tages ein Sturm völlig zerstörte. Das bekümmerte ihn, denn oft hatte er dort oben die Nächte zugebracht und konnte dann mit stolzer Jagdbeute zurückkehren. Als er so in Gedanken ging, befand sich plötzlich wieder das Wesen neben ihm und sagte, es habe ihm bei seinem Haus geholfen, weil er sich als guter Sohn der Gegend und ihrer Geschichte erwiesen habe. Hier nun liege der Fall etwas anders. Er wolle ihm auch bei seinem privaten Vergnügen helfen, aber die Bedingung sei härter. Der Jäger hörte sich alles an, erwog es und schlug dann ein. Und wahrhaftig: In kurzer Zeit stand eine stabile, an den Balken schön geschnitzte Jagdhütte an noch günstigerer Stelle als die alte!«
Der Jäger packte, so kam es den Gästen vor, in diesem Moment seine Uhr fester und richtete den Blick unverwandt auf die Zeiger: »Die Bedingung aber ist folgende: Immer wenn ich einen Gast bewirte und beherberge, müssen sich noch zwei weitere dazugesellen. Immer müssen es, falls ich nicht allein hier bin, also drei Besucher sein. Außerdem gilt es, ihnen bis Mitternacht, es darf am Ende der letzten weder ein bißchen früher noch ein wenig später werden, zwölf Sagen aus der Gegend zu erzählen, sonst nämlich« – der Jäger starrte die Uhr an und machte eine kleine Pause – »ist meine Seele« – er lächelte, als der Sekundenzeiger sich der Zwölf näherte – »im selben Augenblick« – er räusperte sich, er lachte – »verkauft.«
Abstieg
Beim Abstieg im leichten Regen, aus dem jeden Moment hätte Schnee werden können, da freilich wäre Wind beinahe von einem schmalen Schotterweg abgerutscht und den steilen Hang hinuntergerollt. Das ist nun, dachte er, schon der dritte Unglücksweg, den ich ab sofort nicht mehr gehen darf, um das Schicksal nicht herauszufordern. Allmählich versperrt sich mir die ganze Gegend. In allen Himmelsrichtungen stellt sie Verbotsschilder für mich auf.
So, dachte er heiter, würde ich denken, wenn ich, was ich nicht bin, furchtsam, wenn ich ein bißchen ängstlich wäre und abergläubisch zwischen den Felsen.
Die dreizehnte Sage
Was Wind nie erfahren wird: Im folgenden Juni lud der Jäger drei andere Gäste in seine Hütte und erzählte ihnen in gemütlicher Runde, wie gewohnt und wie er mußte, pünktlich die zwölf Sagen. Diesmal jedoch trank er ein Glas zuviel. Es gelang ihm nicht, sich rechtzeitig zu beherrschen. Nach Mitternacht hängte er, wär doch gelacht, eine dreizehnte an. Was würde geschehen?
Natürlich nichts! Es passierte nicht das Geringste. Das Feuer flackerte friedlich, kein Flämmchen zuckte stärker als sonst. Wie wurde da mit den Augen gezwinkert, vernünftig geschmunzelt ringsum und noch eine Flasche und noch eine geöffnet! Alles gutgegangen.
Der Jäger indessen spürte, bei prächtiger Gesundheit, fortan einen kleinen Hohlraum in sich, eine winzige unvergängliche Leere.
Familiäres
Eine junge Frau, Eva Wilkens, die erst vor zwei Wochen ihrem Freund Klaus den Laufpaß gegeben hatte, traf sich im Berliner Hauptbahnhof in einer Kamps-Filiale mit ihren Eltern zu einem Kaffee. Sie wirkte ungeduldig, fast schon gereizt, denn am nächsten Morgen wollte sie von ihrem durch große Bedürfnislosigkeit ersparten Geld für drei Monate, so behauptete sie, nach Amerika. Da, während sie noch einmal die wichtigsten Punkte von Reise und Aufenthalt durchgingen, überfiel das Mädchen ganz unerwartet das heiße Bedürfnis, statt den beiden ihr so freundlich Gegenübersitzenden davonzufliegen, sich mit ihnen inbrünstig zu verbinden, unauflöslich, und so mit ihnen zu … verschweben für alle Zeit.
Orchideen
In Berlin, im Gewächshaus D des Botanischen Gartens, als draußen alles kalt und kahl war, saßen zwei Botanikstudenten mit ihren Kleinen bei den Orchideen. Sie fotografierten die einander übertrumpfenden Rachen und Schlünde, und man hörte sie abwechselnd lateinische Blumennamen, dann wieder Wörter in Kindersprache rufen. Der mit dem Kinnbärtchen meinte, manche der Blüten schnitten regelrechte Fratzen vor Ausgelassenheit. Der mit dem Zopf sagte, als er dachte, kein anderer würde ihnen zuhören, seine Großmutter habe, apropos Übermut, eines Tages Besuch vom Tiefseeforscher Hans Hass bekommen, der auf ihrer blütenweißen Tischdecke ein paar Tropfen Rotwein verschüttete, was ihn sehr beschämt habe. Daraufhin sei die Großmutter, um ihm jede Peinlichkeit zu ersparen, in Gelächter ausgebrochen: »Und das soll schlimm sein?«, und habe den gesamten restlichen Flascheninhalt unter dem Ausruf: »Macht doch überhaupt nichts!«, über der Tischdecke ausgeleert.
Der mit dem Kinnbärtchen antwortete daraufhin gutgelaunt, ein Nachbar habe versehentlich den Hund seiner Schwester überfahren, was den Mann sehr schmerzte. Daraufhin habe die Schwester, die Ute, auch noch ihre Katze verstoßen, nur um den unglücklichen Bruder mit seiner Tat nicht allein zu lassen.
Nun konnte es die schon mehr als matronenhafte, normalerweise höchst ehrenwerte Frau Knochendöppel, Mutter eines gewissen Graf Otto und in Berlin auf Besuch, die hinter einem Gebüsch gefüllte Schokolade gegessen und alles mit angehört hatte, nicht lassen, es überfiel sie einfach, es mußte raus aus ihr. Sie mischte sich ein: »Herr Moßmann hat im Zorn meinen Vater umgebracht durch Fahrlässigkeit. Danach war er der unseligste Mann der Welt. Da ging ich hin und sagte ihm: ›Nehmen Sie es nicht zu schwer, Sie sind nicht der einzige schuldhaft Verstrickte auf dieser Welt‹, und habe, ihm zum Trost, seine Mutter die Treppe runtergestürzt.«
Später schämte sich die redliche Frau des Schlossermeisters sehr wegen ihrer Lüge und begriff sich selbst nicht.
Wie aber kam es zu solchen Geschichten? Es lag bestimmt an der schwülen Treibhausluft und den flunkernden Grimassen der Orchideen. Auch waren die Kinderchen der Studenten gottlob noch viel zu klein, um Schaden zu nehmen.
Künstliches Frühstücken
Dem Botanischen Garten in Berlin ist ein Museum mit Dioramen und Schautafeln angeschlossen. Gut und schön. Aber es gibt dort auch einen Frühstückstisch für vier Personen, mit allem, was normalerweise dazugehört, jedenfalls in einer ordentlichen Familie mit Vater, Mutter, Sohn und Tochter, auch wenn sie hier fehlen, wie die Zwerge bei Schneewittchen. Jeder der Abwesenden hat etwas anderes verlangt, und alle Wünsche wurden auf bunten Streifensets reichlich erfüllt. Vier kleine Reiche mit jeweils eigenen Statuten. Man will seitens des Museums damit zeigen, aus wie vielen Regionen der Erde wir bei einem alltäglichen Frühstück Rohstoffe usw. beziehen. Natürlich ist alles imitiert, Schokoladenpaste, Kokosflocken, Trockenfrüchte, Spiegelei, Bananen, Tee, alles aus Gips oder Plastik, aber täuschend echt, wenn auch etwas staubig.
Elsa, zu Besuch in der Hauptstadt, hatte es mit eigenen Augen angesehen und fing an sich zu wundern, warum sie es so lange, so versunken tat, viel länger als bei den Fotos von den exotischen Herkunftsländern. Plötzlich fiel ihr ein, wie ungern sie als Heranwachsende ausgerechnet den Frühstückstisch deckte, wie leidenschaftlich sie aber doch, im Gegensatz dazu, schon als Kind das morgendliche Tischdecken nachgeahmt, ja, wie sie es sich allein am Nachmittag für vier eingebildete Personen vorgespielt und das feine Klingeln der Löffelchen dabei angehört hat.
Wer weiß die Lösung?
Glatteis
Ein Mann, der, da ihm Frau und einziger Sohn gestorben waren, allein leben mußte, soll öfter im Kreis der ihm verbliebenen Freunde betont haben, wie stolz er auf seine tapfer aufrechterhaltene Selbständigkeit sei. Auch zu diesem Winteranfang war es nicht anders. Er saß, sagte man, mit dem Vogelbestimmungsbuch am Küchenfenster und verfolgte das Treiben der kleinen Gäste so interessiert wie das ängstliche Vorantasten besonders der alten Menschen bei Glatteis da draußen. Mit einer Hand sah er sie die Leine eines großen oder kleinen Hundes halten, mit der anderen umklammerten sie den Briefkasten oder stützten sich gegen die Müllcontainer auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig. »Hier ist mein Platz, solange ich noch die fünf Eingangstore habe für die Welt, damit sie bei mir eintreffen kann!« soll er oftmals zu dem deutlich jüngeren Herrn Fritzle gesagt haben.
Und doch, so heißt es, hat er sich im Dezember entschlossen, die Waffen zu strecken und sich um Aufnahme in einem Heim zu bemühen. Von einem zum anderen Tag! Als nämlich das Eis auf der vierstufigen Außentreppe seines Häuschens zwischenzeitlich geschmolzen war, gab es plötzlich ein Loch frei, etwa so groß wie ein Normalbrot.
War das so schlimm? Beim Rauf- und Runtersteigen hatte er doch nie auf diese Stelle getreten.
Doch, es soll verheerend gewesen sein für ihn. Warum aber? Weil er durch die Öffnung im Beton in die reine Schwärze sah, in eine bodenlose Finsternis. Dieser Hohlraum soll ihn, Herrn D., ehemals Pressefotograf, so verdutzt haben, daß er, ohne sich erst bei einem Maurer nach einer möglichen Reparatur zu erkundigen, prompt den Schutz eines Altersheims suchte.