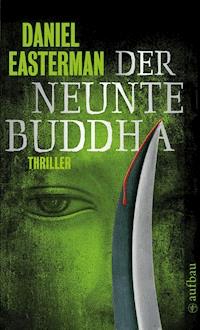8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Jagd nach dem Schwert des Propheten - rasant, spannend, hart.
Professor Goodrich erhält von einem arabischen Buchhändler ein altes Schwert und einen Brief zur Begutachtung. Ist es wirklich das Schwert Mohammeds? Kurze Zeit später gerät sein Leben vollkommen aus den Fugen. Der Besitz des Schwertes kommt einem Todesurteil gleich, denn islamische Fundamentalisten schrecken vor nichts zurück, um in seinen Besitz zu gelangen. Doch Goodrich gibt nicht auf. Er kämpft um seine Tochter, sein Leben und schließlich um Ägypten und die ganze Welt...
Ein Thriller aus dem heutigen Kairo, wo Moderne und islamischer Fundamentalismus dicht nebeneinander existieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Daniel Easterman
Das Schwert
Thriller
Aus dem Englischenvon Eva Bauche-Eppers
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
The Sword
erschien 2007 bei Allison & Busby, London.
ISBN 978-3-841-20546-9
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, November 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © 2007 by Daniel Easterman
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z. B. über das Internet.
Umschlaggestaltung morgen, Kai Dieterich
unter Verwendung eines Fotos von Bridgeman Art Library
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH,
www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Gewidmet: Beth. Wem sonst.
Quem for beijado por ti/Até se esquece de Deus
Natália dos Anjos
Danksagungen
Vielen, vielen Dank allen, die mir bei der Arbeit an diesem Buch hilfreich zur Seite gestanden haben, insbesondere meiner lieben Frau Beth. Ich danke meiner Agentin, Vanessa Holt, für ihr unermüdliches Engagement und meiner klugen, souveränen Verlegerin, Susie Dunlop. Zu guter Letzt bedanke ich mich bei Sebastian Gutteridge, der einige mir unmöglich erscheinende Berechungen einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hat.
Al-dschanna tahta zilal al-suyuf»Das Paradies liegt unter dem Schatten der Schwerter.«
Aus den Sprüchen des Propheten,
Sammlung Al-Buchari, Band 4.73
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1 Im Garten des Lichts
2 Der Oberste aller Dschinns
3 In der Siegreichen Stadt
4 Der Brief
5 Der Ägypter
6 Der Engel des Todes
7 Von hier bis in die Ewigkeit
8 Das Schwert Allahs
9 Waffenbrüder
10 Der Tod und das Mädchen
11 Trautes Heim
12 ... das Ungeheuer aus seinen schlimmsten Träumen
Zweiter Teil
13 Schottische Zuflucht
14 Fiona
15 Hintergründe
16 Ein Schuss aus dem Dunkel
17 Gälischer Psalm
18 Ein Licht in der Dunkelheit
Dritter Teil
19 Der Wind des Paradieses
20 Geblendet in Kairo
21 Assistent des Chargé d’Affaires
22 Tausendundeinenacht
23 In der Stadt der Lebenden und der Toten
24 Taxi
25 Rot wie Blut und Weiß wie Schnee
26 In den Müllbergen
27 Ein arisches Kind
28 Schlagzeilen
29 Zu Füßen des Pharao
30 Travestie
31 Advent
32 Durch einen Spiegel ein dunkles Bild
33 Eine Brücke zu weit
Vierter Teil
34 Persephone in Ägypten
35 Georgina
36 Vesper
37 Im Syrischen Portikus
38 Mitternachtsmesse
39 Der Vater des Schreckens
40 Weihnachten
41 Auf der Flucht
42 Totenwache
43 Hinter Gittern
44 Der perfekte Verdächtige
Fünfter Teil
45 Der Beginn einer wundervollen Freundschaft ...
46 Anwärter auf das Paradies
47 Ton und Licht
48 In der Kammer des Königs
49 Am Meer
Erster Teil
1Im Garten des Lichts
Straße zwischen Gardes und Sarghun Schahr
10 Meilen südlich von Sareh Scharan
Ost-Afghanistan
Montag, 27. November
Hoch oben in den Bergen, wo Fischadler am Himmel mit Amurfalken tanzten und Weißschwanzadler im Sturzflug auf Beute niederstießen, die selten genug war in dieser kargen, unwirtlichen Landschaft, beobachtete ein Mann durch ein starkes Fernglas die Vorgänge unten im Tal. Das Doppelfernrohr saß auf einem kleinen Stativ. Es erlaubte die Vergrößerung von Objekten um das 150-fache und versetzte den heimlichen Beobachter in die Lage, aus seinem Felsenhorst die Ereignisse so genau zu verfolgen, als wäre er dabei.
Tags zuvor hatte man einen langen Holzpfahl, ungefähr fünfzehn Zentimeter im Durchmesser und etwas mehr als mannshoch, in dem ausgetrockneten Flussbett aufgepflanzt. An diesem Morgen war ein Jeep gekommen, besetzt mit sieben Taliban-Soldaten. Sie zerrten einen einzelnen Mann heraus, ohne jeden Zweifel ihr Gefangener. Allem Anschein nach hatte man ihn brutal misshandelt. Sein Körper – was der Beobachter davon sehen konnte – war übersät von Platzwunden und Blutergüssen, und jeder Schritt schien ihm Schmerzen zu bereiten, als hätte man ihn mit Stöcken auf die Fußsohlen geschlagen oder seine Beine mit Peitschenhieben traktiert.
Sie stellten den Gefangenen an den Pfahl, zogen seine Arme nach hinten und fesselten ihm die Hände. Obgleich es ihm unmöglich gelingen konnte, sich zu befreien, musste einer der Taliban als bewaffneter Wächter zurückbleiben. Die anderen fuhren in dem Jeep davon, eine ockerfarbene Staubfahne hinter sich herziehend, die mit ihnen in der Ferne verschwand. Nachdem das Röhren des zu hoch drehenden Motors verstummt war, senkte sich eine vollkommene Stille über das Tal.
Der Beobachter überprüfte den Sitz eines winzigen Funkempfängers in seinem Ohr. In Verbindung mit einem hochempfindlichen Parabolmikrophon, bereits in der vergangenen Nacht an verborgener Stelle im Tal platziert und auf den Pfahl ausgerichtet, ermöglichte er ihm, über eine Entfernung von bis zu einem halben Kilometer eine in normaler Lautstärke geführte Unterhaltung zu belauschen. Den ganzen Vormittag hatte Stille geherrscht. Jetzt hörte man Musik aus dem Radio des Wächters.
Gar nicht weit entfernt, trugen die Berggipfel weiße Kappen aus Schnee. Eine bittere Kälte lag über allem. Die Luft war wie Eis.
Ein paar Meter abseits der Straße hörte der Gefangene dieselbe Musik. Irgendwo hinter ihm tönte ein Lied auf Dari krächzend aus einem kleinen Kofferradio. Es hatte Tempo und einen eingängigen Beat, ein Party-Schlager: Az jad-e rochat mastam ... »Ich bin berauscht von der Erinnerung an dein Gesicht«. Er bemühte sich, den Text zu verstehen, wie um diesen letzten Minuten seines Lebens einen Sinn abzuringen. Der Sender war Radio Free Afghanistan. Regionale Stationen wagten nicht mehr, Musik zu spielen, nicht einmal die Hits von Pop-Idol Farhad Darja. Das Land geriet langsam, aber sicher wieder unter den Einfluss der Taliban, und Musik war wie früher verboten. Aber, dachte der Gefangene, Ausnahmen bestätigen die Regel: Er befand sich in der Gewalt der Taliban, und sein Wächter dudelte die neusten Hits.
Er seufzte und versuchte sich einen Eindruck von der Gegend zu verschaffen, in die man ihn gebracht hatte. Wacholder, Tamarisken und wilde Pistazienbäume an den mit Strauchwerk bewachsenen Hängen, aber hier in der Talsohle nichts als Steine. Als sie vor ein paar Stunden angekommen waren, er und seine Peiniger, ging eben die Sonne über Indien und Pakistan auf und erklomm das Toba-Kakar-Gebirge, auf das er schaute. Im Norden bekrönte der Hindukusch die Welt; die schneebedeckten Gipfel Symbole des Unmöglichen.
Gleich hinter der Grenze zu Pakistan, und geprägt von dem Hauptmassiv des Toba-Kakar, erstreckten sich die Stammesgebiete Wasiristans, eine wilde, archaische Region, wo Muslim-Missionare der heidnischen Bevölkerung den einzig wahren Glauben predigten. Dort oben in den Bergen hatte Pakistan seine Nuklearwaffen gebaut und etwas weiter südlich die international verurteilten Atomtests durchgeführt. Schlimmer noch, Wasiristan war nun wieder Taliban-Gebiet; Städte und Dörfer waren an die Fundamentalisten zurückgefallen. Chost, nur wenige Meilen entfernt von dort, wo er jetzt stand, war die ursprüngliche Rekrutierungsbasis für al-Qaida gewesen, unter der Führerschaft von Ajman Sawahiri, Bin Ladens Arzt und rechter Hand.
Westliche Analysten glaubten, al-Qaida und die Taliban wären unschädlich gemacht. Der Gefangene wusste es besser. Immer noch überquerten militante Sympathisanten ungehindert die Grenze. Manche kamen in Autos, die Pakistans Geheimdienst zur Verfügung stellte, andere langsamer, aber dafür unbemerkt und ungefährdet, im Schutz der Dunkelheit zu Fuß, geführt von Ortskundigen.
Sein derzeitiger Auftrag aber hatte damit nichts zu tun, sondern betraf etwas gänzlich Anderes, und zwar etwas, dachte er mit einem flauen Gefühl in der Magengrube, das unter Umständen eine größere Gefahr darstellte, als Atombombe und Taliban zusammengenommen.
Seine Entführer hatten ihn ein paar Meter von der Straße weg ins flache Gelände gebracht – es war eher ein unbefestigter Weg als eine Straße –, an einen dort eingerammten hohen Pfahl gefesselt und in der Obhut eines der Ihren zurückgelassen, eines kräftig gebauten Angehörigen des Durrani-Stammes. Er trug einen gestreiften Turban; die beiden Enden hingen ihm wie Zöpfe über die Schultern.
Seit der Abfahrt seiner Kameraden saß er auf einem Stein in der Vormittagssonne, die noch einen langen Weg bis zum Zenit zurückzulegen hatte, und tippte im Takt der verbotenen Musik mit dem Fuß auf den Boden.
Der Gefangene, ein Mann Ende zwanzig mit Namen John Navai, musterte zum hundertsten Mal seine Umgebung. Dies war einer der einsamsten Orte der Welt, dachte er, keine Gegend, wo man sich vorstellen konnte, dass die Kavallerie mit Hurra von den Hängen herabstürmte. Es wunderte ihn nicht, dass niemand gekommen war, um ihn zu retten, weder zu Lande, noch aus der Luft, per Helikopter. Von Anfang an hatte er gewusst, dass er allein arbeiten würde und, falls er in Gefangenschaft geriet, allein sterben. Seine Identität musste um jeden Preis geheim bleiben, auch den seines Lebens. John war ein Agent des MI6, des britischen Auslandsgeheimdienstes, und seine Mission in Afghanistan – hatte man ihm gesagt – von allergrößter Wichtigkeit für die nationale Sicherheit Großbritanniens.
Sie hatten ihn bereits verhört, weiter oben in den Bergen, in einem ihrer Verstecke, die man nur mit dem Maultier erreichen konnte oder zu Fuß. Lotrechte Steilwände, gewundene Pfade über lockeres Felsgestein, tiefe Klüfte und die schneebedeckten Nadeln unzähliger Gipfel – eine ihm vertraute Welt und doch eigentlich so fremd wie die Oberfläche des Mars, ein geheimes, uneinnehmbares Reich, welches niemand ohne Erlaubnis betrat oder verließ.
Sein Gefängnis war eine verräucherte Höhle gewesen, die er, angekettet an einen tief in den Fels eingelassenen Ring, mit einer Herde stinkender Schafe und Ziegen teilte. Fledermauskot bedeckte den Boden, und ein Stück weiter hinten von dort, wo er saß, war am Tag die Höhlendecke schwarz von ihren samtigen, kopfüber hängenden Leibern.
Seine Höhle, begriff er nach und nach, war Teil eines größeren, durch unterirdische Gänge verbundenen Systems. Sie befand sich etwa fünfzehn Meter unter der Erdoberfläche, zugänglich durch einen steil nach unten führenden Tunnel, dessen Öffnung hinter dichtem Buschwerk verborgen lag. Ein Schacht in der Decke bildete die einzige Luftzufuhr.
Jeden Morgen erhielt er ein Frühstück, bestehend aus Quark und altem Brot. Während er aß, redete ein Turban tragender Geistlicher namens Hadschi Achmad mit sanfter Stimme und in englischer Sprache auf ihn ein, bat ihn, zum Islam zu konvertieren und sich damit Schmerz und Tod zu ersparen. Jeden Tag hatte er geschwiegen, und der Achund hatte lächelnd seine Entscheidung respektiert. Er war ein Christ, hatten sie gesagt, also würden sie ihn nicht töten, weil er sich weigerte zu konvertieren. Falls sie ihn töteten, dann nicht wegen religiöser Unbelehrbarkeit, sondern wegen seiner anderen Verbrechen.
Worin diese bestanden, war schnell erklärt. Nach Hadschi Achmads Überzeugung war der Gefangene ein britischer Spion im Dienst des MI6 oder gehörte als Offizier des britischen militärischen Geheimdienstes zu der Schnellen Eingreiftruppe der Alliierten in Kabul. Der Gefangene trug einen flachen afghanischen Hut und einen wollenen Umhang; man konnte ihn für einen Einheimischen halten. Er gab vor, weder Dari noch Paschtu zu verstehen, aber sein Befrager brauchte ihm nur ins Gesicht zu blicken, um zu erkennen, dass er wahrscheinlich iranischer Abstammung war, auch wenn er Englisch mit starkem britischem Akzent sprach. Hadschi Achmad hatte an der Universität Newcastle in Ingenieurswesen promoviert und ein feines Ohr für englische Dialekte. Sein Gefangener entstammte der Mittelschicht und war irgendwo im Süden des Landes beheimatet. Viele Iraner waren nach der Revolution in Städte wie Brighton geflohen, und Hadschi Achmad glaubte, dass die Eltern des Gefangenen zu diesen gehörten. Alles nur Vermutungen, natürlich, aber Hadschi Achmads Vermutungen pflegten meistens zuzutreffen.
Die Folter begann jeden Tag nach der Aufforderung zu konvertieren. Ausgeführt wurde sie von wechselnden Mitgliedern der Gruppe nach den Anweisungen des Mannes mit der sanften Stimme und den wohlgesetzten Worten, Hadschi Achmad. Der Gefangene wusste genau, mit wem er es zu tun hatte. Hadschi Achmad war ein ägyptischer Araber, wie sein Busenfreund Sawahiri. Ursprünglich ein Mitglied von Ägyptens berüchtigtem Islamic Jihad, war er 1981 von einer von Bin Laden ins Leben gerufenen Gruppe rekrutiert worden, für den Kampf gegen die Russen in Afghanistan.
Geblieben war er als Mitglied von al-Qaida, einer von etlichen hundert »Afghan Arabs«, die erkannten, dass ihnen die Rückkehr in die Heimat verwehrt war, wo ein Haftbefehl auf sie wartete. Später, 1998, half er, Bin Ladens Dachorganisation aufzubauen, die »Islamische Front für den heiligen Krieg gegen die Juden und Kreuzritter«. Ein mittelalterlich anmutender Name vielleicht, aber die Juden standen für die Bewohner moderner Länder, und die Kreuzritter waren Amerikaner, Europäer, Australier und alle, die sie unterstützten.
Er hatte die Kunst der Folter bei den Russen studiert und sich mit sorgfältig kalkulierten Häppchen geheimer Informationen revanchiert, um sie glauben zu machen, er sei ihr Mann, während er die ganze Zeit doch nur Gott gehörte und sonst niemandem. Sein Rufname war Achmad, und der nächste Ibn Abdullah, der Sohn von Gottes Diener. Was immer er tat, in seinem Herzen versuchte er, seinem Schöpfer zu dienen.
Zur Folter ihres Gefangenen bedienten sie sich der Mittel, die ihnen zu Gebote standen. Sie verfügten nicht über die übliche technische Ausrüstung – keine Elektroschocker, keine Hochgeschwindigkeitsbohrer, keine Kopfhörer für die Beschallung mit hochfrequenten Tönen –, aber lange Jahrhunderte immer wieder neuer Kriege sowie Hadschi Achmads Lehrer hatten dafür gesorgt, dass sie wussten, wie man einem Menschen Schmerzen zufügt.
Sie wussten, wann man beginnt und wann man aufhört, wann man Blut vergießt und wann die Blutung stillt, wann es angebracht ist, den Gefangenen mit Drohungen zu zermürben und wann, ihn mit Freundlichkeit dankbar zu stimmen. Sie hatten ihn mit Feuer gebrannt – ein wenig hier, ein wenig dort –, ihm schwere Steine aufgelegt, deren Gewicht ihm beinahe das Rückgrat brach und den Brustkorb zusammenpresste, bis er zu ersticken glaubte; sie gebrauchten scharfe Messer, um ihm die Haut abzuschälen, und Verbände und Salben, um die Heilung zu beschleunigen, damit er nach drei, vier Tagen für ein neues Verhör bereit war. Die Stunden vergingen langsam, als hätten sie einzig und allein den Zweck, Schmerzen zu bringen und noch mehr Schmerzen.
Sie handelten nicht aus Sadismus. Sie wollten Informationen von ihm, und er war entschlossen, nichts preiszugeben, nicht einmal seinen Namen. Er hätte die Tortur jederzeit beenden können, indem er ihnen einfach sagte, was sie wissen wollten. Andererseits war ihm klar, wenn er das tat, würden sie ihn dennoch töten.
Er hatte Englisch mit ihnen gesprochen, denn der geringste Hinweis, dass er verstand, was man auf Dari oder Paschtu zu ihm sagte, bedeutete das Ende seiner Tarnung. Um ihn auf die Probe zu stellen, hatte Hadschi Achmad einen seiner Mudschahed aufgefordert, ihm persische Lyrik vorzutragen. Zwischen den Foltersitzungen rezitierte der Mann also auswendig, in halblautem Singsang mystische Verse des Dichters Rumi, und sein Gefangener lauschte und hörte in der Erinnerung seines Vaters Stimme dieselben Worte sprechen. Doch er verriet sich nicht, mit keiner Geste, keinem Wimpernzucken.
Ein klammes Frösteln kroch in die Höhle, wo es zu allen Jahreszeiten kalt war. Manchmal tat es weh, an das Tageslicht zu denken. Bei Sonnenschein war Afghanistan schöner als jeder andere Fleck auf Erden, den er kannte.
Irgendwann einmal hatte er das Grabmal des Kaisers Babur in Kabul besucht. Obwohl in den vergangenen Kriegen erheblich beschädigt, hat es seinen Charakter behalten: ein niedriges Dach auf Säulen über einem schlichten Sarkophag, eine Ruhestätte, umfangen von Licht und klarer Luft. Die Inschrift auf dem Grab besagte, Babur lebe ewiglich in dem lichten Garten des Engelskönigs, wo er zugleich König ist und Engel.
Manchmal gestatteten sie ihm, am Eingang der Höhle zu sitzen, unter einem Nachthimmel, an dem Millionen Sterne gleißten. Sie sagten ihm, die Sterne wären Lampen in den Händen von Engeln im ersten Firmament. Er glaubte ihnen nicht. Sie sagten ihm, Gott wacht über uns. Und auch das glaubte er ihnen nicht.
2Der Oberste aller Dschinns
Seine Knie wurden weich, und sein Rücken schmerzte, als ob tausend Dämonen der Hölle darin tobten. Langsam ließ er sich an dem Pfahl in die Hocke gleiten, auch wenn er fürchtete, nie wieder aufstehen zu können. Vielleicht töteten sie ihn einfach mit einem Genickschuss, während er hier saß. Er hoffte, dass er sich nicht nass machte, wenn der Augenblick kam. Am frühen Morgen hatte er das letzte Mal seine Blase entleert, und allmählich begann er sich ausgesprochen unbehaglich zu fühlen.
Er schaute die Straße hinauf und hinunter. Seit Stunden war kein einziges Fahrzeug mehr vorbeigekommen; seine Entführer mussten diesen Teil der Strecke abgeriegelt haben. Ob sie ihn einfach liegenlassen würden, nachdem sie ihn getötet hatten, für die Sonne, den Wind und die wilden Tiere?
Er hatte Hadschi Achmad erzählt, dass er ein Christ sei und von seiner Mutter in der Tradition der Anglikanischen Kirche erzogen und dass er, als Christ, unter dem Schutz des Islam stand. Der Koran garantierte Christen und Juden Sicherheit vor Verfolgung, argumentierte er, auch wenn sie sich weigerten zu konvertieren.
»Du täuschst dich«, hatte der Mullah erwidert. »Wir befinden uns im Krieg mit den Christen und den Juden. Die Scheichs haben den Dschihad erklärt und allen wahren Gläubigen den Heiligen Krieg als Pflicht auferlegt. Du bist ein Spion in Kriegszeiten, und dein Leben ist tausendfach verwirkt.«
Er sagte Hadschi Achmad, ich habe Frau und Kind zu Hause, meine Frau hat keine Schuld an den Missetaten, die ihr mir vorwerft, aber wenn du mich tötest, tötest du auch sie und zerstörst das Leben eines kleinen Kindes. Er sagte, meine Frau heißt June und meine Tochter Mary. Er bot Hadschi Achmad die Namen dar, als könnte es ihn erweichen, wenn er sie kannte, nicht abstrakte Personen, die Frau und das Kind, sondern June und Mary.
»Willst du June zur Witwe machen und Mary zu einem Waisenkind? Sie ist erst fünf Jahre alt.«
»Wie viele Witwen und Waisen gibt es in Afghanistan durch die Schuld der Briten und Amerikaner?«, hielt Hadschi Achmad ihm entgegen. »Und im Irak? Unschuldige Frauen, unschuldige Kinder, die gestorben sind, weil sie Muslime waren. Meine Frau war Irakerin. Sie war in Bagdad, als ihr mit eurem Krieg angefangen habt, zu Besuch bei ihrer Familie. Sie alle starben bei einem Angriff der Amerikaner. Du bist nichts Besonderes. Dein Herz ist nichts Besonderes. Deine Frau und dein Kind sind nichts Besonderes. Deine Liebe zu ihnen und ihre Liebe zu dir ist nichts Besonderes. Wenn du mir nicht sagst, was ich von dir wissen will, dann wird die bisherige Folter gewesen sein wie nichts. Du glaubst, du hast bereits gelitten? Denk nach. Ich kann dir Schmerzen zufügen, wie du sie dir nicht vorzustellen vermagst. Ich werde erfahren, was ich wissen will, und dann belohne ich dich mit einem schnellen Tod.«
Das Motorengeräusch eines Lastwagens näherte sich vom Ende des Tals. Der Wächter schaltete sein kleines Radio aus und verbarg es in seinem Turban. John schaute zu, wie er aufstand und auf ihn zukam.
»Du kannst nicht da sitzen! Hadschi Achmad kommt. Er darf dich nicht so sehen. Er wird glauben, du hast dich ausgeruht.«
Statt des Jeeps fuhren sie jetzt einen lädierten Pritschenwagen, stumpf rotbraun, bis auf ein paar Reste der ursprünglich blauen Lackierung, verbeult und rostzerfressen, aber sehr schnell. In eine Wolke ockerfarbenen Staubs gehüllt, kam er aus den Bergen wie ein geflügelter Dämon oder der Oberste aller Dschinns.
Er brachte drei Männer: Zwei Bewaffnete, ausstaffiert mit alten russischen AK47, die Schultergurte gespickt mit Ersatzmagazinen, saßen hinten, bei der aus etlichen langen Brettern bestehenden Ladung. Hadschi Achmad saß am Steuer. Sie parkten das Auto ungefähr zwanzig Meter hinter dem Pfahl. John hörte, wie die Heckklappe geöffnet wurde, und wollte sehen, was das alles zu bedeuten hatte, aber es war ihm kaum gelungen, sich wieder aufrecht hinzustellen, als der Geistliche in sein Gesichtsfeld trat.
»Du bist sehr tapfer gewesen«, sagte sein Peiniger. »Aber wir befinden uns nun in der Phase der Entscheidung, und bald wird dein Mut über alles Erträgliche hinaus auf die Probe gestellt werden. Du wirst zerbrechen, dessen sei versichert. Doch je eher du mir sagst, was ich wissen will, desto eher beschenke ich dich mit einem schnellen und schmerzlosen Tod.«
Für John unsichtbar, hatten die Begleiter des Mullah, zu denen sich der Wächter gesellte, damit begonnen, aus dem mitgebrachten Holz etwas zu zimmern; die raschen, trockenen Hammerschläge tönten zwischen den steilen Hängen wie das Läuten einer gesprungenen Glocke.
Er redete beschwörend auf den Mullah ein.
»Begreifst du nicht, dass ich dir im Würgegriff der Schmerzen nur erzählen werde, was du hören willst, ob es wahr ist oder nicht? Ich bin kein Spion. Ich habe es dir tausendmal gesagt, und immer noch willst du mir nicht glauben. Ich bin Journalist. Ich arbeite für den Guardian. Kennst du diese Zeitung?«
»Ich habe sie früher gelesen.« Hadschi Achmad lächelte. »Ein ausgezeichnetes Blatt.«
»Und weshalb glaubst du mir dann nicht? Meine Papiere sind in meiner Reisetasche, aber du behauptest, sie wären nicht echt. Du brauchst nichts weiter tun, als meinen Herausgeber anrufen, und er wird dir meine Angaben bestätigen.«
»Das würde ich gern tun. Aber wenn ich ein Telefongespräch mit London führe, meinst du nicht, dass man mich bald aufgespürt hätte? Das musst du wissen, wenn du sonst nichts weißt. Das ist dein Job, nicht wahr? Leute aufspüren.«
»Dann schick ein Telegramm, irgendwas.«
Hadschi Achmad lächelte.
»Das habe ich getan. Einer unserer Leute hat es in Kabul aufgegeben. Die Antwort kam von einem Mann namens Roland Anderson. Er hat bestätigt, dass es in der Tat bei der Washington Post einen Journalisten namens Mike Smith gibt. Unglücklicherweise ist dir damit nicht geholfen. Mr. Anderson, oder vielleicht eine von ihm beauftragte Sekretärin, hat einen verhängnisvollen Fehler begangen. Das Antworttelegramm wurde von einer Poststelle im Hauptquartier des britischen Geheimdienstes aufgegeben. Vauxhall Cross, wenn ich mich recht erinnere. Du wirst bestimmt wissen, um welche Poststelle es sich handelt. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich glaube, meine Freunde sind mit ihren Vorbereitungen fertig. Ich werde dir jetzt die Fesseln abnehmen.«
Er fühlte, wie der Strick gelöst wurde, doch er rührte sich nicht, gelähmt von der Angst, sich umzudrehen und sehen zu müssen, was ihn erwartete, und dass man ihm keine Gelegenheit geben würde zu entkommen. Die Nachricht von dem Telegramm hatte ihn bis ins Mark erschüttert. Wie hatte dieser dumme, banale Fehler passieren können? Unfassbar, dass man so achtlos, gedankenlos seine Tarnung zerstört und sein Schicksal besiegelt hatte.
»Mike Smith, oder wie immer du in Wirklichkeit heißen magst, ich habe diesen Ort zum Schauplatz deiner Hinrichtung bestimmt. Damit werden wir nun beginnen. Zuvor lass dich jedoch warnen, du wirst nicht schnell sterben. Der Tod, den ich für dich vorgesehen habe, wird außerordentlich qualvoll sein, in einem Maße, wie du es dir vielleicht nicht vorzustellen vermagst. Ich werde es dir sogleich erklären. Nun möchte ich dich bitten, dass du dich umdrehst.«
Er gehorchte, und sein Blick fiel auf ein riesiges Kreuz, zwei Meter hoch oder höher und anderthalb Meter breit, ein perverser Eindringling, Symbol einer fremden Religion und einer fremden Gottheit.
»Das ist Blasphemie«, sagte er. »Der Koran sagt eindeutig, dass Jesus nicht ermordet und auch nicht gekreuzigt wurde.«
»Doch er sagt ebenfalls, dass jemand an seiner statt das Martyrium erlitten hat. Es gab ein Kreuz, der Koran hat es nie geleugnet. Auch musst du wissen, dass im Römischen Reich die Kreuzigung eine durchaus gewöhnliche Hinrichtungsart gewesen ist.
Ich will dir erklären, was geschehen wird. Es ist wichtig, dass du genau weißt, was du erleiden wirst, solange du am Kreuz hängst.
Man wird dich hochheben und deine Arme am Querholm festbinden. Deine Füße werden an die Seiten des senkrechten Pfostens genagelt. Wenn das geschehen ist, treiben wir lange Nägel durch deine Handgelenke, zwischen diesen Knochen ...« Er zeigte fragend auf sein Handgelenk, im Ungewissen über den Fachausdruck. John nickte, er hatte Mühe, alles zu begreifen.
»Elle und Speiche«, sagte er.
»Vielen Dank. Ja, man schlägt die Nägel zwischen Elle und Speiche ein, nicht durch die Handfläche, wie eure christlichen Maler es darstellen. Die Knochen der Hand sind zu schwach, sie könnten dein Gewicht nicht halten. Ebenso bei deinen Fußgelenken: die Nägel sitzen zwischen zwei starken Knochen.
Des weiteren gibt es einen kleinen Sitzpflock an dem senkrechten Pfosten. Er soll dir ermöglichen, dich etwas abzustützen, und damit dein Leben verlängern, wie auch deine Qualen. Wenn du Glück hast, tritt der Tod innerhalb von Stunden ein. Aber für den Gläubigen gibt es so etwas wie ›Glück‹ nicht. Einzig Gottes Wille ist es, der zählt. Und heute ist es Gottes Wille, dass du leiden sollst.
Dein Tod wird durch eine oder mehrere Ursachen eintreten. Erstens der durch die Nagelwunden hervorgerufene Schockzustand: Wenn du ein schwaches Herz hast, wird er dich töten. Austrocknung ist eine weitere Gefahr, aber wir werden Sorge tragen, sie zu verhindern. Im Lauf der Zeit werden deine Brustmuskeln schwächer und schwächer werden, und du erstickst allmählich.
Sobald du oben am Kreuz hängst, wird das Gewicht deines Körpers dir nach und nach die Schultern und Ellenbogen ausrenken. Wenn sie aus den Gelenken springen, zerreißen Sehnen, und dir wird es umso schwerer fallen, die Brust zu heben und zu atmen. Durch die ausgebreiteten Arme wird der Brustkorb gedehnt, und du musst dich noch mehr anstrengen, deine Lungen mit Luft zu füllen.
Aber das alles wirst du zu gegebener Zeit am eigenen Leib erfahren. Oder du wählst den gnädigen, schnellen Tod. Sag mir, wen du hier treffen wolltest und was du mitgebracht hast, um es ihm zu geben. Wenn es nicht ein Gegenstand war, dann waren es vielleicht Informationen über einen Gegenstand. Wo er ist, wer ihn hat, wie er dorthin gelangt ist. Versteht du mich? Hast du ein Schwert mitgebracht oder Informationen über ein Schwert? Du weißt, welches Schwert ich meine, nicht wahr? Hast du ein Schriftstück gesehen, einen Brief? Einen arabisch geschriebenen Brief? Einen sehr alten Brief. Weißt du, wo das Schwert ist? Hat es Kairo verlassen? Haben deine Leute es an sich genommen oder ist es noch bei Goodrich?«
John wusste, wovon die Rede war: Ein Schriftstück wie der erwähnte Brief war ihm nicht untergekommen, aber von einem Schwert hatte er gehört, und jemand hatte ihm von Goodrich erzählt. Goodrich hatte das Schwert nicht, da war man sich ziemlich sicher. Seine Leute waren überzeugt, dass al-Masri es gestohlen hatte, und nahmen an, dass es nach Afghanistan geschafft worden war, zu Bin Laden. Deshalb hatte man ihn nach Afghanistan geschickt, um das herauszufinden. Doch er schwor sich, wenn er nur lange genug standhaft bleiben konnte, Hadschi Achmad nichts zu verraten. Zu viel – alles – hing von dem Schwert ab, davon, ob es echt war oder nicht, ob man verhindern konnte, dass es in die falschen Hände geriet. Verglichen damit hatte sein Leben nicht mehr Bedeutung als das Leben der gelben Schnecke zu seinen Füßen.
Er schwieg, also entkleideten sie ihn und trieben Nägel durch seine Füße, erst den rechten, dann den linken, und der Schmerz war furchtbarer als alles, was er je erlebt hatte. Und als sie seine Handgelenke an den Querbalken nagelten, flehte er schreiend um Gnade und machte sich nass und betete, dass der Tod ihn erlösen möge.
Stunde um Stunde hing er so da, und immer fühlte es sich an, als wäre sein Körper im Begriff, in Stücke zu brechen. Es gab keinen Teil von ihm, der nicht schmerzte wie im innersten Kreis der Hölle, als wühlten glühende Zangen in seinem Fleisch, keinen Muskel, der nicht zerrissen war oder kurz davor, zu zerreißen. Die Anstrengung, sich auf den kleinen Sitz zu hieven, brachte der überdehnten Brust und der mühsam arbeitenden Lunge einige wenige Augenblicke Erleichterung, um den Preis unbeschreiblicher Schmerzen in Knöcheln und Füßen. Doch sobald die Kraft seiner Beine erlahmte und er wieder herunterrutschte, zahlte er mit doppelter Marter in den Füßen und einem Gefühl, als füllte seine Brust sich mit flüssigem Talg.
Er bemühte sich, an etwas zu denken, was ihn von der immer größer werdenden Qual ablenken konnte – sein Zuhause in Cambridge, seine Eltern, die seinerzeit vor Männern wie Mullah Achmad geflohen waren und sich in England ein neues Leben aufgebaut hatten, June, Mary, alte Freunde, Kollegen, aber keiner dieser Gedanken hatte mehr als ein oder zwei Sekunden Bestand. Er rief sich Musikstücke ins Gedächtnis, Lieder, die ihn bewegt hatten, Jerusalem singen in der Morgenandacht in der Leys School, Gedichte, die ihm zu Herzen gegangen waren, seines Vaters Stimme, die in der Stille eines jungen Tages Iden von Hafis rezitierte, Junes Gesicht, das ihn gleich bei ihrer ersten Begegnung bezaubert hatte, aber die Erinnerungen flackerten nur kurz auf wie Meteoriten an einem schwarzen Himmel und erloschen.
Minuten vergingen, Stunden oder auch Tage, und immer noch hing er am Kreuz und glaubte, dass er im nächsten Augenblick sterben würde. Von Zeit zu Zeit gelang es ihm, die Lider zu heben, und jedes Mal sah er Hadschi Achmad, der reglos dastand und ihn stumm beobachtete. Seine Augen schwammen in Blut, vermischt mit Tränen, und Blut lief ihm in Strömen aus Nase und Ohren.
Er hatte geglaubt, er würde nicht anders können, als seine Schmerzen hinauszubrüllen, aber nein. Längst war jeder Atemzug ein mühsames Ringen gegen das Ersticken, zum Rufen, erst recht zum Schreien fehlte ihm die Kraft. Bestenfalls konnte er stöhnen und tat es, bis sein Stöhnen der einzige Laut im Universum war, und sein Körper war das Universum, und das Universum befand sich im freien Fall, haltlos taumelnd ins Nichts.
»Sprich mit mir, Mike. Ich verlange nicht viel, nur ein Wort. Einen Namen. Einen Hinweis. Sag mir, wo das Schwert sich befindet, sag mir, wer es hütet, und ich beende augenblicklich deine Qualen.«
Er bemühte sich, die Augen zu öffnen, und durch einen blutig-roten Schleier sah er seinen Henker vor sich, mittels einer Leiter oder sonstigen Vorrichtung zu ihm hinaufgelangt.
»Wie ... lange hänge ich ... schon hier ... oben?«, fragte er. Seine Stimme drang krächzend aus seiner Kehle, die rau war wie Sandpapier, jedes einzelne Wort bedeutete eine ungeheure Kraftanstrengung.
»Eine halbe Stunde«, antwortete der Mullah. »Ich komme wieder.«
Eine halbe Stunde? Ihm war es vorgekommen wie eine halbe Ewigkeit. Wie würde eine ganze Stunde sein? Wie sollte er einen Tag überstehen? Wie die lange Nacht mit eisigem Wind anstelle des Sonnenscheins?
Alles Denken erlosch. Er war nurmehr eine Maschine, die nach einem Moment der Linderung strebte oder dem Ende. Wie ein Roboter stemmte er sich hoch und sank herab; Muskelfasern und Sehnen zerrissen und Nervenstränge, abgeschürfte Haut entblößte rohes Fleisch.
Sobald er das Bewusstsein verlor, injizierte Hadschi Achmad ihm ein schnell wirkendes Medikament in den Oberschenkel. Das Stimulans hielt ihn wach, lange, unerträgliche Minuten, bis die Wirkung nachließ und er wieder in einem Abgrund aus Schwärze versank. Er hatte kein Zeitgefühl mehr. Das Maß für seine Sekunden und Minuten war Schmerz.
»Wie lange?«, fragte er mit vor Durst brüchiger Stimme. Sein Hals fühlte sich an wie mit heißem Sand gefüllt.
»Zehn Minuten«, hörte er Hadschi Achmad antworten.
»Das ... das kann ... nicht ... sein.«
»Nur ein Wort. Nur ein Name.«
Er versuchte, den Kopf zu schütteln, aber es gelang ihm nicht. Sein Herz jagte, von Hadschi Achmads Drogen wie mit Peitschenhieben vorangetrieben.
Wieder gnädige Dunkelheit, wieder qualvolles Erwachen. Sein Gesäß war zerschunden vom rohen Holz des Sitzpflocks. Er spürte, wie die Knochen seiner Hand- und Fußgelenke sich knirschend an den dicken Nägeln rieben, die ihn an das Kreuz hefteten, und der Schmerz zog von dort durch seinen ganzen Körper und sammelte sich unter dem Schädeldach, bis er glaubte, sein Kopf müsse zerspringen. Mund und Nase waren voller Blut und Schleim. Angst wühlte in seinen Eingeweiden wie ein rostiges Schwert.
Über den Gipfeln kreiste mit ausgebreiteten Schwingen ein Lämmergeier, angelockt vom Blutgeruch und der Witterung eines baldigen Todes. Der Beobachter stellte das Fernglas zur Seite, dabei achtete er darauf, dass die Linsen nicht das Sonnenlicht reflektierten. Dann zog er ein Mobiltelefon aus der Tasche und wählte eine Nummer auf der anderen Seite der Welt. Der Anruf wurde von einem der Telekommunikationssatelliten der USA weitergeleitet, die unablässig die Erde umkreisen.
»Malcolm? Hören Sie, ich glaube, er hält nicht mehr lange durch. Wenn er redet, wissen die, dass wir keine Ahnung haben, wo das verdammte Schwert abgeblieben ist. In den nächsten paar Minuten. Habe ich Ihre Erlaubnis zu handeln? Ja? Dann erledige ich die Sache jetzt gleich. Grüßen Sie Christina von mir. Ciao.«
Er beendete die Verbindung und griff hinter sich nach einem Gewehr, das bereits auf ein Dreibein geschraubt war. Er stellte es vor sich hin. Es handelte sich um ein Barrett .50, das beste Scharfschützengewehr, das zur Zeit auf dem Markt war. Mit seinem langen Lauf erzeugte es eine Mündungsenergie von annähernd 15 000 Joule, ausreichend, um einen Menschen auf eine halbe Meile Entfernung und mehr zu töten. Es war bereits früher an diesem Vormittag eingestellt worden – er brauchte nur noch zu zielen und abzudrücken. Um sich Gewissheit über die Windverhältnisse zu verschaffen und inwieweit sie die Flugbahn des Projektils beeinflussen könnten, zog er ein Anemometer zu Rate und kalkulierte den korrekten Schusswinkel.
Unten im Tal beobachtete Hadschi Achmed die schwächlichen Bewegungen des Gekreuzigten und begriff, dass er eine Entscheidung treffen musste, und zwar rasch. Wartete er ab, starb sein Gefangener demnächst an Herzversagen oder erstickte und nahm sein Wissen mit in den Tod. Oder er quälte sich noch einige weitere Stunden. Im Gegensatz zu dem, was Hadschi Achmad behauptet hatte, hing Smith nicht erst Minuten am Kreuz, sondern bereits drei volle Stunden. Er hatte außerordentliche Zähigkeit bewiesen, aber nun lief seine Zeit ab.
Er stieg erneut die Leiter hinauf und versprach dem Gefangenen wieder einmal ein Ende seiner Leiden, die Erlösung von irdischer Pein.
Im selben Augenblick ertönte aus dem klaren Himmel, aus dem Revier von Adlern und Falken, aus den fernen Bergen, ein scharfer Knall. Die Kugel traf das Kinn des sterbenden Mannes, durchschlug den Unterkiefer, zerstörte das Kleinhirn und tötete ihn auf der Stelle. Kein Aufschrei, kein Röcheln, er sackte einfach in sich zusammen; Blut stürzte aus der Wunde über seine Brust.
Hadschi Achmad sprang mit einem Satz von der Leiter und warf sich flach auf den Boden. Seine Kameraden folgten seinem Beispiel. Doch dem einen Schuss folgte kein zweiter. Mit Augen, die an dieses zerklüftete Terrain gewöhnt waren, suchten sie die Bergflanken ab, doch sie konnten nichts entdecken, und kein Geräusch verriet den Standort oder auch nur die Anwesenheit des Scharfschützen.
Hadschi Achmad stand halblaut fluchend auf und klopfte sich den Staub von den Kleidern. Die Treffsicherheit, dachte er, war eines Afghanen würdig, aber kein Afghane besaß ein Gewehr, dass auf diese Entfernung mit solcher Genauigkeit ins Ziel traf. Er hielt es nicht einmal für der Mühe wert, Leute loszuschicken, um den Schützen aufzuspüren: Wer immer diese Tat ausgeführt hatte, hatte auch seinen Rückzug vorbereitet, über perfekt abgesicherte Stationen von hier bis London. Oder sogar bis Washington.
3In der Siegreichen Stadt
Zwei Monate zuvor.
Kairo, Ägypten
Montag, 18. September
14.05 Uhr
Kairo war heiß und stickig, in der Luft hing der Staub der Wüste, die lehmgelben Fluten des Nil wälzten sich träge durch ihr Bett. Von Norden nach Süden, von Osten nach Westen waberte über der riesigen Stadt eine Kakophonie aus dem Tosen der Menschen- und Automassen, heiserem Eselsgeschrei, knatternden Motorrädern und den krächzenden Lautsprechern von fünfzehntausend Moscheen. Dies war die größte Stadt in ganz Afrika; was die Bevölkerungsdichte anging, stand sie an dreizehnter Stelle unter den Städten der Welt. Fünfzehn Millionen Menschen drängten sich auf den beiden schmalen Uferstreifen des Nils.
Jack Goodrich war Engländer, nominell Mitglied der anglikanischen Kirche und Absolvent des King’s College in Cambridge, doch seit vielen Jahren betrachtete er sich als einen von diesen fünfzehn Millionen, einen Bürger dieser lebensprallen Metropolis. Kairo war ohrenbetäubend, dreckig, übelriechend, heiß, staubig und ungepflegt, doch er liebte dieses geballte urbane Chaos mit beinahe religiöser Inbrunst.
Er hatte kaum in dem abgewetzten Ledersessel des Bartscherers Platz genommen, als die erste Bombe hochging. Der Barbier, ein geschäftstüchtiger Mann in mittleren Jahren namens Al Hamid, fluchte leise in irischer Sprache, pog ma hon. Das alte Fluchwort hatte ihm vor vielen Jahren ein irischer Professor beigebracht, mit der Garantie, dass 99,9% der restlichen Erdbevölkerung keine Ahnung haben würde, was es hieß.
Jack als Engländer und berühmt für seinen stoischen Gleichmut, ignorierte die Bemerkung. Er wusste natürlich, was es bedeutete, pog ma hon, wie jeder an der Universität, doch hatte er es sich Ali gegenüber nie anmerken lassen.
»Was zum Henker war das?«, rief er.
Ali, der Inhaber des kleinen Barbierladens in der Nähe der Amerikanischen Universität, zog es vor, nicht über die Bombenanschläge nachzudenken, die seit Monaten die Stadt immer wieder in Angst und Schrecken versetzten. Sie waren schlecht fürs Geschäft.
»Das war woanders, nicht hier«, beruhigte er seinen Kunden, aber sie wussten beide, dass es überall gewesen sein konnte: eine kleine Bombe in der Nähe, eine große Bombe weiter weg und eine beliebige Anzahl von Kombinationen dazwischen. Vielleicht hatte ein Selbstmordattentäter sich das Paradies verdient, oder man hatte per Fernzündung ein Auto in die Luft gesprengt.
Gleichmut hin oder her, Goodrich hatte Angst. Seine größte Sorge war, der Anschlag könnte der amerikanischen oder britischen Botschaft gegolten haben, beide ganz in der Nähe, gleich gegenüber am anderen Flussufer. Seine Frau arbeitete als Sekretärin in der britischen Botschaft. Seit sie in Kairo lebten, quälte beide Goodrichs eine gemeinsame, stets präsente Befürchtung – dass der eine oder der andere einem Terroranschlag zum Opfer fallen könnte, entweder sie in der Botschaft oder er in der Universität.
»Bleiben Sie hier, Professor«, meinte Ali. »Die Bombe kann überall hochgegangen sein. Es ist zu früh für Nachrichten, aber ich lasse das Radio an, für die ersten Eilmeldungen.«
Er redete Arabisch mit diesem Kunden, die in Ägypten gebräuchliche Variante, die Goodrich so umfassend beherrschte, wie einem Ausländer irgend möglich. Im Lauf der Jahre hatte er beim Haareschneiden und Rasieren in Alis Barbierstube mehr Kairo-Arabisch gelernt, als in dem seinerzeit vom Fachbereich angebotenen, kostenpflichtigen Sprachkurs.
Ali hatte sich in Positur gestellt, den Rasierpinsel in der erhobenen Hand, bereit, ans Werk zu gehen. Er war die Primadonna unter den Barbieren, falls es so etwas gibt. Auf einer Bühne wäre er stolziert. Der Rasierschaum umschmiegte den Pinsel wie ein üppiger Klecks glatt und glänzend geschlagener Sahne. Goodrich schüttelte den Kopf.
»Ich versuche anzurufen. Wenn sie drangeht, ist alles in Ordnung.«
In der letzten Woche hatte es mehrere Anschläge gegeben, die meisten gegen ausländische Ziele gerichtet.
Er nahm sein Handy heraus und wählte. Nichts. Er schaute auf den Signalbalken.
»Ali, was soll das? Ich habe ein Netz gegenüber auf dem Universitätsgelände. Ich habe ein Netz nebenan, im Café Faruk ...«
Ali zuckte die Schultern.
»Das ist doch jedes Mal so«, sagte er. »Sie müssen Geduld haben.«
Er beugte sich vor und schaltete das Radio aus.
»Versuchen Sie es jetzt.«
Diesmal klingelte es, und Emilia meldete sich.
»Liebe Güte, Jack. Hier ist gar nichts passiert. Die Explosion war am anderen Ufer, beim Englisch-Amerikanischen Krankenhaus. Wir warten noch auf einen Bericht über die Opfer.«
»Arbeitet Dr. Fathi nicht dort?«
»Ja, und seine Frau ebenfalls, als Krankenschwester. Jack, das geht nicht so weiter mit deinen Panikanrufen. Jedes Mal, wenn in Kairo eine Bombe hochgeht, klingeln hier sämtliche Telefone wie wild. Du solltest mittlerweile wissen, dass dies hier einer der sichersten Orte im ganzen Mittleren Osten ist. Mogadischu und der Libanon und Bagdad sind uns eine Lehre gewesen.«
»Ich mache mir eben Sorgen, weiter nichts. Und geh mir weg damit, wie sicher die Botschaft ist, oder wie viel eure Leute in Beirut gelernt haben. Ein Selbstmordattentäter kommt überallhin, wo er hin will, wenn er es will.«
»Irgendwann musst du mal probieren, an unseren Sicherheitsposten vorbeizukommen, dann wirst du schon sehen. Übrigens, solltest du nicht arbeiten?«
»Ich bin bei Ali und lasse mich rasieren.«
Emilia kannte Ali nicht. Die kleine Barbierstube war ausschließlich männliches Territorium.
»Dann sag ihm, er soll etwas weniger großzügig mit seinem Rasierwasser umgehen.«
»Warum?«
»Wenn du Glück hast, erfährst du’s heute Abend. Jetzt möchte mein Chef mir etwas diktieren.«
Sie legte auf. Jack drückte die »Beenden«-Taste an seinem Handy und steckte es zurück in die Tasche.
Ali glättete den gestreiften Frisierumhang, den er Jack umgelegt hatte, und schlug noch einmal frischen Schaum in seiner alten, gesprungenen Tasse. Niemand verstand sich aufs Einschäumen wie Ali. Goodrich hatte ihm einmal empfohlen, sich einen Dachshaarpinsel zuzulegen, aber der Barbier hatte freundlich erklärt, Dachse wären nach religiösen Gesetzen unrein, was bedeutete, man durfte sie weder verzehren noch berühren.
Auf seine Weise war Ali gläubig. Er betete fünfmal am Tag, fastete während des Ramadan, ging am Freitagmittag in die Moschee des Viertels und lauschte dösend der Predigt. Und was das Wichtigste war, er unternahm alle drei oder vier Jahre eine Pilgerfahrt – nicht nach Mekka (das sparte er sich für den Ruhestand auf), sondern zum alljährlich stattfindenden Mulid-Fest am Grabmal des großen ägyptischen Heiligen, Sidi Achmad al-Badawi.
Er zog mit hingebungsvoller Ausdauer die Klinge des Rasiermessers an dem Riemen ab, der allein seinem Gebrauch vorbehalten war. Erst wenn die Schneide perfekt war, pflegte er mit einer Rasur zu beginnen. Das gefiel ihm am besten an seinem Beruf: dass seine Kunden ihm vertrauten. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten von ihnen Lehrer an der Amerikanischen Universität waren, überwiegend US-Amerikaner und Briten, konnte er sich auf dieses Vertrauen einiges zugutehalten. In Algerien hatten die religiösen Eiferer das Durchschneiden von Kehlen zu ihrem Markenzeichen gemacht. Und nicht nur die Fremden lebten gefährlich. In Bagdad mussten Barbiere, die Ungläubigen den Bart schoren, damit rechnen, dass man auch ihnen die Kehle aufschlitzte.
Als Ali sich daran machte, die Stoppeln von Goodrichs Wangen zu schaben, kam in den Radionachrichten die Meldung, im Carrefour Supermarkt hätte es eine Explosion gegeben, in der Maadi Mall im Süden der Stadt. Momentan gäbe es noch keine genaueren Informationen. In der folgenden Stille hörte man draußen nah und fern die Sirenen von Polizei, Ambulanz und Feuerwehr. Dies war die größte Stadt Afrikas, aber jedes Mal, wenn der Chor der Sirenen ertönte, schien sie auf eine Handvoll Straßen und Gassen zusammenzuschrumpfen.
4Der Brief
Kairo
14.30Uhr
Draußen auf der Straße erlebte er für einen Augenblick die Panik, die alle Nicht-Einheimischen in Kairo überfällt: zu viel Verkehr, zu viele Menschen, zu viel Lärm und Staub, zu viele Gerüche. Er stand auf dem Bürgersteig am Tahrir Square, dem größten öffentlichen Platz der Stadt. Wuchtige Mercedes Limousinen (»Hühnerärsche« im hiesigen Straßenjargon) versuchten sich mit bösem, scharfem Hupen gegen Busse durchzusetzen, die Busse schüchterten röhrend alles ein, was ihnen den Weg zu versperren drohte, Mopeds fegten in tollkühnen Schlangenlinien – und oft zu ihrem Verhängnis –, durch die Lawine der Blechkarossen, und wo er hinschaute, sah Goodrich junge Männer in Jeans und Kinder in ausgeleierten Pullovern, alte Frauen in schäbigen Dschellabas, junge Frauen mit Kopftuch, die alle ihr Leben aufs Spiel setzten, nur um die andere Straßenseite zu erreichen.
Er musterte seine Umgebung: Verkehrszeichen mit einer Patina aus dem Schmutz und Rost vieler Jahre, Werbeplakate für die neusten Produkte der ägyptischen Filmstudios, Ladenschilder in Arabisch und gebrochenem Englisch, Lichtreflexe auf schmutzigen Fensterscheiben, niedersinkender Staub in Sonnenstrahlen. Hier starrte das Antlitz des Sphinx ausdruckslos ins Leere. Dort schaute eine junge Schauspielerin namens Basma mit ihren großen Augen und einem verführerischen Lächeln auf die Passanten herab. Ringsumher schmückten die anmutigen Bögen und Schnörkel arabischer Buchstaben den Platz. Vergangenheit und Zukunft reichten sich an jeder Ecke die Hände. Zeit hatte hier keine Bedeutung.
Er ging an Ladentüren vorbei, aus denen die neusten ägyptischen Popsongs wummerten, vorbei an einem Bettler mit heischend ausgestreckter Hand, dem er etwas Geld gab, ein ägyptisches Pfund. Nicht viel, dachte er, nur ein paar Pennies, umgerechnet. Aber hier konnte man mit wenig lange auskommen.
Er schaute auf die Uhr. Halb drei. Bald würde es langsam ein wenig kühler werden, jetzt aber war es noch heiß, staubig und laut, und es gab davor kein Entkommen. Die meisten Kairoer lebten ihr Leben in einem einzigen Zimmer, ganze Familien vegetierten auf lächerlich engem Raum, wo Babys plärrten, alte Männer und Frauen sich an ein elendes Dasein klammerten, junge Männer und Frauen im Halbdunkel stumm kopulierten, ohne Freude. In der islamischen Nekropole, am Rand der Stadt der Lebenden, hausten die Ärmsten in den Gräbern und teilten ihre kümmerliche Existenz mit den lange Dahingeschiedenen.
Er nahm sein Handy und versuchte Emilia zu erreichen. Sie meldete sich nicht. Er rief in der Vermittlung an.
»Ich fürchte, sie ist in einer Konferenz, Sir.«
»Vielen Dank. Ich rufe später wieder an.«
Er steckte das Handy ein. Alles in Ordnung: Die Botschaft stand noch.
Zurück in der Universität, wartete der ganze Stapel der Morgenpost auf ihn. Miss Mansy steckte den Kopf zur Tür herein, um Bescheid zu geben, dass sein Kurs um 16.00 Uhr über Verbformen im Südarabischen des 7. Jahrhunderts abgesagt worden war.
Er ließ es sich nicht nehmen, Miss Mansy nachzuschauen, wie sie den Flur hinunterging, genauer gesagt, ihrem Allerwertesten. Man war einmütig der Ansicht, sie hätte das schönste Hinterviertel in Kairo, und in einer Stadt, wo die meisten Frauen sich immer noch von Kopf bis Fuß verhüllt in der Öffentlichkeit bewegten, war das eine ernste Sache. Einige der ägyptischen Studenten verfielen ihr mit Haut und Haaren und litten unendliche Liebespein um Miss Mansy. Sie hingegen hegte seit langem den festen Entschluss, sich einen amerikanischen Professor oder reichen Mann zu angeln, der sie von ihrem Dasein als Fakultätssekretärin erlöste.
Goodrich schloss die Tür und begab sich ohne rechte Begeisterung zu seinem Schreibtisch. Er dachte, dass es für ihn einer mittleren Katastrophe gleichkäme, wenn Miss Mansy kündigte oder wenn Soziologie oder Englisch sie ihm wegschnappten. Sie alle waren scharf auf sie, denn, Augenweide oder nicht, sie galt zu Recht als die beste Sekretärin der ganzen Universität. Sie hatte einen Abschluss in Arabisch, beherrschte fließend fünf Dialekte sowie die moderne Schriftsprache, und sie war mit alleinstehenden männlichen Angehörigen verschiedener Fakultäten ausgegangen. Ein Juwel. Unersetzlich. Und heißer als eine Horde Affen.
Seufzend setzte Goodrich sich vor den Stapel eingegangener Post, der seiner harrte. Über die letzten Tage hinweg hatte sich einiges angesammelt, und er wusste kaum, wo er anfangen sollte. Er fischte den Brieföffner aus der Schreibtischschublade. Wie gewöhnlich war das meiste Makulatur. Interessantes kam heutzutage per E-Mail. Etliche Bücherkataloge waren dabei, auch einer mit antiquarischen Büchern, die weder er persönlich noch die Universität sich leisten konnten.
Jack war mittlerweile seit fünf Jahren Professor für mittelalterliches Arabisch an der AU. Das Angebot war aus heiterem Himmel gekommen, kurz nach Emilias Versetzung an die Botschaft. Davor hatte er glücklich und zufrieden in London gelebt, wo sie im Außenministerium tätig war. Die Versetzung nach Kairo bedeutete für sie eine Beförderung, und dass er sie nun begleiten konnte und sich gleichzeitig beruflich verbessern, war geradezu perfekt. Sein Lehrauftrag an der Schule für orientalische und afrikanische Studien lief ins Leere. Geld war knapp, wie überall auf dem Universitätssektor, anderswo wurden Fachbereiche gekappt, und mit vierzig Jahren brauchte er sich kaum mehr Hoffnung auf eine Beförderung im akademischen Betrieb zu machen, geschweige denn auf eine Bestallung auf Lebenszeit.
Er hatte sich erst spät der akademischen Laufbahn zugewendet. Seine erste Liebe war die Armee gewesen. Mit siebzehn war er eingetreten, drei Jahre später ging er von seinem Heimatregiment, den Royal Anglians, zum SAS, dem Special Air Service. Seinem Einsatz im Irak während des ersten Golfkriegs war ein mehrmonatiger Lehrgang für Arabisch an der Militär-Sprachschule in Buckinghamshire vorausgegangen, den er als Bester seiner Klasse abschloss. Sein Lehrer fand, er hätte eine Begabung für Arabisch. Am Ende des Krieges hatte er genug Tod und Gewalt gesehen, um für den Rest seines Lebens damit bedient zu sein. Seine jugendliche Begeisterung für militärische Dinge war stilleren Leidenschaften gewichen, einer Begeisterung für Lernen und Wissen, speziell auf die arabische Kultur bezogen.
Emilia traf er bei der Eröffnungsfeier für eine Ausstellung von Koranmanuskripten, die er in seiner Zeit an der Schule für orientalische und arabische Studien zu organisieren geholfen hatte. Er stand allein mit einem Glas Wodka in einer Ecke des Raums, als sie zu ihm trat und ein Gespräch begann, welches nach fünfzehn Jahren immer noch frisch und lebendig weiterging. In derselben Nacht schliefen sie das erste Mal miteinander, und auch darin hatte sich noch kein Überdruss eingeschlichen.
Er begann die nächste Schicht Briefe abzutragen. Ein Haufen Werberundschreiben wanderten zusammengeknüllt und ungelesen in den Papierkorb.
Beinahe ganz zuunterst befand sich ein Brief von seinem Freund, dem Gelehrten und Buchhändler Mehdi Mussa. Wie alle von Mussas Briefen war er in der elegantesten arabischen Kalligraphie abgefasst, der Ruq’a-Schrift. Die Sprache war blumig, beeinflusst von den erlesensten klassischen Vorbildern. Nach mehreren Zeilen verschnörkelter Wendungen aus dem Werk von Al-Hariri und anderen Meistern gehobener Prosa kam Mehdi zu seinem eigentlichen Anliegen.
»Sehr verehrter Herr Professor«, schrieb er, »ich bedaure zutiefst, dass ich mich genötigt sehe, Ihre wertvolle Zeit in Anspruch zu nehmen. Desungeachtet wäre ich überaus glücklich, wenn Sie es irgend ermöglichen könnten, mich in meinem Laden aufzusuchen, sehr gern am Montag, nachmittags, gegen 17.00 Uhr. Ich habe etwas, das ich Ihnen zeigen möchte. Bisher habe ich es noch keinen anderen sehen lassen, teils aus Freundschaft, teils, um mich zu schützen. Ich weiß, Ihnen kann ich vertrauen, deshalb diese Einladung und diese besondere Gelegenheit, in Augenschein zu nehmen, was ich Ihnen zeigen werde. Ich versichere Ihnen, Sie werden Ihre Zeit nicht als vergeudet betrachten. Wie das Sprichwort sagt: ›Glaube, was du siehst und vergiss, was du weißt‹.
Falls Sie nicht geneigt sind oder sich nicht in der Lage sehen, meiner Einladung Folge zu leisten, werde ich mich umgehend an einen anderen Interessenten wenden. Doch würde ich es sehr begrüßen, wenn Sie der Erste wären, dem ich es vorlege und dessen Urteil ich vernehme. Ich werde bis 18.00 Uhr warten, und wenn Sie bis dahin nicht gekommen sind, werde ich mich anders orientieren.«
Jack legte das Blatt seufzend auf den Schreibtisch. Garantiert wollte der alte Knabe ihm ein weiteres Manuskript des Kitab al-Buchala präsentieren, ein Text aus dem 9. Jahrhundert, der dem Buchhändler besonders am Herzen lag. Doch selbst angenommen, dass es sich wirklich um eine Kostbarkeit handelte, sah er seine Hände gebunden: Das Budget des Fachbereichs war noch knapper bemessen als sonst, und er war überzeugt, der stets präsente Bedarf für die Dinge der grundlegenden Ausstattung wog schwerer als der Luxus, noch ein Manuskript oder noch eine Lithographie zu erwerben. Andererseits, Mussa war ein schlauer Manipulator. Er kannte das Budget seiner Klienten bis auf den letzten Piaster. Nie würde er etwas zeigen, von dem er nicht glaubte, es auch verkaufen zu können, und er hatte Goodrich als den Kunden ausgewählt, von dem am ehesten ein lohnendes Angebot zu erwarten war. Sein Kurs für diesen Nachmittag war ohnehin abgesagt, deshalb blickte Jack erwartungsvoll seinem Treffen mit dem Buchhändler entgegen. Nicht in seinen schlimmsten Träumen hätte er sich vorgestellt, welche Folgen diese Verabredung haben würde.
5Der Ägypter
Das al-Manar Gebetshaus
Ischak Allee
Imbaba
Kairo
Montag, 18. September
15.00 Uhr
In den Straßen spielten Kinder auf Müllbergen. In provisorischen Wohnblocks aus Lehm und Backstein hausten Familien zu dreißig Personen in einem Zimmer, und in den engen, von Gestank und Verwesung erfüllten Gassen, war der Boden in ständiger Bewegung, wie Treibsand, und schillerte von den Leibern von zehn Millionen Fliegen. Wenn es still war, sangen ihre Flügel ein Lied, ein trauriges Lied von Elend und Verwahrlosung. Dicker schwarzer Qualm aus nahe gelegenen Fabriken durchwaberte die glutheiße Luft. Imbaba war eine Bruststätte für Krankheiten. Krankheiten und Religiosität.
In den 90er Jahren war Imbaba ein Staat im Staate gewesen. Spaßvögel nannten es die Islamische Republik Imbaba und waren damit gar nicht weit von der Wahrheit entfernt. In dem unübersichtlichen Labyrinth der kaum fertiggestellt, schon vom Verfall gezeichneten Häuser und oft genug ins Leere laufenden, schmalen Straßen, bildeten radikale Islamisten die Regierung, sprachen Recht nach den strengen Regeln des Koran, belegten Christen mit Steuern, bestraften Kriminelle und speisten die Armen. Es hatte ausgesehen, als wären sie unantastbar. Dann hatten die Sicherheitskräfte zugeschlagen und sie in einer Serie rasch aufeinanderfolgender Razzien aus den Verstecken getrieben, jeden Mann mit langem Bart und kahl rasiertem Kopf verhaftet, jede dicht verschleierte Frau, und ins Gefängnis geworfen, um dort zu verrotten oder gefoltert zu werden.
Heute, mehr als zehn Jahre danach, waren sie wieder da, doch anders als vorher. Diese neuen militanten Gruppen waren schlau. Sie benutzten Handy und Laptop, sie hatten überall ihre Spione, und sie agierten hinter den Kulissen. Ihr Ehrgeiz beschränkte sich nicht darauf, in Imbaba das Sagen zu haben, sie strebten die Weltherrschaft an. Sie organisierten sich in Zellen und verrichteten ihre Arbeit in aller Stille; sie rekrutierten nur die Ergebensten, bestraften Ungehorsam und Verrat mit dem sofortigen Tod. Jeden Freitag versammelten sie sich in kleinen Zimmern zum Gebet, geschützt vor neugierigen Blicken. Zu anderen Zwecken trafen sie sich an geheimen Orten, die nur durch ein Labyrinth stinkender Gassen zu erreichen waren oder durch Gänge tief unter der Erde.
Wie zum Beispiel dieser Gebetsraum in einem am Ende einer Sackgasse gelegenen Wohnhauskomplex namens Haij Fatima. Die ganze Wohnung war das Hauptquartier einer Zelle der kleinen, aber gefährlichen Organisation mit dem schlichten Namen al-Dschaisch: Die Armee. Die Wände waren dünn, man hörte die Geräusche aus den Wohnungen in den oberen Stockwerken – Babygeschrei, ein streitendes Ehepaar, das Radio eines Teenagers. Von der Straße drang das Knattern eines Mopeds herein, dann das Rufen von Jungen, die nach dem Unterricht in der Koranschule nach Hause rannten. Ein paar hatten bereits einen Ball aus Lumpen gefunden und kickten ihn zwischen sich hin und her.
Neun Männer hockten im Kreis auf dem billigen Teppichboden, mit dem der Raum ausgelegt war. Ihre äußere Erscheinung wirkte ärmlich, doch anders als bei so vielen, die ebenfalls in Armut lebten, war ihre Kleidung fleckenlos, der Bart sauber gestutzt, der Kopf frisch geschoren. Männer wie diese übten sich in Bedürfnislosigkeit, gleich dem Propheten, der auf einer Strohmatte schlief, sich von einer Handvoll Datteln täglich ernährte und seinen Durst mit Wasser stillte. Sie wollten sein wie er. Er war ihr Vorbild in allem. Ihre Verehrung für ihn war grenzenlos. Sie hatten feierliche Eide geschworen, seine Ehre mit ihrem Leben zu verteidigen.
Ein Mann stach unter den anderen hervor. Er war gekleidet wie sie, er trug Haar und Bart wie sie und hielt wie sie eine Gebetskette aus Plastik in der rechten Hand. Und doch war er anders. Man sah auf den ersten Blick, dass er ihr Anführer war. Es zeigte sich in seinen Augen, in dem Zug um seinen Mund, in seiner aufrechten Haltung, in der Ruhe, die er ausstrahlte. Seine Finger spielten nicht mit den Perlen, wie es bei einigen anderen im Kreis zu beobachten war. Er rutschte nicht unruhig hin und her. Seine Reglosigkeit glich der marmornen Starre eines Standbilds. Allein seine Augen bewegten sich, und sie bewegten sich langsam, musterten der Reihe nach jeden Einzelnen, als wäre er einer der beiden Engel, die kommen, um den Verstorbenen im seinem Grabe zu befragen.
Er zählte vierzig Jahre, und sein Gesicht trug die Spuren eines Lebens als Kämpfer für al-Qaida in Afghanistan und Irak. Er hieß Mohammed wie der Prophet, und sein Familienname lautete al-Masri: Der Ägypter. Mohammed der Ägypter. Jedermann. Ein ganz einfacher Name. Jedoch kein einfacher Mann.
Ungeachtet seines Namens war Mohammed al-Masri nicht irgendjemand, wie Dokumente, seit Jahrhunderten im Besitz seiner Familie, bezeugten. Er war ein lebender Nachkomme des letzten großen Kalifen aus dem Geschlecht der Abbasiden, den Herrschern aus Tausendundeinernacht, deren Palast in Bagdad einst das Staunen der Welt gewesen war. Mohammeds Vorfahre wurde von den Mongolen getötet, als sie 1258 Bagdad eroberten. Man ließ ihn, eingerollt in einen Teppich, von Pferden zerstampfen, so dass die abergläubischen Eroberer von sich sagen konnten, sie hätten nicht das Blut eines Königs vergossen.
Nur einer aus der Familie des Kalifen, ein Knabe, Achmad, war dem Morden und der Zerstörung entkommen. Achmad floh aus der brennenden Stadt des Friedens und machte sich auf nach Kairo, mit sich führte er Dokumente, den Nachweis seiner Herkunft. Diese selben Schriftstücke hatte al-Masri von seinem Vater erhalten, kurz vor dessen Tod vor einigen Jahren. Darunter befand sich ein von Achmad handschriftlich verfasstes Testament, worin er seinen Sohn zum nächsten Kalifen bestimmte und danach dessen Söhne in direkter Linie, bis endlich Allah das Ende der Welt beschließt.
In seinen Augen und denen seiner Getreuen war Mohammed ein wahrer Führer des Islam, welcher berufen war, das Kalifat wiederzuerrichten und den letzten Dschihad gegen den ungläubigen Westen auszurufen. Er würde zu Ende bringen, was der Prophet im siebten Jahrhundert begonnen hatte, nämlich sämtliche Nationen unter der Herrschaft des einen Gottes zu vereinen.
Eins fehlte ihm noch, ein bestimmter Gegenstand, den er in seinem Besitz haben musste, bevor er es wagen konnte, aus dem Schatten zu treten, sich zu offenbaren und die Muslime der ganzen Welt aufzurufen, ihn in seiner heiligen Mission zu unterstützen. Er wusste seit Jahren von der Existenz dieses besonderen Gegenstands, und seit kurzem glaubte er auch zu wissen, wo er zu finden sein könnte. Er schloss die Augen, murmelte ein kurzes Gebet und öffnete sie wieder. »Gott sei gelobt«, begann er. »Einundsechzig Tote gab es bei den Explosionen heute. Jeder unserer Märtyrer hat Ungläubige mit sich genommen. Die Ungläubigen sind in die Dschahannam hinabgestürzt, den tiefsten Abgrund der Hölle. Die Märtyrer sind aufgefahren ins Paradies, wo sie Wein trinken, der nicht berauscht, und sie ergötzen sich an Jungfrauen mit einer Haut wie goldener Honig.«
»Allahu akbar!«, riefen die Versammelten, »Gott ist größer.« Einer der Märtyrer, der sechzehnjährige Hamid, war von ihrer Zelle rekrutiert worden, dem harten Kern der Bewegung. Für seine Familie war gesorgt. Al-Masris Gefolgsleute mochten bettelarm aussehen, sie trafen sich vielleicht in einer schäbigen Kammer in einem Slum, sie setzten vielleicht Besitzlosigkeit gleich mit Gottgefälligkeit, aber die Organisation hatte wohlhabende Gönner, fromme Männer und Frauen, die es sich leisten konnten, eine auf lange Sicht angelegte Terrorismuskampagne zu finanzieren. Der Koran fordert die Gläubigen auf, in den Heiligen Krieg zu ziehen, aber nicht nur das, er verlangt auch, dass sie ihre irdischen Güter hergeben, um anderen zu ermöglichen, sich dem Kampf anzuschließen.
»Aber Gott erwartet mehr von uns als dies. Die Amerikaner, die Juden, die Kreuzfahrer allerorten werfen immer noch ihren Schatten auf die Gläubigen. Hier einige auszumerzen und einige dort ist nicht genug. Die Zwillingstürme zu zerstören war nicht genug. Wir müssen einen Schlag führen, der sie in die Knie zwingt. Wir müssen ihre Städte dem Erdboden gleichmachen, so wie Gott Sodom und Gomorrah vernichtet hat. Wir müssen ihre Könige und Präsidenten in das Reich Satans stürzen. Bald wird die Zeit gekommen sein, meine Freunde. Ihr werdet es mit eigenen Augen sehen.«
Er lächelte, und wenn er das tat, verwandelte ein Strahlen den strengen Ernst seines Gesichts. Es war nicht das Lächeln eines Politikers. Es war ohne Falsch. Es entwaffnete mit seiner Offenheit, seiner ungeheuchelten Aufrichtigkeit. Mohammed al-Masri war eben deshalb gefährlich, weil er nicht das Wesen eines Politikers besaß. Er würde niemals Kompromisse machen, nie verhandeln, nie versprechen, was er nicht auch halten konnte.
»Jetzt«, sagte er, »erstattet mir Bericht.«
Einer nach dem anderen legten die Anwesenden Rechenschaft ab über die Arbeit der Abteilung, der sie vorstanden, nicht allein in Imbaba, sondern verstreut über ganz Kairo. Al-Masris Zelle war der Kopf und setzte sich zusammen aus seinen Leutnants, zu denen auch sein jüngerer Bruder gehörte. Für alle anderen Mitglieder der Bewegung war er ein Schatten. Keiner seiner Gefolgsleute, ausgenommen diese acht Männer, hatte je sein Gesicht gesehen. Außerhalb dieses engen Kreises kannte man ihn nur als Mohammed. Seine wahre Identität war ein wohlgehütetes Geheimnis.
Raschid bemerkte sie zuerst. Die schleichend sich ausbreitende Stille. Das Kind hörte auf zu schreien, aber das war kaum befremdlich. Das Radio wurde abgestellt, aber wer wollte es der Mutter des Halbwüchsigen verdenken, wenn sie irgendwann die Geduld verlor. Der Wortwechsel des streitenden Paares verstummte, aber kein Streit geht endlos weiter.
Raschid lauschte, und ihm fiel auf, dass nichts Neues die eben entstandenen Lücken in der Geräuschkulisse füllte. Ihm wurde bewusst, dass er schon seit längerem kein Moped mehr gehört hatte und auch nicht das Geschrei von spielenden Kindern.
Er hob die Hand und unterbrach den Vortrag seines Nebenmannes.
»Seid mal still«, sagte er. »Hört ihr was?«
Nichts.
Sie schauten sich an. Totenstille ringsumher. Alle wussten, was das bedeutete.
»Schnell!«, befahl al-Masri. »Nach nebenan. Rasch!«
Ohne Panik begaben sich die Acht der Reihe nach in das angrenzende Zimmer, das wie ein normaler Wohnraum eingerichtet war. Raschid lief zu dem Fenster mit vorgelegtem Laden, das zur Straße hinausging, und entfernte die Metallscheibe vor einem Guckloch, durch das er nach draußen spähen konnte.
»Polizei!«, zischte er.