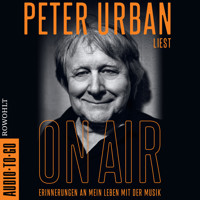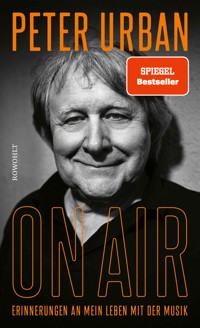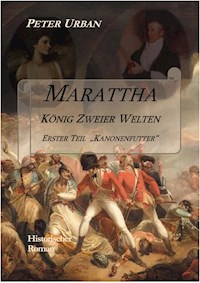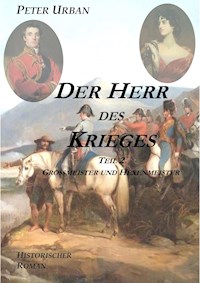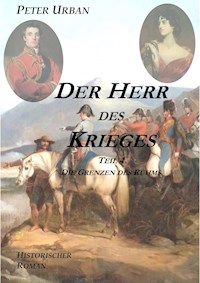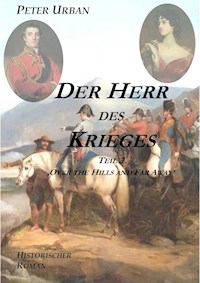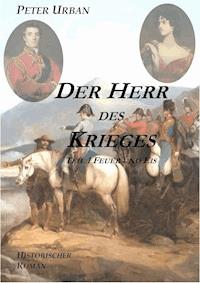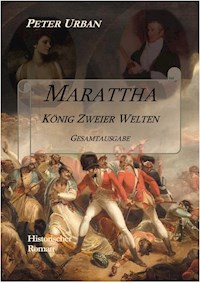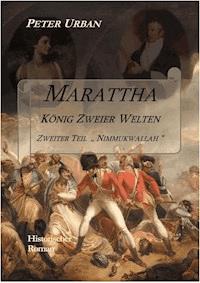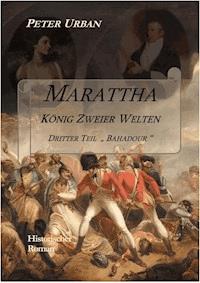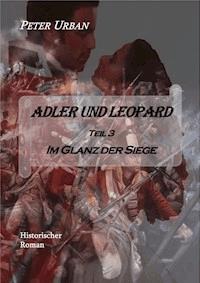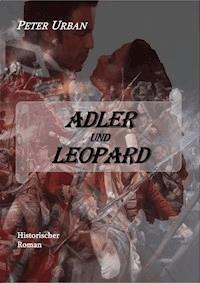6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannend und gut recherchiert: Ein Reise durch Russland zur Zeit des Zaren Peter I. 1696: Vor der türkischen Festung Azov am Schwarzen Meer steht der junge Zar Peter vor einer ausweglosen Situation. Sein erster Feldzug scheint zum Scheitern verurteilt. Nur dank der Hilfe von Peter Schaffirow, einem versehentlich zwischen die Fronten geratenen Diamantenhändler jüdischen Glaubens, gelingt die Einnahme. Als Dank für dessen Dienste stellt der Zar Schaffirow zunächst in niederen Diensten unter seine Fittiche - und macht ihn im Verlauf zum Chef seines Geheimdienstes. Die beiden Männer werden im Lauf der Jahre und auf zahlreichen Eroberungszügen zu Vertrauten - und zu erbitterten Rivalen, als die große Politik und die Liebe einen Keil zwischen die Freundschaft treibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 777
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Peter Urban
Das Schwert des Zaren
Historischer Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Russland im Winter 1694: Als Zar Peter I. vor der Festung von Azov kurz vor einer Niederlage gegen die Türken steht, spielt ihm der jüdische Diamantenhändler Schafirow aus Amsterdam eine kriegsentscheidende Information zu, um seine eigene Haut zu retten. Der Zar nimmt die Festung ein und ist von seinem neuen Freund so angetan, dass er den Mann nicht, wie versprochen, ziehen lässt, sondern ihn als Spion in seinen Dienst stellt. Für Schafirow beginnt ein kometenhafter Aufstieg im verworrenen und undurchschaubaren Labyrinth der russischen Machtpolitik. Doch dann begeht er einen entscheidenden Fehler …
Spannende historische Unterhaltung von Peter Urban!
Inhaltsübersicht
Das Schwert des Zaren
Prolog – 1692
Erster Teil – Sturm im Osten
Kapitel 1 – Die Hölle von Asow
Kapitel 2 – Im Dienste des Zaren
Kapitel 3 – Anna
Zweiter Teil – Das Dritte Siegel
Kapitel 4 – Der Strelitzenaufstand
Kapitel 5 – Narwa
Kapitel 6 – Machtspiele und Verrat
Kapitel 7 – Geheimdiplomatie
Dritter Teil – Die Schatten von Poltawa
Kapitel 8 – Masepa und Jewdokija
Kapitel 9 – Der Zar und der Soldatenkönig
Kapitel 10 – Das Verhängnis am Pruth
Vierter Teil – Im Schatten der Finsternis
Kapitel 11 – Der Zarewitsch
Kapitel 12 – Der geheimste Dienst
Kapitel 13 – Die Verschwörung
Kapitel 14 – Nemesis
Epilog – Der Fluch des Zarewitschs
Anmerkungen zum historischen Hintergrund
Glossar
Das Schwert des Zaren
»Wir werden Europa für einige wenige Dekaden brauchen,doch dann werden wir ihm den Rücken zukehren!«
(Pjotr Alexejewitsch Romanow; Zimmermann, Bombardier und Zar aller Reußen unter dem Namen Peter I.)
Prolog – 1692
Im Jahre des Herrn 1692, das in der orthodoxen Zeitrechnung des Moskowiterreiches das Jahr 7191 war, hatte eine zwölftausend Reiter starke Horde wilder Tataren die russische Stadt Nemerow an der unteren Wolga überfallen. Zuerst hatten die Männer des Khans Devlet Giray jeden, der Widerstand zu leisten wagte, totgeschlagen, dann hatten sie alle Mönche oder Popen, die sie zu fassen bekamen, kurz und hoch aufgeknüpft. Schließlich hatten sie noch alle Mädchen und Weiber der Stadt mit Gewalt genommen. Nach Beendigung ihres erfolgreichen Raubzuges waren sie schließlich mit zweitausend unglücklichen Gefangenen über die Grenze ins Reich des Sultans von Konstantinopel verschwunden, um ihre Beute auf seinen Sklavenmärkten in hartes Gold zu verwandeln. Nur ein kurzes Jahr später war die Anzahl der verschleppten und versklavten Untertanen der Moskauer Fürsten bereits auf fünfzehntausend Seelen angewachsen.
Seit den beiden glücklosen Strafexpeditionen des Fürsten Wassili Golizyn gegen die Tataren – 1688 und 1689 – und der aus ihnen resultierenden Absetzung der Zarewna Sophia hatte das Dritte Rom nur wenig unternommen, um die südlichen Grenzen seines Riesenreiches zu schützen. Doch nun war endlich eine neue Zeit angebrochen! Nach vielen Wirren und internen Streitereien um die Nachfolge des großen Zaren Alexei Michailowitsch Romanow, der im Jahr 1676 überraschend und jung verstorben war, hatten die Russen in seinem einzigen überlebenden Sohn, Peter Alexejewitsch Romanow, wieder einen starken, energischen und vor allem kriegerischen Herrscher gefunden.
Zu Anfang seiner Regierung war dieser Geschmack am Militärischen wohl nicht viel mehr gewesen als der Zeitvertreib und die Spielerei eines sehr jungen Mannes. Doch dann hatten die schweren Bronzeglocken des prachtvollen Moskauer Kreml bereits am 1. September 1694 der europäischen Zeitrechnung das neue Jahr 7193 der orthodoxen Zeitrechnung für die Moskowiter eingeläutet, und dieses neue Jahr sollte zu einem Schlüsseljahr in ihrer Geschichte werden: Der Zar, mit seinen nun zweiundzwanzig Jahren, war kein Kind mehr, und für seine Ambitionen als Kriegsherr reichten die Spiele im Jagdschloss von Preobraschenskoje und auf dem Pleschew-See nicht mehr aus.
Erster Teil – Sturm im Osten
Kapitel 1 – Die Hölle von Asow
Noch bevor die schweren Bronzeglocken der Christus-Erlöser-Kirche, der Erzengel-Kirche und der Auferstehungs-Kirche verklungen waren, hatten die erstaunten Moskowiter aus dem Mund ihres Herrschers vernehmen dürfen, dass nach der Schneeschmelze mit den ersten Sonnenstrahlen des Frühjahrs der Krieg gegen die Tataren und ihren Verbündeten, den Sultan von Konstantinopel, wieder aufgenommen würde.
Peter Alexejewitsch hatte beschlossen, die Festung von Asow am Schwarzen Meer anzugreifen und im Sturm zu nehmen und damit nicht nur mit den Muslimen zu einem Ende zu kommen, sondern auch für sein Land einen ganzjährig offenen Zugang zum Meer zu erschließen. Dann wollte er seine Flotte bauen und sein Riesenreich aus dem Mittelalter endlich in die Neuzeit zwingen.
Ohne Zweifel, der Beschluss, auf Asow zu ziehen, wurde stark durch die Leidenschaft des jungen Herrschers für die See motiviert und vielleicht auch durch sein Bedürfnis, seine Spielzeugsoldaten aus dem Jagdschloss von Preobraschenskoje gegen eine richtige Festung zu schicken und nicht immer nur gegen die Mauern von Pressburg.
Doch es gab auch andere Gründe, Gründe, die eines Herrschers und Staatsmannes würdig waren: Moskau hatte nie mit der »Goldenen Pforte« Frieden geschlossen. Moskaus Verbündeter, Polens katholischer König Jan Sobieski, drohte einen Sonderfrieden mit dem Sultan an und wollte dann, gemäß dem Beistandspakt, Kiew von den Russen zurückfordern.
Der Botschafter des Zaren am polnischen Hof hatte dieses Ultimatum tief besorgt in den Kreml geschickt. Der russische Botschafter war ein schwatzhafter Mann, der ein Geheimnis nicht für sich behalten konnte. Der russische Botschafter war außerdem ein treuer Kunde von Peter Schafirow, dem Vertreter der Amsterdamer Diamantenhändlergilde in Osteuropa und im Osmanischen Reich. Und Peter Schafirow war ein Vollidiot!
Zumindest redete der junge, jüdische Kaufmann sich dies fleißig ein, während er im Kontor der Garnison von Asow hinter einem Schreibtisch saß, die Kugeln des Abakus von links nach rechts fliegen ließ und vorgab, die Geschäftsbücher des Residenten Moische Mendelsohn zu prüfen.
Moische saß auf einem dreibeinigen Hocker neben seinem Herrn und zuckte dauernd verstört zusammen, und wenn er nicht zusammenzuckte, dann flehte er um Gottes Hilfe.
Schafirow konnte es dem Mann nicht einmal verdenken, dass er sich so unprofessionell benahm, denn draußen schlugen russische Brandbomben zwischen den Häusern ein und säten Tod und Verwüstung unter den Belagerten. Seit vielen Wochen schon war es unmöglich, Schlaf zu finden oder sich auch nur ein bisschen auszuruhen, denn der Lärm und das Donnern der Feldgeschütze auf beiden Seiten der Wälle dauerten Tag und Nacht an.
Peter Schafirow hätte sich das alles ersparen können: Er hatte gewusst, was der russische Botschafter seinem Herrn im Kreml mitteilte, und er hatte gewusst, dass eine riesige Streitmacht aus Moskau auf den Weg an die Südgrenze geschickt wurde. Er hatte sogar gewusst, welche Teilstreitmacht unter welchem Kommandeur welche Route nach Asow einschlagen sollte und wie viele Geschütze vor den Wällen in Stellung gebracht würden.
In seinem Geschäft war es überlebensnotwendig, solche politischen Details zu kennen!
Der Krieg war traditionell der beste Geschäftspartner der Amsterdamer Gilde. Immer dann, wenn die Kanonen sprachen und die Trommeln schlugen, hatten seine kleinen, transparenten Steine Hochkonjunktur: Die einen verkauften billig, die anderen erwarben um jeden Preis. Ein Diamant ließ sich leicht verstecken. Einen Diamanten konnte man immer zu Geld machen! Aus diesem Grund war Schafirow nach Asow gekommen, denn er hatte gehofft, mit dem Krieg zwischen Russen und Türken einen schönen Profit zu erwirtschaften und sich dann endlich aus seinem gefährlichen Beruf zu verabschieden.
Er hatte davon geträumt, sich in ein hübsches Haus an den Grachten zurückzuziehen, mit einer netten Frau, einer Bande reizender Kinder, guten Büchern, guter Musik und ab und an einer Partie Schach gegen einen alten Freund. Und jetzt saß er in diesem unberechenbaren Feuersturm fest.
»Moische Mendelsohn, werdet Ihr endlich aufhören zu schnattern! Wie soll ich nur nachdenken, wenn Ihr einen solchen Lärm macht?«, tadelte er den Residenten der Gilde.
Seine Stimme hatte nichts Unfreundliches an sich. Während seine klugen, braunen Augen den alten Mann auf dem Hocker fixierten, flogen die Kugeln des Abakus immer noch von links nach rechts, und seine Feder kritzelte über das Papier in einem kleinen, schwarzen, ledergebundenen Buch.
»Herr, wie könnt Ihr nur so ruhig … Sie werden uns zuerst berauben und dann umbringen!«, stotterte Moische kaum hörbar in seinen langen Bart. Seine Hände hatte der alte Mann fest vor der Brust verschränkt, so als ob diese Berührung ihn vor den Kanonen der Russen beschützen könnte.
Schafirow atmete tief durch und ließ den Gänsekiel ins Tintenfass zurückgleiten. Dann packte er bestimmt Mendelsohns Hände und nahm sie fest zwischen die seinen.
»Mein Freund, wenn wir beide unsere Haut retten wollen, dann müssen wir nachdenken! Davonzuflattern wie nasse Hühner hilft nicht weiter, wenn draußen vor der Tür der Krieg tobt!«
Er hatte in seinem jungen Leben schon mehr Krieg und Blutvergießen gesehen als die meisten Männer. Er wusste, was es hieß, um sein Leben zu fürchten, und mehr als einmal war er dem Tod nur knapp entkommen. Seine Ruhe, seine Selbstbeherrschung waren Fassade.
Tief in seinem Inneren hatte er genauso viel Angst wie der Resident der Gilde in Asow, doch er hatte gelernt, dass Angst ein schlechter Ratgeber war, und darum hielt er seine Gefühle mit eiserner Hand im Zaum. Moische Mendelsohn schien sich ein wenig zu beruhigen. »Gut so!«, flüsterte Schafirow ihm zu. »Denkt! Denkt nach und hört bitte auf zu zittern!« Seine Worte glichen einer Beschwörung. Der alte Mann nickte ergeben.
Die Garnisonsstadt Asow und ihre Festung standen am linken Ufer des Don, etwa fünfundzwanzig Werst flussaufwärts von der Asow-See. Bereits im fünften Jahrhundert vor Christus hatte an dieser Stelle eine griechische Kolonie existiert.
Später beherrschte Asow die Einfahrt in den Don und damit den Handel entlang des Flusses. In diesen Tagen war die Stadt zu einer venezianischen Kolonie geworden. Erst 1475 konnten die Türken die Festung erobern und zu ihrem Schlüssel für den Zugang zum Schwarzen Meer machen. Damals war Asow ausgebaut worden, und man hatte die Wälle verstärkt, denn außer der See dominierte die Stadt auch die Grenze mit dem Moskowiterreich. Etwa zwei Werst flussaufwärts hatten die Türken große Wachtürme errichtet, zwischen denen schwere Eisenketten eine Verbindung am linken und am rechten Don-Ufer aufrechterhielten.
Die Ketten dienten dazu, den schnellen Booten der Kosaken den Weg ins offene Meer zu versperren. Genauso schwer, wie man von der See in den Don hineinkam oder vom Don in die See hinaus, war es, in die Festung selbst zu gelangen. Schafirow hatte im Schutze der Nacht, und ohne es Mendelsohn zu sagen, schon mehrfach den gefährlichen Weg auf die Wälle hinauf gewagt.
Die russischen Kanonen waren von den Militäringenieuren des Zaren zu beiden Seiten von Asow halbmondförmig postiert worden. Soldaten und Strelitzen gruben Tag und Nacht an einem Erdwerk, das sich unaufhaltsam gegen die Befestigungen schob. Sobald diese Rampe sich in einer bestimmten Entfernung und in einem bestimmten Winkel zu den Wällen der Stadt befand, würde Peters erfahrenster General, der Schotte Patrick Gordon, sicher den Sturm befehlen. Etwa dreißigtausend Russen lagen vor Asow. Vor den Wachtürmen flussaufwärts befanden sich noch einmal Truppen und Geschütze. Nur wer diese Anlagen eroberte, konnte überhaupt daran denken, die Stadt selbst zu nehmen.
Schafirow wusste, dass es auch im Lager der Angreifer nicht zum Besten stand, denn es war eine schwere Aufgabe, so viele Soldaten in einem so unwirtlichen Landstrich zu versorgen, und die Don-Schiffer konnten den Proviant nicht zum Hauptheer bringen, denn die türkischen Eisenketten versperrten ihnen den Weg. Die Russen mussten von Booten auf Ochsenkarren umladen, und diese Ochsenkarren überfiel regelmäßig die Kavallerie der Tataren aus dem Hinterhalt. Diese Überraschungsangriffe banden mehr Soldaten, als es dem Zaren vor einem solchen Bollwerk wie Asow lieb sein konnte.
»Die Russen werden die Stadt über kurz oder lang einnehmen«, dachte der Diamantenhändler laut nach.
»Ja, Herr«, antwortete Mendelsohn ihm traurig.
Schafirow hatte seine Hände losgelassen und war aufgestanden. Langsam ging er zu seiner Reisetruhe hinüber und öffnete sie. Sicher verborgen zwischen Kleidung und Schriftstücken lagen ein scharfer, türkischer Dolch und zwei feine, englische Steinschlosspistolen. Zuerst steckte er den Dolch in den Gürtel, dann breitete er die Pistolen, das Pulverhorn und Zündstein auf dem Tisch aus und begann, seine Waffen sorgfältig zu laden.
Moische beobachtete ihn verwundert. Juden trugen keine Waffen. Sie zogen es vor, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Doch Schafirow war nie so gewesen wie seine Glaubensbrüder.
Der Lärm der russischen und türkischen Geschütze wurde von Minute zu Minute unerträglicher. Immer wieder fiel feiner weißer Kalkstaub von der Decke des Kontors, und die Wände zitterten.
»Es ist besser, wenn wir uns von Asow verabschieden, mein Freund! Und zwar noch heute Nacht! Ich will versuchen, den Stadtkommandanten zu überreden.«
Schafirow entfernte einen Ziegelstein aus der Mauer des Kontors. In einem Hohlraum verborgen lag ein schwerer Lederbeutel. Er öffnete ihn und ließ einen Teil des Inhalts in seine Handfläche rieseln. Jeder der fein geschliffenen Diamanten wog mindestens ein halbes Karat. Im Licht der Kerzen funkelten und leuchteten sie in allen Farben des Regenbogens.
Als er die Anzahl der Steine für ausreichend befand, drückte er den Lederbeutel mit einem aufmunternden Lächeln in die zitternden Hände von Moische Mendelsohn.
»Näht das in unsere Reisemäntel ein und rührt Euch nicht vom Fleck, bis ich zurückkomme, alter Mann! Versprecht es!«
Die Diamanten verschwanden aus seiner Hand in einem Lederbeutel, den er um den Hals unter seinem Kaftan versteckt trug. Die beiden englischen Pistolen verbarg der Kaufmann unter dem Umhang. Kurz umarmte er Mendelsohn.
»Seid ohne Sorge!«
Und noch bevor dieser antworten konnte, hatte die schwere, eisenbeschlagene Tür des Kontors sich einen Spalt weit geöffnet, und Peter Schafirow war in den brennenden Straßen von Asow verschwunden.
Es war unendlich schwer, durch diese Hölle des Krieges, die nur aus herabfallenden Trümmern, zerfetzten Leibern und schreienden Soldaten zu bestehen schien, bis zum Amtssitz von Ahmed Pascha vorzudringen. Auch vor diesem Gebäude hatten die russischen Brandgeschosse nicht haltgemacht, und der einst so schöne Palast glich nur noch einer schwelenden Ruine, als Schafirow ihn bei Einbruch der Dunkelheit endlich erreichte.
Er hielt einen jungen Offizier der Leibgarde des Ahmed Pascha auf. »Wo ist der Wesir?«
Der Mann erkannte den Juden, dann deutete er mit ausgestrecktem Arm auf den Westwall der Festung. Als der Diamantenhändler schon davoneilen wollte, hielt der jemadar ihn jedoch zurück.
»Herr, bringt Euch lieber in Sicherheit, als durch diesen Feuersturm auf den Wall zu steigen! Man wird Euch heute nicht zu Ahmed Pascha vorlassen können, denn die Ungläubigen haben vor einer Stunde erneut einen Angriff versucht, und dort oben wird gekämpft!«
Der Jude zog ein Goldstück aus der Tasche. »Dann bringe mich zu deinem Kommandeur!«
Der Türke wies die Gabe zurück und schüttelte den Kopf. »Herr, Yusuf Bey ist gefallen, und er hätte Euch auch nicht weiterhelfen können! Ihr sucht wie wir alle, einen Weg hinunter zum Meer … es gibt im Augenblick aber keinen, denn durch den Tunnel am Ostwall bringt man gerade neue Munition und Verstärkung von den Schiffen zur Stadt hinauf. Die Wesire Ali, Bekir und Hasam Pascha sind schon auf dem Weg, uns zu entsetzen, und wir haben einen guten Freund im feindlichen Lager, der uns täglich darüber informiert, welche neuen Pläne der Zar ausheckt. Habt noch ein wenig Geduld, seid ohne Sorge, versteckt Euch im Keller Eures Kontors und steht uns Soldaten hier nicht im Weg herum! Wir werden die Russen bald schon vertreiben!«
Schafirow verbeugte sich kurz mit vor der Brust gekreuzten Armen, wie die Muselmanen es zu tun pflegten. Die Nacht verbarg das kleine Lächeln, das auf seinen Lippen lag, als er sich in bestem Türkisch empfahl.
»Danke, jemadar! Du hast sicher recht. Ich werde jetzt lieber gehen.«
So billig und einfach war der Diamantenhändler schon lange nicht mehr an Schlüsselinformationen herangekommen. Sie waren wertvoller als jeder Hinweis darauf, wie man aus Asow verschwinden konnte, denn sie ließen ihm nun zwei potenzielle Wege offen, seine Haut und die von Moische Mendelsohn zu retten, ohne den alten Mann dabei auf einer gefährlichen Flucht mitnehmen zu müssen.
Atemlos und staubig erreichte er das Kontor. Er musste eine Weile kräftig gegen die schwere Tür hämmern, bevor man sie ihm endlich einen Spaltbreit öffnete. Sein Resident empfing ihn erleichtert. Er hatte bereits vor Stunden jede Hoffnung darauf aufgegeben, Schafirow lebend wiederzusehen.
»Herr, alles ist fertig, und die Steine sind in den Säumen sicher eingenäht! Habt Ihr einen Weg gefunden?«, platzte Moische aufgeregt heraus, als er der zufriedenen Miene des Diamantenhändlers gewahr wurde.
Schafirow klopfte sich den Staub aus dem Kaftan und rang ein wenig nach Luft. Er war durch die Kanonenkugeln und Brandbomben hindurchgerannt wie ein Kaninchen auf der Flucht vor dem Fuchs.
»Zwei! Aber jetzt müsst Ihr einfach Gottvertrauen haben! Entweder ich versuche, ins Lager der Russen zu kommen, und zeige diesen Barbaren den Weg in die Stadt, oder die türkische Entsatzarmee erreicht Asow, und niemand wird Hand an Euch legen. Ich werde dann schon weitersehen, wie ich mich wieder von meinen neuen russischen Freunden verabschiede … Falls die Türken gewinnen, dann nehmt die Steine und die Geschäftsbücher und verschwindet mit dem ersten Schiff, das Ihr von Konstantinopel oder Varna aus nehmen könnt. Fahrt an meiner Stelle nach Amsterdam und erklärt Simeon ben Serfabi und den anderen alles. Ich befürchte, dass es sich lange nicht mehr lohnen wird, Kontore an der südlichen Grenze zu Russland zu unterhalten, denn der junge Zar wird so lange wiederkommen, bis ihm diese Stadt unterliegt, und der Krieg mit den Türken wird nicht enden wollen.«
»Herr, Euer Onkel wird sich beunruhigen …«
»Zum Teufel, Moische Mendelsohn! Sagt Onkel Simeon, dass ich alt genug bin, um auf mich aufzupassen, und jetzt lasst mich wieder nach draußen, verriegelt die Tür und versteckt Euch mit den Steinen im Gewölbe unter dem Haus!«, fuhr Schafirow den alten Mann ungehalten an.
Wenn es einen Charakterzug gab, den er bei seinen Glaubensbrüdern nicht ertragen konnte, dann war es diese Ängstlichkeit! Immer mussten sie vor allem zittern und ließen sich von jedem hergelaufenen Bettler mit einem Knüppel in der Hand alles gefallen. Sein Vater war genauso gewesen: Er hatte sich auch nie zur Wehr gesetzt. Und wohin hatte ihn diese Unterwürfigkeit gebracht? In ein frühes Grab! Selbst der erniedrigende Akt, offiziell vom jüdischen zum orthodoxen Glauben zu konvertieren, hatte ihm nicht geholfen. Ein betrunkener russischer Strelitze hatte ihn nachts in einer finsteren Gasse von Smolensk erschlagen, obwohl er den Dienstrock des Außenamtes am Leib getragen hatte. So nützlich, wie Pawel Schafirow für die Moskowiter Barbaren gewesen war, wenn es darum ging, diplomatischen Schriftverkehr ins Lateinische oder ins Polnische zu übersetzen, so wenig scherten sie sich doch darum, wie man mit den Konvertierten umsprang. Sie waren und blieben im Moskowiterreich, solange sie lebten, nur Menschen zweiter Klasse!
Der Diamantenhändler hatte von dieser Konversion zum orthodoxen Glauben und vom Tode seines Vaters nur durch Zufall erfahren, denn er war, kurz bevor Smolensk an Russland fiel, zu Verwandten nach Amsterdam geschickt worden, damit er dort eine vernünftige Ausbildung erhalten konnte. Nach dem Tod von Pawel Schafirow hatte er keinen Grund mehr gesehen, in seine Geburtsstadt zurückzukehren. Er war ins Diamantengeschäft seines Onkels eingestiegen und hatte seiner Lust nach weiten Reisen und Abenteuern nachgegeben. Alles, was ihm noch von zu Hause geblieben war, waren akzentfreies Russisch und der unbändige Wille, sich niemandem mehr zu beugen.
Der jemadar vor dem brennenden Palast von Ahmed Pascha hatte berichtet, dass die Türken ihre Verstärkung durch einen Tunnel am Ostwall der Festung nach Asow hineinschafften. Also konnte man annehmen, dass die östliche Seite der Stadt kaum einer Bedrohung durch die russische Armee ausgesetzt war. Schafirow hatte in den letzten Tagen von den Mauern aus erkennen können, dass der Belagerungsring aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht vollständig geschlossen worden war, also schlich er sich durch die brennenden Straßen Richtung Osten. Als er am Wall ankam, sah er, wie Männer im Waffenrock des Sultans von Konstantinopel sich aus einem schwarzen Loch in die Stadt hinein ergossen und sofort den Weg in Richtung auf den gefährdeten Westwall und die Kampfhandlungen mit den Moskowitern einschlugen. Er blieb eine Weile hinter einem Trümmerhaufen versteckt und beobachtete. Es gab einen toten Winkel am Ostwall.
Mit ein bisschen Geschick musste es möglich sein, auf der einen Seite der Mauer hinauf- und auf der anderen Seite wieder hinunterzuklettern, ohne gesehen zu werden. Es kam Schafirow so vor, als hätten seine Augen noch nie so lange gebraucht, um sich von Licht auf Finsternis umzustellen. Nur allmählich leuchteten aus dem Dunkel des Ostwalls die Konturen der hellgrauen Steinquader auf. Vorsichtig suchte seine Hand in einer Mauerritze Halt. Ein dünner Lichtstrahl – wohl das Ergebnis des Einschlags einer russischen Brandbombe – wies ihm seinen Weg nach oben. Seine Augen waren ganz ruhig auf die Granitsteine geheftet.
Gelassen zog er sich höher und höher. Er stockte nicht, sondern atmete nur tief durch und kletterte weiter. Irgendwann verlor er den Sinn für die Zeit, die er brauchte, um sein erstes Hindernis zu überwinden. Es schien, als ob Tage vergangen waren, als er endlich wieder den festen Boden auf der anderen Seite des Ostwalls unter seinen Füßen spürte. Das Schilf, das von der Festung bis hinunter zu einer Biegung des Don wuchs, bog sich leicht unter dem Luftdruck einer fernen Explosion. Für Sekunden war es nicht mehr Röhricht, sondern ein schützender Wald, der dem Juden Deckung bot. Blitzschnell und ohne nachzudenken, stürmte er vorwärts und hetzte durch das Schilf. Alles geschah so schnell, dass er nicht einmal Zeit hatte, Angst zu empfinden. Ein Flimmern huschte durch die Nacht, als das Röhricht sich wieder aufrichtete. Der Donner der Explosion und seine Echos verklangen, das Zittern der Luft verebbte.
Schafirow ließ sich atemlos zu Boden fallen. Einige Minuten rang er nach Luft. Sein Herz schlug so wild, dass er glaubte, die Türken und die Russen müssten ihn einfach hören. Doch dann wurde er wieder ruhiger und bemerkte das sanfte Plätschern von Wasser gegen Steine unweit seines Verstecks. Er hatte den Don erreicht! Vorsichtig schob er sich in Richtung des Geräuschs. Die Vorposten der Russen lagen an der Nordseite der Biegung. Er konnte den Schein ihrer Feuer erkennen. Schafirow glitt unter tief hängenden Zweigen durch, sprang über bemooste Baumstümpfe. Lautlos eilte er dahin, nun selbst ein Teil der grünbraunen Wildnis und der schwarzen Nacht, die ihn umgaben, selbst ein Teil dieser sonderbaren, unheimlichen Stille mitten in einem verzweifelten Kampf.
Die Feuer kamen näher und näher, und plötzlich konnte er die Stimmen der russischen Soldaten vernehmen. Es ähnelte dem Brummen eines Schwarms wild gewordener Hummeln; bedrohlich und doch unverständlich. Er hatte noch gar nicht darüber nachgedacht, wie er dem ersten Mann, dem er begegnen würde, klarmachen konnte, ihn nicht mit einem Hieb oder einem Schuss ins Jenseits zu befördern. Schafirow verwarf seine unangenehmen Gedanken: Vielleicht war es ja immer noch besser, auf dem Weg durch die Linien von einer schnellen, gnädigen Kugel getroffen zu werden, anstatt wie eine Ratte in Asow zu krepieren.
Raschelnd teilte sich das Schilf. Es gab nun keine natürliche Deckung mehr. Im fahlen Mondlicht schimmerte der Don. Schafirow richtete sich auf und sah die russischen Feuer an, dann den Fluss, dann wieder die Feuer.
Plötzlich huschte ein Schatten durch diese Lichtstreifen, und der Jude schrak zusammen, doch er duckte sich nicht weg. Langsam nahm der Schatten eine menschliche Form an. Der Uniform nach zu urteilen, hatte er es mit einem Russen zu tun, mit einem einzelnen Russen. Der Soldat pfiff leise ein kleines Lied vor sich hin, und Schafirow bemerkte im fahlen Mondlicht, dass der Mann keine Waffe trug. Er atmete auf. Noch ehe der Russe es bemerkte, stand er hinter ihm.
Erschrocken fuhr Stabskapitän Graf Peter Tolstoi herum. Schafirow verneigte sich leicht.
»Ich hielt es nicht für ratsam, mich anzumelden.«
Der Jude sprach so gelassen, wie er dastand. Der vertraute Klang einer russischen Stimme beruhigte sein Gegenüber ein wenig. Die Angst machte der Neugier Platz.
»Es ist mir gelungen, aus der Festung von Asow zu schlüpfen«, erklärte die staubige Gestalt in einem weiten Kaftan und mit schmutzigen Reitstiefeln, als ob das als Erklärung genügen würde, warum er sich mitten in der Nacht inmitten der russischen Stellungen befand.
»Wer seid Ihr?«, fragte Graf Tolstoi leise.
Vielleicht war der Fremde ja ein Spion General Gordons, der das zweite russische Truppenkontingent vor dem Westwall der Festung kommandierte.
»Peter Schafirow! Ich bin ein Kaufmann aus Amsterdam, der aus Versehen in diesen ganzen Schlamassel zwischen Euch und den Türken hineingeraten ist. Drinnen in Asow wurde es ungemütlich, und da habe ich mir gedacht, ich versuche mein Glück auf der anderen Seite!«
»Ihr seid also keiner von Gordons Spionen?«
Schafirow schüttelte den Kopf. »Und ich bin mir nicht sicher, dass auch nur ein einziger russischer Spion je hinter diesen Mauern war! Aber die Türken haben einen Mann im russischen Lager!«
Tolstoi trat auf den Juden zu und hob die Hand, als ob er ihn schlagen wollte. Doch Schafirow wich nicht zurück. Er hatte mit einer befremdlichen Reaktion gerechnet. Die Information, die er diesem Russen soeben ganz locker und mit leichtem Spott in der Stimme an den Kopf geworfen hatte, besaß Zündstoff.
»Ich danke Euch, dass Ihr es so ruhig aufnehmt!« Schafirows Augen lächelten. »Ich hätte Euch diese Überrumpelung gerne erspart, aber ich hatte nur die Wahl zwischen Euch und einem Versuch, irgendeinen Eurer schießwütigen Strelitzen oder Kosaken von meinen guten Absichten zu überzeugen!«
Tolstoi bemerkte durch das fahle Mondlicht hindurch, dass die Augen des jungen Mannes vor ihm ohne Furcht waren. Er schüttelte den Kopf.
»Was wisst Ihr noch, Schafirow?«
»Bringt mich zu Eurem Kommandeur!«
Der Russe musste über die Unverfrorenheit seines Gegenübers lachen. Entweder er war sich nicht darüber im Klaren, dass man jeden bewaffneten Unbekannten, den man mitten in der Nacht und ohne Passierschein so nahe beim Hauptquartier der russischen Streitmacht aufstöberte, üblicherweise ohne großes Federlesen zu seinem Schöpfer schickte, oder es war ihm völlig gleichgültig, und er spekulierte darauf, dass man ihn erst würde ausreden lassen und dann über sein Schicksal beschied.
»Tolstoi, Stabskapitän Graf Peter Tolstoi! Ich bin der Adjutant von General Scheremetew!«
Schafirows Gesichtsausdruck veränderte sich mit einem Schlag. Das spöttische Grinsen, das noch vor wenigen Minuten auf seinen Lippen gelegen hatte, verschwand, und er wurde ernst.
»Boris Petrowitsch Scheremetew?«
Tolstoi nickte verwundert. »Genau der! Ihr wisst …«
»Bringt mich bitte zu General Scheremetew, Graf Tolstoi, und Ihr sollt alles erfahren, was ich weiß! Es gibt vielleicht einen Weg für Eure Truppen nach Asow hinein.«
Kurz nach Mitternacht befand Peter Schafirow sich in einem großen Zelt, das taghell erleuchtet war. Über einem riesigen Tisch waren zahllose Karten unordentlich ausgebreitet. Leere Gläser und Flaschen standen auf einer kleinen Kiste in einer Ecke aufgereiht, und alles zeugte davon, dass sich hier noch vor Kurzem eine große Anzahl russischer Offiziere intensiv beraten haben musste. Vor einer schweren, dunkelgrünen Stoffbahn, die das Zelt abteilte, lag auf einer Matratze auf dem Boden ein Bursche, dessen Uniformierung ihn als Reitersoldat kenntlich machte. Er schnarchte laut, und selbst die beiden Männer, die so unerwartet in das Zelt eingetreten waren, schienen ihn nicht aus seiner nächtlichen Ruhe zu bringen, obwohl seine eigentliche Aufgabe war, über General Boris Scheremetews Leben zu wachen.
Graf Peter Tolstoi knurrte ungehalten. Dann trat er rüde nach ihm, und der Mann rappelte sich erschrocken hoch.
»Tolja, fauler Hund! Wenn ich nun ein Türke wäre, was hätte ich dann mit Euer Gnaden, dem General, alles anstellen können?«
Schafirow beobachtete verwundert die Reaktion des Soldaten. Er winselte nur wie ein Hund und kroch dann auf allen vieren aus dem Zelt. Es schien in Russland nicht nur Menschen zweiter Klasse zu geben, sondern auch solche, die diese Barbaren schlimmer als Vieh behandelten. In Amsterdam hätte ein solch herrschaftlicher Tritt ein schönes Strafgeld von den Gildemeistern nach sich gezogen. Nicht einmal den jüngsten und dümmsten Lehrbuben hätten sie zu Hause so behandelt. Aber drüben, in seiner schönen Stadt an den Grachten, da lebten eben zivilisierte Menschen und keine stinkenden, ungewaschenen Barbaren wie diese Moskowiter, oder die Türken, denen er gerade erst entkommen war.
»Wartet hier, Schafirow, und rührt Euch nicht vom Fleck!«, brummte Graf Tolstoi. Mit einem halb misstrauischen, halb amüsierten Blick auf den spitzen Dolch am Gürtel des Juden und auf die beiden Pistolen fügte er noch an: »Und denkt erst gar nicht daran, eine Dummheit zu versuchen, die Euch leidtun könnte. Draußen stehen fünfzehntausend bis an die Zähne bewaffnete Männer … Ihr kämt keine zwei Schritt weit!«
Dann verschwand er hinter der dunkelgrünen Tuchbahn und kehrte wenige Minuten später mit General Boris Scheremetew zurück. Der Offizier hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, nach seinem Morgenrock zu greifen, um den unerwarteten Besucher zu empfangen. Nur in einem knielangen, weißen Hemd und barfüßig tauchte er auf.
Ohne langes Vorspiel und ohne irgendwelche Höflichkeitsfloskeln wandte er sich an den Diamantenhändler. Die Waffen am Gürtel des Mannes ignorierte er.
»Also, was habt Ihr mir zu berichten! Los, macht keine Umstände, ich habe keine Zeit zu verlieren!«
General Scheremetew war ein kräftiger, breitschultriger Mann mit lebhaftem Gesichtsausdruck und ebensolchen Augen. Das Schicksal hatte es immer gut mit ihm gemeint. Er entstammte einer der ältesten und wichtigsten Familien Russlands. Von frühester Jugend an war er für den Kriegsdienst vorbereitet worden, und er liebte seine Aufgabe. Bereits mit fünfundzwanzig Jahren hatte er einen der wichtigsten Militärdistrikte Russlands befehligt, und die Herrscher im Kreml hatten ihm viele diplomatische Aufgaben anvertraut, die ihn in einen regen Kontakt mit Polen, Litauern, Preußen und anderen Ausländern gebracht hatten. Heute hatte er knapp die vierzig überschritten und schien auf der Höhe seiner Macht und seines Einflusses. Sein Weg aus der Ukraine, entlang des Dnjepr bis hinunter nach Asow war eine Straße der Siege gewesen. Er hatte vier türkische Festungen zu Fall gebracht und unzählige Tatarenhorden aufgerieben.
»Dob’sche, dob’sche!«, erwiderte Schafirow leise, aber unbeeindruckt vom herrischen Auftreten des Generals auf Polnisch.
Diese leisen Worte schienen Scheremetew zu überraschen. Plötzlich packte seine große, schwielige Soldatenhand den Juden unterm Kinn und drehte sein Gesicht ins Licht der Kerzen.
»Pudre Er sich die schwarzen Haare, und verkleid Er sich mit einer Redingote, seidenen Kniehosen und einem Halstuch aus Brüsseler Spitze, und der Teufel soll mich holen, wenn das nicht des polnischen Königs Schutzjud ist! Schafirow, du Halunke, was treibt dich mitten in unseren Krieg? Konntest wohl das feine Leben in Warschau nicht mehr ertragen und warst auf der Suche nach ein bisschen Abenteuer!«
Der Diamantenhändler grinste. Graf Peter Tolstoi war erstaunt.
»Warum hat Er mir das nicht gleich gesagt?«, brummte der russische General jetzt seinen Adjutanten an. »Er hätt mir sagen sollen, dass Er mir meinen alten Freund Peter bringt, der mir schon in Warschau immer mein schönes Gold für seine hübschen Edelsteine abgenommen hat, nur weil mein Weib ohne diesen Tand nicht leben kann!«
»Ich wusste nicht, Euer Gnaden«, flüsterte Tolstoi unterwürfig.
»Er kann’s auch nicht wissen! Ist ja auch noch nie aus seinem rückständigen Moskau herausgekommen! Hol Er die Gläser, Peter Andrejewitsch, und eine Flasche! Setz dich, Schafirow! Zuerst trinken wir auf dieses Wiedersehen, und dann erzählst du mir alles, was du in Asow gesehen und gehört hast. Sind deine Ohren immer noch so spitz wie in Warschau und deine Augen so scharf?«
Der Diamantenhändler klopfte sich den Staub aus dem Kaftan, zog Dolch und Pistolen aus dem Gürtel und legte alles auf den Kartentisch. Dann ließ er sich bequem in einen der Stühle fallen.
»Boris Petrowitsch, das Trinken überlass ich mit Freuden Euch und dem Herrn Stabskapitän! Auch darin hab ich mich seit Warschau nicht verändert!«
»Zum Teufel, wie soll man nur mit einem Mann ins Geschäft kommen, wenn er nicht einmal richtig saufen tut? Aber unverfroren ist er, und den Mut hat er von zwanzig Soldaten der Leibgarde! Was bist du nur für ein Jud, Peter Pawlowitsch?«
Schafirow nahm Graf Tolstoi eines der Gläser aus der Hand und bedeutete ihm, eine symbolische Menge Wodka einzuschenken. Dann hob er sein Glas und neigte leicht und spöttisch den Kopf vor General Scheremetew.
»Einer, mit dem Euer Gnaden immer gute Geschäfte gemacht hat! Es gibt vielleicht einen Weg hinein nach Asow. Am Ostwall, unweit der ersten Biegung des Don, existiert ein geheimer Tunnel, der in die Stadt führt. Er liegt so nahe am Wasser, dass die Türken schon seit Tagen unbeobachtet von Euch Munition und Verstärkung zu Ahmed Pascha bringen. Außerdem sind Schiffe des Sultans auf dem Weg. Die Wesire Ali, Bekir und Hasam Pascha haben den Auftrag, die Festung zu entsetzen. Sie sollen durch die Asow-See den Don hinauffahren. Wenn Ihr nicht aufpasst, dann werden Euch die Türken in den Rücken fallen, Boris Petrowitsch!«
Scheremetews Glas schlug hart gegen das leere Glas des Diamantenhändlers. Der General lachte verächtlich. Doch diese Verächtlichkeit galt nicht dem Juden.
»Was verstehst du schon vom Krieg, Kaufmann? Die Türken sind schlechte Soldaten, und ihre Kommandeure sind schlechte Kommandeure! Sie machen mir keine Angst!«
Langsam erhob Schafirow sich von seinem Stuhl. Gelassen nahm er ein Stück Kreide vom Tisch und wählte mit großer Selbstverständlichkeit, ganz so, als sei er der Herr des Hauses und nicht General Scheremetew, eine der Karten aus.
»Kommt, Boris Petrowitsch! Ich will Euch etwas zeigen! Ich bin nur Kaufmann, aber dem Krieg bin ich in den letzten zehn Jahren nur zu oft begegnet …«
Er fing an, die beiden russischen Truppenkontingente und General Gordons Erdwall auf der Karte zu skizzieren. Dann wählte er eine andersfarbige Kreide und zeichnete die türkischen Kanonen auf den Festungswällen von Asow ein.
»Seht Ihr, Euer Belagerungsring von Land her ist nicht geschlossen. Es ist eigentlich kein Ring, sondern nur ein stürmischer Frontalangriff von zwei Seiten, der zahllose Lücken offen lässt. Hier, von See her, kommen die Türken mit der Entsatzarmee. Eure Schiffe liegen immer noch tief im Don fest, viele Werst hinter den beiden Schutztürmen. Nicht einmal die Kosakenboote kommen an den Ketten vorbei. Die Türken werden in den Don einfahren, man wird die Ketten für sie hochziehen, und sie werden Zar Peters kleine Flotte im seichten Flusswasser in tausend Stücke schießen, denn die neuen, großen Galeeren sind für die See gebaut worden und können nicht manövrieren! Dann landen sie ihre Männer an und fallen beiden russischen Truppenkontingenten in den Rücken, während Ahmed Pascha einen Ausbruch aus Asow unternimmt und Euch frontal angreift und die Tatarenreiter Euch von allen Seiten her zermürben! Was haltet Ihr von meiner Hypothese, Boris Petrowitsch!«
Hart schlug die Faust des Generals auf den Kartentisch. »Teufel, Schafirow! Wie kommst du auf diese Idee?«
»Die Türken haben einen Spion in Eurem Lager! Ich weiß nicht, wer es ist, aber der Mann muss sie gut informieren. Asow brennt zwar, und viele Häuser sind zerstört, aber die Garnison Ahmed Paschas ist intakt. Jedes Mal, wenn Ihr angegriffen habt, waren seine Männer immer vollzählig und pünktlich genau an der richtigen Stelle auf den Wällen. Hat Euch das nie verwundert?«
»Er hat recht!«, mischte Graf Tolstoi sich vorsichtig in die Unterhaltung ein.
Der Stabskapitän war nicht nur Adjutant General Scheremetews, sondern auch der offizielle Chronist des Feldzuges. Er kannte alle Details der mühevollen Belagerung und hatte alle Fehlschläge sorgfältig aufgezeichnet.
»Euer Gnaden, wir müssen mit Gordon sprechen, und der Zar muss informiert werden!«
Scheremetew nickte zustimmend, dann griff er nach seinem Waffenrock und verschwand hinter dem dunkelgrünen Vorhang, um sich anzuziehen. Peter Tolstoi betrachtete schweigend und nachdenklich den Juden. Ihm war im ersten Moment gar nicht aufgefallen, wie jung sein Gegenüber war; vielleicht gerade einmal halb so alt wie er selbst und nicht einmal ein Soldat. Und trotzdem schien der Mann genau zu begreifen, woran die gesamte Operation gegen die Türken krankte.
»Was würdet Ihr an unserer Stelle tun?«, fragte er ihn vorsichtig.
Schafirow verschränkte die Arme vor der Brust und sah dem Stabskapitän geradeheraus in die Augen.
»Ich bin kein Soldat, Graf Tolstoi … Ihr müsst zuerst die beiden Wachtürme flussaufwärts nehmen, damit Ihr selbst Herr über die Ein- und Ausfahrt in den Don werdet. Dann müsst Ihr Eure Kriegsschiffe hinunter in die Asow-See schicken und die türkischen Kriegsschiffe außer Gefecht setzen. Wenn es Euch gelingt, Ahmed Pascha den Nachschub abzuschneiden, wird die Festung schnell fallen. Wenn es Euch gelingt, den Zugang über den Tunnel am Ostwall zu beherrschen, dann sind die Türken verloren.«
»Was verlangt Ihr von uns, damit Ihr uns helft, Schafirow?«
Tolstois Augen spiegelten Misstrauen wider. Solche wertvollen Informationen erhielt man nicht umsonst und aus Freundschaft. Der Jude war kein Russe, sondern ein freier Bürger von Amsterdam. Die Türken waren seine Kunden genauso wie die Russen oder die Polen oder die Litauer. Er stellte sich mit allen gut, denn er war Kaufmann und machte nur Geschäfte.
Schafirow seufzte leise, und seine klugen, braunen Augen blickten traurig in die von Peter Tolstoi.
»Zwei Leben! Das ist alles, was ich verlange! Das eines alten Mannes in der Festung und meines! Im Krieg muss man manchmal auch Geschäfte machen, die auf den ersten Blick nicht gerade profitabel aussehen … und dann freies Geleit über die russische Grenze zurück nach Polen.«
»Das ist nicht viel, Schafirow«, brummte Peter Tolstoi verächtlich.
Das Leben eines Juden war im Moskowiterreich nichts wert. Doch die Einnahme einer strategisch wichtigen Position wie Asow bedeutete alles. Der Stabskapitän gab sich keine Mühe, seinen Spott zu verbergen. Wie die meisten Russen hatte er für die Kinder Israels nichts übrig. Er hasste sie zwar nicht oder trachtete ihnen nach dem Leben, aber sie waren ihm gleichgültig. Sie waren nur wenig besser als die Ungläubigen, die er gerade bekriegte. Sollte der Diamantenhändler ruhig seine verdammte Haut retten!
General Scheremetew erschien in voller Uniform und bedeutete den beiden Männern, ihm zu folgen. Nachdem sie in die Nacht hinausgetreten waren, eilte ein Unteroffizier der Leibwache auf sie zu. Er salutierte vor dem General.
»Euer Gnaden?«
»Drei Pferde, Mann! Schnell! Und eine Eskorte, und schick Er einen Kurier zu General Gordon und einen Kurier zum Zaren!« Er übergab dem Unteroffizier zwei gefaltete und versiegelte Papiere.
»Du kannst doch wohl reiten, Schafirow!«, spottete Scheremetew dann leise.
Genauso leise erwiderte der Jude: »Ich will es versuchen, Boris Petrowitsch!«
Die meisten Juden ließen sich nicht nur von jedem alles gefallen, sie bewegten sich auch nur zu Fuß oder mit Maultiergespannen, denn in vielen Ländern war ihnen nicht nur die freie Berufsausübung untersagt und das Tragen von Waffen, sondern auch der Besitz und die Benutzung von Reitpferden. Doch Schafirow war nicht so wie seine Glaubensbrüder. Er hatte sich nie um die Gebote und Verbote geschert, die für sein Volk auf der ganzen Welt zu gelten schienen. Er hatte nie akzeptiert, dass eine Mehrheit einfach beschloss, über das ganze Leben und Verhalten einer Minderheit zu bestimmen. Er war nie unterwürfig gewesen oder hatte sich dessen geschämt, was er von Geburt her war, und seitdem er die Umstände des Todes seines Vaters kannte, wollte er sich niemandem mehr beugen. Er war frei, und diese Freiheit konnte niemand ihm nehmen, und sollte ihm irgendwer wegen dieser Aufmüpfigkeit den Kopf abschlagen, dann starb er zumindest als freier Mann und ohne in seinem Stolz gebrochen worden zu sein. Bestimmt nahm er einem Soldaten die Zügel eines Pferdes aus der Hand und schwang sich in den Sattel.
»Reiten wir, Boris Petrowitsch! Die Zeit drängt!«
Während der langen Wochen der Belagerung hatte Zar Peter unablässig und unermüdlich geschuftet wie der gemeinste seiner einfachen Soldaten. Als Artillerist Peter Alexejew hatte er geholfen, die Belagerungsgeschütze zu laden und die Mörser gegen die Wälle von Asow zu feuern, und als Zar der Reußen war er dem Obersten Kriegsrat vorgestanden und hatte alle Operationspläne studiert und genehmigt. Außerdem hatte er noch seine gesamte Korrespondenz mit den Freunden in der Hauptstadt Moskau aufrechterhalten.
Als General Gordon zu ihm eilte, um ihm die Nachricht von Scheremetew zu überbringen, war der Bombardier Peter gerade dabei, mit den anderen Männern seiner Batterie russischen Fußsoldaten und Strelitzen, die einen Vorstoß gegen Asow wagten, Deckungsfeuer zu geben. Der junge Zar war dreckig und durchgeschwitzt. Seine Wangen glühten vor Aufregung und Anstrengung. Dieser erste wahre Kriegszug seines Lebens begeisterte ihn als Menschen, obwohl die vielen fruchtlosen Versuche des Moskowiter Feldheeres gegen die Türken ihn als Herrscher in Unruhe versetzten.
Nachdem Gordon ihm durch das Donnern der Kanonen hindurch die Nachricht zugebrüllt hatte, wischte der Zar sich mit dem Ärmel seines schmutzigen Hemdes den Schweiß aus dem Gesicht und übergab seinen Ladestock einem anderen Soldaten.
»Patrick Iwanowitsch, ich muss diesen Mann sofort sehen und mir anhören, was er zu berichten hat. Wenn Scheremetew eine Sache so eilig macht, dass er seinen Zaren mitten in der Nacht stört«, sprudelte es aus Peter Alexejewitsch hervor.
Er war dreiundzwanzig Jahre alt und trotz seiner herausragenden Stellung noch nicht viel mehr als ein verspieltes und emotionsgeladenes Kind. Dem alten, schottischen Offizier fiel es schwer, mit dem energischen jungen Mann Schritt zu halten, und er musste beinahe neben Peter hertraben, um ihn auf dem Weg ins Zelt des Hauptquartiers nicht im Menschengewirr der russischen Belagerungsoperation aus den Augen zu verlieren.
Kurz nachdem Peter sich in einen einfachen Stuhl hatte fallen lassen, meldete einer der Wachposten die Ankunft General Scheremetews. Der Offizier betrat, gefolgt von Stabskapitän Graf Tolstoi und Peter Schafirow, das Zelt seines Herrschers und verbeugte sich tief.
»Peter Alexejewitsch, ich bringe wichtige Neuigkeiten!«, eröffnete er das Gespräch. »Gestattet mir zuerst, Euch diesen jungen Mann vorzustellen.« Er deutete auf den Diamantenhändler. »Das ist Peter Schafirow! Es ist ihm gelungen, aus der Festung von Asow in unsere Linien zu entkommen. Er hat wichtige Informationen über die Pläne der Türken!«
Schlaksig erhob sich der junge Zar von seinem Stuhl und trat zu dem Juden hin. Seine schwielige Hand schlug dem Neuankömmling kräftig auf die Schulter. Peter Alexejewitsch war ungewöhnlich groß. Sein energisches, rundes Gesicht zierte ein kleiner Schnauzbart im holländischen Stil, und er trug keine Perücke, sondern hatte seine langen, dunklen Haare einfach mit einem Lederriemen im Nacken zusammengebunden. Seine blauen Augen sprühten vor Leben.
»Sprich offen und hab keine Furcht!«
Schafirow verbeugte sich leicht vor dem Herrscher aller Reußen. Dann berichtete er ihm in kurzen, klaren Sätzen, was er zuvor schon Scheremetew und Tolstoi erklärt hatte. Als er seine Erzählung beenden wollte, stieß Scheremetew ihn kräftig in den Rücken.
»Den Rest auch, Peter Pawlowitsch! Sag alles ganz freiheraus, auch deine Idee, wie wir’s mit der Festung halten sollen! Wir sind hier unter Freunden. Man wird dir zuhören!«
Der Jude stockte kurz. Dann atmete er tief durch und bahnte sich seinen Weg zwischen dem Zaren und dem General bis zum Kartentisch. Genau wie zuvor in Scheremetews Zelt, wählte er die richtige Karte und zwei Stück Kreide aus. Diese kurze Denkpause gestattete ihm, seine Angst wieder unter Kontrolle zu bringen. Als er die kühle Kreide in seiner Rechten hielt, überkam ihn plötzlich eine seltsame Ruhe. Es war eine Ruhe, die er immer dann spürte, wenn er in seinem Leben um alles oder nichts spielen musste und unbedingt gewinnen wollte.
»Seht, Herr, dies sind die russischen Stellungen«, begann er, »und hier liegen Eure Schiffe im Don. An dieser Stelle befinden sich die türkischen Wachtürme, und die Schiffe der Wesire Ali, Bekir und Hasam Pascha müssten ungefähr hier sein. In der unteren Don-Biegung liegen bereits ein paar kleinere türkische Schiffe und entladen Munition und Verstärkung für die Garnison. Wenn Ihr zuerst die beiden Wachtürme nehmt, während Eure Fußsoldaten und Artilleristen gleichzeitig den Belagerungsring um die Stadt ausdehnen, und dann Eure Schiffe in die Asow-See einfahren lasst, dann könnt Ihr die Türken zur See angreifen und eine Anlandung von Entsatz verhindern, während Ihr die Festung zu Lande gleichzeitig von allen Seiten angreift. Sollte es Euch gelingen, die Kriegsschiffe der Wesire zu vernichten oder zum Rückzug ins Schwarze Meer zu zwingen, dann macht Ihr Euch zum Herrn des einzigen Weges in die Stadt hinein: der geheime Tunnel am Ostwall, der von der ersten Don-Biegung in die Garnison führt! Ahmed Pascha hat dann nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder er verschießt seine restliche Munition und wird dann von Euch ausgehungert, oder er akzeptiert die Reddition!«
Der Zar hatte dem Juden aufmerksam zugehört, obwohl er, von seiner rastlosen Energie getrieben, unablässig in seinem großen Zelt auf und ab gegangen war. Über das Gesicht des schottischen Generals Patrick Gordon hatte sich ein leichtes, kryptisches Lächeln gelegt. Scheremetew starrte die Karte an.
»Wie bist du an deine Informationen gekommen!«
Der Zar hatte mitten in seiner Bewegung innegehalten und sich Schafirow zugewandt. Fest blickte er ihm in die Augen. Es war ein Blick, der kein Ausweichen und keinen Widerspruch duldete. Obwohl der Jude sich insgeheim unbehaglich fühlte, denn der Mann, dem er gerade vorgetragen hatte, war ein absoluter Herrscher über Leben und Tod und damit in seinen Handlungen völlig unberechenbar, versuchte er doch, so gelassen wie möglich zu scheinen.
»Als Diamantenhändler komme ich viel herum. Ich habe ein Kontor in der Festung und treibe meinen Handel auch mit den türkischen Offizieren und Soldaten. Von der Ankunft der Wesire weiß ich von einem Offizier der Leibgarde des Ahmed Pascha. Den Tunnel und den Nachschub habe ich mit eigenen Augen gesehen, und den ganzen Rest konnte ich im Verlauf der letzten Woche beobachten, wenn ich nachts auf die Wälle von Asow stieg.«
Zar Peter betrachtete sein Gegenüber aufmerksam. Der Mann war nur wenig älter als er selbst. Sein Russisch war perfekt und zeugte von guter Bildung, seine Ausdrucksweise gewählt und präzise. Er konnte offenbar sehr logisch denken und schlussfolgern. Seine Kleidung verriet – obwohl sie staubig war –, dass er gewiss nicht zu den Ärmsten der Armen gehörte, die für einen Brocken Brot und aus Verzweiflung jeden Unsinn erzählten. Seine Haltung strahlte viel Selbstsicherheit aus, und seine Augen waren ohne Furcht.
Der Mann gefiel Zar Peter, denn der Zar war jung und emotional – und er konnte sich für gute Dienste sehr dankbar erweisen, wenn er hierzu in der richtigen Stimmung war.
»Bringt ihn in einem bequemen Zelt unter! Lasst ihn gut ausruhen und kümmert Euch darum, dass er alles bekommt, was er möchte!«, befahl der Zar einem Ordonnanzoffizier aus dem Regiment Preobraschenskoje.
Dann streckte er Schafirow die Hand entgegen. »Danke, mein Freund! Wir werden jetzt über alles, was du uns berichtet und vorgeschlagen hast, nachdenken. Ruhe dich inzwischen aus! Ich werde nach dir schicken lassen, sobald wir unseren Beschluss gefasst haben!«
Der Jude nahm die angebotene Hand verwundert an und erwiderte den festen Händedruck des Zaren.
Nachdem der Diamantenhändler das Zelt verlassen hatte und Peter Alexejewitsch mit seinen Generälen Gordon und Scheremetew alleine war, ließ er sich wieder in seinen alten Stuhl fallen und schenkte sich ein großes Glas Wodka ein. Die beiden Offiziere taten es ihm gleich, während Stabskapitän Graf Tolstoi Feder und Papier zur Hand nahm und darauf wartete, was man ihm diktieren würde.
»Ein interessanter Mann!«
Patrick Gordon hatte bereits seit Wochen mit ähnlichen Gedanken gespielt wie denen, die von Schafirow vorgetragen worden waren. Aber da es in der Belagerungsarmee keine Kommandoeinheit gab und jeder irgendwie immer tat, was er wollte, ohne auf die Einwände und Befürchtungen des anderen zu hören, war nie etwas Vernünftiges zustande gekommen. Immer wenn er vortrug, verbündeten Schein, Scheremetew und Lefort sich gegen ihn. Immer wenn einer der drei anderen sprach, veränderte die Bündnisstruktur sich dementsprechend aus Stolz, Verbohrtheit und Furcht, vor dem Zaren einen Fehler eingestehen zu müssen. Für Patrick Gordon waren Schafirow und sein kleiner Vortrag ein willkommenes Geschenk.
»Ich muss Euch sagen, Peter Alexejewitsch«, sagte Scheremetew schmunzelnd zu seinem Herrscher, »Schafirow ist Jude!«
Der Zar trank sein Glas in einem Zug leer, knallte es auf den Tisch und lachte schallend. »Das war unser Herr Jesus Christus auch! Ich bin ein rechtgläubiger, orthodoxer Christ, der alte Gordon hier ist ein häretischer, katholischer Götzendiener, mein Freund Sascha Menschikow, der sich draußen mit Kanonen und Kriegspielen vergnügt, ist ein altgläubiger Teufelsanbeter und Graf Tolstoi ein kalter Fisch, auf den ich mir einfach keinen Reim machen kann! Der Mann gefällt mir, und er kann mir nützlich sein. Wenn wir die Türken besiegt haben, werde ich sehen, was wir mit ihm anstellen!«
»Er bat für diese Informationen um sein Leben und freies Geleit nach Polen«, bremste Scheremetew den Enthusiasmus seines Zaren.
Peter Alexejewitsch schenkte sich nach und leerte das zweite Glas Wodka ebenfalls in einem Zug. »Sein Leben soll er haben und Gold und eine feine Stellung bei Hof, aber nach Polen ziehen lasse ich ihn gewiss nicht! Russland ist ein rückständiges Land. Ich brauche kluge, gebildete Männer hier an meiner Seite, wenn ich dieses Land zu einer Großmacht in Europa machen will!«
»Lasst uns erst über die Festung befinden!«, seufzte der alte Patrick Gordon verzweifelt.
Bombardier Peter war manchmal wie ein Kind. Er konnte noch nicht entscheiden, was wichtig und was unwichtig war. Zuerst mussten sie mit den Türken fertig werden, dann konnte man sich immer noch überlegen, mit welchen Argumenten man Schafirow in den Dienst presste. Der Schotte wusste aus eigener Erfahrung, dass es aus dem Moskowiterreich kein Zurück mehr gab: Selbst als König James II. von England Peters Vater Alexei Michailowitsch darum ersucht hatte, Gordon wieder nach Hause zu entlassen, war ein Erfolg ausgeblieben. Der General hatte sich zwischenzeitlich damit abgefunden, dass er sein Leben auf russischer Erde beschließen und die heimatlichen schottischen Berge nie wiedersehen würde.
Wie jeden Tag, sobald es dämmerte, schlug Peter Schafirow die Augen auf, obwohl ihn niemand geweckt hatte. Das Donnern der russischen und türkischen Kanonen hatte nicht nachgelassen, aber in dieser Nacht nach seiner Flucht aus der Festung von Asow hatte er doch zum ersten Mal seit Wochen wieder wunderbar geschlafen. Er sah sich in dem Zelt um: Man hatte seinen staubigen Kaftan fortgenommen und ihm dafür ein russisches Gewand und einen russischen Mantel hingelegt. Die Kleidungsstücke waren prachtvoll gearbeitet, der Pelz schien Nerz zu sein. Seine Reitstiefel waren sauber gebürstet worden, und auf einer kleinen Truhe fand er seinen Dolch und die beiden englischen Pistolen wieder. Er atmete erleichtert auf. Offenbar verlangte es den Zaren aller Reußen nicht nach seinem Blut, obwohl Scheremetew seinem Herrscher zwischenzeitlich wohl bereits gestanden hatte, dass der Mann mit den interessanten Informationen aus Asow ein Jude war.
Reflexartig tastete Schafirow nach dem Beutel mit den Diamanten an seiner Brust. Er war immer noch da. Niemand hatte versucht, ihn während seines todesähnlichen Schlafes zu berauben. Er beschloss, sich zu waschen und anzukleiden. Dann würde er weitersehen. Noch bevor er zu den Kleidern greifen konnte, huschte eine gebückte Gestalt auf ihn zu.
»Herr, man hat mir befohlen, Euch zu Diensten zu sein. Wie sind Eure Anordnungen!«
Schafirow zuckte zusammen und drehte sich um. Der Mann war steinalt und trug ein grobes, knielanges, bunt besticktes Hemd. Sein Gesicht lag hinter einem dichten Bart und einer riesigen Fellmütze verborgen. Er roch entsetzlich nach Schweiß, Küche und Rossäpfeln.
»Wie heißt du, Väterchen!«
»Dima, Herr! Zu Euren Diensten, Herr!«, antwortete der Alte unterwürfig, ohne die Augen auf sein Gegenüber zu richten.
»Dima, gibt es hier irgendwo heißes Wasser, Seife und ein Rasiermesser?«, versuchte der Jude sein Glück.
Der Mann hob den Kopf und sah ihn erschrocken an. »Ich verstehe Euch nicht, Herr!«
»Schon gut! Besorge mir ein sauberes Tuch und irgendetwas zu essen!«
Der Alte grinste und verschwand erleichtert aus dem Zelt. Schafirow schüttelte den Kopf. Als ob die Frage nach heißem Wasser, Seife und einem Rasiermesser etwas Gotteslästerliches in sich hatte. Die Moskowiter waren eben ein barbarisches, rückständiges Volk ohne jegliche Kultur und ohne das Bedürfnis nach Komfort und etwas Sauberkeit. Er goss kaltes Wasser aus einem Krug in eine Tonschüssel und versuchte, den Schmutz der Flucht aus Asow so gut wie möglich zu entfernen. Gerade als er fertig war, tauchte Graf Peter Tolstoi in seinem Zelt auf. Fröhlich begrüßte der Stabskapitän den Juden.
»Ihr habt den alten Dima in Angst und Schrecken versetzt!«, spottete er und warf Schafirow ein sauberes Handtuch zu. »Er ist zu mir gerannt, als ob er dem Antichrist begegnet wäre! Zieht Euch an und folgt mir. Man erwartet uns bereits im Zelt des Zaren.«
Schafirow fuhr sich mit der Hand unzufrieden über das stoppelige Kinn. Dann griff er seufzend zu den Kleidungsstücken, zog sich genauso seufzend an und wollte bereits Tolstoi folgen.
»Vergesst nicht Euer Waffenarsenal, Peter Pawlowitsch! Ihr habt gestern einen großen Eindruck bei unserem Herrscher hinterlassen. Und er schätzt es, wenn die Männer an seiner Seite wehrhaft sind!«
Dann klopfte er dem Juden bewundernd auf die Schulter und strich mit der Rechten an einem der langen, pelzbesetzten Ärmel des Mantels entlang. »Ein ganz beachtlicher Aufstieg in so kurzer Zeit. Peter Alexejewitschs eigene Sachen!«
Schafirow legte den Kopf schief und blickte Tolstoi verlegen an. »Meine waren weg, und diese lagen an ihrer Stelle.«
»Natürlich haben wir sie verbrannt! Ansonsten wäre noch irgendein schießwütiger Strelitze oder Soldat auf die Idee gekommen, Euch mit einem Türken zu verwechseln. Ihr hattet gestern Nacht wirklich Glück, gerade über mich zu stolpern!«
Tolstoi ging aus dem Zelt, und Schafirow folgte ihm. Leise hörte er den Offizier vor sich hinmurmeln. »Besser gesagt, hatten wir Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Ansonsten würden wir auch noch den Winter vor dieser verdammten Festung zubringen.«
Kaum eine Stunde später setzte sich ein Trupp aus zweihundertfünfzig Donkosaken in Bewegung, der den Auftrag hatte, die Mündung des Don zu erkunden und festzustellen, wie viele türkische Schiffe dort bereits ankerten. Die Reiter bestätigten Schafirows Informationen aus der vorhergehenden Nacht, und Zar Peter erteilte General Gordons bestem Regiment den Befehl, sich auf neun russischen Galeeren einzuschiffen und, begleitet von vierzig Kosakenbooten, den Fluss hinunterzufahren. Gleichzeitig befahl er den Donkosaken unter ihrem Hetman Scherebzow, einen Angriff gegen den Wachturm am linken Don-Ufer zu unternehmen. Bereits in der Nacht musste ein Beschluss gefasst worden sein, Artillerie von der Festung abzuziehen und flussaufwärts in Stellung zu bringen.
Die Überraschung gelang. Die Türken wurden von den Russen völlig aufgerieben, und die Kosaken nahmen den Wachturm im Handstreich. Als die Türken im Wachturm am rechten Don-Ufer des ersten Erfolges der Belagerer gewahr wurden, gaben sie kampflos auch diese Position auf und zogen sich in heller Panik nach Asow zurück. Kurz vor Einbruch der Nacht wurden die beiden schweren Ketten, die die Ausfahrt aus dem Don in die See hinein versperrten, unter frenetischem Jubel der Belagerer hochgezogen. Die neun Galeeren und vierzig Kosakenboote glitten stolz an diesem Hindernis vorbei auf die Festung zu. Zar Peter selbst befand sich an Bord eines der Schiffe.
Schafirow beobachtete inmitten der russischen Infanteriesoldaten das Spektakel. Er war erleichtert, dass sein Rat zu einem Erfolg für die Moskowiter geführt hatte. Damit war seine Haut zumindest für die nächsten paar Tage gerettet.
General Scheremetew brachte sein Pferd neben dem des Juden zum Stehen. Der Offizier sah müde und mitgenommen aus, denn er hatte die ganze Nacht damit zugebracht, gemeinsam mit dem Zaren und Gordon Wodka zu trinken und aus den Ideen und Informationen von Schafirow einen vernünftigen Operationsplan zu entwickeln. Artillerie und Infanterie hatten bewegt werden müssen. Der Schweizer Lefort war hektisch damit befasst gewesen, Fußsoldaten einzuschiffen und die Kosakenboote an einer Stelle im Don zu sammeln. Doch trotz seiner Müdigkeit und Erschöpfung war der Soldat bester Dinge. Wochenlang hatte sich vor Asow nichts mehr bewegt. Es war nur noch ein Austausch von Brandgeschossen und Eisenkugeln gewesen, bei dem es keinen Gewinner und keinen Verlierer gab, sondern nur sinnlose Opfer, meist aufseiten der Belagerer. Jetzt war Bewegung in die Sache gekommen. Die Russen hielten endlich wieder die Initiative in Händen. Er brauchte Bewegung und Initiative, um zu kämpfen, genauso wie der Schotte Gordon Initiative und Bewegung brauchte. Doch er und Gordon hätten sich ohne äußeren Einfluss nie einigen können. Dazu war jeder zu stolz und zu machtbewusst und zu sehr darauf bedacht, die Gunst des Zaren nicht zu verlieren. Schafirow war überraschend aufgetaucht und hatte Peter Alexejewitsch eine Idee verkauft, die auch in Scheremetews Kopf herumgeschwirrt war. Doch dieses Mal hatte der Zar befohlen und nicht Rat bei ihm oder Patrick Iwanowitsch gesucht. Damit war der Operationsplan konsensfähig geworden. Was der Zar befahl, taten alle ohne Widerspruch.
»Für einen Kaufmann hast du ein gutes Auge in militärischen Dingen, Peter Pawlowitsch«, raunte er Schafirow zu.
Der Jude wandte seine Augen einen Augenblick lang vom Schauspiel der vorbeigleitenden Galeeren und Boote ab und lächelte Scheremetew wissend an. Doch er war klug genug, sich jeden Kommentar zu sparen. Als er in der Nacht diesen sonderbaren Ausdruck auf dem Gesicht des schottischen Generals Gordon bemerkt hatte, da hatte er auch ohne große Erklärungen verstanden, was vorging. Diese Moskowiter Barbaren waren trotz ihres Riesenreiches schon immer schwach gewesen, weil sie sich nie einigen konnten und jeder, der ein bisschen Macht hatte, immer mit aller Gewalt seinen Kopf durchsetzen musste. Wenn man an einem Russen kratzte, dann kamen sicher die geschlitzten, bauernschlauen Augen eines Mongolen hinter der Fassade hervor: Korruption, Machtspiele, Intrigen und Vetternwirtschaft! Als er in England gewesen war, da hatte er gesehen, wie mächtig auch die kleinste Insel werden konnte, wenn alle sich nur einig waren und für ein gemeinsames Ziel kämpften.
Schafirow bewunderte König Georg I. und die Lords. Sie verstanden es sehr wohl, ein gemeinsames Ziel über Einzelinteressen zu stellen. Deswegen war diese kleine, sturmgepeitschte Insel im Atlantik ein unumgänglicher Faktor der Macht in Europa geworden. Deswegen wagte es kaum einer, die Engländer herauszufordern oder gar anzugreifen. Leicht zog er die Zügel seines Pferdes an und wendete das Tier, um vom Ufer des Don zurück ins Feldlager zu reiten. Er wollte beobachten, was Scheremetews Konkurrent Gordon in diesem Augenblick tat.
Ahnungslos luden die Türken Munition und Verstärkung von ihren Schiffen in der ersten Biegung des Don ab. Sie glaubten sich sicher und unbeobachtet, und insgeheim lachten sie über die Dummheit der Russen. Durch den geheimen Tunnel strömten Männer ins Innere von Asow, und Ahmed Pascha war zuversichtlich. Sein Informant im russischen Heerlager würde bald auftauchen und ihm berichten, was Zar Peter vorhatte. Die Schiffe von Ali, Bekir und Hasam Pascha würden bereits in den frühen Morgenstunden des neuen Tages in den Don einfahren und ihre Entsatztruppen im Rücken der Russen tief im Landesinneren anlanden.
Vorsichtig hatte General Patrick Gordon seit Sonnenaufgang den Belagerungsring um Asow immer weiter in die Länge gezogen. Die Soldaten und Strelitzen waren in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden, und Kosaken patrouillierten unablässig entlang des Belagerungsringes, bei den Nachschubbasen und um den Artilleriepark. Immer wieder schlugen sie kleine Gruppen tatarischer Reiter zurück, die versuchten, sich den russischen Stellungen zu nähern. Der alte Soldat und sein Stab überließen nun nichts mehr dem Zufall. Zar Peter hatte befohlen, und weder Scheremetew noch Schein noch Lefort oder der vorlaute Menschikow hatten sich auf irgendwelches Geplänkel eingelassen. Schon vor Wochen hätten sie sich zu dieser Aktion entschließen sollen! Asow wäre bereits ausgehungert oder im Sturm gefallen. Aber in diesem verdammten Moskowiterreich musste ja immer jeder sein eigenes Spiel treiben, um seine eigenen Ziele zu verfolgen, anstatt einmal die Ärmel aufzukrempeln und den Eigennutz hintenan zu stellen. Gordon verfluchte seine eigene Sturheit: Er hätte selbst nur ab und an einmal nachgeben müssen oder versuchen sollen, mit Scheremetew vernünftig unter Männern zu diskutieren. Beide waren sie erfahrene Berufssoldaten.
»Verdammt, mehr als dreißig Jahre in diesem Narrenhaus zu leben, hat mich schon zu einem sturen Russen werden lassen!«, murmelte er vor sich hin, während er seinem großen weißen Pferd den Hals tätschelte.
Schafirow hatte seinen Weg durch das Heerlager bis zu General Gordon erfragt. Es war mühselig gewesen, sich in dieser wirren Ansammlung von Menschen, Zelten, Geschützen und Trosswagen zurechtzufinden und gleichzeitig ein nervöses Reittier zu bändigen, das bei jeder Explosion zusammenschrak und nur noch daran dachte, die Flucht zu ergreifen, doch schließlich machte er den dunkelblauen, federgeschmückten Dreispitz des alten Schotten und seine aufrechte Gestalt in einer bunten Ansammlung traditioneller russischer Uniformen und Schap’kas aus.
Er stieß seinem nervösen Pferd die Hacken bestimmt in die Flanken und trieb es zu einem widerwilligen Trab an. Niemand bemühte sich, ihn zu begleiten oder zu beaufsichtigen. Wo er auftauchte, machte man ihm anstandslos den Weg frei. Es wäre in diesem Augenblick so einfach gewesen, den Barbaren den Rücken zu kehren und auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Er hatte ausreichend Diamanten in seinem Ledersäckchen um den Hals, um sich den Weg bis zur polnischen Grenze zu erkaufen. Er hatte seine Waffen, und er hatte ein ganz ordentliches Pferd unter dem Sattel. Aber Peter Schafirow war einfach zu neugierig. Er wollte mitverfolgen, wer das große Spiel um Asow gewann. Russen oder Türken! Außerdem hatte der junge Zar ihm irgendwie gefallen, ja sogar Vertrauen eingeflößt. Er benahm sich anständig und kein bisschen hochmütig, und Scheremetew hatte ihm schließlich sein Wort gegeben. Als er seinen schreckhaften, hochbeinigen Fuchs neben General Gordon zügelte, begrüßte der Schotte ihn freundlich.
»Für einen Kaufmann habt Ihr ein gutes Auge für militärische Dinge!«
Schafirow konnte sich ein spöttisches Grinsen nicht verkneifen.
»Was ist?«, brummte Gordon.
»Diesen Satz habe ich heute schon einmal gehört, General!«
Jetzt grinste Gordon spöttisch und nickte wissend. Dem Juden stand der Sinn nicht danach, sich in irgendwelche Plänkeleien zwischen den hohen Offizieren des Zaren einzumischen. Er lenkte schnell vom Thema ab.
»Ich habe vor zwei Jahren Euer Land besucht. Es war beeindruckend und sehr lehrreich.«
»Was gibt es Neues von den Inseln?«, ließ der General sich auf die Plauderei ein.