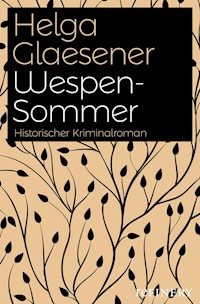9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Schwestern, drei Schicksale – ein Ort der Menschlichkeit Amrum, 1920: Nur widerwillig kehrt Frida zur Beerdigung des Großvaters zurück auf ihre nordfriesische Heimatinsel. Der alte Kapitän Kirschbaum gehörte zu Amrum wie die Wellen zum Strand. Aber für Frida hatte er zuletzt kein gutes Wort übrig. Ihren Traum, in Hamburg Medizin zu studieren, hielt er für Weiberflausen und drehte ihr den Geldhahn kurzerhand zu. Dabei hätte der Insel-Patriarch eine vertrauenswürdige Ärztin in dem kleinen Hospital, das er für lungenkranke Kinder gestiftet hat, gut gebrauchen können. Nach seinem Tod droht der Einrichtung nun wegen Geldmangels das Ende. Aber was wird dann aus den kleinen Patienten? Fridas Mutter will aus der imposanten Strandvilla lieber ein exklusives Kurhotel machen. Auch von ihren beiden Schwestern kann Frida keine Hilfe erwarten. Dennoch nimmt sie den Kampf auf – und ahnt nicht, wie hoch der Preis für sie und ihre Familie sein wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Helga Glaesener
Das Seehospital
Roman
Über dieses Buch
Drei Schwestern, drei Schicksale – eine Insel
Eine Insel in den Stürmen der Zeit – ein Ort der Menschlichkeit
Eine Insel in den Stürmen der Zeit – ein schicksalhaftes Zuhause für drei Schwestern
Das Haus in den Dünen, ein kostbares Vermächtnis, drei Schwestern im Kampf für Gerechtigkeit
Amrum 1920: Der alte Karl Kirschbaum gehörte zur Insel wie die Wellen zum Strand. Nach seinem Tod droht nun auch dem Seehospital, das er für lungenkranke Kinder eingerichtet hatte, das Ende. Es fehlt an Geld und Personal, das Erbe fortzuführen. Seine Schwiegertochter will aus der imposanten Strandvilla ohnehin lieber ein exklusives Kurhotel machen. Von den drei Kirschbaum-Enkelinnen kämpft vor allem Frida, die Älteste, für den Erhalt des Hospitals. Auch wenn das bedeutet, dass sie nach Amrum zurückkehren und ihre Ausbildung zur Krankenschwester am Hamburger Universitätsklinikum aufgeben muss. Dort, wo sie jüngst ihr Herz vergeben hat. Aber jetzt wird sie auf Amrum gebraucht. Frida ahnt jedoch nicht, wie weit die Mutter gehen wird, um ihre Interessen durchzusetzen …
Liebe, Leid und Intrigen – das Schicksal einer Familie im Seebad Amrum Anfang des 20. Jahrhunderts
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Silke Jellinghaus
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildungen akg-images, mauritius images/Paul Fearn/Alamy
Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen
ISBN 978-3-644-40346-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1.FRIDA
Großvater ist tot.
Was hat der Mensch zu fühlen, wenn er so eine Nachricht erhält? Trauer? Auflehnung? Verzweiflung? Frida strich über das Telegramm, das vor ihr auf dem schmalen Holzpult lag. Ihre Hände zitterten leicht. Das Stimmengewirr ihrer Mitstudenten – fast ausschließlich Männer, angehende Ärzte in Hemd und Weste, mit Nickelbrillen und tintenbefleckten Fingern – erfüllte die Luft. Gelächter, Besserwisserei, kleinlaute Fragen der Faulpelze und Fetzen verwegener Flirts mit den wenigen Studentinnen drangen an ihr Ohr. An gewöhnlichen Tagen liebte sie diese Atmosphäre, sie gab ihr das Gefühl, lebendig und in ihrem Element zu sein. Aber heute fühlte sich jeder Laut wie ein Peitschenhieb an. Die blau und orange bemalte Stuckdecke senkte sich herab, als wollte sie sie erdrücken, das Sonnenlicht verblasste.
Frida legte die Hände flach auf das Papier. Durch ihren Kopf zogen längst vergangene Szenen: Tabakrauch in Großvaters Stube, seine krächzende Stimme, die aus dem eisgrauen Bart drang, Schenkelklopfen, scharf gezischte Vorwürfe, verlegene Umarmungen … Die Bilder waren da, aber Gefühle dazu wollten sich einfach nicht einstellen.
Dabei war es doch Großpapa gewesen, der sie zu dem Menschen geformt hatte, der sie heute war. Er hatte sie seit ihrer Kindheit ermutigt, Dinge auszuprobieren, ihr später gegen den Willen der Mutter zugeredet, sich in Hamburg zur Krankenschwester ausbilden zu lassen, und sogar die Kosten dafür getragen. Ohne ihn säße sie jetzt immer noch auf Amrum, womöglich gefangen in einer dumpfen Ehe. Sie war ihm also von Herzen dankbar. Warum war ihr trotzdem so leer zumute? Frida meinte die Stimme ihrer Mutter zu hören: Zu viel Verstand, zu wenig Gemüt, das ist deine Schwäche, Kind.
«Was steht denn drin?» Annemie, ihre Kommilitonin, stieß mit dem Fuß gegen ihr Bein. Sie hatte ihr das Telegramm aus dem Erikahaus mitgebracht, dem Wohnheim der Krankenschwestern, wo es am Vormittag abgegeben worden war. Frida suchte nach Worten, kam aber nicht zum Antworten, weil Professor Schneider ans Pult trat und sein Manuskript zurechtrückte.
«Nun sag schon», zischte Annemie. «Von …»
«Könnte man die beiden Damen in der fünften Reihe überreden, ihr Schwätzchen nach der Vorlesung weiterzuführen?», fiel Schneider ihr ins Wort. Er hielt nichts von Frauen an Universitäten und ließ es die Studentinnen bei jeder Gelegenheit spüren. Frida wartete ab, bis er aus seiner Kladde vorzutragen begann. Dann senkte sie unauffällig den Blick auf das braune Papier und überflog noch einmal die wenigen Worte. Aufgegeben: Telegraphenstation Wittdün auf Amrum. Datum: 6. April 1920. Adressat Frida Kirschbaum. Inhalt: Großvater ist tot.
Unvermittelt stieg Zorn in ihr auf. Wie hatte Mutter nur ein so herzloses Telegramm aufgeben können? Es hätte heißen müssen: Dein geliebter Großpapa ist heute Nacht verschieden. Komm bitte zu uns nach Hause. In Liebe, deine Mutter. Hatte sie sich aus Geiz so kurz gefasst? Oder drückte sie mit den dürren Worten ihre tiefsitzende Abneigung gegen Großpapa aus?
«Es wäre erfreulich, wenn Sie sich endlich den Folgen langanhaltender Hypertonie zuwenden könnten, junge Frau!»
Vierzig Studenten und acht Studentinnen bevölkerten den kleinen Hörsaal der medizinischen Fakultät. Alle starrten Frida jetzt an. Vor allem die Frauen in ihren adretten Blusen blickten vorwurfsvoll. Sie kämpften täglich mit dem Vorurteil, für den Arztberuf zu empfindlich zu sein, in dramatischen Situationen zu unentschlossen und natürlich auch zu dumm. Entsprechend hassten sie es, wenn eine von ihnen bei einem Fauxpas ertappt wurde.
Frida blickte verkrampft auf den Professor, der seinen Vortrag wieder aufgenommen hatte und nun storchenhaft vor den Bankreihen auf und ab stolzierte. «… muss man wissen, dass Hypertonie häufig durch eine Verengung der Nierenarterie verursacht …»
Ihre Hand lag auf dem Telegramm, das Papier fühlte sich an wie ein heißes Blech, und endlich gestand sie sich ein, warum sie kaum Trauer verspüren konnte. Sie hatte Großpapa immer noch nicht den Spott vergeben, den sie über sich hatte ergehen lassen müssen, als sie ihm offenbarte, dass sie Medizin studieren wolle. Flausen, Weiber werden hysterisch, wenn es knifflig wird, sie sind nicht hart genug, der Mensch muss seinen Platz kennen … Als sie sich trotzdem einschrieb, drehte er ihr kalt den Geldhahn zu. Du kommst schon noch zurückgekrochen. War sie aber nicht, und bei ihren anschließenden Besuchen auf der Insel hatte Großpapa sie kühl behandelt.
«… hören wir zu diesem Thema unseren ausländischen Gast, Herrn Dr. Tylor.»
Die Stille, die Schneiders Worten folgte, ließ Frida aufschrecken. Verstohlen beobachtete sie den korrekt gekleideten Mann, der neben den Bankreihen die Treppe hinabstieg. James Tylor arbeitete erst seit wenigen Monaten in der Eppendorfer Klinik. Ein Engländer, guter Internist, hieß es, aber langweilig. Frida war ihm einige Male zwischen den Krankenhauspavillons begegnet.
«Was ist denn nun?», wisperte Annemie, aber Frida reagierte nicht. Nur kein weiterer Rüffel!
Tylor hatte das Pult erreicht – ohne Kladde, fiel ihr auf. Er war noch jung, sie schätzte ihn auf Mitte dreißig, mit beginnenden Geheimratsecken und einem klugen, aber verschlossenen Gesicht. Frida wusste, dass Schneider ihn hasste. Der Professor hatte im Krieg vier Söhne verloren. Der Engländer war für ihn der Mörder seiner Kinder, und er hatte sich lange gegen dessen Anstellung an der Eppendorfer Klinik gesträubt. Angeblich hatte er sogar gedroht, die Klinik im Fall des Falles zu verlassen, diese Drohung dann aber doch nicht wahr gemacht. Seine verächtlich herabgezogenen Mundwinkel zeigten, wie sehr er hoffte, sein Kollege würde sich blamieren.
Doch Tylor dozierte kenntnisreich über die Ursachen der Hypertonie. «… renovaskulär durch eine Verengung der Nierenarterie, parenchymal durch eine Nierenkrankheit … Im Anfangsstadium kann der Bluthochdruck ohne äußere Beschwerden verlaufen, aber wenn er chronisch wird, äußert er sich oft in Müdigkeit, Kopfschmerz und einer Verminderung der Leistungs…»
Frida verlor sich erneut in Grübeleien. Warum hatte ihr niemand geschrieben, dass Großpapa leidend war? Oder war sein Tod überraschend gekommen? Ihre Schreckstarre löste sich in Vorwürfen auf. Sie hätte über Weihnachten nach Hause auf die Insel fahren sollen. Vielleicht hätte sie Symptome entdeckt und ihm helfen können, vielleicht würde er noch leben, wenn sie sich nicht hätte überreden lassen, während der Weihnachtsfeiertage Dienst zu tun. Nun kamen sie doch, die Tränen. Verstohlen wischte sie sie mit der Spitze des kleinen Fingers aus dem Augenwinkel. Sie merkte, dass Tylor sie beobachtete, und senkte den Kopf. Sie war stark, niemand sollte sie weinen sehen.
Plötzlich kam ihr ein weiterer entsetzlicher Gedanke: Sie musste natürlich zur Beerdigung heim nach Amrum fahren. Und das hieß, dass sie wenigstens eine Woche bei der Arbeit und den Vorlesungen fehlen würde. Aber das konnte sie sich auf keinen Fall leisten.
Ihr wurde kalt und ein bisschen übel.
«Du dramatisierst», meinte Annemie, als sie nach der Vorlesung an einem schäbigen Warenhaus und einem Zeitungsstand vorbei zur Haltestelle der Elektrischen am Mittelweg eilten. «Du hast doch … Oh, da kommt sie schon, Mist …» Ein offener, kaum gesicherter Gulli versperrte den Weg. Sie mussten ihn umkreisen und rennen, um die gelb-grüne Tram noch zu erwischen, die gerade mit Gebimmel um die Ecke bog. Atemlos, die Hände an den Hüten, quetschten sie sich auf die letzten freien Plätze in der dritten Klasse. Ihnen gegenüber saß eine abgemagerte Frau, an die sich auf jeder Seite ein kleines Mädchen schmiegte, beide so dürr wie die Mutter. Der Krieg war vorüber, aber der Hunger geblieben und vielleicht sogar noch schlimmer geworden. «Bauern retten im Moment mehr Leben als Ärzte», hatte einer ihrer Professoren letztens gemeint.
Annemie klammerte sich an der Haltestange fest und beugte sich zu Fridas Ohr. «Jeder fährt nach Hause, wenn der Großvater stirbt, das gehört sich so. Natürlich kriegst du dafür frei!», zischte sie.
Sie hatte gut reden. Annemie bekam das Studium von ihren unfassbar großzügigen Eltern bezahlt, für Frida war die Situation brenzliger. Als Großpapa sich geweigert hatte, sie weiter finanziell zu unterstützen, hatte sie die Oberin der Eppendorfer Klinik gefragt, ob sie ein bisschen Geld verdienen könne, indem sie den unbeliebten Wochenenddienst in den Krankenpavillons übernahm. Schwester Dietrich, die sie schätzte, hatte zugestimmt und sich bei der Universitätsleitung für sie eingesetzt, und als man dort ablehnend blieb, hatte sie sogar die Krankenhausverwaltung aufgesucht. Am Ende hatte man sich darauf geeinigt, dass Frida am Wochenende und in zwei Nächten Dienst tun würde und dafür weiterhin im Erikahaus wohnen und essen dürfe. In ihrer freien Zeit könne sie dann das Studium absolvieren. Wenn sie nun aber mindestens eine Woche ausfiel … Gerade jetzt, wo sich einige der Schwestern mit der Grippe angesteckt hatten …
«Rede mit Dr. Kröppke», schlug Annemie vor, als hätte sie ihre Gedanken mitgelesen. «Der ist in dich verschossen und hat ausreichend Charme, um die Oberin zu bequatschen.»
«Das ist doch Unfug!» Frida versuchte entrüstet zu klingen, musste aber gleichzeitig lächeln. Daniel Kröppke war vor einem Jahr aus Afrika an die Klinik gekommen. Vielleicht war es der Aufenthalt in der Fremde gewesen, der seinen Blick und sein Herz weit gemacht hatte. Er war ein umgänglicher Mensch, der mit den Patienten und Schwestern genauso unbeschwert scherzte wie mit seinen Kollegen. Und, ja … Er trieb sich tatsächlich auffallend oft in ihrer Nähe herum. Letztens hatte er vorgeschlagen, ihr bei einem Kaffee von der Schlafkrankheit zu erzählen, die unter den Afrikanern grassierte. Sie hatte abgelehnt, das Angebot war zu überraschend gekommen. Wer auf Amrum aufgewachsen war, neigte zur Verschlossenheit, dagegen kam sie immer noch nicht an.
«Was ist Unfug? Das mit der Oberin oder das mit Kröppke?» Annemie lachte auf, als sie Fridas Gesicht sah. «Aus dir wird kein Fräulein Doktor Kirschbaum, sondern eine Frau Doktor Kröppke, darauf verwette ich mein Stethoskop.» Unter der Hutkrempe zwinkerte sie Frida zu.
«Ihr Großvater, wie bedauerlich. Mein herzliches Beileid, Fräulein Kirschbaum.» Die Oberin, die als einzige der Eppendorfer Schwestern in Schwarz gekleidet war, faltete die Hände auf ihrem Schreibtisch, einem wuchtigen Möbel, dessen zerkratzte Oberfläche von langer Benutzung zeugte. Über ihrem mageren Busen hing die Kreuzkette, eine Schwesternbrosche hielt den engen Kragen zusammen, die weiße Haube thronte auf ihrem Kopf.
Und nun?
Frida blickte sich in dem nüchternen Büro um und wurde von Panik erfasst. Sie hatte erst kürzlich ihre erste Leiche seziert, einen jungen Tuberkulosetoten. Bereits vor seinem Ableben hatte sie eine Röntgenaufnahme der Lunge machen lassen und bei der Sektion festgestellt, dass sie in ihrer Beurteilung des Bildes richtig gelegen hatte: ein ausgeheilter Herd in Höhe der vierten Rippe, dazu verkalkte Lymphdrüsen, besonders an der rechten Lungenpforte … Die Möglichkeit, in einen Menschen hineinzusehen, ohne ihn aufschneiden zu müssen, war atemberaubend. Und man staunte bereits über neue Entdeckungen. In Paris hatte Calmette an einer Verbesserung seines Tuberkulose-Impfstoffs gearbeitet, den man vielleicht ebenfalls bald würde einsetzen können. Die Medizin war so aufregend, sie lebten in einer Zeit, in der sich die Erkenntnisse überschlugen, und sie hatte das unfassbare Glück, an dieser Entwicklung teilhaben zu können. Würde ihr Traum im nächsten Moment zerplatzen?
«Wie lange werde ich auf Sie verzichten müssen?»
O lieber Gott, alles ging gut. «Ich weiß noch nicht, wann das Begräbnis stattfindet, aber nicht mehr als eine Woche, denke ich. Vielleicht zehn Tage. Höchstens.» Sie versuchte, nicht allzu flehentlich zu klingen. Die Oberin lächelte. Und gab ihr den gewünschten Urlaub.
Frida fiel Annemie, die draußen im Flur auf sie gewartet hatte, um den Hals. Ihre Freundin lachte. «Kommst du mit ins Anno 1905? Da ist heute Musik, jemand singt, keine Ahnung … Oh, ’tschuldigung, du bist ja in Trauer. Oder willst du doch?»
Frida schüttelte den Kopf, und Annemie eilte mit wehendem Rock davon, die Personifizierung unbändiger Lebensfreude. Frida erklomm die breite, geschwungene Eichenholztreppe, die hinauf in die Wohnräume der Krankenschwestern führte. Das Zimmer, in dem sie lebte, war klein und nur kärglich ausgestattet, denn sie hatte keines der vorhandenen Möbelstücke durch etwas Eigenes ersetzt. Von Amrum etwas mitzunehmen wäre zu kompliziert gewesen. Rasch begann sie zu packen. Was würde sie brauchen? Lag in der Kommode ihres ehemaligen Kinderzimmers noch Unterwäsche? Hingen alte Kleider im Schrank? Oder hatte Mutter inzwischen alles fortgegeben? Damit hatte diese nämlich bei ihrem letzten Besuch gedroht. «Man sieht ja, dass es der Madame nicht mehr reicht, bescheiden bei ihrer Familie zu leben. Dann kann man auch Platz schaffen.»
Frida füllte den Koffer, bis nichts mehr hineinpasste. Sie starrte auf das fleckige Leder, und plötzlich legte sich etwas Schwarzes auf ihr Gemüt wie eine düstere Vorahnung. Amrum. Ihr wurde das Herz eng, als sie an die Insel dachte.
Es war noch kühl, als Frida am nächsten Morgen zum Hauptbahnhof fuhr. Frierend stieg sie aus der Elektrischen. Ihre Stimmung hob sich ein wenig, als sie die gelben Windröschen und Anemonen sah, die auf dem Platz vor der Bahnhofshalle blühten wie ein Hoffnungsschimmer auf wärmere Tage. Die Markisen vor den Geschäften waren ausgefahren, die Verkäuferinnen legten Waren auf den Tischen aus.
Frida eilte durch die Wandelhalle, in der sich Männer in eleganten Mänteln, aber auch Arbeiter mit zerknautschten, schmutzigen Ballonmützen und erschöpft wirkende Frauen in züchtiger Bürokleidung in einem steten Strom Richtung Bahngleise bewegten. Im Wartesaal für die erste Klasse wurden Tische eingedeckt und Blumenvasen aufgestellt, aus der Bahnhofsküche drang der Geruch frischen Gebäcks. Frida drängte sich eine der Treppen hinab zu dem Gleis, auf dem der Zug nach Bremerhaven einlaufen sollte. Hier unten war es noch kälter, und ihr Anflug von morgendlichem Optimismus schwand. Fröstelnd schlang sie die Arme um den Oberkörper.
Ein Bahnbeamter mit Mütze und Uniform senkte gerade das Metallschild, das anzeigte, welcher Zug als nächster einfahren würde. Natürlich nicht der nach Bremerhaven. Frida unterdrückte einen Seufzer. Die Aussicht, tagelang auf Amrum aushalten zu müssen, schlug ihr auf den Magen, sie hatte heute Morgen keinen einzigen Bissen runterbekommen. Gleichzeitig schämte sie sich. Zu Hause warteten doch auch ihre jüngeren Geschwister. Und Louise, Emily und Christian hatte sie wirklich gern. Stimmte es vielleicht doch, was Mutter ihr vorwarf? Besaß sie zu wenig Gemüt? Ihr Blick blieb an einem Warnschild hängen, das darauf hinwies, dass Damen mit unverdeckten Hutnadelspitzen von der Beförderung in Zügen ausgeschlossen waren. Im Krieg waren zwanzig Millionen Menschen gestorben, und die Bahn warnte vor Hutnadeln. Was für ein Irrsinn …
Sie zuckte zusammen, als plötzlich von der Treppe her ein lautes Rufen ertönte: «Fräulein Kirschbaum!»
Erstaunlich, wie schnell die Stimmung umschlagen konnte. Frida gab sich betont uninteressiert, als sie sich umdrehte, aber ihre Wangen füllten sich mit Glut.
«Na, das nenne ich aber unfreundlich, einfach zu verschwinden, ohne einer Menschenseele Bescheid zu geben.» Daniel Kröppke eilte über den Bahnsteig und packte ungestüm ihre Hände. Der offene Mantel flatterte um seine Beine, die Schirmmütze hing ihm schief auf dem Kopf. Er tat, als merke er nicht, wie sehr er sie überrumpelte.
«Keiner Menschenseele außer der Schwester Oberin und den Herren von der Verwaltung und der Armee der Erikaschwestern …», antwortete Frida lächelnd.
«Aber nicht dem armen Wurm, dem es das Herz brechen könnte.»
Die Glut in ihrem Gesicht wurde intensiver. Das war ziemlich deutlich. Kröppke hob ihre Hand und hauchte altmodisch einen Kuss darauf. «Kommen Sie auf einen Kaffee mit in den Wartesaal? Ich muss Ihnen etwas erzählen, Frida, unbedingt und auf der Stelle. Bitte! Es ist lebenswichtig.»
«Dr. Kröppke, mein Großvater …»
«… ist verstorben, verzeihen Sie, ich weiß. Erlauben Sie mir, Ihnen mein Beileid auszusprechen.» Seine Stimme klang gehetzt und flehentlich zugleich. «Ich würde Sie auch nicht bedrängen, wenn es warten könnte, halten Sie mich nicht für pietätlos. Aber es gibt Momente, in denen sich das Leben entscheidet. Weichenstellungen …», sagte er mit einem bedeutungsschwangeren Blick auf die Gleise. Er wollte sie mit sich ziehen, doch sie widersetzte sich.
Das Metallschild, das die eingehenden Züge anzeigte, war umgeschlagen worden: Bremerhaven stand dort nun. Gleichzeitig ertönte das Pfeifen einer Lokomotive, und schon rollte der Zug heran. Sein Zischen und Stampfen füllte die Bahnhofshalle. Das Licht, das durch das rußverschmierte Fenster über den Gleisen fiel, ließ die schwarzen Waggons glänzen.
«Ich flehe Sie an …»
Frida drehte sich wieder zu Kröppke um. Sie wusste nicht, was genau er von ihr wollte, aber plötzlich erfüllte sie helle Verzweiflung. Weichenstellungen … Sie mochte ihn gern, sehr sogar. Er war wie … wie die fleischgewordene Zuversicht, um die sie Tag für Tag rang. Ohne dass er dick gewesen wäre, besaß er ein fülliges, rundes Gesicht mit breiter Nase und einem offenen Lächeln, das sofort Vertrauen einflößte. Frau Dr. Kröppke … Andererseits: Sie kannten einander doch gar nicht. Frida schaffte es auf die Schnelle nicht, ihre Gefühle zu entschlüsseln. «Dr. Kröppke …»
«Sagen Sie bitte Daniel zu mir. Ich werde noch einmal nach Malawi gehen, Frida. Das ist es. Ich habe heute Morgen die Bewilligung vom Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten im Briefkasten gefunden. Ich darf meine Untersuchungen fortsetzen, die ich in Afrika begonnen habe. Sie wissen schon – zur Schlafkrankheit. Das Institut finanziert einen Anschlussaufenthalt. Kommen Sie mit. Bitte! Helfen Sie mir. Ich werde eine tüchtige Krankenschwester brauchen. Jemanden, der mehr fertigbringt, als Verbände zu wechseln, der auch nach der Arbeit …»
Der Zug war neben ihnen quietschend zum Stillstand gekommen. Türen öffneten sich. Frida musste einen Schritt beiseitetreten, um den Schaffner herauszulassen. «Dr. Kröppke … Daniel, mein Großvater …»
«Er würde es verstehen.» Kröppke beugte sich vor und küsste sie mutig auf die Stirn. «Mehr noch – er würde es begrüßen, wenn er wüsste, welche Gelegenheit sich Ihnen bietet.»
Nein, das würde er nicht. Großpapa hatte gewollt, dass sie nach der Schwesternausbildung nach Amrum zurückkehrte und in dem kleinen Seehospital aushalf, das er zum Gedächtnis an Fridas verstorbenen Vater gegründet hatte und in dem Kinder aus einem Hamburger Waisenhaus an der Seeluft genesen sollten. Aber da war noch etwas: Wenn sie mit Kröppke nach … wie hieß das? Malawi? … ginge, müsste sie ihr Studium aufgeben. Hätte sie damit nicht alles verraten, wofür sie so hart gekämpft hatte? Eiskalte Gedanken ohne Gemüt, würde ihre Mutter monieren. Doch das Studium war ihr so wichtig. Frida sah das Feuer in Kröppkes Augen. Er liebte sie und sie ihn vielleicht auch. Außerdem würde sie an seiner Seite an einer Art von Forschung teilhaben, die ihr vermutlich nie wieder angeboten würde …
«Einsteigen oder draußen bleiben?», blaffte der Schaffner.
Zögernd löste sie ihre Hände und erklomm mit ihrem Koffer die Stufen zum Waggon. Als sie sich in der Tür noch einmal umdrehte, sah sie die Enttäuschung in Kröppkes Gesicht. Er winkte kurz und ging dann mit hochgezogenen Schultern zur Treppe.
Sie hatte einen Fehler gemacht. Beim Ruckeln, mit dem der Zug sich in Bewegung setzte, wurde ihr das klar. Es ging ihr wie ein Stich ins Herz. Niedergeschlagen suchte sie sich einen Platz auf einer der harten Sitzbänke in der dritten Klasse und starrte durch die staubige Scheibe auf die vorüberziehenden Hamburger Häuser und dann auf die karge norddeutsche Landschaft.
Kurz vor dem Bremerhavener Bahnhof entdeckte sie in ihrer Manteltasche ein Foto. Sie zog es heraus. Daniel Kröppke war darauf abgebildet, in seltsam anmutenden kurzen Hosen und einem weißen, vorn geöffneten Kittel. Er musste es ihr heimlich hineingesteckt haben, wie auch immer er das geschafft hatte.
Auf ihr Gesicht stahl sich ein Lächeln.
2.FRIDA
Es war kurz nach fünf, als die Amrum-Fähre an der weit ins Meer reichenden Holzbrücke vor Wittdün anlegte. Das Wasser schäumte grau und weiß, der Wind riss an ihrer Kleidung. Hier war nichts mehr von der Hamburger Frühlingsidylle zu spüren. Frida packte ihren Koffer, schaffte es gerade noch, den Hut vor einer Windbö zu retten, und eilte über die Brücke dem Strand entgegen.
Dort blieb sie stehen, als wüsste sie plötzlich nicht weiter. Kaum einen Steinwurf entfernt, duckte sich die graue Inselbahn in ihrem Schuppen. Dahinter erhob sich das Kurhaus, das stolzeste Gebäude von Wittdün. Es hatte mehrere Fahnen gehisst, die hart im Wind flatterten, als gäbe es etwas zu verteidigen. In seinen Mauern befanden sich praktisch sämtliche moderne Einrichtungen für die Badegäste: eine Apotheke, eine Arztpraxis, ein kleiner Laden und natürlich die Poststelle, von der aus Telegramme zum Festland geschickt werden konnten. Rechts von dem Gebäude lagen die durch ein Spinnennetz von Wegen verbundenen Pensionen und Hotels, in denen vor dem Krieg der Kurbetrieb stattgefunden hatte.
Wittdün war erst vor wenigen Jahrzehnten mit der Ankunft der ersten Badegäste errichtet worden – und hatte der Insel einen beachtlichen Aufschwung beschert. Doch auf den Strandwegen und Terrassen, wo vor dem Krieg Männer mit Strohhüten und Frauen in bunten Seidenkleidern flaniert waren, wirbelte jetzt nur noch Sand. Amrums einstige Badegäste waren finanziell ruiniert oder im Krieg unter die Räder gekommen. Frida wusste, wie schwer das Ausbleiben der Gäste die Inselbewohner ankam. Hatte man anfangs noch über die Eindringlinge gewettert, die zweifellos die guten Sitten verderben würden, so war man bald dazu übergangen, Zimmer an sie zu vermieten. Pensionen und Hotels waren wie Pilze aus dem Boden geschossen, nicht nur hier, sondern überall auf der Insel. Sogar in Privathäusern wurden Zimmer vermietet. Manche Familien zogen gar während der Saison in die Keller, um weiteren Platz anbieten zu können. Und als mit dem Krieg das Geschäft ausblieb, waren viele in Not geraten.
Ließ sich nicht ändern, wie das meiste im Leben. Frida machte sich auf den Weg. Sie musste mit ihrem Koffer an Pfützen vorbei und Matschkuhlen ausweichen. Die wenigen Reisenden, die mit ihr an Land gegangen waren, überholten sie stumm. Es waren ausschließlich Männer von der Insel, und ein Gespräch hatte sich auch während der Überfahrt nicht ergeben. Man hatte sie sicher erkannt, aber sie war eben das Kirschbaumfräulein mit den hochgestochenen Plänen, der die Insel nicht ausreichte. Da hielt man sich bedeckt.
Frida lief ein Stück in den Ort hinein und hielt kurz inne, um über die Bucht zu ihrem Heimatdorf Steenodde hinüberzublicken. Wobei das Wort Dorf eine glatte Übertreibung war. Es gab dort das Gasthaus zum lustigen Seehund, wo in besseren Zeiten ebenfalls Gäste untergekommen waren, einige Bauernhöfe, das Seehospital und ein bisschen abseits gelegen, in der Nähe des Strandes, sodass sie von hier nicht zu sehen war, die Villa ihrer Familie.
Unerwartet kämpfte sich die Sonne durch die Wolken, und einen Moment lag Steenodde in ihrer Lichtbahn. Kam jetzt doch ein bisschen Heimatgefühl auf? Nein, die Beklemmung blieb. Sie löste sich erst, als Frida ein paar Minuten später im Pfeifen des Windes die Stimmen ihrer Schwestern vernahm. Sie blinzelte gegen das Sonnenlicht und sah Emily und Louise über den Strandweg auf sich zulaufen. Lou stürmte mit wehenden Röcken voran, Emily folgte langsamer, aber vor Glück strahlend. Frida begann ebenfalls zu laufen, ließ ihren Koffer fallen, warf die Arme um Lou und drehte sich mit ihr im Kreis. Emily drückte sie lachend einen Kuss auf die Wange. Jetzt endlich war es da, das Glücksgefühl, wie eine Riesenwelle, die sie förmlich überrollte.
«Woher wusstet ihr, dass ich komme?»
«Na, wenn der Großpapa die ewige Reise antritt … Gerlinde hat das Telegramm losgeschickt, den Rest haben wir uns aus dem Fahrplan der Fähre zusammengereimt. Los, gib mir den Koffer.» Lou nahm ihr das Gepäckstück aus der Hand, und Emily hakte sich bei Frida unter. «Ich bin so froh, dass du wieder da bist.» Ihre kleine Schwester schmiegte sich an sie, und mit der Wärme ihres Körpers platzten lauter verborgene Erinnerungen auf. Die Sommertage, die sie schwimmend am Strand verbracht hatten, die Lampionfeste beim Kurhaus, die Musik der Kurkapelle, der sie verborgen hinter den Strandkörben gelauscht hatten, die Versteckspiele auf dem Dachboden der Villa …
Sie liefen einige Meter an den Gleisen der Inselbahn entlang, die Amrum bis hinauf nach Norddorf durchquerte, und bogen dann auf den Strandweg ein, auf dem die Mädchen gekommen waren. Lou begann sie zu bestürmen. «Nun erzähl schon!»
«Was denn?»
«Na, alles! Jede kleinste Kleinigkeit. Deine Briefe, also da muss ich wirklich schimpfen, wie spärlich die waren, und wenn sie kamen … als hätte eine Gouvernante sie diktiert! Wie sind die Hamburger Männer? Sie haben dir zu Füßen gelegen, stimmt’s? Nun rede schon. Keine Geheimnisse.»
Frida musste lachen. «Natürlich haben sie mir zu Füßen gelegen, was sonst? Mitsamt ihren Beulen und Brüchen und den verkorksten Lungen, die armen Burschen. Und jeder hat Tränen des Glücks geweint, wenn er mir auf nimmer Wiedersehen den Rücken kehren konnte.»
«Aber die Ärzte! Es muss sie doch verrückt gemacht haben, mit einer Frau zu reden, die … na, die eben dasselbe weiß wie sie. Zeig deine Finger! Gibt es einen Verlobungsring?»
Frida entzog ihrer Schwester die Hand. «Was ist hier passiert? Das ist viel wichtiger. Wie ist Großpapa gestorben?» Die Stimmung kippte, plötzlich waren ihre Schwestern so still, dass das Rauschen der Brandung wie ein Blasorchester dröhnte.
«Ich vermisse ihn, Frida. Ich hätte das gar nicht vermutet, weil er … Er hat doch ständig an uns rumgemeckert. Also an mir, Emily ist ja sein Liebling gewesen, und Christian hat er wie Luft behandelt.»
«Er hatte dich ebenfalls lieb», widersprach Emily.
«Was weiß man schon», gab Lou mürrisch zurück.
«Ist er krank gewesen?»
«Er hatte sich schon seit Wochen nicht wohlgefühlt. Immer war ihm schwindlig gewesen, er ist kaum noch aus dem Haus gegangen. Und dann ist er die Treppe hinabgestürzt, nachts, sodass wir es nicht bemerkt haben. Er hat sich das Genick gebrochen und war wohl sofort tot, meinte der Arzt. Jedenfalls lag er direkt vor der untersten Stufe, und wir haben ihn nicht rufen hören.» Wieder wurde es still. «Alles geht vorbei. Man muss sich beeilen mit dem Leben. Das hab ich gedacht, als ich ihn morgens gefunden habe. Dass man sich beeilen muss. Irgendwann liegt jeder von uns tot auf einem Fußboden.» Louise kickte gegen einen Kieselstein.
«Was redest du denn?», flüsterte Emily betroffen.
«Ist doch wahr. Sag ihr das, Frida: Irgendwann sind wir alle tot. Ich bin jedenfalls fest entschlossen, alles aus dem Leben rauszuholen, was möglich ist.» Sie wurde schneller und drehte sich mit dem Koffer im Kreis. «Was ist mit dir, Frida?», fragte sie, während sie rückwärtslief. «Bist du ausgegangen? Hast du getanzt? Ich hab gehört, dass ganz Hamburg voller Varietés und Theater ist.» Sie begann den bekannten Schlager von der Foxtrottkönigin zu trällern. «Lou, du kleine Motte, du tanzt famos, jedoch der Foxtrott, das ist dein Clou, Lou, du raubst mir …»
«Aufhören, das ist ja grässlich.» Frida hielt sich lachend die Ohren zu. «Außerdem studiere ich und arbeite in den restlichen Stunden der Woche als Krankenschwester. Schon vergessen? Wenn mein Tag vorbei ist, fall ich wie ein Sack Kartoffeln ins Bett.»
«Wie fad von dir! Aber du hast wenigstens die Wahl. Hier geht man vor Langeweile ein. Das wird sich auch erst ändern, wenn die Gäste zurückkehren. Hast du’s mitgekriegt? Dass die Dänen wie verrückt unsere Hotels kaufen, weil sie glauben, dass wir nach der Abstimmung zu Dänemark kommen werden?»
«Was für eine Abstimmung?»
«Es geht darum, zu welchem Land wir in Zukunft gehören wollen. Deutschland oder Dänemark. Aber wir bleiben deutsch. Ich kenne niemanden, der zu den Dänen will. Na gut, niemanden im riesigen Steenodde.»
«Mir ist egal, was wir sind. Wenn nur die Gäste wiederkommen», seufzte Emily.
«Nanu?» Frida drückte scherzhaft ihren Arm, und Emily errötete.
«So meine ich das doch nicht. Aber ich könnte sie fotografieren. Die würden bestimmt gut zahlen, weil es hier auf Amrum ja keine Fotografen gibt, und jeder will eine Erinnerung an seinen Urlaub.»
«Knipst du immer noch?»
«Klar. Ich hab mir sogar eine eigene Dunkelkammer eingerichtet, oben auf dem Dachboden.»
«Bis jetzt hast du nur Seehunde vor die Linse gekriegt», spöttelte Lou. Wahrscheinlich meinte sie es nicht so abfällig, wie es klang, aber so war sie – ein Vulkan, der Aschewolken paffte und ab und zu auch Glut und Lava spie. «Ich will mich verlieben», trällerte sie und drehte sich erneut, sodass der Koffer flog wie der Sitz an einem Kettenkarussell. «Sapperment, das Mädel, das hat Beine …», sang sie.
Ihr Lied zerstob im Wind, und kurz drauf passierten sie den Lustigen Seehund mit seinen nassen Sprossenfenstern. Schließlich betraten sie durch die hintere Gartenpforte das Grundstück ihrer Familie.
Wie auf ein geheimes Kommando blieben sie stehen. Auf Amrum wuchs nicht viel, deshalb hatte ihr Großvater, als er nach Vaters Tod sein Kapitänsleben beendete und sich hier niederließ, Erde vom Festland herüberschaffen lassen und Bäume, Rasen, Blumen und eine Hecke angepflanzt, die inzwischen haushoch aufragte. Dornröschens Garten, dachte Frida, nur dass hier keine Prinzen die Lippen spitzten, um die Prinzessinnen zu befreien. Da sich wieder Wolken vor die Sonne geschoben hatten, wirkte der Garten düster. Die Villa in seiner Mitte glich einer riesigen, grauen Schachtel mit einem steilen Hut darauf, die beiden erleuchteten Fenster, die zum Schlafzimmer ihrer Mutter gehörten, sahen wie Katzenaugen aus.
«Nun kommt schon», drängte Lou, die nichts Bedrückendes aushielt. Sie folgten ihr ums Haus herum in die kleine Eingangshalle, in der es seit der Elektrifizierung der Inselbahn ebenfalls elektrisches Licht gab. Die Birnen des Kronenleuchters flackerten, wenn die Inselbahn den benachbarten Ort Nebel passierte, manchmal fielen sie auch ganz aus. Jetzt allerdings brannten sie ruhig, mit warmem, gelbem Licht.
«Ich mache uns einen Tee.» Emily hängte ihren Mantel in den Garderobenschrank und lief zur Küche. Ein Haus dieser Größe hätte in Hamburg ein Dutzend Dienstboten beschäftigt, aber der enge finanzielle Spielraum hatte ihre Mutter genötigt, sich mit wenig Hilfe zufriedenzugeben. Ein Köchin, die gemeinsam mit dem Hausmädchen auch putzte, die ältliche Zofe Gerlinde, die früher ihr Kindermädchen gewesen war, Großvaters Kammerdiener Willy und ein Hausdiener, der sich gleichzeitig um den Garten kümmerte und die Kutsche fuhr und … eigentlich alles tat, was jenseits der Hausarbeit anfiel. Viel zu wenige Menschen. Trotzdem blitzte der schwarz-weiß geflieste Fußboden, und auf den wenigen, aber gediegenen Möbeln stach nicht die kleinste Staubfluse ins Auge. Mutter war streng.
«Wo liegt er denn?», fragte Frida Lou.
«Großvater? Oben in seiner Schlafkammer. Aber ich geh da nicht mehr rein. Tote machen mir Gänsehaut.» Schon war auch sie verschwunden.
Frida stieg die dunkle Treppe mit den knarrenden Stufen hinauf und gelangte über eine kleine Galerie zu einer weiteren Treppe. Großpapa hatte sich im obersten Geschoss des Hauses eine großzügige Wohnung eingerichtet. Von dort hatte er also hinabgewollt und war gestürzt? Sie konnte keinen Blutfleck entdecken. Aber vielleicht war er ja auch erst bei der unteren Treppe ins Stolpern geraten. Oder er hatte überhaupt nicht geblutet.
Ihr wurde der Hals eng, als sie sich seinem Schlafzimmer näherte. Der Spalt unter der Tür war dunkel. Sie fand ihn in bedrückender Einsamkeit auf seinem Bett liegen. Kein Stuhl stand neben seinem Lager, als hätte niemand den Wunsch gehabt, bei ihm zu wachen. Frida schaltete das Licht einer kleinen Wandlampe ein.
Ihr Großvater sah nicht friedlich aus. Beim Sturz hatte er sich den Kiefer verletzt, vermutlich gebrochen, sodass man den Mund nicht mehr hatte schließen können. Er wirkte wie ein drittes großes Auge, das ihr entgegenstarrte. In den Mundwinkeln und zwischen den Barthaaren klebten Reste von Blut.
Frida ging ins Bad und füllte Großvaters blau geblümte Porzellanwaschschüssel mit Wasser. Sie machte sich daran, sein eingefallenes Gesicht zu säubern. Großpapa war immer penibel frisiert gewesen, der Bart akkurat gestutzt, das Haar mit Pomade in Form gebracht. Nun wucherten Bartstoppeln in seinem eingefallenen Gesicht, und die Schnurrbartenden stachen wie gekrümmter Draht in die Luft. Sie schäumte die Seife auf, nahm den Rasierhobel zur Hand und entfernte die Stoppeln, so gut es eben ging.
«Es geht mir gut», erzählte sie ihm dabei leise. «Ich studiere jetzt im dritten Semester, und es macht mir Freude, ich merke, dass ich eine Begabung für die Medizin habe. Ja, hör nur zu, Großpapa. Ich bin dem Studium so gut gewachsen wie die Männer. Und ich darf sogar schon in der Chirurgie helfen. Letztens bei einem Kaiserschnitt, stell dir vor. Die Zwillinge haben beide überlebt, ihre Mutter auch. Und im Winter habe ich einem Jungen einen Nagel aus der Lunge geholt, den wir mit Hilfe von Röntgenstrahlen entdeckt hatten. Die sind übrigens ein Segen, diese Strahlen, eine Revolution. Ich werde Leben retten, Großpapa. Das ist doch etwas.»
Ihr Großvater hörte ihr im Tod ebenso wenig zu wie im Leben. Reglos stierte er ins Leere. Sie wusch den Rasierschaum aus den Furchen und trocknete das Gesicht mit einem Handtuch ab. Dann strich sie Wichse in die Barthaare und bog ihm den Schnurrbart zurecht. Seltsam, dass der alte Willy ihn nicht würdig für den Sarg hergerichtet hatte. Die beiden waren gemeinsam bis Sumatra gesegelt, und Willy hatte seinen Kapitän verehrt wie den lieben Gott. Aber offenbar nur, solange er ihm nützlich sein konnte, dachte Frida bitter. Sie würde ihm die Meinung geigen.
Nachdem sie das Rasierzeug ausgespült, getrocknet und in die Holzkiste zurückgelegt hatte, stand sie ratlos neben dem Bett. Das also sollte es gewesen sein? Der Tod war ihr vertraut, aber in diesem Moment kam er ihr wie ein Fremder vor, der sich ungebeten in ihr Leben eingemischt und sie um etwas Wichtiges betrogen hatte. Plötzlich wurde ihr klar, wie wichtig es ihr gewesen wäre, vor Großpapa hinzutreten und ihm ihren Abschluss zu überreichen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Um sich abzulenken, goss sie noch einmal frisches Wasser nach. Auch der Rest des armen Körpers musste ja gewaschen werden. Und wenn Willy schon bei dem Gesicht geschludert hatte …
Sie schlug die Decke zurück. Großpapa trug seine geflickte alte Hose, das Hemd und die ausgebeulte Jacke, in der er es sich oft bequem gemacht hatte. Seltsamerweise hatte er die Hosenbeine in seine Socken gesteckt. Frida holte saubere Kleidung aus dem Schrank. Offenbar hatte schon jemand nach etwas Passendem für die Beerdigung gesucht, denn es herrschte Unordnung in den Fächern. Willy, der dann aber vor der schweren Aufgabe kapituliert hatte?
Sie kehrte zum Bett zurück, um Großpapa den letzten Liebesdienst zu erweisen. Als sie am Fenster vorbeikam, erblickte sie draußen im Garten die Schaukel vor dem weiß gestrichenen Schuppen, und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Ihr Großvater hatte die Enkelkinder auf seine schroffe Art geliebt und für sie gesorgt.
Vorsichtig begann sie mit einer Schere seine Ärmel und dann das Hemd zu zerschneiden. Die Totenstarre war bereits gewichen, es bereitete ihr kaum Schwierigkeiten, ihn zu entkleiden. Nur der Geruch, der aus den Kleidern stieg, war unangenehm, aber das ließ sich nicht ändern. Als sie den Gürtel öffnete, um auch die Hose entzweischneiden zu können, gewahrte sie im trüben Licht der Lampe plötzlich eine Bewegung unter dem Stoff. Entsetzt wich sie zurück und starrte auf das karierte Hosenbein. Kein Zweifel, der Stoff hob und senkte sich, und zwar an mehreren Stellen.
Aber Großvater war tot.
Mit bebenden Händen zerschnitt sie den Stoff. Und kreischte entsetzt auf, als ihr ein paar grün-schwarz gefleckte Kröten entgegensprangen.
«Was hast du getan? Was hast du nur getan, du … Satansbraten? Das ist … entsetzlich!»
Christian stand vor ihr, in Knickerbockern und Stiefeln, mit Hosenträgern über einem schmutzigen, weißen Hemd und einem frechen Grinsen im Gesicht. Er war kein Kind mehr, aber auch noch lange nicht erwachsen. Bei Fridas Umzug war er neun gewesen. In der gemeinsamen Zeit zu Hause hatte er stets an ihr gehangen wie eine Klette, mit tausend Fragen und einem unerschöpflichen Vorrat an Blödsinn im Kopf. Er hatte mütterliche Instinkte in ihr geweckt und sie zugleich bis zum Platzen gereizt. Unvergessen, wie er Maden gesammelt und sie zwischen die belegten Käsebrote für ihr Picknick gelegt hatte. Inzwischen war er fast vierzehn, und natürlich hatte sie erwartet, dass sein kindischer Sinn für Albernheit …
«Ich weiß gar nicht, wovon du redest.» Ihr Bruder tat blasiert, aber es war klar, dass er log. Er hatte ihr noch nie etwas vormachen können. Aufgebracht packte Frida ihn bei den Schultern. «Wie konntest du nur! Er ist dein Großvater. Und selbst, wenn er es nicht wäre … Tote verdienen Respekt. Sie können sich doch nicht mehr wehren!»
Das Blasierte verschwand. Kleinlaut murmelte Christan: «Er hat’s doch gar nicht mehr gemerkt. Und ich war so wütend auf …»
«… auf einen toten Mann?»
«… auf dich!», rief er und fügte hitzig hinzu: «Du hattest versprochen, mir zu schreiben. Mindestens einmal im Monat, hast du gesagt. Und dass du zu Weihnachten nach Hause kommst. Und ich dich mal besuchen darf … Du hast mich immer nur angelogen!» Seine Augen wurden plötzlich feucht. Er entwand sich ihr und rannte aus dem Zimmer.
Entgeistert starrte Frida ihm nach. Ganz von der Hand weisen konnte sie seine Anschuldigungen nicht. Sie war ja wirklich über Weihnachten in Hamburg geblieben, und das mit dem Besuch würde erst klappen, wenn sie in eine eigene Wohnung gezogen war. Aber das hatte sie ihm doch in ihren Briefen, die sie zugegebenermaßen auch nicht immer pünktlich zur Post gebracht hatte, erklärt. Und außerdem: Wer würde wegen solcher Bagatellen die Leiche des eigenen Großvaters … Sie verbot sich das böse Wort schänden. Es klang gar zu hässlich. Christian war schlicht ein Kindskopf, immer noch, man konnte nur hoffen, dass die Flausen sich bald verwuchsen.
Pünktlich um sieben trafen sie im Esszimmer aufeinander, die ganze Familie, so, wie es in diesem Haus üblich war. Frida sah zum ersten Mal seit ihrer Ankunft ihre Mutter – eine Frau Mitte vierzig, mit einer hochgeschlossenen Bluse, aus deren Rüschenkragen der Kopf wie eine Blüte aus den Kelchblättern ragte. Ihr strenggefältelter Rock fiel ihr bis auf die Knöchel. Das Haar war zu einer aufwendigen Frisur aufgesteckt, über dem Busen hing eine schwere Kette mit einem in Gold gefassten Jadestein. Sie sah elegant aus, aber so, als stamme sie aus dem vergangenen Jahrhundert.
Genau wie unser Haus, dachte Frida, deren Blick durch das Zimmer glitt, als sähe sie es zum ersten Mal. Schwere dunkle Möbel mit gedrechselten Beinen, überladen mit Zierrat, steife Vorhänge, glasbehangene Lüster, bei denen das Auswechseln der Kerzen Stunden in Anspruch nahm … Mutter klammerte sich an die alten Zeiten. Das hatte sie schon immer getan, und der Krieg mit seinen Grausamkeiten hatte diese Neigung wohl noch verstärkt.
Rudolf von Möhring, ihr Stiefvater, geleitete Mutter zum Tisch und rückte ihr den Stuhl zurecht. Er war mit seinem Frack ebenfalls überkorrekt gekleidet, aber wohl nur Rosa zu Gefallen. Rudolf war ein Mann der Natur. Wann immer es sich einrichten ließ, verschwand er ins Freie, um zu jagen oder auf dem einzigen Pferd, das ihnen geblieben war, einen Ausritt zu machen.
Frida und ihre Geschwister setzten sich ebenfalls um den ovalen Tisch mit der weißen Decke und dem noch von Mutters Großeltern stammenden gelb geblümten Geschirr. Das Silberbesteck war blank gewienert, die Servietten akkurat gebügelt, der unvermeidliche Blumenstrauß, dieses Mal Tulpen aus dem Garten, ragte zwischen den Tellern empor.
Lou schnupperte. «Schon wieder Fisch!», maulte sie. Das hätte sie sich bei Fridas letztem Besuch noch nicht getraut. Verstohlen lugte Frida zu ihrer Mutter hinüber, doch die hatte offenbar beschlossen, die freche Bemerkung zu überhören. Auch Christian und Emily schwiegen. Ihr Bruder sorgte sich bestimmt, ob sie die Sache mit den Kröten verraten hatte, und hielt sich deshalb lieber dezent im Hintergrund.
Die alte Gerlinde trug das Essen auf. Ihr Gesicht war ausgedörrt wie eine Backpflaume, das Haar so dünn, dass die Kopfhaut hindurchschimmerte. Aber den Rücken hielt sie gerade. Das ist das Wichtigste: Immer Haltung bewahren!, hatte sie ihnen in ihrer Kindheit eingetrichtert. Nur dass die Haltung nicht half, wenn das Innere hohl war. Sofort schalt Frida sich für ihren gehässigen Gedanken. Sie hatte Gerlinde nie gemocht, aber das war kein Grund, schäbig über sie zu denken. Was war es nur, das sie in diesem Haus so dünnhäutig werden ließ? Sie füllte ihren Teller mit einer Kartoffel und einem kleinen Stück Bratfisch. Mehr würde sie nicht hinunterbekommen.
Nach einigen Bissen richtete Mutter zum ersten Mal das Wort an sie. «Es wäre hilfreich gewesen, wenn du uns telegraphiert hättest, mein Kind. Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich dir die Kutsche gesandt.»
Frida ließ entgeistert die Gabel sinken. «Aber … Großpapa ist gestorben. Natürlich komme ich heim.»
«Nur hättest du mir die Ankunftszeit mitteilen sollen. Es wäre eine Frage der Rücksicht gewesen, meinst du nicht auch?»
«So schwer war die ja nicht zu erraten. Ich hab’s jedenfalls geschafft.» Lou zwinkerte Frida hinter vorgehaltener Hand zu, und Mutter warf ihr einen kühlen Blick zu. Erneut senkte sich Schweigen über die kleine Tischgesellschaft.
Frida starrte auf den Fisch. Unmöglich, sich etwas in den Mund zu stecken, ihr Magen rebellierte. Kurz entschlossen schob sie den Teller von sich und platzte heraus: «Ich war bei Großpapa im Zimmer. Er lag immer noch in den Kleidern, in denen er gestorben ist, im Bett, mit Blut im Gesicht … Warum um Himmels willen hat sich denn niemand um ihn gekümmert?»
«Die letzten beiden Tage waren für uns alle äußerst schwierig», herrschte Mutter sie an. «Es wundert mich nicht, dass du so etwas nicht nachvollziehen kannst, du hast ja niemals einer Familie vorgestanden. Aber sei beruhigt: Wir haben den Kaplan aus Nebel beauftragt, er wird morgen kommen und euren Großvater für die Beerdigung herrichten.»
«Warum hat Willy das nicht längst erledigt? Wo steckt er überhaupt?»
Ihr Stiefvater hob die Hand, um ihre Mutter am Sprechen zu hindern. Er räusperte sich. Seine Stimme war tief, er sprach knapp und strahlte die Autorität aus, die ihren Diskussionen schon früher ein Ende zu setzen pflegte. «Du versteht die Lage nicht. Mit dem Tod deines Großvaters …», er räusperte sich, «sind auch einige finanzielle Fragen aufgetaucht, Fragen, die uns als Familie betreffen. Wir wissen noch nicht, wie wir jetzt finanziell dastehen. Also bleibt uns nichts übrig, als so sparsam wie möglich zu sein und sämtliche Angestellten, auf die wir verzichten können, zu entlassen.»
«So schnell?»
«Möglicherweise werden wir mit dem Pfennig rechnen müssen.»
«Aber Willy …»
Mutter legte Rudolf die Hand auf den Arm. «Er ist bei seinem Neffen untergekommen. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass er nicht auf der Straße steht. Er hat unserer Familie ja lange genug gedient, und es gehört zu den Pflichten …»
«Aber die paar Stunden …»
«Ich kann es nicht fassen!» Mutters Stimme schraubte sich in die Höhe, wie meist, wenn ihr der Verlauf eines Gesprächs missfiel. «Immer diese kindischen Streitereien. Warum fällt es dir so schwer, Frieden zu halten, Frida?» Sie schob den Stuhl zurück und stand auf. Ihre sorgfältig nachgezeichneten Augenbrauen waren nach oben gewandert, ihre Mundwinkel bogen sich hässlich nach unten. «Frida, Louise, Emily … Ich bedauere, dass ich so deutlich werden muss, aber zu unseren Häuptern liegt ein verstorbenes Mitglied unserer Familie. Ich gebe nicht vor, euren Großvater geliebt zu haben, nach allem, was ich seinetwegen ertragen musste. Dennoch gebührt ihm unser Respekt. Ich dulde in diesem Trauerhaus kein zänkisches Benehmen. Rudolf, wenn ich bitten darf …»
Ihr Stiefvater warf dem Fisch einen bedauernden Blick zu, stand aber sofort auf und reichte ihrer Mutter den Arm. Die beiden rauschten hinaus. Ein Ritual. Der große Abgang, dessen Sinn es war, Verwirrung und einen Berg an Schuldgefühlen zurückzulassen. Frida wusste wieder, warum sie die Besuche bei ihrer Familie so verabscheute.
«Warum muss sie nur immer so gemein zu uns sein?» Lou, die die Kammertür geöffnet hatte, tastete sich zum Bett. Sie fühlte nach ihrer Schwester, kroch unter die Decke und schob die eisigen Füße zwischen Fridas Beine. Eine Angewohnheit von früher.
Die Lampen im Haus waren gelöscht, aber der Mond tupfte einen hellen Flecken auf die Möbel, und sein Licht fiel auch auf eine verblasste Fotografie neben dem Kleiderschrank. Das Bild zeigte ihren Vater auf einem Ausflugsdampfer, Frida hatte es von Großpapa zum zwölften Geburtstag geschenkt bekommen. Damit du weißt, von wem du abstammst. Wäre ihr Leben anders verlaufen, wenn Vater nicht gestorben wäre? «Weißt du, warum Mutter Willy sofort nach Großpapas Tod entlassen hat?», fragte sie leise.
«Er wurde flapsig, als sie angedeutet hat, dass Großvater vielleicht zu tief ins Glas geguckt hat, bevor er gefallen ist. Und zack hat sie ihn rausgeschmissen.»
«O Gott, der Arme.»
«So ist sie doch immer», zischte Lou. «An mir krittelt sie auch ständig rum. Schließ den oberen Knopf, unterbrich die Gäste nicht, lach nicht so laut … Und gleichzeitig kreist sie über den unverheirateten jungen Männern auf der Insel wie ein Geier. Ständig lädt sie jemanden ein. Den Neffen vom Strandvogt, den Kapitän Tönissen, der sich nichts aus Frauen macht und nur darüber redet, wann er endlich wieder in See stechen kann … In Wirklichkeit sind ihr die natürlich nicht gut genug. Du müsstest sie mal jammern hören: Wann kommen endlich die Badegäste wieder … Und damit meint sie natürlich die unverheirateten Schnösel, die beim Anblick junger Mädchen zittrige Knie bekommen. Bei ihr war es ja umgekehrt. Sie war der Badegast und Papa der Insulaner mit den zittrigen Knien.» Lou kicherte, hörte aber sofort wieder damit auf. «Mir geht das auf die Nerven, Frida. Ich kann dir nicht sagen, wie ich es hasse: dieses Herumgereichtwerden, als wäre ich ein Stück Baiser mit Schlagrahm drauf.»
«Willst du denn nicht heiraten?»
Lou drehte sich auf den Rücken und starrte zur Decke. «Unsinn, natürlich will ich. Aber ich such mir meinen Ehemann selbst aus. Das hab ich mir geschworen. Wenn ich heirate, soll es die ganz große Liebe sein. Einer, der sich neue Wege zutraut. Ein Rebell.»
«Ach, du lieber Himmel.»
«So wie unser Vater.»
«Aber der war doch gar kein Rebell.»
«Er ist im Sturm rausgefahren, um die Seeleute zu retten, die vor Henningstedt in den Masten hingen. Er ist für sie gestorben. Das zeigt doch, dass er das Herz auf dem rechten Fleck hatte.»
«Dann ist er ein Held, kein Rebell.»
«Jetzt hör schon mit der Worteklauberei auf.» Lou stieß ihr das Knie in die Seite. Sie starrten beide zu dem Foto ihres Vaters hinüber. Er war kurz vor Emilys Geburt mit dem Seenotrettungsboot hinausgefahren. Das Lister Boot konnte wegen des Wetters nicht auslaufen, also hatten die Amrumer helfen müssen. Die Besatzung hatte zumeist aus erfahrenen Seeleuten bestanden, seit Jahren war keinem ein Leid geschehen. Doch in dieser tragischen Nacht brachte eine hohe Grundsee ihr Boot ebenfalls zum Kentern. Die Männer hatten es zwar wieder aufrichten können, und die meisten waren dem eisigen Wasser entronnen, aber Anders Kirschbaum, der leichtsinnigerweise nicht die vorgeschriebene Korkweste getragen hatte, ertrank in den Fluten.
«Vor allem ist er Arzt gewesen», meinte Frida einsilbig.
«Dann wäre er auf uns beide stolz. Auf dich, weil du ebenfalls Ärztin wirst, und auf mich, weil ich mich was traue! Vielleicht wandere ich auch nach Indien aus und angele mir einen Maharadscha.» Lou kicherte und schmiegte sich noch enger an sie. «Ich bin so froh, dass du wieder da bist, Frida! Ich hab dich schrecklich vermisst.»
3.LOUISE
Der Samstag war gekommen, der Tag, an dem Großpapa beerdigt werden sollte. Lou riss das Fenster ihres Kinderzimmers auf. Die Sonne schien, der Garten schimmerte in dem durchscheinenden Grün, das nur der Frühling bereithält, aus den Beeten lugten die Spitzen der Maiblumen. Hinter der Hecke lag das Dorf mit seinen wenigen Häusern, hundert Meter weiter sah sie die Flut gegen den kargen Strand rollen. Sie war froh, dass sie ihren Großvater nicht im Nieselregen in den nassen Geestboden hinablassen mussten. Wie deprimierend das gewesen wäre. Danke, lieber Gott!
Aber sie musste sich beeilen. Hektisch riss Lou ihr Kleid vom Bügel und zog es über den Kopf. Sie drehte sich vor dem Spiegel in der Mitteltür des alten Schranks. Trauerkleidung war hässlich, selbst wenn sie nicht aus einer muffigen Truhe stammte wie das Kleid, das Mutter ihr aufgenötigt hatte. Es hatte einer Großcousine gehört, die es angeblich bei Vaters Beerdigung getragen hatte. Gerlinde hatte es ein wenig gekürzt, aber es hing immer noch altmodisch bis fast auf die Füße.
Lou vergaß das Kleid, als sie ein Paar schwarze Handschuhe von ihrer Kommode nahm. Ihr Herz füllte sich mit Trauer. Das, was sie zu Frida gesagt hatte, stimmte nicht: In Wirklichkeit hatte sie ihren Großpapa gern gehabt, trotz seiner gelegentlichen Mäkelei. Er hatte ihr den eigenen Vater ersetzt, den sie so schmerzlich vermisste. Rudolf hatte sich ja nie die Mühe gemacht, seinen Stieftöchtern nahezukommen. Mit Christian war er oft unterwegs, wohl, weil er sein leibliches Kind war, aber die Mädchen … Lou musste lächeln, als sie daran dachte, wie Großpapa sie im Kreis geschwungen und ihre schwarzen Locken bewundert hatte.
Ihre Trauer wandelte sich in Schuldbewusstsein. Warum hatte sie Großvater, nachdem der Arzt fortgegangen war, nur nicht gewaschen? Sie hätte nicht auf Frida warten dürfen. Aber sie hatte es kaum geschafft, sein Zimmer zu betreten und ihm einen Kuss auf die kalte Stirn zu hauchen. Der Tod war so … hart, so unzugänglich. Kein Schmeicheln möglich, um ihm etwas abzuringen. Vom Verstand her war ihr das klar, aber es selbst zu erleben … zu begreifen, dass Großpapa sie niemals wieder heimlich auf einen Pharisäer einladen würde, dieses herrliche Gesöff aus Kaffee, Rum und Schlagrahm …
Lou verdrängte das unheimliche Bild des toten alten Mannes. Mutter hätte sich um ihn kümmern müssen. Basta! Sie steckte ihre Haare hoch und setzte den schwarzen Hut auf, ein bisschen schräg, damit es keck aussah. Das würde Großpapa auf seiner Wolke gefallen.
Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass sie sich sputen musste. Sie hastete die Treppe hinab und eilte über den Kiesweg zur Straße. Die drei Kilometer zum Kirchhof nach Nebel würden sie mit der Kutsche zurücklegen. Lou wäre bei dem schönen Wetter lieber zu Fuß gegangen, aber Mutter hatte auf der Kutschfahrt bestanden – man hielt auf sich, zu einer Beerdigung kamen nur die Inseltrampel zu Fuß. Ich werde auf keinen Fall weinen, schwor sich Lou, während sie in die Kutsche stieg, in der der Rest der Familie sie schon ungeduldig erwartete.
«Es gehört sich nicht, Liebes, bei solch einem Anlass wie ein aufgescheuchtes Huhn in letzter Minute …»
Nein, Mutter, und blababla …
Sie ruckelten los.
Der Friedhof der St.-Clemens-Kirche war bedrückend still, die Kirche kalt und muffig, der Gottesdienst grässlich, weil Mutter dem Pastor eine Menge blumigen Unsinn eingetrichtert hatte, den er über Großpapa erzählen sollte. Kein Wort passte, alles war irgendwie falsch und geheuchelt. Später liefen sie im Gänsemarsch zwischen Grabsteinen, auf denen oft geschrieben stand, dass jemand auf See geblieben war. Großpapa war elend zu Füßen einer Treppe gestorben. Das hätte ihn gewurmt, wenn er’s noch mitbekommen hätte. Lou merkte, wie ihr nun doch die Tränen hinabliefen. Zum Glück besaß ihr Hut einen dünnen, schwarzen Schleier. Sie schielte zu Frida, die so gelassen neben ihr schritt, als wäre eine Beerdigung – die Beerdigung ihres Großpapas! – ein gewöhnlicher Spaziergang. Wurde man so, wenn man das Leichenaufschneiden zu seinem Beruf machte? So … hart?
Am Grab lauschten sie noch einmal dem Pfarrer mit seinen rot geäderten Wangen, der erzählte, dass Gott den Ludwig Kirschbaum nun in seine Obhut nehmen werde. Er hätte lieber auf ihn aufpassen sollen, als er auf der Treppe stand, dachte Lou böse. Sie spürte, dass sie Kopfweh bekam. Plötzlich legte jemand den Arm um ihre Schulter. Frida. Ihre Schwester drückte sie leicht an sich. Als wäre das ein Signal, schob Emily von der anderen Seite ihre Hand in Lous Ellenbogenbeuge. Sogar Christian, der Riesenfratz, trat dichter an sie heran. Und dann – unfassbar – lächelte ihre Mutter ihnen von der anderen Seite des Grabes tröstend zu.
Lou entdeckte ein ungewohntes Gefühl in sich: Stolz auf ihre Familie. Sie stritten zu viel, sie bereiteten ihrer Mutter Kummer, und vielleicht waren sie jetzt sogar verarmt, aber wenn es drauf ankam, so wie hier am Grab, standen sie zueinander. War das nicht das Einzige, das zählte?
Sie hielt den Kopf hoch, als sie die obligatorische Schaufel Erde auf den Sarg warf. Adieu und gute Reise, Großpapa. Und danke, danke, danke!
«Lou …» Frida zog sie auf dem Weg zum Friedhofstor zur Seite in eine der Gräberreihen und flüsterte etwas.
«Was ist? Sprich lauter, ich …»
«Wo sind die Kinder?»
Was für Kinder? Plötzlich fiel es Lou wie Schuppen von den Augen. Die aus dem Seehospital natürlich! Die Waisen, denen Großpapa das alte Kapitänshaus gekauft hatte. Sie blickte sich um. Die Menge der Trauergäste war groß, bestimmt hundert Leute waren gekommen, um dem alten Ludwig, der bis zum vorletzten Tag seines Lebens mit ihnen im Lustigen Seehund gezecht hatte, die letzte Ehre zu erweisen. Die meisten waren Seeleute, einige von ihnen Kapitäne, wohlhabend geworden auf großer Fahrt. Der Badearzt war da, der Apotheker, der Kurdirektor Wolff. Aber Frida hatte recht: keine Spur von den Hospitalkindern. Und auch nicht von den Leuten, die sie versorgten. Na, das war ja wohl …
Sie hielt ihre Schwester fest, wartete, bis der alte Willy zu ihnen aufgeschlossen hatte, packte ihn am Arm und wiederholte Fridas Frage. Großpapas Freund und Diener, der mit roten Augen als Letzter am Grab verharrt hatte, wiegte verwundert den Kopf. «Aber wissen Sie das gar nicht? Die gnädige Frau hat angeordnet, dass alle Kinder zurück nach Hamburg müssen, ins Waisenhaus.»
«Was soll das heißen?», flüsterte Frida entgeistert.
Auch Willy senkte die Stimme. «Wohl, dass die Gnädige zu geizig ist, um das Seehospital weiter zu unterhalten. Sie hat Schiffs- und Eisenbahnkarten für die Kinder besorgt und Jonny Peters ausrichten lassen, dass er sie und Hannah zur Fähre karren soll.» Er spuckte aus, und weil er Kautabak kaute, landete ein brauner Klecks auf dem Weg zwischen den Gräbern.
«Wann?», fragte Lou.
«Ich weiß es nicht, aber da sie nicht hier sind und Hannah auch nicht … Die Hannah, die hat den Käpt’n doch so verehrt. Wenn’s ihr möglich gewesen wäre, hätt sie mit am Grab gestanden … Was soll denn das? Lou, Mädelchen, bleib hier! Wenn die Gnädige entschieden hat …»
Aber Lou rannte schon zum hinteren Ausgang des Friedhofs. Sie hatte den Fahrplan im Kopf. Die Fähre fuhr um ein Uhr. Ihr blieb also eine knappe Stunde, um zur Landungsbrücke zu gelangen. Emily war schon mit Mutter zur Kutsche gegangen, doch Frida folgte ihr. Sie rafften die schrecklichen Trauerkleider, ihre Haare lösten sich aus den Spangen. «Wie viele Kinder sind es überhaupt?», keuchte Frida.
«Nur noch ungefähr ein Dutzend. Seit Großpapa nicht mehr so gut zu Fuß war, hat Mutter dafür gesorgt, dass keine Neuen nachgekommen sind, wenn jemand nach Hamburg zurückgeschickt wurde. Ich glaube, er hat das gar nicht gemerkt.»
«O Gott.»
«Und jetzt will sie sie alle forthaben – du siehst es ja. Großpapa wird in den Wolken toben!» Das Hospital sollte schließlich die Erinnerung an seinen Sohn Anders wachhalten. Großpapa war heimgekehrt, als er gestorben war. Bis in die Seele erschüttert, hatte Willy ihnen später erzählt, weil er sich ja mit ihm überworfen und vor seinem Tod nicht mehr versöhnt hatte. Da er im Stiftungsrat eines Hamburger Waisenhauses tätig gewesen war, beschloss er, als Buße auf Amrum ein Seehospital zu gründen, in das er neunzehn kränkelnde Jungen und neunzehn Mädchen, ein Kind für jedes Jahr, das sein Sohn gelebt hatte, holte, damit sie in der kräftigenden Seeluft gesund würden. War eines wieder auf den Beinen, hatte er es zurückgesandt und ein anderes schicken lassen. Also war das kleine Hospital immer voll belegt gewesen – bis Großvater vor einem Jahr das Rheuma zwickte und er nur noch selten bei den Kindern vorbeischaute. Da hatte Mutter sich eingemischt, mit den entsprechenden Folgen.
Und nun wollte sie das Hospital ganz schließen? Sie hatte nicht einmal gewartet, bis Großpapa unter der Erde war, um sein Liebeswerk zu vernichten. Und natürlich hatte sie die Sache heimlich eingefädelt! Lous Gesicht brannte vor Wut.
Sie hatte Seitenstiche, und die Lunge tat ihr weh, als der kleine Hafen endlich vor ihnen auftauchte. Zum Glück lag die Fähre noch in der Fahrrinne vor Anker. Sie konnte die kleinen Gestalten zwischen den anderen Schiffsgästen ausmachen. Die Jungen trugen die blauen Matrosenanzüge, an denen Großpapa solche Freude gehabt hatte, die Mädchen dazu passende Matrosenkleider. Einige standen an der Reling, andere saßen auf den Bänken, die Größeren wirkten bedrückt. Sie wussten ja, dass sie in eine traurige Zukunft fuhren. Hannah, rundlich, das Haar zu einem weißen Knoten gebunden, umschwärmte sie und wirkte gleichzeitig wie die Verwirrteste unter ihnen.
Lou wollte zur Brücke, aber Frida hielt sie zurück. Keuchend fragte sie: «Was, wenn wirklich nicht genügend Geld da ist, um für die Kinder zu sorgen? Rudolf hat doch gesagt, er weiß nicht, wie es um unsere Finanzen steht.»
«Kein Geld? Von einem Tag auf den anderen? Du bist ja verrückt!»
«Aber …»
«Nun hör schon auf!»
Der Rest des Weges zog sich. Sie erreichten das Schiff gerade in dem Moment, als einer der Fährleute das Metalltor in der Reling schließen wollte. «Warten Sie», keuchte Lou. «Die Hospitalkinder gehen wieder an Land.»
Wenn es so einfach gewesen wäre. Nicht alle Kinder konnten laufen, einige zitterten von Schüttelfrost, andere husteten sich die Seele aus dem Leib und schafften es kaum aufzustehen. Dabei hätten sie es bei Lous Anblick so gern getan. Sie war ja oft genug im Seehospital gewesen, um mit ihnen zu spielen und ihnen Rosinen vorbeizubringen, die sie aus der Villenküche stibitzte.
«Helfen Sie den Kindern an Land», befahl Frida einem der Männer. Er gehorchte ohne Widerspruch. Und weil der Kapitän ablegen wollte, packten noch weitere Seeleute mit an.
Hannah schwirrte zwischen ihren Schützlingen herum. «Man muss sie zählen», murmelte sie, stupste einen kleinen Jungen, bewahrte ein Mädchen, das über den Saum seines zu großen Kleides stolperte, vor einem Sturz ins Wasser und schickte zwei Jungs, die in etwas besserer Verfassung waren, einen Koffer zu holen. Ihr schlohweißes Haar war aus dem Knoten gerutscht, der schäbige Mantel hatte einen frischen, braunen Fleck in Höhe des Knies, der bös nach Kuhfladen aussah. Zu anderen Zeiten hätte Lou gelacht.
Jetzt hatte sie genug anderes zu tun. Einige der Jüngsten stanken – ihre Windeln waren durchweicht. Ein Mädchen mit blonden Zöpfen übergab sich, und weil sie gut erzogen war, versuchte sie, über die Reling ins Wasser zu spucken, was ihr aber nicht gelang. Lou wischte ihr mit einem Taschentuch über den Mund. Die Kleine begann zu wimmern, Lou nahm sie auf den Arm und trug sie über die Brücke. Das Mädchen war sicher schon vier Jahre alt, aber, Himmel, wie dünn und leicht. Lou spürte durch das Mäntelchen hindurch die Knochen.
Endlich standen sie alle an Land. Auf der Fähre spülte jemand mit einem Eimer Wasser das Erbrochene fort. «Wartet hier, wir brauchen einen Wagen.» Frida lief hinüber zum Kurhaus. Nach wenigen Minuten kehrte sie mit einem hageren Mann zurück, mit Ebbe Rörden, einem der letzten Angestellten der Kurverwaltung, der seit einem Bootsunfall humpelte. Sie ging mit ihm ums Haus herum.
«Was hat das denn nun zu bedeuten, Fräulein Kirschbaum? Hat sich die gnädige Frau anders besonnen?», fragte Hannah hoffnungsvoll und wiegte einen krebsroten Schreihals in den Armen.
«Ist er nicht zu dünn angezogen?»
«Anton? Der schwitzt vom Fieber. Wenn man ihn noch dicker einpacken würde, brächte ihn das um, vertrauen Sie mir. Können wir ins Hospital zurückkehren? Hab ich das richtig verstanden? O Gott, wäre das ein Glück.» Sie begann zu weinen.