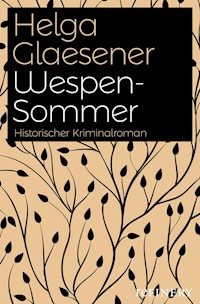8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Familie ist das Chaos garantiert!
Kea hat die Nase gestrichen voll. Nach einem Burn-out soll die toughe Unternehmensberaterin nicht mehr arbeiten. Sie flieht ins Haus ihres Vaters nach Ostfriesland. Doch Ruhe findet sie dort nicht. Ihr Vater ist völlig durchgeknallt und will im Garten ein Kolosseum bauen. Außerdem ist ihre Schwester abgehauen und hat ihren Mann mit den beunruhigend kreativen Kindern sitzen lassen. Kea wird klar: Hier ist ein Profi wie sie gefragt. Nur erweist sich ihre Familie als beratungsresistenter Problemkunde. Als wäre das nicht schon schlimm genug, verliebt sie sich auch noch ...
Das E-Book ist vormals unter dem Titel "Es geht immer noch schlimmer" und dem Pseudonym Ida Hansen erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Mit Familie ist das Chaos garantiert Kea hat die Nase gestrichen voll. Nach einem Burn-out soll die toughe Unternehmensberaterin nicht mehr arbeiten. Sie flieht ins Haus ihres Vaters nach Ostfriesland. Doch Ruhe findet sie dort nicht. Ihr Vater ist völlig durchgeknallt und will im Garten ein Kolosseum bauen. Außerdem ist ihre Schwester abgehauen und hat ihren Mann mit den beunruhigend kreativen Kindern sitzen lassen. Kea wird klar: Hier ist ein Profi wie sie gefragt. Nur erweist sich ihre Familie als beratungsresistenter Problemkunde. Als wäre das nicht schon schlimm genug, verliebt sie sich auch noch ..
Das E-Book ist vormals unter dem Titel "Es geht immer noch schlimmer" und dem Pseudonym Ida Hansen erschienen
Über die Autorin
Helga Glaesener hat ursprünglich Mathematik und Informatik studiert, bevor sie sich entschloss, freie Autorin zu werden. Gleich ihr erster Roman »Die Safranhändlerin« wurde ein Besteller. Sie lebt heute in Oldenburg. Im Verlag Rütten & Loening erscheint von ihr: »Die Wikingerin«, im Aufbau Taschenbuch liegt ihr Roman »Das Erbe der Päpstin« vor.
Helga Glaesener
Schlimmer geht immer
1
»Arigatõ gozaimashita«, sagte Herr Yamaguchi, als Kretschmar ihm die Tür zum Quadrigaaufhielt. Das ist Japanisch und heißt »danke schön«. Er benutzte den Ausdruck gern und oft, obwohl er perfekt Deutsch sprach. Ich glaube, es war seine Art, mir und Herrn Kretschmar zu zeigen, wie sehr er sich über unseren Vertragsabschluss freute.
Ich sagte: »Dõitashimashite.« Das heißt »gern geschehen«, und es war meine Art auszudrücken, dass ich mein horrendes Honorar zu Recht bekam, weil ich mir sogar eine komplizierte japanische Floskel aneignete, um meinen Kunden glücklich zu machen. Mein Briefträger, der sich ein paar Jahre in der Welt herumgetrieben hatte, hatte sie mir beigebracht, und ich hatte sie mir sicherheitshalber mit einem Kuli auf den Arm gekritzelt.
»Arigatõ gozaimashita«, lächelte Herr Yamaguchi, als ich ihn und Kretschmar zu dem Tisch führte, den ich für uns reserviert hatte.
»Dõitashimashite«, lächelte ich zurück. Ich wartete ab, bis meine beiden Gäste sich gesetzt hatten, und ließ mich dann auf den dritten Stuhl fallen. Donnerwetter – was für ein Moment! Darauf hatte ich vier verdammte Monate hingearbeitet. Ich wartete auf das Glücksgefühl, das sich bei mir in solchen Augenblicken einstellt, aber ich fühlte nur Müdigkeit. Kretschmar hatte mich ausgelaugt.
Mein Kunde besaß einen 30-Mann-Betrieb, der sich mit dem Ausstopfen verstorbener Haustiere befasste, und weil der Laden miserabel lief, hatte er unsere Unternehmensberatung engagiert. Es hatte viel Mühe gekostet, ihn zu überzeugen, dass Excel-Tabellen der Buchführung auf Post-its überlegen waren, und noch mehr Mühe, ihm abzugewöhnen, seine Kunden mit einem präparierten Hyänenkopf zu unterhalten – auch wenn der mittels MP3-Player im Unterkiefer »Muffi hat Mama lieb« krächzen konnte und das total witzig war. Ich hatte die Bücherkiste mit den Mängelexemplaren von Friedhof der Kuscheltiere aus dem Wartebereich entfernt. Ich hatte ihm günstigere Lieferanten besorgt und seiner Frau verboten, mit seinen Kunden die Auswirkungen künstlicher Hüftgelenke auf die Verdauung zu debattieren. Ich hatte also aus seinem Kramladen einen effektiven, wettbewerbsfähigen Betrieb gemacht.
Und als alles wie am Schnürchen lief, hatte ich ihn mit Herrn Yamaguchi zusammengebracht, der in Japan ein Imperium aus Seniorenheimen aufbaute und nach neuen Möglichkeiten suchte, seiner Kundschaft das Alter zu verschönern. Herr Yamaguchi war von der Idee, Haustiere auszustopfen, begeistert, und nun würden wir im Quadrigafeierlich die Unterschriften unter die Verträge setzen.
»Wobei ich persönlich ein sehr weltoffener Mensch bin«, erklärte Kretschmar Herrn Yamaguchi gerade. »Und Japan find ich besonders klasse. Wir haben so eine verwandte Mentalität, was? Nur das mit den Autos habt ihr versaut. Ich hab meinen Toyota wegen der Fensterheber in die Werkstatt bringen müssen.« Er schlug Herrn Yamaguchi kumpelhaft auf die Schulter, und ich merkte, wie mein Magen sich verkrampfte.
Der Kellner brachte uns die Weinkarten. »Arigatõ gozaimashita«, sagte Herr Yamaguchi.
»Dõitashi –«
»Hoffentlich habt ihr auch anständige Weine!«, fiel Kretschmar mir ins Wort und fegte die Dekoration zur Seite, um Platz für die Karten zu schaffen.
»Ich denke, wir können Sie zufriedenstellen«, murmelte der Kellner.
Herr Yamaguchi lächelte.
»Was nun die Autos angeht – da solltet ihr mal deutsche Ingenieure hinzuziehen«, half Kretschmar unserem Gast mit einem guten Rat weiter. »In Sachen Technik seid ihr ja nicht schlecht, aber mehr so in Richtung Computer, was?«
»Und in Sachen Medizintechnik und … eigentlich auf jedem anderen Gebiet auch«, sagte ich und wünschte mir, ich könnte meinem Schützling die Hände um den feisten Hals legen. Ich hatte diese Geschäftsbeziehung bis ins letzte Detail geplant. Kretschmar würde sie doch nicht im letzten Moment platzen lassen?
»Ich war mal in Peking – das ist ja fast das Gleiche wie Japan«, plauderte Kretschmar, während sein Finger über die Weinkarte fuhr. »Und muss sagen: Donnerwetter! Also dieser Barbarenwall. Mauern bauen könnt ihr, da beißt kein Huhn einen Faden ab.«
»Ein Huhn?«, fragte Herr Yamaguchi.
»Das ist nur eine Redensart«, erklärte ich nervös.
»Drei Flaschen von eurem Besten«, bestellte Kretschmar beim Kellner.
Als Herr Yamaguchi sich erhob, um das diskrete Örtchen aufzusuchen, bat ich Kretschmar mit unter dem Tisch geballten Fäusten, sich zurückzuhalten.
»Warum denn?«, fragte er verblüfft.
»Japaner sind eher stille Menschen. Sie lieben den förmlichen Umgang. Sie reden nicht so viel.«
»Echt jetzt?« Kretschmar versprach, es zu berücksichtigen, hakte aber sicherheitshalber noch mal nach, als Herr Yamaguchi zurückkehrte. »Quassel ich Ihnen die Hucke voll? Also, können Sie ruhig sagen, wenn ich nerve. Nerv ich Sie?«
»Keineswegs«, sagte Herr Yamaguchi.
»Na bitte!« Kretschmar zwinkerte mir zu, um anzudeuten, dass ich eben auch nicht alles wisse.
Ich knibbelte an der Speisekarte. Eigentlich war ich es gewohnt, mit solchen Situationen umzugehen. Aber in den letzten vier Jahren hatte ich kaum Urlaub gemacht, und an diesem Abend fühlte ich mich wie ein ausgewrungener Waschlappen. Hatte ich mich vielleicht übernommen? Ging mir die Puste aus?
»Nur das mit den Haifischflossen – das find ich nicht korrekt von euch. Jetzt mal vom Tierschutz her. Und ziemlich eklig ist das auch«, sagte Kretschmar, während der Kellner vor uns den Wein abstellte.
Herrn Yamaguchis Lächeln wurde so dünn, dass man die Sonne hindurchscheinen sah. Mir war klar: Ich musste intervenieren und dafür sorgen, dass die Stimmung wenigstens lange genug hielt, um den Vertrag in trockene Tücher zu bekommen. Dann war mein Auftrag erfüllt, und ich konnte meine Rechnung ausstellen. Aber mir fiel nichts ein, außer dass ich mir einen harten, stumpfen Gegenstand wünschte, um Kretschmar zum Schweigen zu bringen.
»Vielleicht sollten wir den Vertrag unterschreiben, bevor das Essen kommt?«, schlug ich vor.
Herrn Yamaguchis dünnes Lächeln galt jetzt mir. Fand er es unhöflich, dass ich drängelte? Galt so etwas in Japan als peinlich?
»Oder wir unterschreiben später – im Grunde ist es ja egal.« Ich war so fertig. Ich wollte nach Hause und mich verkriechen. Hundert Jahre schlafen. Ich unterdrückte den Drang, hysterisch zu kichern.
»Frauen haben’s immer so eilig!«, lachte Kretschmar. »Die sind von Natur aus aufm Sprung. Nie geht ihnen was schnell genug. Meine ist genauso. Nicht, dass ich an ihr was auszusetzen hätte. Das ist ’ne gute Seele. Tut und werkelt. Aber am liebsten sind sie uns doch, wenn sie das Nest warm halten und uns machen lassen, was!« Er boxte Herrn Yamaguchi mit grölendem Gelächter in die Seite.
Das Glas in meiner Hand zitterte. Ich packte es fester und schüttete Kretschmar meinen Rotwein ins Gesicht.
Als ich Stunden später meiner besten Freundin Jo in meinem Wohnzimmer gegenübersaß, zitterte ich immer noch. Das hörte gar nicht mehr auf. »Weißt du, ich hab wochenlang auf Frau Kretschmars Röntgenbilder gestarrt und die Ähnlichkeit ihres künstlichen Hüftgelenks mit dem Schattenriss eines Pekinesen bewundert. Ich habe meinen Urlaub geschmissen, und ich hab Frau Kudrjawzew ein doppeltes Gehalt gezahlt, damit sie nicht zur Arbeit kommt und mich stört. Letzte Woche hab ich sogar kotzen müssen, vor lauter Müdigkeit.«
»Das ist richtig«, meldete sich Frau Kudrjawzew von nebenan, wo sie mit dem Geschirr klapperte. »Hat sie ekelhaftes Geräusch bei gemacht. Ich werde nicht bezahlt, zu hören ekelhaftes Geräusch.«
»Du hast gekotzt?«, fragte Jo.
Ich brach in Tränen aus. Jo reichte mir mitfühlend die Porzellanrosenbox mit den Kleenex und kaute auf ihrer Lippe. Während ich heulte wie ein Schlosshund, schaute sie mehrere Male auf die Uhr. Draußen im Auto wartete Sören. Den hatte sie vor einem halben Jahr bei einem Aktivurlaub in der mongolischen Steppe kennengelernt. Oder bei einem Zahnarztbesuch. Ich wusste es nicht mehr genau. Wir waren ja kaum noch zum Reden gekommen vor lauter Arbeit. Die beiden wollten nach Amerika rüber, Wildwasser paddeln oder Grizzlybabys kraulen.
»Du musst los«, sagte ich.
Jo nickte. »Dieser Widerling Kretschmar hat dich also gekränkt, und da hast du …«
»Wahrscheinlich bin ich gestolpert. Kann sein, das Ganze war nur ein Versehen. Eine Riesenungeschicklichkeit.« Hoffnungsvoll blickte ich meine Freundin an.
»Du hast gesessen und bist dabei gestolpert?«
Sie hatte recht. Ich schrumpfte wieder in mich zusammen und heulte erneut. Das lief bei mir momentan wie die Niagarafälle. Auf der Straße hupte ein Auto. Sicher Jürgen, der Angst um seinen Urlaub hatte. Ich zog meine Freundin hoch und drückte ihr die Handtasche in die Hand.
»Hast du schon mit Axel gesprochen?«, fragte sie, während sie über den Staubsauger stolperte, den Frau Kudrjawzew im Flur hatte stehen lassen.
»Klar«, log ich. Genau genommen hatte ich nur auf seinen Anrufbeantworter gesprochen. Axel Heiner war mein Geschäftspartner, und außerdem das, was man mit dem eckigen Wort Lebensabschnittsgefährte umschreibt. Wir wohnten zwar nicht zusammen, weil wir das für spießig hielten, aber wir liebten uns und waren immer füreinander da.
»Ist kein guter Mensch, Herr Heiner. Hat einen krummen Charakter. Würde sonst Frau Hinrichs zu eine ehrbare Frau machen«, gab Frau Kudrjawzew aus der Küche ihren Kommentar ab.
»Sie meint heiraten«, wisperte ich unter Tränen. »Als ob ich das wollte.«
»Wer flüstert, der lügt«, brüllte Frau Kudrjawzew.
Ich öffnete die Haustür. Sören – oder hieß er doch Jürgen? Weiß der Kuckuck, warum ich mir seinen Namen nicht merken konnte – saß in seinem Cabriolet und kaute Kaugummi. Er sah nett aus, sportlich, mit dunklen Haaren. Wie schade, dass ich fast nichts über ihn wusste. Aber Kretschmar hatte eben meine gesamte Zeit in Anspruch genommen, und …
»Du brauchst Urlaub!« Jo stemmte sich gegen meine Drängelei, indem sie sich in den Türspalt stellte. »Nimm dir frei, Amke. Versprich’s mir. Richtig lange.«
»Du verpasst den Flug!«
»Schätzchen, du bist überarbeitet.« Jo sprach langsam, als hätte sie es mit einem besonders einfältigen Kind zu tun. »Du hast dich ausgebeutet, und nun ist der Saft raus. Burn-out!«
»Ich weiß.«
»So was kann gefährlich werden. Du musst also unbedingt etwas dagegen tun. Oh, ich hasse es, dass ich gerade jetzt fortmuss. Warum gehst du nicht in ein Kloster? Die bieten solche Entspannungsgeschichten …«
Jupp hupte.
»Versprichst du es mir?«
»Ja doch.«
Jo beäugte mich skeptisch. »Süße, ich nehme das als heiligen Schwur!« Sie sauste davon, und ich winkte dem Auto hinterher.
Während ich die Tür schloss, floss alle Erregung aus mir heraus. Puh. Endlich Stille. Ich schaute den Flur hinauf. Der Weg zu meinem Sofa war lang, er fühlte sich an wie ein Marathon durch die Sahelzone. Ich ließ mich daraufplumpsen und schloss die Augen. Wie konnte man nur so erschöpft sein und gleichzeitig so aufgedreht!
Noch einmal versuchte ich, Axel anzurufen. Dieses Mal wurde abgehoben. Am anderen Ende des Telefons meldete sich eine weibliche Stimme. Ich drückte mein Taschentuch gegen die Augen. Axel und ich führten eine freie Beziehung, jenseits aller Spießigkeit. Das hatten wir von Anfang an klargestellt. Wir waren einander seelisch treu, also ein richtiges Paar. Aber wenn sich einer von uns einen kleinen Flirt leistete, war das keine Katastrophe. Dieses Arrangement funktionierte wunderbar. Nur dass er gerade jetzt beschäftigt sein musste …
»Da ist wer für dich«, rief die Stimme, die piepsig klang wie von einem magersüchtigen Model, das über einen Laufsteg wackelt.
»Oh, doch nicht jetzt!«, brummelte Axel.
»Nicht jetzt«, piepste die Stimme und legte auf. Ich horchte ihr nach. Moment, war das nicht die Praktikantin, die seit einem Monat bei uns im Büro rumlungerte? Dieses unmögliche Geschöpf mit den Shorts, die ihr wie eine zweite Haut am Hintern klebten, und dem Piercing in der Lippe, das alle Arbeiten nur murrend erfüllte? Verdammt! Dass wir uns nicht einigeln wollten, war klar, aber wir hatten festgelegt, dass Flirts mit gemeinsamen Bekannten tabu waren.
Ich spürte, wie etwas in meinem Herzen splitterte. Axel war nicht irgendjemand für mich. Wir kannten uns schon aus dem Studium, hatten uns nach dem Examen aber aus den Augen verloren und vor vier Jahren zufällig in Paris wiedergetroffen. Es war wie ein Tornado gewesen. Wir hatten gelacht, uns auf dem Eiffelturm geküsst und schließlich beschlossen, unsere beiden Büros für Unternehmensberatung zusammenzulegen und nach Berlin zu ziehen, wo das wahre Leben tobte. Danach hatten wir Hinrichs und Heiner – ein Garant für Erfolg gemeinsam auf die Überholspur gebracht und … Ich war so verliebt in ihn! Wie konnte er gerade jetzt, wo ich ihn brauchte, mit unserer Praktikantin rummachen?
Frau Kudrjawzew erschien in der Tür. Der Blick, mit dem sie mich betrachtete, war plötzlich sorgenvoll, fast könnte man sagen: mitleidig. »Geht er nicht ans Telefon, miese Kanaille?«
»Er ist keine Kanaille. Wir lieben uns.«
»Er ist natürlich Kanaille«, sagte Frau Kudrjawzew. »Guter Mann bringt Frau nicht zum Weinen.« Sie reichte mir einen Papierkorb. »Hier rein, bitte schön!« Seufzend schaute sie zu den Fenstern, die sie wahrscheinlich wahnsinnig gern geputzt hätte. Aber dafür hätte sie mein Sofa beiseiterücken müssen, und das ging nicht, weil ich ja draufsaß.
»Keine Mama?«
»Bitte?«
»Wenn Mensch Kummer hat, dann geht er zu seine Mama!«, sagte Frau Kudrjawzew in einem Ton, als erklärte sie einem Analphabeten die Schrift.
»Meine Mama ist tot«, sagte ich und brach erneut in Tränen aus. Nicht aus Verzweiflung. Meine Mutter war bei meiner Geburt gestorben, und ich hatte nicht die geringste Erinnerung an sie. Aber es war mir mittlerweile zur Gewohnheit geworden, das Ende jeden Satzes mit Tränen zu begießen.
Erstaunlicherweise setzte Frau Kudrjawzew sich neben mich aufs Sofa und legte den Arm um meine Schultern. Sie seufzte. »Das ist schlimm. Tote Mama ist sehr schlimm.«
Schluchzend nickte ich.
»Und Papa?«, wollte Frau Kudrjawzew wissen.
Vor mir tauchte das Bild unseres Hauses im ostfriesischen Großefehn auf. Mein Vater war Lehrer im Ruhestand. Seit seiner Pensionierung hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, unser Zuhause in ein Schmuckstück zu verwandeln, in eine Perle der gemütlichen ostfriesischen Beschaulichkeit. Swantje, meine ältere Schwester, wohnte gleich nebenan. Hinter den Häusern floss ein Kanal, auf dem im Sommer Enten schwammen. Darin hatte ich mit Swantje geangelt, als ich noch zu Hause wohnte.
Inzwischen hatte sie geheiratet – Klaes Eilers, der im Sommer ’92 Schützenkönig gewesen war und schon damals phantastische Fünf-Gänge-Menüs zaubern konnte. Klaes hatte sein Hobby inzwischen zum Beruf gemacht und werkelte im besten Restaurant von Aurich. Zwei Kinder besaßen sie auch. Ich überlegte, wann ich das letzte Mal bei meiner Familie gewesen war. Es musste bei Fennas Taufe gewesen sein, also vor etwa drei Jahren.
Jetzt tat es mir leid, dass ich die letzten Urlaube immer mit Axel in Florida verbracht hatte. Ich bekam Sehnsucht nach dem prächtigen Holunderschnaps, den Swantje brannte. Und nach Papas gegrilltem Zander. Wie gemütlich es bei uns immer gewesen war. Warum zum Teufel hatte ich meine Leute so lange nicht besucht?
Ich löste mich aus Frau Kudrjawzews Umarmung. Auf einmal hatte ich wieder den Durchblick. Ich würde nach Hause fahren. War doch das Natürlichste der Welt.
»Zu Papa?«, fragte Frau Kudrjawzew erleichtert, als ich in mein Ankleidezimmer ging und meine Reisetasche hervorkramte. Sie begann wieder zu summen. Die Liiiiiebe, die ein seltsames Spiel war, begleitete mich, bis ich die Tür ins Schloss zog.
2
Es würde alles gut werden. Das merkte ich schon hinter Oldenburg, als die Wiesen plötzlich bis zum Himmel reichten und weiße Wölkchen sich zu Schäfchenherden sammelten. Fehnhäuser säumten die Straßen, Klappbrücken überspannten die Kanäle, Windräder durchpflügten die klare Luft. Das ist es: Heimat!, dachte ich euphorisch. Hier war ich mit dicken Beinchen durch meine Kindheit gestapft. Ich stellte im Radio NDR ein, und als hätte man dort geahnt, wonach sich die verlorene Tochter sehnte, sang jemand Dat Rasenmaiher Leed. Er hoult de Rasenmair, auch wenn et regnen dair … Ich kurbelte die Fenster runter und sang mit. Platt ist eine wunderbare Sprache. Warm und undramatisch.
Beschwingt bog ich eine halbe Stunde später auf den Parkplatz neben Papas Haus ein – und hätte fast einen Blumenkübel gerammt. Erschrocken stellte ich den Motor aus. Was war denn hier los? Fast die gesamte Fläche vor der Garage meines Vaters war mit leeren Trögen zugepflastert. Es sah aus wie die Ausstellungsfläche einer Gärtnerei. Blumen hatte mein Vater ja schon immer gemocht. Die sabbeln nicht so viel wie Kinder, war immer seine Redensart gewesen. Aber jetzt war ich doch ein bisschen geplättet.
Vorsichtig stieg ich aus dem Wagen und atmete in tiefen Zügen die ostfriesische Luft ein. Oben im geöffneten Giebelfenster unseres Hauses flatterten weiße Gardinen. Nebenan bei Swantje konnte ich im Garten blaue Gartenstühle unter einem blau-weiß gestreiften Sonnenschirm erspähen. Freude durchrieselte mich. Gerade erst angekommen und schon geheilt. Das geht ja ratzfatz, freute sich mein effizientes Unternehmensberaterinnenherz.
Gutgelaunt holte ich meine Reisetasche aus dem Kofferraum. Gerade als ich den Wagen abschloss, öffnete sich die Eingangstür unseres Hauses. Etwas stapfte die beiden Stufen herab. Nicht Papa, nein, ganz und gar nicht. Das Wesen trug eine schwarze, zerrissene Jeans, aus der an den unmöglichsten Stellen weiße Haut lugte, dazu blutroten Lippenstift und fingerbreit schwarzen Kajal um die Augen. Außerdem eine schwarze, etwas schmierige Lederjacke. Doch am schockierendsten waren die Haare. Sie standen in jede Richtung vom Kopf ab, als hätte das Wesen gerade in eine Steckdose gefasst. Ich zog vorsichtshalber den Kopf ein, aber es stapfte glücklicherweise an mir vorbei, ohne mich zu bemerken. Benommen griff ich nach meinem Handy. Für den Fall, dass sich in Papas Haus gerade etwas Furchtbares abgespielt hatte, wollte ich ohne Zeitverlust die Polizei informieren können.
Das Wesen ging zu Swantjes Haus hinüber und verschwand darin. Das Letzte, was ich sehen konnte, war, wie es mit dem Handrücken unter der Nase rieb. Und da fielen mir die berühmten Schuppen von den Augen. Blitzartig verjüngte sich das Wesen um drei Jahre. Und wurde zu einem dreizehnjährigen mageren Mädchen, das TKKG las und von Ponys schwärmte und, wenn es groß war, Ärztin werden wollte. Ponyärztin vorzugsweise.
Rieke, dachte ich benommen. Die süße Rieke mit ihren Schwärmereien, die sich über die Weihnachtsfeiertage an meinen Arm gehängt und mich stundenlang mit Geschichten über gewiefte Kinderdetektive zugequatscht hatte. Bevor ich wieder wegfuhr, hatte sie mich in ihr Poesiealbum schreiben lassen. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.
Puh! Dass Kinder sich veränderten, wusste ich ja. Aber so? Andererseits hatte Swantje, meine patente Schwester, die Haushalt und Kinder routiniert wie ein Zirkusjongleur am Laufen hielt, sicher alles im Griff. Wahrscheinlich war dieses Aussehen nur eine Phase. Vielleicht hatte Rieke sich für einen Maskenball ausstaffiert? Und wenn nicht, dann hatte Swantje noch ein paar Jahre, um die Sache wieder hinzubiegen.
Ich kramte meinen Schlüssel aus der Jackentasche und wollte die Tür zu unserem Haus aufschließen. Doch der Schlüssel passte nicht. Wie blöd. Irritiert rüttelte ich an der Tür. Offenbar hatte Papa das Schloss auswechseln lassen. Und zwar ohne mir Bescheid zu sagen. Was sollte das denn? Wohnte ich hier nicht mehr, nur weil ich ein paar Jahre fort gewesen war? Ich gebe zu: Das ging mir schon ein bisschen ans Herz. Auf mein Klingeln rührte sich nichts, also ging ich ums Haus herum in Richtung Garten. Dort hatte ich bereits die ganze Zeit ein dumpfes Rumoren gehört. Es wurde mit jedem Schritt lauter. Ich bog um die Ecke – und blieb wie vom Blitz getroffen stehen.
Um meinen Schock zu verstehen, muss man wissen, dass Papas Garten immer etwas Besonderes gewesen war. Ein Prachtstück aus Obstbäumen, Büschen, Rasen und Blumen, die den Garten den ganzen Sommer über in einen Farbenrausch versetzten. Dazu ein heimeliges Eckchen mit Gemüsebeeten. Ein Wohlfühlparadies. Und jetzt?
Wo früher Beete und Rasen gewesen waren, erstreckte sich ein Acker mit schwarzer, krümeliger Erde, aus der abgebrochene Äste ihre Arme wie Ertrinkende reckten und rote Rosenblüten gleich Blutstropfen die Furchen sprenkelten. Durch diese Verwüstung marschierte mein Vater hinter einer Art motorisiertem Pflug und zerstörte ein weiteres Stück Rasen. Ich merkte, wie sich etwas in mir zusammenzog.
»Mensch, Papa!«, brüllte ich. Der stampfende Dieselmotor dröhnte und übertönte mich, mein Vater machte ungerührt weiter. Ich hopste durch die Ackerfurchen und schaffte es, mich so zu platzieren, dass er mich sehen konnte, ohne mich sofort niederzuwalzen. Heftig schwenkte ich die Arme. »Papa – hallooooo!«
Seine Miene hellte sich auf. Strahlend stellte er den Motor des unheimlichen Dieselmonsters ab und schloss mich in die Arme. »Ja Amkekind, Schätzchen, mein Liebes, was für eine Überraschung!« Seine Stimme schwankte vor Rührung. »Dass du gekommen bist. Ich freu mich so!« Er schwenkte mich unbeholfen herum und umarmte mich so heftig, dass ich plötzlich ein rabenschwarzes Gewissen bekam. Wie hatte ich meinen Vater nur so lange allein lassen können? Drei Jahre, in denen wir nichts als belanglose Telefongespräche geführt hatten. Dabei liebte ich ihn doch so!
Er wandte sich zu der gepflügten Fläche, legte den Arm um meine Schulter und fragte mit einem zufriedenen Blick auf seine Baustelle: »Sieh mal, was ich aus unserem Garten mache. Na? Was denkst du, Schätzchen?«
Ich starrte auf den Acker. »Papa, was soll das denn werden?«
»O wie fühl’ ich in Rom mich so froh!«, rezitierte mein Vater mit dramatischer Stimme. »Gedenk’ ich der Zeiten, da mich ein graulicher Tag …«
»Was?«
»Das ist Goethe, mein Schätzchen. Aus den Elegien. Er besingt Rom. Gedenk’ ich der Zeiten …«
»Papa …«
»Schon gut, mein Herz. Ich plane einen römischen Garten, darum geht es. Ich werde unser Grundstück in eine Oase voller südländischen Charmes verwandeln. Italien nach Ostfriesland holen. Stell dir das Ganze vor wie den Park bei der Villa Borghese.«
Bitte? Wollte er etwa nackte Kerle aus Marmor in unseren Garten stellen, die lüstern zu meinem Kinderzimmerfenster starrten? »Papa …«
»Ich werde hier Palmen pflanzen und ein paar Zitronenbäumchen und Orchideen … Vielleicht baue ich auch einen Brunnen, aber da bin ich noch nicht sicher. Na, was denkst du?«, wiederholte er seine Frage.
Ja, was sollte ich denn denken? Palmen in Ostfriesland? Ein Villa-Borghese-Park im Püttjeweg 213 in Ostgroßefehn auf einem handtuchschmalen Grundstück? Da gab es doch praktisch nur eine Schlussfolgerung, und die war schrecklich. Wurde mein Vater womöglich dement?
Als er in die Küche ging, um uns einen Tee zu brühen, stürzte ich zum Nachbarhaus. Swantje würde mir erklären, was los war. Vielleicht war ja alles gar nicht so schlimm, wie es sich im ersten Moment anhörte. Ich klingelte Sturm. An Swantjes Haustür hing ein Schild: Ich baue nicht aus Lust und Pracht, die Not hat mich dazu gebracht. Mich konnte die Not jetzt auch zu allerlei treiben.
Ungeduldig trippelte ich von einem Fuß auf den anderen. Nichts rührte sich. Swantje und ihre Familie waren offenbar ausgeflogen. Nicht einmal der Vampir ließ sich blicken.
Ich ging ums Haus herum. Hinter dem Garten ankerte das Hausboot von Peet im Kanal. Peet war Klaes’ älterer Bruder, also mein Schwippschwager oder wie man so jemanden nennt. Ähnlich wie Klaes hatte er nie den Absprung vom elterlichen Hof geschafft. Aber während Klaes das Haus in Besitz genommen hatte, hatte Peet es sich am Kanalufer gemütlich gemacht. Ich sah ihn zwischen Terrakottatöpfen voller Frühlingsblumen in einem Liegestuhl schlafen.
Eine breite Planke führte vom Rasen zu seinem Boot. Wenig begeistert tastete ich mich über den Holzsteg zum Bootsdeck. Das Kanalwasser war von Entengrütze bedeckt, und ich vermutete, dass sich darunter Schlingpflanzen befanden, bereit, einen unvorsichtigen Schwimmer in den nassen Tod zu ziehen. Auch die Existenz von Wassergeistern mit Armen aus glitschigen Algen war aus meiner Sicht nicht glaubhaft widerlegt.
Ich atmete auf, als ich sicher auf dem Bootsdeck angelangt war. Wenig begeistert betrachtete ich den Schlafenden. Peet ähnelte seinem Bruder. Eine blonde Mähne, die sich schwer bändigen ließ. Eine Buckelnase. Und ein Gesicht mit einem runden, friedlich wirkenden Kinn, was aber nicht täuschen durfte. Denn Peet war knallhart.
Als ich ihm mit dreizehn Jahren in einem in schlaflosen Nächten gefertigten, mit rosa Herzen verzierten Brief die berühmte Ja-Nein-Vielleicht-Frage stellte, hatte er meinen Herzenserguss bei seinen Kumpels von der freiwilligen Feuerwehr rumgezeigt, und jeder von ihnen hatte mit Namen angekreuzt, ob er sich eine Zukunft mit Amke Hinrichs vorstellen könnte. Das Resultat war nicht gerade überwältigend gewesen. Viele hatten auch noch einen Kommentar dazugeschrieben, der sich auf meinen Babyspeck bezog. Lauter Blödmänner. Oberblödmann: Peet Eilers.
Aber das war jetzt nicht wichtig. Ich räusperte mich.
Peet öffnete die Augen – und ich segelte durch die Luft. Aus den Augenwinkeln hatte ich gerade noch ein riesiges, haariges Ungetüm wahrgenommen, im nächsten Moment schlug ich schon auf dem Wasser auf.
Was die Schlingpflanzen angeht: Ja, es gibt sie wirklich. Sie umklammerten meine Beine und zogen mich unbarmherzig in die Tiefe. Wassergeister existieren ebenfalls. Einer von ihnen zerrte mich an den Armen zu sich heran. Ich blickte in stechend blaue Augen und schrie, was das Zeug hielt.
»Ruhe!«, brüllte der Wassergeist.
Nie im Leben! Oder … vielleicht doch. Der Wassergeist hatte Peets Züge und sprach mit seiner Stimme. Hektisch schnappte ich nach Luft und klammerte mich an Peet fest. Eine Ente zog vorbei und beäugte uns neugierig. Am Ufer stand ein Hund – das fette Vieh, das mich ins Wasser gestoßen hatte – und kläffte.
»Können Sie schwimmen?«
Ich nickte.
»Dann schwimmen Sie, verdammt noch mal.« Peet machte sich los und kraulte zum Ufer. Sein Kopf war über und über mit Wasserlinsen bedeckt. Einen Moment war ich erfüllt von Dankbarkeit. Vielleicht war er immer noch ein Oberblödmann, aber immerhin hatte er nicht gezögert, in den Kanal zu springen und mir das Leben zu retten. Ich folgte ihm ans Ufer.
Der Hund kläffte immer noch. »Nimm ihn weg«, rief ich Peet zu, der sich bereits ins Trockene hochgearbeitet hatte.
Er zog sich das klatschnasse Hemd über den Kopf. Darunter kam ein erstaunlich muskulöser Oberkörper zum Vorschein. »Quatsch! Quasimodo tut nichts.«
Ha ha ha! »Nimm ihn weg!«
Peet packte das Tier brummig am Halsband und wartete, während ich wenig elegant das Ufer erklomm.
Frierend stand ich in der Sonne. »Hast du ein Handtuch?«, wollte ich von Peet wissen. »Ich muss mit jemandem reden.«
»Amke? Amke Hinrichs? Herrgott, bist du das wirklich?«, fragte er.
»Worüber willst du denn reden?«, wollte er wissen, als ich wenig später in eine Decke gehüllt zitternd in der Kajüte stand. Durch die offene Tür konnte ich seine Schlafkoje sehen, die von einem schmalen Doppelbett fast ausgefüllt wurde. Unter der Bettdecke lugte ein seidenes Pyjamabein hervor. Peet Blödmann hatte offenbar geheiratet. Ich wandte den Blick ab. »Mein Vater, Peet. Ich mache mir Sorgen. Er … tut so verrückte Sachen.«
»Wieso?«
Die Worte sprudelten jetzt aus mir heraus. »Ein römischer Garten. Hier auf unserem Grundstück. Stell dir das mal vor: Mein Vater will Palmen pflanzen in einem Landstrich, in dem man ständig im Moor stecken bleibt und über Hitzewellen klagt, wenn das Thermometer zwei Tage hintereinander zwanzig Grad zeigt. Hast du kapiert, was ich sage? Mein Vater will …«
»Entspann dich«, sagte der Blödmann und rubbelte sich den Kopf trocken. »Es ist doch egal, was er pflanzt. Hauptsache, er hat seinen Spaß daran.«
»Aber …«
»Du bist doch in ein paar Tagen sowieso wieder weg.«
Was sollte das denn nun? So wie Peet es aussprach, klang es, als könnte er meine Abreise kaum erwarten. Er selbst hatte übrigens auf meinen Zettel, weil er damals schon gern zeichnete, eine Dampfwalze gemalt, die gerade ein Strichmännchen in grünen Hosen plattmachte. Für die Begriffsstutzigen hatte er auf die Dampfwalze Amke geschrieben und auf das Männchen Peet.
Mir verging die Lust, mit ihm über meinen Vater zu reden. Offenbar kapierte er gar nicht, wo das Problem lag. Schlechtgelaunt schaute ich in eine tiefer gelegene Kabine, in der ein Schreibtisch und ein Regal voller Leitzordner standen. Peet hatte Architektur studiert, und offenbar hatte er sein Büro ebenfalls hier auf dem Boot eingerichtet. Unter dem Schreibtisch erspähte ich ein kleines Mädchen, das Quasimodo Spangen ins Fell flocht. Nachwuchs hatte er also auch schon. »Hallo«, sagte ich. Das Mädchen spielte ungerührt weiter.
»Wo stecken eigentlich Klaes und Swantje?«, fragte ich mürrisch.
»Klaes kocht«, sagte Peet und schob mich zu der kleinen Treppe, die an Deck führte.
»Immer noch in dem Restaurant in Aurich?«
Er zuckte mit den Schultern. Wieder an der frischen Luft, starrte ich trübsinnig zu Swantjes blauen Gartenmöbeln. Meine Schwester hatte nicht wissen können, dass ich kommen würde, aber irgendwie fand ich es trotzdem gemein, dass sie nicht da war. Ich hatte mich so darauf gefreut, endlich mal wieder mit ihr zu quatschen.
»Wie lange wirst du denn bleiben?«, fragte Peet.
»Keine Ahnung. Nur ein paar Tage.«
»Hätte mich auch gewundert.«
»Was?«
»Wenn du vorgehabt hättest, dich mal ein bisschen um den Karren zu kümmern, der hier im Dreck steckt.«
»Wieso kümmern? Wieso Dreck?«
Wieder hob er die Schultern. Das konnte er offenbar am besten: Andeutungen machen und dann den Gesprächspartner informationsmäßig ins Nirwana schicken. Ich gab ihm seine Decke und balancierte über die Planke zurück in den Garten.
Zwei Stunden später schmierte ich mir und meinem Vater, der nach des Tages Müh unter die Dusche gegangen war, ein paar Stullen, und nach dem Essen gingen wir beide zu Bett. Ich schlief auf der Stelle ein, glücklicherweise, denn ausreichend Schlaf ist ja das Fundament jeder Erholung.
Leider wurde ich bereits nach kurzer Zeit wieder wach. Die Nächte sind nicht das Schönste bei Liebeskummer und Burnout. Ich starrte eine gefühlte Ewigkeit aus dem Fenster, wo die Wolken wie Geisterheere vorbeizogen, und malte mir aus, wie es sein würde, wenn ich nicht mehr arbeiten könnte. Axel würde mich natürlich nicht im Stich lassen, aber irgendwann würde er sich für die Firma eine neue Partnerin suchen müssen, die keinen Wein über die Kunden schüttete. Frau Kudrjawzew würde kündigen und bei einer Chefin anheuern, die ihr schriftlich und von einem Notar beurkundet versicherte, dass sie nienieniemals zwischen neun und siebzehn Uhr ihre Wohnung betrat und sich darin auch keinesfalls übergab. Und ich selbst würde auf der Straße enden, das stand für mich fest.
Selbstmitleidig begann ich zu heulen, allerdings nicht sehr laut, denn Papa hatte seine Schlafkammer gleich nebenan, und ich wollte ihm keinen Kummer machen. Dann griff ich nach meinem Handy, um zu überprüfen, ob noch Geld auf meinem Konto war. Sicherheitshalber. Nicht, dass mich Herr Kretschmar in Schwierigkeiten bringen würde, wenn er nicht zahlte, aber Millionärin war ich auch nicht. Und jetzt, wo ich wegen meiner Erkrankung mit Frühverrentung rechnen musste … Ach, Mist! Ich würde ja gar keine Rente bekommen. Ich war doch selbständig. Warum hatte ich nichts Anständiges gelernt? Werde Lehrerin, hatte Papa immer gesagt, weitsichtig wie ein Prophet.
Mein Smartphone konnte mir nicht mit meinen Kontodaten aushelfen, weil ich dreimal meine PIN falsch eingab. Ich legte es beiseite und stellte den Fernseher an, um mich abzulenken. Das Einzige, was gesendet wurde, war ein Zug. Also nicht der Zug selbst, sondern das, was man durch die Fenster der Lok sehen konnte, während der Zug durch die Walachei gondelte. Vor allem Schienen und Büsche, manchmal eine Wiese, gelegentlich als Highlight eine Bahnstation in der Pampa. Davon aber nur die Bahnsteigkante.
Es dauerte eine ganze Weile, ehe ich aufhörte, auf eine Handlung zu warten. Man glaubt ja nicht so rasch, dass unsere Rundfunkgelder dafür ausgegeben werden zu zeigen, wie eintönig der Alltag eines Lokführers aussieht. Ein Gutes hatte die Sendung aber: Irgendwann nickte ich weg.
Hinter dem Stück Land, das Papa gerade umpflügte, befand sich noch ein Rest unseres alten Obstgartens. In der Mitte prangten zwei Pflaumenbäume, an denen die letzten weißen Blüten zwischen den Blättern schimmerten. Als ich am nächsten Morgen wie zerschlagen erwachte und zum Fenster taumelte, sah ich sie, ein Relikt aus meiner Kindheit, als mein Leben noch heil und ganz gewesen war und ich keinen Drang verspürte, Wein zu verspritzen. Meine Stimmung besserte sich ein wenig.
Ich entdeckte in meinem alten Kleiderschrank einen Jogginganzug, zog ihn an und stieg in den Keller hinab. Dort umrandete ich einige Eimer mit getrocknetem Mörtel und fand hinter den Resten einer Zwischenmauer, die Papa wohl eingerissen hatte, um den Raum zu vergrößern, die Hängematte, in der ich als Jugendliche die Sommertage verdöst hatte.
Im Kühlschrank in der Küche entdeckte ich einen Joghurt, den ich rasch auslöffelte, dann ging ich mit meiner Beute in den Garten. Die Sonne schien und legte einen Teppich aus Glanz und Gold über Ostfriesland. Vögel sangen. Papa schob zufrieden seinen Pflug durch die Gegend. Plötzlich kamen mir die Sorgen, die ich mir seinetwegen machte, übertrieben vor. Mein Vater wurde ein bisschen exzentrisch, okay, aber im Grunde hatte Peet recht: Hauptsache, ihm machte das Buddeln Freude.
Ich winkte ihm zu und hängte die Hängematte in die Ösen, die immer noch in den Pflaumenbaumstämmen steckten. Mein Vorhaben war einfach: Ich würde so lange hier liegen bleiben, bis ich mein Burn-out hinter mir gelassen hatte. Aufatmend ließ ich mich in die Matte plumpsen, rekelte mich, wackelte ein bisschen mit den Zehen und schloss die Augen. Puh, das entspannte.
Rattarrr …
Ich öffnete ein Auge.
Raratta … ratarattata …, machte Papas Pflug.
Nun ja. Nur schön ist es schließlich nirgends. Im Paradies hat die Schlange fiese Vorschläge zum Thema Obstverzehr gemacht, in Florida hatten mich Krebse gezwickt, in Berlin Frau Kudrjawzew genörgelt. Das bisschen Lärm war mir doch egal. Ich konzentrierte mich auf das Positive und wippte wieder mit den Zehen. Eine Biene summte. Grundsympathische Tiere, das. Fleißig, diszipliniert, effizient.
Rattataaraattaara …
»Papa, willst du nicht mal eine Pause einlegen?«
Der Diesel machte einen Höllenlärm. Mein Vater hörte mich nicht. Widerwillig bugsierte ich mich aus der Hängematte und ging zu ihm hinüber. Er stellte die Maschine ab und erklärte zufrieden: »Es dauert alles ein bisschen, aber ich komme voran, Amke.«