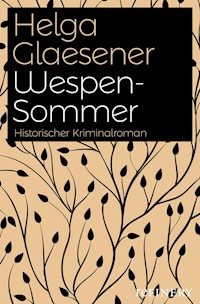8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein hochspannender historischer Krimi vor der atemberaubenden Kulisse der Semperoper Dresden, 1869: Annie Troll betreibt die erste Fechtschule für Frauen und genießt deshalb einen zweifelhaften Ruf. Als eine ihrer Schülerinnen, eine Ballerina an der Semperoper, in ihren Räumen stirbt, gerät Annie unter Verdacht. Sie sucht Hilfe bei Daniel Raabe, dem ersten Privatdetektiv Sachsens. Er nimmt sich des Falles an und arbeitet mit einer ganz neue Methode: Er setzt auf Fingerabdrücke als Beweismaterial. Zusammen mit Annie sucht er den Tatort danach ab. Doch offiziell anerkannt ist dieses Verfahren noch nicht. Als Annie einen gefälschten Brief findet, in dem sie selbst den Mord zugibt und ihren eigenen Selbstmord ankündigt, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Raabe erkennt, dass das Briefpapier das der Dresdner Freimaurerloge ist. Was hat die Loge mit dem Mord zu tun? Und wer hat ein gläsernes Herz an das Grab der Ermordeten gehängt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Dresden, 1869: Annie Troll betreibt die erste Fechtschule für Frauen und genießt deshalb einen zweifelhaften Ruf. Als eine ihrer Schülerinnen, eine Ballerina an der Semperoper, in ihrem Räumen stirbt, gerät Annie unter Verdacht. Sie sucht Hilfe bei Daniel Raabe, dem ersten Privatdetektiv Sachsens. Er arbeitet mit einer bislang unbekannten Methode: Er setzt auf Fingerabdrücke als Beweismaterial.
Bei der Beerdigung des Opfers wird auf Annie ein Anschlag verübt. Raabe nimmt einen Trauergast mit einem Totenschädel am Spazierstock ins Visier. Gehört er zu den unheimlichen Freimaurern? Hat die Loge mit dem Mord zu tun? Und warum versucht man, Annie aus dem Weg zu räumen?
Die Autorin
HELGA GLAESENER wurde in Niedersachsen geboren und studierte in Hannover Mathematik. Im Trubel ihrer fünfköpfigen Kinderschar begann sie 1990 mit dem Schreiben historischer Romane, von denen gleich der erste, Die Safranhändlerin, zum Bestseller avancierte. Neben dem Schreiben bringt sie angehenden Autoren die Kniffe des Handwerks bei. Seit 2010 lebt sie in Oldenburg.
Weitere Informationen unter www.helga-glaesener.de
Helga Glaesener
Historischer Roman
List
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1827-1
© 2018 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotive: © Magdalena Russocka / Trevillion Images; © Bridgeman Art Libary »View of Dresden«, 1850, Germany 19th Century.); De Agostini Picture Library; © Christie‘s Images Ltd »Napoleons Abdankung«. Um 1890-99, 170.2 x 140.3 cm; Geschichte; Cain; Georges Jules Auguste; 1856-1919; 19. Jahrhundert; Öl auf Leinwand; FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
1. Kapitel
Jette konnte fliegen. Sie schwang die Arme, sie drehte Kreise, sie flitzte übers Eis, als gäbe es keine Schwerkraft. Die Sonne war nah und hell wie eine himmlische Laterne, ein Leierkasten spielte das Lied von der russischen Kalinka, und in ihrer Nase hing der Duft von Pfefferkuchen, Bratgewürzen und Käsekeulchen. Sie war glücklich.
Dschummm … ein weiterer Bogen. Die Bäume, die am Elbufer standen, sausten an ihr vorbei. Sie hatten die Blätter verloren, aber der Winter hatte die Äste mit Girlanden aus Reif geschmückt und die Abendsonne ihre Kronen in Gold getaucht. Kurz überlegte Jette, eine Pirouette zu drehen. Sie konnte das, im Ernst, sie hatte es kürzlich auf einem zugefrorenen Teich ausprobiert. Aber die Elbe war voller Menschen, die mit ihr den Abend genossen, und da wollte sie sich nicht auf den Hintern setzen und sich blamieren.
Dschummm … Das Eis knirschte unter den Kufen ihrer rostigen Schlittschuhe. Die Fische darunter glotzten sicher und staunten, wie schnell sie sich bewegte. Noch eine Drehung … Vor ihr tauchte ein Schlitten mit einer Mutter und ihrem Kind auf, der von einem Mann über das Eis geschoben wurde. Die Fahrt war stürmisch, und das Kind drückte die Wange an die schützende Brust ihrer Mutter. Die Frau, in Pelze und Decken gehüllt, lachte, der Vater gab Acht, dass den beiden nichts geschah.
Beim Blick in sein bärtiges Gesicht piekte ein Stachel der Eifersucht direkt in Jettes Herz. So etwas geschah ihr gelegentlich. Annie war eine fabelhafte Mutter, die sie liebte und beschützte, so gut es eben ging, aber ihr Vater war gestorben, als Jette noch ein Säugling gewesen war. »Erst war er krank, dann war er tot«, hatte Annie kurz angebunden erklärt, als sie alt genug gewesen war, um nach ihm zu fragen. Und damit hätte Jette sich vielleicht abfinden können. Es starb ja immer irgendwer. Aber als sie ihrer Nachbarin, der Frau Kröger mit den dicken Brüsten und dem mageren Hals, davon erzählte, hatte die sie ausgelacht und behauptet, dass Jettes Mutter überhaupt nie verheiratet gewesen sei und ihr Vater wahrscheinlich keine Lust gehabt habe, sich von einer, die mit dem Erstbesten ins Bett stieg, einen Balg ans Bein binden zu lassen. Seitdem stach der Stachel der Eifersucht, wenn Jette Kinder mit ihren Vätern sah.
Aber … ach was! Wenn die Fliege geschissen hat, hilft kein Heulen mehr, sagte Annie immer. Jette hob die Arme zu einer erneuten Drehung. Schneeflocken flogen ihr ins Gesicht wie zarte, kalte Küsse. Die Kröger log sowieso, das wusste die ganze Straße.
Sie zog eine besonders enge und damit gefährliche Kurve. Das Kunststück gelang, aber der Zauber des Nachmittags war bei dem Gedanken an ihren Vater verflogen. Plötzlich war Jette wieder zu einem zwölfjährigen Mädchen in geflickten Kleidern geworden, dessen Schlittschuhe vom Abfall stammten und das weder besonders klug noch besonders hübsch war. Die Sonne stand auf den Dächern, die Menschen strebten dem Ufer zu und warfen Blicke zum Himmel, weil Wolken aufzogen. Der Leierkastenmann deckte ein Tuch über seine Drehorgel und trat nach seinem Hund. Bald würde es dunkel sein, sie musste zusehen, dass sie nach Hause kam.
Kurz zögerte sie. Vielleicht zum Schluss doch noch eine kleine Pirouette, damit der Abend einen letzten Glanzpunkt bekam? Sie nahm Schwung auf … und blieb an etwas hängen. Knie und Arme krachten aufs Eis, die Wange schrappte wie über Scherben, Schmerzen schossen durch ihren Körper. Benommen drehte sie sich auf den Hintern – und starrte in ein höhnisches Gesicht.
»Was ist los? Biste gefallen, Blödbacke?«, fragten die in einem buschigen Bart gefangenen Lippen, die über ihrem Gesicht schwebten. Casimir Schmitt. Der König der Dresdener Altstadt. Der Mann, der das Sagen hatte, wenn es dunkel wurde und zwielichtige Gestalten wie Ratten in die Schenken strömten, um krumme Geschäfte auszuhandeln. Er gehört zur Mischpoke, zum Gesocks, dem man aus dem Weg gehen muss, sagte Annie immer. Casimir Schmitt hatte ihr ein Bein gestellt.
Jette rappelte sich auf. Obwohl sie nicht besonders groß war, konnte sie ihm in die Augen blicken – Schmitt war nämlich ein Zwerg. Sein Kopf, der wie der eines erwachsenen Mannes aussah, saß auf einem schmächtigen Kinderkörper, und das verlieh ihm ein unheimliches Aussehen, genau wie der karottenrote Bart, der im grellen Gegensatz zu seinen kohlschwarzen Haaren stand und ihm etwas Verlogenes gab. Die untergehende Sonne hatte den Himmel so rot wie den Bart gefärbt, und einen Moment sah es aus, als bestünde sein Gesicht nur aus dem Rahmen des schwarzen Haares, der schwarzen Melone, die darauf thronte, und den dunklen Augen.
»Genug geglotzt?«
Casimir Schmitt sprach grob, trug aber feine Kleider: graugrüne Hosen, lederne Handschuhe, blanke Stiefel und einen pelzbesetzten, braunen Mantel. In der Hand hielt er einen Spazierstock mit einem silberfarbenen Griff, der extra für seine Größe gefertigt worden war.
Er redete weiter, doch Jette war so entsetzt, dass sie nur Wortfetzen aufschnappte. »… fette Henne … Küken fressen …«, hörte sie ihn giften. Er packte sie und begann sie zu schütteln. »Was ist? Biste auch auf die Klappe gefallen? … hab deine Alte gewarnt … wer nicht hören will … biste dran, Blödbacke … kann sie dich aus der Gosse kratzen! Komm, los …«
Er packte sie am Arm, aber sie schaffte es, sich loszureißen und auf ihren rostigen Kufen abzuhauen. Fluchend setzte Schmitt ihr nach. Die Eisläufer, denen sie bei ihrer überhasteten Flucht vor die Füße lief, fluchten ebenfalls, eine Frau stürzte.
Ein gehetzter Blick über die Schulter zeigte Jette, dass der Zwerg ihr folgte, aber da er normale Stiefel anhatte, war sie für ihn auf dem Eis unerreichbar. Sie lachte hysterisch. Am Ufer löste sie mit zittrigen Fingern die Lederbänder und drängelte sich, die Schlittschuhe an die Brust gepresst, durch die Menschenmenge. Jemand schlug nach ihr, Bierbuden mussten umrundet werden …
»… aus der Gosse kratzen.« Die Worte klebten in ihrem Kopf wie Plakate an der Annonciersäule. Schmitt und ihre Mutter hatten in der vergangenen Woche einen furchtbaren Streit gehabt, bei dem es um Geld gegangen war. Annie hatte gebrüllt, der Zwerg sehr leise gesprochen. Trotz der gedämpften Stimme war er Jette aber mächtiger und vor allem gefährlich vorgekommen.
Nach dem Streit war er gegangen. Ohne Geld. Mit dem Gelächter ihrer Mutter im Nacken. Und nun hat er sich aufgemacht, es uns heimzuzahlen, dachte sie. Leute wie der Zwerg gaben nicht nach. Jette rannte über die Augustusbrücke, hinter dessen Eisengeländer man im Sommer die Elbschiffe beobachten konnte und wo jetzt der Schnee auf den Holzbänken in den Ausbuchtungen lag, und dann auf den matschbedeckten Schlossplatz. Noch ein Blick über die Schulter – vom Zwerg nichts zu sehen. Sie wollte weiter Richtung Altmarkt, bog dann aber in kleinere Gässchen ab, weil sie sich dort sicherer fühlte.
Schließlich hielt sie inne. Ihre Lunge stach, die Seite auch. Keuchend blickte sie sich um. Häuser mit himmelstrebenden Giebeln verschlangen das wenige Abendlicht. Zwei Männer in Gehpelzen kamen näher und schlenderten an ihr vorbei, schenkten ihr aber keine Aufmerksamkeit. Jette blickte ihnen nach, bis sie in einem finsteren, langen Tunnel verschwanden, der die Straße überwölbte.
Der Tunnel. Er war unheimlich, aber auch sie musste da durch, wenn sie nicht über den Altmarkt wollte, wo der Zwerg vielleicht nach ihr Ausschau hielt. In der Mitte des Tunnels standen dicke Säulen, hinter jeder einzelnen könnte sich jemand verbergen, und wenn man sie dort umbrächte, würde es niemand merken. Ihr Herz hämmerte, aber sie rief sich zur Ordnung. Nur kein Schisshase sein. Annie verachtete Schisshasen. Sie rannte los, so schnell sie konnte, und kam heil auf der anderen Seite wieder ins Freie.
Mit den letzten Sprüngen rettete sie sich einige Stufen hinab in einen Dienstboteneingang. Erst mal verschnaufen und wieder Mut schöpfen. Durch ihre Schuhe drangen Nässe und Kälte. Die Schlittschuhe an die Brust gepresst, starrte sie zur Straße hinauf. Ihr kam ein neuer, grässlicher Gedanke: Der Zwerg hatte ihr nicht folgen können, da war sie sicher, aber was, wenn er einen seiner Leute am Ufer postiert hatte und der ihr gemächlich hinterhergeschlendert war? Einen von denen, die den Dreck für ihn erledigten, wie Annie es nannte.
Jette wusste, was ihre Mutter damit meinte: den Dreck erledigen. Im Sommer hatte sie gesehen, wie die Gendarmen einen Mann aus dem Cholerabrunnen beim Postplatz gezogen hatten. Sein Kopf, auf den die grünen Brunnenechsen Wasser gespien hatten, war aufgeplatzt gewesen, so dass das Gehirn rausquoll. Aber noch schlimmer hatte sein Gesicht ausgesehen. Jemand hatte das rechte Auge in den Kopf gedrückt – mit einer dünnen Eisenstange, vielleicht aus einem Zaun gebrochen, hatte der Gendarm, der ihn auf dem Pflaster ablegte, gemeint. Das geöffnete Lid hatte den Blick auf einen blutigen Brei freigegeben.
Allein die Erinnerung machte, dass Jette übel wurde. Sie presste sich gegen die eisige Mauer, ihr Rücken gefror, ihr Blick haftete ängstlich auf dem Pflaster über der obersten Treppenstufe. Schon bereute sie, sich in den Dienstboteneingang gerettet zu haben, wo sie wie die Maus in der Falle saß.
Die Glocke der Frauenkirche läutete das Angelus. Es war inzwischen völlig dunkel. Jette überwand sich und kehrte in die Gasse zurück. Der Schein der Gaslaternen zeichnete milchige Kreise in den Schneematsch. Hinter dem Fenster eines Hauses stand ein Mann mit erhobenem Zeigefinger. Sein Mund ging auf und zu wie bei einem Schattenspiel. Vielleicht drohte er seinem Hausmädchen. Ich muss heim, dachte Jette, der vor Kälte die Zähne klapperten.
Bald erreichte sie das Haus, in dem sie mit ihrer Mutter wohnte. Es war ein schäbiges, fünfstöckiges Gebäude, eingezwängt zwischen ähnlichen Häusern, mit Reihen schmuckloser Fenster, über die sich ein schneebestäubtes Dach mit rauchenden Schornsteinen wölbte. Auf der anderen Straßenseite ging eine winklige Nebengasse ab. Die Gegend hier war verkommen. Von den Fassaden platzte die Farbe ab, über Fenster, deren Scheiben zerbrochen waren, hatten die Bewohner Holzplatten genagelt. Eines der Häuser trug einen verblassten Schriftzug. Dort hatte einmal ein Kolonialwarenhändler gewohnt, der aber umgezogen war, als das Viertel nach und nach verarmte.
Jette drückte die schwere Haustür auf. Kurz packte sie wieder der Schrecken. Da der Zwerg wusste, wo sie wohnte, konnte ja auch hier jemand lauern. Sie horchte angespannt. Aus den Wohnungen drangen Stimmen, ein Kind wimmerte, zwei Frauen sangen gemeinsam von der Liebe in den Hinterhöfen, die eine schön, die andere, Frau Kubiak, nicht. Es roch nach verschwitztem Bettzeug, Hühnerkacke und gedünstetem Wirsing. Wenn sie nur schon oben wäre. Die Arme ihrer Mutter kamen ihr plötzlich wie das sichere Himmelreich vor. Aber gut, es half ja nichts. Erst musste sie die Stiegen hinauf. Im Treppenhaus war es stockdunkel, doch da sie die abgetretenen Stufen schon tausend Mal raufgeklettert war, machte ihr das nichts aus. Ihre Wohnung befand sich im dritten Stockwerk zur linken Seite. Hier war es zum Glück ein wenig heller, weil Mondlicht durch ein kleines Fenster fiel. Jette kramte den Wohnungsschlüssel hervor und wollte die Tür öffnen.
In diesem Moment hörte sie über sich, auf dem Dachboden, einen Schrei. Es war ein schrecklicher, nicht enden wollender Laut, erst gedämpft, dann ein paar Mal laut und schrill, schließlich wieder leise, bis er erstarb. Eine Tür quietschte. Jemand kam die Treppe hinab. Ihre Mutter? Annie hatte den großen, kahlen Raum mit den Holzstreben gemietet, um dort ihre Kunden zu empfangen. Aber sie polterte. Annie polterte immer. Das war ihre Art, bei Annie Troll gab’s keine Stille. Doch wenn es nicht Annie war, die da runterkam – wer dann? Und wer hatte geschrien?
Die Schritte klangen verstohlen, wie bei der Mischpoke, die Schmitt schickte, um Leuten wie Annie Troll klarzumachen, dass sie blechen mussten, wenn sie in seinem Viertel überleben wollten.
Atemlos vor Angst versuchte Jette, den Schlüssel ins Schloss zu bekommen, schaffte es aber nicht. Auf der anderen Seite des Flurs befand sich ein winziger Vorraum, der zu einem besonders schäbigen Zimmer führte, in dem vor ein paar Wochen der Mieter gestorben und vergammelt war und aus dem man den Geruch nicht mehr rausbekam, sodass es vorerst nicht vermietet werden konnte. Sie huschte hinüber, kauerte sich an die Wand, kniff die Augen zusammen und stopfte die Finger in die Ohren.
Wer hatte geschrien? Und wer kam da runter?
2. Kapitel
Das Dresdener Kriminalgericht hatte Herbert Broyhahn wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilt. Der Prozess war am Nachmittag zu Ende gegangen. Leicht war es nicht gewesen, den Mann dranzukriegen. Der Staatsanwalt hatte die Indizien, die die Detektei Raabe ihm im Lauf der Wochen zugetragen hatte, minuziös vor den Richtern ausgebreitet. Er hatte brillant argumentiert und damit für Aufsehen gesorgt, aber schlussendlich nicht überzeugen können.
Was zu erwarten gewesen war. Broyhahn hatte weitsichtig bereits vor einem Jahr mit einer Spende die Renovierung der Armenwohnungen im Maternihospital ermöglicht. Er hatte das Weihnachtsessen in der Taubstummenanstalt ausgerichtet und dem Komitee, das die Renovierung der Sophienkirche vorantrieb, Geld zukommen lassen. Beim Begräbnis seiner Frau hatte er einen Schwächeanfall erlitten, man musste ihm einen Stuhl ans Grab tragen, die halbe Dresdener Bevölkerung war Zeuge gewesen. Und so ein Mensch sollte ein Mörder sein? Sein armes Weib war einem Herzleiden erlegen, der Familienarzt hatte es bestätigt. Und dass seine Tochter eine Detektei beauftragte, um dem eigenen Vater eins auszuwischen: Pfui Deibel!
Überhaupt: Eine Detektei? Was war das für ein neumodischer Firlefanz? Und was zerrten diese Leute für Belanglosigkeiten ans Licht. Vielleicht hatte Broyhahn ja wirklich kurz vor dem Tod seiner Frau in einer Apotheke Arsenik gekauft. Aber die Ratten waren eine verfluchte Plage, jeder benutzte das Gift. Und dass er es eigenhändig besorgt und nicht die Dienstboten beauftragt hatte … Man sollte doch solche Nebensächlichkeiten nicht aufbauschen …
Als sie an dieser Stelle des Verfahrens angelangt waren, hatte Daniel Raabe dem Staatsanwalt zugenickt. Das Publikum war müde, Broyhahn wähnte sich in Sicherheit – es war Zeit für das Finale, mit dem Raabe den Prozessverlauf noch einmal wenden wollte. Sie hatten das wichtigste Beweisstück zurückgehalten: einen Nachttopf voll mit getrockneter Scheiße. Der Staatsanwalt rief den Dresdener Anatomieprofessor Günther in den Gerichtssaal, und Daniel beobachtete den honorigen Mann, wie er, begleitet von zwei Assistenten, vor den Richtertisch trat.
»Was bitte soll das jetzt?«, fragte der Richter.
Günther war ein angesehener Wissenschaftler, er galt als Koryphäe auf seinem Gebiet – keiner, dem man die Aufmerksamkeit verwehren konnte. Der Mann verneigte sich. »Hochverehrtes Gericht: Es gibt ein neues wissenschaftliches Verfahren, das geeignet ist, mit höchster Präzision den Nachweis zu führen, ob ein Mensch Opfer einer Krankheit wurde oder …« Dramatisch schnipste er mit den Fingern und befahl seinen Assistenten, die Utensilien, die sie trugen, auf dem Richtertisch abzusetzen. »Wenn Sie erlauben?« Auf das Nicken des Richters hob er den Deckel vom Nachttopf und füllte mit einem Löffel vorsichtig einen Klumpen Kot in einen Kochtopf um. Er schüttete Chlorwasserstoffsäure darüber und rührte und erhitzte unter den Augen des gespannten Publikums den Brei über einer dicken Kerze, die einer seiner Assistenten entzündet hatte.
Der Richter säuberte seine Brillengläser, das Volk stand auf und reckte die Hälse. Aha, es handelte sich bei dem Klumpen um ähäm … den Kot der Verstorbenen?
Die Sache dauerte. Der Staatsanwalt nutzte die Zeit, um das Hausmädchen der Broyhahns reinzurufen, das Daniel in der Nacht vor dem Prozessbeginn doch noch zu einer Aussage hatte bewegen können. Sie identifizierte den mit Schmetterlingen bemalten Nachttopf als den ihrer Herrin, mit schlechtem Gewissen, weil es an ihr gewesen wäre, ihn zu entleeren und zu reinigen. Aber wer dachte schon an so etwas, wenn sich die Herrin unter Qualen im Bett wand und der Raum voller Doktoren war und die Verwandtschaft die Hände rang und sie selbst vor Mitleid fast verging? Sie hatte den Topf mit dem Fuß unters Bett geschoben und ihn dort vergessen, bis der Herr von der Detektei ins Haus kam und ihn entdeckte.
Professor Günther beendete sein Experiment, indem er ein Netz aus Kupferdraht in die Brühe tunkte. Er hob es wieder heraus und zeigte dem Richter und seinen Beisitzern mit dem selbstsicheren Lächeln eines Könners einen dunkelgrauen Belag auf dem Metall. »Was Sie hier sehen, werte Herren, ist ein Ring aus Arsenik. Und dieser Ring beweist ohne den Schatten eines Zweifels, dass der Mensch, der sich in den Nachttopf erleichterte, auf grässlichste Weise vergiftet wurde. Die Methode, die ich benutzt habe, geht auf meinen Kollegen Hugo Reinsch zurück, einen glänzenden Chemiker, der …«
Der Richter interessierte sich nicht für den Kollegen Reinsch. Er blickte zu dem Mann, den er beinahe freigesprochen hätte. Im Saal war es totenstill geworden. Broyhahns Anwalt starrte griesgrämig auf seine Fingernägel. Broyhahn selbst … Ging ihm die Geliebte durch den Kopf, die er ehelichen wollte und derentwegen er seine Frau ermordet hatte? Suchte er nach Ausflüchten? Er begann zu weinen. Und anders als am Grab wurden diese Tränen als Schuldbekenntnis gewertet.
Daniel Raabe, der Mann, der Broyhahns Verbrechen aufgedeckt hatte, wurde plötzlich von einer tiefen Melancholie gepackt. Als der Staatsanwalt mit seinem Plädoyer begann, verließ er still den Saal.
Zu Hause angekommen, warf er den Mantel ab. Ohne nach dem Kammerdiener zu läuten, zog er die Stiefel aus und ging in seine Bibliothek, in der zwei Gaslampen mildes Licht spendeten. Er ließ sich erschöpft in einen Fransensessel sinken – ein hässliches Ungetüm, das sein Diener damals, als er nach dem Brand umziehen musste, für ihn aufgetrieben hatte. Gott, war er müde. Er spürte in sich hinein und suchte nach einem Funken Euphorie, der sich nach der aufreibenden, aber am Ende von Erfolg gekrönten Arbeit doch eigentlich hätte einstellen sollen. Aber er fand nichts. Wenig überrascht schloss er die Augen. Der Tag hatte ihn erschöpft, und das war vielleicht das Beste an der ganzen Sache.
War er eingeschlafen? Ein Rascheln ließ ihn hochschrecken. Er lauschte. Das Geräusch kam von der gegenüberliegenden Seite des Zimmers aus einem Gang, der sich zwischen einem polierten Eichentisch und der dahinter liegenden deckenhohen Bücherwand entlangzog. Mäuse? Zwischen den Tischbeinen stapelten sich Papierrollen, Zeichnungen, die noch vom Vorbesitzer stammten und die er aus Gleichgültigkeit nie hatte entfernen lassen. Die Rollen verwehrten ihm den Blick auf die Ursache des Raschelns.
Er blickte über die Schulter zum Klingelzug neben dem Gobelinvorhang. Sollte er Bonifaz Link herbeirufen, seinen Kammerdiener, der seinen Alltag dirigierte? Große Lust verspürte er nicht. Die Stille tat gut nach der Rastlosigkeit der vergangenen Wochen, in denen er sich aufgerieben hatte, um Broyhahn den Mord nachzuweisen. Träge spielte er mit den Troddeln des Sessels. Doch das Rascheln hinterm Tisch war wie ein Juckreiz. Am Ende erhob er sich und schaute selbst nach.
Vor der Bücherwand saß ein Kind.
Es war jung, sehr jung, vielleicht ein Jahr alt, schätzte er. Und hässlich. Weiße fleischige Beinchen steckten in einer feuchten Windel, die auf dem blauweißen Seidenteppich einen nassen Flecken hinterlassen hatte. Bis auf die Windel war es nackt. Neugierig war es ebenfalls. Es hatte mehrere Bücher aus den unteren Regalen gezogen. Die Getreue Darstellung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse, Römische Satiren, Hegels Wissenschaft der Logik … Nichts davon hatte Gnade vor seinen Augen gefunden. Es hatte Seiten herausgerissen und kaute darauf herum.
Plötzlich blickte es auf, und Daniel drehte sich der Magen um. Das Kind war gar nicht hässlich. Im Zwielicht der Gaslampe schimmerten weißblonde Locken, ein Grübchen kerbte den linken Mundwinkel, das Blau der Augen erinnerte an sorglose Sommerhimmel. Sein einziger Makel bestand in der Nase, die die Andeutung eines Höckers aufwies, der sich im Lauf der Jahre zu einer Hexennase ausprägen würde. Und damit war auch das Rätsel gelöst, wie dieses Kind hierhergekommen war. Link hatte ein weiteres Familienmitglied in sein Haus geschleust.
Gereizt betätigte er den Klingelzug. Das Kind griff nach einem der Regalbretter und zog sich daran auf die Füße. Es tappte auf ihn zu und umklammerte seine Hosenbeine. Er merkte, wie seine Muskeln sich versteiften. »Link, verflucht!« Im Rest des Hauses blieb es still. Das Kind wischte den Sabbermund an seiner Hose ab. Uringeruch stieg in seine Nase. »Verdammt, Link, wo steckst du? Komm endlich aus deinem gottverdammten …«
Sein Kammerdiener erschien in der Tür, nachlässig gekleidet, mit unrasiertem Kinn.
»Du bist entlassen! Hörst du, Mann? Ich schmeiß dich raus.«
Dem stoischen Gesicht war keine Unruhe anzumerken. Link packte das Kind und nahm es in die behaarten Arme. »Nanu, wen haben wir denn da?«
»Eine Kröte? Ein Schlachtferkel?«, schlug Daniel sarkastisch vor.
»Verzeihen Sie bitte, Herr Doktor. So ein kleiner Ausreißer aber auch.« Das Kind juchzte.
»Schaff’s weg. Ich meine es ernst!«
»Aber natürlich. Es ist schon gar nicht mehr da. Mariechen, Mariechen …« Link ging zur Tür.
»Warte«, hielt Daniel ihn auf. »Ist es deins?«
Links abscheuliche Hakennase berührte die winzige Nase des jungen Menschleins. »Leider nicht«, sagte er mit echtem Bedauern, »ich bin eine taube Nuss, wenn Sie mir die Vertraulichkeit verzeihen. Mir ist als Kind eine Ziege gegen den Hammer getreten.«
»Wem also …?«
»Die Sache ist ein bisschen kompliziert. Alles fing damit an, dass Isabelle sich den Knöchel brach und im Anschluss …«
»Wer ist Isabelle?«
»Ihre Köchin, Herr Doktor, die Fee, die die wunderbaren Soufflees zaubert, die kräftigen Eintöpfe, die delikaten …«
Dunkel erinnerte Daniel sich an ein molliges Weib, dem er gelegentlich in der kleinen Halle begegnete, die hinab ins Untergeschoss führte. War das Isabelle? Er kannte die Köchin so wenig wie die übrigen Dienstboten. Sie lebten im Souterrain des Hauses, das er niemals betrat, und waren, bis auf die seltenen Begegnungen in der Halle, unsichtbar wie Geister. Er wusste nicht einmal, wie viele von ihnen es gab. Link hatte sie eingestellt, er beaufsichtigte sie und sorgte dafür, dass sie ihren Lohn bekamen. Da sie allesamt mit der gleichen Höckernase gestraft waren, nahm Daniel an, dass er sie aus seiner weitläufigen Familie rekrutierte. Es interessierte ihn nicht. Link war der Einzige, den er oben in der Wohnung duldete, der Mann war diskret, erledigte, was nötig war, und so war es gut.
»… niemand anderen finden. Dora ist vor Kurzem Witwe geworden, das arme Ding, ihr Mann ist bei einem Unglücksfall beim Bau des Hetzdorfer Viadukts zu Tode gekommen, Sie haben sicher davon gehört. Aber was schwatze ich. Dora verfügt zum Glück über die gleichen Kochkünste wie ihre Tante, was kein Wunder ist, da sie als Kind bei ihr in die Lehre gegangen ist. Und so hatte ich gedacht …«
»Wie heißt sie?«
»Dora, Herr Doktor.«
»Ich meine das Kind.«
»Oh!« Link begann zu lächeln, das kleine Mädchen versuchte, ihm den Finger in die Nase zu stopfen. »Ihr Name ist Marie.«
»Es tut mir leid, aber Marie muss fort, ich dulde keine Kinder unter meinem Dach. Lass dir etwas einfallen.«
»Noch heute, selbstverständlich. Noch in dieser Stunde.«
Die beiden verschwanden, und Daniel öffnete das Fenster. Gierig sog er die eisige Nachtluft ein, in die sich der Geruch des Rauchs aus den zahllosen Dresdener Schornsteinen mischte. Draußen schneite es. Ein Trupp Soldaten amüsierte sich in der Gasse. Sie grölten das nicht tot zu kriegende Lied vom Mariechen, das weinend im Garten saß. Einer kotzte in den Vorgarten des Hauses gegenüber. Daniel dachte an Broyhahn, dem das Fallbeil erspart bleiben würde, weil der sächsische Generalstaatsanwalt im vergangenen Jahr die Todesstrafe abgeschafft hatte – was allerdings nur hieß, dass sein Sterben sich hinziehen würde. Kaum jemand mit einer langjährigen Haftstrafe verließ das Zuchthaus lebend. Und Hedwig Broyhahn würde dafür sorgen, dass sich niemand für eine vorzeitige Entlassung ihres Vaters einsetzte. Sie hatte ihre Mutter geliebt. Deshalb war sie ja in seine Detektei gekommen.
Das Link’sche Kind begann zu jammern. Sein Quengeln drang durch das Kellerfenster, das aus unerfindlichen Gründen offen stand, und mischte sich in den versoffenen Männergesang. Hastig schlug er das Fenster wieder zu. Das Glas klirrte im Rahmen. Er trat einen Schritt zurück und versenkte die Hände in den Hosentaschen, aber in seinem Kopf weinte das Kind weiter. Er spürte die kleinen Hände wieder an seinen Hosenbeinen, ihm drehte sich der Magen um. Langsam, befahl er sich, ganz langsam jetzt. Er war müde, er würde zu Bett gehen, er würde einschlafen.
Sollte er Link und seiner höckernasenen Sippschaft morgen den Laufpass geben? Mit einer Summe, die sie über Wasser hielt, bis sie etwas anderes gefunden hatten? Allerdings müsste er dann neues Personal einstellen … Würde er das schaffen? Gott, die Ausdünstungen der Windel hingen immer noch im Raum. Kleine Kinder besaßen exakt zwei Gerüche. Den süßen ihrer Haut und den stechenden ihres Urins. Den einen hatte Mariechen mitgenommen, als Link sie hinausschaffte, letzteren hatte sie zurückgelassen. Wahrscheinlich würde er noch wochenlang den Raum füllen. Könnte man ihm mit Essig beikommen? Dann würde ein Fleck auf dem Dielenholz zurückbleiben. Und wenn er den Fleck mit einem Teppich bedecken ließe, würde der Teppich ihn erinnern … O Gott … Er griff in seine Haare. Er brauchte Schlaf. Aber wenn er schlief, würde er von Clara träumen. Er träumte immer von ihr, wenn ihm tagsüber ein Kind begegnet war.
Als plötzlich die Klingel schellte, die einen Besucher ankündigte, stöhnte er vor Erleichterung auf. Gleich wer kam – es würde ihn ablenken. Daniel hörte Link an der Haustür sprechen. Sein abfälliger Ton ging in einen Zweikampf mit einer weiblichen Stimme über, die hysterisch klang.
»Ist Ihnen vielleicht bewusst, Gnädigste, was die Turmuhr gerade eben geschlagen hat?«
»Für dich fünf vor zwölf, Kerl«, herrschte das Weib ihn an, »wenn du mir nämlich nicht sofort den Weg freimachst! Ich muss zu Herrn Raabe, weil ich einen Auftrag für ihn hab. Die Sache drängt und verträgt keinen Aufschub, und wenn er sich was verdienen will …«
»Er wird begeistert sein, dich zu empfangen, zweifellos«, höhnte Link. »Ich pack mir auch gern den Sack mit Golddukaten auf die Schulter, den du unsichtbar hinter dir herziehst.«
»Ja, ja«, kam es nervös zurück. »Kannste vielleicht mal die Kleine da hinten wegpflücken, bevor sie die Stufen runterknallt? Hör mir zu, Mensch! Ich muss den Herrn Raabe nicht wegen irgendeinem Hundeschiss sprechen, es geht um was … Mann, hol den Fratz da weg … Du, ich geb dir zwei Groschen, wenn du deinen Herrn weckst.«
Daniel öffnete die Tür zur Halle. Die Frau, die unentwegt versuchte, an seinem Kammerdiener vorbeizuhuschen, entdeckte ihn. »Verzeihung, sind Sie der Herr Raabe?« Sie nutzte den Moment, in dem Link abgelenkt war, drängelte sich an ihm vorbei und stand auch schon vor Daniel. »Ich muss Sie sprechen, Herr Raabe. Tut mir leid, tut mir wirklich leid. Ist nicht meine Art, jemanden mitten in der Nacht zu überfallen. Ich weiß, was sich gehört und so. Aber die Situation ist besonders und … nimm deine verdammte Klaue von mir!«, herrschte sie Link an.
Erzürnt blickte der Kammerdiener zu Daniel.
Die nächtliche Besucherin war etwa dreißig Jahre alt und so hager, als würde sie zu selten essen, was ja oft geschah in diesen Zeiten. Die dunklen Augen huschten durch die Halle, als lauerte sie auf etwas oder versuchte, sich die Umgebung einzuprägen. Sie besaß einen entschlossenen, zu großen Mund, zweckmäßig frisierte braune Haare und einen schäbigen Mantel mit einem ebenso schäbigen Kleid darunter, bei dem vor allem ein Blutfleck in Höhe der Hüfte auffiel. Interessant. Auf jeden Fall aber war sie geeignet, ihn von seiner gottverfluchten Unruhe abzulenken.
»Du hörst, worum die Dame gebeten hat.« Daniel machte eine einladende Handbewegung zum Salon hin und folgte seiner Besucherin. Sie bewegte sich graziös, beinahe damenhaft, was ihn verwunderte. Auch schien sie keine Schmerzen zu verspüren. Das Blut auf ihrem Kleid war also nicht ihr eigenes, es sei denn, sie stand unter Schock.
Die Frau blieb in der Tür des Salons stehen und musterte das Zimmer, und er tat es ihr gleich. Der Raum war, genau wie die Bibliothek, vom Vorbesitzer eingerichtet worden, mit ebenso scheußlichen Möbeln. Die Mitte des Raums wurde von einem Ungetüm aus mehreren miteinander verbundenen Sesseln beherrscht, unmodern, ausufernd. An der Wand stand ein Sekretär, an dem nichts auszusetzen war. Daneben eine altmodische, quadratische Standuhr, deren Zeiger stehen geblieben war. Außerdem gab es eine dreigeschossige Etagere …
Die Frau schritt zur Sitzgruppe und ließ sich auf einem der Sessel nieder, ohne zu warten, dass er sie zum Sitzen einlud. Sie hatte also keine besonders feine Erziehung genossen. Aber das war ja bereits an der Tür klar geworden.
Daniel nahm ihr gegenüber Platz. Hatte sie jemanden ermordet und wünschte in dem Glauben, er würde als Anwalt praktizieren, seine Hilfe? Die wenigsten Menschen wussten, worin die Arbeit einer Detektei bestand. In England und in Amerika hatten sich solche Agenturen bereits einen gewissen Ruf erworben. Pinkerton’s National Detective Agency war über die Grenzen hinaus berühmt. Aber in Deutschland sprossen die Nachahmer erst zaghaft aus dem Boden. Die meisten befassten sich vornehmlich mit Erkundungen über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit künftiger Vertragspartner. Andererseits existierte die Detektei Raabe in Dresden bereits seit zwei Jahren, und es war zu einigen aufsehenerregenden Prozessen gekommen, in denen sie eine Rolle gespielt hatte. Vielleicht hatte seine Besucherin etwas aufgeschnappt.
»Sie starren.«
»Ich weiß«, gab er zurück.
»Ich bin froh, dass Sie starren. Ich brauche jemanden, der denken kann. Wer starrt, von dem kann man ja hoffen, dass er auch denkt.« Seine Besucherin zitterte vor Nervosität. »Mein Name ist …« Sie stockte. »Ich muss wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann.«
Unter ihrem abgeschabten Mantelärmel war eine Schnittwunde zu sehen, die vom Handknöchel bis zum kleinen Finger lief. Sie war noch frisch. »Worum geht es?«
»Jemand ist tot. Man wird sagen, ich hab sie umgebracht. Das ist aber nicht so.«
»Und warum wird man es dann behaupten?«
»Weil … Wie kann ich mich darauf verlassen, dass Sie auf meiner Seite sind?« Sie kratzte nervös über ihre Wange. Ihr Ärmel rutschte dabei ein Stück höher. Die Wunde setzte sich am Unterarm fort. Ein richtiger Schmiss.
»Wie ist das passiert?«
»Was?«
Er deutete auf die Wunde.
»Ach, bei der Arbeit«, meinte sie achtlos.
»Tatsächlich?«
»Ich sag’s doch.«
Die Wunde stammte von einer Klinge. Womit mochte die Frau ihr Geld verdienen? Als Küchenmädchen? Oder in einer Fabrik? Daniel versuchte sich eine Tätigkeit vorzustellen, bei der ein Messer die Außenseite eines Unterarms verletzte und dann über den Handknöchel bis zur Außenseite des kleinen Fingers weiterglitt. Ihm fiel nichts ein. Sie hatte einen Stich abgewehrt, eindeutig.
»Bei welcher Art von …«
»Ich gebe Ihnen Geld, Herr Raabe. Und ich will, dass Sie sich dafür was anschauen. Und dann einschätzen, was Sie für mich tun können. Ob Sie also das Schwein finden können, das den Armen auf dem Gewissen hat.«
Der Arme plötzlich, nicht mehr, die Arme.
»Und wenn Sie glauben, dass Sie das nicht hinkriegen, dürfen Sie den Schotter trotzdem behalten. Aber dafür werden Sie vergessen, dass ich jemals hier gewesen bin. Das ist der Handel. Da will ich Ihr Versprechen.« Sie blickte ihn in blanker Verzweiflung an.
Er nickte.
»Sie müssen auch dafür sorgen, dass der Hansel, der Ihre Tür bewacht …«
»Er ist diskret.«
Sie zweifelte, sie zauderte. Doch dann öffnete sie ihren Mantel und nestelte eine Tasche hervor, deren Metallkette sie mittels eines Karabinerhakens am Gürtel ihres Kleides befestigt hatte. Sie kramte ein Tüchlein heraus, in dem sich Münzen befanden: ein Silbertaler mit dem Bildnis König Johanns und vierzig Groschen. Nicht viel. Gar nicht viel. Der Wochenlohn eines Webers betrug mehr als zwei Taler. Einen Mörder zu finden, würde vermutlich sehr viel mehr Zeit kosten. Und das wusste seine Besucherin auch.
Sie war zu stolz zum Betteln. Mit erhobenem Kinn und einem Lächeln, in dem etwas schwer Deutbares lag, faltete sie das Tüchlein wieder zusammen und erhob sich. »Ich hab ’ne Frage gestellt. Sie haben geantwortet. Also gut, ich gehe.«
»Das Kind …«
Sie zog überrascht die Augenbrauen hoch.
»Ich meine das Kind aus der Halle. Könnten Sie das Mädchen für die Zeit meiner Ermittlungen in Pflege nehmen?«
»Was?«
Er wurde deutlicher. »Ich will sie aus dem Haus haben. Nur für einige Tage, bis sich etwas gefunden hat, wo sie auf Dauer bleiben kann. Das wäre der Handel.«
»Ach so.« Die Frau bemühte sich nicht einmal, ihre Verachtung zu verbergen. Wahrscheinlich hielt sie ihn für den Vater des Mädchens, einen wohlhabenden Schnösel, der einem Hausmädchen oder der Köchin ein Kind angehängt hatte, das ihm nun lästig war. So etwas gab es ja zuhauf. Er meinte ihr Zähneknirschen zu hören. Sie schickte sich drein.
»Sagen Sie dem Fatzke da draußen, er soll Windeln und warme Kleider einpacken. Sie schauen sich die Sache, wegen der ich hier bin, an, und wenn wir uns einig werden, nehme ich das Würmchen auf dem Rückweg mit. Und nun kommen Sie. Es drängt.«
Das Mietshaus, in dem seine neue Auftraggeberin wohnte, war ein düsterer Ort. Nicht nur aus Mangel an Licht – es herrschte eine muffige Trostlosigkeit in dem Treppenaufgang mit den zerkratzten Wohnungstüren, vor denen Stiefel mit schief getretenen Absätzen und daumengroßen Löchern traurige Paraden abhielten. Renovierungen hatten hier seit Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden. Kein schöner Ort zum Wohnen.
Sehen konnte er nichts, aber er hörte seine Mandantin – sie hatte ihren Namen immer noch nicht verraten – vor sich die Stufen hinaufsteigen. Er tastete nach dem Geländer und folgte ihr. »Wir müssen bis ganz nach oben«, tönte ihre Stimme. Aus den Wohnungen drang kein Geräusch. Licht, egal ob es von Kerzen, Petroleum- und Gaslampen oder Öfen gespendet wurde, war teuer. Armut bedeutete im Winter Finsternis und Kälte, man verzog sich frühzeitig ins Bett.
Wieder war eine Treppe erklommen, er hörte das Ratschen von Metall auf Metall. Die Frau stieß eine Tür auf, ging einige Schritte, rieb ein Schwefelholz und entzündete eine Lampe. Daniel trat in ein Zimmer, das zwar ärmlich war, aber anders, als er erwartet hatte. Statt trauriger Schäbigkeit gab es hier ein geblümtes Sofa, einen runden Tisch mit Schubladen und mehrere zum Sofa passende Stühle, außerdem einen Schrank und in der Ecke einen kleinen Herd mit poliertem Eisengestänge, also insgesamt eine sparsame Möblierung, aber heimelig. Blumentöpfe mit Christrosen standen auf der kleinen Fensterbank, an der Wand hingen Bilder, auf einer der Kommoden reihten sich russische Porzellaneier. War die Frau verheiratet? Warum war dann nicht der Gatte bei ihm erschienen? War er es gewesen, der ermordet worden war?
In einem Nebenraum, in den er hineinsehen konnte, lag ein halbwüchsiges Mädchen in einem Bett, das ihn ängstlich anstarrte.
»Schlaf weiter, Jette.« Seine Auftraggeberin nahm die glimmende Lampe und eilte auch schon wieder zur Tür hinaus.
»Schließt du ab?«, tönte es aus dem Bett.
»Mach ich doch immer.« Als Daniel im Flur war, zog sie die Tür zu und drehte den Schlüssel um. Gemeinsam stiegen sie eine letzte Treppe empor, die zum Dachboden führte. Es war ein kahler, eiskalter Raum, in der Mitte unterteilt durch eine Mauer. Zwei schräge Balken stützten die Querstreben unterm Dach, der Boden war mit Brettern ausgelegt. Am Ende des Raums war eine Leine gespannt, über der ein geblümtes, bodenlanges Laken hing. Unter der Dachschräge standen einige Stühle, zwischen ihnen eine Kiste. Außerdem lehnten an den Wänden merkwürdigerweise einige bodentiefe, breite Spiegel. »Dies hier ist mein Gewerbe«, erklärte die Frau, und zum ersten Mal meinte Daniel etwas wie Stolz in ihrer Stimme zu hören.
»Verraten Sie mir, worum es geht?«
Der Stolz war schon wieder verklungen. Die Frau durchquerte den Raum und ging zu dem Vorhang. Das Licht der Lampe begann zu flackern, weil ihre Hand plötzlich zitterte. Sie wartete auf ihn, reichte ihm die Lampe und drehte sich weg. Daniel zog den Stoff beiseite.
Er verspürte eine absurde Erleichterung. Auf dem Boden lag eine Leiche. Und sie schwamm in Blut. Er war gerettet. Seine Ermittlungen würden Tage in Anspruch nehmen, vielleicht Wochen. Er würde für eine weitere kostbare Zeitspanne davon verschont bleiben, sich mit seinem eigenen Leben befassen zu müssen. Die Sache mit Marie war geklärt, Link würde bleiben, alles würde weiterlaufen wie immer. Scham über seine Empfindung verspürte Daniel keine, darüber war er längst hinweg.
»Würden Sie die Güte haben, mir nun doch Ihren Namen zu verraten?«, bat er die Frau, die vor Anspannung kaum noch atmete.
»Annie Troll.« Sie überwand sich und trat neben ihn. Gemeinsam starrten sie auf die Tote hinab. Die Frau war atemberaubend schön, wenn man sich die Verwüstungen fortdachte, die Messerstiche an Hals und Leib angerichtet hatten. Ihre Gesichtszüge könnten slawisch sein, die schwarzen Haare, aus denen sich beim Sturz einige Nadeln gelöst hatten, waren zu einer komplizierten Frisur gesteckt, die Wimpern, lang und zart wie Seidenfäden, glichen japanischen Fächern. Sie trug eine dunkelblau schimmernde, eng sitzende Hose, die am Knie geschnürt war, dazu schwarze Strümpfe, eine rostrote Schärpe und eine hellblaue Bluse, in der sich wegen der Verletzungen das Rot der Schärpe in Rinnsalen fortsetzte. Es waren Kleidungsstücke, die mehr enthüllten als verbargen. Skandalös, so würde man wohl sagen. »Jemand vom Ballett? Oder vom Zirkus?«, fragte Daniel. Der Körper unter dem Stoff wirkte muskulös.
»Sie arbeitet … arbeitete am Königlichen Hoftheater.«
»Genau wie Sie?«
Annie Troll lachte heiser. »Zu viel der Ehre.« Sie drehte sich um, machte eine ausladende Bewegung mit dem Arm und ergänzte, als er fragend die Augenbrauen hochzog: »Ich erteile Fechtunterricht.« Trotzig fügte sie hinzu: »Für Frauen. Kann doch nicht schaden, wenn man den Frauen beibringt, wie man sich verteidigen kann, oder?«
»Und diese Dame …?«
»War eine meiner Kundinnen.«
»Warum?«
»Was?«
»Warum nimmt eine Frau, die beim Ballett arbeitet …«
»Wie soll ich das wissen? Sie hat das Honorar gezahlt, ich hab ihr beigebracht zu kämpfen. Sie war begabt.«
»Gibt es viele Frauen, die den Wunsch haben, bei Ihnen Unterricht zu nehmen?«
»Jede, die abends in die Gassen raus muss und keine Sänfte oder Droschke bezahlen kann, würd ich sagen. Nur können die, die’s am nötigsten haben, sich meine Dienste nicht leisten. Hören Sie, da liegt eine Tote, und der wurde ein Messer reingestoch …«
»Befinden sich in der Truhe die Gerätschaften zum Üben?«
Annie Troll starrte ihn an. Dann ging sie zu dem abgeschabten Holzkasten, öffnete den schweren Deckel und entnahm ihm einen Degen. Damit ging sie auf ihn los, erst tänzelnd, dann rasend flink, couragiert wie ein Mann, besser als ein Mann. Die Klinge sauste an seiner Schläfe vorbei, die Spitze zog einen Schlitz in seinen Ärmel. Er rührte sich nicht. Wozu auch.
Seine Gleichgültigkeit ließ sie die Waffe senken. »Überzeugt, dass ich’s kann?«
»Ich werde nicht gern angelogen, Frau Troll, das ist die Sache. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau eine Fechtschule …«
»Ich hab auch noch nie gehört, dass ’n Anwalt der heiligen Justiz den Rücken kehrt, um die Drecksarbeit der Gendarmen zu erledigen. Ich hab’s aber auch geglaubt.«
»Die Drecksarbeit der Kriminalpolizei«, korrigierte Daniel. Er kehrte zu der Toten zurück. »Wie heißt sie?«
»Serafina Bischof. Hat sich jedenfalls so nennen lassen. Klingt mir nicht wie ein Name, mit dem man sein Kind zum Taufbecken trägt. Aber beim Theater ist ja alles nur Schein und Blenden. Ich hätte gedacht, Sie kennen sie. Die ist nämlich berühmt.«
Daniel glaubte sich vage an eine Balletttänzerin zu erinnern, die gerade Furore machte, aber er war seit Dorotheas Tod nicht mehr im Theater gewesen. Bemüht, nicht mit der Blutlache in Berührung zu kommen, kniete er nieder und leuchtete mit der Lampe über die tote Frau. Ein Stich hatte ihren Hals durchbohrt, mindestens drei weitere Stiche die Brust – der blutdurchtränkte Stoff ließ nur eine Schätzung zu. Ein besonders heftiger Stoß war in ihren Unterleib gegangen, einer in die Hand, die sie vermutlich zum Schutz gehoben hatte. Der Daumen war zur Hälfte abgetrennt, das hübsche, zarte Gesicht allerdings verschont geblieben. Daniel merkte es sich.
Er überflog mit den Blicken den kleinen Raum hinter dem Vorhang, der offenbar zum Umkleiden diente und nur mit einem Stuhl möbliert war, auf dem ein tabakbraunes, blumenbesticktes Kleid, eine Mantille, ein modischer Hut und ein Muff lagen. Wenn Serafina Bischof wirklich hatte kämpfen können, dann musste sie, im Gegensatz zu ihrem Angreifer, waffenlos gewesen sein. Oder ihrer Angreiferin? Serafina Bischof war eine zierliche Frau, Annie Troll dagegen hochgewachsen, und dass sie Geschick im Umgang mit Waffen besaß, hatte sie ja gerade bewiesen. Außerdem gab es noch die Verletzung an ihrer Hand.
Er erhob sich und drehte sich zu der Fechtlehrerin um. »Ich komme noch einmal auf die Sache mit der Ehrlichkeit zurück, Frau Troll. Da bin ich empfindlich, es ist eine Marotte von mir, wenn Sie so wollen. Sollte ich entdecken, dass Sie mich anlügen, ist unser Vertrag beendet.«
»Ich schreib’s mir an die Wand, dann werde ich’s mir merken können!«, schnappte sie gekränkt. Sie maßen einander mit Blicken.
»Also gut, dann von Anfang an: Wann haben Sie die Tote gefunden?«
Die Frau brauchte einen Moment, um ihren Ärger niederzukämpfen, ehe es aus ihr herausbrach: »Serafina hatte Unterricht bei mir. Wie jeden Donnerstag. Sie kommt seit acht Monaten. Weil sie Angst vor den Kerlen hat, die sie bewund … nein, die sie dreckig anstarren, wenn sie auf der Bühne die Beine hebt, weil sie glauben … Ach, Mistdreck!« Sie begann über den Dachboden zu marschieren. »Weil sie sie für leichte Beute halten. Da gibt’s extra einen Raum im Theater, das Feuee-della-dans oder wie sie’s nennen, da lungern die Kerle in ihren Fracks rum und fangen die Tänzerinnen ab, wenn sie rauskommen … Vielleicht kennen Sie das ja.« Sie blieb vor Daniel stehen. »Es geht mich nichts an, ich leb in anderen Sphären, was Leute wie Sie tun, ist mir egal. Aber Sie müssen es sich merken, weil es wichtig ist. Serafina hatte Angst vor den Frackmännern. Die haben ihr nicht nur nach den Auftritten aufgelauert, sondern auch sonst, bei ihrer Wohnung und so. Sie hat sich aber nichts bieten lassen. Die war um kein Wort verlegen, und meist sind die Kerle dann abgehauen, besonders wenn sie was von ihren Ehefrauen gesagt hat, vor denen haben die doch alle Schiss. Aber sie selbst hatte eben auch Schiss und …«
»Ja?«
Wieder begann Annie Troll den Raum zu durchmessen. Sie wirbelte mit dem Degen und schlug so ihre Anspannung in die kaltmuffige Luft des Dachbodens. Zack, noch ein letzter Hieb, dann stand sie wieder vor ihm. »Sie kriegen es ja sowieso heraus, also sag ich’s gleich: Ich habe mit ihr gestritten.«
»Worüber?«
»Über Geld. Was sonst? Sie stand seit zwei Monaten bei mir in Kreide. Jetzt reicht’s, hab ich zu ihr gesagt. Ich muss auch Mietzins zahlen, hab ich gesagt. Ich hab ’ne Tochter. Ich war so wütend. Aber deswegen bring ich keinen um.«
»Gibt es Zeugen für diesen Streit?«
»Weiß ich nicht. Kann schon sein, wenigstens für die ersten bösen Worte, da haben wir nämlich beide gebrüllt. Danach wurden wir leiser.« Sie starrte auf die Tote, auf das Blut, das an den Rändern bereits geronnen war.
»Was passierte danach?«
»Ich bin rausgegangen, also ganz raus aus dem Haus und in den Hinterhof. Da ist ein Garten, nichts Schönes, aber es gibt eine Bank. Ich hab mich draufgesetzt. Ich brauchte frische Luft und Ruhe.«
»Es war kalt.«
»Ja, Kälte brauchte ich auch!«
»Hat jemand Sie dort gesehen?«
»Glaube ich nicht. Ich hab geheult. Ich war so …«
»… wütend?«
»So wütend, genau. Weil ich das Geld für den Mietzins und … ist egal. Aber ich hab sie nicht umgebracht. Das wäre doch auch unsinnig gewesen. Wenn sie tot wäre, hätte ich überhaupt nichts gekriegt. Spricht das nicht für mich?«
Nicht vor Gericht, dachte er. »Und dann?«
»Bin ich wieder hoch. Ich glaubte, sie wäre weg. Ich wollte aufräumen, weil sie die letzte Kundin gewesen war. Und da hab ich sie liegen sehen.«
Daniel ging erneut vor der Toten in die Hocke. Er setzte die Lampe auf einen Schemel und versuchte vorsichtig, ihren Kiefer zu bewegen. Die Totenstarre, die diesen Körperteil zuerst ergriff, setzte bereits ein. Die Frau war also seit mindestens zwei Stunden tot, vielleicht seit drei oder vier. Das stand nicht im Widerspruch zu dem, was Annie Troll behauptet hatte: die Zeit im Garten, der Fund der Leiche, das Abwägen, was zu tun sei, der Weg zu ihm und wieder zurück … Es passte.
Er drehte die Leiche vorsichtig auf die Seite – und fand unvermutet das Tatwerkzeug, ein etwa zehn Zoll langes Messer. Der Täter musste es weggeworfen haben, als Serafina gestürzt war, und anschließend hatte er sich nicht getraut, es unter ihr hervorzuziehen. Oder er hatte es für überflüssig gehalten, weil man ihn nicht mit der Waffe in Verbindung bringen würde. Mit spitzen Fingern zog er sie hervor und hielt sie in den Schein der Lampe. Es handelte sich um ein Klappmesser mit einrastender Klinge und Griffschalen aus Horn, ein Laguiole, wie die Gravur in der Klinge bewies.
Das Blut am Griff war weitgehend getrocknet. Er entdeckte Fingerabdrücke, besonders deutlich fiel der Abdruck eines Daumens ins Auge. Eines massigen Daumens. Er blickte auf die Hand von Annie Troll. Sie besaß dünne, nicht besonders lange Finger, das war gut. Er zog ein Tüchlein aus der Tasche, wickelte das Messer hinein und steckte es ein.
»Warum machen Sie das?«
»Kennen Sie die Waffe?«
Annie Troll schüttelte den Kopf.
Als Daniel die Ermordete umkreiste, entdeckte er auch noch Fußabdrücke. Einen, der sich deutlich im Blut abgebildet hatte, zwei verwischte. Länge und Breite des deutlichen Abdrucks passten zum Daumen, sie stammten von einem großen Menschen. Annie Trolls Füße waren keinesfalls für diesen Latschenumfang geschaffen. War sie damit aus dem Schneider? Er drehte sich zu seiner Auftraggeberin um und musterte ihr blutbeflecktes Kleid. Wie war das Blut dorthin gekommen? Er fragte sie danach.
»Als ich Serafina hier hab liegen sehen … ich habe sie angefasst, ich dachte, sie könnte noch leben oder … ich hab gar nichts gedacht.« Die Frau stand vor ihm, erschöpft und trotzdem wie zum Sprung bereit. Sie war weder besonders hübsch noch besonders hässlich. Drahtige Locken, die jedem Versuch widerstanden, sie in eine hübsche Frisur zu verwandeln, und wilde Augen. Sie erinnerte Daniel an eine Katze, die die Köchin seiner Mutter mit weiteren neugeborenen Kätzchen ertränken sollte. Vier von ihnen starben, eine schaffte es, den Stoff des alten Beutels, in dem sie ersäuft werden sollten, zu durchbeißen und sich auf ein Waschbrett zu retten, das zufällig in dem kleinen Flüsschen trieb. Das Brett verschwand in einer Schilfinsel. Ob die Katze es ans rettende Ufer schaffte, hatte er nicht mehr beobachten können. »Sie haben sie wirklich nicht umgebracht?«
»Ich schwöre es.«
Also gut. In seiner Tasche befanden sich ein kleines Büchlein und ein Bleistift. Sorgfältig zeichnete er den Abdruck des Schuhs nach. Die Spitze bestand aus einander im rechten Winkel kreuzenden Linien, in der Ferse bildete sich deutlich erkennbar ein V ab. Er fasste gedanklich zusammen. Das Kleid seiner Klientin war mit Blut besudelt, die Nachbarn hatten ihren Streit mit der Ermordeten mitangehört – schlecht. Und da es sich um einen Mordfall handelte, der durch die Berühmtheit des Opfers großes Aufsehen erregen würde, würde die Kriminalabteilung der Dresdener Polizei bemüht sein, rasche Erfolge vorzuweisen. Ebenfalls schlecht.
»Wir gehen folgendermaßen vor«, sagte er und erklärte seiner Klientin, was zu tun war.
3. Kapitel
Annies Kreischen füllte den Fechtsaal. Sie hatte die Tür offen stehen lassen, damit es übers Treppenhaus auch garantiert in sämtliche Wohnungen drang, in jedes der fünf Stockwerke, vielleicht gar bis auf die Straße …
Es fiel ihr nicht schwer zu schreien. Die tote Serafina war in der Nacht von Ratten angefressen worden. Wie hatten diese höllischen Scheusale in so kurzer Zeit so großen Schaden anrichten können? Sie hatten ihre Nase angenagt und versucht, sich durch die Augen in den Kopf vorzubeißen. Die Augenhöhlen füllte eine blutige Masse, das Gesicht war zu einer Fratze geworden, zu einem Albtraum. Man hätte die Arme niemals die Nacht über hier liegenlassen dürfen. Der verfluchte Detektiv, dieses herz- und gottlose Mannsbild, der hatte doch bestimmt gewusst, welches Bild sie erwarten würde …
Endlich kamen die erhofften Schritte, die Nachbarn rannten herbei. Willi Kubiak, ihr Vermieter, seine Frau Else mit der Hasenscharte, Ernst Schlosser, Henni Walther … Auch sie begannen zu schreien, als sie die Tote sahen. Eine wüste Brüllerei. Else, die sich sonst durch nichts erschüttern ließ, liefen die Tränen runter.
Willi war der Erste, der sich wieder fasste. Er packte Annie bei den Schultern und schüttelte sie. »Wer ist das? Herrgott, was ist passiert?« Er ohrfeigte sie grob, Annie verstummte. Auf dem Dachboden drängelten sich inzwischen gut ein Dutzend Leute, sogar Kinder waren darunter. Warum scheuchte man die nicht raus? Konnten ihre Mütter sich nicht vorstellen, was die Kleinen träumen würden, nachdem sie einen von Ratten angefressenen Leichnam gesehen hatten?
»Ruhe!«, brüllte Willi, und jetzt wurde es tatsächlich still. Beklommen und auch ein wenig fasziniert sammelten sich die Nachbarn um die Leiche. Annie meinte, ihre Gedanken hören zu können: Habt ihr gestern Abend auch den furchtbaren Streit gehört? Das war doch die Annie Troll gewesen. Die hat Ausdrücke gebraucht, die ein gottesfürchtiger Mensch nicht mal kennt. Und dann war’s plötzlich so still geworden …
»Das war eine von deinen Kundinnen, oder?«, brachte Henni Walther, die die meiste Zeit im Bett lag, weil sie sich einbildete, an Schwindsucht zu leiden, die Sache auf den Punkt.
Annie starrte auf Serafinas feines Gesicht mit den hohen Wangenknochen … Ogottogott … Ihr wurde übel.
»Schau mal genau hin, Annie«, befahl Willi. »Das muss eine von deinen Kundinnen sein. Sieht man doch an den … also Kleider sind das ja gar nicht«, stellte er mit einem schwer deutbaren Blick auf den muskulösen Körper fest, von dem ja rein gar nichts verborgen war und der ihm sicher die Glut in die Lenden getrieben hätte, wenn er nicht von den Stichen und Rattenbissen so verunstaltet gewesen wäre. »Wie heißt sie?«
Geben Sie sich natürlich, hatte der Detektiv ihr gestern Abend geraten, als er sie auf diesen Moment vorbereitete. Leider hatte er vergessen zu erklären, wie unschuldige Menschen sich verhielten, wenn sie durch die zerbissenen Wangen einer toten Frau deren weiße Zähne glänzen sahen. »Serafina Bischof«, stieß sie hervor.
Staunen und Tuscheln. Annie war diskret, was ihre Kundschaft anging. Keiner ihrer Nachbarn hatte gewusst, dass die berühmte Tänzerin über ihren Häuptern Ausfall und Parade übte.
»Du hast gestern mit der gestritten. Oder mit jemand anders. Aber die hier ist auf jeden Fall tot«, brummte Ernst Schlosser, der ihr grollte, weil er ihr eine Weile erfolglos nachgestiegen war.
Sprechen Sie als Erste von dem Streit, hatte der Detektiv ihr geraten, die Sache würde ja sowieso herauskommen. Diesen Moment hatte sie verpasst. So beeilte sie sich wenigstens zu nicken. »Und wie. Sie wollte ihren Unterricht nicht zahlen. Oder konnte das nicht. Ich hab ihr gesagt, dann soll sie verschwinden. Leute für süße Worte unterrichten, kann ich mir nicht leisten. Ich bin dann runter in den Garten …« Sie legte eine kurze Pause ein, voller Hoffnung, dass jemand bestätigen würde, sie gesehen zu haben. Kam aber nichts. Also erzählte sie weiter, wie sie zu müde gewesen war, noch einmal hochzulaufen, wie sie das nun bedauerte, weil sie der armen, von ihrem Mörder hingemeuchelten Tänzerin vielleicht ja noch hätte helfen können …
»Oder er hätte dich ebenfalls abgemurkst!«, meinte Mirabella Kröger, die in der Wohnung unter ihr wohnte. Alle Blicke gingen wieder zu der Leiche. Mirabellas halbwüchsiger Sohn drückte sich, gebannt vom Grauen, näher an die Tote heran. Annie zerrte den Tölpel zurück. Dass nur ja die Fußabdrücke erhalten blieben, die bewiesen, dass Serafina durch die Hand eines Mannes umgekommen war! »Auf jeden Fall ist hier ein Verbrechen geschehen«, erklärte sie mit festerer Stimme. »Wir müssen die Gendarmen benachrichtigen.«
Und die waren, von Willi Kubiak alarmiert, auch in kürzester Zeit zur Stelle. Ein halbes Dutzend Männer in schwarzgrauen Uniformen mit silberfarbenen Tressen, Epauletten und Pickelhauben, auf denen das großherzogliche sächsische Wappen abgebildet war. Der Mann, der sie anführte, war ein Major von Römer, ein eiskalter Kerl, so kam es Annie vor, ohne jede Verbindlichkeit, die Augen verhangen, als hätte er schon zu viele Tote gesehen. Seine Stimme klang wie Stahl, der über Eis kratzt. Das war keiner, mit dem sich spaßen ließ. Er umrundete die Leiche und ließ einen seiner Männer Serafinas Kopf drehen und einen anderen ihre Wunden zählen.
»Ich kenne die«, platzte einer der Gendarmen heraus. »Es handelt sich bei der Toten um eine Tänzerin, die berühmte, diese Bischof. Ich hab ja öfter Dienst im Theater, und da hab ich …«
Römer winkte ab, der Mann verstummte, sein Vorgesetzter starrte auf die Leiche. »Eine Tänzerin also. Scheinbar hat sie diesen Raum zum Üben genutzt«, meinte er mit einem Blick auf Serafinas Kleidung, in der es sich so vortrefflich fechten und sicher auch tanzen ließ. »Sie wird sich hier mit einem Tänzer getroffen haben, vielleicht auch mit einem Liebhaber, es gab Streit, er hat sie getötet. Bringt sie zur Leichenhalle auf dem Armenfriedhof. Sie soll aber nicht sofort verscharrt werden. Findet heraus, ob es eine Familie gibt oder ob sie genügend Geld für ein anständiges Grab hinterlassen hat.«
Die Gendarmen hatten die Nachbarn herausgescheucht und nur Annie, die sie auf den Boden geführt hatte, bleiben lassen. Sie hatte sich seit dem Eintreffen der Männer am Rand des Geschehens gehalten. Verheimlichen Sie ihnen auf keinen Fall, dass der Dachboden von Ihnen gemietet wurde und die Frau Ihre Kundin gewesen ist, hatte der Detektiv ihr eingeschärft. Weil auch das ja sowieso herauskäme. Aber was, wenn er sich irrte? Wenn sich die Ermittlungen auf Serafinas Kollegen und ihre Liebhaber beschränken würden? Da gab es einige, wie Annie wusste. Vielleicht klopften die Gendarmen dann gar nicht bei den Nachbarn.
Der Major wandte sich zur Tür.
Schon wieder ein Moment verpasst, doch dieses Mal zu ihrem Glück. Zur Hölle mit dem Detektiv! Alles ging gut, die Gendarmen würden sie in Ruhe lassen. Schade um den Silbertaler und die vierzig Groschen.
Annie trat beiseite, um den Major rauszulassen. Aber ein Neuankömmling versperrte ihm den Weg. Ein Mann in Zivil mit Gehrock und Melone, einem pechschwarzen Lockenbart, der seine untere Gesichtshälfte wie ein gerahmtes Dreieck wirken ließ, und ebenso lockigem Haupthaar, und dazu einem aufreizend frechen Blick, der dem Major galt, aber sofort weiterglitt zur Leiche. »Na da schau her.« Seine Stimme klang ebenfalls frech, obwohl er nichts Ungehöriges gesagt hatte.
»Die Kriminalpolizei«, murmelte der Major säuerlich.
»Die es gern hat, wenn man sie bei einem Mord hinzuzieht. Vergessen, nicht wahr? Einfach nicht dran gedacht. Wir sind ja auch erst seit fünfzehn Jahren hier.«
»Es handelt sich um eine Tänzerin.«
»Die aber offenbar nicht an einem Hühnerknochen erstickt ist.«
Der Major biss sich auf die Lippe. Man konnte einander nicht ausstehen, das war unübersehbar. »Serafina Bischof hatte einen ganzen Sack voller Liebhaber. Einer davon hat sie umgebracht, die Sache ist klar.«
»Ihr Scharfsinn ist bewundernswert, Major. Ich sehe bisher allerdings nichts als eine Leiche mit Stichwunden, einige Fußspuren und … gibt es keine Tatwaffe?«
»Der Täter hat sie mitgenommen.«
»Was sagen die Leute im Haus?«
»Wir sind auch gerade erst angekommen.«
Annie wusste nicht viel über die Polizei, aber doch, dass es zwei Arten von Polizisten gab. Einmal die Gendarmen, die ihre Hauptwache beim Königlichen Hoftheater hatten. Die schnüffelten in den Gassen und Kaschemmen herum, steckten ihre Nasen in private Angelegenheiten und ließen sich auch gern mal schmieren. Und dann gab es die Kriminalpolizei. Unheimliche Leute sind das, hatte Willi Kubiak, der durch seine regelmäßigen Schenkenbesuche immer auf dem neuesten Stande war, einmal erklärt. Die kommen, wenn was besonders Schlimmes passiert ist, wenn also jemand abgemurkst wurde oder so. Und dann lassen sie keinen Stein auf dem anderen. Die verbeißen sich wie Kläffer in die Wade. Die geben nicht auf, bis sie jemanden eingebuchtet haben!
Dieser hier hatte sich als Erstes in die Wade vom Römer verbissen, so viel war klar. Und dem tat’s ordentlich weh. »Wenn ich einen Haufen Scheiße sehe«, zischte er mit knallrotem Kopf, »dann nenne ich das einen Haufen Scheiße, lass ihn wegkehren und fertig. Andere Leute pulen den Scheißhaufen auseinander, weil sie sich einbilden, sie könnten darin die Geheimnisse des Universums entdecken. Kriegt man aber einfach beschissene Hände von.«
»Meine Männer klopfen bereits an den Wohnungen, um die Mieter zu befragen. Sie können also mit Ihren Gendarmen abziehen und weiter Scheißhaufen zusammenkehren«, meinte der Schwarzbärtige bissig.
Er wartete, bis die Gendarmen den Raum verlassen hatten, Major von Römer bleich vor Wut, dann wandte er sich der Leiche zu. Er nahm sich sehr viel mehr Zeit als der Gendarm, sah sich alles an, auch die Fußspuren, von denen er genau wie der Detektiv eine Skizze anfertigte. Dann ließ er die Tote drehen und machte sich Notizen … Annie, die gehen wollte, bat er schroff, zu bleiben.
Schließlich kam er zu ihr, zog ein Oval aus Kupfer hervor, auf dem in schöner Schrift KRIMINALPOLIZEI und ein Stern mit einem Loch in der Mitte eingraviert waren, und sagte: »Kriminalinspektor Keller. Wie ich hörte, haben Sie diesen Dachraum gemietet, Frau Troll. Und wie ich außerdem hörte, hatten Sie einen Streit mit der Toten, kurz bevor sie starb. Ich würde mich gern ausführlicher mit Ihnen unterhalten.«
Da saß sie also in der Tinte. Annie begleitete den Mann notgedrungen, aber wie der Detektiv ihr geraten hatte, schnappte sie sich zuvor Jette, ihr Mädel mit dem blassen Gesicht, dem peniblen Mittelscheitel und den straff gebundenen Zöpfen. Jette trug den erbärmlich krähenden Bastard von Daniel Raabe auf den Armen und sah aus, als wollte sie in das Heulen einstimmen. Hastig nahm Annie ihr das Kind ab, wiegte es und begann zu erklären: »Denk dir, da oben, in meinem Fechtsaal, liegt ’ne tote Frau. Die Tänzerin, die ich gestern Abend unterrichtet hab. Die ist erstochen worden, Jette, kannste dir das vorstellen? Unter unserm Dach …« Das Kind des Detektivs verstummte plötzlich und riss die Augen auf. Sie waren tintenblau. »Die wollen mich jetzt mitnehmen. Und mir vielleicht sogar was anhängen. Weil ich mit der Frau gestritten hab, bevor sie tot war. Dabei streitet doch jeder mal. Aber das verstehen die nicht.«
Der Kriminalinspektor, der hinter ihr stand, lauschte, als könnte jedes ihrer Worte sie als Mörderin entlarven. Die Gendarmen hätten sie einfach gepackt und unter dem Gejohle der Leute zur Wache abgeführt. Der Kriminale war gesitteter, aber gefährlicher. Dieser Raabe hatte die Lage richtig eingeschätzt.
»Hör zu, mein Engel. Lauf zu dem Mann, von dem sie gerade alle reden. Zu dem Detektiv, der den Giftmörder gepackt hat, du weißt schon. Frag Willi, wo er wohnt, der wird’s rausfinden.« Sie redete schneller, der Kriminalinspektor verlor die Geduld. »Geh hin und richte dem Mann aus, dass ich seine Hilfe brauche. Sag ihm, er muss den Mörder von der armen Serafina finden …«
Jette nickte und klappte den Mund auf und zu, so verwirrt, wie man es sich nur wünschen konnte, obwohl Annie alles mit ihr abgesprochen und ihr außerdem eine genaue Wegbeschreibung gegeben hatte. Annie drückte ihr das Kind wieder in die Arme. Es begann auf der Stelle zu schreien.