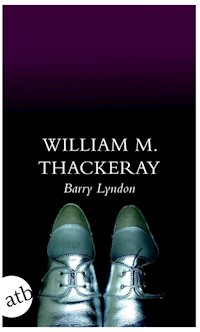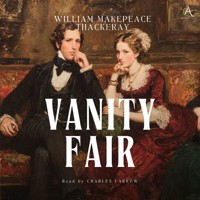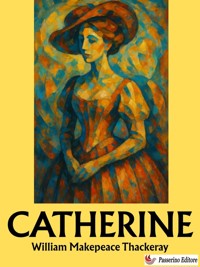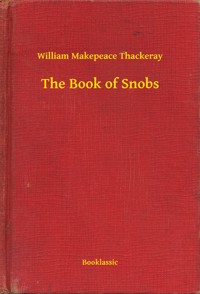1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Notwendigkeit einer Abhandlung über die Snobs an der Hand der Geschichte und durch treffliche Beispiele erläutert. Ich bin dazu ausersehen, ein solches Buch zu schreiben. Verkündung meiner Berufung mit Worten feuriger Beredsamkeit. Ich weise nach, daß die Welt allmählich für dieses Werk und seinen Verfasser reif geworden ist. Snobs müssen studiert werden wie andere Erscheinungen in der Naturgeschichte auch. Sie bilden einen Teil des »Schönen«. Sie sind in allen Klassen zu finden – schlagender Beweis: Oberst Snobley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Snob-Buch: DeWest Collection
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorbemerkungen
Die Notwendigkeit einer Abhandlung über die Snobs an der Hand der Geschichte und durch treffliche Beispiele erläutert. Ich bin dazu ausersehen, ein solches Buch zu schreiben. Verkündung meiner Berufung mit Worten feuriger Beredsamkeit. Ich weise nach, daß die Welt allmählich für dieses Werk und seinen Verfasser reif geworden ist. Snobs müssen studiert werden wie andere Erscheinungen in der Naturgeschichte auch. Sie bilden einen Teil des »Schönen«. Sie sind in allen Klassen zu finden – schlagender Beweis: Oberst Snobley.
Wir alle haben wohl schon die Behauptung gelesen, deren Echtheit ich mir aber durchaus zu bestreiten erlaube, denn ich möchte wirklich wissen, welche Gründe für ihre Richtigkeit herangezogen werden könnten, wir alle, sage ich, haben bereits den Vorzug gehabt, zu lesen, daß, wenn die Not der Zeit und der Welt nach einem Mann verlangt, ein solcher auch gefunden wird.
So wurde zur Zeit der französischen Revolution (den Leser wird es sicherlich freuen, daß ich so bald von ihr anfange), als es sich als unvermeidlich erwies, dem Volk ein Abführmittel einzugeben, Robespierre gefunden, eine allerdings widerliche und abscheuliche Mixtur, die gleichwohl von dem Kranken begierig und schließlich zu seinem größten Vorteil hinuntergeschluckt wurde. So trat, als es nötig wurde, John Bull aus Amerika herauszuwerfen, Washington auf den Schauplatz und entledigte sich dieser Aufgabe zu aller Beifall. So erschien, als der Graf von Aldborough sich unpäßlich fühlte, Professor Holloway mit seinen Pillen und heilte, wie es in seinen Anzeigen heißt, seine Lordschaft usw. usw. ... Unzählige Beispiele könnten dafür herangezogen werden, daß, wenn ein Volk sich in größter Not befindet, auch die Hilfe am nächsten ist, gerade wie im Puppenspiel (dieser Welt im kleinen), wo dem Hanswurst, wenn er irgend etwas, etwa eine Wärmflasche, einen Pumpenschwengel, eine Gans oder einen Muff, braucht, immer gerade das Gewünschte aus den Kulissen zufliegt.
Weiter – wenn Menschen etwas unternehmen wollen, so verstehen sie es stets, ihr Beginnen als eine absolute Weltnotwendigkeit hinzustellen, die nach Ausführung schreit. Handelt es sich zum Beispiel um eine neue Bahn, dann wird die Direktion sicher bekanntgeben: »Eine engere Verbindung zwischen Bathershins und Derrynane-Beg ist im Interesse der Zivilisation unbedingt nötig und entspricht auch dem stets wiederkehrenden Verlangen des großen irischen Volkes.« Oder es steht die Gründung einer Zeitung in Frage. Da wird die Ankündigung etwa so lauten: »Jetzt, wo die Kirche in Gefahr ist, wo wilder Fanatismus und abscheulicher Unglauben sie bedroht, wo der Jesuitismus sie zu untergraben sucht und sie durch Spaltungen im Inneren sich nahezu selbst vernichtet, ist ein allgemeiner Schrei – das gequälte Volk hat seine sehnsüchtigen Blicke nach dem Ausland gerichtet – nach einem Meister und Führer laut geworden. Ein Verein, dem Geistliche und Bürger der Stadt angehören, hat sich in dieser Stunde der Gefahr gebildet und hat die Gründung eines Blattes unter dem Namen ›Der Kirchendiener‹ beschlossen usw. usw.« Hieraus erhellt wenigstens das eine unwiderleglich: Was das Publikum verlangt, erhält es auch, und umgekehrt: Das Publikum besitzt bereits etwas, dann hat es auch Verlangen danach.
Lange habe ich die Überzeugung mit mir herumgetragen, daß ich ein Werk verfassen müßte – ich bitte, » Werk« groß zu schreiben –, daß ich einen Zweck zu erfüllen hätte, etwa wie Curtius, der mit seinem Roß in den Abgrund setzte, daß ich ein großes soziales Übel zu enthüllen und zu heilen hätte. Diese Überzeugung verfolgte mich Jahre hindurch. Sie packte mich mitten im Verkehr der Straße, sie setzte sich zu mir in die stille Studierstube, sie ließ sich vernehmen, wenn ich mein Glas an der Festtafel erhob, sie verfolgte mich auch im Getriebe von Rotten Row, sie folgte mir sogar in fremde Länder. Am steinigen Strande Brightons und im Sande von Margate übertönte die Stimme das Rollen der See. Sie versteckte sich selbst in meine Nachtmütze und flüsterte mir zu: »Schläfer, wache auf, dein Werk ist noch immer nicht begonnen.« Im vorigen Jahre weilte ich beim Mondschein im Kolosseum und hörte wieder die feine eindringliche Stimme sprechen: »Smith oder Jones, mein braver Junge, das ist ja alles sehr schön, aber du solltest eigentlich zu Hause sitzen und an deinem großen Werk über die Snobs schreiben.«
Wenn jemand einen derartigen Ruf in seinem Inneren vernimmt, so wäre jeder Versuch, ihn zu überhören, eine Verkehrtheit. Er muß zu den Völkern sprechen, er muß sein Innerstes umkehren, wie James sagen würde, oder daran ersticken und sterben.
»Fühlst du denn nicht«, habe ich oft Ihrem ergebensten Diener in Gedanken zugerufen, »fühlst du nicht, wie du nach und nach für deine große Arbeit reif geworden bist und wie du nun unwiderstehlich zu ihr hingezogen wirst?« Zuerst wurde die Welt geschaffen, danach folgerichtig die Snobs! Sie waren seit Jahrtausenden da und blieben dennoch ebenso unentdeckt wie Amerika. Aber auf einmal, ingens patebat tellus, wurde die Menschheit dunkel gewahr, daß ein solches Geschlecht wirklich existierte. Indessen erst vor ungefähr fünfundzwanzig Jahren kam der so bezeichnende einsilbige Name auf und hat sich mit gleicher Schnelligkeit wie die Eisenbahnen über ganz England verbreitet. Heute sind Snobs gekannt und anerkannt in unserem Reiche, in dem, wie ich gelernt habe, die Sonne niemals untergeht. Der »Punch« erscheint gerade zur rechten Zeit, um ihre Geschichte aufzuzeichnen, und der eigens hierfür prädestinierte Mann ist zur Stelle, um diese Geschichte im »Punch« zu schreiben.
Ich habe (und zu dieser Gabe gratuliere ich mir selbst aus tiefster, dankbarster Seele), ich habe einen entschiedenen Blick für Snobs. Wenn das Wahre schön ist, so ist es schön, sogar das Wesen der Snobs zu studieren, ihrer Geschichte nachzuspüren, so wie gewisse kleine Hunde in Hampshire Trüffeln aufstöbern; so ist es schön, Schächte in die Gesellschaft zu bohren, um auf reiche Adern von Snob-Erz zu stoßen. Das Snobtum gleicht dem Tode in dem Verse des Horaz, den Sie hoffentlich noch nie gehört haben und der also lautet: »Er pocht gleicherweise an die Tür der Armen, wie er an den Palastpforten der Kaiser rüttelt.« Es wäre ein großer Irrtum, über Snobs oberflächlich urteilen und glauben zu wollen, man träfe sie nur unter kleinen Leuten an. Ein gewaltiger Prozentsatz von Snobs, davon lasse ich mich nicht abbringen, ist in jeder Gesellschaftsklasse dieser sterblichen Welt zu finden. Urteilen Sie nicht kurzerhand oder geringschätzig über Snobs, Sie beweisen damit nur, daß Sie selbst ein Snob sind. Auch ich bin schon dafür gehalten worden.
Als ich mich zur Brunnenkur in Bagnigge Wells aufhielt und dort im Hotel »Imperial« wohnte, saß ich beim Frühstück eine kurze Zeit lang einem so unerträglichen Snob gegenüber, daß ich fühlte, der Brunnen würde mir nicht bekommen, solange er dort weilte. Er hieß Oberstleutnant Snobley und stand bei einem Dragonerregiment. Er trug Lackstiefel und hatte einen gewichsten Schnurrbart; er lispelte, sprach nachlässig und ließ aus den Worten die R's aus. Er prahlte stets und wischte sich seinen geölten Bart mit einem großen rotseidenen Taschentuch, welches einen so penetranten Geruch nach Moschus im Zimmer verbreitete, daß ich schließlich so weit war, mit diesem Snob den Kampf aufzunehmen, bis er oder ich den Gasthof verließ. Ich fing zuerst harmlose Gespräche mit ihm an, was ihn sehr irritierte, weil er nicht wußte, wie er mir entgegnen sollte, war er es doch nicht im mindesten gewohnt, daß jemand es sich herausnahm, ihn zuerst anzureden. Dann gab ich ihm eine Zeitung, und als er auch von diesem Entgegenkommen keine Notiz nahm, fixierte ich ihn scharf und benutzte meine Gabel als Zahnstocher. Nachdem ich dieses zwei Tage hintereinander durchgeführt hatte, hielt er es nicht länger aus und überließ mir den Kampfplatz.
Sollte der Oberst dies zu Gesicht bekommen, so wird er sich gewiß des Herrn erinnern, der ihn fragte, ob er nicht auch Publikola für einen guten Schriftsteller hielte, und der es fertig brachte, ihn mit einer vierzinkigen Gabel aus dem Hotel zu vertreiben.
-1- Einige scherzhafte Anekdoten über Snobs
Man kann relative und absolute Snobs unterscheiden. Unter absoluten Snobs verstehe ich solche Personen, die sich überall in allen Lebenslagen, Tag und Nacht, von der Wiege bis zum Grabe, als Snobs betragen, weil eben der Snobismus ihre wahre Natur ist! Die andere Klasse sind Gelegenheits-Snobs, je nach Lage der Umstände und Verhältnisse im Leben.
Zum Beispiel: Ich kannte jemanden, der vor meinen Augen ein ähnlich abschreckendes Gebaren zur Schau trug wie ich, als ich Oberst Snobley herausgraulen wollte: ich meine den Gebrauch der Gabel als Zahnstocher. Also ich kannte jemanden, der mit mir zusammen im »Café Europa« (gegenüber der Großen Oper – wie jedermann weiß, das einzig anständige Speisehaus in Neapel) das Mittagessen einzunehmen pflegte und Erbsen mit dem Messer aß. Er war ein Mensch, dessen Umgang mir anfangs das größte Vergnügen machte – wir hatten uns am Kraterrand des Vesuv kennengelernt, waren dann in Kalabrien von Briganten ausgeraubt, gefangen und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben worden, was eigentlich nicht zur Sache gehört –, er war also ein geistvoller Mann von bedeutenden Gaben und vielseitiger Bildung; aber ich hatte ihn noch nie Erbsen essen gesehen, und sein Benehmen dabei verursachte mir größtes Unbehagen.
Wenn jemand sich vor aller Welt so benehmen konnte, so blieb mir nur eins zu tun übrig – den Verkehr mit ihm abzubrechen. Ich beauftragte daher einen gemeinsamen Freund (den Ehrenwerten Poly Anthus), dem Herrn die Sache so schonend wie möglich beizubringen und ihm zu sagen, daß unliebsame Vorkommnisse, die in keiner Weise die Ehre des Herrn Marrowfat berührten oder meiner Achtung für ihn Abbruch täten, mich zwängen, den vertrauten Verkehr mit ihm aufzugeben; denselben Abend trafen wir uns auf einem Ball der Herzogin von Monte Fiasco und schnitten uns bereits vollkommen.
Alle Welt in Neapel wunderte sich über die Trennung von Damon und Pythias – hatte doch Marrowfat mir mehr als einmal das Leben gerettet –, aber konnte ich als Gentleman anders handeln?
In diesem Fall war mein Freund ein relativer Snob. Leute von Rang in anderen Ländern dürfen ruhig ihr Messer in der geschilderten Art gebrauchen, ohne als Snobs angesehen zu werden. Sah ich doch selbst, wie Monte Fiasco die Platte mit dem Messer abputzte und wie jeder Principe in der Gesellschaft das gleiche tat. Sah ich doch an der Tafel Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großherzogin von Baden (die, wenn diese ehrfurchtsvollen Zeilen je vor Ihre Kaiserlichen Augen kommen sollten, sich ihres untertänigsten Dieners gnädig erinnern möge), sah ich doch, sage ich, die Erbprinzessin von Potztausend Donnerwetter (diese klassisch schöne Dame) ihr Messer als Gabel oder Löffel verwenden; ich habe sie es, bei Gott, beinahe mit verschlucken sehen, wie es Ramo Samce, der indische Gaukler, nicht besser machen konnte. Wurde ich damals blaß, oder verringerte sich deshalb meine Ehrfurcht für die Prinzessin? Nein, süße Amalie! Wohl die tiefste Leidenschaft, die ich je für eine Frau hegte, hat diese Dame in meiner Brust entfacht. O schönstes Wesen! Mögest du bis in die fernsten Zeiten mit dem Messer das Essen zu deinen Lippen, den rosigsten und lieblichsten der Welt, führen!
Vier Jahre lang habe ich den wahren Grund meines Zwistes mit Marrowfat keiner sterblichen Seele auch nur angedeutet. Wir trafen uns bei den Empfängen der Aristokratie – unseren Freunden und Verwandten – weiter. Wir stießen uns fast beim Tanz und bei der Tafel, aber die Entfremdung hielt an und schien unwiderruflich, bis der 4. Juni vorigen Jahres kam.
Wir trafen uns bei Sir George Golloper. Bei Tische saß er rechts, ich links von der entzückenden Lady G. – Erbsen bildeten einen Teil der Speisenfolge – Enten mit grünen Erbsen. Ich zitterte, als Marrowfat davon angeboten wurde, und wendete mich voller Unbehagen ab, fürchtete ich doch, wieder den Degen in seinen schrecklichen Kinnbacken verschwinden zu sehen. Wie groß war mein Erstaunen und Entzücken, als ich ihn die Gabel wie jeder andere Christenmensch gebrauchen sah. Er nahm auch nicht ein einziges Mal den kalten Stahl zu Hilfe. Die Erinnerung alter Zeiten überkam mich, an seine uneigennützigen Dienste, als er mich aus der Gewalt der Briganten befreite, an sein ritterliches Verhalten bei der Geschichte mit der Gräfin Dei Spinachi, als er mir mit 1700 Lire aus der Verlegenheit half. Ich vergoß beinahe Freudentränen, meine Stimme zitterte vor Rührung. »George, mein alter Junge«, rief ich, »George Marrowfat, alter Kerl, ein Glas Wein!«
Jäh errötend in tiefer Bewegung, fast ebenso zitternd wie ich, erwiderte George: »Frank, soll es Rheinwein oder Madeira sein?« Wenig fehlte, und ich hätte ihn vor der ganzen Gesellschaft ans Herz gedrückt. Lady Golloper ahnte schwerlich, was mich so erregte, daß ich den Entenbraten, den ich gerade zerlegte, auf ihren gräflichen rosaseidenen Schoß fallen ließ. Die gütigste aller Frauen verzieh mir meine Ungeschicklichkeit, und der Lakai entfernte den Vogel.
Seitdem waren wir die dicksten Freunde, und natürlich verfiel George nie wieder in diese abscheuliche Angewohnheit. Er hatte sie sich auf der Schule eines Dorfes angeeignet, wo Erbsen gezogen und nur zweizinkige Gabeln gebraucht wurden. Erst auf dem Kontinent, wo allgemein vierzinkige Gabeln Mode sind, legte er diese schreckliche Unsitte ab.
In dieser Hinsicht, aber nur in dieser, bin ich ein Anhänger derjenigen, die für silberne Gabeln Schule machen, und wenn diese Erzählung auch nur einen Leser des »Punch« zum Nachdenken veranlassen sollte, sich feierlich zu fragen: »Esse ich Erbsen mit dem Messer oder nicht?«, dann wird er begreifen, in welchen Abgrund er geraten würde, wenn er bei dieser Übung beharrte, oder seine Familie, falls sie seinem Beispiel folgte; dann werden diese Zeilen nicht umsonst geschrieben sein. Und nun noch eins: was andere Schriftsteller sich auch dünken mögen, die über diesen Gegenstand geschrieben haben, das eine darf ich wenigstens für mich in Anspruch nehmen, daß ich die Sache als ein Mann von Moral beleuchtet habe.
Da manche meiner Leser etwas langsam begreifen, ist es vielleicht ganz gut, wenn ich hier schon selbst die Moral meiner Geschichte erzähle. Sie ist nämlich die: die Gesellschaft hat ihre ungeschriebenen Gesetze; wer zu ihr gehören will, muß ihre Sitten befolgen und ihren harmlosen Vorschriften sich anpassen.
Angenommen, ich ginge auf das »British and Foreign Institute« (und der Himmel möge mich davor bewahren, daß ich es unter irgendeinem Vorwand oder in irgendeinem Anzüge tue), oder ich ginge zu einer Teegesellschaft in Schlafrock und Pantoffeln und nicht in dem für einen Gentleman vorgeschriebenen Anzug, nämlich in Kniehosen, weißer Weste mit goldenen Litzen, Zylinderhut, Spitzenmanschetten und weißer Halsbinde, so würde ich damit die Gesellschaft beleidigen oder mit anderen Worten ... »Erbsen mit dem Messer essen«. Eine Person, die einen derartigen Verstoß gegen die allgemeine Sitte vollführt, sollte alsbald durch den Portier des Institutes an die frische Luft befördert werden. Ein solcher Missetäter ist in den Augen der Gesellschaft ein höchst widerhaariger Snob. Die Gesellschaft hat ihren Kodex und ihre Polizei so gut wie die Regierung, und wer in ihr ein behagliches Leben führen will, muß sich ihren zum allgemeinen Besten gegebenen Vorschriften fügen.
Ich bin natürlich ein Feind der Selbstsucht und hasse Eigenlob im Grunde meiner Seele; aber ich kann nicht anders und muß hier ein Begebnis erzählen, das mein Thema erläutert und bei dem ich mich, wie ich glaube, mit beträchtlicher Klugheit verhalten habe.
Vor einigen Jahren war ich in knifflicher Mission in Konstantinopel; die Russen spielten damals – ganz unter uns – ein doppeltes Spiel, und es wurde für uns nötig, eine Sondergesandtschaft hinzuschicken. Zu der Zeit gab Leckerbiß-Pascha von Rumelien, damals der Obergaleote der Pforte, ein diplomatisches Diner in seinem Sommerpalast in Bujukdere. Ich saß zur Linken des Pascha und der russische Geschäftsträger, Graf von Diddloff, auf seiner rechten Seite. Diddloff ist ein Hansnarr, der so tut, als ob er beim Duft einer Rose vor Wonne vergehen sollte. Dabei hatte er im Verlauf der Verhandlungen dreimal den Versuch gemacht, mich morden zu lassen. Vor der Welt aber waren wir natürlich die besten Freunde und begrüßten uns in der liebenswürdigsten und herzlichsten Weise.
Der Pascha ist – nein, leider war, denn die seidene Schnur hat seitdem das ihrige getan – ein rechtschaffener Anhänger der alttürkischen Diplomatenschule. Wir aßen mit den Fingern und benutzten Brotscheiben als Teller. Die einzige Neuerung, die er gestattete, war der Genuß von europäischen Schnäpsen, die er mit größter Wonne hinter die Binde goß. Dazu schlug er eine gewaltige Klinge. Unter den vielen Gerichten, die aufgetragen wurden, befand sich auch ein Lamm, das in seinem Fell gebraten und mit Pflaumen, Knoblauch, Teufelsdreck, spanischem Pfeffer und anderen Gewürzen gefüllt war. Es war jedenfalls das scheußlichste Sammelsurium, das je ein Sterblicher gerochen oder gekostet hatte. Der Pascha aß unglaubliche Mengen davon, und den Sitten des Orients gemäß legte er seinen Gastfreunden zur Rechten und Linken selbst vor. Kam aber ein besonders aromatischer Bissen ihm unter die Finger, so schob er ihn höchst eigenhändig in den Mund seiner Gäste.
Niemals werde ich das Gesicht des armen Diddloff vergessen, als Seine Exzellenz eine ziemlich große Kugel aus der Füllung formte und sie mit dem Ruf: »Buck, Buck« (das ist sehr gut) Diddloff zwischen die Lippen praktizierte. Die Augen des Russen rollten schrecklich, als er diesen Leckerbissen erhielt; er würgte ihn indessen unter Grimassen mit Todesverachtung herunter, griff dann schleunigst nach der nächsten Flasche, die er für Sauterne hielt, die aber in Wirklichkeit nichts anderes als Kognak war, und spülte ziemlich einen halben Liter davon hinterher, ehe er seinen Irrtum bemerkte. Das gab ihm den Rest, er wurde halbtot aus dem Speisesaal nach einer kühlen Laube am Bosporus getragen.
Als ich an die Reihe kam, nahm ich das Gemengsel freundlich lächelnd entgegen, sagte »Bismillah« und leckte mir die Lippen voller Behagen. Bei dem nächsten Gericht drehte ich dann meinerseits mit großem Geschick eine Kugel und stopfte sie dem alten Pascha mit so viel Grazie in den Mund, daß ich mir das Herz des alten Herrn vollständig eroberte. Rußland war damit erledigt, und der Vertrag von Kabobanopel wurde unterzeichnet. Mit Diddloff war es aus, er wurde nach Petersburg zurückberufen, und Sir Roderich Murchison sah ihn später als Nr. 3967 in den Bergwerken des Ural arbeiten.
Die Moral von dieser Geschichte habe ich kaum nötig zu erklären; sie lehrt, daß man in der Gesellschaft viel Unangenehmes mit lächelnder Miene hinunterschlucken muß.
-2- Der Königliche Snob
Lange Zeit ist es her, beim Regierungsantritt unserer jetzigen gnädigen Königin, da begab es sich an einem schönen Sommerabend, wie James sagen würde, daß einige junge Edelleute nach Tisch beim Wein in der von Frau Anderson in dem königlichen Dorfe Kensington geführten Wirtschaft zum »Königswappen« saßen. Es war ein herrlicher Abend, und die Ausflügler schauten auf ein liebliches Landschaftsbild. Die hohen Ulmen des alten Gartens standen in vollem Laub, und zahllose Karossen des englischen Adels rollten vor dem benachbarten Palais vor, wo der Prinz von Sussex (dessen Einkommen ihm neuerdings nur erlaubt, Tagesgesellschaften zu geben) aus Anlaß der Anwesenheit seiner königlichen Nichte ein Hoffest veranstaltete. Als die Equipagen des Adels ihre Insassen vor der Festhalle abgesetzt hatten, begaben sich die Kutscher und Diener in den benachbarten Garten des »Königswappens«, um dort eine Flasche nußbraunen Ales zu trinken. Wir beobachteten diese Burschen von unserem Fenster aus, und, beim heiligen Bonifatius, das war ein köstlicher Anblick.
Die Tulpen in Mynheer van Duncks Gärten konnten nicht farbenprächtiger sein als die Livreen dieser bunt gekleideten Mannen. Alle Blumen des Feldes blühten an ihrer in Falten abgenähten Brust, und alle Farben des Regenbogens leuchteten aus ihren Plüschpluderhosen, als sie mit ihren langen Stöcken den Garten in gravitätischer Feierlichkeit auf und ab spazierten unter jenem ergötzlichen Beben der Waden, das auf uns stets einen so berückenden Zauber ausübt. Der Weg schien nicht breit genug, um alle die ungeschlachten Kerle in kanariengelb, karmoisinrot und lichtblau leuchtenden Farben einherstolzieren zu lassen.
Da plötzlich, als sie sich in ihrer ganzen Pracht sonnten, ertönte eine kleine Glocke, und durch eine Seitenpforte traten, nachdem sie ihre königliche Herrin abgesetzt hatten, Ihrer Majestät höchsteigene Karmoisinlakaien mit Epauletten und schwarzen Plüschhosen.
Es war ein kläglicher Anblick, bei ihrer Ankunft die anderen armen Johanns sich fortschleichen zu sehen. Nicht einer der braven Privatplüschhosen konnte vor den königlichen Bedienten bestehen. Sie verließen den Weg und schlüpften in dunkle Ecken, wo sie still ihr Bier austranken. Der königliche Plüsch nahm Besitz von dem Garten, bis für sie das königliche Plüschdiner angerichtet war, dann zogen sie sich zurück, und wir hörten aus dem Pavillon, in dem sie speisten, staatserhaltende Hochs, Reden und frenetische Hurras. Die anderen Bedienten wurden nicht mehr gesehen.
Meine lieben Bedientenseelen, die ihr in einem Augenblick so unglaublich eingebildet und im nächsten so kleinmütig wäret, ihr seid mir nur die Abbilder eurer Herren. Merkt euch: wer Niedriges in niedriger Weise bestaunt, ist ein Snob. – Vielleicht ist dies die treffendste Bestimmung des ganzen Begriffs.
Darum habe ich auch, mit größtem Respekt natürlich, den königlichen Snob an die Spitze meiner Liste gesetzt, was zur Folge hat, daß ihm der Vortritt vor den anderen Snobs gelassen werden muß, so wie es die Bedienten vor ihren königlichen Kollegen im Kensingtongarten machten. Wenn ich von dem oder jenem allergnädigsten Landesherren sage, er sei ein Snob, so sage ich von Seiner Majestät nichts anderes, als daß er ein Mensch ist. Könige sind eben auch Menschen und Snobs. In einem Lande, wo die Mehrzahl der Bewohner Snobs sind, kann der hervorragendste unter ihnen sicherlich nicht untauglich zur Regierung sein. Beweis: ihre bewundernswürdigen Erfolge bei uns.
Zum Beispiel war Jakob I. ein Snob, und zudem ein schottischer Snob, also das denkbar anstößigste Geschöpf auf dieser Welt. Er scheint keine einzige Mannestugend besessen zu haben, weder Tapferkeit noch Edelmut, noch Ehre, noch Verstand; aber lesen wir einmal nach, was die großen Geistlichen und Gelehrten Englands über ihn gesagt haben!
Sein Enkel Karl II. war ein Schuft, aber kein Snob; während Ludwig XIV., sein querköpfiger Zeitgenosse, der große Perückenanbeter, mir stets und zweifelsfrei als königlicher Snob vorgekommen ist.
Ich will indessen weitere Beispiele von königlichen Snobs nicht aus der Geschichte meiner Heimat nehmen, sondern von einem benachbarten Königreich »Brentford« und seinem Monarchen, dem großen und vielbeweinten Georgius IV., berichten. Mit derselben Demut, mit der sich die Lakaien im »Königswappen« vor dem königlichen Plüsch zurückzogen, kroch der hohe Adel der Brentforder Nation vor Georgius zu Kreuz und erklärte ihn für den ersten Gentleman Europas. Muß man sich da nicht voll Verwunderung fragen, was denn nach der Ansicht des Adels einen Gentleman ausmacht, wenn er Georgius einen derartigen Ehrentitel gab?
Was heißt es eigentlich, ein Gentleman zu sein? Soll er nicht ehrbar, tapfer, edelmütig, mutig, klug sein? Und wenn er alle diese Eigenschaften besitzt, soll er sie dann nicht vor aller Welt in anmutiger Weise zur Schau tragen? Soll ein Gentleman nicht ein guter Sohn, ein treuer Gatte, ein sorgsamer Vater sein? Soll nicht sein Lebenswandel untadelig sein, soll er nicht seine Schulden bezahlen, soll nicht sein Geschmack entwickelt und elegant, sollen nicht seine Liebhabereien erhaben und vornehm sein? Mit einem Wort, sollte nicht der Lebenswandel des ersten Gentleman von Europa derart sein, daß seine Biographie in höheren Töchterschulen und Unterrichtsanstalten junger Leute zu aller Nutzen gelesen werden könnte? Ich richte diese Frage an alle Jugenderzieher – an Mrs. Ellis und an die englischen Frauen; an alle Schulvorsteher von Doktor Hawtrey abwärts bis zu Mr. Squeers. Ich berufe damit einen erhabenen Gerichtshof von Jugend und Unschuld, geleitet von ihren ehrwürdigen Lehrern (gleich den zehntausend rotwangigen Armenschülern in der St. Paulskirche), und auf der Anklagebank sitzt Georgius, der sich verteidigen muß. »Hinaus mit ihm aus dem Saal, hinaus aus dem Saal, dicker, alter Florizel! Gerichtsdiener, führt diesen aufgeschwemmten Mann mit den vielen Pickeln im Antlitz hinaus!« – Wenn Georgius ein Standbild in dem neuen Palast, den die Brentforder bauen wollen, erhalten soll, so sollte es im Lakaienhaus errichtet werden. Man sollte ihn darstellen, wie er ein Gewand zuschneidet, in welcher Kunst er es ja, wie es heißt, zur Vollendung gebracht hat. Er hat auch den Maraschino-Punsch und eine Schuhschnalle erfunden (das geschah in der Vollkraft seiner Jugend und der Blüte seiner Erfindungsgabe) und einen chinesischen Pavillon, das scheußlichste Bauwerk der Welt. Er konnte ein Viergespann fast ebenso gut lenken wie der Postkutscher von Brighton, focht elegant und war angeblich ein guter Violinspieler. Und er lächelte so unwiderstehlich, daß jeder, der in seine erhabene Nähe kam, ihm mit Leib und Seele zum Opfer fiel, so wie ein Kaninchen die Beute einer großen Boa constrictor wird.
Ich möchte wetten, daß, wenn Mr. Widdicomb durch eine Revolution auf den Thron von Brentford käme, das Volk ganz in der gleichen Weise von seinem unwiderstehlichen, majestätischen Lächeln bezaubert sein und daß es ebenso zittern und niederknien würde, um ihm die Hand zu küssen. Wenn er nach Dublin käme, so würde man an der Stelle, an der er zum ersten Male landete, einen Obelisken errichten, wie es die Paddyländer taten, als Georgius sie besuchte. Wir haben alle mit Vergnügen die Geschichte der Reise des Königs nach Haggisland gelesen, wo seine Anwesenheit ungeheure Begeisterung entfachte, wo der berühmteste Mann des Landes – der Baron von Bradwardine –, als er an Bord der Königsjacht kam, ein Glas ausfindig machte, aus dem Georgius getrunken hatte, und es in seiner Rocktasche als unschätzbares Andenken verschwinden ließ. Aber bei der Rückfahrt an Land setzte sich der Herr Baron auf das Glas, so daß es zerbrach und seine Rockschöße zerschnitt. So ging die unschätzbare Reliquie der Welt auf immer verloren!
O edler Bradwardine! Wie konnte ein so veralteter Aberglaube dich zur Anbetung eines derartigen Idols hinreißen?
Wenn man Lust hat, über den Wechsel alles Irdischen zu philosophieren, so muß man sich die Figur von Georgius in seinen beglaubigt echten Kleidern im Panoptikum ansehen. Eintritt einen Schilling. Kinder und Lakaien zahlen die Hälfte. Ich sage euch, geht ja hin und zahlt euern halben Schilling!
-3- Der Einfluß des Adels auf die Snobs
Letzten Sonntag vor einer Woche war ich in der Stadtkirche, und nach Schluß des Gottesdienstes hörte ich, wie zwei Snobs sich über den Pfarrer unterhielten. Der eine fragte den anderen über die Person des Geistlichen aus. »Er heißt Soundso und ist Hauskaplan bei dem Grafen Wieheißterdochgleich!« – »Oh, wirklich!« sagte der erste Snob mit dem Ausdruck unbeschreiblicher Befriedigung. Für den Geist dieses Snob waren damit die Rechtgläubigkeit und die Persönlichkeit des Pfarrers unzweifelhaft festgestellt. Er wußte über den Grafen nicht mehr als über seinen Kaplan, aber aus dem Ansehen des ersteren schloß er auf den Charakter des letzteren; und äußerst befriedigt von Hochwürden ging er nach Hause – dieser kleine servile Snob.
Dieses Erlebnis gab mir mehr Anlaß zum Nachdenken als die Predigt, und ich staunte über die Verbreitung und Ausdehnung des Götzendienstes, der bei uns zulande mit einem hohen Adel getrieben wird. Was konnte es dem Snob bedeuten, ob Hochwürden bei Seiner Erlaucht Kaplan war oder nicht? Was haben wir doch für eine Vergötterung der Pairswürde in unserem freien Lande! Wie sind wir doch alle damit behaftet und liegen mehr oder minder auf dem Bauche vor ihr! – Und bei der Bedeutung dieser Frage stehe ich nicht an zu erklären, daß der Einfluß der Pairs auf das Snobtum größer ist als auf irgendeine andere Einrichtung. Das Blühen, Wachsen und Gedeihen der Snobs gehört, wie Lord John Russel sagt, zu den »unschätzbaren Verdiensten«, die wir dem Adel verdanken. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Jemand wird beispielsweise sehr reich oder arbeitet mit Erfolg als rechte Hand eines Ministers oder gewinnt eine große Schlacht oder schließt einen vorteilhaften Vertrag ab oder ist ein geschickter Anwalt, der hohe Honorare und schließlich einen Sitz auf der Richterbank erhält, so belohnt ihn das Land sicherlich für alle Zeiten durch eine goldene Krone (mit mehr oder weniger Kugeln und Laub), durch einen Titel und die Stellung als Gesetzgeber. »Euer Verdienst ist so groß«, sagt die Nation, »daß auch eure Kinder in irgendeiner Form uns regieren sollen. Es ist ganz gleichgültig, daß euer ältester Sohn schwachsinnig ist. Wir halten eure Verdienste für so hervorragend, daß die von euch bekleideten Ehrenstellen dennoch auf ihn übergehen sollen, wenn der Tod euch eure erhabenen Schuhe auszieht. Seid ihr arm, so wollen wir euch und den Erstgeborenen eures Stammes für alle Zeiten so stellen, daß ihr in Glanz und Wonne leben könnt. Es ist unser Wunsch, daß in unserem glücklichen Vaterlande eine Sonderklasse leben soll, welche die erste Stelle einnimmt und vor allen anderen berufen ist, alle Regierungsämter und Patronate zu besetzen. Wir können nicht alle eure teuren Kinder zu Pairs machen, das würde der Pairswürde Abbruch tun, das Haus der Lords überfüllen und ungemütlich machen, aber die jüngeren Mitglieder eurer Familien sollen alles erhalten, was die Regierung ihnen sonst zu geben vermag. Sie sollen sich die Posten aussuchen dürfen, sie sollen mit neunzehn Jahren Kapitäne und Oberstleutnants werden, während altersgraue Leutnants dreißig Jahre hindurch exerzieren lassen müssen. Sie sollen mit vierundzwanzig Jahren das Kommando über ein Schiff und über altgediente Soldaten haben, die schon im Felde standen, ehe jene geboren wurden. Und da wir ein so hervorragend freies Volk sind und alle Leute in ihrem Streben ermutigen, so sagen wir jedem Mann von nur einigem Rang: bereichere dich, so sehr du kannst, nimm als Rechtsanwalt die kolossalsten Gebühren, halte große Reden, zeichne dich aus oder gewinne Schlachten, und du – auch du wirst in die auserwählte Klasse kommen, und dann werden natürlich auch deine Nachkommen über die unsrigen herrschen.«
Wie können wir das Snobtum verhindern bei solch einer hervorragenden nationalen Einrichtung, die wie zur Anbetung geschaffen ist? Wie können wir das Kriechen vor den Lords abwenden? Fleisch und Blut können nicht anders. Wie kann ein Mensch dieser großen Versuchung widerstehen? Beseelt von dem, was man edlen Wetteifer nennt, jagen viele den Ehrenstellen nach und erhalten sie auch schließlich. Andere, die zu schwach oder zu mittelmäßig sind, bewundern und kriechen blindlings vor denen, die welche errungen haben. Andere wieder, die nicht fähig waren, sie zu erreichen, hassen, beschimpfen und beneiden jene Glücklichen auf das wütendste. Es gibt nur wenige nüchterne und vorurteilslose Philosophen, die das Wesen der Gesellschaft, nämlich die ausgemachte Speichelleckerei, die gemeine und dabei vom Gesetz begünstigte Anbetung der Höherstehenden und des Mammons, mit einem Wort das verewigte Snobtum, erfaßt haben und dieses Faktum nun kühl registrieren. Und doch, gibt es selbst unter diesen kühlen Moralisten auch wohl nur einen, dessen Herz nicht vor Freude höher schlüge, wenn man ihn Arm in Arm mit Herzögen die Pall Mall auf und ab promenieren sehen könnte? Nein, unter den bei uns nun einmal herrschenden Gesellschaftszuständen ist es unmöglich, nicht bisweilen selbst ein Snob zu sein.
Diese Zustände ermutigen einerseits den Bürger, sich snobhaft unterwürfig, und andererseits den Edelmann, sich snobhaft anmaßend zu betragen. Wenn eine edle Marquise in ihrer Reisebeschreibung Betrachtungen darüber anstellt, wie sehr die Passagiere auf den Dampfern darunter zu leiden haben, daß sie mit allem möglichen Volk in Berührung kommen, und damit zu verstehen gibt, daß es für die gnädige Frau peinlich sei, mit einer Anzahl göttlicher Geschöpfe, über denen sie zu stehen meint, zusammenzukommen, wenn, sage ich, die Marquise von X so etwas zu schreiben fertigbringt, so müssen wir uns vergegenwärtigen, daß keine Frau aus ihrem natürlichen Empfinden heraus eine solche Meinung sich bilden würde, daß aber die Gewohnheit des Dienerns und Kriechens, welche die ganze Umgebung im Verkehr mit dieser schönen und mächtigen Dame, dieser Besitzerin so vieler schwarzer und anderer Diamanten, angenommen hat, ihr die Überzeugung beibringen mußte, daß sie im allgemeinen hoch über ihren Mitmenschen steht und daß ihr deshalb die Masse des Volkes in respektvoller Entfernung vom Leibe gehalten werden muß. Ich erinnere mich, daß ich einmal gerade in Kairo war, als ein Prinz aus europäischem Königshause auf der Durchreise nach Indien gleichfalls dort weilte. Eines Abends herrschte im Hotel große Aufregung, weil ein Mann sich im Brunnen ganz in der Nähe ertränkt hatte. Die Gäste des Hotels eilten nach der Stelle, und unter ihnen befand sich auch Ihr ergebener Diener, der einen neben ihm stehenden jungen Mann nach dem Grunde des Auflaufs fragte. Wie konnte ich wissen, daß der junge Herr ein Prinz war? Er trug weder Krone noch Zepter, sondern einen weißen Anzug und Filzhut, aber er war sehr erstaunt darüber, daß ihn jemand ansprach, und antwortete mit irgendeinem unverständlichen Worte, dann winkte er seinen Adjutanten heran, der mit mir sprechen sollte.
Es ist unsere Schuld und nicht die der Großen, wenn sie sich so hoch über uns stehend dünken. Wenn Ihr Euch selbst unter die Räder werft, so wird »Juggernaut, der Herr der Welt« Euch seelenruhig überfahren, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Und wenn vor Euch, lieber Freund, und vor mir täglich Kotau gemacht würde und wenn, wo wir uns auch blicken ließen, das Volk in sklavischer Anbetung vor uns auf den Knien läge, so kämen wir uns natürlich wie höhere Wesen vor und würden die Erhabenheit annehmen, die das Volk uns beharrlich andichtet.
Hier ein Beispiel aus den Reiseschilderungen Lord L.s, aus denen erhellt, in welcher ruhigen, wohlwollenden und selbstverständlichen Weise ein großer Mann die Huldigung unter ihm Stehender entgegennimmt. Nachdem er einige tiefsinnige und geniale Bemerkungen über Brüssel gemacht, sagt Seine Herrlichkeit wörtlich: »Ich wohnte einige Tage im Hotel ›Bellevue‹, einem sehr überschätzten Hause, das nicht annähernd so vornehm wie das ›Hôtel de France‹ ist, und machte die Bekanntschaft des Dr. L., des Arztes der Missionsanstalt. Er war glücklich, mir die Honneurs im Hotel erweisen zu dürfen, lud mich zu einem ›dîner en gourmand‹ im Restaurant ein und behauptete, daß man hier besser äße als bei Rocher in Paris. Wir waren unser sechs oder acht Teilnehmer und waren uns alle darüber einig, daß das Gebotene nicht im entferntesten an Paris heranreichte und zudem viel teurer war.« Soweit die Erzählung.
Und nun noch ein Wort über den Herrn, der das Diner gab. Dr. L., »glücklich, Seiner Herrlichkeit die Honneurs im Hotel erweisen zu dürfen«, feiert ihn mit den auserlesensten Gerichten, die man für Geld haben kann; und Mylord findet das Essen teuer und schlecht. Teuer! Ihn kostet es doch nichts. Schlecht! Aber Herr L. tat doch sein Bestes, um diesen edlen Gaumen zu befriedigen, und Mylord nimmt das Mahl gnädigst entgegen und verabschiedet den Gastgeber mit einer Zurechtweisung. Er benimmt sich wie ein Pascha von drei Roßschweifen, der über ein ungenügendes Bakschisch brummt.
Aber wie sollte es auch anders sein in einem Lande, wo die Lordanbetung ein Teil unseres Glaubensbekenntnisses ist und wo es den Kindern schon eingeimpft wird, den Adelskalender als eine zweite Bibel der Engländer zu verehren.
-4- Der Hofbericht und sein Einfluß auf die Snobs
Ein Beispiel ist das beste Lehrmittel. So wollen wir denn mit einer als wahr verbürgten Geschichte beginnen, die beweist, wie junge aristokratische Snobs gezüchtet werden und wie ihr Snobtum zur Blüte gebracht wird. Eine schöne und vornehme Dame (ich bitte die gnädige Frau um Verzeihung, daß ich ihre Geschichte der Öffentlichkeit preisgebe, aber sie ist so moralisch, daß die ganze Welt sie kennenlernen muß) erzählte mir, daß sie in früher Jugend eine kleine Freundin hatte, welche jetzt ebenfalls eine schöne und vornehme Dame ist. Es handelt sich um Miß Snobky, die Tochter von Sir Snobby Snobky, deren Vorstellung bei Hof am vorigen Donnerstag so großes Aufsehen erregte; habe ich nötig, noch mehr zu sagen?
Als Miß Snobky noch so jung war, daß sie sich in Wärterinnenkreisen bewegte und frühmorgens im St. James Park unter dem Schutze einer französischen Gouvernante und gefolgt von einem großen bärtigen Lakaien in der kanariengelben Livree der Snobkys spazieren geführt wurde, pflegte sie bei diesen Gelegenheiten den jungen Lord Claude Lollipop, den jüngeren Sohn des Marquis von Sillabub, zu treffen. In der Hochsaison beschlossen plötzlich die Snobkys aus irgendeinem unaufgeklärten Grunde, die Stadt zu verlassen. Als Miß Snobky dies hörte, fragte das zartsinnige Kind ihre Freundin und Vertraute: »Was wird nur der arme kleine Lollipop sagen, wenn er meine Abreise erfährt?«
»Oh, vielleicht erfährt er es gar nicht«, antwortete die Vertraute. »Meine Liebe, er wird es in der Zeitung lesen«, erwiderte die süße kleine siebenjährige Krabbe. Sie war sich schon ihrer Wichtigkeit bewußt und wußte auch, wie alle Einwohner Englands, wie alle als vornehm geltenwollenden Leute, wie alle Anbeter von silbernen Gabeln, alle Neuigkeitskrämer, alle Ladeninhaberinnen und Schneiderinnen, Anwalts- und Kaufmannsfrauen und die Leute, die am Clapham und Brunswick Square wohnen und nicht mehr Gelegenheit haben, mit einem Snobky eingeladen zu werden als mein lieber Leser hat, mit dem Kaiser von China zu dinieren, an den Begebenheiten bei den Snobkys Anteil nehmen und glücklich sind zu erfahren, ob sie in London angekommen sind oder es verlassen haben.
Hier folgt der Bericht über die Toilette von Miß Snobky und ihrer Mutter, der Lady Snobky, aus den Zeitungen vom vorigen Freitag.
Miß Snobky
»Prinzeßhängerchen aus gelber imitierter Nankingseide über einem Unterkleid von erbsengrünem Rips, garniert mit Ranken und Buketts aus Brüsseler Spitzen. Das Mieder und die Ärmel waren reizend mit Samt und mit Girlanden benäht. Der Kopfputz bestand aus Mohrrüben und Schleifen.«
Lady Snobky
»Prinzeßkleid, gefertigt aus den schönsten Pekinger Taschentüchern und auf das eleganteste besetzt mit Füttern, Stanniol und roten Bändern. Die Corsage und das Unterkleid waren aus himmelblauem Velvet, garniert mit Perlen und Quasten von Klingelzügen. Der Umhang war ein Eierkuchen. Der Kopfputz bestand aus einem Vogelnest mit einem Paradiesvogel darin, das über einer messingnen Türklinke ›en ferronnière‹ angebracht war. Dieses prächtige Kostüm stammt aus dem Atelier von Madame Crinoline, Regent Street, und bildete den Gegenstand allgemeiner Bewunderung.«
Solch ein Zeug lest ihr! Oh, Miß Ellis! Oh, englische Mütter, Töchter, Tanten, Großmütter, so ist eure Zeitungslektüre beschaffen, die ihr nicht anders haben wollt. Wie könnt ihr etwas anderes als Mütter, Töchter usw. von Snobs sein, solange euch solch ein Quatsch vorgesetzt wird?
Man zwängt den rosigen, kleinen Fuß einer jungen Chinesin in einen Schuh, der nicht größer als ein Salzfaß ist, hält die armen, kleinen Zehen darin gefangen und umwickelt, so lange, bis die erstrebte Winzigkeit unreparierbar geworden ist. Späterhin kann der Fuß sich nicht mehr zur natürlichen Größe entwickeln, selbst wenn man ihm anstelle von Schuhen Waschkübel anziehen wollte. Sie muß eben ihr ganzes Leben hindurch ihren kleinen Fuß behalten und bleibt ein Krüppel ... Oh, meine liebe Miß Wiggins, danken Sie es Ihrem guten Stern, daß Ihre hübschen kleinen Füße, die ich für so klein erkläre, daß man sie beim Gehen kaum wahrnimmt – danken Sie es Ihrem guten Stern, daß Ihre Mitmenschen an Ihnen nicht so gehandelt haben, aber halten Sie einmal Umschau unter Ihren Freundinnen in den höchsten Kreisen, und Sie werden finden, wie vielen ihr Gehirn vorzeitig eingezwängt und verkrüppelt worden ist.
Wie darf man erwarten, daß diese armen Geschöpfe sich natürlich entwickeln, nachdem die Welt und ihre Eltern sie so grausam verstümmelt haben? Wie, zum Teufel, können, solange es noch einen Hofbericht gibt, diejenigen Leute, die ihre Namen darin lesen, sich für ebenbürtig mit jener kriechenden Menge halten, welche täglich dieses greuliche Gewäsch liest? Ich glaube, daß unser Vaterland das einzige Land der Welt ist, wo der Hofbericht noch so in voller Blüte steht, in dem man lesen kann: »Heute ist Seine Königliche Hoheit der Prinz Pattypan in seinem Kinderwagen ausgefahren.« Oder: »Die Prinzessin Pimminy machte in Begleitung ihrer Puppe und ihrer Hofdamen eine Spazierfahrt usw.« Wir lachen zwar über die Ernsthaftigkeit, mit der Saint Simon berichtet: »Sa Majesté se médicamente aujourd'hui«, aber vor unseren eigenen Augen wird die gleiche Torheit täglich begangen. Dieser herrliche und geheimnisvolle Mann, der den Hofbericht verfaßt, kommt jeden Abend mit seiner Ausbeute auf die Redaktion, und ich habe auch schon den Verleger der Zeitung gebeten, ihn mir einmal aus dem Hinterhalt ansehen zu dürfen.
Von einem Königreich, das einen deutschen Prinzgemahl hat (es muß wohl Portugal sein, denn die Königin dieses Landes heiratete einen deutschen Prinzen, der von den Bewohnern sehr verehrt und bewundert wird), habe ich mir folgendes erzählen lassen: Wenn der Prinzgemahl zu seinem Vergnügen in den Kaninchengehegen von Cintra oder in den Fasanerien von Mafra der Jagd obliegt, so läßt er sich natürlich die Flinten von seinem Büchsenspanner laden. Dieser gibt sie dem Stallmeister, einem Edelmann, und dieser erst darf sie dem Prinzen überreichen. Der Prinz wiederum gibt das abgefeuerte Gewehr dem Edelmann, der es dann wieder dem Büchsenspanner einhändigt. Und so fort. Aber niemals würde der Prinz das Gewehr direkt aus den Händen des Büchsenspanners entgegennehmen.
So lange, wie diese unnatürliche und ungeheuerliche Etikette in Kraft ist, muß es Snobs geben. Alle drei bei diesem Zeremoniell beteiligten Personen müssen während der Ausübung ihrer Tätigkeit notwendig Snobs sein.
1. Der Büchsenspanner ist der kleinste Snob von ihnen, weil er seine tägliche Pflicht erfüllt; aber er erscheint doch in diesem Falle als Snob, das heißt, in einer ihn vor seinen Mitmenschen erniedrigenden Stellung (nämlich in seinem Verhältnis dem Prinzen gegenüber, mit dem er nur durch Vermittelung eines Dritten verkehren darf). Ein freier portugiesischer Büchsenspanner, der sich für unwürdig hält, direkt mit irgendeiner Person zu verkehren, gibt damit zu, daß er ein Snob ist.
2. Der diensttuende Edelmann ist ein Snob. Wenn es den Prinzen erniedrigt, das Gewehr aus den Händen des Büchsenspanners entgegenzunehmen, so ist es erniedrigend für den Edelmann, an seiner Statt diesen Dienst zu verrichten. Er handelt als Snob an dem Büchsenspanner, den er von dem Verkehr mit dem Prinzen fernhält, und er ist in seinem Verhältnis zu dem Prinzen ein Snob, weil er ihm eine ihn herabwürdigende niedere Handreichung leistet.