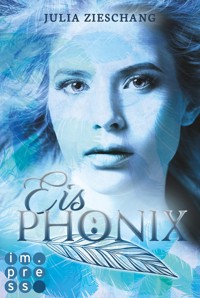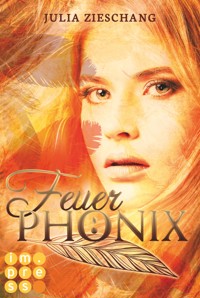Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: LagoHörbuch-Herausgeber: Miss Motte Audio
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine Welt aus Schatten und Licht Der Schattenprinz lädt zu einer neuen Runde seines gefährlichen Spiels ein. Die 16-jährige Elena nimmt daran teil, um ihren verschollenen Vater zurückzubekommen. Spannend und rasant Die Regeln sind einfach: sechs Spieler, sechs Partien. Und es kann nur einen Gewinner geben. Wer wird das Spiel des Schattenprinzen überleben und seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt bekommen? Gut gegen Böse: Wem kannst du trauen? Wer ist dein Feind? Jeder der Teilnehmer verfolgt seine eigenen Ziele. Als Elena in größte Not gerät, hilft ihr der unnahbare Alex. Aber kann sie ihm vertrauen oder ist das alles nur Teil des Spiels? Denn Gefühle, die zwischen Konkurrenten entfachen, können trügen und die Spielregeln sind unveränderbar! Autorinnen mit hoher Reichweite Die Autorinnen Anika Lorenz und Julia Zieschang lieben das Texten und ergänzen sich wunderbar. Anika Lorenz findet besonders solche Geschichten und Abenteuer spannend, die über die Grenzen der Realität hinausgehen. Julia Zieschang mag besonders die feinen Details, die den Erzählungen Echtheit verleihen. Durch ihren erfolgreichen Podcast Bücher & Sonntage führt sie außerdem inspirierende Gespräche mit Menschen aus der Bücherwelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
ANIKA LORENZ JULIA ZIESCHANG
DAS SPIEL DES
SCHATTEN PRINZEN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2022
© 2022 by LAGO Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Jil Aimée Bayer und Nina Krönes
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/detchana wangkheeree, ekosuwandono
Layout und Satz: inpunkt[w]o, Haiger | www.inpunktwo.de
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95761-225-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-326-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-327-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.lago-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
»Never fear shadows. They simply mean there’s a light shining somewhere nearby.«
Ruth E. Renkel
Spielregeln
Eine Welt geschmiedet aus Schatten und Licht, der Prinz lädt ein, öffnet seine Tore auch für dich. Komm näher, sei sein Gast, mit den richtigen Worten du Zutritt hast.
Es erwartet dich ein Ort voll Zauber und gefährlicher List, der Gewinner bekommt zurück, was er schmerzlich vermisst. Doch nur eine einmalige Teilnahme sei dir gewährt, auf ewig gefangen ist, wer wiederkehrt.
Löse die Rätsel und wachse über dich hinaus. Scheiterst du, strecken die Schatten ihre Klauen nach dir aus. Erreiche das Schloss und du kannst wieder heim, doch um zu gewinnen, musst du der Schnellste sein.
Bist du dennoch bereit, es zu wagen?Denn verlierst du, ist die Strafe für dein Versagen: Du wirst ein Teil der Schatten für die Ewigkeit, dein Dasein fristen in Dunkelheit.
Hörst du das Wispern der Schatten?Versuch, nicht in ihre Fallen zu tappen. Nun ist es so weit, das Spiel beginnt, doch achte auf den Sand, denn die Zeit, sie rinnt.
Der Prinz persönlich fordert dich heraus, nun sprich die folgenden Worte laut aus: Ich akzeptiere die Regeln des Spiels, drum lass mich hinein; mein Schicksal sollen fortan Schatten und Licht sein.
Inhalt
Prolog – Der Schattenprinz
Die Entdeckung der Spieluhr – Elena
Die Welt aus Schatten und Licht – Alex
Das Spiel beginnt – Elena
Das Karussell der Fabelwesen – Alex
Der Sumpf des Todes – Elena
Das Rätsel der Spieluhr – Alex
Eine mysteriöse Abendveranstaltung – Elena
Der Schmetterling im Labyrinth – Alex
Der Düstere Wald – Elena
Die Schatten auf seiner Haut – Alex
Die Todesschlucht – Elena
Das Schloss des Schattenprinzen – Alex
Die Lichtprinzessin – Elena
Epilog – Einen Monat später
Danksagung
Prolog
Der Schattenprinz
Schatten und Licht wechselten sich ab, während der Prinz schnellen Schrittes den langen Flur durchquerte. Wand, Fenster, Wand, Fenster …
Manchmal fühlte er sich im einfallenden Licht der Sonne wohler, manchmal in der Dunkelheit des alten Gemäuers. Dennoch, trotz der vielen Fenster, wurde es nie gänzlich hell im Schloss. Schon lange nicht mehr.
Heute jedoch beachtete er die unterschiedlichen Lichtverhältnisse nicht. Er hatte Wichtigeres zu tun. Ab morgen würde sich wieder ein Bann über seine Welt legen; das Spiel beginnen, das eine neue Ära im Königreich einläutete. Endlich rückten seine Ziele in greifbare Nähe.
Aus dem Augenwinkel stellte Henry sicher, dass die Schatten ihm auf Schritt und Tritt folgten. Wie abgerichtete Tiere hafteten sie an seinen Fersen. Er war der Mittelpunkt ihrer Welt und hatte unermessliche Macht über sie.
Ein siegessicheres Lächeln umspielte seine Lippen, während er die Rundbogentür vor sich fokussierte. Das Rascheln der schwarzen Federn seines Umhangs ging im lauten Poltern seiner schweren Stiefel unter. Synchron öffneten die Wachen, die den Eingang zum Thronsaal flankierten, die Flügeltüren und gaben den Blick in das Innere frei. Der große Raum war düster. Kurz zögerte er an der Schwelle, die eine Grenze zwischen Licht und Dunkelheit bildete. Als Kind hatte der Prinz Angst vor der Finsternis gehabt, das war nun anders. Jetzt verlieh sie ihm Kraft. Die Dunkelheit in seiner Welt brachte ihm die Schatten, und ohne Schatten gäbe es kein Spiel. Auf dieses Spektakel wollte er ungern verzichten, vor allem, weil es eine befriedigende Rache an den Menschen war. Ihr Schicksal hatten sie selbst bestimmt, als sie ihm durch ihren Einfluss genommen wurde.
Verrat schneidet tief, Rache hilft beim Heilen – das hatte sein Vater oft gesagt. Oh, wie der König die Spiele genossen hatte! Nun tat es sein Sohn an seiner statt. Henry fand großen Gefallen daran, die Menschen wie Marionetten tanzen zu lassen.
Als er in den Raum eintrat, glitt sein Blick über die imposanten Fresken an der Decke. Es waren Bildnisse dunkler Kreaturen, die seine Welt bevölkerten. Sein liebstes Fresko war das einer Putte, aus deren Augen blutige Tränen rannen. Es spiegelte den Schmerz seiner Kindheit. Trotzdem gab es helle Flecken, die von einer anderen Zeit erzählten, einer leuchtenden Zeit. Doch wann immer er sich daran zu erinnern versuchte, tauchten stattdessen kurze Sequenzen seines Lebens vor seinem geistigen Auge auf. Von seiner Mutter, die seinen Vater ins Unglück gestürzt hatte. Von Tränen … von Schmerz …
Um nicht länger die Bilder seiner eigenen Familientragödie sehen zu müssen, wandte er seine Aufmerksamkeit seinem Vater zu. Dem Elternteil, der ihm geblieben war.
So, wie der Prinz es gewohnt war, besetzte der König den Thron. Er war das Machtzentrum dieser Welt, während sein Sohn, trotz des fragilen Gesundheitszustandes des Herrschers, zu seinen Gefolgsleuten gehörte. Erst nach dessen Tod würde die gebündelte Magie dieser Welt von ihm an seinen Sohn übergehen. Doch niemals würde er es dazu kommen lassen. Henrys Augen glitten über den ausgezehrten Körper des Königs. Er war nur noch das schwache Abbild seiner früheren Erscheinung.
Schließlich betrachtete der Prinz den schwarzen Kristall, aus dem der Thron bestand und mit dem sein Vater verschmolzen war. Lediglich sein Oberkörper ragte daraus hervor. Es war, als wären seine Beine in einer Schicht dunklen Eises eingefroren.
Aus einem Impuls heraus legte Henry seine Hand auf die Schulter des Königs. Die Haut unter seinem Umhang war warm, dennoch zeigte dieser keine Reaktion auf die Berührung seines Sohnes. Dem Leben nah, aber dem Tod noch näher …
Hart presste der Prinz seinen Kiefer zusammen, während eine dunkle Bewegung an der Wand hinter dem Thron seine Aufmerksamkeit erregte. Eines der Schattenwesen kroch daraus hervor. Sein augenloses Haupt ragte aus dem kalten Marmor hinaus. Dicke Tropfen, die an flüssiges Pech erinnerten, trieften auf den schwarzen Kristall und wurden eins mit ihm. Ihre Magie hielt seinen Vater am Leben. Nur was war das für ein Leben, reglos gefesselt an einen Thron? Das nächste Spiel könnte die Erlösung für die Qualen des Königs bringen, alles verändern und den Schatten jene Macht verleihen, die sie brauchten, um ihn zu retten.
Wir tun alles für Euch, Eure Hoheit, erhob sich eine zischende Stimme in seinen Gedanken.
Der Schatten streckte seine dreifingrige Klaue nach ihm aus, als wolle er ihn zu sich locken. Unwillkürlich trat Henry näher heran.
Euer Plan birgt für Euch keinerlei Risiken, den Spielern jedoch wird es anders ergehen. Von ihnen werden wir zehren, bis wir schließlich ›Eure‹ Vision für diese Welt realisieren können. Nur so kann die Vorherrschaft der Schatten besiegelt und das Licht verbannt werden.
Versonnen schloss der Prinz die Augen und träumte sich in die verheißungsvolle Zukunft, als er plötzlich spürte, dass der Körper des Königs unter seinen Fingern bebte. Er riss die Augen auf und blickte in die sturmgrauen Augen seines Vaters. In ihnen lag eine Angst, die das Herz des Prinzen krampfen ließ.
Der König fürchtet sich vor dem Tod, erklärte der Schatten. Er spürt ihn mit jeder Faser seines Seins.
Der Prinz kniete sich hin und umschloss die noch immer zitternde Hand fest mit seiner.
»Vater, Ihr werdet nicht sterben. Ich verspreche, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das zu verhindern.« Eindringlich sah Henry den König an und hoffte, ihn mit seiner Unerschrockenheit zu überzeugen, doch noch immer spiegelte sich Furcht in dessen Blick. Sein Vater gab einen röchelnden Laut von sich und ein unangenehmer Schauer überfiel Henry. Wie hatte es nur so weit kommen können?
Es war die Liebe, antwortete der Schatten auf seine unausgesprochene Frage.
Ich weiß, pflichtete er ihm bei.
Sein Vater hatte Gefühle zugelassen. Und was war nun aus ihm geworden? Ein Häufchen Elend war er, mehr nicht. Armselig. Der König hatte geliebt, Henry würde diesen Fehler nicht begehen. Liebe war ein Fluch, eine nicht willkommene Sehnsucht nach Licht, die mit diesem Spiel endlich enden würde.
Von Vorfreude durchströmt erhob er sich. Vor den Augen seines Vaters trat er auf den gläsernen Boden, an die Stelle, die sich unter dem höchsten Punkt der Kuppel befand. Augenblicklich spürte er die Kraft des wirbelnden Strudels aus Licht und Dunkelheit durch seinen Körper vibrieren.
»Vater, die Figuren stehen bereit«, verkündete er und breitete in einer feierlichen Geste die Arme aus. Seine Worte hallten durch den Saal. »Die Partien sind erschaffen und die Teilnehmer ausgewählt. Morgen um diese Zeit wird die Spieluhr sich nach fünf Jahren endlich wieder drehen. Das Spiel beginnt …«
Das Tosen des Wirbelsturms unter seinen Füßen wurde stärker. Als würden seine Worte ihn befeuern. Unwillkürlich neigte der Prinz seinen Kopf. Der durchsichtige Boden erlaubte ihm einen perfekten Blick auf das Portal, das die Menschenwelt mit seiner verband. Weißer Nebel vermischte sich mit schwarzem. Ein Sturm, der an einen Kampf zwischen Dunkelheit und Licht erinnerte, tobte unter ihm und würde die Spieler schon bald zu ihm bringen. Marionetten … meine Marionetten, dachte der Prinz triumphierend, auch wenn das nicht gänzlich zutraf. Nicht er allein hielt die Fäden in der Hand, genauso wenig wie die Schatten.
Wo Schatten sind, da ist auch Licht … Henry runzelte unwillig die Stirn. Das Licht war eine Unbekannte in seiner Gleichung, die ihm Sorgen bereitete. Es zwang den Prinzen, sich an gewisse Regeln zu halten. Jedoch gab es Mittel und Wege, das Licht zu begrenzen, und letztendlich würde er es eliminieren. Dann würde sich die Schwärze der Nacht wie ein schützender Umhang über seine Welt legen; sie einhüllen in tröstender Dunkelheit. Das war Henrys einziger Wunsch und dafür war er bereit, alles aufs Spiel zu setzen.
Die Entdeckung der Spieluhr
Elena
Ein Lichtstrahl drang durch den Spalt unter der Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters und lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich. Die dunklen Dielen aus Ebenholz knarrten unter meinen Schritten, während ich mich der Tür näherte.
Im Haus war es still, viel zu still. Früher war das Lachen seiner Bewohner durch die Gänge gehallt, wenn mein Vater mit mir Fangen gespielt hatte. Als Kind war ich durch das gesamte Herrenhaus gestürmt, bis raus in den weitläufigen Garten, in dem meine Mutter gerne die betörend duftenden Rosen verschnitten hatte. Lächelnd hatte sie die Gartenschere beiseitegelegt und war meinem Vater und mir hinterhergelaufen. Gemeinsam hatten sie mich über den feinen englischen Rasen gejagt. Meistens war es mein Vater gewesen, der mich zuerst erwischte. Er hatte mich gepackt, durch die Luft gewirbelt und gerufen: »Hab ich dich!«
Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie ich vor Vergnügen gequietscht hatte. Der schrille Ton hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Eine bittersüße Erinnerung an bessere Zeiten. Mit Vaters Verschwinden war auch die Lebensfreude meiner Mutter verloren gegangen. Das Herrenhaus hatte sich zu einem trostlosen Gemäuer entwickelt; einem Gefängnis, aus dem weder meine Mutter noch ich auszubrechen vermochten.
Ich versuchte es von Zeit zu Zeit, indem ich mich von meiner Neugier treiben ließ und das Haus und seine zahlreichen Winkel erforschte, wie auch jetzt, als ich meine Hand um den kühlen Metallknauf legte und diesen herumdrehte. Sacht schob ich die Tür einen Spaltbreit auf. Muffige, abgestandene Luft längst vergangener Tage schlug mir entgegen. Die Sonne schien durch das Fenster ins Zimmer. In ihrem Licht tanzte der Staub, dicht und grau. Er überzog den gesamten Raum mit einer feinen Schicht. Selbst die Dielen, die draußen im Flur vom Bohnern dunkel geglänzt hatten, wirkten hier, als hätte sich Nebel über sie gelegt und ihnen jegliche Farbe entzogen.
Seit mein Vater, Clifford Johnson, 1888 verschwunden war, hatte dieses Zimmer niemand mehr betreten, geschweige denn geputzt. Meine Mutter wäre sehr wütend, wenn sie erführe, wo ich mich gerade aufhielt. Das Arbeitszimmer war tabu, denn hier hatte alles angefangen, es war der Ursprung allen Übels. Hier hatte mein Vater, ein gefeierter Astrophysiker, in dem Jahr vor seinem Verschwinden die größten Erfolge erzielt. Als ihm vor fünf Jahren der Durchbruch in seinen Forschungen gelang, hatten wir plötzlich sehr viel Geld und konnten in ein schickes Anwesen in der Nähe von Oxford ziehen. Wir konnten uns sogar eine Handvoll Bediensteter leisten.
Doch der Erfolg hatte auch den Ehrgeiz in meinem Vater geweckt, sodass er sich oft tagelang in seinem Arbeitszimmer verschanzte, bis er vor vier Jahren zu einer neuen Expedition aufgebrochen und dabei verschwunden war.
Nun schmerzte allein der Anblick dieser Tür meine Mutter so sehr, dass sie es vermied, den Gang entlangzulaufen. Meistens zog sie sich ins Licht zurück, wo die Schatten der Vergangenheit sie weniger zu quälen schienen. Deshalb verbrachte sie viel Zeit im Garten, inmitten ihrer geliebten Blumen.
Ich trat vor das Fenster und tatsächlich erspähte ich dort auf einer weiß lackierten Holzbank meine Mutter. Sie war umringt von zartlilafarbenem Sommerflieder, hielt ein Buch in der Hand und trug einen eleganten Hut passend zu ihrem azurblauen Kleid, auf dem sich weiße Rosen befanden. Die breite Krempe, die sie vor der Sonne schützte, verhinderte gleichzeitig, dass ich ihr nach unten geneigtes Gesicht erkennen konnte. Ihre unverwechselbaren roten Haare, die sie in einer aufwendigen Frisur im Nacken zusammengebunden hatte, leuchteten, als stünden sie in Flammen.
Auch meinen Kopf zierte dieses fuchsrote Haar und ich hatte die gleiche zierliche Gestalt. Trotzdem wirkte ich bei Weitem nicht so fragil wie Mildred Johnson. Vielleicht lag es daran, dass sie zerbrochen war. In dem Moment, als mein Vater verschwand.
Mit einem Frösteln wandte ich mich vom Fenster ab. Obwohl draußen Sommer war, drang die Hitze nicht durch das dicke Gemäuer bis ins Innere. Zu gerne hätte ich die warme Sommerluft hineingelassen, aber das Öffnen des Fensters hätte meine Mutter bemerken können.
Ein wenig schämte ich mich dafür, hier heimlich herumzustöbern, doch das Licht, das durch den Türspalt gefallen war, hatte mich angelockt wie eine Motte. Und vielleicht hoffte ich, hier die Präsenz meines Vaters zu spüren und auf etwas Tröstliches zu stoßen. Etwas, das meine Sehnsucht nach ihm linderte, denn heute war das Gefühl des Alleinseins in mir wieder sehr greifbar.
Ein Sonnenstrahl schien auf das Regal neben der Tür und ich steuerte darauf zu. Im Gehen streifte der Saum meines Kleides über den Boden und wirbelte den Staub auf, der im Licht schimmerte. Ich betrachtete das Durcheinander aus Phiolen und Reagenzgläsern, die dicht gedrängt auf dem Regal standen und in denen sich noch immer die Überreste irgendwelcher Substanzen befanden. Wahllos griff ich nach einem Glasgefäß und wischte mit der Hand den Staub weg, um besser erkennen zu können, was sich darin befand. Es war ein Stück eines Gesteins, schwarz und scharfkantig mit einer unebenen Oberfläche und zahlreichen Vertiefungen. Über manchen Stellen lag ein silbriger Schimmer. Mein Vater hatte versucht, das Universum zu erforschen, und vielleicht war das hier ja ein Stück eines Sterns. Der Gedanke ließ mich lächeln und ich machte mir einen Spaß daraus, in jede der Phiolen zu linsen.
Schließlich griff ich nach einem dunklen bläulichen Glas. Etwas klimperte darin, aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Kurz entschlossen zog ich den Korken heraus und erspähte einen metallischen Gegenstand. Vorsichtig schüttete ich ihn auf meine Handfläche. Er entpuppte sich als ein Schlüssel. Mit angehaltenem Atem betrachtete ich ihn. Die Reide bestand aus drei Halbkreisen, die in ihrer Form an ein Kleeblatt erinnerten. Der Halm wirkte abgegriffen, da an dieser Stelle das Silber besonders matt war, und er mündete in einem kreuzdurchbrochenen Kammbart.
Was hatte der Schlüssel hier verloren und wie lange lag er schon unbeachtet in der Phiole? Und vor allem: Was verschloss er?
Ein Duft von Abenteuer, der versprach, diesem Tag eine Prise Aufregung zu verleihen, lag in der Luft. Mein Blick glitt suchend umher und ich keuchte auf, als ich im Bücherregal zwischen der Fachlektüre meine Ausgabe von Alice im Wunderland entdeckte. Das war mein liebstes Kinderbuch und ich hatte es die letzten Jahre über vergeblich gesucht. Meine Mutter hatte behauptet, es müsse beim Umzug hierher verloren gegangen sein, aber ich war mir sicher gewesen, dass das nicht stimmte.
Voller Freude darüber, diesen Schatz wiedergefunden zu haben, zog ich es heraus. Dabei bemerkte ich, dass dahinter etwas verborgen lag. Ich nahm ein paar weitere Bücher aus dem Regal und stapelte sie neben mir auf dem Boden, bis ich die Holzkiste erreichte. Sie war schlicht, unscheinbar und groß genug, damit ein Foliant hineinpassen würde. Handelte es sich hierbei um ein besonders wertvolles Buch, das Vater versucht hatte, vor Sonnenlicht und Staub zu schützen? Doch etwas irritierte mich. Die Kiste wog zu wenig, um ein so dickes Buch zu beinhalten. Zudem war sie zugesperrt.
Ich erinnerte mich an den Schlüssel in meiner Hand und eine Welle der Neugier erfasste mich, so heiß und brennend wie die Julisonne selbst. Probehalber steckte ich den Schlüssel ins Schloss und er verschwand tatsächlich bis zum Gesenk darin. Mein Herz schlug schneller, als ich ihn nach links drehte und ein leises Klacken ertönte. Mit angehaltenem Atem öffnete ich den Deckel und meine Augen wurden groß, sobald ich den Inhalt erblickte. Gebettet in weichen roten Samt befand sich darin ein Gegenstand, der aussah wie ein Karussell.
Zuerst sprang mir ein aus Holz geschnitzter Hahn mit gespreizten Flügeln ins Auge. Doch es war kein gewöhnlicher, denn sein Körper endete in einem Schlangenschwanz.
Ich holte das merkwürdige Konstrukt aus der Vertiefung und betrachtete es, besah die weiteren Figuren und identifizierte sie allesamt als Fabelwesen, die in ihrer Detailtreue erschreckend lebendig wirkten. Auf einer Drehscheibe befestigt waren besagter Hahn, ein Pegasus, ein geflügelter Hirsch und ein Greif.
Eine Erinnerung blitzte vor meinem inneren Auge auf. Ich hatte das Karussell schon einmal gesehen! Damals, kurz bevor mein Vater verschwand, war ich in sein Arbeitszimmer geplatzt, während er es untersucht hatte. Ich war näher gekommen, weil mich die Fabelwesen auf sonderbare Weise anzogen, aber Vater ließ es sofort in einer Schublade seines Schreibtisches verschwinden. Anschließend erhob er sich von seinem Stuhl und schrie mich an, was mir einfallen würde, ohne anzuklopfen, reinzukommen. Ich hatte nicht verstanden, weshalb er so zornig auf mich war, und war weinend aus dem Arbeitszimmer gerannt.
Nun hielt ich das Karussell in den Händen und diesmal konnte er es mir nicht wegnehmen. Ich betrachtete mein Gesicht in einem der acht winzigen Spiegel, die sich in der Mitte befanden und das Gerüst der Konstruktion bildeten. Wehmütige grüne Augen blickten mir aus einem blassen Gesicht entgegen, auf dem sich zahlreiche Sommersprossen verteilten.
Ich blinzelte und sah mir den Rest des Karussells genauer an. Über den Spiegeln mündete das Gebilde in einem runden, geschwungenen Dach, ähnlich dem eines Zirkuszelts mit schwarzen und weißen Streifen. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Tiere das einzig Farbige waren, weshalb sie umso lebendiger wirkten. Sie spiegelten sich in den kleinen gläsernen Flächen, und es kam mir so vor, als starrten sie mich an. Eine Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus.
Als ich den Greif berührte, merkte ich, dass sich die Scheibe unter ihm bewegte, und erst da begriff ich, was ich wirklich in Händen hielt: eine Spieluhr.
Vorsichtig, um keines der filigranen Fabelwesen zu beschädigen, zog ich sie auf, stellte sie vor mir auf den Boden und beobachtete, wie die Tiere anfingen sich zu drehen. Gleichzeitig füllten zarte Klänge, die mir seltsam vertraut vorkamen, die Stille des Raumes. Die Staubflocken vor dem Fenster schienen im Takt der Melodie zu tanzen, die aus der Spieluhr erklang. Das Licht wurde auf nahezu magische Weise von den kleinen Spiegeln reflektiert, während sich die Scheibe langsam drehte und ein Tier nach dem anderen an mir vorbeizog. Verzaubert betrachtete ich die Spieluhr, lauschte der wunderschönen Musik und eine tiefe Melancholie ergriff von mir Besitz.
Nur einen Wimpernschlag später leuchteten die Spiegel hell auf, als würden sie das zuvor eingefangene Licht bündeln. Diesmal warfen die Fabelwesen, die an mir vorüberzogen, lange dunkle Schatten an die Wand gegenüber. Gruselige, verzerrte Silhouetten ihrer Holzgestalten zeichneten sich ab. Auf einmal wurden Buchstaben sichtbar, die den Anschein erweckten, als wären sie aus Schatten gemalt. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich auf die Botschaft, die sich auf der Wand offenbarte. Buchstabe um Buchstabe und schließlich Zeile um Zeile erschienen. Darunter kreisten noch immer die Schatten der Fabelwesen wie Gespenster, während die zarten Töne der Spieluhr den Raum erfüllten. Stocksteif und mit angehaltenem Atem las ich, was dort stand:
Eine Welt geschmiedet aus Schatten und Licht, der Prinz lädt ein, öffnet seine Tore auch für dich. Komm näher, sei sein Gast, mit den richtigen Worten du Zutritt hast.
Es erwartet dich ein Ort voll Zauber und gefährlicher List, der Gewinner bekommt zurück, was er schmerzlich vermisst.
Die Spieluhr vor mir auf dem Boden hörte gar nicht mehr auf sich zu drehen. Zögerlich näherte ich mich der Wand, berührte mit meinen Fingern die Worte aus Dunkelheit. Die Melodie kam mir nach wie vor vertraut vor und im Zusammenhang mit den Zeilen waren da auf einmal weitere Worte in meinem Kopf.
Doch nur eine einmalige Teilnahme sei dir gewährt, auf ewig gefangen ist, wer wiederkehrt.
Löse die Rätsel und wachse über dich hinaus. Scheiterst du, strecken die Schatten ihre Klauen nach dir aus. Erreiche das Schloss und du kannst wieder heim, doch um zu gewinnen, musst du der Schnellste sein.
Bist du dennoch bereit, es zu wagen?Denn verlierst du, ist die Strafe für dein Versagen: Du wirst ein Teil der Schatten für die Ewigkeit, dein Dasein fristen in Dunkelheit.
Hörst du das Wispern der Schatten?Versuch, nicht in ihre Fallen zu tappen.
Mit dieser Zeile brach meine Erinnerung ab. Ich wusste, da gab es noch mehr, aber ich konnte mich nicht an den Rest des Liedes erinnern. Zu lange war es her, seit ich die Strophen das letzte Mal gehört hatte. Damals war ich noch ein Kind gewesen, nicht älter als zwölf Jahre, und mein Vater hatte es mir öfter vor dem Einschlafen vorgesungen.
Ich grübelte darüber nach und die Gedanken in meinem Kopf kreisten mit dem Karussell um die Wette. Was war eine Welt aus Schatten und Licht? Von welchem Prinzen war die Rede und warum lud er mich ein? Oder war diese Einladung für jemand anderen bestimmt? Doch für wen? Meinen Vater? Was für Worte sollten mir oder ihm Zutritt verschaffen und was hatte die letzte Zeile an der Wand zu bedeuten?
Der Gewinner bekommt zurück, was er schmerzlich vermisst.
Der letzte Ton der Spieluhr verhallte und mit ihm verschwanden sowohl die Schatten der Tiere als auch die Worte. Ein seltsames Knacken durchbrach die Stille. Es klang so, als würde etwas einrasten. Ich drehte mich um und sah, dass sich ein Stück aus dem Boden der Spieluhr leicht hervorgeschoben hatte, wie eine Schublade, die geöffnet worden war.
Mit klopfendem Herzen ging ich zurück und versuchte sie weiter herauszuziehen. Da sie klemmte, brauchte ich einige Anläufe, doch schließlich gelang es mir die Schublade zu öffnen. Eine kleine Papierrolle kam zum Vorschein, es musste also ein Geheimfach sein. Mit angehaltenem Atem angelte ich sie mit zwei Fingern heraus und entrollte sie. Als mein Blick auf die Handschrift fiel, taumelte ich vor Schreck einen Schritt zurück. Dabei stolperte ich über das Holzkästchen und landete unsanft auf dem Boden. Ungläubig blinzelnd starrte ich auf das Papier, denn die Schrift war die meines Vaters. Sie ausgerechnet hier wiederzusehen, war befremdlich, aber noch viel merkwürdiger war das, was er geschrieben hatte.
Erinnere dich an die gesungenen Worte und sie werden dir einen Ort offenbaren, dessen Schönheit und Magie deine kühnsten Vorstellungen übertrifft. Doch lass dich davon nicht verzaubern, bewahre dir stattdessen deinen kühlen Verstand. Freund oder Feind, Schatten oder Licht sind oft nicht so leicht voneinander zu unterscheiden.
Mit den gesungenen Worten musste das Lied gemeint sein, das mir schon von selbst in den Sinn gekommen war, nur verstand ich nicht, weshalb die Erinnerung daran wichtig sein sollte. Wie konnte mir ein simples Lied eine ganze Welt offenbaren? Das alles ergab überhaupt keinen Sinn. Warum nur hatte mein Vater sich die Mühe gemacht, einen solch undurchsichtigen Text so sorgsam zu verstecken?
Noch dazu in dieser merkwürdigen Spieluhr. Zumindest wusste ich nun, dass die Einladung offenbar doch mir galt. Aber wollte ich überhaupt der Gast dieses Prinzen sein?
Und noch etwas ließ mich stutzig werden: Auch hier war die Rede von Schatten und Licht, genau wie bei der Projektion der Spieluhr, die von einer Welt geschmiedet aus Schatten und Licht erzählt hatte.
Konnte es sein, dass sich mein Vater auf ebendiese Welt bezog? Aber das würde ja bedeuten, dass so ein Ort tatsächlich existierte …
Ich warf aus dem Augenwinkel einen Blick auf die Spieluhr und hoffte, sie würde mir noch mehr verraten, doch sie war wieder in ihre alte Starre verfallen. Wie eine harmlose Spielzeugfigur blickte mich der geflügelte Hirsch an und dennoch befiel mich ein eigenartiges Schaudern.
Was war hier eben passiert?
Ich zog die Spieluhr ein weiteres Mal auf, wieder erklang die Melodie und abermals drehte sich das Karussell, aber die Schatten blieben aus. Die Botschaft erschien kein zweites Mal. Sehr merkwürdig.
Nachdem das Lied verklungen war, zog ich sie erneut auf und dann noch einmal. Doch stets verhielt sie sich wie eine gewöhnliche Spieluhr. Kein weiteres Geheimfach öffnete sich und auch sonst geschah nichts.
Allmählich begann ich, an meinem Verstand zu zweifeln. Hatte ich eben wirklich die aus Schatten gemalte Botschaft eines Prinzen als Projektion an der Wand gelesen? Oder war ich so in die Melodie und die Erinnerungen an meinen Vater eingetaucht, dass ich es mir nur eingebildet hatte? Allerdings hielt ich immer noch den Zettel in meiner Hand …
»Elena?«
Die entfernte Stimme meiner Mutter drang an mein Ohr. Hastig rappelte ich mich auf, steckte den Zettel in eine Tasche meines Kleides, verstaute die Spieluhr in dem Holzkästchen, stellte es ins Regal und die Bücher davor. Dann warf ich den Schlüssel in die Phiole, schlich mich auf den Gang und zog leise die Tür hinter mir zu.
»Elena? Wo treibst du dich wieder herum?« Inzwischen klang meine Mutter ungeduldig.
»Ich komme schon!«, rief ich und eilte die breite Treppe hinunter.
»Wo warst du denn? Ich habe bestimmt fünf Mal nach dir gerufen.« Mutter zog die Augenbrauen vorwurfsvoll in die Höhe.
»Ich war im Badezimmer«, log ich und hoffte, dass ihr die verräterischen Staubspuren auf meinem Kleid entgehen würden.
Doch sie sah bereits woandershin. »Ist er nicht schön?«, fragte sie mit einem schwärmerischen Ausdruck im Gesicht.
Ich folgte ihrem Blick zur Holzkommode, auf der sich in einer Glasvase ein Strauß Sommerblumen befand. Schon wieder ein Strauß. Ihre gesamte Welt drehte sich nur um ihre Pflanzen.
»Wirklich sehr schön«, rang ich mir ab und versuchte mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Weswegen wolltest du mich sprechen?«
Sie wandte sich wieder mir zu. Der Blick aus ihren braunen Augen war voller Wärme. »Ich reise morgen für ein paar Tage mit der Kutsche nach London. Du erinnerst dich? Ich wollte vor meiner Abreise noch ein wenig Zeit mit meiner Tochter verbringen. Lass uns einen Spaziergang machen.«
Mutter war zu einem Empfang in der Hauptstadt geladen worden, wie mir jetzt wieder einfiel. Da sie wusste, wie wenig ich von derlei steifen Veranstaltungen hielt, hatte sie diesmal glücklicherweise nicht darauf bestanden, dass ich sie begleitete. Nach Vaters Verschwinden hatte sie sich nur schwer von mir trennen können und mich möglichst immer bei sich haben wollen, wo sie mich in Sicherheit wusste.
»Natürlich. Ich hole nur eben meinen Hut.« Ich stürmte wenig damenhaft die Stufen hinauf und in mein Zimmer, froh um die Gelegenheit, den Staub von meinen Röcken klopfen zu können.
Eilig suchte ich einen passenden Hut zu dem pastellfarbenen Kleid, das ich trug. Meine fuchsroten Haare hatte ich zu einem komplizierten Zopf geflochten, der sich perfekt als Hutfrisur eignete.
Wenig später fuhren wir mit der Kutsche nach Oxford. Auf dem Weg dorthin dachte ich daran, wie oft ich bereits mit meiner Mutter den botanischen Garten besucht hatte, da dieser Ort sie faszinierte. Doch heute war dies nicht unser Ziel, sondern der nahe der Universität gelegene Park, wo wir gemeinsam mit den anderen Herrschaften am River Cherwell entlangflanierten. Neben den vielen Studenten, die von ihren Vorlesungen Erholung im Grünen suchten, kamen uns Männer in Gehrock mit Zylinder und Spazierstock entgegen. Ein paar von ihnen pafften Zigarren. Ihre Frauen, in hochgeschlossenen Kleidern mit prächtigen Hüten und kunstvollen Sonnenschirmen, hatten sie untergehakt.
»London ist grässlich. All der Trubel, Schmutz und Gestank. Ich bin froh, wenn ich wieder zurück bin«, sagte Mutter.
Ich konnte sie verstehen. Für jemanden, der seinen Garten und die Ruhe dort so sehr liebte wie sie, war London kein geeigneter Ort.
»Es ist ja nicht für lange«, tröstete ich sie. »Und ich werde gut auf deinen Garten achtgeben.«
»Danke, Kind.« Sie stieß einen langgezogenen Seufzer aus.
Seit Vater verschwunden war, schienen ihre Tage nur noch aus Seufzern zu bestehen. Sie tat mir leid, wie sie so in sich gekehrt und von Traurigkeit zerfressen war, und doch konnte ich ihr nicht helfen. Auch ich konnte meinen Vater nicht wieder herbeizaubern, ganz egal, wie sehr ich ihn vermisste.
An einem blühenden Rosenbusch hielt Mutter inne und roch an einer rosafarbenen Blüte. Dabei schloss sie die Augen, und während sie den Duft einatmete, nahm ihr Gesicht einen friedlichen Ausdruck an. Ein heftiger Stich durchzuckte mich, als mir einmal mehr klar wurde, dass nur die Blumen ihr Trost zu spenden vermochten. Nicht jedoch ich. Die Erkenntnis, dass ich nicht genug war, tat weh. Obwohl sie stets bemüht war, sich vor mir zusammenzureißen, weil sie wusste, dass auch ich unter Vaters Verschwinden litt, reichte das nicht. Sie hätte für mich da sein sollen. Ich hätte sie gebraucht. Ich war das Kind und sie die Mutter. Doch sie war nur für ihre Pflanzen da. Und nun wusste ich auch, was dieser schmerzhafte Stich war: Eifersucht. Ich war eifersüchtig auf ihre geliebten Blumen.
Schweigend setzten wir unseren Spaziergang fort, schlenderten im Schatten mächtiger Eichen und Kastanien vorbei an perfekt getrimmten Büschen und gepflegten Blumenbeeten. Der Anblick machte mich wütend und traurig zugleich. Es ging immer nur darum, den Anschein zu wahren. Alles perfekt aussehen zu lassen. Auch wir beide wirkten wie ein glückliches Mutter-Tochter-Gespann. Doch die Realität konnte nicht weiter davon entfernt sein.
Abends saß ich auf dem ausgepolsterten Fenstererker in meinem Zimmer, den Zettel mit der Botschaft meines Vaters in der Hand, und starrte zum Sternenhimmel hinauf. Wenn mir nur der Rest des Liedes wieder einfallen würde! Ich summte die Melodie aus der Spieluhr, doch wieder stockten meine Gedanken an derselben Stelle. Ich kam einfach nicht darauf, wie der Reim weiterging.
Ich schloss die Augen und stellte mir vor, ich sei wieder zwölf Jahre alt. Mit einem Buch lag ich im Bett, als mein Vater hereinkam.
»Du bist ja immer noch wach«, sagte er, setzte sich neben mich auf die Bettkante und strich mir über das Haar. »Aber das ist gut, da ich dir etwas sagen muss.«
»Was denn?« Ich blickte ihn aus großen Augen an.
»Elena, hör jetzt gut zu«, sagte er – und allein daran, dass er mich Elena anstelle Elly nannte, merkte ich, wie ernst es ihm damit war. »Das Lied, es könnte einmal wichtig werden. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber es fühlt sich richtig an, es dir vorzusingen.«
»Wie meinst du das?« Ich blickte ihn verständnislos an.
»Das kann ich dir nicht sagen, mein kleiner Wildfang. Pass gut auf, ich singe es dir einmal vor.«
Er stimmte ein Lied mit einer mir unbekannten Melodie an.
»Hast du dir alles gemerkt?«, fragte er anschließend und sein Lächeln war seltsam sanft und angespannt zugleich.
Ich kuschelte mich in seine Arme. »Ich mag es nicht. Es klingt gruselig.«
»Das ist es, aber es ist auch unglaublich schön«, erwiderte er und strich mir über den Kopf.
Als ich aufschaute, bemerkte ich, dass sein Blick in unbestimmte Ferne gerichtet war, als wäre er mit den Gedanken woanders.
Anschließend hatte er mir das Lied noch mehrmals vorgesungen. Ein ungutes Gefühl beschlich mich, sobald ich aus der Erinnerung auftauchte. Hatte sich das nicht nur wenige Wochen vor Vaters Verschwinden ereignet? Und obwohl ich die Szene genau vor Augen hatte, geriet meine Erinnerung immer an derselben Stelle ins Stocken.
Es dauerte lange, bis meine Gedanken sich beruhigten. Die Schatten von geflügelten Wesen schienen um mich zu kreisen und ich meinte zu spüren, wie mich eines davon streifte. Wie der Hauch einer Feder auf meiner Haut. Ich erschauderte.
Sonnenstrahlen kitzelten meine Nase. Ich lag mit im Nacken verschränkten Armen und geschlossenen Augen im Gras unter dem großen Apfelbaum. Etwas, das ich nur tun konnte, wenn meine Mutter nicht da war. Sie würde es nicht gutheißen, wie ich hier im Halbschatten lag und die Blässe meines Porzellanteints gefährdete.
Das Kitzeln nahm zu und ich rümpfte die Nase. Wahrscheinlich ein Käfer. Ich wischte mir über die Nasenspitze, doch es hörte nicht auf.
Ich blinzelte und blickte in ein mir nur allzu vertrautes Gesicht. »Mensch, Jim, was soll das? Musst du nicht arbeiten?« Genervt riss ich ihm den Grashalm aus der Hand und richtete mich auf.
Jim hockte unbeeindruckt neben mir im Rasen, ein freches Grinsen auf seinem Gesicht, und ich konnte nicht anders, als zurückzugrinsen. Er war der beste und gleichzeitig einzige Freund, den ich hatte. Er half seiner Mutter, die für uns kochte, oft in der Küche aus, weshalb wir nie genug Zeit füreinander hatten.
»Ist nicht viel zu tun heute, weil Mrs Johnson nicht da ist.« Jim legte sich – wie ich zuvor die Arme im Nacken verschränkt – neben mich auf die Wiese.
Natürlich, wenn meine Mutter nicht da war, gab es auch keine Abendessen, zu der sie die feine Gesellschaft einlud. Wir empfingen zwar nicht täglich Gäste, aber oft genug. Manchmal glaubte ich, meine Mutter versuchte, durch solche Besuche die Leere in ihrem Herzen zu füllen und die Stille im Haus zu vertreiben. Doch auch das lenkte sie nur kurzzeitig ab, bis sie wieder mit sich und ihren Gedanken allein war. Auch die Empfänge waren nur Schein. Es schien paradox: Je mehr sie das Licht suchte, desto schwieriger wurde es für sie. So, wie auch in der prallen Sonne die Schatten immer am härtesten waren.
Auch ich legte mich wieder hin, fühlte das weiche Gras unter meinem Rücken, und gemeinsam starrten Jim und ich hinauf zu den kleinen grünen Äpfeln über unseren Köpfen.
Wieder kreisten meine Gedanken um die Spieluhr und die Einladung in die verheißungsvolle Welt aus Schatten und Licht. Wenn ich nur wüsste, was das alles zu bedeuten hatte. Ob ich Jim von meiner Entdeckung erzählen sollte?
»Du bist so nachdenklich.« Jim stupste mich mit dem Ellbogen in die Seite. »Was ist los, Elly?«
Ich drehte den Kopf und betrachtete meinen besten Freund. Obwohl er wie ich sechzehn Jahre alt war, konnte Jim genauso gut als groß gewachsener Vierzehnjähriger durchgehen. Er war dünn und schlaksig und füllte kaum seine Kleidung aus. Die dunkelbraune Hose saß viel zu locker, dazu trug er passende Hosenträger über einem weißen Leinenhemd, das ihm ebenfalls zu groß war.
»Nichts, gar nichts«, erwiderte ich, konnte ihm aber deutlich ansehen, dass er mir nicht glaubte.
»Du kannst mir alles erzählen, das weißt du doch, Elly.«
Ich seufzte leise. »Es ist nur … Gestern, also da habe ich etwas gefunden.«
Jim sah mich aus seinen braunen Augen abwartend an.
»Von meinem Vater«, fügte ich hinzu und presste die Lippen zu einem Strich zusammen.
»Deinem Vater? Was war es?« Jim klang aufgeregt, was mir ein winziges Lächeln entlockte.
Er rollte sich zur Seite und stützte seinen Kopf mit einer Hand ab, während er mich aufmerksam musterte.
»Es war ein Zettel, auf dem stand: Erinnere dich an die gesungenen Worte.« Den restlichen Text, und was sich davor zugetragen hatte, behielt ich lieber für mich. Jim würde meinen Vater nur für verrückt erklären. Ein verschrobener Forscher, der an die Existenz einer Welt aus Schatten und Licht glaubte. Und das war er auf gar keinen Fall, oder? Ich war mir sicher, der Spieluhr haftete ein Hauch von Magie an, den ich mir nicht erklären konnte. Allein die Worte, die sich an der Wand geformt hatten, waren mir äußerst suspekt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie nur eine Illusion gewesen waren oder etwas, das sich durch einen mechanischen Trick erklären ließ. Dafür hatten sie zu echt gewirkt.
Ich beobachtete das Schattenspiel der Blätter in den Bäumen, als eine sanfte Brise hindurchfuhr und merkwürdige Formen entstehen ließ. Vielleicht lag ich auch falsch und für all das gab es eine nüchterne wissenschaftliche Erklärung. Möglicherweise war das Spiel aus Schatten und Licht nichts anderes als das, was da eben in den Bäumen vor sich ging. Ein Sonnenstrahl, der auf Wasser traf und in Regenbogenfarben reflektiert wurde; Schatten, mit denen man eine Geschichte erzählen konnte wie in einem Schattentheater. Es gab viele Möglichkeiten.
»Seitdem ich das gelesen habe, überlege ich, was damit gemeint sein könnte«, teilte ich einen weiteren Gedanken mit meinem besten Freund.
»Wo hast du ihn denn gefunden?« Jims Augenbrauen schoben sich kaum merklich zusammen, während er sich eine Strähne seines braunen Haars aus der Stirn strich.
»Versteckt in seinem Arbeitszimmer«, gab ich mit leichtem Widerwillen zu. Nach all den Jahren war ich auf eine Spur von meinem Vater gestoßen und nun fühlte es sich falsch an, Jim von der Spieluhr zu erzählen. Als wäre sie ein Geheimnis zwischen mir und meinem Vater, das nur wir beide teilten und das mich mit ihm verband. Würde ich Jim gänzlich einweihen, könnte das unweigerlich dieses Gefühl zerstören.
»Vielleicht wollte er mir etwas damit sagen. Nur welche gesungenen Worte könnte er meinen?«
»Und woher willst du wissen, dass die Nachricht für dich bestimmt war? Vielleicht war es ja nur eine Notiz an ihn selbst. Stand sonst noch etwas darauf? Dein Name etwa?«
»Nein.« Ich presste die Lippen zusammen. Etwas sagte mir, dass mein Vater die handgeschriebene Botschaft nicht ohne Grund so sorgsam versteckt hatte, und Jim davon erzählt zu haben, erschien mir falsch. »Vergiss es. War nur so ein Gefühl«, murmelte ich deshalb.
»Ein Gefühl?« Um seinen Mund bildete sich ein spöttischer Zug. »Du hast den Verstand vergessen, meine liebe Elly.«
»Jim!« Ich lachte auf und schlug ihm spielerisch auf den Oberarm. »Woher weißt du, dass ich Verstand und Gefühl gerade wieder lese?«
»Liest du nicht immer Jane Austen?«, fragte er mit einem frechen Grinsen.
»Gar nicht wahr!«, widersprach ich vehement, musste dabei allerdings noch lauter lachen. »Gelegentlich lese ich auch Bücher von Charlotte Brontë. Aber Verstand und Gefühl ist nun mal mein liebstes Werk, schließlich hast du es mir geschenkt. Vor drei Jahren, weißt du noch?«
»Natürlich, wie könnte ich das vergessen? Drei Jahre ist das schon her. Unglaublich. Die Zeit, sie rinnt, nicht wahr?«
Ich erstarrte. »Was hast du da eben gesagt?«
»Drei Jahre …«
»Nicht das«, unterbrach ich ihn. »Das andere.«
»Du meinst, dass die Zeit rinnt?« Jim warf mir einen irritierten Blick zu und runzelte die Stirn.
Ich hielt den Atem an, als mir endlich der Rest des Liedes wieder einfiel, der mir schon die ganze Zeit über auf der Zunge gelegen hatte. »Nun ist es so weit, das Spiel beginnt, doch achte auf den Sand, denn die Zeit, sie rinnt«, flüsterte ich.
»Wie bitte?« Er beugte sich über mich und sah mich mit einem Ausdruck an, als mache er sich ernsthafte Sorgen um meinen Geisteszustand.
»Natürlich!« Ich richtete mich ruckartig auf, nur um gleich darauf auf die Beine zu springen. »Jim, du bist ein Genie! Ich danke dir.«
Ich wandte mich ab und lief zum Haus zurück.
»Elly, nun warte doch!« Jim kam hinter mir her und hatte mich aufgrund seiner langen Beine bald eingeholt.
»Geht nicht«, brachte ich keuchend hervor, während ich weiter über den perfekt getrimmten Rasen hastete. »Ich habe noch etwas zu erledigen. Aber morgen können wir uns wiedersehen und gemeinsam Kirschen von den Obstbäumen pflücken.« Mit diesen Worten verabschiedete ich mich von Jim. Solange meine Mutter nicht wieder zurück war, konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Sogar auf Bäume klettern und mir den Bauch mit den süßen roten Früchten vollschlagen, ohne Gefahr zu laufen, eine Rüge dafür zu ernten.
Ich raffte meine Röcke, um noch ein wenig schneller rennen zu können. Vor mir ragte die prächtige Sandsteinfassade des Herrenhauses auf. Zahlreiche Erker verliehen dem Gebäude eine schwungvolle Form, genau wie die vielen Schornsteine am Dach. Runde Ummauerungen über den Fenstern im Erdgeschoss sowie kunstvoll aus Stein gemeißelte Verzierungen oberhalb der Erkerfenster ließen erkennen, dass die Bewohner wohlhabend waren. Normalerweise schenkte ich all dem mehr Beachtung, vor allem, weil es für mich ganz und gar kein gewöhnlicher Anblick war. Obwohl wir seit beinahe fünf Jahren hier wohnten, vergaß ich nicht, in welch bescheidenem Heim wir vorher gelebt hatten.
Im Haus stürzte ich durch die langen Gänge, die Treppe hinauf in den ersten Stock, stieß die Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters auf und ließ mich vor dem Bücherregal auf die staubigen Dielen fallen, wo ich um Atem rang. Dann riss ich die Bücher heraus, verteilte sie achtlos auf dem Boden, bis ich das Holzkästchen in den Händen hielt. Schnell holte ich den Schlüssel aus der Phiole und sperrte auf.
Durch Jims Bemerkung wusste ich endlich wieder, wie der vollständige Text lautete.
Nachdenklich wiegte ich die Spieluhr in meinen Händen. Die richtigen Worte würden mir Zutritt verschaffen, das zumindest hatte gestern als Schattenprojektion an der Wand gestanden. Nur Zutritt wozu? Der Welt aus Schatten und Licht? Ob mit den richtigen Worten der Schluss des Liedes gemeint war, der – wie ich jetzt wieder wusste – einen dazu aufforderte, den letzten Satz laut auszusprechen?
Mit klopfendem Herzen zog ich die Spieluhr auf und stellte sie vor mir auf dem Boden ab. Die ersten Klänge ertönten und ich begann zu singen:
Eine Welt geschmiedet aus Schatten und Licht,
der Prinz lädt ein, öffnet seine Tore auch für dich.
Komm näher, sei sein Gast,
mit den richtigen Worten du Zutritt hast.
Es erwartet dich ein Ort voll Zauber und gefährlicher List,
der Gewinner bekommt zurück, was er schmerzlich vermisst.
Doch nur eine einmalige Teilnahme sei dir gewährt,
auf ewig gefangen ist, wer wiederkehrt.
Löse die Rätsel und wachse über dich hinaus.
Scheiterst du, strecken die Schatten ihre Klauen nach dir aus.
Erreiche das Schloss und du kannst wieder heim,
doch um zu gewinnen, musst du der Schnellste sein.
Bist du dennoch bereit, es zu wagen?
Denn verlierst du, ist die Strafe für dein Versagen:
Du wirst ein Teil der Schatten für die Ewigkeit,
dein Dasein fristen in Dunkelheit.
Hörst du das Wispern der Schatten?
Versuch, nicht in ihre Fallen zu tappen.
Nun ist es so weit, das Spiel beginnt,
doch achte auf den Sand, denn die Zeit, sie rinnt.
Der Prinz persönlich fordert dich heraus,
nun sprich die folgenden Worte laut aus:
Ich akzeptiere die Regeln des Spiels, drum lass mich hinein;
mein Schicksal sollen fortan Schatten und Licht sein.
Nachdem das letzte Wort meinen Mund verlassen hatte, begann das Karussell sich schneller und immer schneller zu drehen. Die Fabelwesen verschwammen vor meinen Augen zu einer wirbelnden Masse aus Formen und Farben und das Zentrum mit den Spiegeln leuchtete so grell auf, dass ich den Blick abwenden musste. Helligkeit breitete sich aus, erfasste mich, und obwohl alles um mich herum aus purem Licht bestand, spürte ich instinktiv, dass dahinter die Dunkelheit lauerte.
Ich kniff geblendet die Augen zusammen. Etwas zog an mir, riss mich in einen Strudel, und ich hatte das Gefühl, mich genauso schnell zu drehen wie das Karussell, das ich längst nicht mehr sah. Um mich herum existierten nur noch Licht und Schatten, Schwarz und Weiß.
Schnell verlor ich die Orientierung, wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Alles drehte sich. Die Welt löste sich auf und ich fühlte mich seltsam schwerelos. Ich hätte nicht sagen können, ob ich nach unten fiel oder nach oben flog.
Furcht ergriff von mir Besitz und mein Herz raste. Ich konnte nicht atmen. Was geschah mit mir? Ich wollte aufstehen und das Arbeitszimmer meines Vaters verlassen, aber meine Muskeln gehorchten mir nicht länger. Keinen Finger konnte ich rühren. Die sich ausbreitende Finsternis verschluckte das Licht. Alles um mich herum wurde schwarz.
Und ich fiel weiter und immer weiter, bis ich auf einmal auf etwas Weichem, Unebenem saß, das nicht länger der Boden des Arbeitszimmers war.
Einen Wimpernschlag später wich die Nacht dem Tag und ich wünschte mir augenblicklich die Finsternis zurück, denn das, worauf ich saß, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren.
Die Welt aus Schatten und Licht
Alex
Unzählige Schatten zeichneten sich durch meine geschlossenen Augenlider ab und glitten in einem unsteten Rhythmus über mein Gesicht. Mein Atem ging schnell und wandelte sich in ein schweres Keuchen, das mich aus der bleiernen Ohnmacht riss. Angst durchflutete mich, doch ich wusste nicht, wovor genau ich mich fürchtete. Meine Finger zuckten, während mein Körper langsam wacher wurde und die lauten Umgebungsgeräusche zu mir durchdrangen. Da waren Gesprächsfetzen, Gelächter und eine helle Melodie, die von einer Drehorgel stammte.
Blinzelnd gewann ich den Kampf gegen die Dunkelheit und erblickte kurz darauf Kleidersäume sowie Hosenbeine. Sie passierten mich in einer nicht enden wollenden Flut. Ich spürte den harten Boden unter mir und lauschte dem Lied der Drehorgel, das mir irgendwie bekannt vorkam.
»Hörst du das Wispern der Schatten? Versuch, nicht in ihre Fallen zu tappen«, erklang der Gesang eines kleinen Mädchens.
Die Menge kümmerte sich nicht weiter um mich, auch nicht, als ich schwerfällig aufstand. Kurz hielt ich inne, weil mich Schwindel erfasste. Sobald sich die Welt um mich herum nicht länger drehte, sah ich mich um. Vor mir erstreckte sich ein Meer aus befremdlichen Masken, die meinen Puls weiter zum Rasen brachten, ehe mein Geist verstand, dass mir von ihnen keine Gefahr drohte. Sie waren Teil von Verkleidungen, in die sich die Passanten hüllten. Ihre Maskeraden waren allesamt Tieren nachempfunden. Seltsam. Reflexartig griff ich an mein Gesicht, aber wie erwartet war da nur bloße Haut unter meinen Fingerkuppen. Keine Maske. Ich rieb mir die Schläfen und versuchte angestrengt, mich an etwas zu erinnern. Wo bin ich? Wieso bin ich hier? Ein dunkler und dichter Nebel umhüllte die Bilder aus meiner Kindheit, meiner Jugend und den letzten Stunden, bevor ich wieder zu mir gekommen war. Ich fühlte mich verloren und ahnte, nicht nur wegen meiner fehlenden Kostümierung, dass ich nicht hierhergehörte.
Ein Schweißfilm bildete sich auf meiner Stirn, während ich tiefer in meinem Verstand grub. Da musste doch etwas sein. Irgendetwas! Entschlossenheit wurde zu Verbissenheit. Ich war nah dran, das spürte ich. Ein stechender Schmerz durchzuckte meine Schläfe, der umso schlimmer wurde, je mehr ich mich bemühte. Er verschlug mir den Atem und ich bekam keine Luft mehr. Das Gefühl steigerte sich noch, als ich mir der Vielzahl der Anwesenden, die mich umgaben, bewusst wurde. Meine Instinkte übernahmen die Kontrolle. Wie von selbst setzten sich meine Beine in Bewegung und ich kämpfte mich durch den Trubel.
Erst als ich mich mit dem Rücken gegen eine Hauswand gepresst am Rand des Platzes befand, kam ich wieder zu mir. Mein Blick schweifte ruhelos umher, glitt über bunt geschmückte Stände und kostümierte Händler, die mit lauten Ausrufen ihre außergewöhnlichen Spezialitäten feilboten. Anscheinend war das hier ein Jahrmarkt. Verkäufer jonglierten mit kandierten Äpfeln, ließen Zuckerwattekugeln in den Himmel aufsteigen, als seien sie schwerelos, oder karamellisierten Nüsse mit einer Flamme, die hell wie die Sonne leuchtete. Meine Augen wurden automatisch von diesem Spektakel angezogen, jedoch besann ich mich wieder. Nicht mal an meinen Namen kann ich mich erinnern …
Es musste einen Grund geben, warum ich hier war. Vielleicht fand ich mehr über mich heraus, wenn ich diesen Ort besser kennenlernte, oder jemand erkannte mich. Das war die einzige Hoffnung, die ich hatte.
Ich wollte mich gerade in Bewegung setzen und zu den Ständen laufen, als eine eindringliche Stimme vom Wind zu mir getragen wurde. »Horcht gut zu. Das, was ich euch heute erzähle, ist so dunkel wie die Schatten selbst«, sagte sie und hob sich deutlich vom Lärm des Platzes ab. Etwas an ihr zog mich an und ich folgte ihr. Kurz darauf trat ich in eine Gasse, in der eine Traube Schaulustiger sich vor einem außergewöhnlichen Schattenspiel versammelt hatte und den Worten eines Mannes lauschte, dessen Antlitz unter einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze verborgen war. Nur ein paar graue Haare lugten daraus hervor.
»Ein Junge wurde geboren, der das Familienglück des Königs und der Königin vollkommen machte.« Die Art, wie der Geschichtenerzähler sprach, inbrünstig und voller Gefühl, weckte meine Neugier.
Passend zu seinen Worten veränderte sich das Schattenspiel, das hinter einem großen rahmenlosen Fenster aufgeführt wurde. Verschiedene Schichten eines durchscheinenden weißen Stoffes waren übereinanderdrapiert und ergaben den Eindruck, als könne man diese Welt betreten. Ein goldenes Licht ermöglichte es, die Silhouetten des Hintergrundes und der im Vordergrund stehenden Figuren besser zu erkennen. Je länger ich mir dieses Schauspiel ansah, desto mehr wurde mir bewusst, dass es sich um eine Tragödie handelte, die das Gefühl, verloren zu sein, in mir verstärkte. Der Mann sprach von einem von Trauer zerfressenen König, der den Verrat seiner Frau nicht verkraften konnte. Von einem Kind namens Henry, das ohne Liebe aufwuchs. Als Figuren von düsteren Schattenwesen die Familie heimsuchten und die Attraktion beherrschten, färbte sich der Stoff schwarz. Die Farbe erinnerte mich an den dunklen Nebel, der in meinem Verstand herrschte. Schlagartig wurde ich zurück ins Hier und Jetzt katapultiert und ich riss mich von der Inszenierung los.
Mit wild klopfendem Herzen trat ich aus der Gasse heraus, fest entschlossen, endlich Antworten zu finden. Eine hochgewachsene Frau kam mir entgegen. Mit ihrem imposanten Hut, auf dem ein bunter Vogel thronte, stach sie geradezu aus der Menge der Passanten heraus.
»Verzeihung«, sprach ich sie an und stellte mich ihr in den Weg. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen?«
Ihr Blick war genervt und sie musterte mich von oben herab. Ich war versucht, meinen Mund missbilligend zu verziehen, entschied aber, ihr stattdessen ein höfliches Lächeln zu schenken. Mein Blick fiel auf den ausgestopften, sonderbaren Vogel. Er war so groß wie meine Hand und saß auf einem Zweig, der in ein künstliches Blumenarrangement eingebunden war. Sein Gefieder war grün, bis auf den gelben Federkranz um seinen Hals und die roten Flügelspitzen. Die Frau gab einen tadelnden Laut von sich, den ich als Zustimmung interpretierte.
»Was ist das hier für ein Ort?«, fragte ich und nickte zu den Marktständen im Zentrum der umgebenden Häuser.
Plötzlich machte der Vogel die kugelrunden Augen auf und ich zuckte erschrocken zusammen.
»Das Spiel beginnt«, drangen krächzende Worte aus seinem tintenblauen Schnabel.
Ich brachte nur ein überraschtes »Wie bitte?« heraus.
Die Frau lachte auf. Sie amüsierte sich köstlich über meine Reaktion. Das kratzte an meinem Ego, aber nun wirkte sie offener und freundlicher. »Bitte entschuldige meinen Vogel. Er weiß zwar, wovon er spricht, aber deswegen heißt das noch lange nicht, dass du es verstehst. Du bist einer der Spieler, richtig?«
Sie winkte ab, als ich die Augen irritiert zusammenkniff. »Natürlich bist du einer von ihnen. Das erkenne ich an deiner fehlenden Verkleidung.«
Der Vogel breitete die Flügel aus und begann sie schnell auf und ab zu schlagen. »Ein Spieler, ein Spieler …«, wiederholte er aufgeregt.
»Ach, gib Ruhe«, sagte die Frau und tatsächlich verstummte er. »Wir sind auf dem Jahrmarkt, Mensch.«
Die Abfälligkeit, mit der sie das Wort Mensch aussprach, löste etwas in mir aus. Aus einem Impuls heraus wollte ich mich verteidigen. Aber kein Ton kam aus meinem Mund. Stattdessen spürte ich wieder dieses unerträgliche Pochen.
»Dass wir auf einem Jahrmarkt sind, sehe ich selbst.« Mein Ton war forsch, ich verlor die Geduld. »Aber wo? In welchem Land?«
Sie lachte über meine Frage, als hätte ich einen Scherz gemacht. »Du weißt ja wirklich gar nichts. Wir befinden uns im Spiel des Schattenprinzen und wir sind seine Figuren.«
Meine Stirn legte sich in Falten. Figuren? Was für eine merkwürdige Wortwahl. Mein Verstand versuchte, irgendeinen Sinn darin zu finden, aber er ließ mich wieder einmal im Stich.
»Wenn ich ein Spieler bin, dann sind Sie …?«
»Eine Figur. Jedes Wesen, dem du hier begegnest, ist Teil des Spiels.«
Meine Gedanken fingen an zu kreisen.
Menschen, Spieler, Wesen, Figuren, wiederholte ich im Stillen.
»Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss zu meinem Sohn. Er kann nur schwer der Zuckerwatte widerstehen und seine Faxen sind unerträglich, wenn er sie gegessen hat. Er benimmt sich dann immer, als hätte er Watte im Kopf.«
Ich hörte sie kaum, denn in meinem Verstand drehten sich die Gedanken immer schneller und vermischten sich mit weiteren Fragen. Ich war verwirrter als zuvor. Das Chaos in meinem Kopf noch größer. Trotzdem bedankte ich mich.
Sie wandte sich zum Gehen, hielt jedoch inne. Ihre Augen verrieten, dass sie mit sich rang. »Lass mich dir noch einen Rat geben. Du solltest besser die Finger von dem angebotenen Essen lassen, denn es hat merkwürdige Eigenschaften. Nur die Nüsse kannst du ohne Risiko verzehren«, meinte sie und eilte davon. Unwillkürlich ballten sich meine Hände zu Fäusten, während ich ihr nachsah. Spieler, höhnte ich in Gedanken. Wahrscheinlich war es ein Spiel für sie, mich für dumm zu verkaufen.
Noch einmal versuchte ich mit aller Kraft, mich daran zu erinnern, wie ich hier gelandet war. Immer tiefer versank ich in dem dunklen Dunst, der meine Erinnerungen umhüllte, tat alles, um ihn wegzuschieben. Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn, während ich meine Anstrengungen erhöhte. Es half alles nichts. Der Nebel war undurchdringlich. Ein frustriertes Schnauben entwich mir, wobei meine Augen suchend umherflogen. Genau genommen war ich auf der Suche nach mir selbst. Ein bitteres Lachen drang aus meiner Kehle, weil es so absurd war. Gleich darauf blieb es mir im Hals stecken, als ich in eine hässliche Fratze blickte. Nein, diesmal handelte es sich nicht um eine Maske. Vielmehr war es ein mit schwarzen Federn bedecktes Gesicht, und zwar … am Hinterkopf. Plötzlich drehte sich das Wesen um. Ich sah wunderschöne blaue Augen, sinnliche Lippen und ein Stupsnäschen. Es war ein Mädchen … mit zwei Gesichtern!
Und in diesem Moment taxierte es mich. Vor Schreck taumelte ich zurück, tauchte rückwärts in die Masse der Leute ein und ließ mich von ihr treiben, bis ich das Mädchen nicht mehr sah.
»Du siehst verloren aus. Und allein«, sprach mich ein Verkäufer an, als ich an den Ständen vorbeilief.
Überrascht hielt ich inne.
»Ich glaube, deine Freunde sind hier.« Die Augenpartie des Mannes wurde von einer schwarzen Maske mit roten Punkten verdeckt und ein merkwürdig geschnittener roter Umhang lag auf seinen Schultern.
Hoffnung regte sich in mir. Könnte er tatsächlich Freunde von mir kennen? Erkannte er mich?
»Wo sind sie?«, wollte ich wissen, während ich mich in dem Trubel aus Leuten umsah.
Der Mann streckte mir ein Glas voller Käfer entgegen. Fühler, rote Panzer und unzählige Beine tummelten sich in dem Behältnis. »Hier.« Er tippte mit dem Zeigefinger auf das Etikett, auf dem stand: Freunde im Glas. Und Enttäuschung machte sich in mir breit.
»Los, nimm schon.« Er drückte mir das Gefäß gegen die Brust. Abwehrend hob ich die Hände.
»Sie sind ganz pflegeleicht, du musst nur eins tun, sie freilassen. Dann werden sie für dich da sein, wenn du sie am meisten brauchst.« Er schaute mich voller Überzeugung an und in seinem Blick lag etwas, das mich ihm vertrauen ließ.
Schließlich rang ich mich durch, es ihm abzunehmen. Meine Hand krampfte sich um das Glas, während ich die Insekten betrachtete.
»Danke«, murmelte ich, zog mich von den Marktständen zurück und schraubte den Deckel auf.
Sobald das Gefäß offen war, schlugen die Käfer wild mit den Flügeln. Keine Sekunde später bildete sich eine rote Wolke über mir, die kurz in der Luft verharrte, ehe sie davonflog. Ernüchtert sah ich ihnen hinterher. Tolle Freunde waren mir das, die mich bei der ersten Gelegenheit allein ließen …
Keine Insekten der Welt konnten mich aus dieser prekären Lage retten, mich den Sinn dieses Ortes verstehen lassen – das hätte ich wissen müssen. Der Schwarm hatte eine Hausfront gegenüber von mir erreicht, dann verschwand er gen Himmel. Mein Blick verweilte kurz an der mintgrünen Hausfassade, bis das Schild über dem Eingang meine Aufmerksamkeit erregte. In großen Lettern stand über der Eingangstür geschrieben: Hier findest du dich selbst.
Mir lief ein Schauer über den Rücken. War das das Werk der Käfer oder nur Zufall?
»Verehrte Schaulustige, kommt näher, tretet heran und schaut euch an, was keiner von euch sonst sehen kann.« Ein Mann mit Zylinder und einem Anzug, der über und über mit schillernden, schuppenartigen Pailletten besetzt war, empfing mich vor dem Haus. Er stand auf einem Holzpodium und versuchte, die Kunden zu seiner Attraktion zu locken. »Ihr seid davon überzeugt, jeden Winkel eures Körpers und Verstands zu kennen. Aber trifft das auch auf die tiefsten, um nicht zu sagen, schwärzesten Bestandteile eures Ichs zu?«
Ein paar Neugierige hatten sich bereits um ihn versammelt. Der Mann hob seinen Gehstock und zeigte nacheinander auf die Interessierten, zuletzt auf mich.
»Ich sehe Unsicherheit in euren Augen. Jeder von euch weiß, dass da etwas in euch schlummert, das ihr selbst nicht versteht. Licht oder Dunkelheit. Das Gute oder das Böse und all die dazwischenliegenden Facetten. Geheimnisse in eurer Vergangenheit, an die ihr euch nicht mehr erinnern könnt, die aber euer heutiges Wesen bestimmen.« Er wies auf den Eingang der Attraktion. Seine Worte waren verheißungsvoll und machten mir Hoffnung. »Tretet ein und ihr werdet etwas über euch erfahren, das weder ihr selbst noch ein anderer über euch weiß. Tretet ein und euer Wesen wird danach kein Geheimnis mehr für euch sein.«
Aufregung durchflutete mich. Eventuell würde ich darin sogar das finden, was ich verloren hatte – mein Gedächtnis. Mich selbst.
Zielstrebig näherte ich mich dem Eingang und schlüpfte durch schwarze Samtgardinen ins Innere eines dunklen Raums, der von flackernden Kerzen in gusseisernen Kerzenständern erhellt wurde. Erst als sich mir ein junger Mann in den Weg stellte, bemerkte ich, dass ich nicht alleine war. Ich bildete mir ein, ihn schon mal gesehen zu haben. Aber natürlich konnte ich mich nicht erinnern. Er schwieg und starrte mich an. Je länger sein stummes Verhalten andauerte, desto mehr irritierte es mich. War er etwa ein Teil der Attraktion?
»Kenne ich dich?«, fragte ich schließlich.
Er bewegte die Lippen im selben Moment wie ich meine, aber aus seinem Mund drang kein Wort. Meine Augen weiteten sich. Das konnte nicht sein …
Als ich mein Gesicht probehalber nach rechts drehte, machte es der Fremde mir nach. Ich hob meine Hand und er hob seine ebenfalls. Erst da fiel mein Blick auf den unauffälligen Rahmen, der in dem schlecht beleuchteten Raum kaum zu sehen war. Dieser junge Mann war ich. Er war mein Spiegelbild.
Ich blickte mich an und versuchte jedes Detail, wie die langen schwarzen Haare, mein kantiges Gesicht, die von dichten Wimpern umrahmten grauen Augen, in mich aufzusaugen. So sah ich also aus. Ich betastete meine Wangen, dabei fiel mir ein Leberfleck am Kinn auf. Als Nächstes entdeckte ich die dünne Narbe an meiner linken Augenbraue, deren Linie ich mit meinem Zeigefinger nachverfolgte. Sie war alt und schien zu mir zu gehören. Trotzdem konnte ich mich nicht daran erinnern, woher sie stammte. Viel schlimmer war jedoch, dass ich mich selbst nicht wiedererkannte.
Die widersprüchlichsten Gefühle tobten in mir und vermischten sich mit unbändigem Frust. Es kam mir vor, als würde ich eine Maskerade tragen, genau wie die Leute draußen auf dem Platz, nur mit dem Unterschied, dass man mir meine nicht ansah und ich sie auch nicht ablegen konnte. Eine weiße Maske, schoss es mir durch den Kopf, weil meine Erinnerungen verschwunden sind und mit ihnen alles, was mich ausmacht.
Etwas blitzte auf der Haut unter dem Ärmel meines Gehrocks hervor und fing meine Aufmerksamkeit auf. Ich schob den Stoff hoch und erkannte, dass sich auf meinem linken Unterarm eine Tätowierung befand. Eine Sanduhr.