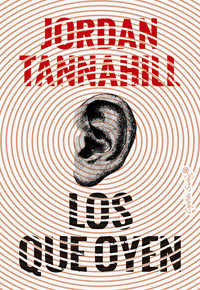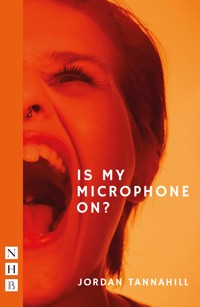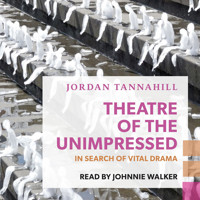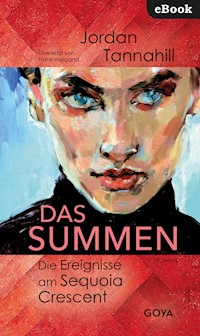
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Claire ist eine ganz normale Frau in einer typischen US-Mittelschichtsvorstadt. Als Englischlehrerin an einer Highschool ist sie bei Schülern und Kollegen gleichermaßen beliebt. Eines Nachts jedoch beginnt die Fassade zu bröckeln: Auf einmal ist da dieses ununterbrochene Summen, das an ihren Nerven zerrt. Das Schlimmste daran ist, dass niemand sonst es wahrzunehmen scheint. Bis Claire, zunehmend in die Isolation getrieben, eines Tages feststellt, dass einer ihrer Schüler es auch hören kann. So findet Claire mit der Zeit eine Ersatzfamilie: Menschen, die das Summen auch hören. Immer tiefer begibt sie sich in die geheime Welt des Summens, die zunehmend sektenartige Züge annimmt. Das Summen ist ein fesselndes psychologisches Portrait, das einen bis zur letzten Minute in seinem Bann hält. Was geschieht, wenn aus Neugier Besessenheit wird? Mit Das Summen erscheint der prämierte Autor und Aktivist Tannahill endlich auf Deutsch. Das gleichnamige Hörbuch erscheint bei GOYALiT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jordan Tannahill
Das Summen
Die Ereignisse am Sequoia Crescent
Roman
Aus dem Englischen von Frank Weigand
Der Autor
Jordan Tannahill, 1988 in Kanada geboren, ist Autor, Dramatiker und Regisseur. Seine Theaterstücke wurden in über zehn Sprachen übersetzt und zwei davon mit dem Governor General’s Literary Award for Drama ausgezeichnet, Kanadas wichtigstem staatlichen Literaturpreis. Das Summen erklomm die kanadischen Bestsellerlisten und stand auf der Shortlist des Scotiabank Giller Prize. Tannahill ist bekennender Kritiker der Monarchie und des Brexits und tritt als Aktivist für die Rechte der queeren Community ein. Er lebt heute in London.
Der Übersetzer
Frank Weigand, 1973 geboren, studierte Romanistik, Philosophie und Komparatistik. Er lebt als freiberuflicher Kulturjournalist und Übersetzer in Berlin. Er hat rund 150 Theaterstücke, Bücher und Hörspiele ins Deutsche übertragen, u. a. von Jocelyne Saucier und Roxanne Bouchard. Weigand und Tannahill kennen sich gut und haben bereits bei der deutschen Übersetzung seiner Theaterstücke zusammengearbeitet.
Das Buch
Die Englischlehrerin Claire Devon lebt glücklich verheiratet mit ihrem Mann Paul und ihrer Tochter Ashley in einer typischen US-Vorstadt. Eines Nachts raubt ihr ein durchdringendes Summen den Schlaf, das sie fortan permanent begleitet, mit starken körperlichen Nebenwirkungen. Weder Ärzte noch Psychologen können das Phänomen erklären. Nach anfänglichem Verständnis gehen ihre Freunde und auch Paul und Ashley auf Distanz. Claire fühlt sich isoliert, bis sie auf Menschen trifft, die »das Summen« ebenfalls hören können. Was als Nachbarschaftshilfe beginnt, nimmt schon bald sektenartige Züge an. Und die Ereignisse eskalieren. Das Summen ist ein spekulativer, fesselnder Roman, der die feinen Grenzen zwischen Glaube, Wahn und Verschwörung auslotet.
Für James
1
Höchstwahrscheinlich sind Sie im Netz schon über das Meme gestolpert, in dem ich splitternackt vor einer Wand von Fernsehkameras herumbrülle. Ein viral gegangener Augenblick von Kontrollverlust, in ein GIF gepackt und dann weltweit in Twitterthreads und Textnachrichten kopiert und weitergeleitet. Höchstwahrscheinlich haben Sie auch die Berichterstattung über die tragischen Vorkommnisse verfolgt, die sich direkt danach am Sequoia Crescent ereignet haben. Und ebenso höchstwahrscheinlich halten Sie mich daher für eine Sektentussi, eine Verschwörungstheoretikerin, der irgendjemand eine gehörige Gehirnwäsche verpasst hat. Falls Sie dieser oder einer der anderen hoffnungslos aufgebauschten Geschichten, die in den Tagen, Wochen und Monaten danach über mich verbreitet wurden, Glauben schenken, kann ich Ihnen das nicht verdenken.
In Wahrheit bin ich allerdings schlicht eine Mutter und Ehefrau sowie eine ehemalige Highschool-Lehrerin, die jetzt in Abendschulkursen in der Bibliothek um die Ecke Englisch für Ausländer unterrichtet. Ich liebe meine Familie über alles. Meine Tochter Ashley ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Immer wieder liest man in der Zeitung von Eltern, die ihre Transgender-Söhne enterben oder kein Wort mehr mit ihren Töchtern reden, weil sie einen Juden geheiratet haben oder weil sie keinen Juden geheiratet haben. Ich finde so etwas einfach barbarisch. Ein Glaube, der Leute dazu bringt, ihre natürlichen Elterninstinkte zu verleugnen, ist im Grunde abartig.
Ich weiß noch, wie ich Ashley im Arm hielt, als sie kaum fünfundvierzig Sekunden alt war. Sie hatte noch nicht einmal die Augen aufgeschlagen, war bloß ein kleines, schleimiges, maulwurfsartiges, fast einen Monat zu früh geborenes Ding, und ich dachte, dass ich für dieses Wesen buchstäblich über Leichen gehen würde. Als ich sie im Arm hielt, stellte ich mir all die Freude und Lust vor, die sie in ihrem Leben empfinden würde, all den Schmerz, vor dem ich sie nicht beschützen könnte, und war komplett überfordert. Ich stellte mir die Männer vor, die ihr irgendwann wehtun würden, und sah mir selbst dabei zu, wie ich sie einen nach dem anderen mit meinen bloßen Händen kastrierte. Und das alles, bevor sie auch nur eine Minute alt war! Deshalb vermochte ich nie zu begreifen, wie jemand einen Glauben oder eine Ideologie über die Liebe zu seinem eigenen Kind stellen konnte – und doch warf mir Ashley in dem Jahr, das mit den Ereignissen am Sequoia Crescent seinen traurigen Höhepunkt erreichte, genau das vor.
In diesem Buch versuche ich, die Ereignisse so getreu wiederzugeben, wie es meine subjektive Erfahrung erlaubt. Alles, was hier steht, habe ich selbst geschrieben. Ich hatte keinen Ghostwriter. Ich habe dieses Buch nicht verfasst, um aus meiner kleinen, zeitlich begrenzten Pseudoprominenz Kapital zu schlagen oder mich irgendwie zu entlasten. Ich habe es geschrieben, weil ich darin eine Möglichkeit sah, dem, was mir widerfahren war, einen Sinn zu verleihen.
Denn nach Sinn habe ich schon immer in Büchern gesucht. Als Kind habe ich Bücher verschlungen. Aufgezogen von einer alleinerziehenden Mutter und einem Fernsehapparat. Als ich heranwuchs, gab es in unserer Wohnung keine Bücher, also nahm ich so viele aus der Bücherei mit, wie ich durfte, und manchmal auch ein paar mehr, die ich nicht zurückgab. Ich fühlte mich stets zu Geschichten über Frauen in Extremsituationen hingezogen, die schwere Zeiten durchmachten und schlimme Entbehrungen ertrugen. Geschichten über Leute, die in Selbstmitleid versinken und ebenso rat- wie ziellos in der Gegend herumtappen, ertrage ich keine Sekunde, ich meine, wen interessiert’s, Leute, reißt euch mal zusammen. Obwohl mein Leben in diesem Buch buchstäblich den Bach runtergeht, kann ich Ihnen versichern, dass ich jede einzelne Sekunde dagegen angekämpft habe. Ich habe mich nie als Opfer gesehen und tue das bis heute nicht. Aber natürlich halten die meisten mich ohnehin für den Bösewicht in dieser Geschichte, doch auch als solchen sehe ich mich keineswegs.
Auf der Highschool träumte ich davon, später mal Essays wie Joan Didion zu schreiben. Ich malte mir aus, dass ich nach meinem Uni-Abschluss ein Nomadenleben führen würde, jeden Tag eine halbe Schachtel Zigaretten rauchen, quer durch Amerika fahren und mit Notizblock und Stift bewaffnet in den Zeitgeist hineinstolpern würde. Ich trug damals ein Armeehemd aus dem Secondhandladen, in dessen tiefe Taschen ich abgegriffene Taschenbuchausgaben von Rimbaud und Pound stopfte. Mein einziger Wunsch war damals, meinen Namen irgendwann gedruckt zu sehen. Das war, bevor ich mit zweiundzwanzig schwanger wurde, Paul heiratete und Englisch auf Lehramt zu studieren begann. Trotzdem habe ich niemals irgendetwas bedauert. Ich genoss es, eine junge Mutter zu sein. Als Ashley älter war, wussten sie und ich immer genau, was die andere dachte. Die Leute machten Witze darüber, dass zwischen uns anscheinend eine telepathische Verbindung bestand, und manchmal glaubte ich, sie hatten recht. Manchmal hatte ich Durst, und sie brachte mir unaufgefordert ein Glas Wasser. Oder ich wachte in dem Wissen auf, dass sie einen Albtraum hatte, und kam bereits in ihr Zimmer gerannt, bevor sie überhaupt nach mir gerufen hatte.
Womit ich sagen will: Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich nach all den Jahren doch noch ein Buch schreiben würde, und ganz gewiss nicht unter diesen Umständen. Es kam nur so weit, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wenn andere Leute meine Geschichte zum Besten gaben, wenn sich sogenannte Experten oder Talkmaster über die Vorkommnisse am Sequoia Crescent ausließen, als hätten sie irgendeine gottverdammte Ahnung, oder wenn die Tragödie zum x-ten Mal für einen Lacher in einer Late-Night-Show verbraten wurde. Dabei kann ich Spott vertragen, glauben Sie mir. Über meine fransigen Haare und die Hängetitten in dem Meme hat garantiert niemand lauter gelacht als ich. Aber die Wahrheit ist nun einmal etwas komplizierter als eine griffige Pointe.
Eins begreife ich allerdings bis heute nicht: dass etwas so Kleines, so Harmloses mein ganzes Leben auf den Kopf stellen konnte, dass all die Qual, die Euphorie, die grauenhafte Ernüchterung mit einem leisen, kaum wahrnehmbaren Geräusch begann.
»Hast du das gehört?«
Ich lag neben Paul im Bett. Er las auf seinem Tablet die New York Times und ich korrigierte Schüleraufsätze zu Was ihr wollt.
»Was gehört?«, fragte er und las seinen Artikel weiter.
Ich legte den Aufsatz auf die Bettdecke.
»Es ist so ein – Summen«, sagte ich.
Paul blickte auf, und für einen Augenblick lauschten wir beide.
»Ein Summen?«
»Ein ganz leises Brummen«, erklärte ich.
Er runzelte die Stirn, zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder seinem Tablet zu.
»Ich höre nichts.«
Ich nahm den Aufsatz zur Hand und versuchte, wieder hineinzufinden. Eine knappe Minute später fragte mich Paul, ob ich mich beim Abendessen gut amüsiert hätte. Ich nickte unverbindlich. Es war eigentlich nur das allmonatliche Treffen meines Frauenlesekreises zum Thema »Dystopien«, doch dann stand ich irgendwann plötzlich in der Küche und bereitete eine üppige Tajine zur Feier von Nadias Geburtstag zu, und schließlich wurden auch noch die Ehemänner eingeladen. Paul meinte, das sei mal wieder typisch für mich gewesen, und das war es wohl. An dem Abend hatte er sich zum Glück bereitwillig als Küchenhilfe einspannen lassen. Das Abendessen zu neunt hatten wir hauptsächlich mit Gesprächen über Trump und den Mueller-Report verbracht, was sich schließlich zu einer intensiven und weitschweifigen Diskussion über Moral und Glaube ausgewachsen hatte, bei der die eine Hälfte der Tischgesellschaft lebhaft diskutiert und die andere konsterniert geschwiegen hatte.
Paul drehte den Kopf auf dem Kissen zur Seite und sagte: »Mir war es nur ein bisschen unangenehm, dass du uns als Atheisten bezeichnet hast.«
Ich verstand nicht auf Anhieb, worauf er hinauswollte. Ich blickte von meinem Aufsatz auf. »Wie bitte?«
»Beim Abendessen. Da hast du gesagt, dass wir nicht an Gott glauben.«
»Was hätte ich denn sonst sagen sollen? Tara hat mir ja quasi die Pistole auf die Brust gesetzt.«
»Na ja, ich würde nämlich sagen, dass ich vielleicht doch an ihn glaube«, erwiderte er.
Paul hielt meinem Blick stand, bis ich lachen musste.
»An welchen Gott?«
»Was meinst du …?«
»Etwa Jesus Christus?«
Paul sah mich an, als wäre ich völlig bescheuert.
»Ja«, sagte er.
»Und auch an seinen Papa?«
Ich blickte forschend in Pauls Gesicht und fragte mich, ob das irgendwie die Einleitung zu einem seiner bemühten Witze war. Dann erzählte er mir, dass er, seitdem sein Vater im Herbst verstorben war, angefangen habe, über seinen Glauben nachzudenken.
»Na ja, nicht bloß nachzudenken, sondern …«
»Sondern?«
»Zu beten.«
»Zu beten?«
»Wann?«
»In meinem Kopf, manchmal im Auto.«
Er erzählte, dass es sich seltsam tröstlich angefühlt habe, als er anlässlich der Beerdigung wieder einmal in der Kirche gewesen sei, und dass es etwas in ihm angerührt habe. Er sagte, er wisse, ich würde mich bloß darüber lustig machen, und genau deshalb habe er mir nichts davon erzählt, und ich sagte, nein, ich würde mich keineswegs darüber lustig machen, und versuchte dabei, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu behalten. Er sagte, er habe darüber nachgedacht, sich vielleicht eine Kirche in unserer Gegend zu suchen, wo er mal hingehen könnte, und sei es nur einmal im Monat oder so. In diesem Augenblick war ich felsenfest davon überzeugt, dass er mich auf die Probe stellte, dass er einen Köder auslegte, vielleicht weil er immer noch ein bisschen betrunken war und mir irgendeine Bemerkung von früher am Abend heimzahlen wollte, aber ich würde auf keinen Fall anbeißen. Ich sah ihn bloß mit großen Augen an und nickte. Dann erinnerte er mich daran, als wäre das nötig, dass Cass und Aldo evangelikale Christen waren.
»Und?«
»Und du hast das ziemlich unhöflich formuliert.«
»Habe ich nicht.«
»Doch hast du. Du warst heftig und herablassend.«
»Das war nicht meine Absicht, und wenn es Cass so vorgekommen sein sollte, kann sie mich ja morgen anrufen.«
Ich hoffte, damit wäre der Fall erledigt, aber wie er so dalag und an die Decke starrte, war Paul anzusehen, dass ihn die Sache immer noch beschäftigte. Obwohl er ein Hüne von einem Mann war, wirkte er wie ein kleiner Junge, wenn er über etwas brütete.
»Ich glaube übrigens, dass ich diese Seite in mir deinetwegen jahrelang unterdrückt habe, und jetzt finde ich …«
»Oh, bitte.«
»… nein, wirklich, weil du nicht an Gott glaubst. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich allein auf mich gestellt wäre, würde ich durchaus zum Glauben tendieren.«
»Wenn du allein auf dich gestellt wärst, würdest du zu Mikrowellenessen und The Wire auf Netflix tendieren.«
Er drehte mir wieder den Kopf zu und lächelte, dann streckte er die Hand aus und stupste mein Gesicht zärtlich mit seiner riesigen Pranke.
»Wenn du in die Kirche gehen willst, nur zu«, sagte ich. »Aber ohne mich.«
»Ich hätte nie etwas anderes erwartet«, erwiderte er.
Paul wusste ganz genau, dass man mir besser nicht mit Gott kam. Ich hatte zwanzig lange Jahre gebraucht, um dieses verkorkste Zeug aus seinem Kopf zu kriegen. Ich hatte gesehen, was die Kirche mit Leuten wie seiner Mutter machte, und es würde niemals so weit kommen, dass ich brav und bescheiden unter der Fuchtel des Patriarchats dahinvegetierte. Ich sah die Sache so: Ich war mit mir im Reinen, also brauchte ich keinen Gott. Diese Meinung hatte sich kaum geändert, seit ich mit sechzehn schlagartig begriffen hatte, dass Gott nicht anders war als jeder beliebige Typ an meiner Highschool: Er interessierte sich erst für mich, sobald ich vor ihm auf den Knien lag.
Für zwei Personen, die nur zusammen waren, weil die eine die andere geschwängert hatte, als beide erst seit ein paar Jahren alt genug waren, um legal Alkohol zu trinken, hatten wir es ziemlich gut hingekriegt, unsere Glaubenssysteme aufeinander abzustimmen. Als wir uns kennenlernten, war ich ein polyamouröses Riot Grrrl, das Geflüchteten aus Südamerika Englisch beibrachte und er ein ungelernter Arbeiter, der die Art von Reihenhaus baute, in der wir jetzt leben.
Er war stolze ein Meter zweiundneunzig groß, schüchtern und höflich. Wenn er tanzte, bewegte er, wenn überhaupt, seine Schultern. Nicht die Art von Typ, der normalerweise eine junge Frau im öffentlichen Nahverkehr fingern würde oder mit ihr auf Demos für die Rechte von Migranten ginge.
LSD, Avocados, Körperpflege und Tarkowski – nach kurzer Zeit hatte ich seinen Horizont entschieden erweitert. Er war immer ein bisschen geblendet von meinem sicheren Auftreten in Gesellschaft. Für ihn schien sich stets alles um mich zu drehen, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war. Einmal sagte er, ich sei die geborene Anführerin. Damals erregte mich sogar seine Abwesenheit in einem Raum. Seine Unterwäsche auf dem Boden, sein Schweiß im Laken, sein Geruch im Kissen reichten völlig aus. Wir waren berauscht von diesem ganz unsinnigen Glück eines frisch verliebten Paars. Manchmal stand ich unter der Dusche hinter ihm und dachte, vergiss nicht, wie Wasser auf seinem Nacken aussieht, mit seiner schmalen Goldkette und seinen Sommersprossen, vergiss das nie, vielleicht weil ich ahnte, dass dieses gemeinsame Duschen etwas zeitlich Begrenztes war, nur ein Kapitel in unserer Liebesgeschichte, und natürlich war es auch so. Doch zum Glück vergaß ich es nie. Ich weiß noch immer, wie das Wasser auf Pauls jungem Nacken aussah.
Paul besaß eine Art von Schönheit, die darum bettelte, unaufhörlich bemerkt zu werden. Es nicht zu tun und sie als etwas Selbstverständliches anzusehen, fühlte sich an wie ein extravaganter Luxus. Außerdem hatte er keinen blassen Schimmer davon, dass er schön war und dass ich ihn schön fand, und es verursachte mir einen geradezu erotischen Kitzel, diese Tatsachen vor ihm zu verheimlichen. Einmal sagte ich zu ihm, er habe ein Gesicht wie Cornflakes – offen und sonnig, mit Grübchen darin. Das kam nicht so gut an, wie es gemeint war. Am besten sah er aus, wenn er verärgert war oder sich stark konzentrierte. Wenn er sich auf die Lippe biss, musste ich an die Spielzeugeisenbahn denken, die ich als kleines Mädchen besessen hatte. Sie hatte ein Gesicht vorne drauf und ich zog sie stets an einer Schnur hinter mir her.
Wir waren seit ungefähr sechs Monaten zusammen, als das mit der Schwangerschaft passierte. Es war meine Entscheidung, das Baby zu behalten, aber wir brauchten die Hilfe von Pauls Familie, die wir unter dem Vorbehalt bekamen, schleunigst zu heiraten. Paul war arm und träumte heimlich von Reichtum. Ich dagegen war arm und träumte heimlich von einer glamourösen Art von Armut. Arm mit Stil. Jean-Genet-mäßig arm. Irgendwann, als Ashley zwölf war, machte sich Paul mit seinem Handwerksbetrieb selbstständig. Das Geschäft florierte, und unversehens landeten wir in einer vollkommen anderen Gesellschaftsschicht. Wenn man mittellos aufwächst, prägt einen das wie eine Krankheit. Paul sagt immer, dass ich meine Unterwäsche so lange trage, bis ich einen Gürtel dafür brauche. Ich bin vollkommen zufrieden damit, einen abgebrochenen Rückspiegel mit Klebeband zu reparieren oder einen Fön zu benutzen, der Funken sprüht. Ich bin ungeschickt und mache ständig Sachen kaputt, und manchmal denke ich, das liegt daran, dass ich es immer noch nicht gewohnt bin, viele Sachen zu besitzen, Sachen, die nicht aus Plastik sind, Sachen wie zerbrechliche Vasen oben auf Bücherregalen und Lampen auf Beistelltischen.
Ich wuchs in Armut auf, aber immerhin in der Stadt, während Paul ein echter Hinterwäldler war, der sich mit drei Brüdern ein Zimmer teilen musste, in einem Bungalow mit Sperrholzboden, irgendwo eine halbe Stunde außerhalb von Amarillo, wo man seinen Namen in den Schmutz auf der Windschutzscheibe schreiben konnte, wenn man seinen Wagen drei Tage lang nicht bewegt hatte. Ein zärtlicher, aufrichtiger Hinterwäldler, den es immer noch glücklich macht, wenn ihm eine Frau zum Einschlafen Gedichte vorliest. Alles an Paul ist übergroß. Seine Hände, seine Ohren, sein Gesicht und sein Herz. Müsste ich ihn mit einem Wort beschreiben, dann wäre das: »besorgt«. Besorgt um mich, um mein Glück, ob mir zu kalt ist, zu heiß, besorgt, weil ich so still bin, besorgt um Ashley, um ihre Noten, ihre Freunde, ihre Frisuren, besorgt um die Zukunft, unsere Finanzen, die Erderwärmung, besorgt darum, was seine Nachbarn von ihm denken, besorgt, weil seine Mutter alt wird, krank werden und sterben könnte, besorgt um seinen alkoholkranken Bruder, besorgt darum, richtig zu handeln, das Richtige zu denken und zur richtigen Zeit irgendwo einzutreffen. Ich dagegen bin vollkommen unbesorgt.
Während Paul aus dem Bett stieg und zum Pinkeln ins Badezimmer stapfte, nahm ich den schwülstigen Aufsatz wieder zur Hand, aber bevor ich die Stelle fand, an der ich abgebrochen hatte, hielt ich inne. Es war immer noch da. Ich konnte das Geräusch immer noch hören. Es existierte nicht bloß in meiner Vorstellung. Da war ein sehr leiser, nachhallender Ton, gerade noch wahrnehmbar unter dem Plätschern von Pauls Urin in der Toilettenschüssel, dem leichten Rauschen der Klimaanlage und dem gedämpften Face-Time-Gespräch, das aus Ashleys Zimmer am Ende des Flurs herüberdrang. Es war gut möglich, dass das Geräusch schon immer da gewesen war und ich es bloß nie bemerkt hatte. Aber jetzt, wo ich es hörte, schien mir das kaum vorstellbar.
Paul spülte und kam zurück ins Zimmer.
»Stimmt was nicht?«, fragte er.
Ich zeigte in die Luft.
»Es ist immer noch da«, sagte ich.
Er seufzte und schüttelte den Kopf, aber wir lauschten beide, diesmal geschlagene zehn Sekunden, und durchforsteten dabei das Zimmer mit Blicken.
»Ich höre gar nichts«, stellte er schließlich fest.
»Es ist fast wie eine Vibration«, entgegnete ich.
Paul fragte, ob ich die Dunstabzugshaube in der Küche angelassen hätte. Ich konnte es nicht ausschließen. Ich stöhnte, schälte mich aus dem Bett und zog das Nachthemd über, das ich zusammengeknüllt auf dem Boden liegen gelassen hatte. Ich ging in den Flur, vorbei an Ashleys Zimmer und dann die Treppe hinunter ins stockfinstere Erdgeschoss, wo die roten und grünen LED-Lämpchen von Alarmanlage, Feuermelder, Rauchmelder, WLAN und Heizungsthermostaten eine Art Sternbild formten. Es fasste alle Systeme zusammen, die dem Körper unseres Hauses unbemerkt und unbeachtet wie Atem oder Blutkreislauf Leben einhauchten. Ich betrat die Küche und horchte. Die Dunstabzugshaube war ausgeschaltet. Der Kühlschrank hörte sich normal an. Aber das Summen war immer noch da, genauso laut, wie es vom Schlafzimmer aus geklungen hatte.
Ich ging ins Esszimmer, und wieder blieb das Geräusch unverändert, was mich aus der Fassung brachte. Ich fragte mich, ob ich an einer Art Tinnitus litt. Ich hielt mir mit flachen Händen die Ohren zu, und das Geräusch klang gedämpfter. Es war nicht in meinem Kopf. Das Geräusch kam von irgendwoher. Ich stand im Dunkeln neben dem Tisch, auf dem sich noch die Teller vom Abendessen stapelten, die wir stehen gelassen hatten, bis wir am Morgen wieder nüchtern wären, und drehte langsam den Kopf, in der Hoffnung, dass eine Veränderung der Lautstärke mich in eine Richtung wies. Dann ging ich im Raum auf und ab. Jedes Mal, wenn ich mir sicher war, dass das Geräusch aus einer bestimmten Richtung kam und ich mich dorthin bewegte, erschien es mir plötzlich, als käme es aus der genau entgegengesetzten Richtung. Ich fragte mich, ob vielleicht unser Nachbar Farhad mit irgendeinem elektrischen Werkzeug in seiner Garage hantierte. Er war bekannt dafür, manchmal abends um zehn seinen Rasen zu mähen. Aber dann hätte das Geräusch eine eindeutige Richtung gehabt. Was auch immer es war, es ließ sich nicht orten.
»Ashley?«, rief ich nach oben.
Ich wartete auf Antwort und ging dann zum Fuß der Treppe.
»Ashley?«
»Was ist?«, schrie sie aus ihrem Zimmer zurück.
»Kannst du mal nachschauen? Hat da oben jemand die Badezimmerlüftung angelassen?«
Es folgte eine Pause und dann das Geräusch ihrer sich öffnenden Tür. Sie erschien in karierten Boxershorts und einem ausgeleierten weißen T-Shirt oben auf der Treppe und kratzte sich den Schädel mit der Post-Gender-Frisur. Ashleys Vorbild war nach eigenem Bekunden Sinéad O’Connor ungefähr zu der Zeit, als sie in Saturday Night Live ein Foto vom Papst zerrissen hatte.
»Was?«, fragte sie.
»Die Badezimmerlüftung oben. Hast du die angelassen?«
Sie verschwand kurz und kam dann kopfschüttelnd wieder. Ich beschrieb ihr das Geräusch. Sie lauschte einen Augenblick und schüttelte dann wieder den Kopf.
»Dann verliere ich wohl gerade den Verstand«, sagte ich schulterzuckend.
»Perimenopause«, erwiderte sie.
»Was?«
»Das kommt vor.«
»Du kleines Luder. Ich bin vierzig.«
»Altes Luder.«
»Unverschämtes kleines Luder.«
Der vorgeblich rüde Ton war unsere bevorzugte Umgangsform. Ich weiß nicht mehr, wie die Sache mit dem Luder angefangen hatte. Das war einfach einer unserer Insider-Scherze, der im Laufe der Jahre immer neue Formen annahm. Andere Spitznamen für mich waren Ludermom, Momma Claire, Claire Danes und Lady Luder. Zu meinen Lieblingsspitznamen für sie gehörten Ash Wednesday, Ashton Kutcher und Ashscratcher. Paul macht Witze darüber, dass nur die NSA den Geheimcode unserer Gespräche knacken könne. Ashley blickte kurz zu Boden und schlug einen weniger konfrontativen Tonfall an.
»Vielleicht haben die Sonnenstürme was damit zu tun«, sagte sie. »Anscheinend sind die so stark wie nie. Hast du was davon gehört?«
»Nein.«
»Angeblich stören die unsere Elektrogeräte, und manche Wissenschaftler sagen, vielleicht sogar unser Denkvermögen, also …«
Mit einem vielsagenden Blick verschwand sie von der Bildfläche, wie ein hinterlistiger Geist, der in seine Flasche zurückkehrte.
Ich ging wieder ins Esszimmer. Das Geräusch hatte etwas Atmosphärisches an sich. Ich schaute hoch zur Lüftung in der Decke, ging hinüber zum Thermostat und schaltete die Klimaanlage aus, aber das Summen setzte sich hartnäckig fort, deutlicher als je zuvor. Mir fiel ein, dass es sich womöglich um ein von einem Minibeben ausgelöstes Vibrieren in den Wänden oder im Fundament des Hauses handeln könnte. Bekanntlich gab es in unserer Gegend hin und wieder kleine Erdbeben. Ich berührte die nächstgelegene Wand, spürte aber nichts. Ich hielt mein Ohr dagegen, doch das Geräusch veränderte sich nicht. Dann kniete ich mich hin und drückte mein Ohr gegen die kühlen Bodendielen aus Hartholz – wieder nichts.
Ich hätte es damals einfach dabei bewenden lassen sollen. Ich hätte aufstehen sollen, mein Haar in Ordnung bringen und wieder nach oben ins Bett gehen. Ich hätte mich zu Paul ins Warme kuscheln, die Augen schließen und mir das Ganze aus dem Kopf schlagen sollen. Damit wäre es vorbei gewesen, und mein Leben wäre geblieben wie zuvor. Aber es war bereits zu spät. Die Sache machte mich fuchsig. Und ich bin durchaus nicht zwanghaft, das können Sie mir glauben. Ich mache kein großes Trara wegen Kleinigkeiten. Ich bin keine Perfektionistin. Es ist mir so was von egal, ob das Hause picobello sauber ist oder nicht, sogar wenn Besuch kommt. Normalerweise bin ich sehr entspannt, manchmal eher zu entspannt für Pauls Geschmack (oder den seiner Eltern). Aber aus irgendeinem Grund konnte ich es einfach nicht auf sich beruhen lassen. Ein Teil von mir dachte wahrscheinlich, dass das Geräusch auf ein Problem mit dem Haus hindeutete, das immer noch relativ neu und schnell hochgezogen worden war wie alle Reihenhäuser. Paul stieß ständig auf Mängel bei den Rohrleitungen, den Lüftungskanälen oder der Fensterdämmung, was ihn wahnsinnig machte, denn er selbst war bei seiner Arbeit immer sehr penibel. Aber ehrlich gesagt ging es noch wesentlich tiefer. Das Geräusch machte mich verrückt. Es durfte nicht da sein. Ich kannte »weißes Rauschen«, aber das hier hatte nichts mit irgendeinem Geräusch zu tun, das ich je gehört hatte, und ich wusste, ich würde kein Auge mehr zutun, bis ich nicht herausgefunden hatte, woher es kam.
»Ich komm gleich rauf«, rief ich zurück.
Aber das tat ich nicht. Ich durchsuchte noch zwei Stunden das ganze Haus, lange nachdem Paul die Hoffnung auf meine baldige Rückkehr aufgegeben hatte und eingeschlafen war. Ich ging durch die Dunkelheit, manövrierte mich mit schlafwandlerischer Sicherheit zwischen Möbelstücken hindurch, hielt regelmäßig den Atem an und versuchte, so leise wie möglich zu sein. Das Geräusch war immer noch da, tief und leicht wabernd. Manchmal glaubte ich, ich hätte einen leichten Anstieg in der Tonhöhe wahrgenommen, doch lag es vermutlich einfach daran, dass ich mich zu stark darauf konzentrierte. Ich durchsuchte das Wohnzimmer, den Keller, die Garage, zog den Stecker aus jedem Elektrogerät, dem WLAN-Router, der Mikrowelle, dem Fernsehapparat, dem Durchlauferhitzer, drehte die Rauchmelder ab und entfernte ihre Batterien. Irgendwann legte ich sogar den Hauptschalter um. Dabei fiel mir ein, wie ich als Sechsjährige mitten in einem Gewitter einen Stromausfall erlebt hatte. Die Stille danach war wie eine Offenbarung. Ich hatte niemals in Betracht gezogen, dass unsere Wohnung ein Nervensystem besaß und ständig vor sich hin zu jammern und zu jaulen schien. Verwundert stellte ich fest, dass wir manche Geräusche erst durch ihr Fehlen wahrnahmen, und fand es beunruhigend, wie erfolgreich ich mich selbst dazu erzogen hatte, vieles einfach zu überhören. Wie viel ich ausblenden musste, um im Alltag zurechtzukommen.
Schließlich nahm ich zwei Schlaftabletten und kroch frustriert und mit pochendem Herzen zurück ins Bett. Ich stopfte mir ein Kissen über den Kopf. Nach einer halben Stunde kramte ich zwei Ohropax aus der Waschtischschublade im Bad – aber sie halfen nicht. Ich lag da, versuchte, zu meditieren und machte irgendwelche Sachen mit meinen Chakren. Ich schlug die Augen auf und sah, wie es drei Uhr wurde. Dann vier. Das Geräusch war keineswegs laut. Die meisten Leute hätten sich vermutlich anstrengen müssen, um es zu hören, aber in der Stille des Hauses klang es für mich, als würde es nach und nach alles ausfüllen. Es war ein bisschen, wie wenn man in einem Restaurant zufällig das leise Gespräch eines Pärchens hinter sich mithörte und einfach nicht in der Lage war, sich auf etwas anderes zu konzentrieren – weder auf die Geräusche der anderen Gäste, noch auf den Kellner, noch auf die Person, die einem direkt gegenübersaß.
Um halb fünf konnte ich nicht mehr still liegen. Ich nahm die beiden Ohropax raus, ging nach unten, öffnete die Haustür und trat hinaus. Die Nacht war warm. Es gab nicht den Hauch einer Bewegung auf der Straße. Keinen Wind, der die Blätter störte, keine Flugzeuge, die Spuren am Himmel hinterließen. Bloß den Geruch von Kreosotbüschen und frischer, sauberer Luft, von Regen, der irgendwo in der Ferne aufzog. Die unheimliche Stille erinnerte an ein Filmset. Als würde hier einer dieser Horrorfilme gedreht, in dem die Teenager der Gegend einer nach dem anderen von irgendeiner höllischen Macht umgebracht wurden. Solche Filme spielen immer in Vorstädten wie dieser – Fertighäuser aus dem Katalog, junge Bäume, Einfahrten gesäumt von SUVs. Meine Augen waren trocken, brannten. Meine Wahrnehmung war von der Schlaftablette getrübt. Ich durchquerte den Vorgarten, ging hinaus auf die Straße und lauschte. Es war nicht in meinem Kopf oder im Haus – es war da. Es kam von irgendwo da draußen, vielleicht von nebenan oder ein paar Straßen weiter, vielleicht aber auch von irgendwo außerhalb unseres Viertels. Es war unmöglich, einzuschätzen, wie weit es entfernt war.
Dann erst fiel mir ein Schatten auf der Straße auf, der sich mir kaum wahrnehmbar näherte. Ich starrte angestrengt in die Dunkelheit und beobachtete, wie er näher kam. Er schlüpfte in den Schein einer nahen Straßenlaterne, und ich stellte fest, dass es ein Kojote war. Ohren mit weißen Spitzen und ein weißes Felldreieck in seinem Nacken. Zu schmächtig für ein ausgewachsenes Tier. Eher ein Teenagerkojote oder ein Twenkojote, wenn es so etwas gab. Ich musste lächeln, als ich ihn sah. Oft, wenn ich im Bett liege, höre ich den Kojoten zu, wie sie draußen in der Nacht bellen und jaulen. Aber dieser hier gab keinen Laut von sich, als er zurück in die Dunkelheit schlich. Ich wartete darauf, dass er in dem Lichtkreis neben mir wieder auftauchen würde – aber Fehlanzeige. Er war verschwunden.
Die Kojoten taten mir leid. Meine Nachbarn hassten sie, weil sie Hunde und Katzen aus den Hinterhöfen schleppten und auffraßen. Aber das war eben ihre Natur. Ich hatte schon immer eine gewisse Verwandtschaft mit ihnen empfunden. Auch ich war in der Mittelschichts-Vorstadtwelt ein räudiger Eindringling. Meine Nachbarn hatten irgendwie vergessen, dass die Wildnis nur eine Straßenecke weit entfernt war. Am Ende unserer Straße ging die Stadt in Brachland über. Der ehemalige Grund eines uralten Binnenmeeres. Mehrere Millionen Jahre lang hatten sich hier Meereslebewesen eine gute Meile hoch übereinander abgelagert, verdichtet und zu Rohöl verflüssigt, was einige der Dreifachgaragen und grotesken Fertighaus-Villen auf den benachbarten Grundstücken erklärte. Wenn man nachts aus dem Weltall auf die Stadt blickte, sah unsere Vorstadt aus wie ein kleiner Finger aus Licht, der hinaus in die Dunkelheit deutete. Wir befanden uns am äußersten Ende des nördlichen Stadtgebiets, ja sogar der Zivilisation. Und der Übergang war fließend. Er schien sogar immer uneindeutiger zu werden. Manchmal schlich sich die Wildnis ein und warf nach Sonnenuntergang Mülltonnen um oder kackte einem auf die Türschwelle. Hin und wieder wurden auch die Jungs aus der Nachbarschaft wild. Sie heulten und zertrümmerten Bierflaschen an Garagentoren oder schossen Feuerwerkskörper über die Straße.
»Claire?«
Ich schreckte auf, drehte mich herum. Paul trat aus den Schatten hervor, seine Hände umklammerten einen Golfschläger.
»Was zum Teufel machst du da?«, fragte er.
Ich stand mitten auf der Straße, barfuß und im Nachthemd. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Nachbarn um diese Uhrzeit wach waren, aber wir wären ein ziemlich spektakulärer Anblick gewesen – ich unter der Straßenlaterne und mein Ehemann, der mit einem langen Eisen auf mich zukam.
»Bärchen, wir haben dich im ganzen Haus gesucht.«
»Ist Ashley auch wach?«
»Ja, wir haben uns große Sorgen gemacht. Der Strom ist ausgefallen.«
Ich entschuldigte mich und rieb mir das Gesicht. Ich hatte nicht die Absicht gehabt, daraus eine große Sache zu machen. Es war nichts, wirklich, nur ein kaum hörbares Geräusch, und jetzt war es halb fünf Uhr morgens, wir waren alle wach, und Paul hielt einen Golfschläger in der Hand. Einen Golfschläger? Als mir das klar wurde, fing ich an zu lachen.
»Ich bin aufgewacht, und das Licht ging nicht«, sagte er und kam langsam näher. »Ich konnte dich nirgendwo finden. Ich dachte, irgendjemand wäre eingebrochen. Die Haustür stand offen, alle Möbel waren … Das ist nicht witzig, warum lachst du?«
»Also hast du dir gedacht, du nimmst mal schnell …«
»Das, was eben zur Hand war!«
Paul trug seine Emotionen immer deutlich im Gesicht zur Schau. Ich hatte das schon immer liebenswert gefunden und mich manchmal darüber lustig gemacht, wenn wir gemeinsam Filme anschauten. Ich lachte über die Panik in seiner Miene, fand sie aber auch wirklich rührend. Paul hatte einen Herzfehler namens Mitgefühl, der bei Männern seines Alters ziemlich selten war. Er sah aus wie ein »harter Bursche«, aber was seine emotionale Intelligenz anging, machte ihm so leicht keiner etwas vor. Seine Brüder hielten ihn garantiert für ein Weichei, aber ehrlich gesagt würde ich mich lieber bis in alle Ewigkeit waterboarden lassen, als mit einem von ihnen verheiratet zu sein. Ich mochte es, dass mein Ehemann ein Neuner-Eisen rausholte, wenn er feststellte, dass ich nicht mehr neben ihm im Bett lag. Ich kann generell nur empfehlen, sich Partner zu suchen, die im Fall der Fälle ein Neuner-Eisen zur Hand haben.
»Was zum Teufel geht hier vor?«
Ich beruhigte mich und schüttelte resigniert den Kopf.
»Ich konnte nicht schlafen«, sagte ich.
»Also hast du dir gedacht, gehst du mitten in der Nacht ein bisschen im Nachthemd draußen spazieren«, erwiderte er.
Ich wusste nicht, welche Miene ich aufsetzen sollte, und war zu müde, um zu überprüfen, was für ein Gesicht ich gerade machte, also rieb ich mir mit der Hand über Augen, Nase und Mund, wie mit einem Radiergummi.
»Ich versuche rauszukriegen, wo es herkommt«, erklärte ich. »Ich hab dir doch gesagt – um zwölf, um eins, um zwei –, dass ich nicht schlafen konnte.«
Paul schloss die Augen, drückte sich mit Daumen und Zeigefinger auf die Lider und sagte: »Ich kann nicht glauben, dass es immer noch um dieses verdammte Summen geht.«
»Und ich kann nicht glauben, dass du nicht einfach den Mund halten und zuhören kannst.«
Hörte er es wirklich nicht, selbst jetzt, wo wir in der Stille der Nacht draußen standen? Als er sagte, ich könne seine Ohropax benutzen, holte ich sie aus meiner Nachthemdtasche und schmiss sie auf den Boden.
»Du bist also aufgewacht und in der Dunkelheit rumgeschlichen?«
Wieder musste ich über die Absurdität des Ganzen kichern.
»Ein bisschen gruselig, oder?«, fragte ich.
»O ja, verdammt gruselig«, gab er zurück, aber die Spannung wich langsam von ihm.
Er stand jetzt direkt neben mir, seine Augen funkelten im Schein der Straßenlaterne. Ich stellte fest, dass ich vor lauter Überraschung über sein Auftauchen den Kojoten vollkommen vergessen hatte. Ich überlegte, ob ich ihm davon erzählen sollte, beschloss dann aber, es besser für mich zu behalten. Paul war nicht in der geistigen Verfassung für private Offenbarungen. Ich sah kurz zu Boden, dann wieder ihn an. Sein Gesicht war immer noch eine einzige große süße Zeichnung der Besorgnis.
Meine Hände zitterten, und auf einmal wünschte ich, ich hätte Taschen, in denen ich sie verstecken könnte. Stattdessen verschränkte ich die Arme.
»Tu das nicht einfach ab«, sagte ich.
»Mache ich nicht.«
»Und denk nicht, dass ich übertreibe.«
»Nein, es ist bloß …«
»Bloß was?«
»Ich weiß nicht, wovon du redest.«
»Ich erzähl es dir gerade.«
»Okay.«
»Ich bin empfänglicher für diese Dinge.«
Er setzte zu einem weiteren »Aber« an, schluckte es jedoch herunter und schloss die Augen.
»Ich weiß«, sagte er.
»Das mit dem Gasleck hast du mir zuerst auch nicht geglaubt.«
»Da gab es einen Geruch.«
»Den ich gerochen habe und nicht du. Wir hätten dabei in die Luft fliegen können. Ich habe Erdbeben gespürt, von denen du überhaupt nichts mitgekriegt hast. Zweimal habe ich früher als du gehört, dass die Heizung im Auto kaputt war.«
»Das waren Dinge, die existieren, Claire. Das hier ist kein Ding.«
Die Schatten der Straßenlaterne fielen hart auf Pauls Gesicht und ließen ihn hohlwangig aussehen. Alt. Er stand eine Armlänge von mir entfernt, aber es fühlte sich sehr weit weg an. Ich sagte, dass mir das mit dem Strom leidtue.
»Ich wollte ihn eigentlich gleich wieder anmachen«, erklärte ich. »Ich habe nur kurz den Hauptschalter umgelegt, um das zu überprüfen.«
»Warte, was? Du hast den Strom abgeschaltet?«
Ich sagte, ich hätte nicht die Absicht gehabt, ihn abgeschaltet zu lassen, ich wollte bloß genau Bescheid wissen, und dafür sei Stille notwendig gewesen.
»Du hast den Strom abgeschaltet?«, wiederholte Paul, und sein Unglaube verwandelte sich in Wut.
»Ich musste einfach sichergehen, dass ich es mir nicht eingebildet habe, und jetzt weiß ich, ich habe es mir nicht eingebildet, es ist …« Ich wies mit der Hand die Straße hinunter. »Es ist da draußen.«
»Wo? Da drüben? Bei den Campaneles im Garten?«, fragte er, drehte sich um und zeigte auf das Haus unserer Nachbarn. Er meinte es im Scherz, aber ich hatte tatsächlich überlegt, ob das Geräusch womöglich von der Poolpumpe der Campaneles kam, und erzählte ihm davon.
Er sagte: »Nein, da ist nichts in ihrem Garten. Hör auf, dich lächerlich zu machen.«
Ich setzte ihm auseinander, dass ihr neuer Pool schließlich riesenhaft war, fast wie ein See, und dass ich wetten konnte, dass sie eine gewaltige Pumpe dafür brauchten, die vermutlich die ganze Nacht an war. Jedes Mal, wenn ich mit dem Flugzeug flog und die Stadt von oben sah, war ich schockiert darüber, wie viele Leute Pools besaßen. Mitten in der Wüste! Diese Landschaft war nie für eine Großstadt bestimmt gewesen, ganz zu schweigen von privaten Badeanstalten.
Paul ließ den Kopf des Golfschlägers auf den Asphalt sinken und stützte sich auf ihn wie auf einen Spazierstock.
»Und? Willst du über ihren Zaun steigen und nachsehen?«, fragte er.
Ich schlug vor, wenigstens näher heranzugehen, um zu überprüfen, ob ich es lauter werden hörte. Ich wusste, ich war dabei, es zu übertreiben. Pauls Geduldsfaden war lang, aber auch er würde irgendwann reißen.
»Und was, wenn sie jemanden in ihrem Garten herumschnüffeln sehen?«, wollte er wissen. »Dann rufen sie die Polizei.«
»Wann soll ich denn sonst hingehen?«
»Lass es!«
»Ich gehe bloß bis zum Tor.«
»Nein.«
»Ich kann mich von so einer Sache nicht um den Schlaf bringen lassen.«
Paul schaute mich verblüfft an und erwiderte, das gehe ihm ganz genauso.
Ehrlich gesagt hätte das Geräusch aus jedem Haus oder Garten in der Umgebung kommen können. Ich drehte mich um und begriff, dass ich mitten auf der Straße stand.
»Claire, es ist morgens um halb fünf, warum tust du mir das an?«
»Ich tue dir überhaupt nichts an, ich versuche, ein Problem zu lösen.«
»Ein Problem? Das Problem ist, was du mir gerade antust. Sieh dich doch an. Du trägst nicht mal Schuhe, verdammt!«
Während er sprach, nahm ich einen leichten Druck in meinem Kopf wahr. Es tat nicht weh, es war kein Kopfschmerz. Da war einfach eine Art von Schwere, etwas Voluminöses. Als ich mich darauf konzentrierte, merkte ich, dass ich es auch in meiner Brust spüren konnte. Es dauerte einige Augenblicke, bis ich es mit dem Geräusch in Verbindung brachte. Mir wurde klar, dass ich das Geräusch regelrecht körperlich spüren konnte. Wie eine Druckwelle.
Ich spürte es in den Hohlräumen meines Körpers widerhallen, in meinem Schädel. Bei dem Gedanken begann meine Nase zu kribbeln. Ich wischte mit der Hand darüber und stellte fest, dass sie blutig glänzte.
»O mein Gott!«
»Was?«
»Meine Nase …«
Ich sah, wie Paul das Blut bemerkte.
»Um Gottes willen«, murmelte er. »Was ist los mit dir?«
»Vielleicht solltest du es mit einem Exorzismus versuchen?«
»Ich glaube, fürs Erste reicht ein Taschentuch. Leg einfach deinen Kopf in den Nacken, und dann lass uns …«
»Fass mich nicht an!«
Ich wankte einen Schritt rückwärts.
»Du tust das einfach total ab, das hier«, sagte ich, und hielt ihm meinen blutverschmierten Handrücken hin.
»Bekommst du von dem Geräusch Nasenbluten?«
»Sag das nicht so.«
»Wie soll ich es dann sagen?«
»Das hier verarbeitet gerade mein Hirn zu Brei, Paul, und alles, was du mir anzubieten hast, sind Ohropax und Taschentücher.«
»Jetzt komm schon rein. Bitte!«
»Glaubst du mir?«
»Ich …«
»Hör zu«, sagte ich, wischte mir noch mal die Nase und hinterließ dabei einen frischen Schmierstreifen auf meiner Hand, als wäre das Beweis genug. Ich hatte das Gefühl, dass eine Verbindung zwischen dem Nasenbluten, dem Druck und dem Geräusch bestand, und wenigstens war das Blut etwas Handfestes, das Paul sehen konnte.
»Sag, dass du mir glaubst«, verlangte ich.
Sein Kopf zuckte zurück, als hätte er Angst, ich könnte ihn mit meiner blutverschmierten Hand berühren. Ehrlich gesagt hätte ich ihm am liebsten einen großen roten Handabdruck ins Gesicht geklatscht, wie an den Wänden der Grotte von Lascaux. Er brachte es einfach nicht über sich, es zu sagen. Er bestand darauf, dass das alles stressbedingt sei, im Klartext: Einbildung; im Klartext: Hör auf, so hysterisch zu sein, und ich sagte: »Wow«, schüttelte den Kopf und lächelte ein freudloses Lächeln.
»Wow.«
»Okay«, sagte er und gab sich geschlagen. »Ich glaube dir.«
»Dass ich etwas höre?«
»Ja.«
»Und du glaubst, dass dieses Ding, dieses Geräusch wirklich existiert?«
Er hob die Arme, ließ sie sinken und fragte: »Wie soll ich mit Sicherheit wissen, ob dieses Geräusch, das nur du hören kannst …?«
»Weil ich es dir sage, und das sollte reichen.«
Er starrte mich an wie ein begriffsstutziger Schoßhund, und ich drehte mich um und ging ein paar Schritte weg.
»Hey! Komm schon. Wo willst du hin? Was soll ich denn sagen? Du spielst gerade total verrückt.«
Ich blieb stehen und stieß einen frustrierten Schrei aus. Es brach einfach aus mir heraus. Ich zitterte vor Adrenalin.
Bin ich gerade dabei durchzudrehen?, überlegte ich. Ja, anscheinend, und das mitten auf der Straße.
Ich lachte über mich selbst. Mein Gott, war das ein Ding. Nicht einmal Pauls Mitgefühl erreichte mich mehr. War das wirklich alles? War das alles, was er draufhatte?
Ich wollte zu ihm sagen: »Ich weiß verdammt noch mal, was ich höre, und es ist dein Problem, Paul, nicht meines, wenn du mir nicht glaubst.«
Ich drehte mich um, wollte ihn gerade anschreien, aber da war er schon neben mir, streckte die Hand aus und schloss mich in seine Arme. Ich ließ mich einen langen, stillen Moment festhalten, bis er zärtlich zu mir sagte:
»Ich glaube dir.«
Ich wischte mir die Nase.
»Nein, tust du nicht.«
»Doch. Tu ich«, flüsterte er mir ins Ohr und hielt mich noch fester im Arm. »Doch, ich glaube dir. Ich glaube dir, und ich liebe dich.«
Er löste sich von mir, und ich drehte mich um und sah ihn an.
»Ich liebe dich«, sagte er noch einmal.
Da bemerkte ich, dass der Himmel bereits heller wurde. Im selben Moment hörte ich die ersten Vögel zwitschern.
»Hast du das gehört?«, fragte ich.
Er seufzte und schüttelte den Kopf.
»Nein.«
»Es ist Morgen.«
2
Ich habe Jogger immer für die niedrigste Lebensform auf Erden gehalten. Ich hatte mir geschworen, niemals selbst so tief zu sinken. Doch kaum zwei Jahre nachdem wir in diese Gegend gezogen waren, hatte auch ich meine dreißigminütige Morgenstrecke. Ich war selbst verblüfft über das Tempo, in dem sich meine Prinzipien in Luft aufgelöst hatten. Ich liebte es, beim morgendlichen Laufen zu beobachten, wie am Straßenrand geparkte Autos aus dem Nebel der Dämmerung auftauchten. Sie sahen aus wie gepanzerte Dinosaurier oder riesige prähistorische Gürteltiere. Häuser wurden zu nebelverhangenen, zerklüfteten Felswänden einer Schlucht aus dem Mesozoikum. Ich stellte mir gern vor, dass in dieser unwirklichen Welt alle Zeitalter quasi übereinandergestapelt existierten und Wesen aus grauer Vorzeit Seite an Seite mit denen aus der Zukunft lebten. Hier war es ebenso wahrscheinlich, auf ein verschrecktes Reh zu stoßen wie auf eine Drohne, die von irgendeinem sozial gestörten Nachbarskind gesteuert wurde. Meistens jedoch begegnete ich morgens keiner Menschenseele. Normalerweise war das der einzige Augenblick am Tag, wo ich mit meinem Körper allein sein konnte. Und zu reiner Bewegung wurde. In puncto Jogging war ich ein Gewohnheitstier. Ich trug immer dieselben Leggins, dasselbe Oberteil, dieselbe Sonnenbrille.
Ich brach immer um Punkt sechs auf. Wenn ich ein paar Minuten Verspätung hatte, fühlte ich mich den ganzen Tag lang im Rückstand. Ich nannte dieses Gefühl »meinen Arsch hinter mir herschleppen«. Ich vermied es gern. Ich hielt mich sklavisch an dieselbe Strecke, weil ich mich kannte – ich hatte einen hoffnungslos schlechten Orientierungssinn, und die Straßen in meinem Viertel verliefen im Zickzack und bildeten Schleifen, sodass ich mich sogar nach sechs Jahren noch verirrte.
Ashley und ich erstellten maßgeschneiderte gemeinsame Spotify-Playlists und gaben ihnen Namen wie »Death to Incels« (Bikini Kill, Hole, M.I. A.), »Hold My Drink« (Lizzo, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion) oder »Sad White Boys Anonymous« (Sufjan Stevens, Sam Smith, Bob Dylan). Am Morgen nach der ersten schlaflosen Nacht klickte ich Ashleys Playlist-Meisterwerk »Impeach President Krump« an, drehte die Lautstärke einen Tick höher als sonst und brach zügig auf. Trotz der Erschöpfung tat die Bewegung mir gut. Ich kam an all den vertrauten Gebäuden auf meiner Strecke vorbei, einer austauschbaren Kombination von Bungalows und zweistöckigen Häusern mit hellbraun gestrichenem Putz, Pseudo-Fensterläden und roten Dachziegeln, kiesbedeckten Vorgärten mit Yuccapalmen, prallen Sukkulenten und Fußwegen, die sich zu Haustüren schlängelten, die unter wuchtigen Torbögen verborgen waren. Ein paar Straßen weiter kamen dann nach und nach die Unterkünfte der Besserverdienenden, die mit mittelalterlichen Türmchen, Dachgauben im Neuengland-Stil, und neobarocken Giebeln eine von Zeit und Geschmack losgelöste Architektur anstrebten, die an die Königsschlösser aus Disneyfilmen erinnerte.
Ich kann mir immer noch nicht genau erklären, wie ich es zulassen konnte, dass ich selbst zu einem Teil dieser suburbanen Welt wurde. Paul hatte immer das Ziel gehabt, irgendwann ein »richtiges« Haus zu besitzen, die Art von Haus, die er jahrelang gebaut hatte. Das entbehrte nicht einer gewissen Poesie. Wir wollten beide, dass Ashley gewisse Dinge haben sollte, die wir als Kinder nie hatten. Wir wollten Ruhe, Platz und Fahrradwege für sie. Zu ihrem vierzehnten Geburtstag besorgte ich ihr einen Vibrator. Ich ließ mich von Paul überzeugen, dass ich das Alter erreicht hatte, in dem ich die Nähe zur Natur brauchte. Kleine Vögel, die in meinem Garten Nagetiere ausweideten. Einen unverstellten Blick auf den Himmel. Ich sagte mir: Hier ist das Leben lebendiger als in der Innenstadt. Inzwischen weiß ich, dass das natürlich nicht stimmte. Aber in einem stillen Raum klingt sogar ein Flüstern laut.
Als ich jetzt in den Cascadia Drive einbog, lief ich einer Gruppe Warnwesten tragender Bauarbeiter über den Weg. Sie standen herum und begutachteten einen zwölf Meter hohen Mast, den sie soeben ein paar Schritte von der Straße entfernt aufgestellt hatten. Irgendetwas an dieser aufrecht stehenden Stange kam mir beunruhigend, ja unheimlich vor. Wie ein außerirdischer Monolith. Während ich dort stand, tauchte meine Nachbarin Linda auf, die ihren gruseligen Hund spazieren führte. Ich habe keine Ahnung, um was für eine Rasse es sich handelt, aber er war ziemlich kahl und ziemlich grau. Im Morgennebel sah er wirklich wie eine Geistererscheinung aus. Ich begreife nicht, wie sich jemand ein derart untot aussehendes Tier kaufen kann. Linda kam auf mich zu, verschränkte die Arme und betrachtete die Stange. Sie stöhnte und schüttelte den Kopf.
»Tja, da ist sie also.«
Ich nahm an, sie meinte die Stange und nicht mich.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Das ist der Mobilfunkmast, von dem sie uns erzählt haben«, gab sie mir bereitwillig Auskunft. Sie verdrehte dabei die Augen, als wäre der Mast eine Freundin von uns, die gerade in einem besonders hässlichen Kleid aufgetaucht war, und wir brächten es nicht übers Herz, es ihr zu sagen.
»Wer hat uns davon erzählt?«, fragte ich.
»Wir hatten doch letzte Woche diese Benachrichtigung im Briefkasten.«
Ich gestand, dass ich mich nicht daran erinnern konnte. Lina erklärte mir, dass der Mast die Mobilfunk- und Datenversorgung im Viertel verbessern sollte.
»Mal sehen, ob das auch klappt«, sagte sie.
»Wahrscheinlich haben sie letzte Nacht angefangen, ihn aufzubauen«, erwiderte ich.
»Was ist denn?«
Diese Frage richtete sie an ihren Hund, der winselte.
Ich überlegte kurz, ob ich das Summen erwähnen sollte, und entschied dann, dass ich nichts zu verlieren hatte. Ich fragte Linda, ob es ihr aufgefallen sei. Ein brummendes Geräusch, sagte ich, das irgendwann letzte Nacht begonnen hatte. Sie blickte mich wieder an und legte den Kopf schief.
»Meinst du von dem Sendemast?«, fragte sie.
»Na ja, ich weiß nicht, genau das frage ich mich ja«, antwortete ich.
Sie blickte sich flüchtig um und zuckte die Schultern.
»Ich bezweifle, dass er schon in Betrieb ist«, sagte sie. »Sie haben ihn doch gerade erst aufgestellt.«
Ihr Hund zerrte an der Leine, er wollte weiter.
»Aber was weiß ich schon über diese Dinge?«, rief sie mir im Fortgehen zu.
Mit dem, was Linda nicht über diese Dinge wusste, hätte man garantiert ein Buch füllen können.
Im Laufe der nächsten Tage gelang es mir, mit ein paar Nachbarn zu sprechen, während sie in ihrem Garten arbeiteten oder den Müll rausbrachten. Wie es schien, hörte niemand sonst das Geräusch. Paul beteuerte weiterhin hartnäckig, dass er mir glaube. Das stimmte offenkundig nicht, aber ich wusste seine Unterstützung zu schätzen. Mit jedem Tag, der verstrich, wuchs seine Besorgnis. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich bekam Migräne, was vollkommen neu für mich war. Schwer zu sagen, ob der Auslöser das Geräusch war oder der Schlafmangel, aber sie war heftig, weiß Gott. Ich hatte weiterhin regelmäßig Nasenbluten. Dabei war das Geräusch wirklich nicht laut oder aggressiv. Es war bloß ständig da und zermürbte mich. Und doch begann ich manchmal selbst daran zu zweifeln, ob es existierte.
Ich ging weiterhin zur Schule, denn so bin ich nun mal – ich ziehe Sachen durch. Vor dem Unterricht nahm ich Aspirin und ließ die Fensterläden geschlossen. Eines Nachmittags musste ich meinen Vortrag zu Toni Morrisons Menschenkind in eine offene Diskussion umwandeln, damit ich mich hinsetzen und sammeln konnte. Dabei stellte mir ein Schüler eine Frage, die ich überhörte. Dies wurde mir erst bewusst, als ich aufblickte und feststellte, dass die gesamte Klasse mich anstarrte. Ein anderer Schüler fragte, ob alles in Ordnung sei. An diesem Punkt dachte ich, dass es vermutlich beunruhigender wäre, Normalität vorzutäuschen, als das Problem direkt anzusprechen. Also fragte ich die Schülerinnen und Schüler, ob sie es auch hören könnten.
»Wie ein tiefes, vibrierendes Summen«, sagte ich. »Einfach irgendwo im Hintergrund.«
Ich musterte ihre verdutzten Gesichter. Keiner sagte ein Wort.
»Oder ist es … Oder ist es bloß in meinem Kopf?«, stammelte ich.
Auf einmal kam ich mir lächerlich vor.
![Das Summen. Die Ereignisse am Sequoia Crescent [Ungekürzt] - Jordan Tannahill - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/affe6a53599dffd5b4164e2dce411ec6/w200_u90.jpg)