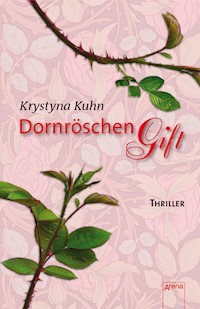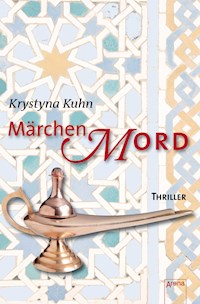5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Das Tal
- Sprache: Deutsch
Remembrance Day! Ein Tag mit einer besonderen Bedeutung für Chris. Und nichts wünscht er sich sehnlicher, als mit Julia über den Feiertag aus dem Tal zu verschwinden, wie die anderen Studenten auch. Doch als sie endlich aufbrechen wollen, zieht ein Jahrhundertsturm auf. Chris, Julia, Debbie, Rose und Benjamin werden von der Außenwelt abgeschnitten. Aber im verlassenen College geht es nicht mit rechten Dingen zu. Wohin ist der Sicherheitsbeamte Ted verschwunden? Warum verhält sich Debbie so seltsam? Und wer spielt ihnen die DVD mit Bildern in die Hände, die direkt in die Vergangenheit des Tals führen? Während der Sturm seinen Höhepunkt erreicht, wird Chris klar, dass ein Unbekannter ein perfides Spiel mit ihnen treibt. Die Frage ist nur, wer ist es und auf wen hat er es abgesehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Krystyna Kuhn
DAS TAL – Season 1
___________________
Der Sturm
Band 3 der Serie
Thriller
Veröffentlicht als E-Book 2010
© 2010 Arena Verlag GmbH, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Frauke Schneider
ISBN 978-3-401-80120-9
www.arena-verlag.de
Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Prolog
Vorabend zum 11. November 2010
Heilige Maria, Mutter Gottes!Heilige Jungfrau über allen Jungfrauen!
Julia kämpfte sich den Weg entlang. Überall stand das Wasser und machte das Vorwärtskommen schwer. Seit letzter Nacht regnete es immerzu und dazu dieser ekelhafte Wind, der ihr den kalten Regen ins Gesicht schlug.
Warum ihr ausgerechnet heute diese blöde Litanei in den Kopf kam, konnte sie nicht verstehen. Es war ja nicht so, dass Julia religiös erzogen worden wäre, obwohl – immerhin hatte sie eine katholische Schule in Berlin besucht.
Julias Blick ging zum Himmel. Kein einziges Loch, nicht die kleinste Lücke war in dem dunklen, wolkenverhangenen Himmel zu erkennen.
11. November. Remembrance Day. Der Tag, der Toten zu gedenken. Julia war seit über einem Monat nicht mehr am Gedenkstein gewesen, und als sie an diesem Morgen aufgewacht war, hatte sie auch noch nicht geplant, hierher zu gehen. Und dann plötzlich, während Brandons Philosophieseminar und seinen öden Ausführungen zu Friedrich Nietzsche, waren ihr die Heiligen eingefallen. Was umso verwunderlicher war, da sie kaum noch auf Deutsch dachte. Selbst wenn sie mit ihrem Bruder Robert alleine war, sprachen sie Englisch.
Wieder peitschte der Wind ihr den Regen ins Gesicht – riesige, fast waagrechte Tropfen, wie graue Fäden, die sich wie Nadelstiche im Gesicht anfühlten. Winterkälte hing in der Luft. Sie war viel zu dünn angezogen für dieses Wetter und bereits völlig durchnässt. Um sie herum nichts als graugrüner Wald aus Fichten, die in den dunklen Himmel stachen. Sie glichen einander, weil sie alle um dasselbe Ziel kämpften – Licht.
Die Bäume mit ihren kahlen Ästen reckten ihre skelettartigen Zweige irgendwie grotesk in den Himmel und Julia hatte Mühe, durch den feuchten, nassen Waldboden zu stapfen. Ihre Schuhe waren jedenfalls ruiniert.
Sie hatte keine Blumen dabei, im gesamten College waren keine aufzutreiben gewesen, nicht einmal diese künstlichen Mohnblumen, die man in Kanada am Remembrance Day auf die Gräber legte. Sie kam sich nackt vor, als ob sie mit leeren Händen zum Grab ihres Vaters ging. Nein, nicht zu seinem Grab. Aber zu der einzigen Gedenkstätte, die sie hier oben hatte.
Heilige Perpetua!
Dieser Name hatte ihr immer am besten gefallen.
Ihr heiligen Märtyrer, bittet für uns!
Vielleicht hatte sich diese Aufzählung auch nur in ihr Gedächtnis gebrannt, weil sie sich zusammen mit ihren Klassenkameradinnen über die Namen kaputtgelacht hatte, damals bei den Schulgottesdiensten in der Aula. Und vielleicht war wohl auch so etwas wie Hoffnung hängen geblieben, in wirklich beschissenen Situationen im Leben könnten diese Heiligen tatsächlich helfen.
Julia wurde langsamer, als sie endlich an der Brücke anlangte, hinter der das Sperrgebiet begann. Von hier aus zweigte der Weg zur Lichtung mit dem Gedenkstein ab.
Durch die heftigen Niederschläge des letzten Tages, teilweise Regen, teilweise Schnee, hatten sich die Holzbohlen der Brücke mit Feuchtigkeit geradezu vollgesaugt. Julia spürte unter den Sohlen ihrer Turnschuhe, wie glitschig sie waren.
Und der Wasserfall schoss mit voller Wucht die Felsen herunter. Das Tosen ging Julia durch Mark und Bein. Ihr Gesicht war bereits völlig nass.
Sie stemmte sich gegen den Wind und blickte zurück zum College. Fast alle Räume in den oberen Stockwerken des Hauptflügels waren hell erleuchtet, dazu noch die Seminarräume, die Mensa und die Empfangshalle. Das College wirkte wie ein Fremdkörper in dieser Landschaft. Etwas, das man mitten in die Natur gestellt hatte und das hier nicht hergehörte.
Die hellen Lichter erinnerten Julia einen Moment lang an die Titanic und daran, wie dieser Riesendampfer, dem Untergang geweiht, mitten in der Nacht direkt auf den Eisberg zusteuerte.
Nur dass es keine Nacht war, sondern einfach nur ein regnerischer Tag im November.
Und dass sie nicht auf einem Ozean waren, sondern im Tal.
Was manchmal aufs Gleiche hinauskam, dachte Julia.
Trügerisch schön. Gottverlassen. Und unvorstellbar grausam.
Sie biss die Zähne zusammen und folgte dem engen Trampelpfad durch das Unterholz. Unwillkürlich wurde sie schneller. Etwas an diesem Ort zog sie magisch an, dann wieder fühlte sie sich abgestoßen.
Warum kam sie nur immer wieder hierher?
Weil du diesen Ort brauchst, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf.
Julia hatte Chris nicht erzählt, warum sie einmal im Monat zum Gedenkstein ging, um Blumen niederzulegen. Und sie hatte ihm auch nicht erzählt, dass sie heute am Vorabend zum Remembrance Day hier heraufmusste, egal wie schlecht das Wetter war.
Morgen würden sie zusammen wegfahren. Etwas in ihr fürchtete sich davor, die nächsten Tage allein mit ihm zu verbringen. Wie lange würde sie durchhalten, ohne ihm etwas über ihre Vergangenheit zu erzählen? Immer wieder stellte er Fragen. Nach ihren Eltern, der Schule, auf die sie gegangen war, nach ihrem Leben in London. Es fiel ihr so schwer, ihm ständig Lügen aufzutischen.
Der Anstieg wurde jetzt steiler, mehrfach rutschte sie auf dem schlammigen Untergrund aus und musste sich an vorspringenden Wurzeln festhalten. Der Regen drang selbst hier im dichten Wald bis auf die Knochen, auch wenn sie vom Wind weitgehend geschützt war.
Gott sei Dank war es nicht mehr weit.
Julia hätte den Weg im Schlaf gehen können. Sie erinnerte sich, wie sie auf den Gedenkstein gestoßen war. Ein halbes Jahr war inzwischen vergangen, seit sie in Panik durch den Wald gestürzt war und die Lichtung gefunden hatte. Hier hatte sie das erste Mal den Namen ihres Vaters Mark de Vincenz auf dem Grabstein gelesen.
Inzwischen brauchte Julia nicht länger als eine Viertelstunde von der Brücke bis zur Lichtung.
Gleich, gleich würde sie da sein.
Und dann blieb sie irritiert stehen. Etwas war anders als sonst. Der Lichteinfall durch die Bäume. Es musste an diesem verdammten Wind der letzten Tage liegen. Vermutlich hatte er einige Bäume umgestürzt.
Nein, etwas anderes war passiert. Die schlanken hohen Fichten, die früher hier dicht an dicht gestanden hatten, waren gefällt worden und die Stämme spurlos verschwunden.
Entstanden war eine kreisrunde Lichtung, in deren Mitte sich der Gedenkstein wie ein Mahnmal in den Himmel erhob. Und jemand hatte das Efeu vom Gedenkstein entfernt und den Stein gereinigt. Die Namen, bis vor Kurzem noch verwittert und kaum lesbar, sprangen ihr nun geradezu entgegen.
Und noch etwas.
Julia gab keinen Laut von sich, aber in ihrem Inneren bildete sich ein Schrei.
Etwa einen Meter neben dem Stein war ein hohes Kreuz aus frischem Holz aufgestellt worden. Und daneben erkannte sie ein dunkles Rechteck. Frisch aufgeworfene Erde türmte sich am Kopfende.
Julia brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie da vor sich hatte. Doch dann fuhr sie herum und rannte.
Dort, wo das Kreuz stand, hatte jemand ein Grab ausgehoben. Und während Julia sich ihren Weg blindlings durch das Unterholz suchte, wiederholte sie in ihrem Kopf immer dieselben Zeilen.
Herr!
Wir bitten dich, erhöre uns!
1. Kapitel
Der 11. November. Endlich!
Chris starrte durch die Regenschlieren hinunter auf den Parkplatz des Campus. Der Regen schien über Nacht etwas nachgelassen zu haben, obwohl der Himmel noch immer wolkenverhangen war und der Wind kräftiger blies als am Tag zuvor. Und immer wieder tauchten vereinzelt Schneeflocken auf, die an der Fensterscheibe kleben blieben, weiß und durchscheinend wie die Flügel lästiger Fliegen, als würden sie angezogen vom Licht in seinem Zimmer.
Es war nicht später als neun Uhr morgens und draußen auf dem Collegecampus herrschte reges Treiben, wenn nicht sogar Chaos. Die Studenten luden vollbepackte Rucksäcke, Taschen und Koffer in die bereitstehenden Autos und Busse, bevor sie selbst einstiegen. Chris beobachtete grinsend, wie Ike, die schwarze Dogge, sich weigerte, in den Kofferraum von Professor Brandons alten Chrysler zu springen. Kläffend sprang er um den Wagen herum und der Philosophieprof versuchte vergeblich, ihn anzuleinen.
Erst gestern hatte Brandon ihnen einen Vortrag über Friedrich Nietzsches Theorie »Über den Willen zur Macht« erzählt und dabei hatte er nicht einmal seinen Hund im Griff.
Chris sah nun bereits zum x-ten Mal auf die Uhr. 09:10 Uhr.
Nicht mehr lange und auch er würde hier oben verschwunden sein.
Vier Tage nur er und – Julia. In einem Zimmer, in einem Bett. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten, sie konnten sich... endlich richtig kennenlernen.
Mann, er hatte so viele Stunden für dieses Wochenende gearbeitet. Dutzende Essays für Mitstudenten verfasst, um sich das Ganze leisten zu können. Und es hatte noch einmal so lange gedauert, bis er Julia überreden konnte, überhaupt mitzukommen.
Chris war zwölf gewesen, als seine Mutter seinen Vater verließ, weil er Alkoholiker war und zudem einen gewaltigen Berg Schulden angehäuft hatte. Chris trug Zeitungen aus, um seine Mutter zu unterstützen, und arbeitete später in den Schulferien in einer Druckerei. Er lernte, wie schwer es war, Geld zu verdienen – und wie leicht es war, es wieder auszugeben.
»Ich will nicht, dass du das alles bezahlst.« Julia konnte beharrlich sein.
»Das ist ein Geschenk, Julia. Mein Geschenk für dich. Geschenke nimmt man an, sonst ist der Schenkende beleidigt.«
»Und Robert?«
»Wie alt ist dein Bruder? Siebzehn, oder? Da wird er ja wohl ein Wochenende ohne dich verbringen können.«
Nach und nach hatte er ihre Argumente widerlegt und ausgerechnet David hatte den entscheidenden Ausschlag gegeben. Chris wohnte zwar schon seit einem halben Jahr mit David Freeman in einem Apartment, aber er konnte nicht gerade behaupten, dass sie Freunde waren. Am Anfang vielleicht. Aber dann war die Freundschaft mit David unmöglich geworden. Denn David war in Julia verliebt.
Chris warf seinen Kulturbeutel in die Tasche. War er froh, dieses quadratische Kabuff, das sich sein Zimmer nannte, für eine Weile hinter sich zu lassen. Chris bewahrte hier nur wenige persönliche Gegenstände auf. Seinen Laptop, ein paar Bücher auf dem Regalbrett über dem Bett und das alte Radio seines Vaters auf dem Schreibtisch, das Dad früher immer mit sich herumgeschleppt hatte. Und das ständig lief, sobald Chris sich in seinem Zimmer aufhielt. Wie jetzt auch.
Als der Sprecher den Wetterbericht ankündigte, drehte Chris die Lautstärke nach oben.
»Der Sturm hat auf seinem Weg über die nördlichen USA viel Unheil angerichtet und zahlreiche Verletzte sowie zwei Tote gefordert. Nun ist er über Edmonton angekommen und gewinnt zunehmend an Stärke. Die Meteorologen beobachten den untypischen Verlauf des Orkans mit großer Sorge und vergleichen ihn schon mit dem großen Sturm im Januar 1998.«
»Hey, Chris, wir fahren dann.«
Chris drehte sich um. David stand in der Tür, den Rucksack über dem Arm. »Mach’s gut!«
»Ihr auch!«
»Und...« David zögerte.
»Was?«
»Sag Julia, dass Robert sich bei meinen Eltern wohlfühlen wird.«
Chris nickte ihm zu. »Nett von dir, ihn einzuladen.«
David zuckte mit den Schultern. »Wir beide kommen gut klar und es war schließlich offensichtlich, dass du . . .«, er zögerte wieder, »keinen großen Wert auf Roberts Anwesenheit legst.«
»Tja, wie gut, dass es einen heiligen Samariter namens David gibt!« Chris gab sich keine Mühe, den ätzenden Klang seiner Stimme zu verbergen.
»Robert ist mein Freund«, antwortete David bestimmt. »Deshalb habe ich ihn eingeladen.«
»Und Julia ist meine Freundin. Deswegen habe ichsieeingeladen.«
Chris wandte David ohne weiteren Abschied den Rücken zu und trat ans Fenster. Der Horizont im Osten war pechschwarz und der See erinnerte mehr denn je an einen Krater, dessen Tiefe niemand wirklich kannte. Bei seinem Anblick verstärkte sich das Gefühl der letzten Tage: das Novembergefühl, wie Chris es insgeheim nannte. Auch der 11. November vor einem Jahr war einer dieser dunklen Tage gewesen, an denen sich die Sonne nicht zeigte. Chris erinnerte sich an diesen Tag deutlicher als an jeden anderen in seinem Leben. Der ganze Monat war als die nervenaufreibendste Zeit in seinem Leben abgespeichert. Die Anrufe, die zunehmend düsteren Nachrichten, die Besuche im Krankenhaus. Die totale Überforderung. Dieser Monat hatte sich angefühlt, als hätte man ihn allein in einen schaukelnden Waggon gesetzt und ein Mann in einer Uniform hätte den Knopf gedrückt. Die Fahrt in einer Achterbahn war nichts dagegen. Er hatte sich noch so gefühlt, als er hier im Grace angekommen war. Um die Wahrheit zu sagen, war die Fahrt erst zu Ende gekommen, als er Julia begegnet war.
Am liebsten hätte er ihr das immer wieder gesagt, aber er wusste, wie wenig Nähe Julia manchmal ertragen konnte. Die anderen hielten ihn vielleicht für einen emotionalen Loser, aber Chris spürte sehr wohl, wann sie Zeit brauchte, um sich zurückzuziehen.
Fakt war, dass Chris noch nie Gelegenheit gehabt hatte, Julia seine Geschichte in Ruhe zu erzählen. Wie auch? Sie waren hier im College ja kaum allein – ausgenommen die Nächte, wenn Julia es schaffte, sich unbemerkt aus dem Apartment zu schleichen, was nicht einfach war mit Debbie als Wachhund.
Nervös ging er zum Radio und schaltete es aus. Er fürchtete sich davor, den Winter hier oben verbringen zu müssen. Manchmal konnte er den eintönigen Alltag am College einfach nicht ertragen. Wenn sich scheinbar nichts bewegte, nichts veränderte, aber man spürte, dass im Tal etwas nicht stimmte, etwas unter der Oberfläche lauerte, worüber kaum jemand sprach.
Zunächst war es nur ein Geräusch, das nur langsam zu ihm durchdrang, doch dann wurde es zu der Melodie aus dem Western High Noon.
Sein Handy.
Unbekannter Anrufer.
Rangehen oder ignorieren? Aus Gewohnheit oder Neugierde – Chris’ Zeigefinger lag bereits auf der grünen Taste.
»Hallo?«
»Ich bin’s.«
Wie immer, wenn er Julias Stimme hörte, spürte er dieses Gefühl von Erleichterung. Sie war noch da, war nicht verschwunden, sie dachte an ihn. Und er fühlte sich auf einmal unglaublich gut gelaunt, sein Herz pochte aufgeregt und sein Körper war plötzlich wie durch ein Wunder voller Energie.
»Von wo aus rufst du an? Bist du etwa alleine losgefahren? Ohne mich?«
»Nein, ich...«
Eine Stimme im Hintergrund.
»Was wolltest du sagen?«
»Ich will so schnell wie möglich hier weg, Chris.«
»Kein Problem. Ich bin fertig. Wo bist du?«
»Ich sitze in der Eingangshalle. Einer der Securitybeamten, Mr Mason, hat mir sein Handy geliehen.«
In der nächsten Sekunde hörte Chris wieder die tiefe Stimme im Hintergrund und spürte einen Stich. Mason? War das nicht dieser Steve? Ein groß gewachsener Typ mit breiten Schultern und einem abscheulichen Akzent, der seine Herkunft aus Texas verriet? Und der mit Vorliebe mit den hübschesten Studentinnen flirtete? Chris kannte ihn von den Drogenkontrollen, die am Grace regelmäßig durchgeführt wurden und bei denen sich der Wachmann aufführte, als befänden sie sich hier in der Bronx und nicht an einem Elitecollege.
Debbie schwärmte immer, er sähe aus wie Edward aus Twilight – nur in Blond.
»Moment, warte mal.« Julia rief einen Abschiedsgruß, dann sprach sie wieder in den Hörer. »Ich habe jedenfalls fertig gepackt. Kommst du?«
»Du klingst irgendwie... aufgeregt. Fast als ob du es nicht abwarten kannst.«
Eine kurze Pause. Dann hörte er Julia lachen, aber es klang nicht fröhlich. »Ich sag doch: Nichts wie weg.«
Chris zögerte. Julia war bereits am Abend zuvor seltsam gewesen. Traurig. Ja, geradezu verstört. Doch er hatte lediglich aus ihr herausgebracht, dass sie am Gedenkstein gewesen war. Und dann hatte sie seine Hand genommen und geflüstert: »Bitte frag mich nicht.«
Und nun war sie so gezwungen fröhlich, irgendwie aufgekratzt. Es kam immer wieder vor, dass Julia den anderen etwas vorspielte, das wusste Chris genau. Und nicht nur den anderen. Auch ihm.
Er hatte schon oft versucht, sie darauf anzusprechen, aber jedes Mal war er an einer Mauer des Schweigens gescheitert. Chris kannte den Grund nicht, aber er hoffte, er würde dieses Wochenende irgendeine Schwelle überschreiten. Und würde damit endlich und unwiderruflich ihr Vertrauen gewinnen.
»Hey, wie kommt es eigentlich, dass du mit dem Packen schon fertig bist? Du bist ein Mädchen! Das ist wider deine Natur«, sagte er möglichst locker. »Sind Rose und Benjamin etwa auch schon unten?«
»Rose müsste jede Minute hier sein. Aber keine Ahnung, wo Debbie steckt. Sie war nicht im Apartment.«
»Die hätte ich glatt vergessen!« Chris seufzte. Warum er sich hatte breitschlagen lassen, nicht nur Ben und Rose, sondern auch noch Debbie mit nach Vancouver zu nehmen, war ihm schleierhaft. Julias Mitbewohnerin Rose war okay und Chris’ Freund Ben sowieso – aber Debbie?
»Wenn sie nicht rechtzeitig auf dem Parkplatz ist, fahren wir ohne sie.«
»Chris!« Julias Stimme klang weniger tadelnd als abgelenkt, als wieder die tiefe männliche Stimme im Hintergrund ertönte und Julia offenbar eine Frage stellte.
Julias Antwort konnte Chris nicht verstehen. Dann sprach sie wieder ins Handy. »Okay, ich warte in der Halle auf dich. Bis gleich.«
»Was will der Typ...«
Doch Julia hatte bereits aufgelegt.
Chris ging bei Ben vorbei, der noch seine Kameraausrüstung einpackte und versprach, in ein paar Minuten nachzukommen. Sie würden Rose am Flughafen in Vancouver absetzen, Debbie zu ihrer Großmutter bringen, die in der Nähe von Vancouver wohnte, und Benjamin . . . »Setz mich einfach irgendwo ab«, hatte Ben gesagt. »Ich werde sehen, wohin mich das Schicksal führt.«
Auf dem Weg nach unten geriet Chris in den Strom der Studenten, die sämtliche Aufzüge blockierten und auf den Treppen an ihm vorbeirannten. Überall standen Rucksäcke, Taschen und Koffer im Weg; Gelächter und fröhliche Stimmen klangen durch die Gänge.
Alessa und Katja kamen ihm entgegen, die beiden waren Freundinnen von Rose und Julia. Chris kannte sie aus dem Französischgrundkurs, wo sie sich zusammen bei Professor Forsters Ausführungen langweilten.
»Hey Chris«, rief Katja. »Happy Remembrance Day.« Sie lachte und folgte Alessa, die einen Rucksack schleppte, der so riesig war, als plane sie eine wochenlange Tour durch Europa. Chris winkte ihnen zu und lief hinüber zum Treppenaufgang, um ins Erdgeschoss zu gelangen.
Das College hatte keine normalen Semesterferien und auch nicht den üblichen Spring Break. Stattdessen schloss es ausgerechnet für den Remembrance Day für vier Tage. Die Studenten schien es nicht weiter zu stören, dass sie die ersehnten freien Tage auf Kosten der Toten hatten. Hauptsache, sie hatten Spaß, so schien das allgemeine Motto zu lauten.
Als Chris die Empfangshalle betrat, sah er sich suchend um. Auf dem riesigen Flachbildschirm an der Wand rechts liefen die Nachrichten von CNN. Schneebedeckte Fahrbahnen, umgestürzte Bäume, Autos, die auf die Gegenfahrbahn rutschten, dann eine Reihe von Trucks, die ineinandergefahren waren. Ein rotes Band mit Unwetterwarnungen für die Mountain-States bis hoch nach Kanada lief über den Bildschirm.
Höchste Zeit, dass sie loskamen. Hier oben war das Wetter sowieso schon unberechenbar – und mit einem Sturm dieser Größenordnung wollte es Chris auf der Fahrt lieber nicht zu tun bekommen.
Er sah sich suchend um und wenig später entdeckte er Julia. Sie saß in einem der Sessel in der Nähe vom Kamin. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, an diesem Tag den offenen Kamin anzufeuern, und offenbar schaffte es die Heizung nicht, wenigstens eine Spur von Wärme in den riesigen Raum zu bringen. Es war ungemütlich kalt hier.
Chris spürte, wie sein Herz einen Satz machte. Julia trug die dicke dunkelbraune Daunenjacke, die sie zusammen in Fields gekauft hatten. Ihr halblanges hellbraunes Haar trug sie offen, es rahmte ihr schmales blasses Gesicht ein, zu dem die grünen Augen einen Kontrast bildeten, der ihm jedes Mal den Atem raubte.
Julia sah hinaus auf den Lake Mirror und Chris wusste selbst nicht, weshalb er auf diesen bescheuerten Gedanken kam – ja –, es war eine alberne Idee, aber Gott, ein bisschen Spaß musste sein, oder? Er schlich über die massiven Stein-platten, und noch bevor er Julia erreicht hatte, hatte er bereits die Hände ausgestreckt. Als er dann hinter ihr stand und Julia immer noch nichts von seiner Anwesenheit ahnte, legte er seine Finger um ihren Nacken.
Sie schwebten den Bruchteil einer Sekunde in der Luft und dann endlich spürte er ihre Haut. Nein, er drückte nicht zu. Wollte sie nur ein wenig erschrecken.
Julia schrie nicht, wie Chris es erwartet hatte. Sie sprang auch nicht wie von der Tarantel gestochen hoch. Sie schien vielmehr unter seiner Berührung zu erstarren. Chris konnte es regelrecht bis in die Fingerspitzen fühlen, dass ihre Haut kalt wurde und ihre Muskeln sich zusammenzogen.
Augenblicklich ließ er sie los.
»He«, sagte er leise. »Ich bin es, Chris. Alles okay!«
Nicht einmal jetzt rührte sie sich. Er ließ die Arme sinken, ging um den Sessel herum, beugte sich zu ihr hinunter und gab ihr einen Kuss.
»Was ist denn los, Julia?«, fragte er.
Sie antwortete nicht, ja, sie schien ihn nicht einmal gehört zu haben. Sie hatte sich wieder einmal völlig in sich zurückgezogen. Genau das Gegenteil von dem, was Chris gewollt hatte. Aber daran hätte er früher denken sollen. Er war manchmal so ein Idiot.
»He!« Er nahm ihr Gesicht in beide Hände. Ihre Züge wirkten völlig verkrampft, ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten ihn entsetzt an. Der Mund, halb geöffnet, brachte keinen Laut hervor. Dieses Gesicht, es war ein Meer von Traurigkeit, und Chris wünschte sich, er hätte nicht versucht, Julia zu erschrecken, er wünschte sich, er könnte derjenige sein, der diese Traurigkeit für immer verbannen würde.
Aber ihr Gesicht entspannte sich nicht bei seinem Anblick, stattdessen stieß sie ihn zur Seite. Und ihr Blick wurde schwarz vor Wut.
»Macht dir das eigentlich Spaß?« Julias Stimme war gefährlich leise.
»Es tut mir leid!« Er schüttelte den Kopf.
»Bist du verrückt geworden, mich so zu erschrecken?«
»Entschuldige.«
»Manchmal glaube ich wirklich, dich macht es glücklich, mir Angst einzujagen.«
Chris hob die Arme und beugte sich zu ihr. »Julia, es tut mir leid, ja? Ich vergesse einfach manchmal, wie schreckhaft du sein kannst.«
Sie schob ihn von sich weg, stieß ihm ihre Hand gegen die Brust und Chris konnte nichts weiter tun. Er musste abwarten, bis sie sich wieder beruhigt hatte.
»Wann kapierst du endlich, dass eine Entschuldigung kein Mittel ist, um für jeden Scheiß, den man macht, einen Freibrief zu bekommen? Ich hasse es, wenn...«
Julia brach ab. Wie immer. Chris kannte das schon. Sie wollte nicht weiterdiskutieren, zog sich in sich selbst zurück. Und es würde vermutlich Stunden dauern, sie dort wieder hervorzulocken.
»Kann ich Ihnen helfen, Julia?«, erklang eine Stimme hinter ihnen.
Steve Mason.
Der hatte Chris gerade noch gefehlt.
Der Security-Mann, höchstens fünf, sechs Jahre älter als Chris selbst, trat zu ihnen an den Kamin.
Julia schüttelte den Kopf. »Nein, alles in Ordnung.«
Mason deutete auf den Bildschirm und sagte in seinem breiten Akzent: »Haben Sie die Nachrichten gesehen? Das ist kein gewöhnlicher Sturm, der da aufzieht. Und am Pass ›White Escape‹ kann es verdammt ungemütlich werden. Sehen Sie zu, dass Sie loskommen.«
»Ja doch, Mann«, sagte Chris ungehalten. »Wir sind ja keine Kleinkinder mehr! Und außerdem wird es schon nicht so schlimm werden.«
»Ach nein?« Der Wachmann zog eine Augenbraue in die Höhe. Dann warf er Julia einen Blick zu und grinste anzüglich. »Na ja, so ein Sturm hat auch Vorteile. Zumindest, wenn man jemanden hat, der einen wärmt.«
Breites, unverschämtes Grinsen. Ein Augenzwinkern.
Chris registrierte zähneknirschend, dass Julia das schmierige Lächeln erwiderte. Tat sie das, um ihn zu ärgern? Wollte sie sich rächen, weil er sie eben so erschreckt hatte? Und wieso fiel es ihr so leicht, jeden x-beliebigen Typen anzulächeln? Es sah irgendwie wahllos aus.
Der Wachmann überragte Chris um einen Kopf. Er hatte ein breites Gesicht unter einer dieser blonden Kurzhaarfrisuren, die ihn immer an einen amerikanischen Marine erinnerten. Früher einmal hätte Chris Typen wie Steve Mason bewundert. Den durchtrainierten Körper und die Muskeln, die sich unter der dunkelblauen Jacke abzeichneten.
Aber heute? Heute sah er nur, wie der Mann Julia anstarrte. Als ob er sie mit seinen Blicken ausziehen wollte.
»Wird schon nicht so schlimm werden, Steve«, sagte Julia leichthin.
Seit wann redete sie ihn mit Vornamen an?
»Wollen wir es hoffen, Julia. Während der freien Tage sind wir nur zwei Security-Leute hier oben. Das College spart mal wieder an allen Ecken und Enden. Und wir müssen es ausbaden.«
Steve Mason hob die Hand und winkte einem zweiten Wachmann zu, der gerade die Halle durchquerte, die sich mittlerweile merklich geleert hatte. »He, Ted, das Hausmeisterteam hat sich noch um die Sturmgitter gekümmert, bevor sie gefahren sind«, rief er ihm zu. »Aber wir müssen die Apartments kontrollieren, ob keiner vergessen hat, die Fenster zu schließen.«
Sein Kollege war zwei Köpfe kleiner als Steve und mochte so Mitte fünfzig sein. Chris kannte ihn nicht. Sein Gesicht war gerötet und das kam vermutlich nicht nur vom Übergewicht. Die Zugluft der offenen Eingangstür blies Chris eine Alkoholfahne ins Gesicht. »Wenn’s sein muss«, murmelte der Mann missmutig.
Steve runzelte die Stirn. »Ja, es muss sein«, sagte er ungerührt. »Ich übernehme die Südseite, wenn du den Nordflügel kontrollierst.«
Er wandte sich zum Gehen.
Na endlich! Chris würde für nichts garantieren, wenn der Typ Julia weiter so anstarrte!
Zum Abschied winkte Steve Julia lässig zu. »Auf Wiedersehen, meine Schöne. Und geben Sie gut acht, bei wem Sie heute ins Auto steigen.«
Ein spöttisches Lächeln lag auf seinen Lippen.
2. Kapitel
Debbie ließ sich auf den Stuhl in der verwaisten Küche des Apartments fallen, griff in die speckige Chipstüte, schloss die Augen und rief sich die Liste mit der Nummer 8 ins Gedächtnis.
Liste No. 8 – Leute, die ich am meisten hasse:
Jake!
Superdad Wilder, der gemeinste Stiefvater ever!
Benjamin, weil er bestimmt schwul ist!
Julia, weil sie kaum noch in ihrem eigenen Zimmer übernachtet!
Debbie hatte früh in ihrem Leben angefangen, Listen anzulegen. Sie war vielleicht acht oder neun Jahre gewesen. Genau konnte sie sich nicht mehr erinnern, wann sie beschlossen hatte, sorgfältig zu vermerken, was sie an einem Tag gemacht hatte. Und zwar nicht in Form eines dieser Tagebücher, wie es andere Mädchen in ihrem Alter führten. Debbie hatte von Anfang an Listen bevorzugt. Nummerierte Aufzählungen ihres Lebens. Zum Beispiel:
Dreimal Zähne geputzt.
In der Schule sieben Lehrer auf dem Flur gegrüßt.
1,75 Dollar für Kosmetik ausgegeben.
Diese Woche nur drei Tüten Chips gegessen.
Ein oder zwei Jahre später veränderten sich die Listen und Debbie war stolz auf ihre Fähigkeit, sich jedes noch so kleine Detail zu merken. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass jemand von den anderen hier, weder diese arrogante Julia Frost noch Chris Bishop mit seinen ungeduldigen grauen Augen, ja nicht einmal Robert Frost diese Perfektion besaßen, derartige Listen aus dem Stegreif entwickeln zu können und jederzeit abrufbereit zu haben, ohne sich etwas aufschreiben zu müssen.
Fünfmal Mr Hill auf dem Handy angerufen und wieder aufgelegt.
Dreimal Katies Handtuch benutzt.
Sechsmal die Security informiert über illegale Partys.
Fünfzehn Seiten Aufsatz zum Thema Marcel Proust geschrieben.
Jake einen Pornofilm aus Benjamins Zimmer geschickt.
Mrs Forsters roten Schal gestohlen.
Sie war eben nicht so dumm, wie die anderen dachten. Sonst hätte sie ja auch nie die Aufnahmeprüfung für das Grace geschafft. Es gab unendlich viele Listen in ihrem Kopf. Und sie vergaß keine.
Im Apartment war es still. Debbie gefiel das. Katie, Julia und sogar Rose, die liebe, geduldige Rose, hatten immer etwas zu meckern. »Friss nicht so viel!«
»Lass meine Schokolade in Ruhe!«
»Bist du endlich fertig im Bad?«
Dabei waren sie ja alle so was von blöd. Katie vor allem, Rose und natürlich Julia.
Julia Sweety.
Julia Darling.
Julia forever.
Die und ihr Chris – sie machten immer einen auf Romeo und Julia, aber sosehr sie sich auch Mühe gaben, Debbie durchschaute ihr Theater. Große Liebe? Ha! Das war etwas für Teenies, die sich in die Hose machten, wenn irgendein Star ihnen aus einem Magazin entgegenstarrte. Und sie wusste sehr wohl, dass Julia keineswegs so sehr in Chris verliebt war, wie der glaubte. Und Chris war verdammt eifersüchtig.
Chris und Julia – das roch geradezu nach einem Drama. Debbie wartete schon seit Wochen, genauer gesagt seit der Sache am Ghost, dass der fünfte Aufzug begann. Bisher aber wartete sie vergeblich.
Sie griff wieder in die halb leere Chipstüte und zog eine Handvoll von diesen leckeren Paprikachips heraus. Oh mein Gott, die waren so lecker und knusprig – sie könnte sterben für dieses Zeug.
Aber – sterben würde sie vermutlich eher vor Langeweile an diesem Wochenende, das sie bei Grandma Martha verbringen sollte, während Chris und Julia...
Debbie seufzte. Manche Leute hatten einfach nur Glück in ihrem Leben.
Ihr Blick fiel auf die große Küchenuhr. Sie hätte längst unten in der Empfangshalle sein sollen. Rose, die vor einer Viertelstunde das Apartment verlassen hatte, hatte ihr eingeschärft, pünktlich zu sein. Irgendein bekloppter Sturm sollte aufziehen.
Debbie kicherte. Ein Sturm. Huh! Da hatte sie aber Angst.
Was, wenn sie jetzt einfach nicht ging? War doch keine schlechte Idee, die alle mal ein bisschen schmoren zu lassen.
Schließlich konnten sie nicht ohne sie fahren. Sie hatte ihren Anteil am Wagen bezahlt.
Debbie rappelte sich auf. Hier oben würden sie als Erstes nach ihr suchen. Am besten verzog sie sich ins Computer-Department. Sie hatte sich lange nicht mehr in ihren Lieblingsforen herumgetrieben. Und wer wusste es schon, vielleicht würde sie heute eine Lücke in Angela Finders Sicherheitsnetz finden. Irgendwo mussten sie liegen – die Geheimnisse ihrer Freunde. Und was erhält die Freundschaft besser als Geheimnisse?
Das CD im zweiten Untergeschoss war genauso leer wie die Gänge und Flure des Colleges. Debbie überlegte, ob sie wieder gehen sollte. Seit dem Tag im Mai, als Alex durchgedreht war, hielt sie sich nicht gerne allein hier unten auf.
Wieder griff die Hand in die Chipstüte.
Ach was. Sie hatte sich vorgenommen, die anderen schmoren zu lassen – also würde sie das auch durchziehen.
Sie nahm an einem der Arbeitstische Platz und schaltete den Computer an, an dem Angela Finder immer gearbeitet hatte. Und da Debbie sich gerne gruselte, stellte sie sich vor, dass Angela hier an ihrer Stelle saß. Nein, nicht lebendig – sondern als Tote. Nein, Untote, verbesserte sich Debbie. So nannte man schließlich die Geister von Verstorbenen, die keine Ruhe fanden. Und Angela konnte keine Ruhe finden, solange sie, Debbie, ihr hinterherspionierte. Debbie kicherte.
Nicht dass sie wirklich daran glaubte – ich bin doch kein Idiot – das war einer von Debbies Lieblingssprüchen – also, ich bin doch kein Idiot, aber...was war schlimm daran, abzutauchen in die Welt der Fantasie?
Sie öffnete mit der linken Hand den Browser und mit der rechten schob sie sich erneut Chips in den Mund. Dann tippte sie eine Adresse, wartete, gab ihren Benutzernamen ein und ihr Passwort, das sie unmittelbar darauf änderte. Das machte sie jedes Mal, wenn sie ein Forum aufsuchte. Sie änderte immer den Zugangscode. Sie war schließlich nicht so dumm wie die makellose Rose, die schon seit ihrer Ankunft hier denselben Namen verwendete: Sally2009.
Die Webseite für den Grace Chronicle öffnete sich. Und niemand wusste, dass sich dahinter weitere Seiten verbargen, zu denen nur sie, Debbie, Zugang hatte. Und Angela. Aber Angela war tot und sie die Verwalterin ihres Erbes.
Debbie klickte aufImpressumund auf eine der Adressen, die nicht aktiv war, wenn man mit der Maus darüberging. Nur sie wusste, dass ein spezieller Tastencode in Verbindung mit einem Mausklick nötig war, um die Seite aufzurufen.
Und da war sie.
Die Welt von Angela Finder.
Wenn sie nur wüsste, wie man die einzelnen Dateien öffnen konnte!
Egal, was sie auch versuchte, sie kam nie weiter als bis zu dieser Liste mit Namen, die auch jetzt wieder auf dem Bildschirm erschien.
Andererseits war ihr ein anderer genialer Schachzug gelungen und sie hoffte, mit der Zeit genauso viele Informationen wie Angela zu sammeln.
Sie hatte es geschafft, einen Filter zu installieren. Von jeder Mail, die über den Server des Grace College empfangen oder gesendet wurde, erhielt sie automatisch eine Kopie. Das war einfach Wahnsinn, was man aus diesen Nachrichten an Informationen erhielt. Manche waren natürlich auch einfach nur Nonsense oder von einem Informationsgehalt, der gegen null ging, andere wiederum bereiteten ihr einfach nur großen Spaß. Und sie hatte ihre Favoriten hier oben am Grace, deren Botschaften sie täglich kontrollierte.
Moment!
Das war ja mal interessant. Julia hatte eine neue Mail erhalten, dabei bekam sie so gut wie nie Nachrichten und wenn, dann nur Informationen der Collegeleitung, irgendwelche Aufgaben der Professoren oder Botschaften von Chris oder Katie.
Debbie klickte aufNeue Nachricht.
Und dann starrte sie mehrere Minuten lang auf den Text am Monitor, bis ihre Augen zu flimmern begannen und sie schon wieder die ersten Anzeichen von Kopfschmerzen verspürte.
Sie blickte auf den Absender [email protected]. Sie hatte keine Ahnung, wer das sein konnte. Auf jeden Fall niemand aus ihrer Liste.
Kam die Mail von außerhalb? Nein...sie war über das Collegenetzwerk geschickt worden, und zwar gestern Abend um 20:50 Uhr.
Ich weiß, was dein Vater getan hat!
Debbie kaute auf ihren Fingernägeln herum. Julias Vater? Noch nie hatte sie Julia von ihren Eltern sprechen hören. Kurz entschlossen griff sie nach der Maus, klickte sich schnell durch die Menüs und dann durchbrach das Summen des Druckers die Stille des Raums.
Debbie erhob sich und holte das Blatt Papier aus dem Drucker. Sie knüllte den Zettel zusammen und steckte ihn in die Hosentasche.
Als ihre Hand abermals in die Chipstüte wanderte, verzogen sich ihre Mundwinkel zu einem zufriedenen Lächeln.
3. Kapitel
Chris trug Julias Tasche, als sie auf den Parkplatz kamen. Er sah auf die Uhr. Viertel vor zehn. Der Campus war inzwischen fast menschenleer. Draußen vor dem Hauptgebäude, dessen historischer Teil das Kernstück des Grace College ausmachte, lösten sich die letzten kleinen Grüppchen auf. Die Studenten stiegen in die Autos und Busse.
Chris blickte hinüber zum Seeufer, wo die schmalen hohen Fichten hin und her schwangen. Ihre Wipfel schienen fast den Boden zu berühren, bis sie erneut nach oben schwangen und sich zur anderen Seite neigten.
Waren das jetzt schon die Vorboten des Sturms? Chris bezweifelte es. Gestern war der Wind ähnlich stark gewesen und über Nacht doch wieder abgeflaut.
Als er merkte, wie Julia neben ihm im kalten Wind fröstelte, legte er den Arm um sie. Und – er registrierte es erleichtert – sie stieß ihn nicht von sich.
»Lass uns so schnell wie möglich von hier verschwinden, Chris«, sagte sie drängend.
Etwas in ihrer Stimme ließ ihn aufhorchen.
»Was ist los, Liebling?« Er zögerte. »Du hast doch etwas – du warst gestern Abend schon so komisch.«
Sie schüttelte den Kopf. »Es ist nur dieser blöde Remembrance Day. Alle gehen auf den Friedhof und . . . ach, ich weiß auch nicht.«
Tränen standen in ihren Augen und Chris konnte das nicht ertragen. Er wusste dann nie, was er machen sollte, konnte nicht die richtigen Worte finden, fühlte sich hilflos, gelähmt und dann... dann stieg sie in ihm hoch – die Wut.
»Wir gehen nicht auf den Friedhof, das versprech ich dir. Wir tun nur die Dinge, die uns Spaß machen!« Er zog sie noch fester an sich.
»Ja.« Ein winziges Lächeln erschien auf ihrem schönen Gesicht. »Du hast recht.« Sie gab ihm einen schnellen Kuss. »Danke, dass du mich hier wegbringst, Chris.«
Er grinste sie an. »Nichts lieber als das!«
Chris nahm Julias Hand und ging mit ihr über den Rasen hinüber zum Parkplatz und dort zu dem collegeeigenen Van, den sie für die freien Tage gemietet hatten. Ein Bus verließ gerade den Parkplatz, einige Vans folgten. Mr Forster, der Leiter des Französisch-Departments, wie immer korrekt gekleidet in Anzug und Krawatte, lud zwei Koffer in seinen weißen Lincoln. Das Oldtimermodell aus den Siebzigerjahren, das Forster jeden Samstagvormittag vor seinem Bungalow zu polieren pflegte, parkte direkt vor der Ausfahrt. Der Wind hatte ihm die sonst akkurat gescheitelten Haare ins Gesicht geweht, die er nun mit einer flüchtigen Handbewegung nach hinten strich.
Der Professor nickte ihnen zu und blieb an der geöffneten Fahrertür stehen. Chris sah seine Frau mit einer Reisetasche auf den Parkplatz kommen. Sie trug keinen Mantel und schien in der klirrend kalten Luft zu frösteln. Mrs Forster unterrichtete Kunst am Grace und Rose beschwerte sich ständig darüber, dass sie ihre Studenten daran hinderte, nach ihren eigenen Vorstellungen zu arbeiten.
Wie immer löste der Anblick der beiden unerträgliche Langeweile in Chris aus, doch wurde er abgelenkt, als er Benjamin und Rose entdeckte, die auf sie zukamen.
Benjamin rief ihm schon von Weitem zu: »He, Chris! Wir losen, wer die Serpentinen runterrasen darf, okay? Mann, ich war schon lange nicht mehr in einer Achterbahn!«
Chris schüttelte den Kopf: »Ich habe den Vertrag für den Wagen unterschrieben, also fahre ich auch. Sonst muss ich für den Schaden aufkommen, wenn du den Van gegen einen Baum setzt.«
»Du bist und bleibst ein Spielverderber.« Benjamin seufzte und sah sich auf dem Parkplatz um.
Drei Fahrzeuge der Security parkten in der Nähe des Haupttors – ansonsten war er verwaist. »Wir sind echt die Letzten, was?«
»Wo ist Debbie?«, fragte Julia nervös und zog sich die Kapuze über den Kopf. Der Regen war inzwischen zum großen Teil in Schnee übergegangen, große nasse Flocken, die schmolzen, kaum dass sie die Seeoberfläche erreicht hatten.
Rose setzte den Rucksack ab und sah auf ihre Armbanduhr. »Ich dachte, sie wäre schon längst hier unten? Ich hab ihr vorhin gesagt, dass sie spätestens in einer Viertelstunde auf dem Parkplatz sein muss.« Sie zog eine weiße Mütze aus der Jackentasche.
»Ausgerechnet bei uns im Wagen muss Debbie mitfahren«, schimpfte Ben. »Sie wird keine Sekunde den Mund halten, immerzu essen und uns etwas vorjammern. Ich glaube, ich kenne schon jede Krankheit ihrer Großmutter.«
Chris wischte sich die Schneeflocken aus dem Gesicht, ging um den Wagen herum und öffnete den Kofferraum. »Wenn sie nicht in fünf Minuten da ist, fahre ich ohne sie.«
»Besser, wir holen sie«, hörte er Julia sagen. »Kommst du mit, Rose?«
Chris rollte mit den Augen. Er spürte, wie die Ungeduld in ihm hochkochte. Er begann, das Gepäck einzuladen, und rief Julia nach: »Richte ihr das aus, ja! Fünf Minuten – länger nicht.«