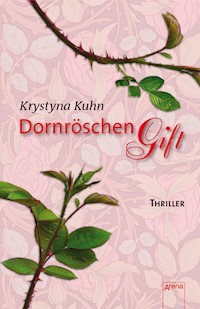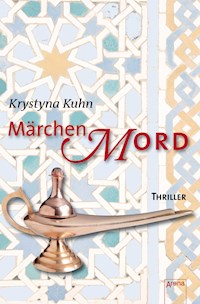Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Widmung
Lob
Prolog
Frankfurt am Main – Freitag, 27. April
Kapitel 1
Frankfurt am Main – Samstag, 28. April
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Prag, Beneditskagasse – Samstag, 28. April
Kapitel 7
Frankfurt am Main – Montag, 30. April
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Prag, Goethe-Institut – Montag, 30. April
Kapitel 11
Frankfurt am Main – Mittwoch, 2. Mai
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Prag, Beneditskagasse – Freitag, 4. Mai
Kapitel 17
Frankfurt am Main – Samstag, 5. Mai
Kapitel 18
Frankfurt am Main – Dienstag, 15. Mai
Kapitel 19
Prag, Husovastraße – Mittwoch, 16. Mai
Kapitel 20
Frankfurt am Main – Donnerstag, 17. Mai Christi Himmelfahrt
Kapitel 21
Frankfurt am Main – Freitag, 18. Mai
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Frankfurt am Main – Samstag, 19. Mai
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Frankfurt am Main – Sonntagnacht, 20. Mai
Kapitel 33
Frankfurt am Main – Montag, 21. Mai
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Frankfurt am Main – Mittwoch, 23. Mai
Kapitel 43
Prag, Beneditskagasse – Mittwoch, 30. Mai
Kapitel 44
Copyright
Buch
Frankfurt: Staatsanwältin Myriam Singer und Hauptkommissar Henri Liebler stehen vor einem Rätsel. Die aus Prag stammende Tänzerin Helena Baarova wurde zu Tode gepeitscht. Kurz darauf wird der amerikanische Austauschstudent Justin Brandenburg tot in seiner Wohnung gefunden. Jemand hat ihn in einen Käfig gesperrt und ihm den Mund zugenäht, sodass er grausam verhungerte. Nichts verbindet die Toten außer der Tatsache, dass beide Professor Milan Hus kannten, einen berühmten Kafka-Spezialisten.
Wenig später setzt sich Filip Cerny, ein Buchantiquar aus Prag, mit der Frankfurter Polizei in Verbindung. Cerny wurden angebliche Originalmanuskripte von Kafka angeboten. Es handelt sich um Erzählungen, in denen eine Tänzerin ausgepeitscht wird und ein Mann in einem Käfig verhungert. Die Kontaktaufnahme des Anbieters mit Cerny erfolgte über Milan Hus’ E-Mail-Adresse – Grund genug, den Professor zu verhaften. Myriam glaubt jedoch nicht an seine Schuld. Sie hat vielmehr das ungute Gefühl, dass sie und die Polizei den Fall ganz falsch angegangen sind. Und dann verschwindet Hus’ Assistent Paul Olivier spurlos …
Autorin
Krystyna Kuhn, 1960 als siebtes von acht Kindern in Würzburg geboren, studierte Slawistik, Germanistik und Kunstgeschichte, zeitweise in Moskau und Krakau. Sie lebt mit Mann und Tochter im Spessart. »Die Signatur des Mörders« ist ihr fünfter Roman.
Von Krystyna Kuhn außerdem bei Goldmann lieferbar: Wintermörder. Roman (46241)
Erinnerung an Prag
Für Lothar
»… ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.«
Franz Kafka
Prolog
Ein anderes, gleichsam ein zweites inneres Wesen hat die Kontrolle übernommen. Diese Kraft, die überwältigend ist, zwingt mich, zu handeln und Dinge zu tun, die keinerlei Bedenken, geschweige denn Reue in mir hervorrufen.
Es ist, als ob dieses Wesen sich eines Nachts mir in den Weg stellte, seinen Hut zog und mich mit ruhiger Stimme bat, ihm zu folgen. Fragte ich zu Beginn noch, wohin es die Absicht habe, mich zu bringen, so folgte ich ihm später ohne großes Nachdenken, und es führte mich in eine Dunkelheit, in der ich niemandem begegnete außer mir selbst.
ICH selbst hatte mich aufgefordert, mit mir zu kommen.
ICH war der Fremde.
Seit diesem Moment leben zwei Personen in meinem Körper, der nur noch eine Hülle scheint, eine Maske, derer sich zwei unterschiedliche Charaktere bedienen. Dieses Gefühl ist so intensiv, ja alles verzehrend, dass ich spüre, in mir ist ein Pulverfass, das nur auf ein Streichholz wartet.
Ja, ich selbst bin das Streichholz.
Die Gefahr, in die ich mich damit begebe, erhöht mich, denn ich riskiere mich selbst dafür, die Welt ins Gleichgewicht zu bringen.
Zu töten ist leicht, ist es doch nur ein Teil des Urteils.
Doch das Urteil zu fällen ist schwer, und nur der Richter ist auserwählt, es zu vollstrecken.
Frankfurt am Main
Freitag, 27. April
1
I’m singing in the rain.
Sie tanzte drei Schritte nach vorne.
Helena nahm den hektischen Betrieb, der wie jeden Freitagabend auf der Kaiserstraße herrschte, kaum wahr. Stattdessen summte sie die Melodie aus dem Film mit Gene Kelly. Einfach glücklich, ohne dass sie den Mittelfinger über dem Zeigefinger kreuzte, ohne dass sie dreimal über die Schulter spuckte, ohne diesen Gedanken im Hinterkopf, dass stets ein Unglück auf das andere folgte.
Diese Unbeschwertheit war ungewohnt und machte sie für einen Moment misstrauisch, sie traute dem Glück nicht, aber war nicht mit Babička endgültig das Gerede über Strafe, Gottesurteile und Teufelswerk gestorben? O nein, Helena vermisste die warnenden Briefe ihrer Großmutter nicht.
Vor ihr ging stockend eine lebhaft diskutierende Gruppe Japaner, vermutlich Geschäftsleute, auf der Suche nach dem billigen Vergnügen. Helena erkannte es an dem Ausdruck von Gier in diesen nur scheinbar gleichgültigen Gesichtern. Das Gefühl, in einen Schwarm exotischer Fische geraten zu sein, machte sie unruhig, sodass sie sich beeilte, die Gruppe zu überholen.
Von der gegenüberliegenden Straßenseite winkte ihr Jess zu, deren schwarze Lederstiefel vermutlich bis hoch an den Stringtanga reichten. Die Prostituierte hielt die schwarze Glitzertasche fest an sich gepresst, da sie in einer ständigen Angst vor einem Raubüberfall lebte.
»Doch«, hatte sie erst vor kurzem Helena erklärt, »andererseits sollte ich nichts mehr fürchten als mich selbst. Schau mich doch an! Bei Wind und Wetter renne ich die Straße auf und ab und denke, was bist du nur für eine abgefuckte Nutte. Und, sag selbst, bin ich das etwa nicht?«
Helena wollte widersprechen, doch Jess winkte ab: »Gibst du ein altes Auto dem Schrotthändler, kriegst du noch Geld. Aber wer nimmt mich? Ich bin nicht einmal mehr als Ersatzteillager zu gebrauchen.«
Jess hatte dazu gelacht. Nicht fröhlich, sondern resigniert, und ihre Tiefseestimme erinnerte Helena an Marlene Dietrich.Wie diese trug auch Jess die blondierten Haare hoch toupiert, sodass sie wie aufgeschäumtes gelbes Softeis aussahen. Aber Helena hatte sie gespürt, die Einsamkeit in diesem Lachen.
Für einen Augenblick spielte sie mit dem Gedanken hinüberzugehen, doch wurde ihr Plan durch eine heisere Stimme hinter ihrem Rücken zunichtegemacht.
»Helena.«
Sie drehte sich um.
Alex, der Tag für Tag vor ihrem Haus herumlungerte, als wolle er sie überwachen. Der nie auf ihr Gesicht sah, sondern immer auf ihre Brüste starrte. Der ihren Balkon hochkletterte, um im Dunkeln auf sie zu warten. Wie konnte er nur glauben, sie würde ihn nicht bemerken, wenn er sie im Schutz der Nacht beobachtete?
»Ich brauche Geld«, murmelte er schuldbewusst. Seine gesenkten Lider flatterten vor Nervosität. Er konnte ihr nicht ins Gesicht sehen.
Als sie bemerkte, wie sich seine Rippen unter dem ehemals weißen Shirt abzeichneten, überwog das Mitgefühl, eine ihrer größten Schwächen. Nie konnte sie nein sagen, oder stopp oder halt!
Sie zog die Geldbörse aus der Handtasche und drückte ihm den letzten Fünfeuroschein in die Hand.
»Aber kauf dir diesmal etwas zu essen, Alex.« Sie sah ihn eindringlich an.
Sein Gesichtsausdruck war zerknirscht, dennoch griff er gierig nach dem Geld. Helena ekelte sich vor seinen gelben Fingern, auf denen das Nikotin wie auch der langjährige Konsum von Heroin sichtbare Spuren hinterlassen hatten. Dann wandte er sich um, wankte schlurfend Richtung Bahnhof.
»Deine Gutmütigkeit rast wieder direkt auf die Blödheit zu«, hörte sie nun Jess neben sich. Sie musterte Helena mit demselben besorgten Blick wie ihre Großmutter, und wie diese sah auch die Prostituierte überall das Unheil.
Jess ging einen Schritt zur Seite, wobei sie zu spät die Pfütze aus Erbrochenem bemerkte.
»Shit. Scheiße!«, fluchte sie.
Helena reichte ihr eine Packung Taschentücher. »Du glaubst doch nicht, dass ich fremde Kotze anfasse? Nicht um alles in der Welt! Nicht einmal mit Aidshandschuhen.« Dennoch nahm Jess die Taschentücher, steckte sie in die Handtasche, um anschließend neugierig zu fragen: »Wie war’s?«
»Ich habe ein gutes Gefühl.«
»Ein gutes Gefühl? Das reicht nicht. Das hatte ich schon hundert Mal. Aber immer lag ich falsch. Kriegst du den Job oder nicht?«
»Ich glaube schon, nein, ich bin mir sicher. Sie schicken den Vertrag zu, andererseits: Solange nichts unterschrieben ist … Sich zu früh freuen bringt Unglück.«
Jess kämpfte einige Minuten mit sich, bis sie schließlich mit einer Mischung aus Erleichterung und Bedauern feststellte: »Dann steigst du also aus?«
»Nein«, beruhigte sie Helena. »Das Engagement beginnt erst im Juni. Das sind noch zwei Monate.«
»Was ist dann heute Abend?«
»Heute nicht, Jess, ich bin müde. Morgen vielleicht.«
»Schon gut, Kleine.« Jess lächelte liebevoll. »Ruh dich aus. Kann ich etwas für dich tun?«
Helena erwiderte das Lächeln. »Wünsch mir einfach nur Glück!«
»Glück«, murmelte Jess und zog den kurzen Rock, der hinten länger war als vorne, nach unten. »Glück ist nur für die, die schon alles haben. Weißt du das nicht?«
Sobald Helena den dunklen, muffigen Flur betrat, in dem einzig das unaufhörliche Tropfen des Duschkopfes zu hören war, verschwand das Glücksgefühl von einer Sekunde zur anderen. Es gelang ihr auch heute nicht, das Unbehagen abzustreifen, das sie regelmäßig beim Betreten ihrer Wohnung überfiel. Jedesmal, sobald sie den Flur betrat, legte sich etwas Schweres auf sie. Etwas, das abzuschütteln ihr nicht gelang.
Sie hatte Prag verlassen, um der düsteren Enge zu entfliehen und nicht zuletzt dem verbohrten Katholizismus ihrer Großmutter, der sich mit einem absurden Aberglauben verbündet hatte.
Und wo war sie gelandet?
Im Frankfurter Bahnhofsviertel.
Wahrlich keine Verbesserung! Doch sie hatte die Wohnung nicht wegen der Lage und schon gar nicht der Ausstattung wegen gewählt. Sie entsprach einfach ihren finanziellen Möglichkeiten. Diese waren nun, während Alex ihr letztes Geld für Drogen ausgab, praktisch gleich null. Zum Teufel mit Alex!
Milan bot ihr immer wieder Geld an, doch sie lehnte es ab. Sie hatte kein Recht, es anzunehmen. Noch nicht. Beim Gedanken an ihn spürte sie erneut die schmerzhafte Enttäuschung.
Andererseits schienen sich seit heute Nachmittag ihre Hoffnungen zu erfüllen. Überirdisch waren die Worte des Produzenten gewesen und Mystery. Genau dasselbe hatte die Zeitung Pražský Denik schon vor Jahren geschrieben. Sie sei ein Mysterium. Ihre Art zu tanzen schaffe im Zuschauer die Illusion zu schweben.
Helena ließ die Jeansjacke zu Boden fallen. Irgendwann, dachte sie, bekommt jeder seine Chance. Auch ich. Es konnte nicht mehr lange dauern, dieses Leben. Ein Leben, das, wie Jess stets meinte, nichts anderes war als ein Billigflug Richtung Friedhof mit Direktanschluss zur Hölle.
Helena streifte vorsichtig die Turnschuhe ab. Unter dem Schmerz zuckte sie zusammen. Für einen Moment schloss sie die Augen und sah dahinter einen Blitz, eine helle gezackte Linie. Barfuß ging sie ins Badezimmer, in dem die Fliesen abfielen, während sich links oben in der Ecke ein grüner Fleck ausbreitete. Helena öffnete den Reißverschluss der engen Jeans, schob sie nach unten und zog den kalten, klammen Duschvorhang zur Seite.Während sie den Wasserhahn aufdrehte, klingelte es an der Tür.
Verflucht, Jess, habe ich dir nicht gesagt, dass ich heute meine Ruhe will? Aber Jess mischte sich immer und überall ein. Wie Babička.
Andererseits – sie brauchte das Geld.
Weshalb schenkte sie ihren letzten Euro auch einem Junkie? Der sie noch dazu wie ein Voyeur verfolgte? Alex’ lüsterne Blicke brannten noch immer auf ihren Brüsten. Wie immer war es diese unverhohlene Gier in den Blicken der Männer, die ihr die Kraft raubte zu widersprechen.
Seufzend zog Helena die Jeans wieder nach oben.
Er lehnte am Türrahmen, die Hand betont lässig in der Hosentasche.
Er? Mit ihm hatte sie nicht gerechnet. Was machte er hier?
»Was willst du? Ich bin müde.«
»Seit wann bist du zu müde zum Tanzen?« Ein spöttisches Lächeln hing in den herabgezogenen Mundwinkeln, während er sich an ihr vorbei in den Flur drängte. Für einen Moment streifte sein schwarzer Mantel Helenas Gesicht.
»Zum Tanzen?«, entgegnete sie verwirrt.
Er schaute sie an. Unter dem dunklen Hut erkannte sie in seinem Blick diesen Ausdruck von totenaugenhafter Ernsthaftigkeit, der typisch für ihn war.Warum nur sah niemand außer ihr, was diese Gesichtszüge offenbarten? Zum Teufel, sie hätte sich nie auf ihn einlassen sollen.
Aber hatte sie eine Wahl?
Nein.
Auch er war Teil ihrer unerfüllten Hoffnungen.
»Der Tag war anstrengend«, erklärte sie müde und gähnte demonstrativ: »Ich hab keine Zeit. Komm ein anderes Mal wieder.«
»Tanze für mich«, sagte er, wobei sein barscher Tonfall klarstellte, er würde nicht aufgeben.
»Heute nicht.«
»Ich bezahle.«
Sie schüttelte den Kopf, doch plötzlich fiel ihr wieder der Fünfeuroschein ein. »Wie viel hast du?«
Er hob die Hand.
Fünfzig Euro? Warum nicht! Davon konnte sie zwei Wochen überleben.
Helena hörte die schleichenden Schritte hinter sich, mit denen er ihr folgte. Das schleifende Geräusch auf dem Boden ließ einen kalten Schauer über ihren Rücken rieseln. Als krieche lediglich sein Schatten hinter ihr her, während er selbst überall in ihrer Wohnung zugleich war.
Im Übungsraum angekommen, räusperte sie sich und deutete auf die Bank neben der Balkontür. »Setz dich. Ich muss mich erst umziehen, oder möchtest du, dass ich in Jeans tanze?«
»Nein, das rote! Zieh das rote Kleid an! »
Sie verließ schnell den Raum. Würde sie die Schuhe, in denen sie den ganzen Tag getanzt hatte, noch einmal über die geschwollenen Füße bringen? Während im Waschbecken der Fön das Leder der Schuhe aufwärmte und weich machte, verklebte sie die Füße mit Leukoplast. Anschließend stopfte sie frische Watte in die Spitzen.
O verdammt, der erste Schritt schmerzte, als ob man ihr die Füße abschneiden würde. Sie biss die Zähne zusammen und zog das rote Kleid über, das sich so eng an ihren Körper schmiegte, dass ihr die Luft wegblieb. Dann kehrte sie in den Übungsraum zurück, wo er ruhig auf der Bank saß und ausgerechnet in dem Buch mit Kafkas Erzählungen las, als wolle er sich über sie lustig machen.
»Also, was soll ich tanzen?«
Er reichte ihr eine in Geschenkpapier verpackte CD.
»Hier. Zum Geburtstag.«
Etwas in ihr sträubte sich, das Päckchen entgegenzunehmen. Babičkas heisere Stimme: »Ein Geschenk am Vortag zu öffnen bringt Unglück.«
Ungeduldig zerfetzte er das Papier und beugte sich hinab, um die CD einzulegen. »Los! Tanz endlich!«
Zitternd stellte sie sich in Position. Ihr Körper war müde, erschöpft, ja geradezu ausgelaugt. Ihr schien, als könne sie ihn nur unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte bewegen.
Die Musik ertönte laut.
Eine Pirouette nach der anderen.
Le Tour en l’air.
Sissone ouvert.
Sissone fermé.
Dann wieder der tröstliche Gedanke an das Geld, das sie dringend benötigte.
Egal, dass ihre Füße brannten, die Muskeln spannten sich unerträglich wie ein Band, das jeden Moment reißen konnte. Körperliche Schmerzen waren nur ein mechanischerWiderstand, den sie als Tänzerin überwinden musste. Hatte sie nicht all die Jahre gelernt, den Schmerz auszuschalten? Ihr Verstand war darin geübt, ihren Körper wie eine Maschine zu behandeln. Je brutaler sie ihn traktierte, desto weniger fühlte sie die Pein, die die Bewegungen hervorriefen.
Empfand sie deshalb den ersten Schlag nicht? Weil sie körperliche Schmerzen kaum noch wahrnahm? Im Gegenteil Befriedigung empfand? Einen unerklärlichen Trost?
Sie schwankte lediglich leicht, denn sie war trainiert, nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten.
Der zweite Schlag traf sie in die Knie. Sie taumelte, wobei sie aus dem Rhythmus geworfen wurde. Sie verstand nicht wirklich, was geschah, hörte nur unaufhörlich den Befehl: »Tanz!«
Dieses hohe Pfeifen. Das Knistern. Das Summen.
Erst beim dritten Schlag jagte der Schmerz durch ihr Fleisch.
Der vierte Schlag: Die Haut zerplatzte an den Waden, dann an den Oberschenkeln. Sie riss wie brüchiges Leder, wie altes Papier.
Die Welt zum Schweben bringen. Schwerelos sein. Das Gefühl vermitteln, dass der Zuschauer glaubt, selbst zu tanzen. Dem Unwirklichen den Status von Realität und Sicherheit verleihen. Dem, wonach das Publikum sich sehnt, Leben einhauchen.
Die Stimme ihrer Großmutter: »Stell dich nicht so an! Tanz! Der Schmerz existiert nur, wenn du stehen bleibst. Du musst lernen, das Leiden zu ertragen, deine Schwäche zu überwinden.Wie Jesus. Die Qual deines Körpers ist dein Kreuz! Erst wenn du sie überwindest, kannst du eine wirkliche Primaballerina genannt werden!«
Und Helena Baarova tanzte weiter.
Eine leere Straße. Bäume, die an einem vorbeiziehen. Der graue Asphalt, der zu einer einzigen Linie wird. Das Begreifen, was Ewigkeit heißt, nach der sich jeder Mensch sehnt, der niemals sterben möchte.
Lange hatte Helena auf den Moment gewartet, in dem sie vergaß, dass sie tanzte, in dem sie die Pein, die ihren Körper quälte, endgültig abschüttelte wie eine lästige Hülle.
Es ist dein Opfer für die Kunst, hörte sie ihre Großmutter heiser flüstern.
Sie fühlte den Boden unter ihren Füßen nicht. Der Schmerz? Er besaß keine Macht mehr. Sie schaltete ihn ab wie künstliches Licht, das in den Augen blendet.
Während langsam das Blut aus den aufgeplatzten Wunden strömte und Helena Baarova schon lange am Boden lag, glaubte sie noch immer zu tanzen und bildete sich ein, ihr Körper sei das Pendel, das allein die Erde im Gleichgewicht hielt.
Sie sah sich selbst beim Sterben zu, und dieser Anblick von anmutiger Leichtigkeit war überirdisch schön. Diese Schlussszene war eine Offenbarung. Zum ersten Mal begriff sie das ganze Mysterium menschlichen Leidens.
Frankfurt am Main
Samstag, 28. April
2
Myriam Singer beobachtete vom Bett aus, wie vor dem Fenster ein dunkelgraues Wolkenband vorbeikroch, und befürchtete das Schlimmste. Sie seufzte tief. An manchen Tagen wurde es einfach nicht hell, weder draußen noch im eigenen Innern.
Nach dem grauenhaften Albtraum, der sie die ganze Nacht gequält hatte, erlebte sie an diesem Samstagmorgen eine der bittersten Auseinandersetzungen mit Henri in der bisherigen Geschichte ihrer einjährigen Beziehung. Wenn nicht sogar die schlimmste. Dabei war es lediglich ein winziger Moment gewesen, während dessen ihre Gedanken unter seinen Küssen abschweiften. Wirklich, sie hatte nur ganz kurz an ihre Tätigkeit als Staatsanwältin gedacht.
Sie überlegte, ob sie ihm von dem Mann erzählen sollte, der sie Nacht für Nacht im Traum verfolgte, um ihr die Haare abzuschneiden und sie dann mit seinen eiskalten langen Fingern in ihren Mund zu stopfen. Ja, er schob sie so tief in ihren Rachen, dass sie keine Luft mehr bekam und nicht einmal schreien konnte. Ihre Haare fühlten sich wie klebrige Fäden an, wie Spinnweben zwischen ihren Zähnen. Doch Myriam hasste es, bemitleidet zu werden.
Seufzend fuhr sie sich mit den Händen durch die Locken. Nein, sie konnte sich einfach nicht an die kurzen Haare gewöhnen.
»Verdammt, wir verbringen zu wenig Zeit miteinander«, hörte sie Henris tiefe Stimme.
War es etwa ihre Schuld, dass sie beide einen anstrengenden Job hatten? Nicht nur sie, auch er war als Hauptkommissar am Frankfurter Polizeipräsidium rund um die Uhr im Dienst. Beide hatten sie keine geregelten Arbeitszeiten, und sie verbrachten kaum ein gemeinsames Wochenende.
»Das ist doch abartig!«, fuhr er gereizt fort. »Du sitzt täglich mehr als zwölf Stunden im Büro. Genauso gut könntest du ins Landgericht ziehen. Jetzt verstehe ich, weshalb es früher Dienstwohnungen für Beamte gab. Beamtin auf Lebenszeit – heißt das, du willst jede Minute deines Lebens für den Staat ackern?«
Ehrlich gesagt fand Myriam ihr Leben perfekt, und nun musste sie feststellen, dass Henri anderer Meinung war. »Der Bermudafall«, appellierte sie an sein Verständnis. »Ich muss eine Entscheidung treffen, ob ich am Montag Anklage erheben soll oder nicht. Hillmer sitzt mir im Nacken. Ich soll mit dem Ehemann verhandeln, damit er mir verrät, wo er die Leiche seiner Frau versteckt hat. Aber du weißt, ich bin gegen Deals bei Gericht und hasse diese korrupten Vergünstigungen, nur damit jemand die Wahrheit sagt. Ich meine, sind wir Kaufleute? Nein! Hier geht es immer noch um das Gesetz.«
Henri richtete sich auf, hob die Beine aus dem Bett und saß nun mit dem Rücken zu ihr. Warum fiel ihr erst jetzt auf, dass er in letzter Zeit immer einsilbiger wurde, wenn es um ihre Arbeit ging? Statt ihr zu antworten, wühlte er nun in dem Kleiderhaufen, der vom Stuhl heruntergerutscht war, bis er endlich aus der Hemdentasche die Packung Camel fischte.
Inzwischen waren vierzehn Monate vergangen, seit Myriam mit dem Rauchen aufgehört hatte. Zugegebenermaßen fing sie allmählich an, sich wie eine militante Bekehrte aufzuführen.
»Waren wir uns nicht einig, dass du im Schlafzimmer nicht rauchst?«, protestierte sie gereizt.
»Ich bezahle die Miete für diese Wohnung, also bestimme ich, wo ich rauche.«
Er saß noch immer mit dem Rücken zu ihr gewandt.
»Willst du, dass ich gehe?«
Für einige Minuten herrschte Schweigen, bis Henri sich umdrehte. Etwas an seiner Miene versetzte Myriam einen Stich. »Sag mal, merkst du es eigentlich nicht selbst?«
»Was?«
Er erhob sich, zündete die Zigarette an und begann aufgeregt im Zimmer auf und ab zu gehen. »Du sollst zu hundert Prozent bei mir sein, nicht nur zu fünfzig. Ist das zu viel verlangt?«
»Hundert Prozent sind immer zu viel«, erwiderte Myriam nun schnippisch. »Das weiß doch jeder.«
»Aber es ist, verdammt, nicht zu viel verlangt, dass du an mich denkst, wenn ich dich küsse, und nicht an irgendwelche Ehemänner, die ihre Frau umgebracht haben.«
»Wie kommst du denn darauf?«, versuchte Myriam von der Tatsache abzulenken, dass er sie wie gewohnt durchschaute.
»Wenn du das nicht selbst merkst … Tatsache ist jedenfalls, dass ich keine Lust mehr habe auf diese … diese Bettbeziehung.«
»Bettbeziehung?«, widersprach Myriam. »Wir haben doch nicht nur Sex miteinander.«
»Ach ja, stimmt. Da wären ja auch noch unsere Arbeitskontakte.« Der Spott in seiner Stimme war verletzend.
Er nahm einen langen Zug, blies den Rauch langsam in die Luft und sagte schließlich mit ernstem Tonfall: »Ich will, dass wir zusammenziehen.«
Das hatte gerade noch gefehlt.
»Okay. Super. Du möchtest also, dass ich mich am Samstagmorgen um neun Uhr entscheide, mein Leben komplett zu ändern. Warum jetzt? Warum heute Morgen?«
»Wann dann?«
»Du hättest schon vorher einmal …«
»Wann?«
Henri griff nach seiner Hose am Boden und zog sie über. »Ich habe es satt, verstehst du. Ich will, dass du morgens neben mir aufwachst, obwohl dein Gesicht zerknittert ist und deine Haare in die Luft stehen.« Er warf ihr einen seiner kryptischen Blicke zu. »Schlecht gelaunt, weil du vor dem Morgengrauen aufstehen musst oder weil wieder keine Zeitung gekommen ist. Ich weiß, ich bin älter, dicker, langweiliger als du, aber … ich hätte gerne, dass du hier mit mir in dieser Wohnung wohnst. Sie ist groß genug. Es ist höchste Zeit, verstehst du nicht? Ich werde nicht jünger.«
Myriam schloss die Augen. O Gott, nein, tu mir das nicht an.
»In drei Monaten werde ich vierundvierzig.Vierundvierzig«, wiederholte er »Du bist vierunddreißig …«
»So genau wollte ich das gar nicht wissen …«
»Zum Teufel, ich muss mich entscheiden, ob ich noch Kinder will.«
Ron, dachte Myriam. Das ist alles deine Schuld. Deine und Berits. Musstet ihr unbedingt Zwillinge in die Welt setzen? Uns allen mit gutem Beispiel vorangehen?
»Sag etwas!«, hörte sie Henri.
Sagte sie nein, würde er sie bitten zu gehen. Ja konnte sie nicht sagen. Ein Dazwischen gab es nicht. Ihr blieb also nur zu schweigen.
»He«, Henris Stimme rutschte eine Oktave tiefer. Er kam auf ihre Seite, beugte sich hinab und legte seine Lippen auf ihre nackte Schulter. Seine linke Hand griff in ihr Haar, und er zog ihr Gesicht zu sich hinunter. Für einen Moment schloss sie die Augen und genoss es. Henri wusste verdammt genau, welche Stelle an ihrem Körper geradezu nach Berührung schrie. Dann dachte sie wieder an die Forderung, sie solle bei ihm einziehen. Sie entzog sich, öffnete die Augen und sah direkt in seine. O Gott! Die Farbe erinnerte bedenklich an Picassos düsterste blaue Periode.
»Du solltest dein Haar wieder wachsen lassen«, sagte er und erhob sich, um nach dem Hemd zu greifen, das am anderen Ende des Bettes lag.
Unwillkürlich versteifte sie sich. Sie konnte den Moment nicht vergessen …
»Wenn du hier bei mir wohnst, musst du nie wieder Angst haben.«
»Zusammenziehen? Das ist eine wichtige Entscheidung. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken.«
»In der Liebe überlegt man nicht«, widersprach Henri und fuhr sich mit der Hand durch die dichte dunkelblonde Löwenmähne. Und wie er nun energisch den Gürtel festzog, lief das Gespräch tatsächlich auf eine ernsthafte Auseinandersetzung hinaus. Etwas, das Myriam gar nicht brauchen konnte. Sie erlebte am Gericht Auseinandersetzungen genug. Und – sie befand sich eindeutig im Nachteil. Er hatte sich im Gegensatz zu ihr vorbereitet. Ihr Plädoyer existierte nicht einmal in ihrem Kopf, aber er hatte vermutlich seit Längerem Indizien gesammelt.
Henri zog das weiße Hemd über. Das blonde Haar kringelte sich im Nacken.
Okay, Myriam liebte diesen Anblick. Aber nur, weil man den Nacken eines Mannes liebt, zieht man noch lange nicht zu ihm.
Jetzt drehte er sich abrupt um. »Also, wie lautet deine Antwort?«
Myriam schloss die Augen. Sie wünschte sich, sie wäre nicht schon wieder mit in seine Wohnung gekommen. Andererseits wusste sie schon gar nicht mehr, wann sie das letzte Mal in ihrem eigenen Bett geschlafen hatte. Warum also schreckte sie davor zurück, mit ihm zusammenzuleben?
Ganz einfach: Einziehen war leicht, aber ausziehen, verdammt, das war vergleichbar mit einem militärischen Rückzug. Sie müsste die Kapitulation erklären.
Sie schlug die Bettdecke zur Seite.
Herrgott, wo waren ihre Kleider?
In seinem, in Henris Badezimmer, doch sollte sie jetzt nackt an ihm vorbeirennen?
»Aber es ist doch gut so, wie es ist«, erklärte sie, wobei sie nach irgendeinem Stück Stoff suchte. »Warum müssen wir etwas ändern?«
»Denkst du nie über Kinder nach?«
Myriam fühlte einen heftigen Stich in ihrer Brust. Für einen Moment bekam sie keine Luft. Sie versuchte, die Trauer zu überspielen, indem sie betont scherzhaft bemerkte: »Seit ich Rons Augenringe gesehen habe, ganz abgesehen von den Kotzflecken auf Berits unzähligen rosa T-Shirts, möchte ich mir Kinder nur noch im Museum betrachten. Hinter Sicherheitsglas, verstehst du.«
»Wenn ich dich und die Zwillinge beobachte …« Henri drückte die Zigarette im leeren Weinglas aus.
»Und? Was hast du gesehen?«
Wieder wandte er sich ihr zu, legte seine warme Hand auf ihr nacktes Knie, das nicht protestierte, im Gegenteil.
»Du hast Maries Haar geküsst«, murmelte er mit diesem wunderbaren tschechischen Akzent. »Du hast deinen Mund auf ihren Kopf gelegt. Mein Gott, ist das so schwer zu sagen, dass du dich nach einem Kind sehnst?«
»Ich sehne mich überhaupt nicht nach einem Kind.« Myriam wurde hysterisch. »Und komm mir jetzt nicht mit dem Scheiß von wegen biologischer Uhr … die tickt vielleicht bei dir wie eine Zeitbombe, aber ich höre sie nicht.«
»Still. Sei ruhig.« Etwas in seiner Stimme brachte Myriam tatsächlich dazu zu schweigen. »Du kennst mich. Ich gebe nicht so schnell auf. Deshalb frage ich dich jetzt ernsthaft und voller Überzeugung, ob du …«
Ein bekanntes, in der Regel verhasstes Trillern unterbrach seine Rede.
Danke, Gott, dachte Myriam, wo immer du bist, ich habe gewusst, dass ich auf dich zählen kann.
»Das ist dein Handy«, sagte sie erleichtert.
»Ich erwarte keine Anrufe. Wer etwas von mir will, soll auf die Mailbox sprechen. Außerdem habe ich keine Bereitschaft.«
Dennoch starrten beide auf das Telefon, das unaufhörlich schrillte.
»Es könnte wichtig sein«, drängte Myriam erleichtert.
Henri seufzte. Sie konnte verstehen, wenn er gekränkt war, aber wie sollte sie ihm erklären, was in ihr vorging? Sie war für dieses Gespräch nicht gewappnet. Es gab zu viele Dinge, die er nicht wusste. Erinnerungen, die sie erfolgreich verdrängte. Ihre Gefühle waren so verworren, so kompliziert. Im Vergleich dazu war das Universum ein primitives System.
»Was gibt’s?«, hörte sie Henri gereizt fragen.
Dann folgte ein langes Schweigen, bis er murmelte: »Bin unterwegs!«
Er beendete das Gespräch und stieß einen resignierten Seufzer aus.
»Wer war das?«
»Ron.«
»Was ist los?«
»Soweit ich verstanden habe, etwas wirklich Abartiges«, antwortete Henri und fischte seine Schuhe unter dem Bett hervor.
Ein Satz, der bedeutete: Irgendwo in Frankfurt gab es einen Toten. Irgendwo in der Stadt war jemand eines gewaltsamen Todes gestorben. Einerlei, was Myriam an Scheußlichkeiten erwartete, eines war sicher: Noch nie war sie einer Leiche so dankbar gewesen wie dieser.
Der VW-Bus rammte den Bordstein, fuhr ein Stück auf dem Bürgersteig entlang, bis er endlich zum Stehen kam. Henri hatte die ganze Fahrt über nicht mit ihr gesprochen, doch nun wandte er sich ihr zu. Diesen Ausdruck hatte sie noch nie bei ihm gesehen.
Jeder Tag sollte eine zweite Chance bekommen. Sie wollte wieder mit ihm im Bett liegen mit der Illusion, die nächsten vierundzwanzig Stunden unbeschadet zu überstehen.
»Henri …«
»Nein, sag nichts. Ich …«
»Es war doch alles gut, wie es war.« Aus welcher Schublade in ihrem Gehirn stammte dieser Satz? Er klang wie vom Discounter. »Familie – das mag dein Traum sein, aber, ehrlich, ich bin die falsche Besetzung dafür.«
»Hör zu«, Henri zog den Schlüssel ab. »Ich möchte, dass du deine Sachen packst.«
»Was?«
»Pack deine Sachen.«
Er warf sie hinaus?
Sie?
Das war nicht ihr Stil. Bisher war sie immer still und heimlich verlassen worden, oder sie hatte in einer dramatischen Geste dem Mann die Koffer vor die Tür gestellt.
»Warum?«, fragte sie. O Gott, ihre Stimme lief aus der Spur. Sie klang wie Kreide, die laut an der Tafel quietscht.
»Ich …« Henri wandte ihr das Gesicht zu. »Ich kann so nicht weitermachen. Ich möchte, dass wir zusammenleben.«
»Aber …«
»Nein, kein Aber.« Er schüttelte bestimmt den Kopf. »Du musst dich entscheiden.«
»Wofür?«
»Wofür auch immer. Denn ich weiß genau, was ich will: Den Rest meines Lebens …«
»Du bist erst vierundvierzig«, unterbrach sie ihn schnell.
»Den Rest meines Lebens mit dir verbringen.« Er hob die Schultern. »Wenn du das nicht willst, trennen sich unsere Wege endgültig.«
Er schnallte sich ab und griff nach dem Türöffner, ohne sie anzusehen.
»Das ist nicht dein Ernst!«
Er wandte sich kurz um. »Meinst du? Nun, ich schlage vor, wir machen, was du von Anfang an wolltest. Wir arbeiten beruflich zusammen, aber sonst geht jeder seiner Wege.« Er stieg aus und blieb kurz stehen: »Ich gebe dir einen Monat, um dich zu entscheiden.«
Entscheiden, dachte Myriam. Verflucht, ich kann mich noch nicht einmal entscheiden, was ich morgens anziehen soll.
3
O Gott, dieser unerträgliche Geruch. Süßlich und bitter zugleich. Als hätte sich jemand übergeben. Als hinge über dem Raum eine Feuchtigkeit wie von modriger Wäsche, von fauligem Schweiß, von Mundgeruch. Als hätte eine Katze irgendwo hingemacht.
Der Raum schwankte. Überall Blut. Mit Blut bespritzter Boden. Rote, fleckige Wände. Ein verschmiertes Fenster gegenüber.
Nur langsam begriff Myriam, dass das Schwindelgefühl von den Spiegeln kam. Die Wände gegenüber sowie links und rechts waren damit verkleidet. Ein verspiegelter Raum auf denkbar kleinem Grundriss. Nicht mehr als zwanzig Quadratmeter.
Zum ersten Mal hatte Myriam eine Vorstellung, was Klaustrophobie bedeutete. In dem winzigen Zimmer drängten sich Polizisten und Beamte der Spurensicherung, die wieder und wieder in den Spiegeln vervielfacht wurden. Ihr stockte der Atem. Die Panik, man würde gleich über sie hinwegtrampeln, wurde größer.
Die Spannung im Hinterkopf nahm zu. Sie spürte, wie ihr der Tee hochkam, vermischt mit dem bitteren Geschmack von Magensäure oder Galle, und einen ekelhaften, säuerlichen Geschmack in ihrem Mund hinterließ.
Links von der Tür stand Hauptkommissar Ron Fischer über die Leiche gebeugt. Seine Hände steckten tief in der abgeschabten schwarzen Lederjacke, von der er sich nicht trennen konnte.
Er hielt den Kopf gebeugt, weshalb Myriam für einen Moment dachte, er bete. Doch das war das Letzte, was Ron tun würde. Nun wandte er ihr den Kopf zu, richtete sich auf und fuhr sich mit den Fingern durch die kaum noch vorhandenen Locken. Seitdem hier und da silbrige Fäden sein Haar durchzogen, trug er diese möglichst kurz, um das Grau zu vertuschen.
»Ah, Myriam, gut … Henri, ist er auch da?«
»Muss irgendwo sein«, murmelte sie in der Hoffnung, Ron würde von ihren Beziehungsproblemen nichts mitbekommen.
»Alles in Ordnung mit Marie und Finn?«
»Eingeschlafen«, seufzte Ron, »sobald ich das Haus verlassen habe.« Ein zufriedenes Lächeln lag auf seinen Lippen, das in offensichtlichem Widerspruch zu dem leidenden Tonfall stand. »Sie geben genau so lange Ruhe, bis ich wieder zuhause bin. Aber, wehe, ich schiebe das erste Bein unter die Decke.«
Sie hätte das Thema Kinder nicht anschneiden sollen, daher fragte sie schnell: »Was haben wir?«
»Schau es dir selbst an.«
Ron machte einen Schritt zur Seite.
Myriam starrte auf die ausgestreckte Gestalt am Boden. Die langen Beine weit gespreizt, die Arme ausgebreitet.
Das ist also die Welt, in die ich mich freiwillig begebe, schoss es ihr durch den Kopf. Henri hat recht! Welch ein Wahnsinn!
Das Mädchen trug ein rotes Kleid, nicht länger als ein Hemd, eines dieser Kostüme, wie Eiskunstläuferinnen sie bevorzugten. Ihr Körper wirkte auffallend zierlich, geradezu grazil. Es grenzte an ein Wunder, dass sie nicht bereits unter dem ersten Schlag, der sie getroffen hatte, zerbrochen war.
Etwas Abartiges. Ron war dafür bekannt zu übertreiben, doch diesmal war dies nicht der Fall. Augenblicklich verstand sie, was er meinte. Hier offenbarten sich Hass aus tiefster Seele und eine Wut, die sich in einer Orgie der Gewalt entladen hatte.
Myriam atmete tief durch, ohne den Blick von den weit geöffneten, geradezu nackten Augen zu wenden, aus denen die eisige Kälte des Todes starrte. Dieser Blick war das letzte verzweifelte Flehen um Hilfe, aber niemand hatte ihn gesehen. Außer dem Täter, dachte sie.
»Nicht älter als zwanzig«, hörte sie Ron hinter sich murmeln.
»Sie war schön«, erwiderte Myriam, um sich sofort zu korrigieren: »Sie ist immer noch schön.«
Das Einzige, was unangetastet schien, waren die langen dunkelbraunen Haare, die wie ein Vorhang um den Kopf lagen. Ihre dichte Fülle rief in Myriam ein Gefühl des Verlustes hervor. Sie dachte an ihre eigenen, die man ihr vor gut einem Jahr mit dem Messer abgeschnitten hatte.
»Da ist kein Stück Haut ganz geblieben«, sagte Ron. »Sie scheint sich völlig aufgelöst zu haben.«
»Schon gut, Ron, du musst nicht jedes Detail aufzählen«, entgegnete Myriam, doch er hörte nicht auf.
»Er hat sie geprügelt, bis das rohe Fleisch hervorkam, bis er auf die Knochen traf. Nicht nur die Haut ist zerfetzt, auch die Muskeln, die Nerven. Er hat sie regelrecht aufgeschlitzt.«
»Herrgott, Ron, es reicht.«
»Herrgott, Herrgott«, wiederholte Ron sarkastisch, fast schon boshaft. »Wer soll das sein, verdammt noch mal, dieser Herrgott, den du da zu Hilfe rufst? Dass du als intelligenter, aufgeklärter Mensch diesen Ausdruck überhaupt noch in den Mund nimmst! Das zeugt schon fast von Ignoranz, als ob du nicht sehen willst, was in dieser Welt, in diesem Land vor sich geht!«
»Werd nicht melodramatisch, Alter.«
Myriam war erleichtert, als Henri endlich den Raum betrat. Wirklich, ich sollte unseren lächerlichen Streit von heute Morgen einfach vergessen, dachte sie. Er hat es nicht ernst gemeint. Doch Henri ignorierte sie. Er zog Handschuhe über, ging in die Knie und beugte sich zu dem Mädchen hinunter. Einige Sekunden erwiderte er ihren Blick, aus dem das Entsetzen starrte, dann fuhr er sanft mit der rechten Hand über die Lider und schloss die Augen der Toten für immer.
»Aber womit?«, fragte Myriam. »Hat er ein Messer benutzt?«
»Nein«, Henri schüttelte entschieden den Kopf, während er sich erhob.
»Was dann?«
»Ich glaube, eine Peitsche«, stellte er ruhig fest. »Er hat sie ausgepeitscht.«
»Ausgepeitscht?«, knurrte Ron, die Lippen zusammengepresst. »Ausgepeitscht? Das Mädchen wurde gegeißelt!«
Gegeißelt.
Existierte dieses Wort noch? Stand es nicht schon lange auf der Abschussliste? Ganz oben auf der Liste der bedrohten Wörter?
»Wo bleibt Veit?«, fragte Myriam. Die Anwesenheit des Gerichtsmediziners Dr. Henning Veit wirkte stets beruhigend auf sie.
»Ich habe schon mit ihm telefoniert«, erklärte Ron. »Jennifer hat eine Tanzaufführung an ihrer Schule, aber er ist auf dem Weg hierher.«
»Hast du bereits Informationen über die Tote?« Henri beugte sich nach unten und hob ein Buch auf, das dort aufgeschlagen lag.
»Moment«, Ron zog einen Notizblock hervor. Verwundert stellte Myriam fest, dass seine Hände zitterten. »Ihr Name ist Helena. Helena Baarova.«
»Ein tschechischer Name«, kommentierte Henri abwesend, während er in dem Buch blätterte.
»Sie hat diese Wohnung gemietet«, fuhr Ron fort. »In ihrer Handtasche haben wir einen Studentenausweis gefunden.«
»Wer hat die Leiche entdeckt?«, wollte Henri wissen.
»Zwei Jungen.«
»Was für Jungen?«
»Schüler, fünfzehn und sechzehn Jahre alt.«
»Was wollten sie hier?« Henri las noch in dem Buch.
»Offenbar hat das Mädchen heute Geburtstag.«
Henri blickte auf. »Geburtstag?«
»Ja. Sie wollten ihr gratulieren, hatten sogar Blumen dabei.« Ron wies mit der Hand auf einen welken Strauß gelber Rosen, der am Boden vor der Balkontüre lag.
»Wo sind die beiden jetzt?«
»Wir mussten einen von ihnen …«, Ron warf einen prüfenden Blick auf den Block. »David Hus, wir mussten ihn ins Krankenhaus bringen. Er hatte einen schweren Asthmaanfall. Ich schätze, sie behalten ihn über Nacht. Zur Beobachtung.«
»Was ist mit dem anderen?«
»Bevor wir hier eintrafen, war er, Simon, die Ruhe selbst. Er hat sogar gewusst, wie er bei seinem Freund erste Hilfe leisten musste. Doch als wir die Wohnung betreten haben, ist er zusammengebrochen. Laut Notarzt handelt es sich jedoch lediglich um einen leichten Schock. Er hat ein Beruhigungsmittel erhalten und wurde von einem unserer Beamten nachhause gebracht, der seine Aussage aufnimmt.«
»Und der andere Junge? Wie war sein Name?«
»David.«
»Also, wann können wir mit David sprechen?«
»Wenn der Arzt es erlaubt. Ehrlich, ich habe geglaubt, der überlebt den Anfall nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er war im ganzen Gesicht blau, als wäre er direkt vom Mars.«
»Marsmenschen sind grün«, entgegnete Henri ungerührt. »Das solltest du wissen, falls dein Sohn dich mal fragt.«
Bis Dr. Henning Veit eintraf, vergingen nicht mehr als zehn Minuten. Im Gegensatz zu sonst trug der Rechtsmediziner einen hellen Anzug. Ein ungewohnter Anblick. Er nickte ihnen lediglich zur Begrüßung zu und machte sich sofort an die Arbeit.
Seine Hände strichen zunächst langsam über die Finger des Mädchens, als versuche er, sie zu beruhigen. Dann holte er aus seinem Koffer eine Schere und begann das rote Tanztrikot von der Brust an nach unten aufzuschneiden. Seine Bewegungen waren vorsichtig, gleichzeitig lief sein Blick immer wieder über den Körper, während er jedes Detail in sich aufnahm.
Myriam wollte, dass er etwas sagte, irgendetwas.
»Hat der Täter sie gefesselt?«, unterbrach sie die Stille. »Damit sie sich nicht wehrt?«
Veit richtete sich auf, um die Anzugjacke abzustreifen. »Nein.« Seine Hand wischte eine blonde Strähne aus der Stirn. »Das glaube ich nicht. Ich kann keine Fesselspuren an den Handgelenken erkennen.«
»Aber«, Myriam fühlte sich irritiert, verwirrt. »Warum hat sie einfach stillgehalten?«
Veit zögerte kurz, bis er schließlich mit einem tiefen Seufzer entschied: »Das Mädchen hat nicht stillgehalten.«
»Aber...«
»Ehrlich gesagt«,Veit drehte ihr den Rücken zu und beugte sich wieder nach unten. »Ich glaube, sie hat getanzt, solange sie sich auf den Beinen halten konnte.«
Getanzt? Das Wort hing in der Luft. Es ergab keinen Sinn. Was sollte das bedeuten?
Dass der Täter das Mädchen unermüdlich, ja erbarmungslos mit der Peitsche angetrieben und es sich dazu im Kreise gedreht hatte? Wie eine Porzellanballerina auf diesen kitschigen Spieldosen? Zu Mozarts Kleiner Nachtmusik?
War es das, was Veit meinte? Sollte sich Myriam das vorstellen? Dass ein Mädchen einfach weitertanzte, während die Peitsche über ihren Körper knallte?
Das konnte er nicht ernst meinen.
»Das ist abartig«, Myriam schüttelte den Kopf. »Niemand tut sich das freiwillig an.«
Veit richtete diesen abgeklärten Blick auf sie, der besagte, er habe schon zu viel gesehen, als dass er nicht an das Unmögliche, das Unfassbare glauben könnte.
»Tatsache ist, sie war Tänzerin«, meldete sich Ron zu Wort. Er deutete auf zahlreiche Fotos an der unverspiegelten Wand: Unverkennbar Helena Baarova in verschiedenen Kostümen und unterschiedlichen Tanzpositionen.
»Schau her«, hörte sie Veit.
Sie wandte den Kopf erneut dem Mädchen zu.
Der Zeigefinger des Gerichtsmediziners fuhr eine besonders tiefe Linie entlang, die vom Brustbein nach links über die Taille nach hinten führte. Sein Finger wechselte zu einem Schnitt am Unterschenkel.
»Was meinst du?« Myriam konnte nichts erkennen, nur blutige Striemen auf einer weißen Elfenbeinhaut, die man kaum noch als Haut identifizieren konnte.
»Schau genau hin!«, wiederholte Veit eindringlich.
Myriam ging in die Knie, kniff die Augen zusammen.
Veit hatte ihr einmal erklärt, dass er sich beim Anblick einer Leiche immer den Menschen vorstellte, wie er vorher ausgesehen, sich bewegt, gesprochen hatte, unverletzt, unbeschädigt, unversehrt, kurz: lebendig.
Myriam schloss für einen Moment die Augen... tatsächlich... Der schmale, weiße Körper dieses Mädchens. Wie war ihr Name? Helena! Sie holte tief Luft. Und mit der Luft, die sie einatmete, schoss das Adrenalin durch sie hindurch und brachte Wut an die Oberfläche. Wut und Zorn.
»Die Haut des Menschen ist vergleichbar mit der einer Zwiebel«, hörte sie Veit neben sich mit sachlicher Stimme erklären. »Die Striemen, die die Tatwaffe auf dem Körper hinterlassen hat, sind von unterschiedlicher Tiefe. Wir unterscheiden die Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. Je nach der Kraft, die auf die Haut ausgeübt wird, sind die unterschiedlichen Schichten betroffen. Hier an den Waden gehen sie nicht tiefer als bis zur Lederhaut. Aber hier an der Brust sind größere Blutgefäße geplatzt, wie sie in der Subcutis liegen. Die Kraft, die hier eingewirkt hat, war also stärker!«
»Aber«, Myriam hörte den Zweifel in ihrer Stimme. »Das heißt doch nicht, dass sie getanzt hat.«
»So eine Kraft, diese enorme Wucht der Schläge, konnte sich nur entwickeln, während das Mädchen in Bewegung war.«
»Sie hat sich gewehrt«, murmelte Myriam, wobei sie es sich aus tiefster Seele wünschte.
»Dann wäre nie diese schöne, gleichmäßige Schnittlinie zustande gekommen. Schau genau hin! Du musst auf zwei Dinge achten!«
Myriam starrte auf den blutroten Streifen, dem Hennings braungebrannter Zeigefinger folgte.
»Beachte zunächst die Tiefe des Einschnittes.« Er zog den Spalt vorsichtig auseinander und ging anschließend mit dem Finger in die Furche. »Ich kann das Brustbein berühren. Und dann ist der Verlauf der Striemen aufschlussreich. Immer dieselbe Breite, dieselbe Tiefe. Es gibt kaum eine Abweichung.« Er wandte sich an Henri. »Hilf mir mal.« Gemeinsam hoben sie das Mädchen ein Stück in die Höhe. Mit einer Hand zog Veit das Kostüm auseinander. »Hier! Diese Linie verläuft in einem Bogen oberhalb der Hüfte nach hinten zum Rücken. Das Opfer hat sich also um ihre Taille gedreht, aber nicht in einer Abwehrbewegung.« Sie brachten das Mädchen wieder in die Ausgangsposition zurück. »Stellt euch eine Drehmaschine vor, die ein Stück Holz bearbeitet.« Veit nahm einen Mundschutz aus dem Koffer und zog ihn über. »Ich denke, ihr braucht so schnell wie möglich Ergebnisse. Sagen wir, Montag nach der Mittagspause? Vierzehn Uhr? Ihr bekommt noch eine schriftliche Einladung.«
»Nenne uns wenigstens schätzungsweise den Todeszeitpunkt.« Henri wandte die Augen nicht von dem Mädchen, als könnte er den Blick nicht von ihrer zerstörten Schönheit lösen, was Myriam absurderweise einen eifersüchtigen Stich versetzte.
»Sie ist in jedem Fall länger als einen Tag tot.«
»Und?«, fragte Ron ungeduldig.
»Ich glaube, sie ist verblutet«, lautete die knappe Antwort. »Geht davon aus, dass er so lange auf sie eingepeitscht hat, bis kein Tropfen Blut mehr in ihren Adern floss.«
Damit wandte sich Veit ab, um sich konzentriert der Untersuchung zu widmen.
»Kommen Sie mal!«, rief jemand. Die Stimme klang aufgeregt, und es schien eine Art freudige Erregung in ihr mitzuschwingen. Myriam wandte sich augenblicklich um. Sie sah einen unbekannten jungen Mann in der Tür stehen, die Hände in den Taschen der engen Jeans. Ungeduldig erwiderte Ron: »Was ist denn, Wagner?«
Myriam verstand sofort, wen sie vor sich hatte: Kevin Wagner, der seit acht Wochen Rons Team verstärkte. Henris Beschwerden über den neuen Assistenten waren die letzten Wochen immer heftiger geworden. Sie verstand sofort, weshalb. Der Assistent spielte offenbar den Cop der Zukunft. Vom Dreitagebart, den struppigen Haaren bis zu dem weißen Hemd über der Hose und der betont lässig gebundenen Krawatte.
»Offenbar hat sie nicht nur klassisches Ballett getanzt.«
Sein Gesicht drückte tiefe Befriedigung aus. Er lachte kurz auf.
Sie folgten ihm in das ordentliche Schlafzimmer gegenüber, wo er ihnen mit süffisantem Lächeln etwas entgegenhielt, das Myriam nur bei gutem Willen als Unterwäsche bezeichnen konnte.
»Woher haben Sie das?«, wollte Henri wissen.
»Aus den Tiefen ihres Kleiderschranks.« Wagner deutete mit einer lässigen Handbewegung auf den Schrank hinter sich. »Eine Nutte«, fuhr er fort. »Da hat einer seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Eine Nutte trifft einen sexuellen Psychopathen. Der Stoff, aus dem heutzutage die Träume sind.« Er schnalzte aufreizend mit der Zunge. »Sie wissen schon. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht.«
Myriam konnte den Blick nicht von dem Kleidungsstück nehmen. Eine Prostituierte.
Hatte sie sich deshalb ohne Widerstand einem Mann ausgeliefert, der sie mit der Peitsche antrieb wie ein Pferd? Hatte es als Spiel begonnen? Handelte es sich um eine Variante dieser sexuellen Abartigkeiten, die rasend schnell aus dem Nährboden kranker Fantasien schossen – einschließlich der dazugehörigen Internetseiten?
Die Hypothese erschien sinnvoll. Dennoch fühlte sie sich enttäuscht, ohne zu wissen, warum.
Wagner beobachtete sie triumphierend, wobei er ihr die Unterwäsche direkt vor die Nase hielt.
Was heißt Unterwäsche? Nein, das Teil verdiente diesen Namen nicht. Nicht nur weil es aus rotem Leder war, sondern weil dieses Ding nichts verbergen konnte, zumindest nicht das, was sie sozusagen unter Naturschutz stellen würde. An den falschen Körperstellen war mit dem Leder gespart worden. An den entscheidenden Stellen, korrigierte sie sich. Dazu kamen die zahlreichen Schnallen im Schritt sowie über der Brust, die hoch zum Hals führten, um dort in einer Art Hundehalsband zu enden.
Wagner hörte nicht auf zu reden. Über Sado-Maso, und überhaupt gehöre so etwas im Milieu dazu. Manche Männer bekämen eben nur einen hoch, wenn sie entsprechend animiert würden. Vielleicht sei einfach etwas schiefgegangen. Dabei stieß er ein unangenehmes hohes Lachen aus.
»Verdammt noch mal, halten Sie endlich die Klappe«, zischte Myriam.
»Hier ist kein Platz für Empfindlichkeiten, Frau Staatsanwältin!«, spottete Wagner mit diesem Grinsen im Gesicht, das leicht mit dem eines Zuhälters verwechselt werden konnte.
»Das sind Spekulationen, Wagner.« Ron nahm ihm das Lederteil aus der Hand. »Außerdem fassen wir nichts ohne Handschuhe an. Wann kapieren Sie das endlich, Mann?«
»Wenn Sie dafür sorgen, dass hier überall Handschuhe bereitliegen und ich sie mir nicht selbst kaufen muss.«
In diesem Moment entschied Myriam: Morgen früh würde sie als Erstes überprüfen, ob Kevin Wagner bereits auf Lebenszeit verbeamtet war, oder ob es eine schnelle Möglichkeit gab, ihn wieder loszuwerden.
4
Davids Laptop stand im Weg. Justin schob ihn beiseite und zündete sich mit zitternder Hand eine Zigarette an. Dann schlug er die Zeitung auf. Milan hatte das Haus ohne ein Wort verlassen. Dies bedeutete den endgültigen Abschied.
To give someone his marching order. Wie hieß das auf Deutsch? Jemandem den Laufpass geben.
Justin hatte immer wieder versucht, mit Milan zu sprechen, doch dieser, sonst gewandt im Reden und jederzeit fähig, die Welt in klare Worte zu fassen, schwieg beharrlich.
Es war die Ruhe vor dem Sturm. Das tiefe Brodeln im Vulkan, kurz vor dem Ausbruch, wenn es in einem bebt, wenn die Gefühle tief im Innern wallen, lediglich zurückgehalten durch die Ahnung einer Katastrophe.
Wann würde es zur Explosion kommen? Bald. Sehr bald.
Justin legte die Zeitung beiseite, griff nach einem Buch und schlug es auf. Montag musste er vor über fünfzig Leuten ein Referat halten.Was sollte er sagen? Wie Haltung bewahren unter Milans kritischen Blicken, die jede Schwäche sofort aufdeckten? Genauso gut könnte dieser ihn unter einem Mikroskop beobachten. Er würde sich wie ein Insekt fühlen. Wie eine Küchenschabe.
Er würde über Kafkas Brief an seinen Vater sprechen und die ganze Zeit nur denken, was ist geschehen? Was passiert? Wann hatten sich Milans Gefühle abgekühlt? Was sollte er tun, bevor Milan ihn aufforderte, das Haus zu verlassen?
Wann das passiert war? Er musste nicht lange überlegen. Seitdem dieser neue Doktorand seine Stelle angetreten hatte. Paul Olivier, Sohn eines Schweizer Professors, dessen angebliche Intelligenz lediglich auf dem Ruf seines Vaters, eines Mathematikprofessors in Genf, beruhte, während Justins eigener Vater, mittelmäßiger Lehrer an einer katholischen Highschool in Philipsburg, New Jersey, die Familie gerade so über Wasser gehalten hatte. Sein Dad hatte ihm nichts vererbt außer einem Hang zu Walt Whitman. Lediglich ein sinnloses Faible für den Wahnsinn von Dichtung.
Konnte dies Zufall sein? Oder lagen die Wohnungsanzeigen absichtlich auf dem Frühstückstisch? Nichts, was Milan tat, geschah ohne eigenes Interesse. Er war kein Mensch der Zufälle. Nein, seine Gedanken, Handlungen und Ideen folgten nur einem Wegweiser, dem Egoismus. Dies war der Stern, nach dem Milan Hus sich richtete. Das war die Wahrheit.
Justin traten die Tränen in die Augen. Es musste ihm nicht peinlich sein. Er war allein. Nicht einmal David befand sich im Haus. Er hatte es gleichzeitig mit seinem Vater verlassen, als wollte er ihm Gelegenheit für einen unbemerkten Rückzug geben. Er konnte also einfach losheulen. Niemand außer ihm selbst wurde Zeuge seiner Erbärmlichkeit.