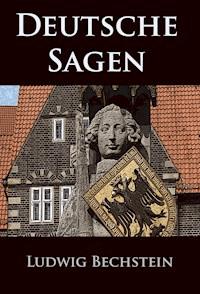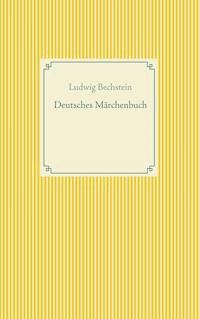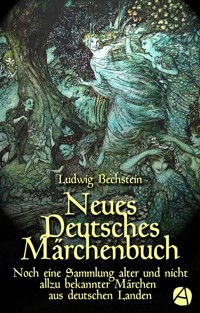Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Das tolle Jahr von Erfurt" ist ein historisch-romantischer Roman aus dem sechzehnten Jahrhundert. Im Roman wird die im Jahr 1509 stattgefundene Revolte der Stadtbevölkerung von Erfurt gegen ihre Ratsherren thematisiert. Tauche ein in die Geschichte einer der bedeutendsten Städte Deutschlands. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 828
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Bechstein
Das tolle Jahr von Erfurt
Historisch-romantischer Roman aus dem sechzehnten Jahrhundert
Mit dem Bilde Ludwig Bechsteins.
Saga
Das tolle Jahr von Erfurt
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1928, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728010310
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Vorbemerkung.
Der Dichter, Novellist und Altertumsforscher Ludwig Bechstein erblickte am 24. November 1801 zu Weimar das Licht der Welt. Früh verwaist, wurde er von seinem Oheim, dem Direktor der Forstlehranstalt in Dreissigacker, Johann Matthäus Bechstein, an Kindesstatt angenommen und erzogen. Von Dreissigacker aus besuchte B. bis zu seinem 18. Jahre das Lyceum im benachbarten Meiningen und widmete sich dann zu Arnstadt der Pharmacie, wurde nach vollbrachter Lehrlingszeit Apothekergehilfe und konditionierte in gleicher Eigenschaft zu Meiningen und Salzungen. Früh schon regte sich sein dichterisches Talent, verschiedene Zeitschriften nahmen seine Poesien und Erzählungen auf; seine erste selbständig erscheinende Schrist, „Thüringische Volksmärchen,“ 1823, in welcher sich Musäus’ Einfluss zeigte, liess er auf Wunsch seiner Angehörigen unter dem veränderten Namen „C. Bechstein“ heraus geben. Eine dem Mittelalter, den Sagen und Märchen aus dem Volksleben, insbesondere seiner thüringischen Heimat zugewandte romantische Richtung, verbunden mit einer schwärmerisch-religiösen Liebe zur Natur, namentlich zur Pflanzenwelt, kennzeichnet seine ersten Versuche in dieser Richtung, wenn auch im Laufe der Zeit mannigfach schattiert, offenbarte sich in allen seinen folgenden Schriften. Herzog Bernhard zu Sachsen-Meiningen, von Bechsteins Talent angesprochen, ermöglichte ihm 1828 ein dreijähriges akademisches Studium zu Leipzig und München, welches vorzugsweise der Philosophie, Geschichte, Litteratur und Kunst gewidmet war. Im Jahre 1831 zum Kabinetts-Bibliothekar und zum zweiten Bibliothekar an der herzoglichen öffentlichen Bibliothek zu Meiningen ernannt, welche Stellung ihm zu schriftstellerischer Wirksamkeit hinreichende Musse liess, gründete B. am 14. Nov. 1832 den Hennebergischen altertumsforschenden Verein, dessen Direktor und zuletzt Ehrenpräsident er bis zu seinem am 14. Mai 1860 erfolgten Tode blieb. 1833 erster und alleiniger Bibliothekar an der öffentlichen Bibliothek, im Jahre 1840 zum Hofrat ernannt, war er seit 1844 auch bei der Ordnung des Hennebergischen Gesamt-Archivs beschäftigt und wurde 1848 von den vier Teilhabern (Meiningen, Preussen, Weimar und Coburg) als gemeinschaftlicher Archivar angestellt.
Ein vollständiges Verzeichnis der lyrischen, lyrisch-epischen, novellistischen und dramatischen Schöpfungen, der Märchen- und Sagen-Sammlungen, sowie der wissenschaftlichen Arbeiten Ludwig Bechsteins auf dem Gebiete der Altertumsforschung giebt Prof. Dr. Reinhold Bechstein in der biographischen Skizze seines Vaters in der „Allgem. Deutschen Biographie“ (Bd. 2, S. 206 ff.), welcher vorstehende Angaben entnommen sind, sowie in dem Werke: „Ludwig Bechstein in seinem wissenschaftlichen Wirken“ (1882). Hier sei nur seiner wichtigsten Werke gedacht. Seine kleineren lyrischen und lyrisch-epischen Dichtungen, die in Zeitschriften, Almanachen, Taschenbüchern u. s. w. zerstreut sind und von denen nicht wenige für die Liederkomposition benutzt wurden, sammelte B. nur einmal selbst in seinen „Gedichten“ (1836). Einige sonst nicht gedruckte brachte er in seinem Sammelwerke „Deutsches Dichterbuch,“ o. I. (1846, 2. Aufl. 1854). Unter den grösseren Epen ist sein letztes, erst nach seinem Tode herausgegebenes Epos „Thüringens Königshaus“ wohl seine bedeutendste Leistung auf diesem Gebiete. Von seinen Romanen behandeln die früheren meist Gestalten und Begebenheiten des Mittelalters oder der Reformationszeit: „Die Weissagung der Libussa,“ 2 Bde. 1829; „Das tolle Jahr von Erfurt,“ 3 Bde. 1833 u. s. w. In neuerer Zeit spielen: „Fahrten eines Musikanten,“ 3 Bde. 1837 (2. Aufl. in 2 Bänden mit einem 4. Teil versehen, 1854), welcher Roman sich wohl den meisten Beifall errang. Von Bechsteins Märchen- und Sagen-Sammlungen sind hervorzuheben: „Der Sagenschatz und die Sagenkreise des Thüringer Landes,“ 4 Teile, 1835—1838; „Deutsches Märchenbuch“ (zuerst 1845 erschienen, in mehreren, auch illustrierten Ausgaben und in wiederholten Auflagen verbreitet); „Deutsches Sagenbuch,“ 1853; „Neues deutsches Märchenbuch,“ zuerst 1856, in zahlreichen Auflagen erschienen, und „Thüringisches Sagenbuch,“ 1857. Eine abhandelnde Schrift auf gleichem Gebiete ist „Mythe, Sage, Märe und Fabel im Leben und Bewusstsein des deutschen Volkes,“ 3 Bde., 1855. In einem Sammelwerke „Deutsches Museum für Geschichte, Litteratur, Kunst und Altertumsforschung“ (2 Bde., 1842) gab er Seltenheiten, meist seinen eigenen Sammlungen entnommen, heraus.
Bechsteins Hauptleistung auf dem Gebiete der Altertumsforschung ist das Prachtwerk: „Geschichte und Gedichte des Minnesängers Otto von Botenlauben,“ mit einem Urkundenbuch und Abbildungen (1845). Von des Dichters Vorliebe für Thüringen, welche er nach den verschiedensten Richtungen hin in seinen Schriften zum Ausdruck brachte, geben namentlich seine „Wanderungen durch Thüringen“ (Leipzig, 1838, Teil des „Malerischen und romantischen Deutschland“) und seine Schrift: „ Thüringen in der Gegenwart“ (1843) Zeugnis.
P. S.
* * *
In Nr. 24—26 des „Erfurter Stadt- und Landhoten“ vom 6., 10 und 13. April 1844 erschienen „Berichtigungen zur Geschichte über: „Das tolle Jahr.“ Der Verfasser, Kanzleidirektor und Sekretär Pabst, beseitigt und berichtigt in seinem Aufsatze „solche Verstösse und Unrichtigkeiten, die sich auf die Örtlichkeit und insbesondere auf die Wohnung des Obervierherrn Heinrich Kellner, und auf andere im tollen Jahre bezeichnete, in der Kellnerschen Leidensgeschichte vorkommende wichtige und angesehene Personen beziehen.“ In Nr. 30 genannten Blattes vom 27. April 1844 äussert sich der Verfasser des Romans „Zu den Berichtigungen über: ,Das tolle Jahr.‘ “ Sein offener Brief hat nachstehenden Wortlaut:
„Einer meiner Freunde in Erfurt hat mir, anonym, die in Nr. 24, 25 und 26 des ,Erfurter Stadt- und Landboten‘ enthaltenen Berichtigungen zugesendet, und ich danke ihm, da ich seinen Namen nicht weiss, für seine freundliche Aufmerksamkeit und für seine wohlwollende Absicht auf diesem Wege.
Nicht minder aber danke ich dem Verfasser jener Berichtigungen, Herrn Kanzleidirektor und Sekretär Pabst im Namen aller Freunde gründlicher Geschichtsforschung für seine ebenso wacker als fleissig ausgearbeiteten Mitteilungen, über die ich mich wahrhaft gefreut habe.
Von seiten meiner, als Verfasser des erwähnten Romans: ,Das tolle Jahr,‘ welcher Roman das Glück hatte, sich namentlich in Erfurt grosser Teilnahme zu erfreuen, erwartet wohl niemand den Versuch einer Rechtfertigung der mit Gründen angefochtenen, dabei untergelaufenen historischen Irrtümer. Die Treue des Historikers ist vom Romantiker nicht anzusprechen. Dieser letztere erfasst seinen Stoff und formt daraus nach der Eingebung seiner Muse die Gestalten, deren er bedarf, und auch die geschichtlich wahren umkleidet er mit Gewändern seiner Phantasie.
Den Gedanken romantisch-epischer Bearbeitung jenes dankbaren Stoffes, den das ,tolle Jahr‘ behandelt, erfasste ich schon, als ich noch in Arnstadt als Pharmaceut lebte. Falkensteins Chronik regte mich dazu an; aber ich fühlte, dass ich des Stoffes nicht Herr sei, und es vergingen vier bis fünf Jahre, ehe ich wagte, ihn, nachdem ich mich für Darstellung solcher Art etwas mehr ausgebildet hatte, wieder vorzunehmen. Jetzt ging ich nach Leipzig, um dort Philosophie, Litteratur und Geschichte zu studieren, und dort begann ich die Ausarbeitung des Buches, das ich ein Jahr später in München vollendete. Meine einzigen, mir damals zugänglichen Quellen waren Falkenstein, Gudenus und ein alter Stadtplan von Erfurt. Nur wenige Zeit war mir vergönnt, auf Lokalstudien in Thüringens Hauptstadt selbst zu verwenden; ich war damals noch nicht so glücklich, wie jetzt, dort der biederen Freunde viele zu zählen. Ein Mann, dem ich noch im Grabe danke, nahm sich freundlich meiner an; es war der alte Buchdrucker Ritschl von Hartenbach; er führte mich herum, gab mir Bescheid auf meine Fragen, kannte vieles, und ich notierte in Eile so viel als möglich. Nur zwei Tage war ich in Erfurt, in diesen zwei Tagen sammelte ich die örtlichen Beziehungen. Der Rosenbaum am Hause der Michaelsgasse zog mich an, die ganze Umgebung, ihr Altertümliches, interessierte mich; die Chroniknachricht, dass Balthasar Kellner den Rosenhagen besessen, bewog mich, Baum und Hain für identisch zu nehmen, und dorthin, in eine mir wohlgefällige Lokalität, den Hauptschauplatz des Romans zu verlegen. So verfuhr ich auch, der Freiheit, die dem Dichter zusteht, mich bedienend, mit anderen Wohnungen der handelnden Personen, und so haben alle derartigen Angaben dieser Art in jenem Buche keine historische Geltung, ja man wird dieselben kaum Verstösse zu nennen berechtigt sein, da sie in einem Werke der Poesie, obschon auf historischem Grund und Boden, auf keine andere Glaubwürdigkeit Anspruch machen, als die der Illusion. Hätte ich freilich das Buch später geschrieben, nachdem ich mich selbst ernsten und gründlichen Geschichtsstudien zugewendet, so würde ich demnach ungleich gründlicher zu Werke gegangen sein. Eine Arbeit solcher Art habe ich in meinem geschichtlichen Roman ,Grumbach‘ (3 Teile) dargeboten, ob aber die Schwere der historischen Stofffülle dieser letzten Arbeit nicht Schaden gethan, ist eine Frage, und ich hätte wohl besser gethan, aus dem mir überreich zu Gebote gestanden habenden Material über die bekannten Grumbachischen Händel ein streng geschichtliche Darlegung auszuarbeiten.
Um wieder auf mein , tolles Jahrs‘ zurückzukommen, so sind alle darin enthaltenen Liebesverhältnisse, die meisten Beziehungen zu Heinrich Kellners früherem Leben, die zu seinen Brüdern, und eine Menge der handelnden Personen ganz meine Erfindung. Schwerlich gab es eine Rosa und eine Charites Milwitz. Zwei liebliche Mädchen, Schwestern, Erfurterinnen, liehen meiner Einbildungskraft ihre Züge, Gestalten und edeln Sitten für jene beiden Patriciertöchter. Da einmal der Vierherr Hans Kranichfeld als mauvais sujet im Roman eine Rolle spielte, die ihm zuzuteilen Falkenstein mich verleitete, so war es notwendig, an ihm einen Akt poetischer Gerechtigkeit üben zu lassen.
Jedenfalls bleibt es verdienstlich, in topographischer, genealogischer und historischer Beziehung Wahrheit und Dichtung eben so gewissenhaft und würdig als mit kundigem Geiste geschrieben zu haben, wie es von Herrn x. Pabst geschehen ist, und es hat jene Berichtigungen wohl kaum jemand mit grösserem Interesse gelesen, als ich selbst, der Verfasser des ,tollen Jahres.‘
Meiningen.
Ludwig Bechstein.“
Erstes Kapitel.
An süsser Hoffnung Hang’ im Ungemach.
Euripides.
Der volle Mond warf sein helles Licht auf das stattliche Patricierhaus, „zum Rosenhagen“ genannt, das dem Vierherrn und Ratsmeister Heinrich Kellner in Erfurt gehörte, und der in Stein ausgehauene und vergoldete Rosenbaum über der Thür strahlte mit mattem Schimmer die sanfte Beleuchtung zurück. Es war der Abend des zweiten Juni 1509; wie lockend und frühlingsherrlich er aber auch herabgesunken, so schienen sich doch in der Michaelisgasse, worin der Rosenhagen gelegen, nicht viele Menschen seiner Schöne zu erfreuen. Die Strassen waren still; in den Häusern verlosch ein Lämpchen nach dem andren, nur die himmlische Leuchte wandelte ungetrübten Glanzes fort. In den blühenden Fliederbüschen, deren duftende Dolden und dichtbelaubte Zweige über die Gartenmauer ragten, schlug noch eine späte Nachtigall, aber nicht mit dem anhaltend schmetternden Lenzgesang, sondern nur in einzelnen Intervallen, als sende sie dem entflohenen Wonnemond noch einige Grüsse und Seufzer nach. Auf der Steinbank vor dem Patricierhaus sass ein bejahrter Mann, sein ergrautes Haupt bedeckte eine Sammetkäpplein, seine Tracht war einfach, aber fein und warm, sodass die Kühle des Abends ihm nicht beschwerlich fiel. Zuweilen hob er sein stilles, ernstes Angesicht empor nach der Mondscheibe, dann senkte er es wieder, leise seufzend, und blickte auch wohl von Zeit zu Zeit die Strasse entlang, als erwarte er noch jemand, obgleich es schon ziemlich spät am Abend war. Zuweilen sprach er auch, nach des Alters Gewohnheit, halblaute Worte zu sich selbst, aber wer diese hätte verstehen wollen, hätte sehr nahe bei dem Alten stehen müssen. Im Hause, vor dem er sass, schien schon alles zu ruhen, kein Licht erhellte mehr von innen die Fenster, nur die Mondesstrahlen fielen mannigfach gebrochen, von ihnen zurück. Jetzt schallten Tritte in der einsamen Strasse, der Alte bog sich hinhorchend vor, und seine noch hellen Augen entdeckten einen langen hageren Mann in geistlicher Tracht, und in ihm den Erwarteten.
„Guten Abend, Adam!“ grüsste dieser den Alten, ihm die Hand reichend. „Guten Abend, Joseph!“ erwiderte der, und der Gekommene setzte sich neben ihn. „Du bist lange ausgeblieben, Joseph,“ nahm Adam das Wort. „Ich konnte nicht früher kommen, lieber Bruder,“ antwortete der Angeredete, „es wurden heute abend noch zwei stille Messen gelesen, und dann weisst du ja, dass es gar ein weiter Weg ist von meiner armseligen Küsterwohnung nahe bei St. Viti bis zu dem Hause deines Herrn, des ehrsamen Patriciers Heinrich Kellner, und folglich zu dir, alter Murrkopf.“
Der Alte lächelte, drückte des Bruders Hand und sagte: „Schelte nur nicht, Joseph, du weisst, was mich drückt; wollte Gott, ich hätte keine Ursache, dich zu so weiten Wegen zu veranlassen. Sprich, Joseph,“ — hier dämpfte er seine Stimme noch mehr und neigte sein Haupt dem Ohr des Bruders näher — „sprich, was hast du vernommen, was ist die Meinung der Gemeinde, was redet man hin und her in der Stadt? denn du weisst, ich erfahre sonst nichts, mir sagt niemand etwas, weil ich des Ratsmeisters Diener bin.“
„Und ein treuer Diener,“ sprach der Küster zu St. Viti. „Meinte es doch ein jeglicher so mit seinem Herrn wie du! Aber Adam, Gutes habe ich dir leider nicht zu melden, nein, nichts Gutes. Gieb acht, Bruder, es kommt eine böse, böse Zeit, und ein trübes Gestirn wirft seinen feindseligen Schein auf unser Erfurt. Der Rat hat es nicht gut gemeint mit der Gemeinde. Die Stadt ist tief verschuldet durch die Schuld des Rates; nun geht die Rede, dass er Rechnung ablegen soll vor den erwählten Gemeindevormündern, und, Bruder, das wird ihm schwer werden, sehr schwer, denn es ist nicht alles, wie es sein sollte.“
„Du machst mir bange, Joseph,“ sprach Kellners Diener. „Es wird sich doch niemand an dem edlen Rat vergreifen?“
„Vergreifen?“ fragte der Küster zurück. „Und wenn sich nun ein edler Rat selbst vergriffen, den Gemeinsäckel für seinen eigenen anzusehen? Es wird manchem manches gar übel bekommen, denke ich. Der gemeine Haufe murrt laut; die Übelgesinnten und Unzufriedenen haben eine böse Saat in die Gemüter der niederen Bürger und Handwerker gestreut, haben die Sache vergrössert, gedenken im Trüben zu fischen, wenn ein Volksaufstand losbricht, und schüren so lange heimlich die glühenden Kohlen, bis die lichte Lohe der Empörung über die Häupter der Stadt zusammenschlägt.“
„So weit wird es nicht kommen, Bruder,“ nahm der Alte wieder das Wort; „die Herren haben viel Ansehen, viele Gewalt, und auch viele Freunde im Volk. Sie haben ein treu Regiment geführt, den Bürger nicht gedrückt, und manchem wohlgethan.“
„Wohlgethan?“ wiederholte Joseph bitter lächelnd. „Deine Haare sind grau geworden, Bruder, und das Alter fängt an, dein Haupt zu beugen, und du solltest noch nicht erfahren haben, wie schnell eine Wohlthat vergessen wird? Jede Wohlthat, die ein Fürst oder eine Obrigkeit dem Volke erzeigt, wird nicht angesehen als eine solche, sondern jederzeit als eine Schuldigkeit, für die sich keiner bedanken zu müssen meint, ja deren Lohn meistenteils noch schnöder Undank ist. Und was das treue Regiment betrifft, Adam, so ist das so eine Sache, von der wir vielleicht beide nicht allzuviel verstehen; nur meine ich mit meinem einfältigen Verstande, treu Regiment bestehe auch mit darin, eine gute Stadt nicht in eine ungeheure Schuldenlast zu stürzen, wie der ehrsame Rat gethan.“
„Ist es denn so sehr arg? Und weisst du denn nicht, wie hoch die Summe sich beläuft, Joseph?“ fragte der alte Diener.
„Hoch genug soll sie sich belaufen, um dem Rat bange zu machen, wenn er Rechnung ablegen soll,“ erwiderte der Küster. „Und ich sage dir, der Rat soll und muss Rechnung ablegen.“
„Nicht so laut, nicht so laut, lieber Bruder!“ flüsterte Adam ängstlich und blinzelte hinauf nach dem Fenster, „der Herr hat einen leisen Schlaf, könnte uns hören. Sprich leise, Joseph, erzähle mir alles, was dir zu Ohren gekommen.“
Und im leisen, flüsternden Gespräch berichtete der Küster dem für die Wohlfahrt seines Herrn redlich besorgten Diener alles, was in jenen Tagen die Gemüter der Erfurter Bürgerschaft bewegte, aufregte und aufs höchste beunruhigte, sodass auch überall ein schlecht verhaltener Unwille, ein tiefer Missmut, eine stille Gärung bemerkbar war, die, wenn sie zum Ausbruch kam, der Ruhe der Stadt äusserst gefährlich schien. Während aber hier der Küster Joseph Eckardt seinen Bruder von der Stimmung des Volkes unterrichtete, und ihm seine eigenen trüben Befürchtungen mitteilte, wurde im Hause selbst ganz leise das kleine Gartenpförtlein geöffnet, und unhörbaren Trittes schlüpfte eine in dunkle Gewänder gehüllte Frauengestalt über die wenigen Stufen in den mondbeglänzten Garten, sah sich furchtsam um, ob sie wohl einen Lauscher gewahre, und ging dann mit schnellerem Schritt tiefer in den Garten hinab, der sich schmal, aber lang, bis nahe an den Arm der Gera erstreckte, der die Stadt Erfurt unter dem Namen des Breitstroms in zwei ungleiche Hälften teilt. Dort standen viele Duftbäume, und eine dichte Laube von Hainbuchen, Geisblatt und Massholder, und es war nicht möglich, dass vom Hause eine nächtliche Lustwandlerin erblickt werde, selbst wenn das Mondlicht die Nacht fast taghell machte. Eine Viertelstunde früher war ein junger Mann, dessen Kleidung den edlen Junker verriet, mit hastigen Schritten durch die Augustinerstrasse gegangen, war um die Kirche zu St. Nikolaus herumgeschlüpft und rasch, über den schmalen Steg geeilt, der dort über die Gera führte, worauf er versucht, eine Gartenthür zu öffnen, die sich nahe bei dem Steg befand, und war, als er die Thür noch verschlossen traf, missmutig zurückgetreten und auf den schmalen, mit Weidenbäumen besetzten Fusspfad, zur Rechten Zäune, zur Linken das Wasser, ungeduldig auf und ab gegangen. Häuser und Bäume verhinderten, dass vieles Mondlicht auf den Pfad des nächtlichen Wandlers fiel, nur sparsam stahlen sich einzelne Strahlen durch das Laub, das der frische Hauch des Abends bewegte. Das Wehr bei der nahen Furtmühle hinter dem grossen Kollegium rauschte laut durch die Abendstille, und schien ein silberglänzender Wasserfall.
Um die Blütenbüsche des Purpurweiderich und die niedrigen Vergissmeinnicht tanzten Johanniskäfer mit bläulichem Phosphorlicht, und die Nachtigall im Garten flötete sanft. Aber der ungeduldige Jüngling hatte kein Auge für die stillen Schönheiten des Abends, kein Ohr für die Liebestöne Philomeles.
„Sie kommt nicht; nein, sie kommt nicht, sie lässt mich vergebens harren!“ sprach er zu sich selbst, und seine schöne freie Stirn wurde von Wolken finsteren Missmuts überschattet. „Dass ich ihrem Versprechen auch glaubte! Das wäre ja zu viel gewährt, viel zu viel; eine trauliche Unterredung dem treuen Freund! Das könnte ihn wohl stolz machen!“
Der Ungeduldige ging immer rascher, jede Minute dehnte sich ihm zur Viertelstunde aus. Zweimal schon hatte er den Fuss auf den Steg gesetzt, um heimzukehren, aber immer wieder den schnellen Entschluss bereut. Oft stand er mitten im Gehen still, und lauschte, ob sich etwas regte, er hustete, er klopfte leise an die Gartenthür, aber alles blieb still, nur das Wehr rauschte eintönig fort.
Jetzt näherte sich die Verhüllte in dem Garten der Thür. Sie lugte durch die Hecken, sie hörte den Schritt des draussen Gehenden; ihr Herz klopfte, ihre Hände zitterten. Elisabeth, die engelschöne Tochter des Vierherrn Kellner, war zum erstenmal auf dem Wege, den heimliche Liebe gern und oft wandelt, wenn sie das Auge des Tages und das der Menge zu scheuen Grund hat. Sie fühlte mit ihren zarten Fingern nach dem Schlüsselloch, denn die Hand, in der sie den Schlüssel hielt, zitterte zu sehr, als dass sie es mit diesem zu finden vermocht hätte.
„Es sei!“ sprach sie nach einer Weile zögernder Unentschlossenheit, und öffnete leise die Pforte. „Habe ich doch ein reines Gewissen, und ist doch der junge Mann ein Biedermann. Der Engel der Tugend sei mein Schutzgeist!“ Sie ging von der Thür zurück nach der Laube. Wie der Wanderer draussen wieder an die Gartenthür kam, durchbebte ihn ein freudiger Schreck, er trat rasch hinein und spähte ringsumher, und da er niemand gewahrte, eilte er der Laube zu. Da trat ihm, das Haupt sittsam gesenkt, mit hochglühenden Wangen, Elisabeth entgegen.
„Meine Libetha!“ rief der Liebende und zog sie stürmisch an sein Herz und bedeckte ihre weisse, weiche Hand mit Küssen.
„Johannes!“ flüsterte sie verschämt, „was müsst Ihr von mir denken? —“
„Dass Ihr ein Engel seid, an Güte wie an Schönheit!“ schmeichelte der Beglückte und zog sie inniger an sich.
„Nicht so, nicht so stürmisch und ungestüm,“ bat sie, und entwand sich ihm sanft. „Mässigt Eure Liebesglut, Ihr macht mir sonst bange, und ich muss Euch verlassen.“
Der Jüngling seufzte und blickte sie zärtlich an. „Euer Händchen lasst Ihr mir doch, Libetha?“ bat er, und zog ihre Linke aufs neue an seine Lippen. Die Jungfrau entzog ihm ihre Hand nicht, sie setzte sich nieder auf die Bank und atmete tief; eine süsse Befangenheit raubte ihr die Sprache, sie legte die rechte Hand beschwichtigend auf ihr hochklopfendes Herz und versank in Gedanken.
„Und ich darf Euch mein nennen?“ flüsterte der Jüngling. „Ihr beglückt mich mit Eurer Neigung! Ich darf um Euch werben, meine süsse Herrin?“
„Mein Herz dürft Ihr das Eure nennen,“ antwortete sie leise. „Kann meine Neigung Such beglücken, wohl mir! Dass ich Euch sehr, sehr hoch schätze, und höher wie jeden anderen Mann, das mögt Ihr daran erkennen, dass ich Euch Eure dringende Bitte um diese Zusammenkunft gewährt, die ich gewiss keinem anderen vergönnt hätte. — Ob Ihr um mich werben dürft, Stadtschreiber?“ setzte sie wehmütig hinzu: „das weiss ich nicht. Verwehren kann es Euch wohl niemand, aber ob Ihr meine Hand auch erhaltet? Mein Vater, den ich über alles liebe und schätze, scheint sich einen anderen Schwiegersohn erkoren zu haben.“
„Einen anderen?“ fuhr der Stadtschreiber Johannes Zimmermann auf, „einen anderen, und wer wäre dieser? Nennt mir ihn, Libetha! Ich will mit ihm um Euch auf Tod und Leben —“
„Um Gottes willen! Johannes!“ flehte das erschrockene Mädchen; „wollt Ihr denn die Nachbarn aus dem Schlafe rufen? Nein, wenn Ihr so heftig seid, dann mag ich ihn Euch gar nicht nennen. Ihr würdet alles verraten und mich verderben. — Lasst uns, lieber Freund,“ fuhr sie milder fort, als er düster schwieg, „lasst uns noch nicht an die Heirat denken. — Wenn Ihr mich wahrhaft liebt, so genüge Euch meine Gegenliebe. Mir ahnt, als werde die nächste Zeit keine Zeit für Hochzeiten und Freudenfeste werden, wohl aber eine Zeit, in welcher es not thut, dass die Guten fest zusammenhalten, eine Zeit, in der sich treue Freundschaft vielfältig bewähren mag. In solcher Zeit, Johannes, würde ich mich glücklich schätzen, wenn ich auf Euch rechnen könnte in jeder Gefahr, die mir und den Meinen droht; auf Euern Kopf und auf Euer Herz, auf Euern Mund wie auf Euern Arm, o mein werter Freund, auf niemand möchte ich lieber rechnen!“
„Mädchen, welche Gedanken kommen dir in den Sinn!“ rief der Stadtschreiber verwundert aus. „Ist auch dir schon die Ahnung trüber Begebenheiten nahe getreten und hat dein jugendlich heiteres Gemüt mit dunklen Prophezeiungen umnachtet? Meine Libetha! Bei dem ewigen Gott und bei den Heiligen, du sollst dein Vertrauen keinem Unwürdigen geschenkt haben. Was auch komme, ich gehöre dir an, ich bin dein Diener, dein Unterthan, dein Leibeigner!“
„Gott lohne Euch diese Liebe, Johannes!“ lispelte Elisabeth, und drückte dem Jüngling warm die Hand. „Und nun,“ fuhr sie fort, „nun, da Ihr Euch mir gelobt, da Ihr mein seid, o nun sagt mir auch, wie steht es im Rat? Ist es wahr, was das Gerücht sagt, dass er öffentlich Rechnung ablegen soll vor der Gemeinde? Ist es wahr, dass man meinen Vater beschuldigt —“
Sie vermochte nicht weiter zu reden, Thränen und eine unendliche Angst hemmten ihr die Sprache.
„Fürchtet nichts für Euern Vater, Libetha,“ sprach er tröstend. „Wenn es auch sich bestätigen sollte, dass der Rat Rechnung, ablegt, es wird doch darum keinem der edlen Herren ein Haar gekrümmt werden; von einem Zwang des Rates kann ohnedies nicht die Rede sein. Aber sage mir, Mädchen, ich bitte dich, sage mir, wer ist es, den dein Vater dir zum Mann bestimmt?“
„Hans Kranichfeld ist’s, der Freund des Vaters, der Schalksnarr, der sich durch seine glatte Zunge und seine Geschmeidigkeit in Gunst gesetzt hat bei meinen beiden Eltern, in und somit auch vermeint, der meinen gewiss zu sein.“
„Der?“ dehnte Johannes Zimmermann, „den fürchte ich nicht, und bist du mir treu, bleibt mir deine Liebe gewiss, mein holdes, trautes Mädchen, dann fürchte ich auch keinen anderen, er sei, wer er sei!
Er küsste aufs neue ihre Hände, er schlang den Arm um ihren zarten Nacken, den ein seidnes Tuch züchtig verhüllte, er zog sie näher an sich und flüsterte: „Meine Libetha, lass uns in Freud und Leid fest aneinander halten.“ —
„Fest, fest, mein Johannes,“ lispelte sie verschämt, und beider Lippen fanden sich, und ein keuscher, heisser Kuss durchschauerte ihre Seelen und besiegelte das stille Gelübde, gab dem Bunde der Herzen die süsse Weihe.
Manches besprachen sie noch im traulichen Gekose, bis die Glocken der Türme, die Hörner der Wächter verkündeten, dass die Geisterstunde angebrochen, da schieden selig küssend die Liebenden. Elisabeth harrte an der Gartenthür, bis der Geliebte über den Steg hinüber war, noch einmal grüsste er mit dem Barett, rief noch ein leises Gutenacht zu ihr hinüber und verschwand hinter der Nikolaikirche, deren Turm hoch und schwarz in die Mondnacht hinaufstarrte. Von einem Schauer von Geisterfurcht übermannt, eilte Elisabeth, so schnell sie konnte, durch den Garten, sie war um diese Zeit noch nie allein da unten gewesen. Erst wie sie wieder heraustrat aus dem Dunkel der Bäunte, wurde ihr leichter, aber dennoch lag auf dem Garten und auf der ganzen Stadt eine eigene, wunderliche Beleuchtung; es war so düster und dämmerig geworden, und der Himmel war doch noch heiter und sternenvoll, und es war doch auch noch Mondschein. Dieses denkend, blickte Elisabeth hinauf zu dem Mond, aber ein entsetzlicher Schreck fuhr ihr durch das zagende Herz: Der Mond hatte seinen Schein verloren, ein dunkler Schatten hing er an dem Himmel, und um den Schatten war nur ein matter Glanz sichtbar. Bebend sah sie noch einmal hinauf, die Erscheinung blieb dieselbe, und nun öffnete sie, zitternd und leise das Gartenpförtlein und schlüpfte, in das Haus und in ihre stille Kammer. Lange währte es, ehe die Aufgeregte, von den Gefühlen der Liebe, der Angst und abergläubischer Furcht gleichzeitig bestürmt, den Schlummer fand. —
Auf der Steinbank vor dem Rosenhagen sassen noch immer die Brüder. Beide blickten unverwandt hinauf zu der verfinsterten Mondscheibe, beide erschöpften sich in ängstlichen Vermutungen.
„Ein böses Omen,“ seufzte der Küster. „Ich habe zum öftern schon Finsternissen an den Himmelslichtern zugesehen, doch ist mir eine ähnliche nicht erinnerlich. Sieh nur, Adam, jetzt ist auch der letzte Schein am Rande erblichen, und nun steht der Mond, wie eine Welt, auf der der Herr Gericht gehalten, und sie überfegt mit der Rute seines Zornes, dass sie nichts mehr ist als ein grosses, weites, dunkles Grab.“
„Wer weiss, was das bedeutet?“ nahm Adam bekümmert das Wort. „Solchen Verdunkelungen des Gestirns pflegt gemeiniglich mehr als ein trauriges Ereignis zu folgen. Wer weiss, wessen Stern untergeht, ehe wir wieder den zweiten des Brach monats schreiben!“
„Von ungefähr geschieht dergleichen nicht,“ setzte der Küster das Gespräch fort. „Die gelehrten Herren Doktoren sagen wohl, solches alles trage sich zu nach natürlichem Gesetz, und die Astrologi und Mathematici können die Finsternisse vorhersagen und den Stand und die Konjunktur der Planeten berechnen, aber wenn wir das auch gern glauben, so bleiben die Erscheinungen am Firmament doch immer etwas Tiefwunderbares und Geheimnisvolles, und wenn ich mir den Himmel denke als das grosse Buch der göttlichen Allmacht, so sehe ich in den Kometen, Finsternissen und wunderbaren Meteoren immer den Finger Gottes, der hineindeutet in die heilige Sternenschrift und uns fündige Menschenkinder warnt und ermahnt, uns zu bessern und Busse zu thun.“
„Ja, ja, Bruder,“ sprach der Diener Kellners darauf, „du hast die rechte Meinung und verstehst das alles zu deuten und auszulegen, bist du doch ein Diener der Kirche und kundig der Schrift; wir armen Laien aber wissen wenig. — Siehe, jetzt wird es wieder licht an der einen Seite, die Finsternis scheint vergehen zu wollen.“
„Ja, sie vergeht,“ versetzte der Küster. „Aber das Unheil, das sie verkündet, wird nicht so schnell vergehen. Siehst du das Gewölk, was sich rings um den Mond lagert? Siehst du die wunderlichen Wolkengestalten, fast wie ein Kriegsheer anzuschauen, die gegen den Mond ziehen, wie gewappnete Reisige gegen eine Feste?“
„Wie ein Haufe aufrührerischer Unterthanen gegen seine Obrigkeit,“ setzte Adam hinzu.
„Ich will nun nach Hause gehen,“ sprach Joseph und erhob sich von seinem Sitz. „Schlafe wohl, mein Bruder!“
„Gute Nacht,“ entgegnete Adam, dem Scheidenden die Hand reichend. „Schliesse uns in dein Gebet ein, und lass mich dich bald wiedersehen.“
Der Küster ging. Der alte treue Diener sah ihm nach, blickte noch einmal hinauf zu dem Mond, schüttelte das graue Haupt und murmelte: „Gutes kann es nimmer bedeuten, noch bewirken, wenn eine Welt in den Schatten einer anderen tritt, wie mein Bruder sagte, dass es hier der Fall sei, denn das Licht ist des Lebens Urquelle. Mir ahnet nichts Gutes Gott schütze uns.“
Leise öffnete er die Hausthür, schlich hinein und schob Drinnen die schweren Eisenriegel vor.
Liebselig eilte der feurige Jüngling Johannes durch die engen und oft gewundenen Gassen seiner Wohnung zu. Der Weg führte ihn durch die Kürschnergasse an einer Schenke vorüber, in der noch Licht war. Nur seine Liebe im Herzen, nur die Gedanken an Elisabeth im Kopf, wollte er achtlos vorbeigehen, als ein tosender Lärm vieler Stimmen, der aus der Schenkstube drang, ihn aufmerksam machte. Er stand und lauschte; durch die trüben, runden Scheiben gewahrte er, dass eine Anzahl junger Bürger und Bürgersöhne drinnen sich beim Wein gütlich that und zum Teil berauscht, die unnützesten Reden führte und die heftigsten Schmähungen gegen den Rat ausstiess. Unter den lautesten Schreiern erkannte der Stadtschreiber den Goldschmied Hanns, dem sein ungeheurer Bart den Namen „Hanns im Bart“ verschafft, den Glaser Kaspar Degenhart, den Pergamenter Schele und einige andere, die sämtlich als lose Gesellen bekannt waren, und schon öfters böser Händel halber vor den Stadtrat gefordert und bestraft worden waren.
„Zusammenhalten! Nur zusammenhalten müssen wir Bürger!“ schrie Hanns im Bart mit dröhnendem Bierbass: „Wir wollen doch sehen, wo die Steuern und Gaben hingekommen sind, die wir zahlen müssen nun so viele Jahre lang!“
„Ja, das wollen wir sehen!“ brüllte Degenhart dazwischen, und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Kannen klirrten. „Wo soll die grosse Schuld herkommen? Wo ist das Geld hin? Unser Geld!“
„Ja, unser Geld! Unser Geld!“ rief es im Chorus. „Das haben die Herren in ihre weiten Säckel geschoben, und nun steckt die Stadt in Schulden, wie ein Esel im Morast, und kann nicht heraus!“ krähte der trunkene Pergamenter. Und kein Teufel kann dahinter kommen, wie gross die Summe der Schuld ist. Wir sind arme Lämmer, verraten und verkauft!“ Er rief es und weinte, von einer plötzlichen Weinrührung übermannt, helle Thränen und konnte vor Schluchzen nicht weiter reden.
„Es ist eine babylonische Verwirrung!“ nahm Hanns im Bart wieder überlaut das Wort, „aber wartet nur, ihr werdet schon sehen, was wir erleben! Und an all dem Unglück ist der Kellner Schuld! Gott verdamme ihn!“ —
„Das alte Lied, das nun schon lange Zeit auf allen Wein- und Bierbänken wiederhallt,“ seufzte Johannes, „wie wird es doch enden?“ Er mochte nichts weiter hören und eilte von dannen.
––––––––––
Zweites Kapitel.
Beglückt in allen Dingen ist kein Sterblicher.
Euripides.
In seine schwarze Amtstracht gekleidet, stand mit stolzem Anstand der Ober-Vierherr und Ratsmeister Erfurts, Heinrich Kellner, in der grossen Familienstube und gab mit freundlichem Lächeln seiner Martha den geleerten Becher des Frühtrunkes, dass sie ihn aufs neue mit würzigem Wein fülle. Sein Knabe, zwölf Jahre alt und nach des Vaters Vornamen benannt, hielt mit jugendlichem Wohlgefallen das lange Schwert in den Händen, das der Vater noch nicht umgegürtet. Elisabeth sass mit ernstsinntendem Gesicht am Fenster, und oft entstieg ihrer Brust ein unhörbarer Seufzer. Sie schlug die dunklen Augen zu dem reinen Sommermorgenhimmel auf, damit die Thränen zurücktreten sollten, die Verräter ihrer Gefühle zu werden drohten. Die Mutter waltete geschäftig, für ihre Lieben besorgt, und trat, als sie ihres Mannes Becher wieder gefüllt hatte, zum Fenster, durch das man in den Garten schauen konnte, und durch welches die Strahlen der Frühsonne gar freundlich hereinfielen. Herr Kellner aber schritt auf und ab in dem geräumigen Zimmer, ernst und schweigend, und bisweilen den Becher an die Lippen führend. Seine Blicke ruhten bald mit Wohlgefallen auf dem schönen, blondgelockten Knaben, bald auf der holden Gestalt Elisabeths, glitten dann auf die Mutter, und weilten lange auf der stillen milden Frau, und seine Gedanken ergingen sich in den Blütenfeldern schöner Erinnerungen. Dann überflog seine Stirn wieder ein trüber Schatten, sein Gesicht nahm einen zornigen Ausdruck an, die Blicke, flammten, und die Rechte ballte sich krampfhaft zusammen. Aber er bekämpfte die bittere Empfindung, die in seinem Gemüt aufzulodern schien, und legte wehmütig die Hand auf das Lockenhaupt seines Heinrich. Da ging die Thür auf, und Balthasar, der Bruder Kellners, der im Hause wohnte, trat, der Familie guten Morgen bietend, in das Zimmer. Er war schon völlig angekleidet, in den Rat zu gehen, dessen Beisitzer er war. Etwas grösser und hagerer, wie der Ober-Vierherr, machte ihn auch ein Zug von Schlauheit und List um den Mund seinem Bruder im äusseren Ansehen unähnlich. Heute waren seine Züge ganz besonders mürrisch und verdrossen. Er setzte den Becher, den ihm Frau Martha gastlich geboten, ohne zu trinken wieder auf den Tisch und sah den Bruder, der noch auf und ab ging, lange und lauernd an.
„Willst du denn in den Rat gehen?“ fragte er nach einer Weile.
Der Ober-Vierherr drehte sich rasch um und sah den Sprecher gross an. „Wie seltsam du fragst,“ nahm er das Wort, „wollte ich nicht hingehen?“
„Hm, ich an deiner Statt liesse mich unwohl melden und bliebe daheim,“ redete Balthasar zurück. „Ich sollte doch meinen, du wüsstest, dass du dem Volk ein Dorn im Auge bist, dass der Pöbel sich einbildet, du habest die Stadt in Schulden gestürzt, weil ihm dies Märlein aufgebunden worden von unseren Feinden, und —“
„Wozu das Geschwätz?“ brauste Kellner auf, und sein kühnes, stolzes Auge blitzte den Bruder zornflammend an. „Meinst du, ich fürchte mich vor dem Volk, ich wiche dem Pöbel aus, ich sei bange vor unseren Feinden? Jage mir den Frauen hier keine Furcht ein, und kümmere dich nicht um mein Thun. Hörst du, Balthasar! Was ich thue und was ich gethan, das kann ich verantworten vor Gott, vor meinem Gewissen und vor der ganzen Welt! Dass ich den Gemeinde-Vormündern ein Dorn im Auge bin, ist mir gar wohl bewusst, fümmert mich aber nicht, lass es, ich bitte dich recht sehr, auch dich nicht kümmern.“
Rascheren Schrittes ging der Aufgereizte durch die Stube, die Scheiben klirrten von seinem gewichtigen Tritt; lächelnd sah ihn Balthasar an und trank dann langsam und sprach darauf im ruhigsten Ton, dem aber doch ein feiner Hohn beigemischt war: „Wohl, mein lieber Bruder, sehr wohl! Alles nach deinem Gefallen. Wann hättest du denn meines Rates bedürft? Wann wäre meine Meinung von einer Sache auch zugleich die deinige gewesen? Nie! Ich sage nur so viel: Ist dir wohl, so bleib davon, das ist mein Sprichwort, bei dem ich mich gut gehabe.
Kellner antwortete nicht, er hatte die Arme untergeschlagen und setzte seinen Spaziergang in der Stube fort. Elisabeth zitterte, sie war schon oft Zeugin unbrüderlicher Zwiste gewesen, die sie immer tief verwundeten und ihr Herz gegen den Oheim empörten. Die Mutter ging seufzend in die Kammer, der Knabe lehnte des Vaters Schwert an die Wand und trat an den Ofen, so finstere Blicke auf Balthasar werfend, als er nur immer fähig war.
„Und was soll es denn nun werden,“ begann Balthasar wieder, „wenn niemand mehr dem Rat leihen will, wenn der Streckit der Stadt aufhört? Ein Auskommen muss ja doch getroffen werden!“
„Geduld bauet, Ungeduld bricht ab!“ eiferte der Ratsmeister. „Thoren haben voreilig den Anschlag gegeben, der Gemeinde diese Sache vorzutragen, und Thoren haben ihn ausgeführt, die mögen es auch ausbaden. Ich sehe schon die ehrsamen Vormünder sitzen und die Köpfe schütteln und die Mäuler aufsperren vor purer, heller Verwunderung. Nun, es gehe wie es wolle, die Macht wird sich der Rat nicht aus den Händen winden lassen.“
„Ei beileibe, das wird und das darf er nicht!“ stimmte Balthasar bei. „Wo die Macht ist, ist die Gewalt, und wo die Gewalt ist, ist das Recht.“
Abermals ging die Thür auf, und es schritt der Patricier Burkhart Unrath, der Bruder von Kellners Ehefrau in das Zimmer, die Anwesenden mit höflichem Neigen grüssend, diesem folgte auf dem Fusse der Ratsmeister Hans Kranichfeld, geschmückt mit Ketten und Ringen, und zierlich auf den Zehen einherwandelnd, als sei er ein welscher Tanzmeister. Elisabeth grüsste den mütterlichen Ohm mit herzlicher Freundlichkeit, aber als sie den geckenhaften Kranichfeld gewahrte, trieb ihr der Unwille das Blut in die Wangen.
„Ich lege Euch meinen guten Morgen zu Füssen, holdeselige Jungfrau!“ begann der verliebte Geck, sich graziös verneigend, nachdem er die übrigen nur kaum flüchtig begrüsst.
Elisabeth neigte nur ein wenig das schöne Haupt zum Dank, aber Balthasar nahm für sie das Wort und sprach spottend: „Da wird er wohl liegen bleiben und in das Auskehricht kommen!“
„O nicht doch,“ versetzte Hans selbstgefällig. „Jungfrau, Elisa ist nicht so unmilder Gesinnung wie Herr Balthasar, und wird meinen unterwürfigen Gruss nicht verschmähen. Nicht wahr, holdselige Schönheit, Rose der Jungfrauen, Blumenzier des Gartens meiner Gedanken?“
Elisabeth schwieg. Kranichfeld wollte fortfahren in seinen schwülstigen Schmeicheleien, als Heinrich Kellner dazwischen rief: „Else, meine Handschuhe!“ und ihr dadurch eine willkommene Veranlassung gab, aufzustehen, um aus der gebohnten Schublade das verlangte Handschuhpaar dem Vater zu holen.
Der Ober-Vierherr befestigte sein Schwert am Gurt, drückte das schwarze Sammetbarett auf die gerunzelte Stirn und das dunkle Kraushaar und warf prüfende Blicke auf Kranichfeld, seinen Bruder und seinen Schwager, als wolle er in das Tiefinnerste ihrer Herzen schauen, aber als gelinge ihm das nicht, oder als werde er irre an der Schrift, die sich seinem forschenden Geist offenbarte, so schüttelte er still vor sich das Haupt, und wandte sich ab von ihnen, die seine Blicke nicht gewahrt, und seufzte leise, denn es kam eine trübe Ahnung über ihn. Da flüsterte die süsse Stimme des geliebten Kindes: „Hier, mein Vater,“ und mit sanftem Lächeln stand seine Elisabeth vor ihm und reichte ihm die begehrten Handschuhe. „Danke, danke, meine gute Else,“ sprach er, sich schnell erheiternd, und strich ihr mit der Hand über die blühenden Wangen.
„Herr Schwager,“ nahm Burkhart jetzt das Wort, „ehe Ihr geht, lasst mich erst noch ein freundliches Wort sagen, denn deshalb bin ich gekommen.“
„Redet in Gottes Namen,“ entgegnete Kellner freundlich, und Burkhart begann: „So wisst, dass Euer alter Feind, Adolf Rössing, Gemeindevormund geworden ist, und Nikolaus Monstedt dazu, und dass sie nicht ruhen und rasten wollen, bis sie Euch aus dem Rat, aus der Stadt, ja vielleicht um Leib und Leben gebracht haben.“
„Um Gottes willen, Oheim!“ rief Elisabeth und legte erbleichend ihre zur Hand genommene Arbeit nieder; Kellners Hausfrau, die wieder in die Wohnstube getreten war, hob die Hände mit einem stummen Klageblick gen Himmel, aber Balthasar und Kranichfeld lächelten sarkastisch, doch Kellner blieb ruhig.
„Ich weiss es, lieber Schwager,“ nahm er das Wort, „und bin dennoch guten Mutes. Das ist die Frucht der Narrheit einiger Ratsherren, dass sie die Gemeinde zu Rate gezogen. Ich weiss, wie sich die Neuerwählten erst zum Schein geweigert, sich der Sache zu unterziehen, und gesagt haben: Mit Herren ist nicht gut Kirschen essen. Der Rat wird sich nicht wollen in sein Spiel sehen lassen, und wenn wir uns gegen ihn stellen, lässt er uns setzen; wir bedanken uns. Ich weiss, dass die Erwählten der Gemeinde ihnen an Eidesstatt geloben mussten, mit Leib und Leben, Ehr’ und Gut, Haut und Haar die neuen Vormünder zu vertreten.“
„So ist’s, so ist es leider,“ klagte Burkhart, „und jene gelobten nun der Gemeinde ein gleiches, und versprachen, nichts, weder kleines noch grosses mit dem Rate zu verhandeln und zu vertragen, ohne Wissen der Gemeinde und ihrer Zustimmung!“
„Ich hab’ es ja gesagt, dass es so kommen würde!“ rief Balthasar aus, „und gebt acht, die Schuster und Wollenweber werden uns bald in hellen Haufen einen Besuch im Rat abstatten, und da wird es über einen gewissen sehr stolzen und sicheren Mann hergehen, der nicht hört auf den Rat seiner besten Freunde.“
„Übel stände es um mich,“ entgegnete der Vierherr bitter, „wärst du mein bester Freund! Noch giebt es Männer, die treu zu mir halten, noch bin ich Ober-Vierherr, und den will ich sehen, der es wagt, mir Trotz zu bieten! Memmen verzagen, aber des Mannes Mut wird durch die Gefahr erhöht! Sie werden in der heutigen Versammlung wohl kommen und fragen, wie hoch die Schuld der Stadt sich beläuft, sie werden wohl erschrecken, wenn wir ihnen sagen: Sechsmalhunderttausend Gulden, aber was weiter?“
„Sechsmalhunderttausend Gulden!“ wiederholte Burkhart, und schlug die Hände vor Schreck zusammen. „Welch eine ungeheure, schreckliche Summe!“
„Kann es mich kümmern? Habe ich die Stadt in Schulden gebracht?“ fragte Kellner. „Lange vor meinem Regiment ist der Grund dazu gelegt worden, was will man von mir? Doch genug der zwecklosen Reden; so es euch beliebt, meine werten Freunde, so gehen wir; ich höre die Rathausglocke läuten. Gehab’ dich wohl. Martha,“ sprach er zu seiner Gattin, und legte ihr seine Hand auf die Schulter, „sei ohne Furcht. Auch du, Else. Lebe wohl, lieber Junge!“ Der kleine Heinrich schüttelte ihm wacker die dargebotene Hand. Balthasar schritt mit flüchtigem Gruss hinaus, Burkhart folgte ihm, Kranichfeld verneigte sich zierlich gegen die Frauen und lispelte zärtlich, zu Elisabeth gewandt: „Euer Diener verlässt Euch, liebliche Elisa, Kleinod meiner Hoffnungen, Königin des Rosenhains; möchte ich doch, wenn mir der Glücksstern wieder strahlt, Euch zu sehen, Euch freundlicher finden.“
„Möchte ich Euch doch einmal vernünftig finden, Herr Kranichfeld,“ zürnte Elisabeth. „Ich sollte meinen, die Zeit sei nicht günstig für Eure Scherze, und wahrlich, ich bin nicht aufgelegt, sie anzuhören. Lebt wohl.“
„Schmeichelt der Dirne nicht zu sehr, lieber Freund!“ sprach der Vierherr zu Kranichfeld, und drohte ihm lächelnd mit dem Finger. „Sie ist ein braves Kind, sie liebt die zuckersüssen Reden nicht. Hab’ auch mein Lebtag nicht viel davon gehalten. Kommt, Freund! Auf Euch hoffe ich rechnen zu können, wenn mir je Gefahr droht. Nicht wahr, das kann ich?“
Kranichfeld sah verlegen aus. „Gewiss, gewiss,“ antwortete er, aber sein Herz war anderer Meinung, das sprach: „Wo die Deichsel sich hinrichtet, gehen die Räder nach. Weit davon ist gut für den Schuss.“
Er fasste Kellners Arm, rief noch im Gehen: „Lebt wohl, Mutter Martha, behüt dich Gott, Heinrich,“ und schritt mit dem Ober-Vierherrn davon.
„Warum heisst Euch denn der alte Junkherr immer Mutter?“ fragte der kleine Heinrich, als hinter jenem kaum die Thür zugefallen war, seine Mutter, und trat näher zu ihr. Frau Martha lächelte, und streichelte ihm die Wangen. „Er hofft, dass ich seine Mutter werde,“ antwortete sie ihm, „da nennt er mich schon im voraus so.“
„Ach, Mutter,“ lachte der Knabe, „du spassest wohl. Wie kannst du denn seine Mutter werden, da du es doch nicht bist?“
„Du bist ja auch noch nicht Ratsmeister,“ scherzte die Mutter, „und willst doch einer werden.“
„Ja freilich,“ sagte er rasch, „aber das ist auch etwas anderes!“ —
Elisabeth war wieder in die Stube getreten, sie stand am Fenster und sah den Männern nach, die stolzen Schrittes durch die Strasse gingen. Fast wie geharnischte Ritter im dunklen Eisenkleid nahmen sie sich aus. Schwarz waren die Baretts und schwarz die Federn daran, schwarz war das kurze, breitschössige Wams, voll weiter Falten und ohne Knöpfe. durch einen Gürtel von schwarzer Farbe, an welchem das Schwert herabhing, zusammengehalten. Die Vierherrn trugen an diesem Oberkleid einen steifen, rundgeschnittenen Kragen, inwendig mit goldgelbem Sammet gefüttert, und auch das Kollett darunter war von schwarzem Sammet. Die schwarzen, weiten Buffen und Falten der Beinkleider reichten nur kaum an die Hüften, und wurden zum Teil vom Oberkleid bedeckt, übrigens lagen sie ganz knapp an und verliefen sich in die Schuhe, die an der Spitze des Fusses am breitesten und hufartig ausgeschweift waren. Die sehr langen Handschuhe waren vom feinsten Wildleder, gelb und geglättet, und darauf schwarze und goldene Blümlein und Sterne sehr zierlich eingepresst. Die ganze Tracht einfach, bequem und doch ungemein wohlkleidend, dem Körper, auch des minder Starken, den Anschein einer gewissen Fülle und Gediegenheit verleihend. Kam nun noch dazu ein stattlicher Bart um Lippen, Kinn und Wangen, und ein trotziger, kühner Blick aus den Augen voll Feuer und Mut, so konnte es nicht fehlen, dass diese Herren, wenn sie ernst zum Rathaus schritten, ihren Zeitgenossen mehr Respekt einflössten, als die dreihundertzweiundzwanzig Jahre später Lebenden den ihrigen.
„Denke nur, Schwester Else,“ wandte sich jetzt Elisabeths Bruder zu der Sinnenden, „denke nur, Herr Hans, der dir immer so närrische Dinge vorspricht, will haben, unsere Mutter soll seine Mutter werden! Über den Mann; das kann doch gar nicht angehen!“
Elisabeth musste lächeln über des Bruders unschuldige Verwunderung, aber es war ein Lächeln durch Thränen; ach, ihr war es gar wohl bewusst, wie es Kranichfeld meine, und es lag ihr dieses Bewusstsein schwer auf dem Herzen. Sie vermochte nicht dem Bruder zu antworten, wandte sich ab und blickte durch das Fenster in die Strasse, aber sie gewahrte nichts mehr, sie vermochte nicht die Thränen zurückzudrängen, die ihren dunklen Augen entquollen, und der Bruder sah es.
„Else weint, Mutter,“ flüsterte er leise, und der Blick seiner grossen Augensterne war voll Kümmernis.
„Du weinst, Tochter?“, fragte Frau Kellner und trat näher zu dem geliebten Kinde und blickte ihm forschend, wie eine liebevolle Freundin, in das zährenüberströmende Angesicht, das Elisabeth jetzt schnell mit ihrem Tuche verhüllte.
„Hat dir jemand ein Leid gethan?“ fragte die Mutter, als immer heftiger die Gemütsbewegung wurde, „sprich doch, mein Kind, was fehlt dir? Du bist doch nicht krank? Um Gottes willen, lass mich doch nicht in der Angst!“
Elisabeth schüttelte das Haupt und schluchzte fort und fort, und die besorgte Mutter schlang ihren Arm um sie und beugte sich über sie, und Heinrich, nicht ahnen könnend den Seelenschmerz der Schwester, rief bittend aus: „Weine doch nicht, Elschen, sei doch gut! Die Mutter bleibt unsere Mutter, Herr Hans kann sich eine andere suchen, wir brauchen keinen Bruder weiter!“
„Sprich doch nicht so albernes Zeug, Heinrich,“ schalt die Mutter, „deswegen wird deine Schwester nicht weinen; geh in den Garten, ruse mir den Adam herein, ich will ihn wohin schicken, geh, lieber Junge!“
Heinrich sah die Mutter etwas ungläubig an und gehorchte.
„Nun bitte ich dich, Mädchen, was hast du, was ist dir?“ drang Frau Martha aufs neue in das weinende Kind, und dieses sank an die treue Mutterbrust und schwieg und schluchzte noch immer.
„Hat dich Herr Kranichfeld gekränkt?“ fuhr jene mit Fragen fort, „das wüsste ich doch nicht, ist er doch immer sehr höflich und sittsam gegen uns Frauen, und ein gar treuer Freund unseres Hauses, und ein angesehener, wohlhabender, feiner Mann von gutem Betragen, den dein Vater lieb hat, mein Kind, und der dir auch zugethan ist vor allen Jungfrauen in der Stadt.“
„O meine Mutter,“ klagte Elisabeth, „das ist es eben, warum ich weine. Ich will nichts von ihm wissen, und mag er mir zugethan sein oder nicht, so bin ich es ihm nicht, und werde es nie sein. Und wie der Bruder vorhin sprach, dass Herr Hans Euer Sohn werden wolle, da fuhr es mir ins Herz wie ein Dolchstich, denn ich bin dem Kranichfeld gram.“
„Du bist ihm gram, Mädchen? Unserem Freund und Vetter, den deine Eltern so wert schätzen?“ fragte Frau Martha verwundert. „Und darum weinst du?“
„Und auch des Vaters Schicksal liegt mir schwer auf dem Herzen,“ schluchzte Elisabeth, „denn alle die Reden, die ich höre, verkünden nichts Gutes, und ich muss Euch sagen, Mutter, wenn Ihr und der Vater glaubt, dass Herr Hans uns ein treuer Freund sei in Freud und Leid, in Schimpf und Ernst, in Not und Tod, so täuscht Ihr Euch, und Ihr werdet noch sehen, dass ich recht habe. Doch wollte Gott, ich hätte unrecht, und erlebte nie, dass seine Falschheit offenkundig würde.“
„Hätte ich doch nimmer gemeint, dass du dem Manne so abhold, mit dem wir uns recht eng zu verbinden hofften,“ gegenredete die Mutter, „aber weine nur nicht, Tochter, zwingen lasse ich mein Kind nicht zu einer Verbindung, in die das Herz nicht willigt, aber der Vater, der Vater, du weisst, wie er auf seinem Sinn besteht. Doch sei nur still, beruhige dich; kommt Zeit, kommt Rat.“
Elisabeth trocknete ihre Thränen. Sie hätte so gern der Mutter ihr ganzes Herz entdeckt, ihr gesagt, wen sich dieses Herz auserkoren, sie hatte noch nie ein Geheimnis vor ihr gehabt, aber es war das erste, und es ist so süss, ein Geheimnis zu haben, und die erste Liebe ist meist schüchtern, zaghaft und befangen. Die jugendlichen Gefühle sind noch nicht stark genug, um sich hinauszuwagen in die Stürme der Welt; Schwingen leiht ihnen nur die Phantasie und die Hoffnung, aber diese Schwingen sind Ikarusflügel, die zu hoch die Überglücklichen tragen.
Elisabeth schwieg; sie küsste die Hand ihrer Mutter, blickte sie zärtlich an und senkte dann erglühend die Blicke; die Mutter drückte ihr einen Segenskuss auf die reine Stirn, und Heinrich trat wieder in die Stube, ihm folgte der treue Adam.
„Hier, Mütterchen,“ rief der Knabe: „bringe ich Adam! Nun, Schwesterchen, bist du wieder freundlich? Was hat dir denn gefehlt?“
„Nichts, lieber Heinrich,“ erwiderte Elisabeth freundlich, und scheitelte ihm mit ihren zarten Fingern die blonden Locken.
„Ich bedarf deiner nun nicht, Adam,“ wandte sich Frau Martha zu dem alten Diener. „Ich dachte, das Mädchen wäre krank und wollte dich zum Doktor schicken.“
„Gott sei Dank, dass es nicht vonnöten ist,“ erwiderte Adam. „Es wäre mir traun ein saurer Gang gewesen, für die liebe Tochter meiner Herrschaft zum Doktor zu gehen.“
„Hast du heute früh nichts Neues gehört, Alter?“ fragte die Gebieterin.
„Ach Gott,“ klagte der Gefragte, „wäre doch das Neue nur stets erfreulich, und wollte uns doch der himmlische Vater vor allem Neuen gnädiglich behüten! Wenn es nur keinen Bürgeraufstand giebt. Auf dem Fischmarkte vor dem Rathaus steht das Volk Kopf an Kopf und führt lästerliche Reden gegen den ehrbaren Rat, ohne Scham und Scheu, und es ist ein grosses Geschrei in der ganzen Stadt wegen der Schuldenlast, die der Rat gewirkt haben soll, und es soll Rechnung gethan werden von dem Haushalte des Rates. Ach, es ist eine böse Zeit. Die vorige Nacht hat der Mond ganz verfinstert gestanden, und ich habe mit meinen Augen eine feurige Volksmenge in den Lüften gesehen, die gegen den Mond heranzog.“
„Grosser Gott!“ rief Frau Martha aus, und griff nach dem Rosenkranz, leise ein Gebet sprechend, und Elisabeth durchschauerte die Erinnerung an den gestrigen Abend. Heinrich trat näher zu dem erzählenden Alten, aufmerksam seinen Worten lauschend.
„Ich will Euch nicht bange machen, edle Frau,“ fuhr der Diener fort, „ich will Euch nicht durch unnütze Besorgnisse ängstigen, vielleicht kehrt der Herr im Himmel alles zum Besten, aber wenn Ihr den Rat eines treuen Knechtes nicht verachten wollt, so meine ich, es wäre wohlgethan, wenn Ihr Eure besten Sachen in Sicherheit brächtet, und etwa einigen von Euern besten Freunden, solchen, die nicht im Rate sitzen, aufzuheben gäbet, denn, edle Frau, Ihr wisst nicht, wie es hergeht, wenn das Volk wütend wird, ich bin einmal Zeuge eines Aufstandes gewesen, und bitte Gott täglich, mich dergleichen nicht wieder erleben zu lassen. Gesprochen ist das Wörtlein Aufruhr bald, aber was es umfasst und mit sich bringt, die Greuelthaten, die schrecklichen Ereignisse, das vermag kaum eine Zunge oder eine Feder genügend zu schreiben. Da geht alles drunter und drüber; kein Gesetz, kein Recht, keine Ordnung, keine Frömmigkeit sind da mehr zu finden; Zucht und Ehrbarkeit hören auf, und die Laster sind losgelassen. Dann ist es wohlgethan, dass der Redliche sein Gut birgt und entflieht, denn just ihm ergeht es am schlimmsten.“
„Du sprichst übel, Adam, und machst mir bange Furcht,“ äusserte Frau Martha, „von Fliehen sprichst du? Guter Gott, wo sollten wir denn hin, haben wir doch hier all unser Eigentum! Der Allmächtige wird es doch dahin nicht kommen lassen.“
„Ängstigt Euch nicht, meine Mutter,“ bat Elisabeth. „Ich habe ein gutes Vertrauen, dass es also schlimm nicht werden mag, wie unser alter Adam fürchtet. Und ob es auch der Übelgesinnten noch viele gebe, so denke ich, wir haben unter den angesehenen Geschlechtern noch manchen Freund, so wie auch im Rate, ich will Euch nur den wackeren Millwitz nennen, Herrn Hans Hirschbach, den alten Gunstedt, den angesehenen Friederus und andere, es werden doch nicht alle den Vater verlassen und von ihm abfallen?“
Einen nannte Elisabeth nicht, einen, der ihr alle die genannten wackeren Männer überwog, einen, auf dessen Treue und Anhänglichkeit sie Felsen baute, ihren Johannes. Der schöne, kräftige junge Mann stand vor ihrem inneren Auge wie ein Schutzheiliger, der sie schirmen würde in der Zeit der Gefahr, und sein Leben einsetzen für ihre Ehre und ihre Sicherheit.
„Du hast gute Namen genannt, Elsbeth,“ wandte sich Adam an die Jungfrau, die er noch mit dem traulichen Du anredete, wie er es gewohnt war aus ihrer Kinderzeit, da er sie noch geführt und getragen und gehätschelt, und ihr zuliebe alles gethan, was sie von ihm verlangt hatte, bis sie allmählich grösser geworden, und seine Liebe und seine Lust an den Kindern seines Herrn sich dem kleinen Heinrich zugewandt, „bei Gott, gute Namen, bei denen einem das Herz aufgeht in Freudigkeit und Zuversicht, aber die Macht des Bösen lehnt sich immer gegen das Gute und die Guten auf, wie ein unbändiges Tier der Wildnis sich dem Menschen widersetzt und der Zähmung, und das Häuflein der Guten ist klein und gering gegen die Zahl der Übelwollenden, aber, trautes Elsbethlein, bleibe bei deinem guten Glauben und halte fest an ihm, denn Bangigkeit macht schwach und es ist ein alter Spruch: denke nicht daran, so thut dir’s nicht weh.“
„Aber. Adam,“ begann Elisabeths Mutter ängstlich, „wenn du das meinst, warum kommst du denn und machst uns bange? Ich zittere und bebe ja, so hast du mich durch deine Rede erschreckt!“
„Hab’ Euch nicht erschrecken wollen, edle Frau,“ verteidigte sich Adam, „sondern warnen, nicht bange machen, sondern vorbereiten, nicht ängstigen, sondern Mut einsprechen. Hab’ ich ein Wörtlein oder zwei zu viel geplaudert, so vergebt es mir, wisst Ihr doch, wie treu es der alte Adam meint mit seiner Herrschaft, und dass er sein Leben für sie lässt, wenn es sein muss. Bin alt und plauderhaft, hab’ einen grauen Kopf und morsche Knochen, aber mein Herz ist noch warm und ist Euer und meines Herrn, und hier Euren lieben Kindern, bis auf den letzten Blutstropfen.“
Der Alte sprach es mit treuherzigem Tone, und es standen Thränen in seinen Augen, er wandte sich und ging.
„O Gott!“ seufzte die Ober-Vierherrin, „wie wird es doch werden! Sprich, Else, wohin soll ich denn mit euch Mindern fliehen, wenn es dahin kommt?“
„Fliehen, Mutter?“ fragte Elisabeth, und ihre Blicke belebte ein ungewöhnlicher Mut. „Wir fliehen nicht! Wir bleiben, wo der Vater bleibt, und der wird die Stadt nicht verlassen.“
„Ich bleibe auch bei dem Vater, Mutter!“ rief Heinrich feurig. „Wir schliessen das Haus zu und lassen niemand herein.“
Die kindische Äusserung des Knaben zwang der Mutter ein wehmütiges Lächeln ab.
„Mögen die Heiligen für uns bitten, und ihre Rechte schirmend über uns halten!“ seufzte sie und ging aus der Stube; der Knabe folgte ihr. Elisabeth aber stand, die Hände gefaltet, mitten in der Stube, die Wangen gerötet von der Zuversicht der Liebe, den Blick fromm und schwärmerisch emporgerichtet, selbst wie eine Heilige auf den Bildern altdeutscher Meister, und sprach: „Dem Geliebten mein Herz, dem Vater meine Seele! Beiden unverbrüchliche Treue! Beiden mein Leben! Das sei hochgelobt bei dem Erlöser und seiner heiligen Mutter!“ —
––––––––––
Drittes Kapitel.
Wer im Glück ist, lerne den Schmerz.
Schiller.
Der Rat war vollzählig versammelt. Zwei lange Tafeln, durch eine Seitentafel am obersten Ende verbunden, standen in dem grossen, geräumigen Saal; zu oberst sassen die Vierherren Kellner, Kranichfeld, Hirschbach und Gunstedt, hinter ihnen an einem grossen Tische der Stadtschreiber Johannes Zimmermann und die Notare Andreas Büchner und Tuchheffter. Längs den Tafeln abwärts nach den Jahren des Amtes die übrigen Ratsmeister, Beisitzer und Gerichtschöppen. Unter ihnen Dietrich Nacke, die Brüder Balthasar und Christoph Krohmann, Georg Friederus, Heinrich Trügeleben, Balthasar Kellner , Burkhart Unrath und andere. Auf einer breiten Doppelreihe altertümlicher Sessel sassen vorn, wo sich die Tafelreihen öffneten, die Vormünder und Erwählten der Gemeinde. Unter ihnen Nikolaus Monstedt, Adolph Rössing, Eoban Kollmann, Werner Kopfheim, Heinz Landgraf und noch viele andere. Hinter diesen, nach der Thür zu, standen die vier Ratsdiener, einer für jedes Viertel, in der Thür selbst aber lehnten, wie ein riesiges Wächterpaar, die Stockmeister Fuchs und Mistbauer. Sie hatten Hellebarden in den Händen, trugen lange Stossdegen, und schauten mit grimmigem Blick auf das Volk, das, zumeist aus Handwerkern und zusammengelaufenem Gesindel bestehend, sich auf dem geräumigen Vorsaal drängte, die Treppe erfüllte und auch auf dem Fischmarkt in grossen und dichten Haufen stand. Auf den Tafeln in der Ratsstube lagen Urkunden, Pergamentbriefe mit grossen Siegeln in Holzkapseln, Statutenbücher, in schwarzen oder Purpursammet gebunden und mit hellem Goldschnitt. Oben rings um den Saal über den Fenstern hing prangend Schild an Schild, auf welchen die Wappen der edlen Geschlechter gemalt waren, von denen seit Jahren Mitglieder im Rate gesessen. Die hohen Bogenfenster waren ganz mit herrlicher Glasmalerei geziert, die ebenfalls Patricierwappen, Sinnsprüche und Reimlein vor das Auge brachten, im mittelsten Fenster aber war das Wappen der Stadt im herrlichsten Transparentglanze sichtbar.
Die vielen schwarzgekleideten, ernsten, bärtigen Männer, unter denen manche waren, deren Haar die Zeit schon überreift, gewährten einen schönen Anblick: eine würdige, feierliche Stille herrschte im Saale, während nur dumpf das Getöse des neugierigen und müssig plaudernden Volkshaufens hereindrang. Auf manchem Gesicht lag ein finsterer Ernst, auf anderen eine bange Besorgnis, wieder andere warfen teils lauernde, teils unwillige Blicke auf den Ober-Vierherrn, die dieser aber nicht bemerken zu wollen schien. Er legte einige noch versiegelte Briefe vor sich hin, schob andere beiseite und liess dann die Hand nachlässig auf dem grossen Stadtbuche ruhen, welches, ein ungeheurer Foliant mit silbernen Ecken und Klausuren, neben ihm lag, während er mit der Rechten den hellen Metallgriff der Schelle erfasste, um den Beginn der Session zu eröffnen denn ein Auge hatte zählend die Reihen der Anwesenden überflogen, es fehlte keiner mehr. Erwartungsvoll richteten sich die Augen mehrerer der Ratsmitglieder auf den Ober-Vierherrn und die Klingel ertönte. Da flogen mit Gekrach die beiden Flügel der hohen Thür zu, und es wurde still im Saale, erwartungsvoll still, und der Ober-Vierherr erhob sich.
„Achtbare, ehrsame, liebe und getreue Vierherren, Ratsmeister, Vormünder und Erwählte!“ begann er die Anrede. „Wir sind hier versammelt, um in Friede und Freundlichkeit, Eintracht und Vorsicht zu beraten und zu beschliessen, was not thut zur Wohlfahrt unserer teuern Väterstadt, zu Nutz und Frommen des gemeinen Bestens; dass wir das thun nach Pflicht und Gewissen, treu und redlich, offen und wahrhaftig, dazu helfe uns der ewige Richter und erleuchte uns mit dem Lichte seiner Weisheit und Gnade!“
„Amen! Amen!“ sprachen die Männer feierlich; alle auf einmal und es wurde noch stiller. Darauf erhoben sich der greise Gemeindevormund Rössing und Nikolaus Monstedt, schritten festen Trittes vor nach dem Sitze der Vierherren, neigten sich, und Rössing nahm das Wort.
„Wir, der Gemeinde dieser Stadt Älteste und Vormünder, fragen nun an bei einem hochedeln und ehrsamen Stadtrat, im Namen der Gemeinde, wie hoch sich Sie Schuldenlast belaufe, die hiesige Stadt zu Boden zu drücken droht, und das wollen wir nun ernstlich wissen!“
Der Ober-Vierherr stand wieder auf, wendete den Folianten so, dass derselbe recht vor das Angesicht der Vormünder zu liegen kam, schlug ihn auf, wendete einige Blätter, deutete dann auf eine Zahl und sprach: „Leset hier!“
„Sechsmalhunderttausend Gulden!“ rief Rössing aus. „Entsetzlich, unerhört!“
„So log das Gerücht nicht, das die Summe also hoch angab!“ setzte Monstedt hinzu.
„So sich das nun also befindet,“ nahm Rössing wieder das Wort, „so ergehet an den edlen Rat das Gesuch der Gemeinde, Rechnung abzulegen, wo die ungeheuere Summe hingekommen, und wie es gekommen, dass sie so gross geworden, da doch die Gemeindemitglieder an Steuer und Schatzung alljährlich eịn nicht Unbedeutendes in den Gemeindesäckel legen müssen?“
Da erhob sich der Ratsmeister Dietrich Nacke und sprach: „Recht und billig ist es, dass Rechnung abgelegt werde, so ziemt es einem frommen Rat, der treu und redlich, nach Pflicht und Gewissen handelt.“ Er warf, indem er sprach, einen Blick voll Hohn und Spott auf Kellner, den er bitter hasste. „Wer nicht berechnen kann, mag gebüsst werden an seinem Sold und seinem Gut.“
„Wohlgesprochen,“ begann, da der Sprecher schwieg Monstedt. „Aber die Gemeinde, die sich zum edlen Rat alles Guten versieht, will, dass er fortan der Gemeinde gestatte, die Thore und Türme unserer Stadt, die Feste, Mauern und Bollwerke zu besetzen und zu verwahren, und versieht sich der Gewährung und hofft, dass der Rat mit ihr in Eintracht und Frieden handle.“