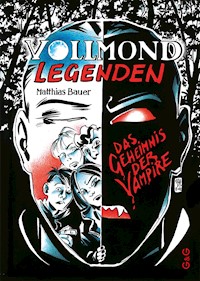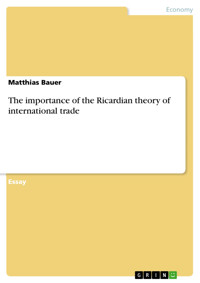Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Phantastische Stories
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen, das glaubt, den Eingang ins Paradies gefunden zu haben. Ein verzweifelter Schriftsteller, der um jeden Preis nach Inspiration sucht. Ein Scheusal von Rockstar, der alle in seiner Umgebung so behandelt, wie es ihm beliebt – bis das Schicksal eines Tages an die Tür klopft …Wie schon in Matthias Bauers erster Storysammlung "Reiche Ernte" führen auch die Kurzgeschichten von "Das Tor" auf unheimliche Pfade. Immer weiter gehen diese Pfade, tief in die Dunkelheit hinab, um am Ende Überraschungen zu enthüllen, die jeden Leser nach Luft schnappen lassen.Sind Sie bereit, "Das Tor" zu öffnen?Die Printausgabe des Buches umfasst 170 gedruckte Seiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias BauerDAS TOR
In dieser Reihe bisher erschienen
01 Geisterstunden vor Halloween von Stefan Melneczuk
02 Drachen! Drachen! von Frank G. Gerigk & Petra Hartmann (Hrsg.) 03 Hunger von David Grashoff & Pascal Kamp (Hrsg.)
04 Schattenland von Stefan Melneczuk
05 Der Struwwelpeter-Code von Markus K. Korb06 Bio Punk‘d von Andreas Zwengel
07 Xenophobia von Markus K. Korb08 Nachtprotokolle von Anke Laufer09 Reiche Ernte von Matthias Bauer
10 Das Tor von Matthias Bauer
Matthias Bauer
Das Tor
Neue makabre Geschichten
Matthias Bauer wurde 1973 geboren. Er lebt und arbeitet als selbstständiger Autor in Tirol.
Mit Bastian Zach schreibt er historische Romane (Morbus Dei-Trilogie, Das Blut der Pikten, Tränen der Erde). Ebenso verfassen Zach/Bauer Drehbücher, u. a. zum Horror-FilmOne Way Trip 3D und zum internationalen Wikinger-Hit Northmen – A Viking Saga.
Das Tor ist nach Reiche Ernte die zweite Kurzgeschichtensammlung, die Matthias Bauer als Solo-Projekt veröffentlicht.
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-604-0Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Für meine Familie
Vorwort
Erinnern Sie sich noch, liebe Leser, was ich im Nachwort zu meiner Kurzgeschichtensammlung Reiche Ernte schrieb? Das war erst der Anfang, drohte ich Ihnen damals, und ich habe mein Versprechen gehalten. Stellte die Ernte eine Sammlung meiner ersten, unveröffentlichten Geschichten dar, so enthält Das Tor ausnahmslos neue Storys.
Die Entscheidung, einen Nachfolger zu Reiche Ernte zu schreiben, entpuppte sich als gar nicht so einfach. Reiche Ernte war ein absolutes Herzensprojekt von mir, die Geschichten darin waren wie gesagt das Erste, was ich jemals geschrieben habe. Nachdem die Ernte auf einiges Wohlwollen bei Kritikern und Lesern stieß, fragte ich mich natürlich, ob mir das mit einem weiteren Kurzgeschichtenband noch einmal gelingen würde, ob ich Twists und Atmosphäre von Geschichten wie Apokalypse, Sommer und vielen anderen wiederholen könnte. Kurzgeschichten sind eine eigene Kunst, der ich nicht in dem Ausmaß fröne wie meinen Romanen, welche ich als Teil des Schreibduos Zach/Bauer verfasse. Romane sind die lange, breite Straße, auf der man viel Zeit zum Erzählen hat. In den kleinen Gassen der Kurzgeschichte hat man ungleich weniger Zeit. Aber packen muss man den Leser trotzdem. Beide Genres beinhalten ihre Herausforderungen.
Ich überlegte also, Reiche Ernte II zu schreiben, und hatte wie immer großen Respekt vor dem neuen Projekt. Dieser Respekt vor dem Neuen schwindet nie (Kann ich das? Wird das was?), ich handle dann stets gleich: eine Kanne Kaffee zubereiten, an den Computer setzen und die vagen Ideen, die im Kopf herumspuken, schriftlich festhalten. Bei Reiche Ernte II verfuhr ich genauso. Mir fielen die inhaltlichen Eckpfeiler der titelgebenden Geschichte ein und los gings. Der kreative Rausch setzte ein, ich kam kaum damit nach, den Film, der im Kopf ablief, aufzuschreiben. Das Tor war aufgestoßen …
Das Tor bietet makabre, manchmal unheimliche Geschichten mit Twist, also die abgründigen Dinge, die Sie schon von mir gewohnt sind. Die Themen sind vielfältig, wie in Reiche Ernte komme ich nicht an den Nazis vorbei. Warum ich mich diesen Unmenschen immer wieder widme, noch dazu in pulpiger Was-wäre-wenn-Form? Ganz einfach: Die Nazis sind die schlimmsten aller Bösewichte – und gleichzeitig die perfekten Bösewichte für Buch und Film. Fragen Sie Indiana Jones.
Neu an Das Tor ist auch, dass ich Gedichte untergebracht habe. Ich bin kein professioneller Lyriker und werde voraussichtlich nie einer sein. Die vorliegenden Gedichte, von Poe und Lovecraft inspiriert, entstanden spontan an einem einzigen Abend, als ich auf einmal Gedanken und Bilder im Kopf hatte, die nach der Gedichtform verlangten. Ich schrieb sie nieder, überarbeitete sie mehrmals, las sie immer wieder. Sie gefielen mir sehr gut, aber was tun damit? Dann erinnerte ich mich daran, dass Stephen King in seinen früheren Kurzgeschichtenbänden hie und da Gedichte zwischen seine Geschichten geschmuggelt hat, und was der darf, darf ich auch, dachte ich. Das war natürlich eine anmaßende Überlegung, denn King ist der King und spielt in einer gänzlich anderen Liga – oder besser noch Sphäre – als ich. Mein Verleger hatte jedenfalls nichts dagegen, und so haben die Gedichte ihren Platz im Tor gefunden.
Wer oder was tummelt sich noch im Buch? Gott bzw. der Glaube, Dämonen, Geister, Serienkiller … finsteres Zeug, aber es bereitet mir immer wieder Vergnügen, solche Storys zu schreiben, und ich hoffe, es bereitet Ihnen ebenso großes Vergnügen, sie zu lesen.
Um die Tradition meiner Drohungen zu kultivieren, darf ich Ihnen auch an dieser Stelle versichern: Ich komme wieder!
Matthias Bauer
Das Tor
„Seit dem Schwarzen September ist das Land nicht mehr das gleiche. Wir sind nicht mehr die Gleichen.“ Der alte Mann stampfte mit seinem Stock auf. „Es hätte nie geschehen dürfen!“ Nach diesen Worten rückte er das rot-weiß karierte Kopftuch zurecht, strich sein abgetragenes, bodenlanges Gewand glatt und lehnte sich zurück. Für einen Augenblick herrschte Stille; dann begann der Alte mit den Fingern der linken Hand unruhig auf den Esstisch zu trommeln, der aus grobem Eichenholz gefertigt war.
Die neunjährige Saida tauchte den Löffel in die Schale mit dem Obstsalat, der vor ihr auf dem Tisch stand, und aß eine kleine Portion. Anders als ihr traditionsbewusster Großvater trug Saida Jeans und ein T-Shirt.
„Es hätte nie geschehen dürfen“, wiederholte der alte Mann.
Wenn er nur endlich aufhören würde, dachte Saida. Sie strich sich die dünnen, fettigen Haare aus dem Gesicht und begann schneller zu essen.
Saidas Mutter Genna, die die Kichererbsen für den Hummus pürierte, musterte ihren Schwiegervater unwillig. „Bitte, Vater. Lass es gut sein.“ Sie hielt kurz inne, wischte sich den Schweiß von der Stirn, dann fuhr sie mit ihrer Tätigkeit fort.
Saida beobachtete ihre Mutter, deren Bewegungen so traumwandlerisch sicher wirkten. Genna hatte wie immer ein einfaches schwarzes Kleid an. Das dunkle Haar war zurückgekämmt, der Silberreifen an ihrem rechten Arm schimmerte im Zwielicht, das in dem alten Ziegelhaus herrschte. In Momenten wie diesen sah Saidas Mutter wie eine Magierin aus, wie aus dem Märchenbuch, welches das Mädchen so liebte.
„Du wirst mir nicht sagen, was ich zu tun habe.“ Das von Sonne und Sorgen zerfurchte Gesicht des alten Mannes verzog sich in tausend Runzeln, seine schwarzen Knopfaugen funkelten. „Ihr Kinder habt ja keine Ahnung, was wir durchmachen mussten.“
Der einst kunstvoll geknüpfte, nun aber abgewetzte Makramee-Vorhang, der den Wohnraum vom Eingang abgrenzte, wurde zur Seite geschoben, und Saidas ältere Schwester Rana betrat den Raum. Wieder einmal wurde Saida schmerzhaft bewusst, wie passend der Name ihrer Schwester war. Rana glich wahrlich einer Blume, lieblich und schön, das Haar glänzend schwarz, die Augen braun und samtig, der Körper schlank und doch fraulich. Sie war erst zwölf Jahre alt und konnte bereits alle Jungen des Dorfes nach ihrer Pfeife tanzen lassen, wenn ihr danach war.
Rana trug wie ihre Schwester Jeans und T-Shirt, aber an ihr sah es so elegant aus, dass Saida sich wie ein Sack Kartoffeln vorkam. Dieses Gefühl hatte sie immer in Gegenwart ihrer Schwester, und niemand in der Familie hielt es für wert, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Nein, es hieß meistens nur: „Saida, mach schneller. Bemüh dich. Warum kannst du nicht mehr wie Rana sein?“
Die Worte taten Saida weh. Bedeutete ihr Name nicht Die Glückliche, weil sich bei ihrer Geburt die Nabelschnur um ihren Hals gewickelt hatte und sie nur ganz knapp dem Erstickungstod entronnen war? Aber ihr Dasein hatte nichts mit Glück zu tun. Saida liebte ihre Familie aufrichtig und wollte sich aus ganzem Herzen nützlich machen, aber irgendwie gelang es ihr nicht. Irgendwie machte sie immer alles falsch, ob bei der Hausarbeit oder in der Schule. Die bitteren Tränen, die sie darüber in zahllosen Nächten vergoss, blieben unbeachtet, sogar von ihrer Mutter.
„Na, Großvater? Erzählst du wieder von früher, von der großen Zeit?“ Rana zwinkerte dem alten Mann keck zu.
Dieser lächelte versonnen. „Rana, meine Schöne. Komm her und leiste mir Gesellschaft.“
„Schluss jetzt mit den alten Geschichten. Es gab keine große Zeit, nur sinnloses Sterben. Das müsstest du doch am besten wissen, Vater.“ Gennas Ton war scharf geworden.
Saida wusste, worauf ihre Mutter anspielte. Jordanien hatte im sogenannten Schwarzen September im Jahr 1970 die PLO – die Palästinensische Freiheitsorganisation, die gegen Israel kämpfte – aus dem Land geworfen, und für Genna war das auch gut so. Sie war damals noch nicht geboren gewesen, aber ihrer Ansicht nach war die PLO nichts anderes als eine Terrororganisation, die am Gleichen gescheitert war wie alle vor und nach ihr: an Israel. Gegen Israel kam man mit Gewalt nicht an, also musste man sich arrangieren. Und keine Bombe würde daran je etwas ändern, ob sie wie damals von der PLO oder heute von der Hamas gezündet wurde. Das war Gennas feste Überzeugung.
Aber der Großvater konnte und würde das niemals akzeptieren. Seine erste Frau war im Sechs-Tage-Krieg gestorben – dem Schmachkrieg, wie ihn der alte Mann immer noch nannte –, in dem die Israelis einen triumphalen Sieg gegen ihre arabischen Feinde gefeiert hatten. Dieser Krieg hatte den jungen Witwer wie so viele Männer seiner Generation zu einem glühenden PLO-Anhänger gemacht, wenn er auch nie in die Organisation eingetreten war. Er blieb weiterhin in der kleinen jordanischen Siedlung am Toten Meer und heiratete ein zweites Mal. Seine Frau schenkte ihm einen Sohn, starb aber bald nach der Geburt. Hasim, der Sohn, entwickelte sich zu einem freundlichen, verantwortungsbewussten Mann, frei von dem Hass, wie ihn sein Vater predigte. Er nahm Genna zur Frau, baute ein Haus und holte den Vater zu sich. Seine zwei Töchter Rana und Saida waren sein ganzer Stolz.
Eines Tages weilte Hasim in der Stadt Arad, als eine Bombe der Hamas am Marktplatz explodierte. Sie riss unzählige Menschen in den Tod, darunter auch Hasim. Die Polizei überbrachte seiner Familie die wenigen Habseligkeiten, die er bei sich gehabt hatte. Darunter war auch ein Silberarmband mit der Gravur Für immer und ewig. Die Polizei berichtete der Familie, dass Hasim gerade aus einem kleinen Schmuckgeschäft gekommen war, als die Bombe hochging. Genna begann zu weinen, denn sie wusste, dass Hasim das Geschenk für sie gekauft hatte, anlässlich ihres fünfzehnten Hochzeitstages. Sie streifte das Armband über und beschloss es als Andenken zu tragen, für immer und ewig.
Hasims Vater bastelte sich wie gewohnt sein eigenes Weltbild zurecht: Auch am Tod seines Sohnes waren die Israelis schuld. Wenn sie nicht im Nahen Osten wären, müsste die Hamas keine Bomben zünden. Genna, in Trauer, sagte nichts. Aber dann, als der alte Mann nicht aufhörte, konnte sie sich nicht mehr zurückhalten. Und seitdem beherrschte Streit das kleine Ziegelhaus am Toten Meer.
So auch heute.
Saida lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und musterte ihre Familie.
„Wegen deiner verdammten Hamas ist Hasim tot!“ Das Gesicht der Mutter, rot vor Wut.
„Du hast doch keine Ahnung, Weib.“ Das Gesicht des Großvaters, eine Mischung aus Trotz und Herablassung.
„Ich glaube, dass Tarik mich mag.“ Das Gesicht der Schwester, kokett und gedankenlos.
Saida blickte von einem zum anderen. Die Gesichter verschwammen, die Stimmen verschwammen, und auf einmal hielt sie es nicht mehr aus. Sie stand auf und schlüpfte aus dem Haus, ohne dass einer der anderen es bemerkte.
Tausende Kilometer entfernt drückte Professor Philippe Cavé auf eine Taste seines Laptops und beendete damit die Vorlesung. Das Bild auf der großen Leinwand des Hörsaals fror ein. Es zeigte den Eingang zur Hölle, über dem schmiedeeiserne Worte hingen.
Arbeit macht frei.
Wieder einmal schüttelte Cavé angesichts von so viel Bösartigkeit und Zynismus innerlich den Kopf, dann trat er vom Pult zurück. Er nahm seine elegante Brille ab, strich sich mit der rechten Hand über sein maßgeschneidertes Sakko und wandte sich seinem Publikum zu.
Der Hörsaal war bis auf den letzten Platz besetzt. In einem zweiten, kleineren Saal, der nebenan lag, verfolgten weitere Studenten die Vorlesung über mehrere Bildschirme. Dies war nicht weiter verwunderlich, zählte Philippe Cavé doch zu den beliebtesten Professoren der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jung, attraktiv und selbstbewusst, verfügte Cavé neben einem messerscharfen Verstand über etwas, das den meisten Akademikern abging – Humor. Dass dieser von der schwärzeren Sorte war, störte keinen der Studenten, im Gegenteil: Was wollte man von einem Historiker erwarten, der sich auf eines der schwärzesten Kapitel der Menschheit spezialisiert hatte? Ohne Humor, diese ultimative Waffe gegen das Grauen, würde man unweigerlich durchdrehen, so der allgemeine Tenor.
Cavé blickte ins Publikum. „Fragen?“
Hände schossen in die Höhe.
„Sie sagten vorhin, dass wir trotz allem Elend viel Glück gehabt haben. Ist das wirklich Ihr Ernst?“ Die Frage stammte von einer attraktiven Blondine, die Cavé seit Semesterbeginn immer wieder auffiel. „Nach all dem, was Sie uns heute über Auschwitz erzählt haben?“ Ein gepflegter Finger deutete auf die Leinwand.
„Interessanter Punkt.“ Cavé strich sich eine widerspenstige Locke aus der Stirn. In letzter Zeit hatten sich erste graue Strähnen in sein dichtes, schwarzes Haar gemischt, aber er war deswegen nicht beunruhigt. Alle Damen im Umkreis betonten, dass es ihn noch attraktiver machte. „Ich glaube nicht unbedingt an das Gute im Menschen, dazu geschieht auf diesem Planeten seit der Ursuppe zu viel Schlechtes, ob auf Schlachtfeldern oder im Schoß der Familie. Aber ich glaube durchaus, auch wenn das für einen Wissenschaftler seltsam klingen mag, an das Glück. Damit meine ich natürlich nicht kleindimensioniertes Glück, wie zum Beispiel das Ihre, schon im ersten Studienabschnitt meine Vorlesungen genießen zu dürfen.“
Die Studenten lachten.
„Mesdames et Messieurs, ich rede vom Glück in großen, historischen Dimensionen. Rufen Sie sich Hitler, Stalin und die anderen Vernichter ins Gedächtnis. Wie oft stand die Menschheit schon vor dem Abgrund und wie oft hat die Menschheit die Kurve gekriegt?“
„Immer. Aber nur unter immensen Opferzahlen.“ Die Blondine ließ nicht locker. Cavé beschloss herauszufinden, ob sie im Bett auch nicht lockerließ. Oder war es besser, wenn er sich zurückhielt? Dekan Encausse hatte ihn schon einmal zur Rede gestellt, aber ein Auge zugedrückt. Das jedoch nur, weil Encausse und Cavés Vater zusammen in der Armee gedient hatten. Andererseits …
„Das ist richtig.“ Cavé nickte. „Die Opfer waren unvorstellbar. Doch sage ich hier und jetzt, dass kein noch so großes Opfer an Mensch und Material ausgereicht hätte, um zum Beispiel Adolf Hitler zu besiegen.“ Er machte eine wirkungsvolle Pause. „Es gab nur eines, das Hitler besiegt hat. Wissen Sie, was ich meine?“
Stille.
„Es war –“, wieder eine Pause, „Hitler selbst.“
Immer noch Stille.
„Es war seine Dummheit, die ihn besiegt hat“, fuhr der Professor fort. „Dummheit oder ideologisch motivierte Kurzsichtigkeit, wie immer Sie es nennen wollen. Sie war unser aller Glück. Ohne sie hätten weder die Engländer, Amerikaner oder Russen Hitler aufhalten können.“
„Eine gewagte These. Und respektlos gegenüber all denen, die gegen die Nazis gekämpft haben.“ Eine andere Studentin, kühl und dunkelhaarig, mit misstrauischem Gesichtsausdruck.
„Finden Sie?“ Cavé zog eine Augenbraue in die Höhe. „Ich will in keinem Fall die Verdienste derer schmälern, die gegen Hitler in den Krieg gezogen sind. Aber gewonnen haben sie nicht wegen Mut, Tapferkeit, überlegener Ressourcen, was auch immer. Gewonnen haben sie wegen der Beschränktheit eines Mannes, der einer fanatischen Ideologie anhing und diese um jeden Preis durchsetzen wollte.“
Der Professor begann langsam auf und ab zu gehen. „Ich bin Adolf Hitler. Ich habe mich zum Führer Deutschlands aufgeschwungen, die Bevölkerung liegt mir zu Füßen. Mein ultimatives Ziel ist es, Krieg zu führen und die Welt zu unterjochen. Dazu brauche ich alle Ressourcen, die mein Land mir bieten kann. Was mache ich also? Nutze ich diese Ressourcen? O nein! Ich gehe unverzüglich daran, alle auszurotten, die auch nur im Kleinsten anders denken als ich und meine Mitstreiter. Vor allem hasse ich die Juden, ein Volk, das in meinem Land an sich wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, brillante Köpfe in seinen Reihen hat und sich durch großen Patriotismus auszeichnet – denn noch im Ersten Weltkrieg haben deutsche Juden tapfer an der Seite des Vaterlandes gekämpft. Trotzdem merze ich sie und alle anderen aus, die nicht in mein Weltbild passen, und beraube mich damit tapferer Soldaten, kluger Wissenschaftler und reicher Wirtschaftsbosse. Ich beraube mich also eminent wichtiger Ressourcen, die ich für meine Eroberungspläne brauchen würde. Doch ist das für mich wichtig? Nein, denn meine Ideologie ist mir wichtiger.“ Cavé blieb stehen. „Und so verfahre ich in jedem Gebiet, das ich nach Kriegsausbruch erobere. Ich marschiere zum Beispiel in der Sowjetunion ein, einem Land, dessen Bevölkerung mich nach Stalins jahrelangem mörderischen Terror als Befreier begrüßt. Nutze ich das aus? Natürlich nicht. Die Russen sind für mich Untermenschen, egal ob Soldaten oder Zivilbevölkerung, also rotte ich Millionen von ihnen aus und verschenke damit ein riesiges Reservoir an Helfern. Und züchte mir zudem eine Partisanenbewegung heran, die meine eigene Armee aufs Heftigste bekämpft.“
Der Professor zog seine Brille aus der Brusttasche und deutete damit zu der dunkelhaarigen Studentin. „Aber damit nicht genug: Ich baue zudem eine Maschinerie aus Konzentrations- und Vernichtungslagern für den Holocaust auf. Der Holocaust bindet unglaubliche Mengen an Mann und Material, die mir buchstäblich an allen Fronten fehlen. Und was geschieht? Ich verliere den Krieg.“
Stille.
Cavé hob die Hände. „Meine Damen und Herren, seien wir froh, dass das Böse, wie ich es hier an dieser Stelle auch als Historiker so plakativ nennen will, dumm und beschränkt ist. Würde es logischer denken, dann wäre die Welt eine andere.“
„Sie sind sehr zynisch, Monsieur le Professeur. Das klingt fast, als würden Sie begrüßen, dass der Holocaust stattgefunden hat.“ Die Augen des rothaarigen Studenten in der ersten Reihe waren bohrend und humorlos. Aufgepasst, Cavé, dachte der Professor, sonst erntest du einen Schmähartikel in der Universitäts-Zeitung.
„Das erzählen Sie am besten meinen Urgroßeltern“, entgegnete er ruhig. „Sie wurden nicht weit von hier von der Waffen-SS ermordet. Und insgesamt sechzehn meiner Familienmitglieder starben in Auschwitz.“
Der bohrende Blick senkte sich nicht. „Beantworten Sie bitte meine Frage.“
„Ich begrüße natürlich nicht, dass der Holocaust stattgefunden hat. Für mich sind Hitler und seine Schergen die schlimmsten in einer langen Galerie menschlicher Übeltäter. Alles an ihnen, die Ideologie und vor allem die penible, technikunterstützte Konsequenz, mit der sie diese Ideologie verfolgt haben, hebt sie über Schlächter wie Stalin und Mao hinaus.“ Cavé hielt inne. „Aber wenn es schon zu Diktaturen wie Nazi-Deutschland kommt, dann ist mir an der Spitze ein Charakter wie Hitler, der aufgrund seines Weltbildes den Keim seines Untergangs von Beginn an in sich trägt, lieber, und ich bitte Sie dieses lieber in meterhohen Anführungszeichen zu sehen. Stellen Sie sich einen rationalen Diktator Hitler vor, der Juden und andere Minderheiten nicht tötet oder vertreibt, der alle verfügbaren Ressourcen nutzt, in Deutschland und in jedem Land, das er erobert. Die Nazis hätten dann vor allen anderen Nationen Atombomben und Düsenjäger entwickelt, und dann würden Sie heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Wenn doch, würden Sie eine schwarze Uniform tragen. Und kein Amerika, kein England hätten daran etwas ändern können.“