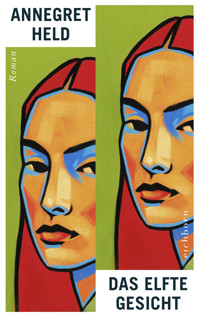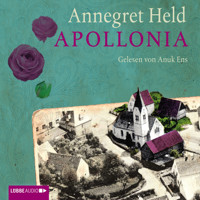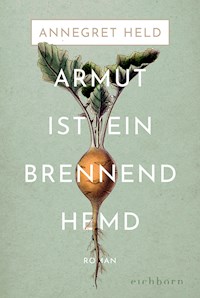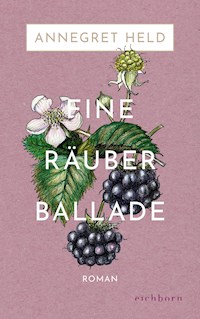9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 80er-Jahre in der zutiefst katholischen deutschen Provinz: Die junge Anna, Streifenpolizistin in Darmstadt, wird für das großartige Feuerwehrjubiläum in ihrem geliebten Dorf als Festdame auserkoren. Dort fällt ihr der fesche evangelische Pfarrer des Nachbarorts ins Auge ("eine Mischung aus Neuem Testament und Testosteron"), und Anna ist sofort hin und weg. So nimmt das Grundverkehrte seinen Lauf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Die 80er-Jahre in der zutiefst katholischen deutschen Provinz: Die junge Anna, Streifenpolizistin in Darmstadt, wird für das großartige Feuerwehrjubiläum in ihrem geliebten Dorf als Festdame auserkoren. Dort fällt ihr der fesche evangelische Pfarrer des Nachbarorts ins Auge (»eine Mischung aus Neuem Testament und Testosteron«), und Anna ist sofort hin und weg. So nimmt das Grundverkehrte seinen Lauf …
Über die Autorin
Annegret Held, 1962 im Westerwald geboren, arbeitete u.a. als Polizistin, Sekretärin, Altenpflegerin und Luftsicherheitsassistentin – und ist erfolgreiche Autorin. Sie bekam den Berliner Kunstpreis der Akademie und den Glaser-Förderpreis, ist PEN-Mitglied und lebt im Westerwald und in Frankfurt. Zuletzt erschien im Eichborn Verlag ihr Roman ARMUT IST EIN BRENNEND HEMD.
ANNEGRET HELD
DASVERKEHRTEUND DASRICHTIGE
ROMAN
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © Annegret Held 2022
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Doris Engelke, Frankfurt
Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia Di Stefano nach einem Konzept von network! unter Verwendung von Motiven von © Fotograzia / Getty Images, © View7 / photocase und © MrVitkin / shutterstock.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7188-8
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Meinem wunderbaren Kind
Es ist nun über dreißig Jahre her.
Alle sind froh, dass Gras darüber gewachsen ist.
Da komme ich daher und grabe es wieder aus. Ohne Not!
Es geht keinen was an. Es bricht ja nur aus mir heraus wie aus einem mit den Jahren morsch gewordenen Verschlag in meiner Seele. Trotzdem hätte ich das Gerümpel nicht beachten müssen.
Doch da hat ausgerechnet mein Kind mich danach gefragt. Für sie schreibe ich das alles auf. Herrgott noch mal.
Ja, der Herrgott hat auch mitgespielt. In dieser Geschichte hing er an jeder Wand, er und all die Erzengel oder auch ein niederer Engel. Manchmal glaubte ich sie zu sehen wie eine Erscheinung, aber vielleicht war es auch nur der Schnaps. Der Schnaps hat auch mitgespielt, wie immer, wenn es um Scholmerbach geht. In Scholmerbach hat es gespielt. Da auch.
Ich werde schon ganz übelst missgestimmt, wenn es um diesen alten Kram geht. Es war kein Ruhmesblatt in meinem Leben. Und was die Leute sagen, wenn ich ankomme mit dem alten Mist. Aber die Geschichte bricht aus dem Verschlag und will heraus mit aller Gewalt. Es gibt nur wieder Zirkus. Aber mir ist auch bald alles wurschtegal.
Schloss Helga: »Und da habe ich mir geschworen: Ab fünfzig geht mir alles am A… vorbei.«
An Schloss Helga kann man sich ein Beispiel nehmen, denn sie kannte das Leben, sie war Feuerwehrfrau und stand an der Kirmes immer in der Wurstbude. Die Feuerwehr hat auch mitgespielt, ja, die auch.
Meine Mutter hat nicht mitgespielt. Sie wollte damit nichts zu tun haben, aber auch gar nichts. Denn sie ist sehr katholisch. Dabei hat die katholische Kirche auch mitgespielt. Die Orgel. Sie spielte unendlich schön in meiner Geschichte. Mit Theodora an den Tasten. Wir sangen immer: »Oh du Himmelskönigin«, und unsere Himmelskönigin war Theodora auf ihrem mächtigen Thronsessel unter den gewaltigen Orgelpfeifen, die das Kirchenschiff mit Klängen erfüllte, die waren nicht von dieser Welt. Theodora hat gewaltig mitgespielt; aus ihren Händen quollen Gesänge, sie umtönten und umdröhnten die Erinnerung mit Herrlichkeit, in allen Kirchenliedern sangen sie von der Herrlichkeit. Eigentlich … eigentlich war die Geschichte auch herrlich, ich hatte es bloß vergessen.
Es ist wirklich lange her.
Wir schrieben das Jahr 1987.
Ich war Polizeibeamtin des Landes Hessen, und ich hatte eine Mütze und einen Schlagstock und eine Handfeuerwaffe mit 9 mm, die genug Durchschlagskraft hatte, um einem flüchtenden Fahrzeug den Reifen zu durchschießen. Ich trug ein senfgelbes Hemd und einen grünen Schlips und Handschellen und ein Ersatzmagazin und mein Reizstoffsprühgerät und eine ABC-Schutzmaske.
Ich war fünfundzwanzig Jahre alt.
Jede Nacht fuhr ich mit meinem Kollegen durch das verbrecherische Darmstadt und nahm Schläger in der Stadtschenke fest oder besoffene Huren vom Straßenstrich, sammelte aus dem Seniorenheim entlaufene Alte wieder auf oder warf mich zwischen prügelnde Ehepaare oder sortierte tonnenweise Blechmüll von den Straßen. Eigentlich hatte ich immer in Frankfurt Streife fahren wollen, mein Herz schrie nach Frankfurt, aber ich war nun mal in Darmstadt gelandet, und das war Schicksal und das musste ich nun aushalten. Immerhin hatte Darmstadt einen großen Puff Richtung Pfungstadt, und den durfte ich mehrere Male durchsuchen. Ich liebte es, überall hinzugeraten, wo ein normaler Mensch nicht hindurfte, und ich konnte nicht genug davon kriegen, meine Nase in Verderben, Sünde und Verbrechen zu stecken.
Die Sünde roch nach Lukiluft und abgestandenem Sekt und mit Fell bedeckten Freierbetten, sie roch nach Zigaretten und Schnaps und Sperma und Parfüm und manchmal auch nach Blut.
Die langen Nächte fallen mir ein, die Schlaflosigkeit, die trüben Tage mit Knochenschmerzen wie verkaterte Tage ohne Suff, die Qual in den Klamotten. Der steife Polizeikragen mit dem würgenden grünen Schlips, die doppelseitig gestrickte gemütliche Polizeijacke; ich erinnere mich an Kartoffelpufferbraten in der Nachtschicht mit der dicken Knarre an der Seite, die schwer war und immer drückte. Das Fiepen des Funkgerätes und der ewig quasselnde Funk in der Ferne.
Ich war noch von allem zu beeindrucken. Schläger und Messerstecher. Frisch verprügelte Frauen. Erbrechende Jungs auf den Revieren. Alles machte mir Eindruck.
Alles schrieb ich nieder. Ich kam nicht nach mit Schreiben.
In meiner Beamtenbude im Reihenhaus von Eberstadt hatte ich einen wackeligen Tisch in einer kleinen Küche mit Efeuranken ums hohe Fenster. Dort breitete ich meine Tagebücher und Notizblätter aus, und was auf der Polizeidienststelle nur ein kleiner dürrer Eintrag mit Stempel im Tätigkeitsbuch war, wurde in meinen Spiralheften zu atemberaubenden Geschichten von Leidenschaft, Lust und Verbrechen. Ich wäre vielleicht noch ewig Streife gefahren, noch ewig.
Wäre da nicht der vermaledeite Funk gewesen, dieser schreckliche Funk, der mir das Leben schwer machte.
Es war vielmehr eine einzige männliche Stimme unter den vielen, die durch den Äther drangen, um Fahrraddiebstähle zu überprüfen oder eine Trunkenheitsfahrt, sie drangen von irgendwoher in den kleinen Innenraum meines Streifenwagens, und nur die eine Stimme trennte die schnöde, verderbte, darmstädtische Nacht von der grenzenlosen Süße des Universums. Diese Stimme war überirdisch, besonnen, dunkel, und ich liebte sie so sehr, dass ich Verbrecher laufen und verzankte Huren am Wegrand stehen ließ. Wenn SEINE Stimme erklang, wurde ich in den Grundfesten meiner Seele erschüttert, alles klirrte in mir wie altes Geschirr in der Vitrine, meine Hände sanken und meine Schultern sanken und mein Herz sank, während die Stimme des Universums ein Kennzeichen durchgab oder einen Namen buchstabierte: Konrad Otto Siegfried Ludwig Otto Wilhelm Siegfried Konrad Ida: Koslowski, geboren am 28.07.1948 in Schwanemünde. – Negativ.
Wenn er die Fahndung durchgab nach einem gelben Audi, fand ich niemals einen Audi, sondern gab ihm einen grünen Mercedes durch; die wunderbarste Stimme der Welt ließ mich schwermütig werden und arbeitsunfähig. Einst hatte die Stimme mir Liebesworte ins Ohr geflüstert und mich Ännchen genannt, einst waren wir gemeinsam Streife gefahren, und bei jedem Kuss hatten die Anhaltekelle gestört und das Funkgerät und die Schreibkladde, die Knarren und die Handschellen und der Sicherheitsgurt und die Handbremse, alles und alles war im Weg gewesen, wenn unsere glühenden Herzen zueinander drangen, und besonders seine Frau.
Ich musste ihn vergessen. Ich konnte ihn nicht vergessen. Er hörte nie auf, Kennzeichen durchzugeben, und die Kennzeichen aus dem Sternenhimmel drangen in mein Herz und das Herz sank, bis es stillstand, und auf jeder Streifenfahrt starb ich hundertmal.
Heinz war meine große Liebe und würde es immer sein.
Ich konnte keine Streife mehr fahren, es ging nicht mehr; sollten doch die Huren alleine über den Straßenstrich stolpern, sollten sich doch alle Autos zu Schrott fahren, sollten die Eheleute von Darmstadt sich den Schädel einschlagen … ich konnte ihnen nicht mehr helfen, solange die Stimme des Universums mich halb umbrachte im einsamen Dunkel des nachtschwarzen Darmstadt, nur ab und zu erhellt von dem blinkenden Blaulicht auf unserem Dach.
Wenn ich das Verbrechen von Darmstadt nicht mehr ertragen konnte, wenn ich der allgegenwärtigen Stimme aus dem Orbit entfliehen wollte, dann musste ich heim in mein Dorf.
Ich ließ die Uniform und alles, was ich nicht so besonders liebte, in der verqualmten Beamtenbude, warf meine Reisetasche in meinen orangen R4 mit Hakelschaltung und fuhr die hundertdreizehn Kilometer erst über die Autobahn und dann über endlose Landstraßen hügelab, hügelauf durch Weizenfelder und Mais und Wiesen und leuchtend gelben Raps, hier ein Dorf und da ein Dorf. Ich brauchte jeden Meter, um immer mehr und mehr von mir zurückzulassen, das mir krank und unglücklich erschien, und jeder Birnbaum am Wegrand ließ mich glücklicher werden, bis ich endlich Scholmerbach im Tal liegen sah.
Das Dorf, in dem ich geboren bin, wurde geschützt von einem hohen Buchenwald, der es ein wenig zu umarmen schien, dann öffnete sich das Tal mit Wiesen und vielerlei Büschen, einem Schafspferch, und dann lag da Scholmerbach der See. Von den Hügeln herabzufahren war wie ein Rausch, jedes Mal ging meine Seele auf, bei jedem alten Haus, jedem Birnbaum, jedem Huhn, das ich in einem Garten sah, dem Metzger, der Bushaltestelle, dem tröpfelnden Brunnen mit seinem rostigen Hahn, beim Kappesgarten und der Schneidmühle, wo die Zimmerleute mit nacktem Oberkörper sägten und hämmerten.
Dann war ich wieder daheim. Einmal Scholmerbach. Immer Scholmerbach. Die Nächte in Darmstadt waren kahl und kalt und voller Verzweifelter, die Nächte in Scholmerbach waren warm und voller Sterne und liebevoll durchsoffen.
Ich war sehr, sehr gerne betrunken.
Ich fuhr also nach Hause zu meinen Eltern und den Geschwistern, die dort noch lebten, und wir aßen Brot mit Quark und Marmelade oder Zwetschgenkraut oder Käse und Gewürzgurken und tranken Kaffee oder Bouillon.
Meine Mutter war gemütlich, sie warf einfach Brettchen auf den Tisch und der Käse war noch im Pergament eingewickelt, wir hatten keinerlei überflüssige Dekorationen, die Wurst kam vom Metzgersch Freddi aus dem Dorf und das Brot vom freundlichen Nanni aus der Bäckerei. Ich fand das großartig, und ich hätte keinerlei gehäkelte Serviettenringe oder farblich abgestimmtes Service gewollt. Unsere Tassen waren von allen Sorten, mal mit verblassenden Rosen und mal mit einem Snoopy bemalt oder mit roten und grünen Karos.
Wir waren auch nicht besonders angezogen, irgendein Pulli mit irgendeiner Strickjacke, und die Jeans durften meine Mutter nicht drücken. Die Haare hingen mal so oder mal so um den Kopf, auch das war nicht besonders wichtig, außer man ging raus oder in die Kirche.
In Scholmerbach gab es auch Verbrechen, aber sie waren wie Gute-Nacht-Geschichten, so niedlich, so ganz ohne Schrecken, sie passten zum Quark und zum Käse im zerknüllten Papier. Meine Mutter erzählte sie genüsslich. Die beim Otto-Versand hochverschuldete Marlene brauchte dringend Geld und wollte Prospekte austragen vom Kaufhaus Schwinn, dem Toom Baumarkt und Möbel Franz gleichzeitig. Aber als die Pakete kamen, waren es so viele, da ist sie einfach mitten in der Nacht mit dem Auto zum Silbersee gefahren und hat mithilfe von Tante Marga die Pakete dort versenkt.
Die vom Geiz befallene Hennegickels Berta war gesehen worden, wie sie nachts um vier heimlich aus dem Haus schlich, um in anderen Gärten Erbsen zu stehlen und sich damit Suppe zu kochen. Die alte Mehlbachs Minna hat schon wieder einen Mann durch eine Zeitungsanzeige angelockt, und man hat sie im schwarzen Korsett auf dem Balkon stehen sehen! Mit siebzig Jahren!
Ich bin niemals heimgekommen, ohne mit neuen Geschichten belohnt zu werden. Das ganze Jahr hindurch rauschte und brummte es. Mein Dorf war wie ein Kirmeskarussell, mit scheppernden, bunten Wagen, und ich musste immer, immer heim. Wo die Dornschlehen blühten und die Brennnesseln brannten, wo der Kappesgarten leuchtete und die Sägen vom Zimmerplatz durch den Himmel dröhnten, da vergaß ich alles Böse dieser Welt und sogar die Stimme aus dem Universum, die im fernen Darmstadt unaufhörlich sinnlosen Buchstabensalat durch den Äther funkte.
An irgendeinem Abend im Juli 1987 ging ich in meinem Dorf Scholmerbach zu Honiels an die Theke, wo Fußballerbilder und Pokale hingen und Vereinssparfächer und Stammtischglocken auf dem Tresen standen und Aschenbecher und Schnapsgläser. Man brauchte sich nicht groß zu verabreden, irgendeiner war immer da, einer von der Feuerwehr oder eine von den Fleischwurstweibern oder von den Schlümpfen oder vom Karnevalsclub.
Anja hinter der Theke war frisch verheiratet mit dem Wirt und räumte aufgekratzt überschäumende Biergläser hin und her, während ihre glänzenden, schwarzen Locken wippten.
Sie war die Einzige, die echte Locken hatte; ich selbst hatte einen Stufenschnitt mit Dauerwelle, und Petra vom Musikverein hatte auch einen Stufenschnitt und Dauerwelle, und dann kamen meine Freundinnen Silvia, Biggi und Ria, und auch sie hatten einen Stufenschnitt mit Dauerwelle. Die Fußballer in der Ecke trugen Minipli und sahen alle aus wie Rudi Völler. Es gab damals keine lockenlosen Menschen in Deutschland.
In der einen Ecke der Theke sprachen sie über den Ausflug vom Kolpingverein, und in der anderen sprachen sie über den neuen evangelischen Pfarrer von Linnen und was er für ein feiner Kerl sei und wie besonders, da käme ja unser katholischer vorne und hinten nicht mit. Und dann sprachen alle vom bevorstehenden Festumzug anlässlich der Fünfzig-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Scholmerbach und den fünfundzwanzig Jahren des Musikvereins Scholmerbach.
Ria, Biggi und Silvia prosteten uns zu. Wir waren leidenschaftliche Thekenpflanzen und schwankten und blühten auf, wenn der Bierstrom golden ins Glas sprudelte, Prost war unser Lieblingswort.
Da schälte sich mein Schicksal aus dem Dunst der Rothändle-Wolken in Form des betrunkenen Schloss Egon, untermalt von der Musikbox, die sang: »Die rote Sonne von Barbados« von den Flippers. Egon war bei der Feuerwehr, und auch er hatte sich von seiner Tochter Gritt Dauerwellen machen lassen müssen, daheim in der Küche. Sie war Friseuse. Sie war verantwortlich für all die Rudi Völlers in unserem Dorf und für jeden Vokuhila, mit dem die Männer von Rot-Weiß-Scholmerbach am Sonntag auf dem Fußballplatz herumliefen.
»Wir haben fünfzig Jahre Freiwillige Feuerwehr Scholmerbach!«
Er sagte es mit solch einem Stolz, dass der heilige Florian förmlich in der Wirtschaft stand, mit Lanze, Banner und Eimer. Die Löckchen lagen wie ein ziselierter, dunkler Heiligenschein um seinen Kopf, aber Egon war kein Heiliger, er hatte vor lauter Bier und Gelächter schon einen ganz roten Kopf, und seine Augen glänzten vor schierem Vergnügen an allem, was er sah; wir liebten Egon auch.
»Da machen wir einen Parademarsch!«
Einen Parademarsch.
»Und ihr sollt vorneweg gehen! Als Ehrenjungfern!«
»In unserem Dorf gibt es die schönsten Mädchen, die schönsten Mädchen weit und breit!«, fiel der Sheriff ein, mit seinen silberweißen Haaren, Sheriff-Haaren, wie aus Bonanza. Er war unser Bürgermeister, und er spendierte uns gleich eine Runde Apfelkorn. Bloß Biggi wollte immer einen Batida de Côco.
»Ehrenjungfern! Was?«
Wir lachten schallend.
Die Siebzigerjahre waren vorbei, und die sexuelle Befreiung hatte auch vor unserem Dorf nicht haltgemacht. Wir hatten sogar einen Beatschuppen und eine Dorfdisco, wo wir uns trafen, um Lady Bump zu tanzen. Wir fühlten uns im Großen und Ganzen noch anständig, aber uns Ehrenjungfern zu nennen – das ging einfach nicht.
»Na ja«, meinte Egon. Er wollte uns nicht zu nahe treten.
»Festdamen«, sagte der Sheriff. »Festdamen kann man das nennen.«
Auch darüber prusteten wir los.
»Hier die Weiber«, sagte Egon, »die Weiber können euch allen ein Gewand nähen. Hauptsache, ihr seid schön!«
»Unsere Mädchen sind die schönsten von allen Dörfern ringsumher«, sagte der Sheriff. In der Ecke saßen die Frauen, die sowohl zu den Schlümpfen gehörten, weil sie mal an Fasching als Schlümpfe auf »Vater Abraham« getanzt hatten, als auch zu den Fleischwurstweibern, die sich immer donnerstags trafen, wenn es beim Metzger frische Fleischwurst gab, die sie noch warm aßen mit einem Doppelkorn dazu. Im Dorf ging es vor allem um viel Spaß. Spaß zu machen aus dem allerletzten Mist, das war die große Kunst meiner Heimat.
In Wahrheit war mir nicht lustig zumute, denn was ich in den Grüften meiner Seele verbarg, war meine zerbrochene Liebe zu Heinz, das heißt: Zerbrochen war sie nicht, aber doch zerrissen, vielleicht auch nur unterbrochen, wie eine schlechte Verbindung am Telefon.
»Na ja, egal, was soll’s« sagte ich mir und kippte den Apfelkorn vom Sheriff.
Die fünfzig freiwilligen Jahre der Feuerwehrleute schwebten durch den Honiels und verwoben sich auf seltsame Weise mit den fünfundzwanzig freiwilligen Jahren des Musikvereins Scholmerbach, der gleichfalls prächtig feiern wollte, und es hätte mich nicht gewundert, wenn auch die freiwilligen Fußballer und die Freiwilligen vom Karnevalsclub und der Liederkranz Harmonia einen Jahrestag zu feiern hätten. Auf jeden Fall wollten alle mitmachen bei dem großen Tag, die Schlümpfe und die Kirmesjugend und einfach alle.
»Wir haben einen Festausschuss«, sagte jetzt Kirschheim, der Feuerwehrhauptmann. »Der plant den ganzen Kommers.«
»Was heißt eigentlich Kommers in dem Zusammenhang?«, fragte Ria und wir prosteten.
»Weißt du«, sagte Silvie.»Von uns ist aber wirklich keine eine J…«
»Pscht«, warf Biggi ein.
»Zuerst kommt die große Parade«, sagte der Kirschheim. »Da kommen sie von überall her! Die Feuerwehren, die Musikvereine und ihr am Anfang.«
Die Pracht der Parade geisterte bereits durch die Wirtschaft und verströmte einen Glanz, den roten Glanz der Feuerwehrwagen und den goldenen von Posaunen und Trompeten; wir hörten schon die Marschmusik und sahen die Fackeln leuchten zum Zapfenstreich.
»Und ihr werdet als Festdamen den Zug anführen!«, sagte der Kirschey. »Sucht also bitte zwölf Mädchen zusammen. Oder acht oder zwölf oder fuffzehn. Lasst euch schöne, prachtvolle Kleider nähen, die könnt ihr selber aussuchen, Geld spielt keine Rolle!«
Es ist gut, wenn man manchmal nicht weiß, wohin alles führt.
Denn mich sollte der prächtige Festzug der Feuerwehren und Musikanten samt Pauken und Fanfaren geradewegs ins Verderben führen. Glorreich war die Parade und glorreich der Schlamassel, in den ich hocherhobenen Hauptes auf meinen hohen Hacken hineingestelzt bin.
Na ja, Verderben oder vielleicht auch mein Glück.
Ansichtssache.
Ja, und so hatte alles angefangen.
Ich hatte eine neue Aufgabe, und es war eine schöne Aufgabe für ein verwundetes Herz. Ich sollte also zwölf hübsche Mädchen finden, im Dorf gab es nur hübsche Mädchen, wir hatten frische Luft getrunken und frische Beeren aus den Wäldern gegessen, natürlich waren wir alle schön mit unseren unbeschreiblichen Locken. Die eine von uns hatte lange Beine und die andere kurze Beine, und eine hatte krumme Beine und eine andere dicke Beine. Dafür hatte sie schwarzes, glänzendes Haar, eine andere vielleicht schiefe Zähne, aber einen Gang wie eine Waldelfe, und eine hatte ein ordentliches Hinterteil, aber dafür schöne Augen, und eine duftete wie der Sommer und lispelte dafür. Was soll ich sagen, wir waren unglaublich schön, eine schöner als die andere … Honiels Ria, Bennos Maria, Dappersch Christina, Alfonsos Ingrid, Tankstellens Judith, Idas Monika, Deisse Friedericke, Kirschheims Susanne, Bongos Bärbel, Schmidtpauls Alexa, Boonesse Nikki, Zirfasse Carmen, Kolle Silvia, Schreinergerdas Biggi.
Es waren die Achtzigerjahre, und aus irgendeinem Grund fanden wir Gold schön, mit Schulterpolstern, es musste Gold sein zur Feier des Tages; mit goldenen Schultern wollten wir den Festzug anführen und an den Leuten vorüberziehen, dass ihnen die Augen übergingen, blenden wollten wir all die Scharen, die die Straßen säumten, sie sollten ins Schwärmen kommen an diesem herrlichen Sommertag im August.
Ich musste nur noch dreimal Streife fahren, und dann trafen wir uns zum Kleidernähen beim Becherfranz, dem Trompeter, einige Fleischwurstweiber waren auch da und auch zwei Schlümpfe. Ihre Männer waren wahlweise im Musikverein oder bei der Feuerwehr, und sie konnten alle gut nähen. Die Weiber hatten die Lippen voller Stecknadeln oder Zigaretten, und sie glänzten von Wacholder, und wir tranken auch Wacholder und mussten schrecklich lachen dabei; der Wacholder war ekelhaft, die Fleischwurstweiber einzigartig, schon rollten sie Bahnen um Bahnen, Ballen um Ballen goldglitzernden Stoff aus, wir waren so besessen davon, golden zu sein und schwarz, war es denn die Möglichkeit?
Doch war es ja nur mein Unglück um Heinz, meine große Liebe, dass ich mich umso heftiger in Gold und Glanz wickelte, die Haare nur umso höher toupierte, die Schulterpolster bis zum Halse zog, um nicht zu ertrinken in meinem Kummer. Vielleicht ist die einzige Antwort auf allen Liebeskummer dieser Welt ein Nachmittag mit Schlümpfen und Fleischwurstweibern oder ein Sommer in meinem Dorf. Ich glaubte, mein Dorf konnte alles heilen, einfach alles. Es war ein Wunder, dass die Kleider trotz unserer betrunkenen Anproberei schließlich saßen wie eine Eins, es waren Wunder-Gold-Wacholder-Kleider, die uns so schön machten, dass Hofmanns Monikas Mutter Ida anfing zu weinen, als sie Monika darin sah.
Ich ersoff in meinem Geheimnis.
Niemand durfte wissen, niemand, dass ich einen verheirateten Mann als Liebhaber hatte, der mich verlassen hatte für seine eigene Frau; ich wollte es nicht glauben. Ich dachte immer noch, er habe sich geirrt, da er mir doch offenbart hatte, was an ihr so langweilig war, die ewigen Dreiviertelhosen, so unattraktiv, die Leopardenmokassins, ganz allgemein war sie ihm gegenüber so verständnislos. Tatsächlich hatte er diesen Satz benutzt: »Meine Frau versteht mich nicht mehr.« Da wollte ich mich eigentlich gar nicht zu ihm hinreißen lassen. Wer so einen Satz sagt, verdient den Stoß von der Bettkante.
Dabei hatte es gewiss nicht an der Bettkante angefangen, sondern im Streifenwagen. Er war mein Praktikant gewesen. Der Kripo-Durchläufer auf der Schutzpolizeistation. Ich durfte nicht mehr dran denken. Schließlich war ich jetzt in Scholmerbach, um ihn zu vergessen.
»Prost«, sagte ich und trank noch einen Wacholder. Da kam mir wieder in den Sinn, wie ich mit Heinz nachts um vier Marmelade geholt hatte. Erdbeermarmelade von Scholmerbach. Auf dem Revier war keine mehr gewesen, und wir mussten immer was essen, wir hatten ständig Hunger. Da ist er einfach mitgekommen und in meine Wohnung hineingestiefelt, sah alle meine Bücher und das aufgeschlagene Notizbuch und die gemalten Bilder meiner Freunde.
»Oh«, sagte er. »Du machst dir viel Gedanken. Was liest du denn da? Tucholsky. Die Gesamtausgabe. Respekt.«
»Na ja«, sagte ich. »Ich habe immer Angst, dass man als Bulle verblöden könnte.«
»Du bist kein Bulle«, sagte Heinz andächtig. »Du bist eine Bullette. Eine Bullette, die zu Höherem geboren ist.«
Da war ich vermutlich schon verloren. Wieso musste ich hier bei den Fleischwurstweibern bloß daran denken? Wieso dachte ich an diesen Anfang mit Heinz, wo es doch jetzt zu Ende war? Nun lebte er wieder daheim bei seiner alten Schachtel. Pappschachtel. Ich war gemein. Die stumme Gemeinheit der Verlierer.
Am besten, ich trank noch einen Wacholder. Ich musste ihn einfach vergessen. Unmöglich.
Von den Fleischwurstweibern beim Becherhans waren Ria, Biggi, Silvie und ich, angeschossen von den Schnäpsen, übergangslos um den Scholmerbacher See getrudelt und am Linner Ufer auf dem Fischfest gelandet. Es gab immer was zu feiern. Egal wo. Immer traf man Leute. Im Zelt auf der Bühne spielte unsere Lieblingsband Troja wie besessen, und Wimmi legte sich mit der Elektrogitarre fast aufs Kreuz, und Elmar am Mischpult wippte mit dem Kopf, während er bedächtig die Schieber hin- und herschob und sein langes, einsames Zöpfchen sich blond über die Schulter kringelte. Manche Leute tanzten nur, andere tranken nur, andere aßen Fisch und aßen und tranken und mussten bald wieder heim. Der Abend wurde dunkel und immer dunkler; meine gähnende Trauer schien sich zu spiegeln in einer glänzenden, immer leerer werdenden Fläche zwischen der Theke und der Tanzfläche. Ria und Silvie hatten irgendwelche alten Berufsschulfreunde getroffen, Biggi war schon gegangen. Ich hätte auch schon gehen sollen. Ich wurde von Wacholder immer sehr schnell betrunken, so rasch, als hätte man mir den Saft aus den Adern gelassen und sie mit Spiritus gefüllt. So torkelte ich herum und suchte Anschluss oder auch nicht. Nein, es ging mir nicht gut, es war mein Geheimnis, das mich herumschlingern ließ, verloren und ohne jegliche Orientierung. Was machte ich bloß hier? Die Musik hatte gewechselt, sie war mir zu laut, es war so dunkel im Riesenzelt, der Boden wurde schlammig von den Fischfestgästen und schimmerte auf in schmutzigen Lachen unter der Lichtorgel.
Ich sollte nach Hause gehen. Man muss wissen, wenn man genug hat.
Aber wenn ich genug hatte, ging ich niemals heim.
An der Theke noch ein versprengter Trupp verheirateter Leute Mitte dreißig; ich hatte sie nicht recht wahrgenommen, war nicht so meine soziale Anknüpfungsrunde. Die hatten alle, was sie brauchten, eine Frau, einen Job, ein Auto, die Urlaube, die Kinder … was sollte man mit denen reden? Nur Thea schien aus der Gruppe herauszutrudeln, irgendwie gelangweilt, sie rauchte und blies Wolken in den Fischfesthimmel, unschlüssig musterten wir uns, qualmend und wankend, bis Thea endlich sagte:
»Na, wie geht’s?«
»Ach, na ja …«
Thea, unsere Dorfschöne, war verheiratet mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Knochschiefelwerke, Bleche und Aluminium. Gymnastiklehrerin mit Aerobic-Kursen auf dem Sportplatz. Mutter. Sie war wie von einem anderen Planeten, dem Planeten der Etablierten. Aber im Dorf musste man mit jedem reden, das gehörte sich so. Immerhin hatten wir beide Dauerwelle und Stufenschnitt und Jeans, ihre Beine waren viel länger als meine, sie hatte einfach ein sehr hohes Stockmaß, und egal was sie anhatte, lange Hosen, kurze Hosen, lila Leggins, die Männer sahen ihr hinterher. Wenn wir an Karneval in der Sektbar standen, musste sie ständig irgendwelche Arme von ihrem Körper räumen; sie verleitete die Männer förmlich zu Ungehörigkeiten, auf jeden Fall war sie die Sektbarkönigin, und es war gut, dass ihr Mann das nicht immer so merkte. Auf Thea konnte man irgendwie nicht eifersüchtig sein, sie war so selbstverständlich schön wie eine Dorfhecke oder ein Fliederbusch. Vielleicht auch, weil ihr Vater in der Kirche so viele Marienlieder gespielt hatte, es blüht der Blumen eine, auf ewig grüner Au, wie diese blühet keine, so weit der Himmel blau. Thea war wie ein Marienlied mit Aerobic-Stulpen.
Inzwischen spielte Thea selber die Orgel, Marienlieder und Beerdigungslieder und Kommunionslieder. Es war einfach immer so, saß man in der Kirche und schaute nach oben, da saß sie und spielte »Wunderschön prächtige, hohe und mächtige«.
Wir hatten also beide braune Haare und Stufenschnitt und einen dichterischen Hang von unseren Vätern. Mein Vater reimte über die Schönheit der Struthecke, er hatte früher den Karnevalsprinzen gemacht und war Büttenredner. Und Theas Vater hatte Lieder geschrieben und Gedichte über die Liebe oder den schönen Wald. Er hatte am Waldrand ein Schild hingestellt:
»Der Wald ist ein Segen, wo Gott ihn auch schuf, den Wald zu pflegen sei jedem Behuf!«
Thea und ich waren beide Dorfdichtertöchter.
Qualmend und überdrüssig standen wir in der feuchten Dunkelheit auf dem Fischfest herum.
»Scheinst ja nicht gerade begeistert zu sein vom Fischfest.«
»Ich, na ja, ich …« Da war es so weit. Übergangslos liefen mir einfach die Worte aus dem Mund wie verbrannte Suppe. »Ich habe rumgeknutscht mit einem verheirateten Mann und … ich habe … es war Ehebruch.«
Thea drehte sich mir zu. Ihr Augen wurden riesig. Grau und blau, ich sehe es noch wie heute, sie leuchteten, wie sie immer leuchteten, denn ihr Lidstrich war phosphorfarben, ihre Wimpern waren von der Wimpernzange gebogen und schwärzer als die verbrannten Streichhölzer auf dem Fischzeltboden. Ich vergesse das niemals, wie ihre Augen aufgingen, als hätte man etwas hineingetropft, als könnte sie fortan im Dunkeln sehen. Theas Augen waren klarer als meine, die trübe vor Betrunkenheit schwammen. Da sagte sie:
»Ich auch!«
Wir starrten uns an, erschrocken und ungläubig, und hatten nun beide Augen groß wie Untertassen. Das Geheimnis, mit einem Paukenschlag aus uns herausgehauen, so dass wir gelähmt und benommen dastanden wie Mondmenschen.
Jetzt waren wir nicht mehr nur Dorfdichtertöchter. Wir waren auch beide Ehebrecherinnen.
»Du musst mich besuchen kommen«, hatte Thea gesagt nach einer langen, fassungslosen Weile. »Vielleicht mal Kaffee trinken oder so …«
Und so war es gekommen. Von diesem Augenblick an waren wir Blutsschwestern.
Wir waren Dorfdichtertöchter, Betrügerinnen und Blutsschwestern.
Es dauerte noch bis zum großen Festumzug, und es half alles nichts, ich musste wieder nach Darmstadt.
Mein ewiger Dienst, meine endlosen Streifenfahrten, Darmstadt bei Nacht. Kasinostraße, eingehauene Köpfe, Stadtschenke, Zechprellerei, Hawaiibar, Beischlafdiebstahl, Heidelberger Straße, brennende Mülltonne, Zweibrücker Straße, Randale im Männerwohnheim.
Ich schrieb alles auf, an meinem kleinen Küchentisch, der immerzu wackelte.
Und ich schrieb es noch schlimmer, als es war, ich notierte die Gerüche dazu (verschmorter Topf bei Hausmeister Seelbach, Frau Seelbach hatte Kohlrabi gekocht, bevor …), die Geräusche (das Trommeln des Einsatzleiters auf dem Funktisch), die Formen (die sich rosenförmig mit gelblich sprudelnden Bläschen ausbreitende Bierlache, die unter dem Wachtisch hervorquoll), die Poesie (»Frau Wachtmeister, du bist so schön, aber ich verlange meinen Diebstahl zurück«).
Mein Kaffee schmeckte mir nicht so recht, denn als ich das letzte Mal die Scholmerbacher Freundinnen zu mir in die Stadt eingeladen hatte, hatte Birgit meine Kaffeemaschine auf der heißen Herdplatte zerschmolzen, und jetzt war die Maschine ganz schief und alles schmeckte nach Plastik. Ich saß vor dem Nachtdienst in der Küche und nach dem Frühdienst in der Küche und überhaupt immer nur in der Küche.
Dann zog ich wieder mein senfgelbes Hemd an und hängte mir den grünen Schlips um, meine Lippen waren bemalt, und es graute mir vor der nächsten Schicht. Wenn die Nächte so lang waren wie in diesem endlosen Sommer, dann schien die Stimme aus dem Orbit öfter zu funken, und sie präsentierte ein ganzes Arsenal von Triebtätern und Pennerschlägern und Drogendelikten. Wäre er nur nicht so erfolgreich gewesen, ein so besessener Kommissar. Er fegte die Stadt leer, war ständig auf der Suche nach immer neuen Schurken und Missetaten, nichts war vor ihm sicher. Ich gebe zu, auch ich hatte diesen Virus, diese Neugier, die Unterwelt zu betreten, zu sehen, was es in Scholmerbach nicht zu sehen gab; meine Neugierde war unstillbar.
Zum Dank spuckte mir eine Rauschgiftsüchtige ordentlich in die frischen Dauerwellen. Eine betrunkene Wohnsitzlose riss mir ein Büschel Haare aus. Und der Lanzeitarbeitslose Hinnerk Wedelstein urinierte mir im Streifenwagen auf den Rücksitz. Aber das war alles nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Wirklich schlimm war nur die überirdische Stimme:
»Hier Heiner zwei-fünf, überprüfen Sie mal ein Kennzeichen – Dora Anton – Wilhelm Berta – Eins-Vier-Sieben … Ende!«
Niemals sagte die Stimme: »Hallo Ännchen, ich weiß, in welchem Streifenwagen du sitzt, es tut mir leid, ich bereue alles, ich werde nie aufhören, dich zu lieben!«
Stattdessen immer nur Halunken, Missetäter und Kennzeichen, und jeder Anton, jede Berta, jeder Cäsar, Dora, Emil, Friedrich, Gustav, Heinrich … sie alle spazierten durch mein Gehirn und ließen mich erschauern. Es wurde nicht besser. Ich konnte dem Funk nicht entrinnen. Ich konnte ihn ja nicht ausmachen. »Ich muss hier weg«, sagte ich laut.
»Wos?«, sagte mein Streifenpartner Zimbo aus seinem Tran heraus.
»Es tut mir leid.«
»Bei mir brauchst du dich für nichts zu entschuldigen.«
Dann döste er wieder ein.
»Da fährt einer bei Rot über die Ampel«, sagte ich schwach.
»Ist doch egal«, brummte Zimbo. Wir waren eine Traumbesetzung. Die Stadt war sicher wie nie. Er würde mir fehlen. Der Funk fiepte eintönig vor sich hin, erzählte nur hin und wieder von einer Ordnungswidrigkeit, streifte ein Vergehen, wartete lustlos mit einer Schlägerei auf in anderen Revierbereichen.
»Haben hier den Tatverdächtigen Richard Lewandowsky, ich buchstabiere: Ludwig-Emil-Wilhelm-Anton-Norbert-Dora-Wilhelm-Siegfried-Konrad-Ypsilon, geboren am 13.11.1949 in Siegburg …«
Die Stimme aus dem Äther brachte mich um. Ludwig-Emil-Wilhelm-Anton-Norbert wollten mich umbringen. Ich war ihnen nicht gewachsen. Es waren nicht nur diese fünf, es waren sechsundzwanzig an der Zahl, und ich war machtlos ihnen gegenüber, machtlos mit meiner schweren Waffe, den Handschellen und dem Schlagstock an meiner Seite.
Drei Tage vor dem großen Fest.
Mein R4 schien sich zu freuen, als ich ihn belud mit meinen Klamotten für Scholmerbach, den alten Jeans und den Sommerkleidern, mit den hohen Pumps und dem Haarspray Ultrastrong. Ich verließ Darmstadt und das Reihenhaus wie einen öden Traum, um in die Pracht und Herrlichkeit meines Dorfes zurückzukehren, wo ich wieder aufblühte wie die Himbeeren unter dem Hollerbusch. Ich hielt am ersten Haus unter dem alten Wasserbasseng mit den Kastanien, ich war eingeladen, eingeladen bei Thea zum Kaffeetrinken.
Ich rieb mir die feuchten Hände, klingelte und war mir nicht mehr sicher, ob die Einladung ernst gemeint war.
Auch Thea schien ein wenig unschlüssig, als sie mir in einer pinken Jogginghose mit Sternchen die Tür aufmachte. Sie wusste nicht genau, wohin mit ihren Kindern, und kochte dann einen Kaffee, den wir beide in hohen Kaffeebechern hinaufschleppten in ihr Schreibzimmer. Thea hatte ein eigenes Schreibzimmer, was mich schwer beeindruckte. Niemand durfte hinein, nur ich, und ich durfte hinein, weil ich ein Geheimnis hatte und weil auch Thea ein Geheimnis hatte: Das hatte die geheime Tür geöffnet.
»Gibt es was Neues im Dorf?«, fragte ich schüchtern.
»Hennegickels Berta ist gesehen worden, wie sie das Waschwasser aus der Waschmaschine aufgefangen hat, um es noch mal als Putzwasser zu nehmen.«
»Ah.«
An der Wand sah man Thea in einem Bilderrahmen schwarz-weiß tanzen, die Hand an einer Ballettstange und den Blick ganz ernst in die Ferne gerichtet. Sie war einmal in Köln gewesen und hatte Tanzen gelernt, und sie war heimgekommen und hatte ihre Bücher mitgebracht, die zahllosen Bücher, Gabriel Garcia Marquez, Erich Fromm, Pablo Neruda … Da standen sie im Schreibzimmer in der Bücherwand, doch kein Buch war so wichtig wie die Bücher im verschlossenen Glasschrank, Theas tausend Tagebücher.
»Und?«, fragte Thea. »Hast du ihn noch mal gesehen?«
»Nein, nur gehört, und ich fühle mich schrecklich.«
Thea verstand das.
Ihre Augen schienen alles, was ich nun erzählte, aufzunehmen, denn immer, wenn sie etwas begriff oder meine Geschichte eine neue Wendung nahm, wurden sie größer, heller und der schwarze Wimpernkranz weitete sich. Vielleicht war es auch wegen der Qualmwolken, in die wir uns nun einhüllten; der Aschenbecher auf der selbstgehäkelten Filetdecke quoll bald über, wir rauchten und tranken Kaffee und dann Wein. Wir mussten einander schnell unsere Sünden beichten, die vielen Sünden, bevor der Mann heimkam. Unsere Sünden wurden auf einmal kostbar; wie Schätze boten wir sie einander an.
»Ich habe schon mal den Jürgen vom Klempnerheinz geknutscht«, flüsterte Thea.
»O Gott, nein, ich auch!«, flüsterte ich. Irgendeine Kirmes, irgendein Karneval. Wir beide schlossen die Augen und schauderten. Der Jürgen vom Klempnerheinz! Er war noch nicht mal schön. Was war in uns gefahren? Und im selben Augenblick wollten wir vor Lachen sterben. Als wären wir vierzehn Jahre alt, aber ich war fünfundzwanzig und sie achtunddreißig. Wir prusteten und lachten so sehr, dass uns das Wasser aus den Augen kam und durch die Finger lief, die wir vor Scham und Vergnügen vors Gesicht hielten; ich dachte, ich kippe um und falle aufs Klavier.
Wir verliebten uns in unsere Geheimnisse, und je schlechter und scheeler sie waren, umso besser. Wir gruben aus, was auszugraben war und noch nie ein Mensch gehört hatte. Ich war nicht mehr so schlimm mit meinem Heinz im Streifenwagen. Auch Thea hatte keinen Heiligenschein verdient. Und sie schloss mit den Worten:
»Ich hätte niemals heiraten dürfen.«
Erschüttert und benommen blieben wir sitzen, während das Gesagte im Raume stand und die Qualmwolken tanzten. Wir fühlten uns liederlich und erlöst von den Fehltritten unserer Leben, nur weil die andere es auch schon mal gemacht hatte. Natürlich war unser ganzes Dorf kein Kind von Traurigkeit. Von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen. Niemand wollte genau wissen, was in den langen trunkenen Sommernächten geschah, wenn niemand heimging und die Sterne so schön funkelten.
»Jetzt ist auch noch der Festzug«, sagte ich. »Da soll ich als Ehrenjungfer gehen!«
Und schon wieder prusteten wir vor Lachen.
Wir fühlten uns amüsiert und schuldig und schlecht, alles in einem. Aber mit Thea gemeinsam schlecht zu sein war eine Ehre und berührte mich zutiefst.
»Kommst du am Samstag zur Parade?«
»Natürlich!«, sagte Thea. »Was glaubst du denn?«
Doch bis dahin schworen wir, unsere Geheimnisse zu bewahren und niemandem etwas zu erzählen, bis wir auf dem Festzug in neue Geheimnisse und Verstrickungen geraten sollten. Sie brannten innerlich so heftig, dass nur noch die Feuerwehr selber uns löschen konnte, während die Musik dazu spielte … mindestens das »Preußens Gloria«.
Am 26. Juni 1987 war es so weit.
Früh am Morgen war die Sonne an einem prächtig blauen Himmel aufgegangen, und hinter dem Feuerwehrhaus stand das Feuerwehrauto, mit Blumen geschmückt wie ein metallener feuerroter Pfingstochse, gewienert und poliert, und am Ortseingang warteten als Überraschung die Oldtimer der Feuerwehren aus dem ganzen Westerwald auf die Parade, und einer war karminrot und einer rubinrot und einer purpurrot und einer zinnoberrot.
Bald schon strömten sie herbei, die Blaskapellen und Liederkränze aus dem ganzen Land, in Trachten und in Uniformen, mit Löschgeräten und Musikinstrumenten in endlosen Karawanen. Es kamen auch der Karnevalsclub, der Gesangsverein, der Sportverein, der Segelclub, der Dorfverschönerungsverein, die Fleischwurstweiber und die restlichen drei Einwohner meines Dorfes.
Schloss Egon stand am Ortsschild und meinte, das Wetter sei so schön, weil Gott ein Feuerwehrmann sei, aber der Musikverein hatte auch einen Egon und der meinte, Gott sei ein Musikant. Der erste Wagen der Parade war ein altmodischer Feuerwehrwagen, gezogen von zwei prächtig geschmückten Gäulen, und darauf saßen die Ehrengäste Honiels Franz, Dorfsheriff Silberlocke und unser ältester Mitbürger, der Alwis Wissemichel.
Dann kamen wir.
Wir waren zwölf, wir trugen goldene Kleider und alle waren wir schön. Wir glitzerten und prangten auf unseren schwarzen Pumps, wir strahlten unter der Sonne und blendeten die Menschen am Straßenrand, wir blendeten das Feuerwehrauto, wir waren selbst geblendet von unserem eigenen Glanz. Wir hatten ganz vergessen, dass es um die Feuerwehr ging und auch um die Blasmusiker, die sich mit glänzend polierten Trompeten hinter uns aufgestellt hatten – die singenden und klingenden Musikanten von Scholmerbach.
Um genau zwei Uhr Nachmittag ertönte die Fanfare.
Infernalisch schlug hinter uns der Egon auf die Pauke, und der Erzherzog-Albrecht-Marsch erklang. Da hoben wir unsere Lackpumps mit den Riemchen und Sternchen und marschierten los, strahlend und funkelnd, stolz über Teer und Split und Graswurzeln, der tosenden Menge entgegen, die jubelnd die Straßen säumte, schon seit dem Morgen. Die Sonne schien uns in unseren schimmernden Gewändern aufzubacken, wir erhitzten uns unter den lackgestählten Dauerwellenungetümen und den Spenzerjäckchen und den schwarzen Strümpfen. Doch schritten wir erhaben weiter, und überall winkten und applaudierten sie und die Schulkinder hopsten und riefen:
»Parademarsch, Parademarsch, der Lehrer hat ein Loch im A…!«
Wir blickten huldvoll, als wir am Busbahnhof, dem Taubenweg und der Tankstelle vorbeischritten, und nickten mal hier und mal da, die Hände an den Blumensträußen, die Abstände zwischen uns gerieten mal länger und mal kürzer, wie bei einer menschlichen Ziehharmonika. Doch machte das alles nichts, denn wir sahen unser Funkeln sich widerspiegeln in den Augen der Leute, und so fühlten wir uns wundervoll und vollkommen würdig in unserer vom Dorfsheriff gepriesenen Schönheit. Schließlich spürten wir die Kraft der uns folgenden Triumphwagen mit den umjubelten Musikanten aus unserem Dorf, wir hörten die Musik der fünfundzwanzig Jahre, wir lauschten den Feuerwehren mit ihren altmodischen Hupen, die lauthals ihre ausgeleierten Signaltöne freudig in die Menge donnerten wie Triumphsalven, wir hörten den alten Magirus Deutz aus Stockhausen, den Hanomag aus Steinefrenz und den Metz aus Wällershofen. Löschzug um Löschzug zog durch unser Dorf, als sollte das halbe Jahrhundert brennen. Scholmerbach hatte nicht Straßen genug, und wir verloren den riesigen Lindwurm der Parade hinter uns, doch hörten wir sie, die Spielmannszüge und Mandolinenvereine, ein unablässiges Pfeifen und Trommeln und Flöten und Trompeten, ganz Scholmerbach war ein einziges singendes klingendes Tschingderassassa.
Gott sei Dank reichte man uns hier und da einen Schnaps, wo wir doch sonst nichts zu trinken hatten an diesem warmen Sommertag. Wir schafften es am Kappesgarten und der Schneidmühle vorbei durch unser aus allen Nähten platzendes Dorf, bis wir zwischen Losbuden, Karussell, Autoscooter und Wurstwagen am Festzelt landeten. Da stand es vor uns und öffnete sich so gewaltig und war brechend voll, wie an einer Mörderkirmes.
Wir schritten unter den gewaltigen Klängen vom Königsmarsch in die sengende Hitze hinein, direkt auf die Bühne, wo wir zwischen mannshohen Blumengebinden auf die herannahende Feuerwehr und die Musikanten von Scholmerbach warteten. Hinter uns ging eine gewaltige Stoffsonne auf aus gelb und blau drapierten Streifen, auf denen stand in Gold: »50 Jahre Feuerwehrverein und 25 Jahre Musikverein Scholmerbach«.
Mannshoch waren auch das Wappen der Feuerwehr mit Spitzhacken, Feuerrad, Flammen und einem roten Kreuz darauf und auf der anderen Seite für die Musikanten eine silberne Lyra, so hoch wie ein Garagentor. Und mannshoch war die gesamte linke Zelthälfte mit der Aufschrift: »Mering, Hirschberger und Co, Heizung und Sanitär«.
Ich kriegte einen Kreislaufzusammenbruch, den ich aber keinesfalls zugeben wollte, hielt mich mühsam aufrecht in meinen wackeligen Wildlederpumps und lächelte ohnmächtig vor mich hin, und der Kirschei und der Krämer nahmen die Parade ab, und wir stierten als Teil des Bühnenschmuckes vor uns hin, während Halbs, Langenhahn, Stockum Püschen, Enspel, Rotenhain, Gemünden, Girkenroth und Guckheim einmarschierten. Sämtliche Männer und Frauen rissen sich sofort die Uniformjacken vom Leib und die Schlipse von den Hälsen und schrien nach Bier.
Immer mehr und mehr Vereine kamen herein, wahrscheinlich waren auch noch der Hunsrück und die Eifel da, und alle mit einem einzigartigen Durst.
Ich schielte zu einem Tisch vor der Bühne, auf dem »Festdamen« stand. Und auf dem Tisch stand eine Flasche Wein mit Gläsern für uns alle. Ach, dieser Durst, dieser ungeheuerliche Durst, ich war ausgetrocknet wie ein vergessener Halm nach der Heuernte. Kaum waren endlich die letzten Takte verklungen und wir in Zweierreihen von der Bühne gewackelt, stürzte ich mich an unseren Tisch, nahm die Weinflasche und trank und trank und trank. Es kam nicht mehr auf uns an. Mission erfüllt.
Während sturzbachartig die goldene Flut meine Speiseröhre hinunterrauschte, floss sie auch wieder hinauf durch die Blutbahnen und durch die Nervenstränge und verwandelte meinen Körper in eine bewegungsunfähige Gliederpuppe. In unbeschreiblicher Geschwindigkeit war ich völlig betrunken und völlig zerschmettert in meinem goldenen Gewand über der Biertischgarnitur. Unsere Aufgabe war erledigt, ich war erledigt. Auch meine Mitjungfern verloren die Fasson, und die Schulterpolster hingen uns auf dem Rücken oder unter den Achseln, unsere kunstvoll toupierten Haare verrutschten und gerieten in Schräglage.
Hinter uns am Nachbartisch landete der »Liederkranz Harmonia« mit der zwinkernden Thea. Den Liederkranz nannten wir immer Gesangsverein Halbe Lunge. Sie alle trugen schwarze lange Röcke und fliederfarbene Blusen und silberne Schärpen. Thea sah wieder mal umwerfend aus, und sie hatte eine Anmut, wie man sie nur haben kann, wenn man in einem albernen Chorkleid aus achtzig Prozent Polyester in einem Bierzelt sitzt.
Dabei hatte der Abend erst angefangen, und eine übermäßig lange Schlange hatte sich angestellt, um auf der Bühne der Feuerwehr und dem Sportverein zu gratulieren; es gab reichlich Fußballer im Westerwald, Rotweiß-Podem, Grünweiß-Ellingen, Blauweiß Hellersberg, sie kamen und überreichten feierlich einen Zinnteller. Dann tanzte die Volkstanzgruppe als Geschenk »Im Rosengarten, da will ich warten«. Dann kam der Landrat und hielt eine Rede und schenkte einen Zinnteller. Dann schenkten der Dorfverschönerungsverein und der Männerchor Winnen und der Liederkranz Harmonia je einen Zinnteller.
»Gleich soll auch der neue Pfarrer aus Lemberg kommen!«, flüsterte Thea. »Den musst du dir ansehen! Ein toller Mann!«
»Ach«, sagte ich.
»Doch, ich habe den schon mal gesehen, der ist toll!«, flüsterte Silvia.
»Ich kann jetzt schon nicht mehr«, sagte ich.
»Ach komm«, sagte Ria. »Ist doch lustig. Wie guckst du überhaupt aus der Wäsche?«
»Ich weiß auch nicht.«
»Trauerst du immer noch um deinen Schimanski?«
»Ach, ich bin nur besoffen. Da kommt einem manchmal sowas hoch.«
»Komm«, sagte Ria. »Andere Mütter haben auch schöne Söhne.«
»Ach …«, sagte ich. Mein Blick glitt durch den Saal, und einer nach dem anderen kam herein, und unter all diesen unzähligen Menschen sah ich keinen, keinen einzigen schönen Sohn. Ich vertrug den Wein einfach nicht.
»Weißt du was?«, rief Ria. »Ich habe einen Studienplatz in Heidelberg! Völkerkunde! Ethnologie!«
»Ach was!«, rief ich. »In Heidelberg? Ich komme mit. Ich schmeiße meinen Job!«
Sie hatte es nicht gehört. Ich aber war erleuchtet von diesem Gedanken! In einem Augenblick hatte sich mir die Zukunft gezeigt! Idas Monika zündete sich gerade eine Zigarette an, Biggi warf aus Versehen den Aschenbecher um, ich rülpste von dem Wein.
Auf der Bühne überreichte Dorfsheriff Silberlocke den Vereinen feierlich einen Zinnteller. Thea erhob sich mit ihren Tischnachbarn, und dann schritten sie nach vorne in ihren schwarzen Röcken. Die Halbe Lunge ging auf die Bühne und sang »Freude schöner Götterfunken«.
Ich goss mir noch einen Wein ein.
»Das ist doch alles eine vollkommen reaktionäre Kacke«, sagte Matthias, der mit seinen langen Haaren aufrecht dastand, die Hände in den Hosentaschen. Er war Achtundsechziger und zu Besuch daheim. Es hieß, er verdiente in München Geld als Statist für den Jesus.
»Hä?«, fragte ich geistig unvorbereitet.
»Heute Nacht machen die auch noch Zapfenstreich«, sagte Matthias. »Wie im Dritten Reich. Ist doch gruselig.«
Ich war schlecht informiert. Was wollten sie machen? Um mich drehte sich alles.
»Wenn die da stehen mit ihren Pechfackeln und Uniformen – das beschwört doch geradezu die Vergangenheit, da wird mir schlecht.«
»Oje, also … ich … ich trage im Dienst auch eine Uniform«, brabbelte ich. Aber er hatte recht, Uniformen überall, wohin ich auch sah, tatsächlich, und heute, ganze Garnisonen, nun, da ich einer Uniform entfliehen wollte, sah ich sie wie in einem Spiegelkabinett tausendfach präsentiert.
»Das ist auch nicht mehr normal«, nickte ich.
»Nichts gelernt aus der Vergangenheit!«, sagte Matthias. »Alles paramilitärisch.«
Ich konnte Matthias’ geistigem Pfad nicht weiter folgen.
»Sie wollen doch bloß Jubiläum feiern«, sagte ich schwach und unpositioniert.
Nun trat der Vorsitzende des Kreismusikverbandes auf und sagte:
»Musik gibt den Menschen Freude! Menschen brauchen Freude! Musik löst die Menschen vom Alltag!« Dann verlieh er die Ehrenplakette des Landes und überreichte einen Zinnteller.
»Siehst du, das ist wie eine Ordensverleihung. Die alten Riten, die alten Symbole«, sagte Jesus-Matthias.
»Ach komm«, sagte Dabbersch Kristina. »Ist doch nicht so schlimm.«
»Also, den Zapfenstreich heute Abend finde ich schon bedenklich«, sagte Thea, die sich nach ihrem Auftritt wieder setzte. »Das erinnert doch an die Nazis, da fehlen nur noch die Fahnen mit …«
»Das meinen sie doch nicht so«, sagte Kristina.
Nun war oben die Geistlichkeit dran. Unser katholischer Pfarrer Weide kam in seinem zerknitterten Anzug auf die Bühne geschlurft, blickte ein wenig in die Runde, sagte »Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr«, überreichte einen Zinnteller und schlurfte freundlich lächelnd wieder herunter.
Feuerwehrhauptmann Kirschheim ging ans Pult und sagte:
»Begrüßen Sie nun mit uns den neuen evangelischen Pfarrer Ulli-Dieter Aschbrenner, der eigens aus dem Dekanat Lemberg angereist ist, um einige Grußworte vorzutragen!«
»Mein Gott«, hörte ich Thea hinter mir sagen. »Da ist er. Er ist so wunderbar.«
Ich hatte nie von ihm gehört. Ich fuhr schließlich die ganze Zeit Streife in einer Stadt mit wenig Kirche und Gott. Da kriegte ich hier nicht alles mit. Alle anderen kannten ihn offenbar schon, denn die Leute fingen an zu raunen und stießen sich an.
Im Bierzelt wurde es still, und ein einzelner Jubelruf drang hinauf.
»Den solltest du mal predigen hören«, flüsterte Thea.
Vorne war ein Mann aufgestanden mit knatterschwarzem Haar, er verbeugte sich leicht, schloss den Knopf seines Anzugs so besonnen, als müsste er beim Knopfschließen in eine kurze Andacht gehen, und schritt dann zur Bühne. Die letzte Stufe sprang er unversehens. Ein schwungvoller, athletischer Bühnenpfarrer. Sehr aufrecht, o Gott, stand er nun vor den dicken blauen und gelben Streifen der aufgehenden Stoffsonne unter dem goldenen Buchstaben F von Feuerwehr – und dann packte er das Pult, als wolle er es in den Saal werfen.
Mir blieb die Spucke weg.
»Verdammt«, sagte ich. »Das ist wirklich … ein schöner Sohn.«
»Verehrte Festgäste«, sagte er. »Ich halte es mit unserer Telefonzelle: Fasse dich kurz!«
Und dass immerhin zwölf Evangelische in dieser Gemeinde seien, die doch mal den Ausflug nach Lemberg unternehmen sollten in die schöne Stiftskirche, wo er sie begrüßen wollte. Dass sie alle ein großartiges Fest feiern sollten. Und dass so ein Fest natürlich Geld kostet. Darum nun habe das Dekanat dem schnöden Mammon dieser Welt ein wenig entwendet, um es der Feuerwehr und dem Musikverein in diesem Umschlag zu überreichen. Ein rauschendes Fest! Fertig!
Mann, das hatte gesessen. Peng. Wieso war dieser Pfarrer so schön wie ein Schlagersänger? Das war doch nicht nötig. Alles, was an einem Mann schöner ist als an einem Affen, sei überflüssig, hatte meine Oma gesagt. An Pfarrer Ulli-Dieter Aschbrenner war alles überflüssig.
»Hast du seine Augen gesehen?«, fragte Thea. »Das ist doch ein glühender Feuerteufel!«
»Bestimmt ist er verheiratet und hat zwei Kinder«, sagte ich, die es gewohnt war, zu spät zu kommen, wenn die Liebe vergeben wurde. »Scheiße«, sagte ich.
Die Unerreichbarkeit des schönen Sohnes auf der Feuerwehrbühne und überhaupt aller schönen Söhne entmutigte mich auf einmal sehr. Nichts klappte in meinem Leben und vorgeführt zu kriegen, was man nicht haben kann, war doch erniedrigend. Irgendwie hatte der blöde Pfarrer mich verstört. Ich ließ es mir nicht anmerken und plauderte artig und qualmend nach allen Seiten unter meiner turmhohen Dauerwelle.
Der Bergmannschor der Grube Alexandria trat auf mit hohen Kappen und brennenden Fackeln und sang: »Lieb Schätzelein: Ich fahre in den finsteren Schacht, bei der Nacht, und da denk’ ich dein. Glückauf, Glückauf.«
Gratulant um Gratulant redeten das Publikum in eine bleierne Lähmung hinein, ein sich betrinkendes Publikum, das unter der Last der Wünsche und Zinnteller auf der Bühne in die Breite ging, in haltloses Flüstern, das mehr und mehr zu dreistem Geschwätz und allmählichem Schwadronieren wurde, so dass die Redner auf der Bühne kämpften wie gegen das Rauschen der Meere im Sturm, und sie fuchtelten und dröhnten und sagten wieder und wieder: »Aber meine Damen, meine Herren, ich muss doch sehr bitten!«
Darum hatte ich zunächst nicht mitgekriegt, wie der Peter Holpers vom Festausschuss an unseren Tisch gekommen war. Doch dann sagte er:
»Hört mal, ihr Festdamen, könntet ihr euch mal um die zwei Pfarrer da kümmern? Den evangelischen und den katholischen? Die sitzen da ganz allein!«
Ich sah mich aufspringen und den Wein umwerfen:
»Ich! Ich! Ich!«
Und das Schicksal nahm seinen Lauf.