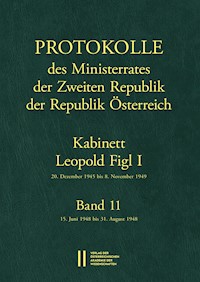9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wer zieht im Hintergrund die Fäden?
Bei der Recherche über neue Architektenhäuser begegnet Elisabeth Winterscheidt einem gleichermaßen dubiosen wie glamourösen Schönheitschirurgen und seinem Weißen Haus am Stadtrand von Berlin. Eine unmögliche Liebe beginnt, für die sie bald bereit zu sein scheint, ihre bürgerliche Existenz mit Mann und Tochter zu opfern. Zu spät erkennt sie, dass ihre Begegnung nicht so schicksalshaft ist, wie sie geglaubt hat. Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Und was ist das Geheimnis des Weißen Hauses?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Bei der Recherche über neue Architektenhäuser begegnet Elisabeth Winterscheidt einem gleichermaßen dubiosen wie glamourösen Schönheitschirurgen und seinem weißen Haus am Stadtrand von Berlin. Eine unmögliche Liebe beginnt, für die sie bald bereit ist, ihre bürgerliche Existenz mit Mann und Tochter zu opfern. Zu spät erkennt sie, dass ihre Begegnung nicht so schicksalhaft ist, wie sie geglaubt hat. Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Und was ist das Geheimnis des weißen Hauses?
Zum Autor
WOLFGANG MUELLER, geb. 1967 in Bensberg, ist ein deutscher Filmproduzent und Schriftsteller. Er produziert mit der Firma Barry Films, ansässig in Los Angeles und Berlin, international erfolgreiche und preisgekrönte Filme und Serien. Zuvor praktizierte er als Rechtsanwalt für Musiker und Künstler. Nach einem Jurastudium in Gießen, Madrid, Mexiko-Stadt, Hamburg und Bonn promovierte er 2000 mit einer Arbeit über Rechte von Minderheiten in Mexiko. Unter dem Namen Oscar Heym veröffentlichte er diverse Romane (u. a. KURKONZERT) und Erzählungen. Er lebt in Berlin.
Wolfgang Mueller
DAS WEISSE HAUS
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe September 2021
Copyright © 2021 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Frauke Brodd/write and read
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Getty Images/Alessandro De Carli
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ts · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-22621-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Die Minute, in der man das zu tun beginnt, was man tun will, ist der Anfang einer wirklich anderen Art des Lebens.
Richard Buckminster Fuller
PERFEKTE PROPORTIONEN
Auf Zehenspitzen, die Kleider im Arm wie ein nächtlicher Dieb, schlich er sich aus dem Zimmer. Meist stand sie mit ihm auf, doch an diesem Morgen fühlte sie sich so traumselig, so körperwarm, dass sie einfach tat, als schlafe sie weiter. Und wirklich, als sie das Schloss in der Tür einrasten hörte, fiel sie einen Moment zurück in dieses sanfte Netz aus Halbschlaf und Gedanken, Augenblicke, Erinnerungen schwebten herbei und verwebten sich mit Traumbildern, der Organismus fuhr herunter, sie begegnete Menschen, die längst Vergangenheit waren, doch alle gaben sich fröhlich, heiter und unbeschwert. Sie war viel jünger. Ein Sommerregen nässte ihre Haare, sie genoss die Abkühlung, bis sie von weit, weit im Hintergrund den Verkehr summen, die Dielen im Flur knarzen hörte und schließlich die Augen öffnete und begriff, dass sie nicht länger weiterschlafen würde. Keine zehn Minuten waren vergangen, seit Anton fort war.
Schlaftrunken ging sie in die Küche. Sie nippte an dem lauwarmen Kaffee, den er zurückgelassen hatte, und blickte zum Fenster hinaus in den trostlosen Nieselregen. Der Verkehr wühlte sich durch die Kantstraße und mit ihm die Geräusche: hupende Autos, die den ausladenden Lastern ausweichen mussten und sich der Ungeduld der Fahrer hinter ihnen aussetzten, wutschnaubende Radfahrer, die nicht verstehen konnten, warum die Autofahrer sich so uneinsichtig und fahrlässig verhielten. Wie unversöhnlich diese Welt sich jeden Morgen aufs Neue zeigte. Wie unklar alles blieb, die Gebäude, die Straßenführung, die Parks, die ganze Stadt. Sie grübelte, ob es bloß an der Unklarheit ihrer Gedanken lag – dieses halb Wache und halb Träumende – oder ob etwas war, das länger schon da war. Diese Holprigkeit, Unebenheit des Daseins spürte sie ja von Tag zu Tag stärker, es war nicht bloß ein melancholisches Gefühl, das kam und wieder verschwand, nein es war ein Zustand geworden, es hatte sich dauerhaft in sie eingenistet und drohte, sich immer weiter auszudehnen.
Es war nicht einmal acht Uhr, als sie sich an den Schreibtisch setzte und in den Unterlagen des Manuskripts blätterte, aber die Müdigkeit blieb wie ein Schleier über ihrer Konzentration hängen. Das Buch, an dem sie nun seit über einem Jahr arbeitete, bräuchte viel mehr Objekte. So wie es jetzt vor ihr lag, kam es ihr leer vor. Fotos und Beschreibungen für gerade einmal zehn Gebäude hatte sie zusammen. Als sie das Projekt über private Villen-Neubauten im Umland Berlins dem Verleger vorgestellt hatte, war es allen wie ein Selbstläufer vorgekommen. Begeistert hatte sie sich ans Werk gemacht. Wie Fontane auf Wanderung durch Brandenburg waren Anton und sie an den Wochenenden herumgefahren, um Perlen der Architektur zu entdecken, die Anstrengungen wohlhabender Bürger und ihrer Architekten, sich im Umland einen angemessenen Wohnsitz zu schaffen. Sie suchte Unentdecktes, das noch in keinem Architekturführer stand, Häuser, die eben nicht Potsdam und seinen ewigen Klassizismus abbildeten, sondern offene, neue Formen. Frische Ideen für ein altes Land!
Berlin quoll ja über mit kreativen Kräften, die sich auch im Privaten entfalten, Träume vom Wohnen und Leben realisieren wollten. Menschen, die es sich leisten konnten, in echten Formen zu leben. Und es gab sie ja, diese mutigen Bauherren, Anton und sie hatten ein paar davon aufgespürt, Männer und Frauen mit Ideen, Courage und Vermögen, die sich im kargen Umland der Hauptstadt niederließen. Doch wenn sie genauer hinschauten, ging es meistens nur um Anbauten, Renovierungen, Instandsetzungen, Umgestaltungen alter Gutshöfe oder Mini-Schlösser. Riesige Fensterwände wurden in Remisen, Ställe, verwitterte Feldsteinhäuser eingelassen, Flächen wurden zubetoniert, der Chic des Minimalismus ins Innere transportiert. Und obwohl das alles wundervoll stilisierte und zeitgeistige Fotos ergab, obwohl die Beschreibungen sich leicht verfassten und die Bezüge zur Baugeschichte tiefschürfend wirkten, war sie im Grunde ihres Herzens von den Ergebnissen enttäuscht. Alle Bauherren betonten, wie wichtig sie es fanden, das Land mit schönen Bauten zu adeln. Die meisten überließen ihr bereitwillig die Pläne der Architekten, so dass sich der Prozess von der Planung bis zur Ausführung leicht nachvollziehen ließ. All diese wohlhabenden Menschen strebten nach einer Idylle, sehnten sich nach etwas, das sie in ihrem Inneren wiederbeleben sollte. Aber je länger sie sich damit beschäftigte, desto stärker beschlich sie das Gefühl, dass keines dieser Häuser der große Wurf war und dass ihren Bauherren stets etwas Entscheidendes fehlte: der Wille, Landschaft unterzuordnen, statt sich ihr anzupassen. Der Wunsch nach Veränderung. Neue Formen zu finden. Der Antrieb, mächtige Symbole zu erschaffen wie früher die Schlösser, Gebäude, die etwas repräsentieren und darstellen. Was sie bisher an Bauten gesehen hatte, blieb im Grunde genommen schal, mittelmäßig und plump. Geist- und seelenlos. Unter den Bauherren befanden sich anpackende Kreative und CEOs bedeutender Unternehmer, und doch haftete allen auch etwas Bodenständiges an, etwas Niedergedrücktes, etwas Zurückweichendes, etwas Vereinzeltes, als seien die Menschen mit ihrem Bauwerk gerade so weit gegangen, wie es ihnen vertretbar schien. Niemand hatte eine Vision, die er der Umwelt aufdrücken wollte, alle wollten sich einfügen, einnisten in das Land, so wie sie es vorfanden. Alle schienen von der Angst durchtränkt, sie könnten sich mit ihrem Vorhaben blamieren. Etwas zu besitzen, das schlechten Geschmack bewies.
Natürlich, solche Gedanken musste sie von sich fernhalten. Für das Buch musste sie das Optimistische, das Aufbruchhafte, das Bürgerlich-Edle herausstreichen. Dem Image der Hauptstadt und seiner Umgebung gerecht werden. Aber es bereitete ihr mehr und mehr Mühe, diese Verzagtheit in den Bauten – oder was auch immer es genau war, woran sie sich störte – einfach beiseitezuschieben und so zu tun, als sei alles erwähnenswert, aufstrebend und von edlem Geschmack. Und sie fragte sich, wie lange sie diese Lüge noch aufrechterhalten könnte.
Anton gegenüber verbarg sie ihre Zweifel. Ohne ihn wäre das Buch nie so weit fortgeschritten. Seine Spürnase, seine Tipps waren von unschätzbarem Wert geworden. Längst sah sie das Buch als Gemeinschaftsprojekt. Natürlich wusste sie, dass die Arbeit daran für ihn auch eine Art Ablenkung gegen die Unzufriedenheit war, die ihm sein Beruf bereitete. Seit Kurzem war klar, dass er die Leitung der Behörde einem Kollegen überlassen musste. Sie wusste nicht, was genau vorgefallen war, Anton sprach kaum darüber oder behauptete kryptisch, das letzte Hochwasser in der Region sei schuld, denn Keitel habe sich in der Krise bewährt und die Rettungskräfte unterstützt. Er, Anton, dagegen habe die Chance verpasst, sich zu profilieren. Auch wenn sie das Ausmaß seiner Frustration erahnen und nachvollziehen konnte, ärgerte sie sich trotzdem über seine passive Einstellung.
»Zum Glück ist Keitel mir wohlgesonnen«, murmelte er beim Abendessen. »Heute hat er mich zu seinem Stellvertreter ernannt.«
Er klang, als müsse er sich selbst Anerkennung und Trost zusprechen.
»Das ist wohl das Mindeste«, platzte es aus ihr heraus. Sie bereute sogleich ihre Unbedachtheit. »Ich meine, das hast du auf jeden Fall verdient«, schob sie besänftigend hinterher. »Vielleicht sollten wir ihn einmal zum Essen einladen.«
Anton kaute lustlos auf dem Fleisch.
»Stellvertretender Direktor ist gar nicht schlecht«, überging sie sein Schweigen. »Vielleicht kannst du dadurch einfacher ins Ministerium wechseln. Das wünschst du dir schon so lange.«
»Keitel hat auch davon gesprochen. Ich glaube, von uns allen will der am schnellsten weg aus diesem elenden Kasten. Er würde mich mitnehmen, wenn es so weit wäre.«
Wortlos aßen sie zu Ende. Irgendetwas an dem Braten war misslungen, sie merkte es, weil er viel länger kaute als sonst.
»Ist das Fleisch zäh? Ich hätte es länger braten sollen.«
»Nein, schon okay so«, winkte er ab, schnitt mit dem Messer ein großes Stück ab und schob es sich in den Mund.
Sie konnte nicht länger stillsitzen und begann, die Schüsseln zu stapeln.
»Übrigens«, sagte er auf einmal, »habe ich noch ein Haus entdeckt, das in das Buch passen könnte …«
»Wirklich? Wo denn?«, fragte sie neugierig.
»Direkt am Fluss. Hinter dem Damm. Gar nicht weit von dem Kasten entfernt.«
»Wieso hast du mir nicht früher davon erzählt?«
»Weil ich all die Jahre immer durchs Dorf gelaufen bin und es dadurch nicht auf meinem Weg lag. Aber wegen der Überschwemmungen und des Schlamms musste ich jetzt vom Bahnhof über den Damm gehen, um zur Arbeit zu kommen. Und da steht es auf einmal vor mir! Es war wie eine Erscheinung! Dieses Haus ist … wirklich bemerkenswert. Du solltest es dir auf jeden Fall anschauen.«
Sie kannte ihn so gut. Sein Tonfall verriet ihr, dass er das ganze Abendessen über nur ihre Neugier auf das Haus hatte schüren wollen. Mit jedem Satz hatte er auf diesen Bericht über seine Neuentdeckung hingearbeitet. Er senkte den Blick, doch sie erkannte darin das Funkeln in den Augen. Bereitwillig schenkte sie ihm seinen Triumph.
»Erzähl mir davon! Was ist das für ein Haus?«, fragte Elisabeth. »Was ist so bemerkenswert daran?«
Behutsam legte er das Besteck beiseite und fuhr sich mit der Zunge genüsslich über die Lippen. Dann faltete er die Hände auf den Tisch.
»Also«, fing er an.
Es hatte endlos geregnet in jenen Wochen, irgendwann war der Fluss über die Ufer getreten und hatte den Dammabschnitt nördlich des Bahnhofs gebrochen. Halb Lebus wurde von dem reißenden Strom geflutet. Mehrere Häuser waren vom Wasser einfach weggerissen worden oder unter der Gewalt der steten Flut in sich zusammengesackt. Vom höher gelegenen Bahnhof erstreckte sich ein Meer aus Häusern in trüben Gewässern, verzweifelte Menschen winkten von Balkonen, Feuerwehrboote überall, ein Sammelsurium des Elends. Nichts und niemand konnte dem Wasser Einhalt gebieten.
Als die Fluten noch höher stiegen, halfen nur noch Boote, um die Menschen aus den Häusern zu evakuieren und Anton und seine Kollegen vom Bahnhof zu ihrem Arbeitsplatz zu bringen. Feuerwehrmänner und Freiwillige paddelten die Beamten durch die braunen Wasserstraßen. Nur weiter südlich, hinter der Kurve, die der Fluss schlug, hatte der Damm standgehalten. Ging man vom Bahnhof den Damm südwärts entlang, kam man zu einem Wäldchen, dort machte der Weg eine lang gestreckte Kurve, zum Flusslauf parallel, und dahinter, auf der vom Fluss geschützten Seite, tauchte wie aus dem Nichts dieses Haus auf. Ja, es wirkte wie einer Phantasie entsprungen, wie eine Fata Morgana. Die Fluten, der Schlamm und das Geröll konnten ihm nichts anhaben, im Gegenteil. Es wirkte noch erhabener.
Wie ein so schnörkelloser Bau die triste Landschaft verzaubern konnte. Ein zweistöckiger Bungalow in weiß geschlacktem Beton. Glas und Stahlrahmen in lackiertem Schwarz ließen das Haus wie eine geometrische Figur schon von Weitem in der kahlen Morgensonne funkeln. Der Eingangspatio war von einer hohen Mauer umgeben, die Terrassenböden auf der Rückseite aus grau geschlemmtem Beton. Aus dem Inneren strömte warmes Licht, Vorhänge verschatteten die Konturen dahinter. Nach hinten hin öffnete sich das Grundstück, einige wenige einzelne Bäume neigten ihr Blätterwerk, und tatsächlich trennte kein Zaun oder Gemäuer die Grenzen des Grundstücks von dem Weg oder dem Fluss, sondern bloß ein tiefer Graben, der von der Terrasse nicht sichtbar war, so dass man den Blick bis weit über die Grenze nach Polen schweifen lassen konnte, ohne zu ahnen, wo das Grundstück aufhörte. Wie das Haus der Nässe trotzte, wie gleichmäßig der schlanke Edelstahl-Schornstein rauchte und das Licht von drinnen die Wände wärmte. Ein solches Haus strahlte eine Internationalität aus, wie sie hier, am Grenzfluss zu Polen, völlig ungewöhnlich war. Es hätte in einer englischen Landschaftsarchitektur stehen können, auf Long Island, an thailändischen Stränden, in den Sümpfen Floridas oder im afrikanischen Busch, es verströmte etwas so Vertrautes und gleichzeitig so Ungewohnt-Besonderes, dass sogar die dumpfste Landschaft etwas Weltläufiges bekam. Das Haus stand einfach da, in den Flussauen der Odergrenze, und verlieh der Tristheit der Natur Würde und Anmut. Ein Fremdkörper, ein Flecken der Ästhetik in der ewigen Ödnis des Ostens.
Der Mann, der ihnen aufmachte, war um die fünfzig, auch wenn jugendliche Energie aus jeder seiner Bewegungen strömte. Man nahm ihm sofort ab, dass er Chirurg war. Die sanft gebräunte Haut des Ägypters, leuchtende Augen unter buschigen Brauen, fester Händedruck. Funkelnder Blick, glitzernde dunkle Augen. Die Haare streng nach hinten gegelt. In dem Wissen, dass er etwas zu bieten hatte, empfing er sie mit der Neugier eines Gastgebers, der etwas von seinen Gästen wollte, aber noch nicht abschätzen konnte, ob sie bereits ahnten, was. Anton bewegte sich geduckt, huschte hinter Elisabeth her, halb besorgt, halb unbeteiligt. Seine Anspannung war mit Händen zu greifen.
»Und Sie?«, ließ er von Elisabeth ab und verlegte seinen stechenden Blick auf Anton. »Sie schreiben mit an dem Buch, richtig?«
»Ja«, nickte Anton und lief rot an, »wir sind Ko-Autoren.«
Es schien Elisabeth, als wäre er am liebsten weggelaufen.
»Aha. Ko-Autoren«, sagte der Mann verächtlich.
»Wir müssten sowieso noch einmal wiederkommen, um Fotos zu machen«, wechselte Elisabeth schnell das Thema.
»Genau«, bestätigte Anton, »Fotos von innen und von außen.«
Elisabeth strafte ihn mit einem wütenden Blick ab. Er wusste doch, wie sensibel Bauherren reagierten, wenn man ihr Bauwerk ablichten wollte! Sie schüttelte den Kopf und trat hinaus auf die Terrasse. Die Sonne brach durch die dichte Wolkendecke. Der Hauseigentümer folgte ihr, während Anton im Haus blieb, da gerade in diesem Moment sein Handy klingelte und er das Gespräch flüsternd, mit einer Hand vor dem Mund, annahm.
»Ihr Haus ist ein Beispiel für außergewöhnlich mutige Architektur«, lobte Elisabeth. Sie hoffte, ihren Gastgeber damit milde zu stimmen. »Für mich hat es perfekte Proportionen. Überraschend, solche Baukunst in dieser … Umgebung anzutreffen.«
Er schmunzelte, sagte eine Weile nichts.
»Und wo hätten Sie es vermutet?«, fragte er schließlich.
»Vielleicht … in England? Oder in Übersee?«
»Mit England«, er lachte schallend auf wie über einen guten Witz, »könnten Sie recht haben! Ich habe lange in England gelebt. Und ehrlich gesagt, möchte ich eines Tages dahin zurückkehren. Weil ich mich von England her auskenne mit Regen, habe ich den Damm erhöhen lassen und darauf geachtet, dass die Auen nicht bebaut werden. Die Behörden wollten das erst nicht akzeptieren, aber nach der Flut der letzten Jahre sagt keiner mehr etwas. Und jetzt sowieso nicht. Ich verstehe nicht, wie unbeholfen Behörden in diesem Land Jahr für Jahr auf die Überschwemmungen reagieren.«
»Das war sehr vorausschauend von Ihnen«, pflichtete Elisabeth ihm bei. »Mir kommt es auch manchmal vor, als begriffen Menschen hier auch nach Jahrhunderten noch nicht, welche Gefahr ihnen vom Wasser droht. Als vergäßen sie im Sommer die Katastrophen vom Frühjahr einfach und dächten, das Wasser bliebe schon brav im Flussbett und fließe träge dahin wie immer. Dabei gibt es nichts Mächtigeres als Wasser.«
»Wie sind Sie auf mein Haus gestoßen?«, wechselte er abrupt das Thema.
Sekundenlang überlegte sie, was sie antworten sollte. Dann entschied sie sich für die Wahrheit.
»Es ist … Anton aufgefallen. Er arbeitet hier in der Nähe.«
Genau in diesem Augenblick trat Anton zu ihnen auf die Terrasse. Mit gesenktem Blick murmelte er, er müsse zu einem Einsatz fort. Der Hausherr machte ihm mit einem flüchtigen Händedruck klar, wie wenig Wert er auf seine weitere Gesellschaft legte.
»Dann auf Wiedersehen«, sagte er nur. »Sie finden sicher alleine hinaus.«
»Natürlich«, nickte Anton, warf Elisabeth einen vielsagenden Blick zu und ging. Der Hausherr strich mit dem Zeigefinger um das Kinn.
»Und Sie sind wirklich Ko-Autoren?«, fragte er, als Elisabeth und er wieder allein waren. »Sie wirken gar nicht wie ein … Team.«
»Doch, doch«, bestätigte Elisabeth. »Ohne seine Unterstützung hätte ich das Material nie zusammentragen können.«
»Ich heiße Hanif«, sagte er unvermittelt und streckte ihr die Hand entgegen.
Überrumpelt von seiner plötzlichen Offenheit, reichte sie ihm zögerlich die Hand.
»Elisabeth.« Es fühlte sich wie ein Geständnis an.
Er fixierte sie, bis sie es nicht mehr aushielt und seinem Blick auswich.
»Dein Mann arbeitet als Beamter, sagst du?«
»Anton und ich«, räusperte sie sich, »wir sind nicht verheiratet.«
Hanif überhörte das Unbehagen in ihrer Stimme.
»Wieso kennt er sich so gut mit Häusern aus? Ist er bei der Baubehörde?«
»Nein, nein.« Sie lächelte und schüttelte gleichzeitig den Kopf. »Er arbeitet bei der Finanzverwaltung. Häuser sind nur sein Hobby. Was Architektur angeht, ist er völliger Laie, aber tatsächlich stammen die meisten Einfälle für das Buch von ihm. Vieles, was heute gebaut wird, wird in der Fachöffentlichkeit ja gar nicht erwähnt. Viele Bauherren haben kein Interesse daran, ihr Haus in Zeitschriften zu präsentieren, weil sie den Neid der Nachbarn und Konkurrenten fürchten. Man stößt oft nur durch Zufall darauf. Man muss herumfahren und sich umsehen. Man ist auf Entdeckungen angewiesen, die Bauherren selbst zeigen nur ungern, was sie haben. Und Anton kommt durch seinen Beruf viel herum …«
»Neid ist ein Grundübel in diesem Land«, stimmte Hanif zu. »Ich lade so gut wie nie Leute zu mir ein. Die Nachbarn kenne ich bis heute nicht. Ich weiß nichts von ihnen, und sie wissen nichts von mir. Sie verhalten sich feindselig. Wenn sie könnten, würden sie mich vertreiben, für sie bin und bleibe ich der dreckige Ausländer.«
»Das ist beschämend«, flüsterte Elisabeth.
Einen Moment schwiegen sie und blickten beide hinüber zum Fluss.
»Vielleicht könnte ich bei Gelegenheit einmal die Baupläne einsehen?«, kehrte Elisabeth schließlich zum Grund ihres Besuchs zurück. »Ich mache das bei allen Häusern so.«
Hanif machte ein undefinierbares Geräusch. Die Bitte schien ihm nicht zu gefallen. Schließlich rang er sich zu einem Nein durch, und es dauerte eine Weile, bis er eine Erklärung nachschob.
»Ich gebe Pläne grundsätzlich nicht heraus! Aus Furcht vor … Kopisten.«
Die Stimmung war eindeutig gekippt, er klang gereizt, und alles Flirten und Sonore schien aus seiner Stimme verbannt. Wieder fixierte er Elisabeth mit diesem stechenden Blick. Er schien darauf zu setzen, dass niemand ihm standhielt. Doch weil sie ihm diesmal nicht auswich, murmelte er etwas von den nervenaufreibenden Genehmigungsverfahren und dass er sich geschworen habe, das ganze Zeug nie wieder anzurühren und durchzusehen.
»Das respektiere ich natürlich«, sagte sie verständnisvoll. »Im jetzigen Stadium ist es auch nicht entscheidend. Aber vielleicht können wir bei anderer Gelegenheit noch einmal darüber sprechen?«
Als er sie zur Tür brachte, stellte sie verwundert fest, dass draußen vor dem Eingang ziemlicher Betrieb herrschte: Paketboten, Gärtner, einige finster aussehende Gestalten in schäbigen Anzügen. Hatte sie das Klingeln überhört? Hanif signalisierte ihnen mit einer Handbewegung, dass er gleich Zeit für sie hätte.
Er benimmt sich wie eine Majestät, dachte sie erstaunt, bereit für die nächste Audienz.
Plötzlich griff er nach ihrer Hand und rückte ganz dicht an sie heran. Sein Daumen streichelte über ihren Handrücken.
»Wir sollten uns wiedersehen! Nur wir beide.«
»Ja«, flüsterte sie irritiert und zog hastig die Hand aus der Umklammerung. »Ja, das sollten wir. Gerne.«
In den fünf Jahren auf dem Amt hatte es nur drei Einsprüche gegen sein Vorgehen gegeben. Das war der Grund, weshalb sie ihn auf die Jagd nach »dicken Fischen« schickten und er einen eigenen Mitarbeiterstab bekam. Anton konnte so den Papierkram delegieren, denn das Herumstochern in Akten wurde mehr und mehr zur Qual. Die ganze Arbeit war ihm ja zunehmend fremd geworden: Leuten nachzustellen, deren Mentalität, deren innerer Antrieb ihm unbegreiflich waren. Manchmal kam er sich wie eine Figur in einem absurden Theaterstück vor. Früher hatte er sich eingeredet, die Verdächtigen handelten aus Gier, aus Schlamperei oder aus niederen kriminellen Instinkten, aber je länger er dabei war, desto unklarer wurden ihm ihre Motive. War es ein Sog, aus Schlampigkeit, Unwissenheit oder aus einer Art Hass auf die Steuerbehörden, Verachtung oder Unwille, eine unausrottbare, instinktive Abneigung gegen Institutionen? Jedenfalls, je öfter er dieses Verhalten beobachtete – in jeder Alltagshandlung, in der Bürger dem Staat Steuern vorenthielten, in tausenden von Varianten, als sei es etwas den Menschen seit allen Zeiten Innewohnendes, Steuern nicht zu zahlen –, desto mehr billigte er es und desto mehr Verständnis empfand er für die Täter. Es schien ein Ur-Bedürfnis der Menschen zu sein, dem Staat nicht zu viel abzugeben von dem, was man hatte. Warum jagte er also diese Menschen? Er konnte so gut nachempfinden, was in den Menschen vorging, und er fühlte, dass auch er diesen Unwillen, einem unfreundlich gesinnten Staat etwas abzugeben, in sich trug. Diese latente Wut auf ein behauptetes Gemeinwesen, das einem mit Gewalt droht, wenn man nicht zahlt. Manchmal ertappte er sich dabei, wie ihn die Methoden, mit denen sie den Tätern nachspürte, offen anwiderten. Hätte er genügend Geld gehabt, würde er wahrscheinlich ebenfalls um alles in der Welt Steuern vermeiden wollen.
Was war er denn schon anderes als ein Rädchen im Vollstrecken des Staatswillens? Einer, der den Steuerpflichtigen Angst einjagen sollte. Wem schadeten diese Menschen denn? Dem Gemeinwesen? Was sollte das denn bitte sein, das Gemeinwesen? Der Staat verschleuderte Milliarden, unzählige seiner Beamten waren faul oder korrupt. Wieso sollte er Menschen, die bloß etwas verschwiegen, gleich wie Kriminelle ächten? Seine Selbstzweifel waren mit jedem Jahr größer geworden. Seit einigen Monaten beobachtete er an sich diese Rastlosigkeit, eine Unruhe, wie er sie noch nie erlebt hatte, eine unvorstellbare Angst, er könnte eines Tages aufwachen und erkennen, dass er all die Jahre auf der falschen Seite gekämpft hatte.
Und seit ein paar Tagen war er felsenfest davon überzeugt, dass es so war.
Antons sogenanntes Team bestand aus sieben Beamten: mit ihm drei Sachbearbeiter, eine Sekretärin sowie zwei ehemalige Bundesgrenzschützer, die die »Eisbrecher« bei Durchsuchungen gaben und Verdächtige durch ihr ruppiges Auftreten derartig einschüchterten, dass viele umgehend ein Geständnis ablegten.
Als Keitel ihm den Fall des Windkraftunternehmers Pollach übertrug, fühlte er wieder diese Unruhe in sich. Der Typ hatte seit Jahren keine Steuern mehr bezahlt, mit schriftlichen Drohungen hatten sie bisher nichts erreicht. Also rückten sie frühmorgens zum Einsatz aus. Die Klinkervilla, auf pompös und reich gemacht, tauchte irgendwo in der üblichen Nebelsuppe vor ihnen auf. Schon als sie sich dem Haus näherten, ahnte er, was für ein geschmackloser Blender dieser Kerl sein musste. Der schwitzenden Erscheinung sah man an, dass er kurz vor der Pleite stand. Sein Blick flackerte unruhig von einem Punkt zum nächsten. Sein Gesicht wirkte fahl, der Ausdruck darin irgendwie erloschen, weit entfernt. Wenn er sprach, rann ihm ein Schleimfaden aus den Mundwinkeln. Wie schafften es solche Typen bloß immer wieder, dass andere ihnen auf den Leim gingen? Anton leierte die Belehrung herunter und verlangte, dass er und sein Team eintreten dürften. Pollach zögerte einen Moment, als überlege er, ob er nicht einfach die Tür vor ihnen zuschlagen und fliehen könne. Sorgfältig studierte er den Ausweis, den Anton ihm vor die Nase hielt.
»Herr Kern! Ich … ich habe Sie erwartet«, stammelte er. »Im Grunde bin ich froh, dass Sie kommen. Sie müssen mir helfen! In dieser Krise müssen Staat und Unternehmer zusammenhalten.«
»Zusammenhalten, Herr Pollach? Ich kümmere mich nur um Ihre Steuern. Und die haben Sie nicht abgeführt. Lohn-, Körperschafts- und Umsatzsteuern. Nicht einmal Erklärungen haben Sie abgegeben. Sie wissen, dass ein Finanzamt irgendwann keinen Spaß mehr versteht.«
Pollach presste eine Hand fest auf die Brust.
»Lassen Sie doch den Quatsch«, grunzte er. »Begreifen Sie nicht, was hier abgeht? Wenn Sie mich hochgehen lassen, geht die ganze Region den Bach runter! Wissen Sie, wie viele Arbeitsplätze an meinen Unternehmen hängen? Wollen Sie das wirklich verantworten? Ich habe einflussreiche Freunde, Herr Kern, vergessen Sie das nicht! Alles, was ich von Ihnen verlange, ist Zeit. Wollen Sie mich lieber fertigmachen? Mann, denken Sie nach!«
»Wir wenden nur die Gesetze an, Herr Pollach. Wir sind das Gesetz.«
»Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen!«
Auf seiner Stirn perlte der Schweiß, als wären es vierzig Grad im Schatten. Die wulstigen Nackenfalten glänzten klebrig. Das Hemd war schweißdurchtränkt. Seine ganze Existenz bestand aus Schweiß. Anton wusste, der Mann war kriminell und gerissen. Dass er jetzt um Mitleid flehte, war Teil der immer wiederkehrenden Masche solcher Leute.
»Ich sage Ihnen was«, grunzte Pollach und fuchtelte mit dem Finger durch die Luft, »wenn Sie mich hochgehen lassen, werden Sie persönlich dafür büßen! Das schwöre ich!«
Er torkelte und stützte sich an einem Möbelstück ab.
»Kommen Sie! Drücken Sie ein Auge zu«, japste er. »Ich zahle, sobald ich wieder liquide bin. Und in der Zwischenzeit werde ich mich für Ihre Geduld erkenntlich zeigen. Ich weiß viel mehr über Sie, als Sie vermuten, Kern!«
»Was wissen Sie über mich?«
»Sie sind ein Mann mit hohen Ansprüchen, Herr Kern, nicht wahr? Mit Bedürfnissen. Da ist das Gehalt eines einfachen Beamten oft hinderlich. Ist es nicht so? Kommen Sie denn mit Ihrem Verdienst aus?«
Als Beamte für Spezialeinsätze hatte man sie für solche Situationen geschult. Sie wussten, dass Steuerbetrüger wie Pollach mit allen Mitteln kämpfen würden, um einer Bestrafung zu entgehen. Dennoch war Anton einen Moment lang konsterniert.
»Die Menschen aus der Region lieben mich«, fuhr Pollach fort, der die Irritation im Gesicht seines Gegenübers instinktiv erfasst hatte. »Ich bin einer von ihnen. Die gehen für mich auf die Straße! Die hassen den Staat! Lassen Sie es nicht darauf ankommen, helfen Sie mir lieber! Was haben Sie sich schon immer gewünscht? Haben Sie eine Geliebte? Möchten Sie ihr nicht einmal etwas Besonderes schenken? Etwas, das Sie von Ihrem Gehalt bisher nicht bezahlen können?«
»Hören Sie auf damit.« Anton drängte sich energisch an ihm vorbei und betrat das Arbeitszimmer, wo sein Team bereits die Hälfte der Unterlagen eingepackt hatte. »Wir vollstrecken hier nur das Gesetz.«
Er stieß wütend den nach Luft japsenden Mann zur Seite und raunzte den Kollegen zu, sie sollten besonders gründlich vorgehen. Doch tief in seinem Innersten nagten wieder diese Zweifel an ihm. Was er hier tat, wollte er nicht mehr tun, mochte der Kerl ihm auch noch so unsympathisch sein. Sein Beruf widerte ihn an. Und für einen kurzen Augenblick glaubte er, er müsse sich auf der Stelle übergeben. Doch was da aus seinem Magen die Speiseröhre hochstieg wie nach einem verdorbenen Essen, das waren keine halb verdauten Speisereste. Sondern Ekel.
Du hast nichts falsch gemacht.«
Elisabeth nahm ihn tröstend in den Arm. Er aber wand sich aus der Umarmung, ging zum Fenster und starrte hinaus.
»Gestern Abend hat er sich erhängt«, flüsterte er unter Tränen. »Sie haben ihn in seinem erbärmlichen Klinkerbau gefunden! Und morgen steht es in allen Zeitungen: ›Von der Steuerfahndung in den Selbstmord getrieben!‹ Die Menschen werden uns noch mehr hassen! Wir haben doch jetzt schon Angst, durchs Dorf zum Bahnhof zu laufen. Und nach dieser Sache wird es richtig gefährlich für … mich.«
»Du weißt nicht, ob dieser Selbstmord überhaupt etwas mit den Steuern zu tun hat! Vielleicht wollte er sich schon lange diesem enormen Druck … entziehen?«
Es fiel ihr schwer, ihn zu beruhigen, die Sache herunterzuspielen, ihm zu sagen, es sei alles nicht so schlimm. Denn im Grunde teilte sie sein Entsetzen: Der Mann hatte sich wegen des Besuchs der Finanzbeamten umgebracht. Es war klar, dass die Presse das Ganze zu einem Skandal aufbauschen würde, durch den das schlechte Image der Behörde noch weiter abzusacken drohte. Und natürlich würden sie innerhalb der Behörde versuchen, einen Sündenbock zu finden.
»Du wirst das wieder geraderücken, da bin ich sicher«, schob sie hastig hinterher. »Mach dir keine Sorgen. Es kommt alles wieder ins Lot. Und jetzt vergiss die Arbeit einmal. Ich habe mit dem Verleger wegen deines Vorschlags gesprochen. Er ist begeistert von dem Haus. Er hat bereits einen Termin mit dem Fotografen ausgemacht. Du hast mal wieder die richtige Spürnase bewiesen.«
Anton drehte sich zu ihr um, langsam, als erkenne er irgendwo in der Ferne einen Funken Hoffnung für sich.
»Wirklich? Wann soll das stattfinden?«
»Donnerstagvormittag. Könntest du dabei sein? Ich würde dich von der Arbeit abholen.«
»Donnerstag? Ja, das könnte klappen«, nickte er. »Aber dieser Hanif Amid ist ein schmieriger Typ, findest du nicht?«
»Er hat sich hochgearbeitet. Er hat Medizin studiert und sich hochgearbeitet. Ein weiter Weg für einen Schafhirten aus Ägypten bis zum Chirurgen in Deutschland, meinst du nicht? Was findest du daran schmierig?«
Anton zuckte mit den Schultern und senkte den Blick.
»Du bist in Gedanken immer noch bei diesem Pollach, stimmt’s?«, meinte Elisabeth kopfschüttelnd. »Glaub mir, übermorgen jagen sie eine andere Sau durchs Dorf. Solche Dinge versanden. Es wird nicht so schlimm, wie du fürchtest.«
Sie versuchte noch einmal, ihn zu berühren, zu trösten. Wieder wehrte er sie ab. Etwas Raues, Brutales lag in der Geste. Immer öfter kroch diese Anspannung in ihre Unterhaltungen, schuf Momente, in denen Kleinigkeiten genügten, um den anderen zu verletzen. Es hatte schleichend begonnen. Eine latente Aggression lag zwischen ihnen wie eine unsichtbare Mauer. War sie daran schuld, weil sie nach und nach alle Hoffnungen in ihre Beziehung hatte fahren lassen? Weil es diese Lebens-Sicherheit, in der sie sich wähnte, gar nicht gab? Viel zu naiv hatte sie geglaubt, dass er sich als Beamter in diplomatische oder europäische Institutionen versetzen lassen könne, einfach so, nach Washington, Paris, London. In Städte, die sie in den Ferien besucht hatten, um Pläne zu schmieden, wo es sich am schönsten wohnen ließe. Wie naiv war sie gewesen! Irgendwann hatte sie begreifen müssen, dass es niemals dazu kommen würde: als Anton bei der Steuerfahndung in einem Kaff an der polnischen Grenze gestrandet war. Inzwischen galt es für sie als Highlight, zur Weihnachtsfeier ins Potsdamer Ministerium eingeladen zu werden. Er könnte von Glück reden, sollte ihm eines Tages der Sprung dorthin gelingen. Wenigstens etwas.
Natürlich war sie enttäuscht von seiner Karriere, und natürlich blieb es an ihr hängen, ihm die Enttäuschung auszureden, Tag für Tag. Zumindest, tröstete sie sich, war es keine plötzliche Erscheinung, es hatte sich nach und nach so ergeben, irgendwann war die Realität einfach eine andere, und weil ihre eigenen Buchprojekte und Aufträge sie mit vielen interessanten Persönlichkeiten zusammenführten, fiel es ihr nicht zu schwer, den ursprünglichen Traum aufzugeben. Sie redete sich ein, für Unzufriedenheit keinen Platz in ihrem Leben zu haben, und dachte kaum noch an die vielen vertanen Chancen. Doch seit diesen Zwischentönen in ihren Gesprächen, seit er aus heiterem Himmel aufbrauste und Vorwürfe auf sie niederprasseln ließ, lag sie oft nachts wach und zweifelte an ihrer Beziehung. Dieses Leben mit Anton – war es nicht eine Sackgasse? Es hatte sich wie ein Gift in ihre Gedanken eingeschlichen. Immer öfter ertappte sie sich dabei, wie sie sich ausmalte, was passieren würde, wenn …
Mit Leonies Vater hatte sie das schon einmal durchlebt. Bis heute war da dieser bittere Nachgeschmack, der Trennung damals war ein harter Kampf vorausgegangen. Er und sie hatten einen großen Freundeskreis gehabt, aber mit der kleinen Leonie hatte sie den Kontakt zu ihrem damaligen Umfeld bald verloren. Anders als ihre Freunde hatte sie auf einmal keine Zeit mehr für Kurzurlaube, Nächte in Clubs oder Abenteuer. Und Leonies Vater hatte sich bestenfalls noch um die Tochter gekümmert, aber nicht mehr um sie. Als sie sich schließlich trennten, gab es nicht einmal Streit, so erschöpft, so betäubt hatte sie sich gefühlt.
Eine Trennung von Anton würde vermutlich viel kälter über die Bühne gehen als die Trennung von Leonies Vater. Anton und sie, sie hatten nie an gemeinsame Kinder gedacht. Anton hatte Leonie zwar stets fair behandelt, aber blieb immer wie ein Unbeteiligter. Niemals wäre ihm der Gedanke gekommen, er könne ihr ein Vater sein. Seit Leonies Pubertät war diese Fairness, dieses Auf-Distanz-Halten immer schroffer geworden, Leonie hatte darunter gelitten, auch wenn sie nie ein Wort darüber verlor. Andererseits, vielleicht wäre es noch viel schlimmer gewesen, wenn er sich als ihr Vater aufgespielt und durchgegriffen hätte. Nein, für die Erziehung ihrer Tochter blieb allein sie zuständig. Vielleicht war es ein Glück, dass Leonie jetzt ausgezogen war. So konnten sie sich wieder auf sich konzentrieren. Doch sie spürte, die Leichtigkeit von früher, sie käme nicht zurück.
Hing es mit dieser latenten Erschöpfung zusammen, die inzwischen manchmal den ganzen Tag wie ein Bodennebel in ihrem Kopf hing? Die sie wie ein Migräne-Anfall überfiel, wie die Betäubung einer Spritze, die so plötzlich wirkte, dass sie sich setzen und durchatmen musste, um nicht einzuschlafen. Die ihr manchmal wie ein Vorbote einer ernsthaften Erkrankung vorkam (einer Erkrankung, die ihr Hausarzt nicht feststellen konnte und bloß einen »allgemeinen Erschöpfungszustand« diagnostizierte). Was bedeutete das schon: Erschöpfungszustand? Sie wusste genau, was sie an diesem Zustand so erschöpfte: Sie kam sich nicht mehr attraktiv vor, auch wenn sie seit ihrem vierzigsten Geburtstag vor zwei Jahren auf bessere Kleidung und Make-up Wert legte. Was war los mit ihr? Sie hatte so vieles, um glücklich zu sein, und schaffte es doch nicht. Übersprang diese Hürde aufgetürmter Hindernisse nicht. Manche Augenblicke, mit Anton oder allein, waren voller Schwingung und Erleichterung, hinterher konnte sie gar nicht fassen, wie erfüllt alles gewesen war. Aber dann, im Alltag, flachte alles schnell wieder ab. Das Buch über die Häuser wollte nicht recht vorankommen, auch wenn der Verleger ihr versicherte, sie müssten nur noch dieses eine Haus fotografieren, dann ginge alles in Druck. Sie hatte den Donnerstagvormittag ausgewählt. Donnerstag, weil dieser arrogante Typ ihr getextet hatte, an diesem Tag sei er nicht zu Hause, und wenn es sich partout nicht verschieben lasse, würde er dafür sorgen, dass jemand da sei.
Sie wollte ihm auf keinen Fall ein zweites Mal begegnen. Seit der Hausbesichtigung hatte er sie mit Textnachrichten überhäuft. Zuerst hatte sie geglaubt, es seien Werbetexte, Dinge, die sich gar nicht speziell an sie richteten, Informationen über seine Praxis und über die neuesten chirurgischen Methoden, mit denen er und seine Kollegen an Frauen herumoperierten, über Cool Sculpturing und diverse Lasertechniken. Wahrscheinlich hatte er sie einfach auf seinen Verteiler gesetzt. Aber dann, gestern, kam statt einer weiteren dieser sinnfreien und seltsam anmutenden Nachrichten eine SMS, die unzweifelhaft nur an sie gerichtet war:
Lass uns treffen! Nur wir beide!
»Auf mich wirkt er finster«, hörte sie wie von fern Antons Stimme.
»Was sagst du?«, fragte sie verschreckt, als hätte er sie bei etwas ertappt.
»Dieser Chirurg, dem das Haus gehört. Auf mich wirkt er finster.«
Sie konnte ihm nicht in die Augen sehen. Sie fühlte sich, als habe er ihre Gedanken gelesen und ihre geheimsten sexuellen Phantasien enttarnt.
»Wenn du magst«, wechselte sie schnell das Thema, »könnten wir deinen Chef kommende Woche zum Essen einladen. Er wohnt doch in Berlin, oder?«
»Aber er ist mein Vorgesetzter.«
»Umso besser, wenn du ihn einlädst! Ist er verheiratet?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Hat er einen Partner?«
»Willst du sagen, er sei schwul?«
»Es wäre nur normal, dass er mit jemandem zusammenlebt.«
»Das wäre mir neu. Ich habe noch nie darüber nachgedacht.«
»Isst er Fleisch?«
Doch Anton schien gar nicht zuzuhören und in seinen Gedanken verloren.
»Wie bitte?«, meinte er nach einer Weile.
»Ich habe gefragt, ob Keitel Vegetarier ist.«
»Woher soll ich das denn wissen?« Aufgebracht durchschnitt er mit der Hand die Luft, als könne er so die lästige Frage verscheuchen. »Nein, nein, ich glaube nicht!«
Da war sie wieder, dieser kalte, grundlose Zorn. Dieses Aufbrausen. Elisabeth erstarrte.
Wutschnaubend kam er auf sie zu.
»Was stellst du mir für blöde Fragen!«, brüllte er sie an. »Was macht es zum Teufel noch mal für einen Unterschied, ob jemand Fleisch isst oder nicht?«
Der Verleger hatte vorgeschlagen, dass Elisabeth Anton abholen solle, während er mit dem Fotografen sofort zum Haus führe. Jetzt wartete sie im Auto auf dem Parkplatz vor dem Kasten und textete Anton eine SMS, er möge herunterkommen. Den Kasten