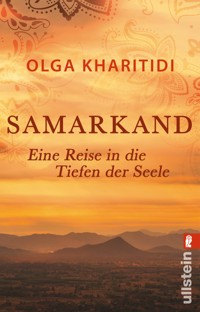13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sibirien; Anfang der neunziger Jahre: Die russische Ärztin Olga Kharitidi verläßt ihre Klinik in Nowosibirsk, um mit ihrer kranken Freundin Anna in das Altai-Gebirge zu den dort lebenden Schamanen zu reisen. Nach einem stundenlangen Marsch in den tiefverschneiten Bergen Sibiriens erfahren die beiden erschöpften Frauen, daß vielleicht alle Mühen der Reise umsonst waren: Die KAMS – so nennen sich die Schamanen im Altai – leben fernab von jeder Zivilisation und meiden das Zusammentreffen mit Fremden. Umso spannender wird es für Olga und Anna, als ihnen schließlich doch Eintritt in die verborgene Welt der letzten sibirischen Schamanen gewährt wird. Die Heilerin Umaj wird Olgas große Lehrmeisterin. Sie läßt die junge, modern Wissenschaftlerin teilhaben an ihrer uralten geheimen Weisheit. In ihrem Buch enthüllt Olga Kharitidi die Geheimnisse einer jahrtausendealten Kultur und berichtet von den erstaunlichen Erfolgen ihrer spirituellen Neuorientierung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Sibirien, Anfang der neunziger Jahre: Die russische Ärztin Olga Kharitidi verläßt ihre Klinik in Nowosibirsk, um mit ihrer kranken Freundin Anna in das Altai-Gebirge zu den dort lebenden Schamanen zu reisen. Nach einem stundenlangen Marsch in den tiefverschneiten Bergen Sibiriens erfahren die beiden erschöpften Frauen, daß vielleicht alle Mühen der Reise umsonst waren: Die KAMS – so nennen sich die Schamanen im Altai – leben fernab von jeder Zivilisation und meiden das Zusammentreffen mit Fremden. Um so spannender wird es für Olga und Anna, als ihnen schließlich doch Eintritt in die verborgene Welt der letzten sibirischen Schamanen gewährt wird. Die Heilerin Umaj wird Olgas große Lehrmeisterin. Sie läßt die junge, moderne Wissenschaftlerin teilhaben an ihrer uralten geheimen Weisheit. In ihrem Buch enthüllt Olga Kharitidi die Geheimnisse einer jahrtausendealten Kultur und berichtet von den erstaunlichen Erfolgen ihrer spirituellen Neuorientierung.
Die Autorin
Olga Kharitidi wurde in Sibirien geboren, studierte in Nowosibirsk Medizin und arbeitete dort als Psychiaterin. Auf ausgedehnten Studienreisen erforschte sie die alten Heilungsmethoden Sibiriens und Zentralasiens und konnte so eine neue Methode zur Heilung psychischer Traumata entwickeln. Heute ist sie praktizierende Psychiaterin in den USA, hält weltweit Workshops und Vorträge zum Thema »Trauma-Umwandlung« und lebt in Minneapolis. Das weiße Land der Seele wurde ein Bestseller.
In unserem Hause ist von Olga Kharitidi bereits erschienen:
Samarkand
Olga Kharitidi
Das weiße Land der Seele
Aus dem Englischen von Sabine Schulte
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 1. Auflage Dezember 2005 7. Auflage 2011 © für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005 © für die deutsche Ausgabe 1996 Paul List Verlag GmbH & Co. KG, München © 1996 Olga Kharitidi Titel der amerikanischen Originalausgabe:Entering the Circle (HarperSanFrancisco [HarperCollins Publishers Inc.], San Francisco) Umschlaggestaltung: zero-media.net, München eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck eBook ISBN 978-3-8437-0187-7
Anmerkung der Autorin
Dieses Buch ist ein wahrheitsgemäßer autobiographischer Bericht über einen Abschnitt meines Lebens. Eine merkwürdige Verkettung von Umständen führte mich damals fort von meiner Arbeit in einer psychiatrischen Klinik in Nowosibirsk, Sibirien, hin zu einer Reihe von schamanischen Erfahrungen und Offenbarungen in die von alters her geheimnisvolle Gegend des Altaigebirges. Die Ereignisse haben sich, mit geringfügigen Ausnahmen, so zugetragen, wie sie in diesem Buch geschildert werden. Ich habe nur wenige Veränderungen vorgenommen, um die Intimsphäre von Familienmitgliedern und Freunden zu schützen. Alle kursiv gesetzten, im Präsens verfaßten Passagen stammen direkt aus meinen Tagebüchern. Die Dialoge habe ich mir eingeprägt und dann später so wahrheitsgetreu wie möglich niedergeschrieben.
Die Zeichnungen im Buch geben – stilisiert – Tätowierungen auf einer Mumie wieder, die in einem uralten Grab im Altaigebirge gefunden wurde, und zeigen andere Kunstgegenstände aus eben diesem Grab.
Olga Kharitidi
Wenn es in unserem Universum jemals etwas gegeben hat
Wenn in den Winden,
In den Bäumen oder Büschen etwas war,
Das aussprechbar war und das die Tiere einst mitanhörten,
Laß dieses heilige Wissen zu uns zurückkehren.
ATHARWAWEDA
(VII –66)
Die Überlieferung besagt, daß diese Hymne als Sühne vorgetragen wurde von jenen, die glaubten, heiliges Wissen unter unrechten Bedingungen weitergegeben zu haben.
Prolog
Endlich hörte der Regen auf, und die Wolken zogen weiter, fortgeweht von kräftigen Ostwinden. Draußen hatte sich der Straßenlärm gelegt, und es war schon fast dunkel. Durch die offene Balkontür trug der frische Wind den angenehmen Geruch von nassen Blättern und feuchtem Asphalt in meine Wohnung.
Ich schaltete das Licht aus und trat auf den Balkon, um einen letzten Blick auf den Abendhimmel zu werfen. Die ganze Stadt lag vor mir und sah aus wie ein ungeheuer großes Passagierschiff, dessen Bullaugen hell erleuchtet waren. In Wirklichkeit war diese riesige, funkelnde Stadt jedoch nur ein kleiner Erdensplitter, ihre Lichter ein Nichts gegenüber den Tausenden von glitzernden Sternen, die über mir in der klaren, friedlichen Nacht erstrahlten.
Als ich dort am Geländer meines schmalen Balkons stand und die milde, duftende Luft einatmete, sah ich, daß ein Stern plötzlich größer und heller wurde als alle anderen. Der Himmel schien aufzureißen, in einem gewaltigen Wirbel, so, als würde der Trichter eines riesigen Tornados auf mich zurasen, bis er mein Gesichtsfeld ausfüllte.
Ich spüre, wie sich mir eine ungeheure, unbekannte Kraft nähert, und ich weiß, daß ich wieder einmal an einen anderen Ort, in eine andere Zeit gerufen werde. Es ist zu spät, um zu fliehen oder Angst zu empfinden. Das Ungewöhnliche ist mir inzwischen allerdings auch so vertraut, daß ich mich vielleicht selbst dann nicht fürchten würde, wenn ich Zeit dazu hätte.
Augenblicklich verändert sich die Szenerie. Eben noch war der klare Nachthimmel über mir, jetzt füllt helles Sonnenlicht mein Gesichtsfeld aus. Ich schwebe hoch über der Erde, über einem Ort, den ich noch nie gesehen habe. Mein Verstand arbeitet jetzt anders, als wäre ich ein neuer Mensch und hätte keine Erinnerung an die Vergangenheit. Ich habe keine Angst, ich bin aufmerksam und empfänglich. Ich weiß, daß ich aus einem bestimmten Grund hierhergebracht wurde. Diesem Wissen vertraue ich und warte.
Als ich mich dem Erdboden nähere, sehe ich eine grasbewachsene Ebene unter mir. Das Gras ist frühlingsgrün, es steht hoch, ist voll von jungem Leben und neigt sich im Wind. Ich rieche den Duft der Wiese, und diese rein körperliche Wahrnehmung hilft mir, alle anderen Gedanken fallenzulassen und mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.
Plötzlich erregt lautes Trommeln rechts von mir meine Aufmerksamkeit. Mein Geruchssinn hat mir bereits einen Zugang zu diesem mir unbekannten Ort geschaffen, jetzt verdichtet mein Gehörsinn das Wahrnehmungsnetz. Mein Körper bewegt sich mühelos in der Luft, ich wende mich nach rechts und folge dem Klang der Trommelschläge. Die Szene, die sich mir darbietet, ist so phantastisch, daß ich sie mir niemals hätte ausdenken können.
Zehn Männer im Alter zwischen fünfundzwanzig und vierzig Jahren tanzen unter mir im Kreis. Sie tragen das Haar zu langen Pferdeschwänzen zusammengebunden. Ihre Kleidung erscheint mir fremdartig: gedämpfte, weiche Erdtöne, verziert mit geometrischen Mustern, noch nie habe ich etwas Derartiges gesehen. Das Trommeln geht ununterbrochen weiter. Die Bewegungen der Männer sind anmutig, und doch liegt in ihrem Tanz eine unverkennbare Dringlichkeit. Als ich mich nähere, um sie besser sehen zu können, erkenne ich, daß in der Mitte des Kreises eine junge Frau liegt. Die Männer bewegen sich im Tanz um sie herum, umkreisen sie mit einem Ausdruck höchster Konzentration auf den Gesichtern. Außer dem gleichmäßigen Klang der Trommel ist kein Geräusch zu hören.
Zuerst verstehe ich nicht, warum die Männer mir so ungewöhnlich erscheinen. Als ich dann aber die Einzelheiten der Szene wahrnehme, wird mir klar, daß ihre Gesichter eine Bewußtheit und eine Verbundenheit mit dem Geschehen ausdrücken, die die Menschen in unserer modernen Welt verloren haben. Ich begreife, daß sie Geschöpfe einer längst vergangenen Zeit sind, ich weiß, daß ich etwas miterlebe, das vor vielen tausend Jahren geschehen ist.
Immer noch schwebe ich über dem Kreis der Tänzer, bewege mich nun langsam abwärts, um herauszufinden, warum ich hier bin. Während ich hinunterschwebe, wird die Frau, um die sich Tanz und rhythmisches Trommeln drehen, deutlicher sichtbar. Ihre leblose Gestalt ist unglaublich schön. Die Einfachheit ihres gelbgrauen Gewandes steht im Gegensatz zu dem üppigen Schmuck, der ihren Hals und das Oberteil ihres Kleides ziert. Die Ketten sind zwar primitiv gearbeitet, aber die Edelsteine, die darin glitzern, sind von erlesener Qualität. Ich weiß, daß die Frau gerade erst gestorben ist.
Ich versuche, mir ein Bild von dem zu machen, was hier vor sich geht und was ich hier tun soll, und sehe mich um. Mein Blick wird von einer alten Frau angezogen. Sie sitzt auf einer kleinen Holzkiste neben einem jurteähnlichen Zelt mit einem Spitzdach aus Grasgeflecht. Sie raucht Pfeife und blickt ständig zwischen dem Kreis der Tänzer und dem Himmel hin und her. Ihre Aufmerksamkeit ist überall gleichzeitig. Man würde ihr physisches Alter auf etwa hundert Jahre schätzen, ihre Erscheinung jedoch ist alterslos. Die Haut der Frau ist dunkel und von Falten gezeichnet, gefärbtem Pergament vergleichbar, das viele Leben lang ständiger Sonne ausgesetzt gewesen ist. Ihre Augen sind schmal, wie die vieler Mongolen. Sie verengen sich zu Schlitzen, wenn die Alte blinzelnd an ihrer Pfeife zieht.
Ihre Rolle in dieser Zeremonie ist unabhängig von den körperlichen Bewegungen der anderen. Der Rhythmus, den ihr Wesen ausstrahlt, ist viel langsamer als der der Tänzer. Sie atmet ruhig, und manchmal hebt sie den Kopf langsam zum Himmel, als würde sie etwas erwarten. In dem Augenblick, als ich das denke, blickt sie mich an, und ich weiß, daß sie mich gesehen hat. Es liegt eine Kraft darin, von dieser Frau erkannt zu werden, und es ruft eine eigenartige Mischung aus Freude und Furcht in mir hervor.
Ich schwebe noch immer in geringer Höhe über dem Erdboden. In meinem Kopf bildet sich eine Frage, während ich spüre, wie diese Frau mich fixiert. ›Wer bin ich, und warum bin ich hier?‹ Da bricht der Trommelrhythmus ab, und die Männer beenden ihren Tanz. Alle blicken gleichzeitig zu mir empor und beginnen eine Art Sprechgesang. Ihre Sprache ist mir unbekannt, dennoch dringen die Worte: »Weiße Göttin! Die Weiße Göttin ist da!« zu mir durch. Ich erkenne diese Worte nicht etwa, weil ich ihre Sprache verstehe. Die Bedeutung der Worte wird mir von dem durchdringenden Blick der alten Frau eingeflößt. Wellen durchströmen meinen Körper.
Meine Aufmerksamkeit kehrt zu den Männern zurück, die den Kreis um die schöne Frau nun vergrößert haben, so daß ich mühelos neben ihr einen Platz einnehmen kann. Die Männer sehen mich an, den Kopf in den Nacken gelegt, und ich spüre ihre Erwartung. Nichts von all dem erstaunt mich. Sollte mich das Staunen überkommen, dann erst später, wenn ich mich auf meinem Balkon wiederfinden würde.
Der Körper, in dem ich schwebe, ist ein riesiger Frauenkörper, der zehnmal so groß ist wie ich. Weiß und schwerelos bin ich, wie eine Wolke. Ich weiß zuinnerst, daß ich hierhergebracht wurde, um diese tote Frau wieder zum Leben zu erwecken.
Ich lasse mich auf den Boden nieder. Als ich ihrem Körper nahe genug bin, berühre ich die dicken schwarzen Zöpfe, die ihr zartes, goldbraunes Gesicht umrahmen. Ich kann sehen, daß sie auf der Grenze zwischen Leben und Tod schwebt, und ich weiß, daß es in meiner Macht steht, sie aus diesem Schwebezustand zurück ins Leben zu bringen. Ich nehme ihren schlaffen Rumpf in die Arme und hebe sie in eine sitzende Position. Irgendwie weiß ich, daß ich sie in dieser Stellung festhalten muß, damit der Strom des Lebens in ihren Körper zurückfließt. Wenn sie allein aufrecht sitzen kann, wird sie ganz zurückgekehrt sein.
Meine Hände bewegen sich um ihren Kopf und ihre Brüste. Sie führen diese Gesten von selbst aus, im Takt eines alten Rituals, und mir ist bewußt, daß dieselben Handgriffe vor Tausenden von Jahren von anderen ausgeführt worden sind. Die Bewegungen rufen die Energie der jungen Frau zurück und bringen sie ins Gleichgewicht, und als ich das Gefühl habe, daß sie gestärkt ist, lasse ich sie los. Jetzt kommt sie langsam von selbst zurück, vorübergehend schwimmt sie zwischen Bewußtlosigkeit und Bewußtsein. Ihr Körper heilt sich selbst, unterstützt von einer unbekannten Kraft, die mit meiner Hilfe zur Verfügung gestellt wird.
Nachdem ich meine Arbeit beendet habe, werde ich von einer unsichtbaren Energie emporgetragen und schwebe wieder über dem Schauplatz. Höher und höher fliege ich. Gerade als die Szene unter mir in der Ferne verschwimmt, sehe ich noch einmal die Augen der alten Frau. Ihr Blick ist immer noch auf mich gerichtet, immer noch raucht sie Pfeife, und sie weiß, daß ich hier bin und wer ich bin. Ich lese Dankbarkeit in ihrem Gesicht. Im Augenblick der Rückkehr, als alles sich auflöst, erkenne ich in der alten Frau Umaj wieder, meine alte Freundin und Lehrerin, in einer anderen Erscheinungsform.
Ich stehe auf meinem Balkon, über mir der strahlende Nachthimmel. Der Übergang von meiner Reise in die ›Realität‹ – falls eines tatsächlich realer ist als das andere – vollzieht sich schnell und vollständig. Obwohl ich eine Frau bin, die in der modernen Welt des zwanzigsten Jahrhunderts lebt, habe ich inzwischen gelernt, diese Erlebnisse, die mir früher so fremd waren, zu akzeptieren.
Plötzlich höre ich in meinem Kopf die Worte: ›Diese Menschen lebten in ferner Vergangenheit. Mit ihren Ritualen und Zeremonien, die sie vor vielen Tausenden von Jahren praktizierten, vermochten sie die Schranken von Raum und Zeit zu überwinden. Sie konnten die Energien von zukünftig lebenden Menschen erreichen und diese Energien in ihre Zeremonien integrieren.‹
Ich erinnere mich, wie der Trichter im Himmel zu Beginn meiner Reise aussah, und wie mein Erleben sich verändert hatte, als ich mich über diesem uralten Land schwebend wiederfand. Ich höre dieselbe Stimme noch einmal: ›Sie wußten, wie man auf Belowodjes Schiffen reist‹, und ganz kurz sehe ich einen kleinen Lichtpunkt, der schnell über den dunklen Himmel zieht. Nach wenigen Sekunden ist er verschwunden. Als er fort ist, verweilt mein Blick bei den Tausenden von Sternen, die jetzt noch ein Geheimnis mehr bergen.
Die Reise ist abgeschlossen, und ich befinde mich wieder in meiner kleinen Wohnung mitten in Sibirien. Hier hat alles begonnen, vor mehr als einem Jahr, als ich an einem scheinbar ganz normalen Wintermorgen aufwachte und zur Arbeit fuhr, nicht ahnend, daß sich mein ganzes Leben verändern sollte. Ich erinnere mich so deutlich an diesen Tag, als sei es erst gestern gewesen.
Kapitel 1
An diesem Morgen klingelte mein Wecker, wie an fast jedem Morgen, um Punkt sechs. Der Bus, der mich in die psychiatrische Klinik bringen würde, in der ich arbeitete, fuhr genau in einer Stunde von der U-Bahn-Station ein paar Straßen weiter ab. Es war der letzte Bus, mit dem ich rechtzeitig zu Dienstbeginn ankommen würde, ich konnte mir nicht leisten, ihn zu verpassen.
Heute fiel es mir besonders schwer aufzustehen. In meiner Wohnung war es kälter als gewöhnlich, draußen war es noch dunkel, schwere Schneewolken verdeckten die Sterne, die sonst vielleicht die Nacht erhellt hätten. Die bittere Kälte in meinem Zimmer war ein sicheres Zeichen dafür, daß etwas mit der Zentralheizung nicht stimmte, und das wiederum bedeutete, daß ich möglicherweise noch Tage ohne Heizung würde auskommen müssen. Solche Gedanken im Kopf, kroch ich aus meinen warmen Decken und bereitete mich auf einen langen Arbeitstag vor. Nach einem schnellen Frühstück, das aus geröstetem Brot und Kaffee bestand und mehr dem Aufwärmen als der Nahrungszufuhr diente, erledigte ich die morgendliche Hausarbeit.
Mit einem Seufzer schloß ich meine Wohnungstür, ich dachte an die lange Fahrt, die ich jeden Morgen durchstehen mußte, um zu meiner geliebten Arbeit zu gelangen. Ich trat auf die glatte, vereiste Straße hinaus, und mein kalter Atem hing wie Streifen vor mir in der frostigen Luft. Es hatte die ganze Nacht geschneit, und der Hausmeister hatte sich noch nicht in den kalten Morgen hinausgewagt, um die Berge von verwehtem Schnee von den Fußwegen um das Mietshaus wegzuschaufeln. Die Schneewehen und eisige Böen erschwerten das Vorwärtskommen. Ein kalter Schauer durchlief mich, ausgelöst von Wind und Schnee und der trüben, unfreundlichen Stimmung dieses Morgens. Die hohen Mietshäuser um mich herum wirkten wie riesige, dunkle, leblose Ungeheuer. Von den vielen Fenstern waren nur wenige erleuchtet, jedes davon ein Zeichen menschlichen Lebens in diesem sibirischen Steindschungel.
Die U-Bahn-Station war fünfzehn Minuten von meiner Wohnung entfernt. Ich ging schnell, mit gesenktem Kopf, um mich so gut wie möglich vor dem Wind zu schützen. Der Schnee sah zwar weich und schön aus, aber als er mein Gesicht, meine Hände und meinen Mantel bedeckte und dann seinen Weg auf die nackte Haut meines Halses fand, durchlief mich wieder ein eisiges Frösteln.
Im Takt meiner eiligen Schritte sang ich mein übliches Wintermorgenlied. Ich murmelte die Worte vor mich hin, in dem Singsangrhythmus der Priester und Zauberer. »Heute will ich einen Sitzplatz. Heute will ich einen Sitzplatz.« Zu dieser Jahreszeit gehörte sehr viel Glück dazu, im Bus einen Sitzplatz zu bekommen, und ich sehnte mich so sehr nach dem Nickerchen, das ich halten würde, wenn ich die Gelegenheit dazu bekäme.
Ich bekam sie nicht. An der Haltestelle wartete bereits eine lange Schlange von Menschen, gespensterhafte Gestalten mit weißen, verschneiten Umrissen. Die Flocken glitzerten im matten Licht der Straßenlaternen und der roten Rücklichter von vorbeigleitenden weißen Erscheinungen, die wie Autos geformt waren und deren Motorengeräusche vom Wind verschluckt wurden. Als ich mich an diesem Morgen der Menschenmenge näherte, verschmolz sie zu einer einzigen Atemwolke, die einem langen, geschmeidig gewundenen Drachen ähnelte, der Tabakrauch ausspie und laut über den kalten Wind und den verspäteten Bus fluchte.
Ich hätte wissen müssen, daß ich mir zu dieser Jahreszeit keine Hoffnung auf einen Sitzplatz oder ein Schläfchen zu machen brauchte, weil viele Männer aus der Stadt hinaus an den zugefrorenen Fluß zum Fischen fuhren. Mein Bus überquerte jeden Tag den Ob, einen der größten Flüsse Sibiriens. Der mächtige, breite Strom teilte meine Stadt, Nowosibirsk, in zwei Teile. Drei weitgespannte Brücken waren gebaut worden, um die verschiedenen Stadtteile miteinander zu verbinden. Nach dem Bau der ersten Brücke, gegen Ende des letzten Jahrhunderts, hatte das Bevölkerungswachstum in der Stadt eingesetzt. Im Winter ist der Ob von einer dicken Eisschicht bedeckt, und die Männer, die mit Begeisterung fischen, können bis auf die Mitte des Flusses hinausgehen, um dort ihre runden Löcher ins Eis zu schlagen. Da sitzen sie dann mit ihren Kameraden auf dem kalten Eis zusammen und erzählen sich stundenlang Geschichten und Klatsch, während sie darauf warten, daß ein hungriger Fisch anbeißt. Die Busroute führte fast bis zum Krankenhaus am Ufer des Ob entlang, und heute, wie an fast jedem Wintertag, nahmen die früh aufgestandenen Fischer mit ihrer unhandlichen Ausrüstung das ganze Fahrzeug ein, saßen in ihren langen dunklen Wintermänteln auf den besten Plätzen, sprachen mit lauten, heiseren Stimmen und fluchten hin und wieder.
Ich arbeitete in einem großen psychiatrischen Krankenhaus. Es lag außerhalb der Stadt, weil man es schon immer für sicherer gehalten hatte, solche Kliniken in einiger Entfernung von bewohnten Gegenden zu errichten. Es kam mir so vor, als hätte ich an diesem Morgen mehr als zwei Stunden in dem eiskalten, ungeheizten Bus gestanden, schwankend, aber bewegungsunfähig in der Menge eingekeilt. Endlich erreichten wir meine Haltestelle am Krankenhaus. Ich stieg aus und schritt kräftig voran, um wieder Gefühl in meine tauben Beine zu bekommen.
Jeden Tag begrüßte mich das gleiche düstere Bild: dreizehn einstöckige Gebäude, alte, hölzerne, kasernenähnliche Baracken, gelblichgrün gestrichen, mit schweren, stark verrosteten Eisengittern vor den winzigen Fenstern. An diesem Ort verbrachte ich die meiste Zeit meines Lebens. Das war meine Klinik.
Als ich über den Hof ging, sah ich, wie etwa zwanzig Menschen das Gebäude verließen, in dem die Küche untergebracht war. Sie trugen große Metallbehälter, die das Frühstück für die Patienten enthielten, und beeilten sich, zu ihren Stationen zurückzukommen, in der vergeblichen Hoffnung, den Morgentee und den Brei warm durch die Kälte zu retten. Ich konnte sie kaum sehen, es war noch immer dunkel, aber auf dem Schnee war das Knirschen ihrer Schritte zu hören, und begleitet vom Geklapper der Gefäße schlugen sie verschiedene Wege zu den jeweiligen Gebäuden ein. Jeden Tag wurde der gleiche Brei serviert. Etwas anderes bekamen wir nicht. Die großen Gefäße mit zwei Metallgriffen und einem flachen Deckel erinnerten mich immer an Essensbehälter in Gefängnissen.
Es gab ein paar Patienten, deren Gesundheitszustand es zuließ, daß sie einfache Arbeiten auf dem Klinikgelände verrichteten. Diese wenigen Privilegierten trugen identische, langärmelige graue Pullover, auf dem Rücken war in großen Ziffern die Nummer ihrer jeweiligen Station aufgedruckt. Die Frauen hatten sich warme Kopftücher umgebunden; den Männern hatte man die Schädel kahlgeschoren. Einige waren lange Zeit meine Patienten gewesen. Obwohl es noch dunkel war, erkannten mich viele und riefen mir freundliche Begrüßungsworte zu. Andere, die neu waren und die mich nicht kannten, schwiegen.
Ich kam auf meine Station und bereitete mich auf die tägliche Besprechung am Morgen vor. Bis zu diesen Besprechungen war ich immer leicht angespannt. Die Krankenschwestern informierten mich über die Ereignisse der vergangenen Nacht, und ich mußte auf alles gefaßt sein. Heute war das nicht anders, und ich ertappte mich dabei, wie ich mir die vielen Probleme ausmalte, die möglicherweise aufgetaucht waren.
Als erstes teilte mir die Nachtschwester in ihrem Bericht mit, daß sich ein Pfleger, der erst vor einem Monat von mir eingestellt worden war, betrunken hatte; er hatte im Rausch einen harmlosen, senilen Patienten zusammengeschlagen, der sich lediglich geweigert hatte, einen unbedeutenden Auftrag auszuführen. Der Pfleger hatte den Greis mehrmals mit seinen schweren Militärstiefeln getreten, so daß der alte Mann mit einer Milzruptur als Notfall in die chirurgische Klinik eingeliefert werden mußte.
Ich hoffte, daß der arme Mann überleben würde. Irgendwie fühlte ich mich für den Vorfall verantwortlich, doch ich wußte, daß dem nicht so war. Die meisten Männer, die bereit waren, als Pfleger zu arbeiten, hatten im Gefängnis gesessen, und häufig brachten sie ihre Drogensucht und ihren Alkoholismus mit. Sie wechselten ständig. Wenn einer nach einem kriminellen Vorfall entlassen wurde, nahm ein anderer seinen Platz ein, mit den gleichen, vom Alkohol abgestumpften Gesichtszügen und dem gleichen Zynismus – keine guten Voraussetzungen für die Patienten in ihrer Obhut. Ich konnte mir nicht aussuchen, wen ich einstellte, und das Wissen, daß es mir nicht möglich war, meine Patienten besser zu schützen, erleichterte mir die Sache zumindest. In diesem Moment wurde der alte Mann gerade operiert, und ich sprach schnell ein stilles Gebet für ihn.
Dann berichtete die Krankenschwester von einem neuen Patienten, der um drei Uhr morgens von der Polizei ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ich las den Polizeibericht:
›Der Patient wurde im Wald gefunden, 25 Kilometer außerhalb der Stadt. Er lief auf den Eisenbahngleisen einem herannahenden Zug entgegen. Nach seiner Festnahme konnte er keinerlei Erklärung für sein Verhalten abgeben. Er beantwortete keine Fragen und fand sich in seiner Umgebung nicht zurecht. Ihm war nicht einmal klar, daß wir ihn festgenommen hatten. Kleidung: Soldatenuniform, schmutzig und zerrissen. Papiere: Bescheinigung, Soldat der Sowjetarmee.
Er führt Selbstgespräche. Seinen Worten kann entnommen werden, daß er um sich herum überall Außerirdische aus einem UFO sieht.‹
Ich war neugierig auf diesen Mann, aber es war Zeit für meine Morgenvisite auf der Männerstation. Ich würde ihn später besuchen müssen.
Auf der Station waren achtzig geisteskranke Männer in von blauen Deckenlampen schwach erleuchteten Zimmern untergebracht. Sie trugen alle die gleichen verschmutzten, weiten grauen Hosen mit schwarzen Längsstreifen. Jeder Raum beherbergte fünf bis zehn Patienten. Sie hatten keine Privatsphäre, es gab keine Türen. Im großen Saal der Langzeitpatienten lagen mehr als zwanzig Männer. Weibliche Hilfskräfte bemühten sich, die Station sauberzuhalten, aber es war unmöglich,den stechenden Gestank von menschlichem Schweiß und Urin, Medikamenten und unangenehmer Stickigkeit zu beseitigen. Das war der übliche Geruch meiner Arbeit, und ich war seit langem daran gewöhnt.
Meine Patienten waren mir alle vertraut, sie waren fast so etwas wie meine Familie. Ich kannte alle Lebensgeschichten, von der frühesten Kindheit an bis zu dem Punkt, an dem eine Geisteskrankheit Erwartungen, Karriere und Familie – ein ganzes Leben – zerstört hatte und sie in die Isolation dieses sogenannten ›Irrenhauses‹ getrieben hatte.
Jeder Patient reagierte anders. Einer bat mich während der Visite, sein Medikament geringer zu dosieren, weil er sich viel besser fühle. Ein anderer hörte mich nicht einmal kommen, weil in seinem Kopf ausschließlich Raum für seine inneren Stimmen war. Wieder ein anderer lachte ununterbrochen in einer Ecke still vor sich hin. Allen gemeinsam war nur das blasse, fast geisterhafte Aussehen, die dunklen Ringe unter den Augen. Diese Männer sahen nie den Himmel und atmeten nie frische Luft.
Ich ging von einem Patienten zum anderen, achtete auf Veränderungen des Gesundheitszustandes, gab den Krankenschwestern die täglichen Anweisungen für die Behandlung und beantwortete Fragen. Meine Gedanken kehrten kurzfristig zu dem neuen Patienten zurück. ›Ein Soldat‹, überlegte ich, ›sehr interessant. Könnten die Schrecken des Soldatenlebens diesen Mann dazu gebracht haben, eine Geisteskrankheit vorzutäuschen?‹
Geisteskrank zu spielen war ein bekannter Trick, mit dem viele Männer versuchten, aus der Armee entlassen zu werden. Normalerweise wurden die jungen Männer mit achtzehn, sofort nach Schulabschluß, zum Wehrdienst eingezogen. Sie kamen aus der Geborgenheit ihrer Familien und waren überhaupt nicht auf die schrecklichen Erlebnisse vorbereitet, die sie erwarteten. Sie wurden von den älteren Soldaten verspottet, gedemütigt und sogar geschlagen. Das war das ungeschriebene Gesetz der Armee. Alles, was man den anderen nicht antat, wurde einem selbst angetan. Viele Männer konnten das nicht akzeptieren. Manche, die damit nicht zurechtkamen, wurden tatsächlich psychisch schwer krank und mußten in geschlossene Anstalten eingeliefert werden. Andere, die das sahen, zogen daraufhin die relative Sicherheit einer psychiatrischen Klinik der Armee vor und täuschten deshalb Krankheit vor.
Ich betrat das Zimmer für die Neuaufnahmen. Auf den ersten Blick war mir klar, daß dieser Soldat wirklich krank war. Er saß in der Ecke, starr vor Angst, und glich eher einem verängstigten Tier als einem Menschen. Seine Körperhaltung drückte eine unglaubliche Anspannung aus. Ich frage mich immer wieder, woher die Geisteskranken diese ungeheure Energie bezogen. Wie erzeugten ihre Körper diese Kräfte?
Die gleiche Energie, die den Soldaten in diesem Moment in der Erstarrung festhielt, konnte auch die Quelle von Gewalttaten sein, die häufig dazu führten, daß Patienten sich selbst oder andere verletzten. Ich hatte bei vielen Patienten Variationen dieses Krankheitsbildes gesehen. Der arme Kerl trug noch die schmutzige, zerrissene Uniform, die auch der Polizeibericht erwähnte. Der Nachtschicht war es nicht gelungen, sie zu wechseln – sie hätten mehr Schaden angerichtet als genützt –, deshalb würde die Tagesschicht diese Aufgabe erledigen müssen. Auch jetzt noch riß der unruhige Mann, der auf dem Fußboden saß, an seiner Kleidung. Sie war aus starkem Tuch gefertigt, das die harten Bedingungen des Soldatenlebens aushalten sollte, und in normaler geistiger Verfassung hätte er sie unmöglich zerfetzen können.
Während ich ihn beobachtete, fuhr der junge Mannfort, den Rest seiner Habseligkeiten zu zerstören. Mit leeren hellblauen Augen starrte er ins Nichts. Unsere Station mochte seinen Körper festhalten, aber er selbst war irgendwo anders.
Seine Lippen flüsterten unverständliche Worte. Ich stellte ihm die üblichen Fragen, ohne Antworten zu erwarten. Ich hatte keinen Zugang zu seiner ›Realität‹, wie immer sie gerade aussehen mochte, also dachte ich über die Dosierung des Medikamentes nach, das ich ihm spritzen wollte. Ich wußte, daß er mir später, wenn er bei klarem Verstand wäre, von dem, was er jetzt sah und erlebte, erzählen würde.
Er hieß Andrej, und ich schätzte ihn auf siebzehn oder achtzehn. Er war sehr mager. Vielleicht hatte er bei der armseligen Kost, die beim Militär üblich war, abgenommen. Sein hellbraunes Haar war beim Eintritt in die Armee kurzgeschoren worden und bedeckte seinen Kopf etwa streichholzlang. Dadurch wirkte sein Gesicht verletzlich und offen. Es hatte immer noch viel von einem Kindergesicht, in dem jetzt die nackte Angst stand. Er war noch ein Junge, sein Verstand war von den traumatischen Erlebnissen, die ihn nun wahrscheinlich sein ganzes Leben lang verfolgen würden, überwältigt worden. Im Moment würde eine mittlere Dosis Haloperidol, intravenös verabreicht, wohl ausreichen, um ihn zu beruhigen und seine Rückkehr in die Realität einzuleiten.
Mein nächster Patient war Sergej, ein hübscher, junger, kräftig gebauter Mann, der nach außen hin wirkte, als könne er bald nach Hause. Er sah fröhlich aus, sprach offen mit mir und berichtete kritisch von seinen Erfahrungen während seiner Krankheit. Bei der Arbeit auf der Station war er eine große Hilfe. Aber vielleicht war alles ein wenig zu schön, zu fröhlich, zu offenherzig. Er wollte leidenschaftlich gern nach Hause zu seiner jungen Frau, aber ich wußte, daß seine Psychose überwiegend mit seiner pathologischen Eifersucht zusammenhing.
Wie immer bei potentiell gefährlichen Patienten war der Chefarzt der Klinik um ein Gutachten gebeten worden. Er hatte eine Kombination von Medikamenten verordnet, die Sergejs bewußten Willen unterdrücken und ihn zwingen sollten, die Wahrheit zu sagen. Ich hatte ihm diese Präparate noch nicht gegeben, obwohl sie mir sicherlich seine tatsächlichen Absichten seiner Frau gegenüber verraten hätten.
Derartige Entscheidungen stürzten mich immer in das gleiche moralische Dilemma. Wie würde ich mich an Sergejs Stelle fühlen, wenn jemand ohne meine Einwilligung mit Hilfe von Medikamenten in meine Psyche eindringen würde, um Antworten auf alle Fragen zu erhalten, die ihm gerade in den Sinn kommen? Meine negative Einstellung zu dieser Methode war unverändert, und ich war immer beunruhigt, wenn solche Medikamente verschrieben wurden.
Hoffentlich konnte ich einen anderen Weg finden, um Sergejs Fall zu klären. Jedenfalls wußte ich bereits, daß ich mich mit seiner Frau treffen und darauf bestehen mußte, daß sie sich scheiden ließen. Ich mußte ihr klarmachen, daß sie so weit wie möglich von ihm entfernt leben mußte. Seine Krankheit würde immer gefährlich bleiben, und die Gefahr, daß er in einem Anfall eifersüchtiger Wut sie oder jemand anders umbrachte, war zu groß. Das tragische Ende solcher und ähnlicher Konstellationen hatte ich schon zu oft erlebt.
Als ich meine Überlegungen zu Sergejs Fall vorläufig beendet hatte, hörte ich, wie die Krankenschwester mich in mein Büro zurückrief. Die Mutter meines neuen Patienten, des jungen Soldaten Andrej, war soeben eingetroffen. Sie war von der Armeeverwaltung benachrichtigt worden und hatte sich sofort auf den Weg gemacht. Meistens erschienen die Verwandten nicht so schnell im ›Irrenhaus‹, auch die Mütter nicht.
Sie hatte eine typisch russische Art. Sie und ihr Sohn ähnelten sich sehr, hatten das gleiche einfache, offene, derbe Gesicht. Auch die nervösen Bewegungen ihrer Hände, als sie vor mir stand, ihr dunkles Winterkleid zerknitterte und sich nicht traute, ohne meine Aufforderung Platz zu nehmen, erinnerten mich an ihren Sohn. Aus Andrejs Unterlagen wußte ich, daß sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen, von denen sich einer nun in dieser Klinik befand, in einem Dorf in der Nähe lebte.
Es war offensichtlich, daß sie noch nie in einer psychiatrischen Klinik gewesen war. Sie verstand noch nicht, was ihrem Ältesten zugestoßen war. Sie schien froh darüber, daß er den Militärdienst so schnell beendet hatte, und war dankbar für seine wohlbehaltene Rückkehr. Sie meinte, sich die nächsten zwei Jahre, die sie mit seiner Abwesenheit gerechnet hatte, keine Sorgen mehr um ihn machen zu müssen. Ihr war der Unterschied zwischen Schizophrenie und Grippe noch nicht klar.
Ihre erste Frage war die einer besorgten Mutter: »Sagen Sie mir, Frau Doktor, wann ist er wieder gesund?« Wenn ich ihr gleich die volle Wahrheit gesagt hätte, hätte ich geantwortet: »Niemals.« Statt dessen sagte ich: »Es wird wahrscheinlich zwei Wochen dauern, bis sein Zustand sich normalisiert hat.« Ihr Gesicht strahlte plötzlich vor Glück. Später würde ich ihr erklären müssen, daß ich damit meinte, er sei dann von seiner derzeitigen akuten Psychose genesen.
In jedem Fall aber würde er ein anderer sein als vorher, wenn er zu ihr zurückkehrte. Zuerst vielleicht nur ein wenig anders, aber im Lauf der Zeit würden sich seine Persönlichkeit und sein Verhalten weiter verändern. Er würde nie wieder so sein, wie sie ihn in Erinnerung hatte. Wie konnte ich ihr sagen, daß ein Übel, das ohne Ansehen der Person Geist und Seele der Menschen zerstört, sich bereits in ihm eingenistet hatte? Aus Erfahrung wußte ich, daß die Schizophrenie eine Kralle war, aus deren Griff man niemanden vollständig befreien konnte.
Ebenso sagte mir meine Erfahrung, daß mir diese Mutter zunächst nicht glauben würde. Sie würde hoffnungsvoll darauf warten, daß ihr Sohn aus der Klinik zurückkehrte und sich mit der liebevollen Unterstützung seiner Familie wieder ganz erholte. Sie und sein Vater würden von ihm erwarten, daß er auf ihrem kleinen ländlichen Anwesen wieder bei der Arbeit half. Eine Weile würde er vielleicht fast normal wirken, bis dann eines Tages die Kralle wieder zupackte, und ihn auf anderen Bahngleisen einem anderen fahrenden Zug entgegenjagte. Irgend etwas dieser Art würde bestimmt geschehen, und von da an sähe die Mutter angstvoll dem Tag entgegen, an dem ihr anderer Sohn, ihr Kleiner, zum Militärdienst eingezogen würde. Für heute hatte sie genug gehört, und sie verließ mich, um ihrem Mann und zweiten Sohn die gute Nachricht zu bringen, daß Andrej in zwei Wochen zu ihnen zurückkehren würde.
Das Gefühl von Hilflosigkeit, von professioneller Unzulänglichkeit, von meiner fehlenden Allmacht als Ärztin, gehörte zu den schwierigsten Aspekten meiner Arbeit. Ich konnte mich nicht an die Tatsache gewöhnen, daß ich mich angesichts der Krankheiten, die ich bekämpfte, häufig teilweise oder sogar ganz geschlagen geben mußte. Ich wußte nicht, ob Fachärzte anderer Disziplinen in der Regel ebenso empfanden, für Psychiater jedenfalls war es ein wohlbekanntes Berufsrisiko. Um den geistigen Zustand eines Patienten wieder zu normalisieren, gab es keine Drogen, keine Medikamente und keine schnellen chirurgischen Eingriffe, wie für so viele andere Krankheiten. Ich nahm mir einen Moment Zeit, schloß die Augen, atmete tief durch und versuchte meinen Kopf freizubekommen. Als ich die Augen wieder öffnete, klopfte es.
Dankbar für die Unterbrechung rief ich: »Herein!« Mein Freund Anatolij trat ein, und ich war froh, daß mich jemand besuchte, mit dem ich mich gern unterhielt. »Hallo!« sagte er. »Wollen wir Mittag essen und eine Tasse Tee trinken?«
Der Vormittag war schnell vergangen, und ich hatte nicht bemerkt, daß es bereits Mittag war. Die Mittagspause war beim Krankenhauspersonal sehr beliebt, denn während dieser Zeit konnten wir uns gegenseitig auf unseren Stationen besuchen, plaudern und gemeinsam essen, was wir uns von zu Hause mitgebracht hatten. Normalerweise gab es Butterbrote oder Salate, dazu eine Tasse starken Kaffee oder Tee. Nur zu besonderen Anlässen, wie zu Geburtstagen oder landesweiten Feiertagen, brachten wir unsere Lieblingsspeisen oder auch Kaviar mit, denn solche Dinge regelmäßig zu kaufen war zu teuer.
Ich mochte Anatolij. Er war jung, gut durchtrainiert und hatte braunes Haar und blaue Augen. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Kreativität, Intelligenz und Sensibilität war er einer unserer besten Ärzte. Wir sprachen häufig über ihn. Seine Professoren und Kollegen hatten erwartet, daß er in der Psychiatrie Karriere machen würde, aber bislang war das nicht der Fall. Ich hatte oft daran gedacht, ihn einmal darauf anzusprechen, aber der Zeitpunkt war mir nie richtig erschienen. Heute beschloß ich, ihn danach zu fragen.
Er saß mit der traditionellen Tasse Tee vor mir auf dem Sofa, bekleidet mit dem obligatorischen weißen Krankenhauskittel. Seine Augen waren wie gewöhnlich hinter einer dunklen Brille verborgen.
»Weißt du, Anatolij, viele glauben, daß du ein psychiatrisches Genie bist. Darf ich fragen, warum sich das noch nicht in deiner Karriere bemerkbar gemacht hat?«
Mit sichtlichem Vergnügen faßte er meine Frage als Kompliment auf. »Ich mache doch steil Karriere«, erwiderte er. Dann fügte er mit einem ironischen Grinsen hinzu: »Aber ich nehme an, du weißt, daß das hier kein psychiatrisches Krankenhaus ist?«
An seine Wortspielereien gewöhnt, ließ ich mir meine Verwunderung nicht anmerken.
»Das hier ist keineswegs ein Krankenhaus. Es ist ein riesiges Irrenschiff, und wir, die Besatzung, glauben tatsächlich, daß wir als Ärzte hier arbeiten. Wir glauben sogar, daß wir die Leute behandeln und heilen können. Aber ich halte es für keine so gute Idee, auf einem Irrenschiff Karriere machen zu wollen. Wir können schließlich nichts weiter tun, als blind auf dem Ozean der Realität zu navigieren, und das in dem Glauben, wir wüßten, was wir tun. Wir werden weiter in Richtungen steuern, die uns unbekannt sind, weil wir nicht anhalten können. Jeder von uns hier hat sich entschieden, auf diesem Schiff durch die Realität zu treiben, und jetzt können wir es nicht mehr verlassen. Weil es der sicherste Ort für uns ist, glauben wir, wir seien Ärzte und dazu in der Lage Menschen zu helfen, die angeblich verrückt sind.«