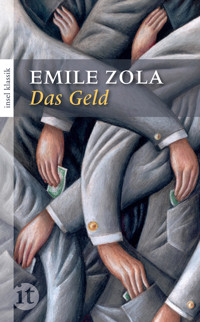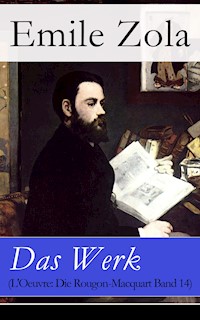
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Das Werk (L'Oeuvre: Die Rougon-Macquart Band 14) " ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Das Werk ist ein Roman von Émile Zola und zugleich der 14. Band des zwanzigbändigen Rougon-Macquart-Zyklus. Der Roman beschreibt die Pariser Künstlerszene und das Entstehen des Impressionismus zu einer Zeit, da diese Stilrichtung von den Kunstexperten abgelehnt wird. Die Hauptfigur Claude Lantier weist Ähnlichkeiten mit Paul Cezanne auf. Für die Zusendung des Romans dankte Cezanne Zola in einem förmlichen Brief und beendete seine Freundschaft zu dem Schriftsteller. Die Romanfigur Pierre Sandoz weist Parallelen zu Zola auf. Das Bild, das im Mittelpunkt der Handlung steht, ähnelt dem von Edouard Manet 1863 gemalten "Das Frühstück im Grünen". Ein weiteres im Roman beschriebens Bild ist dem Gemälde Impression, Sonnenaufgang von Claude Monet sehr ähnlich. Der Protagonist Claude Lantier malt in impressionistischem Stil. Er träumt davon, seine Werke im Louvre ausstellen zu können. Doch die Auswahljury der Académie des Beaux-Arts lehnt seine Werke immer wieder ab. Seine Maltechniken werden nicht akzeptiert, seine nackten Frauen als unanständig empfunden. Claudes beste Freunde sind der Schriftsteller Pierre Sandoz und der Architekt Louis Dubuche. Émile Édouard Charles Antoine Zola (1840-1902) war ein französischer Schriftsteller und Journalist. Zola gilt als einer der großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts und als Leitfigur und Begründer der gesamteuropäischen literarischen Strömung des Naturalismus. Zugleich war er ein sehr aktiver Journalist, der sich auf einer gemäßigt linken Position am politischen Leben beteiligte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Werk (L'Oeuvre: Die Rougon-Macquart Band 14)
Inhaltsverzeichnis
I
Claude ging gerade am Stadthaus vorbei, und es schlug zwei Uhr morgens, als das Unwetter losbrach. Er liebte Paris bei Nacht, und so war ihm die heiße Julinacht mit einem Künstlerbummel durch die Markthallen verstrichen, über den er dann alles andere vergessen hatte. Plötzlich fielen die Tropfen so dick und dicht, daß er sich in Lauf setzte und Hals über Kopf, so schnell er vermochte, am Quai de la Grève hinrannte. Als er aber bei der Brücke Louis-Philippe angelangt war, verdroß ihn sein atemloser Lauf, und er mäßigte seine Eile. Diese Angst vor dem bißchen Naßwerden war ja einfältig. Nachlässig die Hände schwingend überschritt er in der dichten Finsternis durch den peitschenden, das Licht der Gaslaternen verwischenden Platzregen langsam die Brücke.
Übrigens hatte er bloß noch ein paar Schritte. Als er über den Quai Bourbon zur Ile Saint-Louis abbog, setzte ein heftiger Blitz die gerade, flache Zeile der der Seine gegenüber am engen Fahrdamm hingereihten vornehmen alten Häuser ins Helle. Der Widerschein machte die Scheiben der hohen Fenster, die keine Läden hatten, aufglänzen. Man konnte die stolzen, düsteren, alten Hauswände mit ihren Einzelheiten deutlich erkennen: einen steinernen Balkon, das Geländer einer Freitreppe, die gemeißelte Girlande eines Giebels. Hier hatte der Maler in einem Winkel der Rue de la Femme-sans-Tête oben im Dachstock des alten Palastes du Martoy sein Atelier. Der flüchtig erhellte Quai war gleich wieder in Nacht versunken. Ein furchtbarer Donnerschlag hatte das schlummernde Viertel erschüttert.
Als er bei seiner Haustür, einer alten, runden, niedrigen, mit Eisenwerk beschlagenen Pforte, angelangt war, tastete er, da der Regen ihn am Sehen hinderte, nach dem Klingelknauf. Aber da fuhr er zurück. Zu seiner höchsten Überraschung war er gegen ein sich in den Türwinkel hineindrückendes lebendes Wesen gestoßen. Und schon erkannte er beim Glast eines neuen Blitzes, daß es ein großes, schwarzgekleidetes, bereits gänzlich durchnäßtes, vor Angst mit den Zähnen klapperndes junges Mädchen war. Während der Donnerschlag sie beide zusammenfahren machte, rief er:
»Ah, so was ... Wer sind Sie? Was wollen Sie hier?«
Aber schon sah er sie nicht mehr, vernahm bloß, wie sie schluchzend stammelte:
»Oh, mein Herr! Tun Sie mir doch nichts ... Der Kutscher, den ich auf dem Bahnhof genommen hatte, hat mich grob behandelt und hier, vor der Tür, abgesetzt ... Ja, bei Nevers war ein Zug entgleist. Wir haben vier Stunden Verspätung gehabt, und die Person, die mich abholen sollte, war nicht mehr da ... Ach Gott, es ist das erstemal, daß ich in Paris bin, mein Herr, und nun weiß ich nicht, wo ich mich befinde ...«
Ein greller Blitz schnitt ihr das Wort ab. Entsetzt gingen ihre weitaufgerissenen Augen über diesen Winkel, den in gespenstischem Blaulicht sich bietenden phantomhaften Anblick der ihr unbekannten Stadt hin. Der Regen hatte aufgehört. Drüben, auf der anderen Seite der Seine, reihte der Quai des Ormes seine kleinen, grauen Häuser mit dem scheckig bunten Holzwerk ihrer Kramläden unten, oben mit ihren ungleichmäßigen Dachkanten, während sich zur Linken ein weiter Ausblick bis zu dem blauen Schieferdach des Stadthauses bot, zur Rechten bis zur bleigedeckten Kuppel von Saint-Paul. Aber was sie besonders bedrückte, das war der eingeengte Fluß, der tiefe, enge Graben, in dem schwarz, von den plumpen Pfeilern der Brücke Marie bis zu den leichten Bogen der neuen Brücke Louis-Philippe, die Seine dahinglitt. Seltsame Massen belebten das Wasser, eine schlummernde Flotille von Kähnen und Jollen, ein Wasch- und ein Baggerschiff; alles am Quai hin angeseilt. Dann, weiter unten, an der anderen Böschung, mit Kohle gefüllte Pinassen, mit Steinen beladene Zillen; über ihnen ragend der mächtige Arm eines Eisenkrans. Und alles wieder fort.
»Aha, eine 'rausgeworfene Strichdirne, die sich an einen 'ranmachen will«, dachte Claude.
Er traute den Weibern nicht. Die Geschichte mit dem Zugunfall da, der Verspätung, von dem groben Kutscher hielt er für eine lachhafte Erfindung. Beim Schall des Donners aber hatte sich das junge Mädchen entsetzt wieder in den Türwinkel gedrückt.
»Jedenfalls, hier können Sie nicht schlafen«, fuhr er mit lauterhobener Stimme fort.
Sie weinte noch heftiger und stammelte:
»Mein Herr, ich bitte Sie, bringen Sie mich nach Passy ... Ich muß nach Passy.«
Er zuckte die Achseln. Hielt sie ihn für einen Trottel? Mechanisch hatte er den Blick nach dem Quai des Célestins hinübergerichtet, wo eine Fiakerstation war. Doch nicht eine einzige Laterne war dort zu erblicken.
»Nach Passy, meine Liebe? Warum nicht gar nach Versailles? ... Wo, zum Kuckuck, denken Sie denn, daß man um diese Zeit und bei so einem Wetter eine Kutsche auftreiben soll?«
Doch sie schrie laut auf. Ein neuer Blitz hatte sie geblendet. Diesmal sah sie die Stadt in einem tragischen Blutglast auftauchen. Es war ein gewaltiges Loch. Unabsehbar verloren sich beide Enden des Flusses wie in den roten Gluten einer Feuersbrunst. Die geringsten Einzelheiten hoben sich hervor. Man unterschied die kleinen, geschlossenen Jalousien des Quai des Ormes, die beiden Spalten der Straßen de la Masure und du Paon-Blanc mit den Reihen ihrer Häuserfronten. Bei der Brücke Marie hätte man die Blätter der großen Platanen zählen können, die dort ihre prächtigen Kronen wölbten, während nach der anderen Seite hin unter der Brücke Louis-Philippe, beim Mail, die in vier Reihen sich hinziehenden Boote die gelben Flecke der Äpfel aufflammen ließen, mit denen sie bis an den Rand vollgeladen waren. Weiter unterschied man das Gekräusel des Wassers, den hohen Schornstein des Waschschiffes, die regungslose Kette des Baggers, Sandflecke darauf, ein wunderliches Gewirr von Gegenständen, all die Welt, die da die Weite des Flusses, den von einem Ende bis zum anderen eingeschnittenen Graben belebte. Unter Donnergekrach erlosch der Himmel wieder, die Flut unten glitt in dunkler Nacht dahin.
»Ach lieber Gott! ... O Gott, was soll aus mir werden?«
Der Regen setzte jetzt wieder mit solcher Wut ein und ward von einem derartigen Wind getrieben, daß es den Quai mit der Gewalt einer geöffneten Schleuse peitschte.
»Na, lassen Sie mich eintreten«, sagte Claude. »Das ist ja nicht mehr auszuhalten, hier!«
Alle beide waren sie naß bis auf die Haut. Beim ungewissen Schein der an der Ecke der Rue de la Femme-sans-Tête angebrachten Gaslaterne sah er, wie sie triefte und ihr von dem gegen die Tür schlagenden Regensturz das Kleid am Leibe klebte. Mitleid ergriff ihn. Er hätte ja bei einem derartigen Unwetter selbst einen Hund von der Straße mit nach Haus genommen. Doch seine Weichherzigkeit verdroß ihn. Niemals nahm er ein Mädchen mit zu sich hinauf. Mit einer fast krankhaften, unter gemachter Grobheit versteckten Schüchternheit behandelte er sie alle nach der Art eines Junggesellen, der nichts von ihnen wußte. Und die da hielt ihn ja doch für gar zu dumm, daß sie auf so eine Weise, mit so einem Possenabenteuer, sich ihm anhängte. Trotzdem sagte er schließlich:
»Na genug, gehn wir 'nauf! ... Sie können bei mir schlafen.«
Sie geriet noch mehr außer sich, sträubte sich.
»Bei Ihnen! Oh, mein Gott! Nein, nein, das ist unmöglich!
Ich bitte Sie, mein Herr, bringen Sie mich nach Passy! Ich bitte Sie flehentlich.«
Aber jetzt wurde er ungehalten. Was hatte sie sich denn so, da er sie doch bei sich aufnahm? Schon hatte er zweimal die Klingel gezogen. Endlich tat sich die Tür auf, und er stieß die Unbekannte hinein.
»Nein, nein, mein Herr! Ich sage Ihnen, nein ...«
Aber schon wieder machte ein Blitz sie zusammenzucken, und als der Donner krachte, sprang sie außer sich in den Hausflur hinein. Die schwere Pforte hatte sich wieder geschlossen. Sie befand sich in einer weiten, stockfinsteren Halle.
»Frau Joseph, ich bin's!« rief Claude der Pförtnerin zu.
Leise aber fügte er hinzu:
»Geben Sie mir die Hand, wir müssen über den Hof.«
Völlig betäubt und willenlos leistete sie keinen Widerstand mehr und reichte ihm die Hand. Seite an Seite liefen sie von neuem durch den wolkenbruchartigen Regenguß. Es war ein gewaltiger herrschaftlicher Hof mit steinernen Arkaden, die undeutlich sich aus der Finsternis hervorhoben. Dann gelangten sie in einen engen, türlosen Hausflur. Er ließ ihre Hand los, und sie hörte, wie er fluchend Streichhölzer anstrich. Aber alle waren feucht geworden. Man mußte sich hinauftasten.
»Fassen Sie das Geländer an, und geben Sie acht, die Stufen sind hoch!«
Die sehr enge Treppe, eine ehemalige Dienstbotentreppe, hatte drei endlose Stockwerke, die sie, sich am Geländer haltend, ungeschickt mit völlig ermüdeten Beinen hinaufklomm. Dann machte er sie darauf aufmerksam, daß sie durch einen langen Korridor mußten. Mit beiden Händen an den Wänden hintastend, begann sie durch den endlosen Gang, der mit der gegen den Quai hin gewandten Hausfront parallel lief, hinter ihm herzugehen. Dann kam wieder eine Treppe, aber diesmal zum Dachgeschoß hinauf, ohne Geländer, mit krachenden Holzstufen, die schwankten und steil waren wie die abgenutzten Bretter einer Windmühlenstiege. Oben war der Treppenflur so klein, daß sie gegen den jungen Mann anstieß, der dabei war, nach dem Schlüssel zu suchen. Endlich öffnete er.
»Kommen Sie noch nicht herein, warten Sie, sonst stoßen Sie sich wieder.«
Sie rührte sich nicht. Durch den Aufstieg im Dunklen bis zum äußersten erschöpft, atmete sie laut; das Herz schlug ihr, und es sauste ihr in den Ohren. Es war ihr, als ob sie stundenlang durch ein derartiges Wirrsal von gewundenen Stockwerken emporgestiegen wäre, daß sie daran verzweifelte, sich jemals wieder hinabzufinden. Im Atelier gab's ein Geräusch von großen Schritten und tastenden Händen und ein von einem unterdrückten Fluch begleitetes Gepurzel von Gegenständen. Die Tür wurde hell.
»Kommen Sie doch, wir sind da!«
Sie trat ein, schaute, ohne etwas zu sehen. Die einzige Kerze verschwand in dem fünf Meter hohen Speicher und dem dort angehäuften Wirrwarr von Gegenständen, deren große Schatten sich seltsam über die graugetünchten Wände hinbogen. Sie konnte nichts erkennen und hob die Augen zu dem großen Fenster, gegen das ohrenbetäubend der Regen antrommelte. Doch just in diesem Augenblick setzte ein Blitz den Himmel in Gluten, und der Donnerschlag erkrachte so nah, daß sich das Dach zu spalten schien. Stumm, leichenblaß, ließ sie sich auf einen Stuhl sinken.
»Teufel noch mal!« murmelte, auch seinerseits ein wenig erblassend, Claude. »Das war ganz in der Nähe... Es war die höchste Zeit. Es ist hier denn doch besser als auf der Straße, nicht?«
Er wandte sich wieder zur Tür hin, die er geräuschvoll zweimal herum abschloß, während sie ihm stumm verängstigt zusah.
»Na, wir sind zu Hause.«
Übrigens war das Unwetter vorbei; es gab nur noch ein paar entfernte Schläge. Bald hörte auch der Regenguß auf. Er fühlte sich jetzt geniert, musterte sie mit einem Seitenblick. Sie war wohl gar nicht übel, sicher noch jung, höchstens zwanzig. Ungeachtet eines unbestimmten Zweifels, einer unbestimmten Empfindung, daß sie vielleicht doch nicht so ganz und gar löge, steigerte sich sein Mißtrauen. Übrigens mochte sie so schlau sein, wie sie wollte: sie täuschte sich, wenn sie glaubte, sie hätte ihn. Er übertrieb sein mürrisches Benehmen und sagte grob:
»Legen wir uns hin, das wird uns trocknen, wie?«
Ängstlich fuhr sie in die Höhe. Ohne daß sie ihn gerade ansah, musterte auch sie ihn. Seine hagere Gestalt mit den knotigen Gelenken, sein mächtiger, behaarter Kopf steigerte ihre Furcht. Mit seinem schwarzen Filzhut und seinem alten, kastanienbraunen, wetterverschossenen Paletot nahm er sich aus wie einer Räubergeschichte entsprungen. Sie flüsterte:
»Ich danke! Ich fühle mich ganz wohl, will in Kleidern schlafen.«
»Was! In Kleidern! Und dabei triefen Sie!... Machen Sie doch nicht so was Dummes! Ziehen Sie sich mal gleich aus!«
Er stieß mit Stühlen umher, schob einen halbzerborstenen Bettschirm beiseite. Hinter letzterem sah sie einen Waschtisch und ein kleines Eisenbett, dessen Decke er in die Höhe nahm.
»Nein, nein, mein Herr! Machen Sie sich weiter keine Umstände! Ich schwöre Ihnen, daß ich hier auf dem Stuhl bleibe.«
Plötzlich aber geriet er in Zorn, fuchtelte mit den Händen, schlug mit der Faust auf.
»Aber nun lassen Sie mich zufrieden! Sie sollen mein Bett kriegen; was haben Sie sich also zu beklagen?... Es ist gar nicht nötig, daß Sie sich so haben; ich schlafe auf der Chaiselongue.«
Wie mit drohender Miene hatte er sich gegen sie herumgewandt. In dem Glauben, er wolle sie schlagen, nahm sie zitternd und zagend den Hut ab. Von ihren Röcken tropfte es auf den Fußboden. Er fuhr fort zu schelten. Doch schien er's mit einem Bedenken zu bekommen, und wie ein Zugeständnis ließ er endlich fallen:
»Wissen Sie, wenn Sie sich etwa ekeln, will ich gern das Bettzeug wechseln.«
Und schon zog er das letztere ab und warf es über die am anderen Ende des Ateliers befindliche Chaiselongue. Darauf entnahm er einem Schrank frisches und richtete mit der Geschicklichkeit eines an solche Verrichtungen gewohnten Junggesellen das Bett eigenhändig her. Sorgsam klemmte er gegen die Wand hin die Bettdecke unter die Matratze, klopfte das Kopfkissen zurecht und schlug die Decke zurück.
»Na, ist das nicht 'ne hübsche Heia?«
Als sie aber noch immer nichts sagte, sondern nur unbeweglich dastand und, ohne sich entschließen zu können aufzuknöpfen, verlegen an ihrem Leibchen umhertastete, stellte er den Bettschirm um sie herum. Herrgott, was für eine Verschämtheit! Er selber rüstete sich hurtig zum Schlafengehen, breitete das Bettzeug über die Chaiselongue, hing seine Kleider an eine alte Staffelei und lag auch schon, so lang er war, auf dem Rücken. Doch als er schon im Begriff war, die Kerze auszupusten, fiel ihm ein, daß sie dann ja kein Licht haben würde, und er wartete. Zuerst vernahm er keinerlei Geräusch. Sie mochte wohl noch regungslos vorm Bett stehen. Dann aber hörte er ein leises Stoffgeräusch, langsame, zaghafte Bewegungen, wie wenn sie's immer wieder nicht wagte und auch ihrerseits unruhig auf das noch immer nicht ausgelöschte Licht achtete. Endlich, nach langen Minuten, krachte leise die Matratze, und es herrschte tiefe Stille.
»Haben Sie Ihre Bequemlichkeit, Fräulein?« fragte Claude mit sanfter Stimme.
»Ja, mein Herr! Durchaus!«
»Dann gute Nacht!«
»Gute Nacht!«
Er blies das Licht aus. Es herrschte tiefste Stille. Trotz seiner Müdigkeit öffnete er bald wieder die Lider, konnte keinen Schlaf finden und starrte vor sich hin auf das große Atelierfenster. Der Himmel hatte sich vollkommen aufgeklärt. Er sah die heiße, sternfunkelnde Julinacht. Trotz des Gewitters war es noch immer sehr schwül. Es war ihm sehr heiß; er legte die bloßen Arme auf die Bettdecke. Das Mädchen beschäftigte ihn. Ein heimlicher Zwiespalt setzte ihm zu: die Zufriedenheit mit sich, daß er sie so behandelt hatte, wie er getan, die Sorge, sich, wenn er nachgäbe, eine Last aufzuhalsen, stritten mit der Furcht, lächerlich zu erscheinen, wenn er nicht zugriffe. Doch schließlich siegte die Selbstzufriedenheit; er hielt sich für sehr stark, dachte sich einen Roman aus, der sich gegen seine Ruhe richtete, spottete aber doch darüber, daß er der Versuchung widerstanden hatte. Es war ihm zum Ersticken heiß, und er streckte die Beine unter der Decke vor, während er im wirren Gedankendurcheinander seines Halbschlummers mit schwerem Kopf in den Sternflimmer hinein liebeatmende Weiberblößen, die lebenswarmen Weiberglieder träumte, die der Künstler in ihm anbetete.
Dann wirrten sich seine Gedanken mehr und mehr. Was machte sie? Er glaubte sie schon lange eingeschlafen, denn nicht der leiseste Atemzug war zu vernehmen. Jetzt aber hörte er, wie sie sich, gleich ihm, mit größter, atemanhaltender Vorsicht herumwarf. Soweit er sich auf Weiberangelegenheiten verstand, suchte er über die Geschichte, die sie ihm erzählt hatte, nachzudenken. Kleine Einzelheiten trafen ihn jetzt, berührten ihn tiefer. Aber seine Logik versagte; wozu sollte er sich unnütz den Kopf zerbrechen? Genug, ob sie nun die Wahrheit gesagt oder gelogen hatte: es konnte ihm egal sein! Morgen würde sie wieder ihrer Wege gehen; guten Tag und guten Weg, und alles war auf Nimmerwiedersehen gewesen. Erst bei anbrechendem Tage, als schon die Sterne verblaßten, schlief er ein. Hinter dem Bettschirm aber fuhr sie, trotz ihrer drückenden Reisemüdigkeit und unter dem durchhitzten Zinkdach von der stickigschwülen Luft gepeinigt, fort, sich unruhige Gedanken zu machen. Sie genierte sich jetzt nicht mehr; mit einem irritierten Mädchenseufzer warf sie sich, von der Anwesenheit des Mannes, der da in ihrer Nähe schlief, belästigt, in nervöser Unruhe herum.
Als Claude am Morgen zwinkernd die Augen auftat, war es schon sehr spät. Voll drang die Sonne zum Atelierfenster herein. Es war einer seiner Grundsätze, daß die jungen Freilichtmaler die Ateliers mieten müßten, welche die akademischen verschmähten; jene, in welche ungehindert soviel Sonne wie nur möglich hereindrang. Im übrigen war er zunächst aber ganz verdutzt und fuhr mit bloßen Beinen in sitzende Haltung empor. Wie, zum Teufel, kam er auf die Chaiselongue? Mit noch schlaftrunkenen Augen sah er sich um. Da nahm er, halb vom Bettschirm verdeckt, einen Haufen Kleider wahr. Jetzt erinnerte er sich. Ah richtig, ja, das Mädchen! Er lauschte, vernahm lange, regelmäßige, kindlich wohlige Atemzüge. Gut, sie schlief noch. Und so ruhig, daß es schade gewesen wäre, sie zu wecken. Ganz dumm saß er da, kratzte sich die Beine, war verdrießlich über das Abenteuer, auf das er da hineingefallen war und das ihm nun seinen ganzen Arbeitsmorgen verdarb. Er ärgerte sich über seine Weichherzigkeit. Es war am Ende das beste, sie wachzurütteln, und wenn sie dann gleich ihrer Wege ging. Doch glitt er behutsam in die Höhe, trat in die Pantoffeln, ging auf den Zehen.
Die Wanduhr schlug neun. Claude machte eine ungeduldige Handbewegung. Nichts hatte sich gerührt. Das leise Atmen dauerte fort. Er dachte jetzt, es wäre das gescheiteste, wenn er sich an sein großes Gemälde machte. Frühstücken konnte er dann ja nachher, wenn er sich wieder würde rühren und regen können. Doch konnte er zu keiner Entscheidung kommen. Er, der hier in einer so greulichen Unordnung hauste, fühlte sich durch das auf den Boden herabgeglittene Kleiderbündel da geniert. Die Kleider waren noch immer pitschnaß, das Wasser war von ihnen abgeflossen. Mit unterdrücktem Murren hob er sie schließlich Stück für Stück auf, breitete sie über Stühle und stellte sie an die Sonne. Am liebsten hätte er alles drunter und drüber geworfen. Niemals würde das trocknen, niemals würde er sie loswerden! Ungeschickt drehte und wendete er dies Weibergelump hin und her, verhedderte sich in der schwarzen Wollbluse, suchte auf allen vieren nach den Strümpfen, die hinter ein altes Gemälde gefallen waren. Es waren aschgraue, lange, feine, aus schottischer Wolle. Ehe er sie aufhing, prüfte er sie. Auch sie waren vom Rocksaum naß geworden. Er breitete sie aus, zog sie zwischen seinen warmen Händen durch, nur damit er ihre Besitzerin so schnell wie möglich wegschicken konnte.
Seit er aufgestanden war, hatte Claude es mit dem Verlangen, den Bettschirm beiseitezuschieben und sie zu sehen. Diese Neugier, die er für dumm hielt, steigerte seine Mißstimmung. Endlich ergriff er unter seinem gewohnten Achselzucken seine Pinsel. Aber schon vernahm er gestammelte Worte und hörte, wie die Bettdecke rauschte. Als es dann aber ruhig weiteratmete, gab er diesmal nach, ließ die Pinsel und steckte den Kopf hinter den Schirm. Aber was er sah, stimmte ihn ernst. Er stand wie versteinert, und in Verzückung stammelte er:
»Ah, Donnerwetter! ... Donnerwetter!«
Von der Treibhaushitze, die das Fenster glühen ließ, belästigt, hatte das junge Mädchen die Bettdecke zurückgeworfen. Von den letzten schlaflos verbrachten Nächten völlig erschöpft, lag sie, ganz in Licht gebadet, da und schlief, so unbewußt, daß nicht die leiseste Bewegung ihre lichte Nacktheit störte. Als sie zunächst in fiebernder Schlaflosigkeit dagelegen hatte, waren an ihrem Hemd wohl die Achselknöpfe aufgegangen, der linke Ärmel war herabgeglitten und hatte ihre Brust entblößt. Es war eine goldgetönte, seidig feine Haut, in ihrer ganzen Jugendfrische. Zwei kleine, feste, lebenstrotzende Brüste mit zwei blaßrosigen Spitzen. Den rechten Arm hatte sie unter den Nacken gelegt; ihr sanft schlummerndes Gesicht war hintübergebogen. In zutraulicher Hingabe bot sich, anbetungswürdig in der Linie, ihre Brust, während ihr aufgelöstes schwarzes Haar sie in seinen dunklen Mantel hüllte.
»Ah, Donnerwetter! Sie ist verdammt hübsch!«
Da war's! Ganz und gar! Das Gesicht, das er vergeblich für sein Gemälde gesucht hatte. Und fast genau in derselben Pose. Ein wenig schmal und kindlich hager: aber so geschmeidig, von einer solchen jugendlichen Frische. Im übrigen der Körper schon reif. Wo hatte sie, zum Teufel, gestern diesen Busen versteckt, daß er ihn nicht geahnt hatte? Aber wahrhaftig, ein Glücksfund!
Behutsam eilte Claude zu seiner Pastellstiftschachtel hin und ergriff sie und einen großen Bogen Papier. Dann legte er, auf dem Rand eines niedrigen Stuhles hockend, einen großen, steifen Pappbogen auf die Knie und begann mit tief beglückter Miene zu zeichnen. Seine ganze Unruhe, seine sinnliche Neugier und ihr niedergehaltenes Gelüst gingen auf in die hingerissen künstlerische Bewunderung, in die Begeisterung für schöne Farbentöne und wohlproportionierte Muskeln. Schon hatte er in der Entzückung über das schneeige, den feinen Bernsteinton der Schultern so glücklich hebende Weiß ihres Busens das junge Mädchen selbst vergessen. Eine innerlichst ergriffene Scheu gab ihm der Natur gegenüber das Gefühl der Kleinheit; er zog die Ellbogen an, wurde wieder ein sehr artiger, aufmerksamer, ehrerbietiger, kleiner Knabe. Das währte ungefähr eine Viertelstunde. Manchmal unterbrach er sich im Zeichnen, kniff die Augen. Doch hatte er Angst, daß sie ihre Stellung verändern könnte, und machte sich, aus Furcht, er könne sie wecken, mit angehaltenem Atem, wieder an die Arbeit.
Inzwischen bekam er es wieder mit unbestimmten Überlegungen, die ihm in seine Hingabe an die Arbeit hinein im Kopf umhergingen. Wer mochte sie wohl sein? Sicher keine Straßendirne, wie er gemeint hatte; denn dazu war sie zu frisch. Aber weshalb hatte sie ihm die kaum glaubliche Geschichte da erzählt? Und er dachte sich etwas anderes aus: eine Anfängerin, die in Paris mit einem Liebhaber hineingefallen war, der sie jetzt verlassen hatte. Oder vielleicht ein kleines Bürgerfräulein, das mit einer Freundin auf Vergnügen ausgegangen war und sich nun nicht zu ihren Eltern zurücktraute. Vielleicht mochte es sich aber auch um ein verwickelteres Drama handeln, um außergewöhnliche, in aller Unbefangenheit begangene Vergehen, wer wußte was für erschreckliche Sachen? Diese Vermutungen vermehrten seine Ungewißheit. Er ging zum ersten Entwurf des Gesichtes über, das er sorgfältig studierte. Der obere Teil verriet große Gutherzigkeit, große Sanftmut. Die klare Stirn war wie ein heller Spiegel. Die kleine Nase hatte sensible Flügel. Man fühlte förmlich unter den Lidern die Augen lächeln, ein Lächeln, das dann das ganze Gesicht erhellen mußte. Doch der untere Gesichtsteil störte diese strahlende Lieblichkeit. Die Kinnpartie trat hervor. Die zu starken Lippen standen auseinander und zeigten feste, weiße Zähne. Es war in diesen in kindliche Zartheit getauchten Zügen etwas wie Leidenschaft, von unruhig drängender, sich ihrer unbewußter Geschlechtsreife. Plötzlich aber ging über ihre seidige Haut ein Schauer. Vielleicht hatte sie endlich diesen prüfend auf sie gerichteten Mannesblick gefühlt. Sie riß weit die Lider auf und stieß einen Schrei aus.
»Ah, mein Gott!«
Der ihr fremde Aufenthalt, der junge Mann, der da in Hemdsärmeln vor ihr hockte und sie mit seinen Blicken verschlang, machte sie vor Betroffenheit erstarren. Dann aber raffte sie mit einer heftigen Bewegung beider Arme die Bettdecke über ihre Brust herauf, während ihre keusche Angst ihr das Blut in solche Aufregung versetzte, daß ihr mit einer rosigen Welle die glühende Röte ihrer Wangen bis in die Spitzen der Brüste ging.
»Na aber was denn?« rief Claude, den Zeichenstift in der Luft, sehr unzufrieden. »Was haben Sie denn?«
Aber sie sagte nichts mehr, rührte sich nicht mehr, lag, die Decke gegen den Hals gepreßt, so in sich zusammengezogen, daß sich ihr Körper kaum durch das Bett hindurch verriet.
»Ich beiße Sie doch nicht. Na, seien Sie doch nett und legen Sie sich wieder, wie Sie waren!«
Von neuem stieg ihr das Blut wieder bis in die Ohren. Endlich stammelte sie:
»O nein, o nein, mein Herr!«
Aber da wurde er ärgerlich und geriet in eine seiner Zornanwandlungen. Dieser Eigensinn erschien ihm einfach stumpfsinnig.
»Na, aber was geschieht Ihnen denn weiter? Das ist wohl ein großes Malheur, wenn ich weiß, wie Sie gebaut sind! ... Sie sind wahrhaftig nicht die Erste!«
Jetzt schluchzte sie. Ganz verzweifelt bei dem Gedanken, daß er seinen Entwurf nicht fertigbekommen sollte und die Sprödigkeit des Mädchens es ihm unmöglich machte, eine gute Studie für sein Gemälde zu erhalten, geriet er vollends außer sich und in Zorn.
»Sie wollen also nicht? Aber das ist ja doch einfach närrisch! Für was halten Sie mich denn? ... Hab' ich Sie denn etwa berührt? Hätt' ich's auf Dummheiten abgesehen, so hätt' ich über Nacht dazu doch die schönste Gelegenheit gehabt ... Ah, so was ist mir ganz einerlei, meine Liebe! Da könnten Sie mir schon zeigen, was Sie wollten ... Und, wissen Sie, übrigens ist es nicht gerade nett, daß Sie mir diese Gefälligkeit verweigern, wo ich Sie schließlich doch aufgenommen habe und Sie in meinem Bett gelegen haben.«
Sie barg das Gesicht in das Kopfkissen und weinte heftiger.
»Ich schwöre Ihnen, daß ich die Zeichnung brauche, sonst würd' ich Sie nicht belästigen.«
Ihr heftiges Weinen überraschte ihn denn doch, er schämte sich seiner Rauheit. Verlegen schwieg er und ließ sie sich ein wenig beruhigen. Dann begann er mit sehr sanfter Stimme von neuem:
»Na, wenn Ihnen das so sehr widerstrebt, wollen wir's gut sein lassen ... Aber wenn Sie sich das vorstellen könnten! Ich habe da in meinem Gemälde ein Gesicht, mit dem ich absolut nicht vorwärtskommen kann, und ich könnte gerade ihres so gut gebrauchen! Ich würde, wenn es sich um meine Malerei handelt, Vater und Mutter erwürgen können. Entschuldigen Sie; aber, nicht wahr? ... Wirklich, wenn Sie recht liebenswürdig sein wollten, könnten Sie mir noch ein paar Minuten stillhalten. Nein, nein! Unbesorgt! Nicht den Körper mein' ich, nicht den Körper! Den Kopf, nichts als den Kopf! Wenn ich bloß den Kopf fertigstellen dürfte! ... Ach, seien Sie so gütig, bringen Sie Ihren Arm wieder in die vorige Lage, und ich bin Ihnen, sehen Sie, dankbar zeit meines Lebens!«
In seinem Künstlereifer beschwor er sie jetzt und fuhr ganz erbarmungswürdig mit seinem Zeichenstift hin und her. Im übrigen hatte er sich, weit von ihr ab, auf seinem niedrigen Stuhl hockend, nicht vom Fleck gerührt. Und da wagte sie es und enthüllte ihr beruhigtes Gesicht. Was sollte sie machen? Sie war ihm Dank schuldig, und seine Miene war so erbarmungswürdig. Trotzdem zauderte sie noch und hatte es mit einer letzten Scham. Doch zog sie endlich, langsam, ohne etwas zu sagen, ihren nackten Arm hervor und schob ihn von neuem unter den Kopf, wobei sie aber darauf bedacht war, mit der anderen, verborgen gebliebenen Hand die Bettdecke über der Brust festzuhalten.
»Ah, wie gut Sie sind! ... Es soll ganz schnell gehen, gleich sind Sie frei.«
Er hatte sich über seine Zeichnung gebeugt, richtete auf sie bloß noch seinen scharfen Malerblick, für den das Weib verschwunden ist und der nichts sieht als das Modell. Anfangs war sie wieder rot geworden. Ihr nackter Arm und das Wenige von ihrem Körper, das sie mit aller Unbefangenheit auf jedem Ball gezeigt haben würde, setzte sie hier in Verwirrung. Doch erschien ihr der Bursch so verständig, daß sie sich beruhigte. Ihre Wangen gewannen ihre gewohnte Farbe wieder, ihr Mund zeigte ein leises, vertrauensvolles Lächeln. Zwischen ihren halbgeschlossenen Lidern durch beobachtete sie jetzt auch ihn. Wie hatte er sie gestern mit seinem starken Bartwuchs, seinem dicken Kopf und seinen heftigen Gesten erschreckt! Und doch war er nicht häßlich. In der Tiefe seiner braunen Augen entdeckte sie soviel zärtlichen Sinn. Auch seine feine, frauenhafte Nase, die sich zwischen dem aufgesträubten Haar der Lippen verlor, setzte sie in Überraschung. Ein kleines, unruhig sensibles Zittern hatte er; auch von der beständigen Leidenschaftlichkeit, die dem Stift zwischen seinen feinen Fingern ein eigenes Leben zu verleihen schien, fühlte sie sich ausnehmend berührt. Er konnte unmöglich ein schlechter Mensch sein; es handelte sich bei ihm wohl nur um Grobheit aus schüchternem Sinn. Sie überlegte das alles nicht gerade verstandesgemäß, doch fühlte sie es, und wie einem Freunde gegenüber hielt sie sich in der Stellung, deren er bedurfte.
Von dem Atelier allerdings fühlte sie sich nach wie vor etwas beunruhigt. Sie schickte vorsichtige Blicke umher und war über eine derartige Unordnung und Vernachlässigung starr. Vor dem Ofen häufte sich noch die Asche vom letzten Winter. Außer dem Bett, dem kleinen Waschtisch und der Chaiselongue waren an Möbeln nur noch ein alter, verschiefter Schrank aus Eichenholz und ein großer, fichtener Tisch vorhanden, auf dem Pinsel, Farben, schmutzige Teller herumlagen und -standen, und eine Spirituslampe mit einer Kasserolle drauf, in welcher noch ein Rest von Fadennudeln klebte. Zwischen wackligen Staffeleien standen unordentlich Stühle mit schadhaftem Strohgeflecht umher. In der Nähe der Chaiselongue aber lag in einem Winkel auf dem Fußboden, der wohl bloß alle Monate einmal gefegt wurde, die Kerze von gestern abend. Nur die Wanduhr, ein mächtiges, mit roten Blumen bemaltes Gehäuse, machte mit ihrem tieftönigen Ticktack einen munteren, sauberen Eindruck. Wovon sie aber einen besonderen Schreck erfuhr, das waren die rahmenlosen an der Wand hängenden Skizzen. Eine dichte Flut von Skizzen, die bis zum Fußboden herabreichte, der eine wahre Trümmerstätte von bunt durcheinandergeworfener bemalter Leinwand war. Noch nie hatte sie eine so fürchterliche, grobe, grelle, in ihren Tönen gewaltsame Malerei gesehen. Sie verletzte einen wie ein aus einer Schenke heraus vernommener Kutscherfluch. Sie senkte die Augen, wurde dann aber doch von einem umgewandten Gemälde angezogen. Es war das große Bild, an welchem der Maler arbeitete und das er jeden Abend gegen die Wand umdrehte, um es dann am anderen Morgen mit dem ersten, noch frischen Blick, den er darauf warf, um so besser beurteilen zu können. Was mochte das Bild da wohl verbergen, da er's noch nicht einmal zu zeigen wagte? Vom Fenster her aber verbreitete sich, ohne auch nur von dem geringsten Vorhang gehemmt zu werden, die heiße Lichtflut der Sonne über den großen Raum und floß wie flüssiges Gold über all dies Möbelgerümpel, dessen unbekümmerte Dürftigkeit sich dadurch nur um so mehr betonte.
Claude empfand das herrschende Schweigen schließlich als drückend. Er wollte, einerlei was, etwas sagen, weil er glaubte, daß das die Höflichkeit erfordere, besonders aber auch, um sie in ihrer gezwungenen Körperhaltung zu zerstreuen. Aber wie er auch suchte, fiel ihm nichts weiter ein als die Frage:
»Wie heißen Sie?«
Sie tat die Augen auf, die sie, wie von neuem vom Schlaf übermannt, geschlossen hatte.
»Christine.«
Er wunderte sich. Auch er hatte ja noch nicht seinen Namen genannt. Ohne sich zu kennen, weilten sie so seit gestern abend beieinander.
»Ich heiße Claude.«
Als er sie in diesem Augenblick ansah, nahm er wahr, wie ihr Gesicht ein reizendes Lächeln erhellte. Es verriet ein noch kindliches großes Mädchen. Sie fand den verspäteten Austausch ihrer Namen drollig. Dann aber vergnügte ihn ein anderer Gedanke.
»Ach, Claude, Christine! Das fängt ja mit demselben Buchstaben an!«
Wieder ward es still. Er zwinkerte mit den Augen, vergaß sich über seiner Zeichnerei, fühlte sich mit seinen Einfällen am Rande. Als er ihr aber ein ungeduldiges Unbehagen abzumerken glaubte, fuhr er aus Furcht, sie könnte ihre Haltung verändern, um sie zu beschäftigen, fort:
»Es ist recht heiß.«
Diesmal unterdrückte sie ihr Lachen und die ihr angeborene Munterkeit, die, seit sie sich sicher fühlte, sich ihr unwillkürlich eingestellt hatte. Die Hitze war so arg geworden, daß sie sich im Bett wie in einem Bade fühlte und ihre milchig-kamelienbleiche Haut voller Schweißtropfen stand.
»Ja, es ist etwas heiß«, antwortete sie ernsthaft, doch blickten ihre Augen heiter.
Claude schloß jetzt gutmütig ab:
»Das macht, weil die Sonne so hereindringt. Aber, bah! So ein Schmiß Sonne aufs Fell tut gut ... Hätten wir's doch heut nacht, da vor der Tür, so gehabt, nicht?«
Sie lachten alle beide. Er aber fragte sie, erfreut, daß er endlich einen Gesprächsstoff gefunden hatte, nach ihrem Abenteuer, ganz ohne Neugier, im Grunde unbekümmert darum, die richtige Wahrheit zu erfahren, nur von dem Wunsche beherrscht, die Sitzung länger auszudehnen.
Mit ein paar schlichten Worten erzählte Christine die Sache.
Gestern morgen hatte sie Clermont verlassen, um sich nach Paris zu begeben, wo sie bei einer Generalswitwe eine Stelle als Vorleserin antreten wollte. Bei Madame Vanzade, einer alten, sehr reichen Dame, die in Passy wohnte. Nach dem Fahrplan langte der Zug um neun Uhr zehn Minuten an, und alle Vorkehrungen waren getroffen gewesen. Ein Hausmädchen sollte sie erwarten; es war brieflich sogar ein Erkennungszeichen vereinbart worden: eine graue Feder an ihrem schwarzen Hute. Doch da war ihr Zug ein wenig oberhalb von Nevers mit einem Güterzug zusammengestoßen, dessen entgleiste und zertrümmerte Wagen das Gleis versperrt hatten. Und nun hatte es eine ganze Folge von Widerwärtigkeiten und Versäumnissen gegeben. Zuerst ein endloses Sitzen in den dastehenden Waggons; alsdann hatte man die letzteren verlassen, das Gepäck zurücklassen und drei Kilometer zu Fuß zurücklegen müssen, um eine Station zu erreichen, wo schließlich ein Aushilfszug hatte gebildet werden sollen. Man hatte zwei Stunden verloren, und zwei andere waren noch in der Unruhe, welche der Unfall von einem Ende der Strecke bis zum anderen verursacht hatte, daraufgegangen, so daß man mit vier Stunden Verspätung erst um ein Uhr morgens auf dem Bahnhof eingetroffen war.
»Pech!« unterbrach Claude, zwar immer noch ungläubig, aber doch schon halb überzeugt und von der einfachen Weise, mit der sich die verwickelte Geschichte aufklärte, überrascht. »Und natürlich war niemand mehr da, der auf Sie wartete?«
Tatsächlich hatte Christine das Stubenmädchen Frau Vanzades, dem's ohne Zweifel zu langweilig geworden war, nicht mehr vorgefunden. Sie sprach jetzt von der Aufregung, die sie auf dem Lyoner Bahnhof, in der großen, unbekannten, schwarzen, leeren, zu dieser vorgerückten Nachtstunde fast schon gänzlich verlassenen Halle ausgestanden hatte. Anfangs hatte sie nicht gewagt, eine Kutsche zu nehmen, und war mit ihrer kleinen Reisetasche in der Hoffnung, es könnte trotzdem noch jemand kommen, auf und ab gegangen. Dann aber hatte sie sich, freilich zu spät, entschlossen. Es war bloß noch ein unflätiger Kutscher dagewesen, der sie, als er sich ulkend ihr angeboten, mit seinem widerlichen Weindunst angehaucht hatte.
»Ja, ein Vagabund«, fuhr Claude fort, der sich jetzt interessierte, als hätte er der Abwicklung einer Räubergeschichte beigewohnt. »Und Sie sind in seine Kutsche eingestiegen?«
Die Augen gegen die Decke gerichtet, fuhr Christine, ohne ihre Haltung zu verändern, fort:
»Er hat mich gezwungen. Er nannte mich seine Kleine; ich hatte Angst vor ihm ... Als er erfuhr, daß ich nach Passy wollte, wurde er ärgerlich und peitschte so auf sein Pferd los, daß ich mich an den Vorhängen anhalten mußte. Dann, als ich mich ein wenig beruhigt hatte, rollte die Kutsche langsam durch helle Straßen, und ich sah Verkehr auf den Bürgersteigen. Schließlich erkannte ich die Seine. Ich bin nie nach Paris gekommen, aber ich hatte einen Stadtplan eingesehen ... Ich dachte nun, daß er immer an den Quais hinfahren würde; aber da bekam ich's wieder mit der Angst, als ich bemerkte, daß wir über eine Brücke fuhren. Gerade aber als es zu regnen anfing, hielt die Kutsche, die nach einer sehr dunklen Stelle abgebogen war, plötzlich an. Der Kutscher aber stieg vom Bock und wollte zu mir hereinsteigen ... Er sagte, es regne zu sehr ...«
Claude lachte. Er hegte keinen Zweifel mehr. Dieser Kutscher da konnte unmöglich eine Erfindung von ihr sein. Als sie verlegen schwieg, sagte er:
»Gut, gut! Der Halunke ulkte!«
»Sofort sprang ich aus dem anderen Kutschenschlag hinaus. Dann hat er geflucht und mir gesagt, wir wären angelangt, und er würde mir, wenn ich nicht zahlte, meinen Hut nehmen ... Der Regen goß in Strömen, der Quai war vollständig verlassen. Ich verlor den Kopf und zog ein Fünffrankenstück hervor. Er hieb auf sein Pferd ein und ging mit meiner kleinen Reisetasche auf und davon, in der sich glücklicherweise bloß zwei Taschentücher, ein halber Windbeutel und der Schlüssel zu meinem unterwegs gebliebenen Koffer befanden.«
»Aber man merkt sich doch die Kutschennummer!« rief der Maler entrüstet.
Er erinnerte sich jetzt, daß er beim Überschreiten der Brücke Louis-Philippe im strömenden Unwetter einem aus Leibeskräften davonjagenden Fiaker begegnet war. Und er wunderte sich, wie unwahrscheinlich oft die Wahrheit ist. Das, was er für einfach und logisch gehalten hatte, war dem natürlichen Verlaufe der unendlichen Kombinationen des Lebens gegenüber geradezu dumm.
»Sie können sich vorstellen, wie mir unter dieser Tür zumute war!« schloß Christine ab. »Ich wußte ganz gut, daß ich mich nicht in Passy befand. Ich sollte also die Nacht hier, in diesem schrecklichen Paris hinbringen. Und die Donnerschläge, die Blitze, oh! Die schrecklichen blauen und roten Blitze, und die Angst vor all den Dingen, die sie mir zeigten!«
Ihre Lider hatten sich von neuem geschlossen. Ein Schauder machte sie erbleichen. Wieder sah sie die schreckliche Stadt vor Augen, die Löcher der Quais, die sich in den roten Blitzgluten hinzogen, den tiefen Graben des mit seinen bleifarbenen Fluten dahingleitenden Flusses, mit seinen großen, schwarzen Körpern, den Kähnen, die wie tote Walfische waren, den unbeweglich starrenden, ihre galgenartigen Arme reckenden Kranen. Würde sie hier ein Willkommen finden?
Es blieb ein Schweigen. Claude hatte sich wieder über seine Zeichnung hergemacht. Doch jetzt bewegte sie sich, der Arm schlief ihr ein.
»Ach, bitte, den Ellbogen ein bißchen weiter 'runter!«
Doch dann setzte er, um sich zu entschuldigen, und als ob er sich interessiere, hinzu:
»Ihre Eltern werden untröstlich sein, wenn sie von dem Unfall erfahren.«
»Ich habe keine Eltern.«
»Wie? Weder Vater noch Mutter ... Sie stehen allein da?«
»Ja, ganz allein.«
Sie war achtzehn Jahre alt und in Straßburg geboren, gerade zwischen zwei Garnisonswechseln ihres Vaters, des Hauptmanns Hallegrain. Als sie ihr zwölftes Jahr erreicht hatte, war der letztere, ein Gascogner aus Montauban, in Clermont gestorben. Er hatte sich einer Beinlähmung wegen dorthin zurückziehen müssen. Fünf Jahre lang hatte ihre Mutter dann, eine geborene Pariserin, dort in der Provinz von ihrer mageren Pension gelebt und gearbeitet, Fächer gemalt, um die damenmäßige Erziehung ihrer Tochter durchführen zu können. Seit fünfzehn Monaten war auch sie tot und hatte sie allein in der Welt zurückgelassen, ohne einen Sou, bloß mit einer Freundin, einer Nonne, der Oberin der Schwestern der Heimsuchung, die sie in ihrem Pensionat behalten hatte. Und geradewegs aus dem Kloster kam sie jetzt, nachdem es der Oberin endlich gelungen war, diese Stellung als Vorleserin bei ihrer alten Freundin, Madame Vanzade, die fast gänzlich erblindet war, ausfindig zu machen.
Claude war bei diesen neuen Einzelheiten still geblieben. Das Kloster da, die guterzogene Waise, das ganze romantische Abenteuer versetzten ihn wieder in seine Verlegenheit zurück, machten seine Worte und Bewegungen linkisch. Er arbeitete nicht mehr, hielt den Blick auf seine Skizze gesenkt.
»Ist Clermont schön?« fragte er endlich.
»Nicht gerade, eine düstere Stadt ... Übrigens weiß ich's nicht mehr; ich konnte das damals noch nicht so beurteilen.«
Sie hatte sich auf den Ellbogen aufgestützt und fuhr, wie im Selbstgespräch, mit einer noch von ihrer schluchzenden Trauer gebrochenen Stimme sehr leise fort:
»Mama war nicht sehr kräftig und rieb sich mit ihrer Arbeit auf ... Sie verwöhnte mich; nichts war gut genug für mich; für alles hatte ich Professoren. Und ich profitierte so wenig davon. Zuerst war ich krank geworden; dann paßte ich nicht ordentlich auf, immer war ich zum Lachen aufgelegt, hatt' ich das Blut im Kopfe ... Die Musik langweilte mich. Wenn ich am Piano saß, kriegt' ich den Krampf in die Arme. Mit dem Malen ging's noch am besten ...«
Er hob den Kopf, unterbrach sie mit dem Ausruf:
»Sie verstehen zu malen?«
»O nein, ich kann nichts, gar nichts ... Mama, die viel Talent hatte, brachte mir so ein bißchen das Aquarellieren bei, und ich half ihr manchmal die Hintergründe ihrer Fächer malen ... Sie malte sie so schön!«
Unwillkürlich glitt ihr Blick über das Atelier hin, über die erschreckenden Skizzen, von denen die Wände flammten. Und in ihren klaren Augen zeigte sich wieder eine Unruhe, das ängstliche Erstaunen über diese rohe Malweise. Aus der Entfernung sah sie auch etwas von der Studie, die der Maler nach ihr entworfen hatte, und war über die gewaltsamen Töne, die grob aus dem Schatten hervorstechenden Pastellzüge so konsterniert, daß sie nicht die Bitte wagte, sie aus der Nähe sehen zu dürfen. Übrigens fühlte sie sich in diesem glutheißen Bett nichts weniger als wohl, so daß sie sich, von dem Gedanken geplagt, daß sie gehen und mit diesen Dingen, die sie seit gestern erlebt hatte und die ihr vorkamen wie ein Traumbild, ein Ende machen müsse, unruhig hin und her bewegte.
Claude fühlte wohl durch, daß sie erschöpft war. Er schämte sich plötzlich, und sie tat ihm leid. Er ließ die Zeichnung unbeendet und sagte schnell:
»Viel Dank für Ihre Liebenswürdigkeit, mein Fräulein ... Verzeihen Sie, ich habe Ihnen wahrlich zuviel zugemutet ... Stehen Sie auf, stehen Sie auf, ich bitte Sie! Es wird Zeit, daß Sie zu Ihren eigenen Angelegenheiten kommen.«
Ohne zu verstehen, weshalb sie rot wurde und keine Anstalten machte, sondern im Gegenteil in dem Maße, als er sich da vor ihr beeiferte, ihre nackten Arme wieder versteckte, wiederholte er, daß sie doch aufstehen solle. Dann aber machte er eine jähe Handbewegung, unter der er den Bettschirm wieder vorschob und sich zum anderen Ende des Ateliers hinbegab, wo er mit einer übertriebenen Schamhaftigkeit geräuschvoll mit seinem Geschirr hantierte, damit sie, ohne befürchten zu müssen, vernommen zu werden, aus dem Bett schlüpfen und sich ankleiden könnte.
Inmitten des Gepolters, das er veranstaltete, überhörte er ihren zaghaften Anruf:
»Mein Herr! Mein Herr! ...«
Endlich spannte er sein Gehör an.
»Mein Herr, wenn Sie so gut sein wollten ... Ich finde meine Strümpfe nicht.«
Er stürzte eilig hinzu. Wo hatte er denn bloß seine Gedanken? Was dachte er denn, was sie machen sollte da hinter dem Schirm ohne ihre Strümpfe und Kleider, die er an die Sonne gehängt hatte? Die Strümpfe waren trocken, wie er sich vergewisserte, indem er sie leise rieb. Dann schob er sie hinter den dünnen Verschlag, wobei er ein letztes Mal ihren nackten, frischen, runden, kindlich anmutigen Arm wahrnahm. Dann warf er auch die Kleider über das Fußende des Bettes, stieß auch die Schnürschuhe hinzu; nur den Hut ließ er an der Staffelei hängen. Sie hatte Dankschön gesagt und sprach dann nicht mehr. Kaum vernahm er das Geräusch des Linnens, das leise Geplätscher des Wassers. Doch fuhr er fort, sich für sie zu bemühen.
»Die Seife liegt auf dem Tisch in einer Untertasse ... Ziehen Sie die Schublade auf, nicht wahr, und nehmen Sie ein frisches Handtuch ... Wünschen Sie noch mehr Wasser? Ich reiche Ihnen die Kanne hin.«
Der Gedanke, daß er's etwa wieder nicht richtig machen könnte, brachte ihn plötzlich außer sich.
»Ach, aber, nicht wahr, ich belästige Sie ... Tun Sie ganz, als ob Sie zu Haus wären!«
Er wandte sich wieder seiner Wirtschaft zu. Zweifel plagten ihn. Sollte er ihr ein Frühstück anbieten? Er konnte sie doch kaum so gehen lassen. Andererseits würde das aber kein Ende geben, er würde bestimmt um seine Vormittagsarbeit kommen. Ohne einen letzten Entschluß fassen zu können, wusch er, nachdem er seinen Spirituskocher in Brand gesetzt hatte, die Kasserolle und schickte sich an, Schokolade zu bereiten. Er hielt das für besonders angemessen und schämte sich im geheimen seines Nudelrestes wegen. Er schnitt zum Mahle Brot ab, das er nach der Sitte des Südens mit Öl tränkte. Aber er bröckelte eben noch Schokolade in die Kasserolle, als er plötzlich ausrief: »Wie! Schon?«
Christine hatte den Schirm beiseite gestoßen und war schmuck und sauber geschnürt und zugeknöpft in ihrem schwarzen Kleid zum Vorschein gekommen, im Handumdrehen fix und fertig geworden. Ihr rosiges Gesicht zeigte nicht die geringste Spur von Wasser mehr. Ihr schwarzer Haarknoten hing auf den Nacken herab, ohne daß die geringste Strähne hervorstak. Claude war starr über dies Wunder von Geschicklichkeit, über den Eifer, mit dem sie sich wie eine brave, kleine Hausfrau in aller Eile angekleidet hatte.
»Ah, Donnerwetter! Wenn Sie alles so machen!«
Er fand sie größer und schöner, als er geglaubt hatte. Was ihn aber besonders traf, war die ruhige Entschiedenheit ihres Gesichtsausdruckes. Offenbar hatte sie keine Angst mehr vor ihm. Es schien, daß sie, nun sie dies zerlegene Bett verlassen, in dem sie sich nicht in Sicherheit gefühlt, mit ihren Schuhen und ihrem Kleid ihre Rüstung wiedergefunden hatte. Sie lächelte und sah ihm gerade in die Augen. Und da sagte er, was auszusprechen er noch gezaudert hatte:
»Sie frühstücken doch mit mir?«
Doch sie lehnte ab.
»Nein, danke ... Ich werde zum Bahnhof gehen, wo sicher mein Koffer angekommen ist, und werde mich dann sofort nach Passy bringen lassen.«
Vergeblich wiederholte er, daß sie doch Hunger haben müßte und daß es unvernünftig wäre, mit leerem Magen aufzubrechen.
»So will ich wenigstens gehen und Ihnen einen Fiaker holen!«
»Nein, ich bitte Sie, machen Sie sich keine Umstände.«
»Aber Sie können doch so einen langen Weg nicht zu Fuß machen. Gestatten Sie mir wenigstens, daß ich Sie bis zur Fiakerhaltestelle begleite, da Sie doch in Paris unbekannt sind.«
»Nein, nein, es ist nicht nötig ... Wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, so lassen Sie mich ganz allein gehen.«
Es war ein fester Entschluß. Ohne Zweifel beunruhigte sie der Gedanke, daß sie, wenn auch von Unbekannten, mit einem Mann zusammen gesehen werden könnte. Sie würde verschweigen, wo sie die Nacht zugebracht, würde irgend etwas erzählen und die Erinnerung an das Abenteuer für sich behalten. Mit einer zornigen Handbewegung tat er, als ob er sie zum Kuckuck schicke. Fort mit Schaden! Es konnte ihm nur passen, daß er nicht mitzugehen brauchte. Doch fühlte er sich im Grunde verletzt, fand sie undankbar.
»Na, wie Sie wollen. Ich will mich Ihnen nicht aufdrängen.«
Bei diesem Ausdruck wurde das unbestimmte Lächeln Christines deutlicher und bog ihr leise die feinen Mundwinkel. Sie sagte nichts, nahm ihren Hut und suchte mit den Augen nach einem Spiegel. Da sie aber keinen fand, entschied sie sich, seine Bänder auf gut Glück zuzuknüpfen. Ohne Hast warf und zog sie die Bänder mit hochgehobenen Ellbogen, das Gesicht von der Sonne bestrahlt. Claude war überrascht, die Züge der kindlichen Anmut, die er soeben gezeichnet hatte, nicht mehr wiederzuerkennen. Der obere Teil, die reine Stirn, die sanften Augen waren verschattet; der untere Teil dagegen trat jetzt hervor: die leidenschaftliche Kinnpartie, der halbgeöffnete Mund, die schönen Zähne. Und dabei hatte sie noch immer dies rätselhafte Jungmädchenlächeln, das sich vielleicht gar über ihn belustigte.
»Jedenfalls mein' ich«, fuhr er erregt fort, »daß Sie mir keinen Vorwurf machen können.«
Diesmal konnte sie ein leicht nervöses Lachen nicht mehr unterdrücken.
»Nein, nein, mein Herr! Nicht im geringsten.«
Noch immer sah er sie im inneren Zwiespalt seiner Schüchternheit und seiner Ungewißheit und in der Furcht, er könne ihr lächerlich sein, prüfend an. Aber was wußte sie denn, das vornehme Fräulein? Ohne Zweifel, was so die Pensionsmädchen wissen: alles und nichts. Es handelte sich um das ganz unbeikömmliche, heimliche Aufblühen der Sinne und des Herzens. War ihre keusche Sinnlichkeit hier, in dieser freien Künstlerumgebung, im Dunkel sich mischender Neugier und Furcht vor dem Manne vielleicht zum Durchbruch gelangt? Hatte sie es jetzt, wo sie nicht mehr zagte, vielleicht mit der ein wenig verächtlichen Überraschung, daß sie sich überhaupt vor ihm gefürchtet hatte? Wie! So gar keine Artigkeitsbezeugung? Nicht mal ein Kuß auf die Fingerspitzen? Die brummige Gleichgültigkeit dieses Junggesellen, die sie zu erfahren bekommen hatte, mußte ja das Weib in ihr, das sie noch nicht war, unruhig machen. Und so entfernte sie sich jetzt verärgert, irritiert, spielte in ihrem Verdruß die Tapfere, trug unbewußt das Bedauern mit sich fort, daß ihr die schrecklichen Dinge, die nicht geschehen, unbekannt geblieben waren.
»Sie sagten«, fuhr sie fort und wurde wieder ernst, »daß die Haltestelle am Ende der Brücke auf dem anderen Quai wäre?«
»Ja, an der Stelle, wo die Baumgruppe steht.« Sie hatte ihre Hutbänder vollends zugeknüpft, hatte die Handschuhe an und war nun bereit, stand mit hängenden Armen da, ging aber noch nicht, sondern sah vor sich hin. Ihr Blick war auf das gegen die Wand gelehnte große Gemälde getroffen. Sie hatte es mit dem Verlangen, ihn zu bitten, es sehen zu dürfen; doch dann wagte sie's nicht. Nichts hielt sie mehr zurück; und doch nahm es sich aus, als ob sie noch nach etwas suchte, als hätte sie die Empfindung, daß sie etwas zurückließe, das sie nicht zu nennen gewußt hätte. Endlich schritt sie auf die Tür zu.
Als Claude öffnete, fiel ein kleines, gegen die Tür gelehntes Brot ins Atelier herein.
»Sie sehen«, sagte er, »daß Sie mit mir hätten frühstücken können. Meine Pförtnerin bringt mir das jeden Morgen.«
Von neuem lehnte sie mit einer Kopfbewegung ab. Auf dem Treppenflur wandte sie sich um und stand einen Augenblick unbeweglich da. Sie hatte ihr munteres Lächeln wiedergewonnen und hielt ihm zum erstenmal die Hand hin.
»Dank, vielen Dank!«
Er hatte die kleine, behandschuhte Hand in seine breite, vom Pastellstift beschmutzte genommen. Beide blieben sie ein paar Sekunden so, drückten sich die Hand, schüttelten sie als gute Freunde. Noch immer lächelte ihn das junge Mädchen an und hatte auf den Lippen die Frage: »Wann werd' ich Sie wiedersehen?« Doch eine Scham hielt sie zurück, sie auszusprechen. Endlich nahm sie, nachdem sie noch etwas gewartet hatte, ihre Hand aus der seinen.
»Leben Sie wohl, mein Herr!«
»Leben Sie wohl, mein Fräulein!«
Und schon stieg Christine, ohne den Kopf noch einmal zuheben, die Müllerstiege mit ihren krachenden Stufen hinab. Claude aber warf grob die Tür zu und trat wieder ein, wobei er ganz laut sagte:
»Ah, diese Donnerwetter-Weibsbilder!«
Er war wütend, aufgebracht über sich und alle Welt. Und indem er mit dem Fuß gegen die Möbel stieß, die ihm in den Weg gerieten, fuhr er fort, mit lauter Stimme seinem Herzen Luft zu machen. Wie recht tat er daran, daß er niemals eine mit heraufließ! Diese Weibsen waren bloß dazu gut, einen zu übertölpeln. Wer bürgte ihm zum Beispiel dafür, daß die mit ihrer unschuldigen Miene da sich nicht in der ausbündigsten Weise über ihn lustig gemacht hatte? Und er war so einfältig gewesen, daß er ihr ihre Geschichte da geglaubt, mit der sie doch bloß bezweckt hatte, hier oben zu übernachten. Alle seine Zweifel stellten sich wieder ein. Niemals würde ihm jemand die Generalswitwe, den Eisenbahnunfall und gar die Geschichte mit dem Kutscher glauben machen. War es denkbar, daß so etwas passierte? Übrigens konnte man sagen, daß sie einen zu großen Mund hatte, und ihr Gesichtsausdruck war, als sie sich davongemacht hatte, ein durchtriebener gewesen. Wenn er bloß hätte verstehen können, aus was für einem Grund sie gelogen hatte. Aber nein, so ohne jeden Zweck zu lügen, so ganz unverständlicherweise, rein der Kunst wegen! Ah, sie mochte sich jetzt schön ins Fäustchen lachen!
Heftig faltete er den Bettschirm zusammen und schmiß ihn in einen Winkel. Sie hatte doch sicher alles in Unordnung gelassen. Aber als er feststellte, daß alles sich sehr sauber an Ort und Stelle befand, die Waschschüssel, das Handtuch, die Seife, ereiferte er sich, weil sie das Bett nicht gemacht hatte. Mit übertriebener Anstrengung machte er sich daran, es in Ordnung zu bringen, packte mit beiden Armen die noch warme Matratze, klopfte, benommen von diesem warmen, reinen Jugendduft, den das Linnen hauchte, mit beiden Fäusten auf das Kopfkissen los. Dann spülte er sich gründlich mit Wasser ab, um sich die Schläfen zu kühlen, und erfuhr von dem feuchten Handtuch dieselbe Benommenheit, denselben jungfräulichen Hauch, der mit seiner Anmut das ganze Atelier erfüllend ihn von überallher bedrängte. Fluchend und von einer derartigen Malwut befallen, daß er in seiner Hast das Brot in großen Happen hinunterschlang, trank er dann aus der Kasserolle die Schokolade.
»Aber die Hitze ist ja zum Umkommen, man wird ja ganz krank!« schrie er plötzlich.
Die Sonne war fort, es war nicht mehr so heiß. Aber Claude öffnete oben am Dach eine Luke und sog mit großer Erleichterung die hereindringenden warmen Windstöße ein. Dann ergriff er seine Zeichnung, den Kopf Christines, und verlor sich lange in seinen Anblick.
II
Es hatte Mittag geschlagen, Claude arbeitete an seinem Bild, als in vertraulich derber Weise angeklopft wurde. Mit einer instinktiven Bewegung ließ der Maler den Kopf Christinens, nach welchem er das Gesicht des großen Weibes auf seinem Bild umarbeitete, in eine Mappe gleiten. Dann entschloß er sich, zu öffnen.
»Pierre!« rief er. »Du schon?«
Pierre Sandoz, ein Jugendfreund von ihm, war ein Bursch von zweiundzwanzig Jahren, sehr braun, mit einem runden, eigensinnigen Kopf, einer eckigen Nase, sanften Augen, einer energischen, von einem angehenden Bartwuchs umrahmten Gesichtsform.
»Ich habe früher als sonst gefrühstückt«, wurde zur Antwort. »Ich wollte dir eine recht ausgiebige Sitzung geben ... Ah, Teufel! das rückt ja vorwärts!«
Er hatte sich vor das Gemälde gestellt und fügte sofort hinzu:
»Ah, du veränderst den Ausdruck des Weibes.«
Ein langes Schweigen blieb. Alle beide betrachteten unbeweglich das Bild. Es war eine Leinwand von fünf zu drei Metern. Es war schon ganz bemalt; doch hoben sich einige Stücke nur erst im ungefährsten Entwurf hervor. Dieser hingeworfene Entwurf zeigte eine prächtige Kraft und war in der Farbe feurig und lebensvoll. In eine von dicken, grünen Baumwänden eingeschlossene Waldlichtung fiel eine Flut von Sonnenlicht. Nur zur Linken bohrte sich eine tiefe Allee ein, die einen ganz fernen Lichtfleck hatte. Dort lag im Gras, mitten in der üppigen Junivegetation, einen Arm unterm Kopf, mit geschwellter Brust ein nacktes Weib. Ohne wohin zu blicken, die Lider geschlossen, lachte sie in den goldenen Lichtregen hinein, der sie badete. Im Hintergründe aber rangen lachend miteinander zwei andere, gleichfalls nackte Weiber, ein braunes und ein blondes, und gaben in all dem grünen Laub zwei köstliche Fleischtöne. Da der Maler im Vordergrund aber einen Gegensatz von Schwarz gebraucht hatte, hatte er sich einfach damit geholfen, daß er in das Bild einen in ein schlichtes schwarzes Sammetjackett gekleideten Herrn hineingesetzt hatte. Der Herr wandte einem den Rücken; man sah nichts als im Gras seine linke Hand, auf die er sich stützte.
»Das Weib kommt schon sehr schön raus«, sagte Sandoz endlich. »Aber, Wetter! Du wirst mit alldem ein gehöriges Stück Arbeit haben.«
Claude, dessen Augen flammend auf seinem Werk hafteten, hatte eine zuversichtliche Handbewegung.
»Bah! Ich hab' noch Zeit, bis es in die Ausstellung kommt. In sechs Monaten zwingt man's schon! Diesmal werd' ich ihnen vielleicht denn doch zeigen, daß ich kein Stümper bin.«
Ohne es zu sagen, war er von der Skizze, die er von Christines Kopf genommen, so entzückt und im übrigen so gehoben von einer jener großen Anwandlungen von Hoffnung, aus denen er dann infolge seiner leidenschaftlichen Natur um so grausamer in den Zweifel an seinem Künstlertum zurückfiel, daß er anfing, laut vor sich hin zu pfeifen.
»Vorwärts! Nicht gebummelt!« rief er. »Da du da bist, wollen wir anfangen.«
Aus Freundschaft und um ihm die Kosten für ein Modell zu ersparen, hatte Sandoz ihm angeboten, ihm für den Mann im Vordergrund Modell zu stehen. Er hatte nur Sonntag dafür frei, und in vier, fünf Sonntagen sollte die Figur fertig sein. Schon wollte er das Sammetjacket anziehen, als ihm plötzlich eine Überlegung kam.
»Sag' mal, da du ja arbeitest, hast du gewiß noch nicht ordentlich gefrühstückt ... Geh und iß ein Kotelett, ich warte solange.«
Doch der Gedanke, Zeit zu verlieren, brachte Claude auf.
»Aber gewiß doch hab' ich gefrühstückt, sieh doch die Kasserolle! ... Und da liegt sogar noch Brot, das ich im Notfall essen kann ... Los, los, Faulpelz!«
Hastig hatte er nach der Palette gegriffen, die Pinsel zupacken gekriegt und fügte hinzu:
»Dubuche holt uns heut abend ab, nicht wahr?«
»Ja, gegen fünf.«
»Na gut, dann gehen wir gleich dinieren ... Bist du bereit? Die Hand mehr nach links, den Kopf noch tiefer!«
Nachdem er die Kissen zurechtgelegt, hatte Sandoz sich auf der Chaiselongue eingerichtet und seinen Platz eingenommen. Er wandte den Rücken her, doch die Unterhaltung ging nichtsdestoweniger noch eine Weile weiter; denn er hatte heut morgen einen Brief aus Plassans erhalten, der kleinen provenzalischen Stadt, wo der Maler und er, seit sie im Kolleg die ersten Hosen durchgesessen, miteinander bekannt geworden waren. Dann schwiegen sie. Weltentrückt arbeitete der eine, während der andere, von seiner langen, bewegungslosen Haltung ermüdet, vor sich hindämmerte.
In seinem neunten Lebensjahr hatte sich Claude die günstige Gelegenheit geboten, Paris zu verlassen und in den Provinzwinkel, in dem er geboren, zurückkehren zu können. Seine Mutter, eine wackere Wäscherin, die von ihrem Tunichtgut von Mann im Stich gelassen worden war, hatte nämlich einen braven Arbeiter geheiratet, der sich närrisch in die hübsche Blondine verliebt hatte. Doch so unverdrossen sie schafften, hatte es ihnen nicht glücken wollen, voranzukommen. Und so waren sie mit großer Freude darauf eingegangen, als ein alter Herr ihnen angeboten hatte, Claude bei sich aufzunehmen und ihn aufs Kolleg zu schicken. Er war ein Original, ein Kunstliebhaber gewesen, und es hatte sich bei ihm um solch eine edelherzige Schrulle gehandelt; die Männchen, die der Kleine damals so hingekritzelt hatte, hatten ihm gefallen. So war Claude sieben Jahre lang, bis zur Unterprima, im Süden geblieben, zuerst als Pensionär, dann außerhalb des Kollegs bei seinem Beschützer. Eines Morgens hatte man den letzteren vom Schlag getroffen tot auf seinem Bett liegen gefunden. Er hatte dem jungen Menschen, mit der Bestimmung, daß dieser im Alter von fünfundzwanzig Jahren frei über das Kapital verfügen könnte, testamentarisch eine Rente von tausend Franken ausgesetzt. Claude hatte, schon damals fieberhaft für die Malerei begeistert, sofort, ohne erst das Bakkalaureat zu erwerben, das Kolleg verlassen Und war nach Paris geeilt, wohin ihm sein Freund Sandoz bereits vorausgegangen war.
Im Kolleg von Plassans waren Claude Lantier, Pierre Sandoz und Louis Dubuche in der Prima die drei Unzertrennlichen genannt worden. Aus verschiedenen Gegenden stammend, auch ihrem Wesen nach verschieden geartet, nur in demselben Jahr, bloß ein paar Monate auseinander, geboren, hatten sie sich auf Grund einer verwandten inneren Anlage, des Stachels eines ihnen noch unbewußten inneren Ehrgeizes und ihrer erwachenden höheren Intelligenz, inmitten des rohen Schwarmes der abscheulichen Flegel, von denen sie geschlagen wurden, sofort und für immer zusammengeschlossen. Sandoz' Vater, ein wegen einer politischen Verwicklung nach Frankreich geflüchteter Spanier, hatte unweit Plassans eine Papiermühle gegründet, in der neue, von ihm erfundene Maschinen arbeiteten. Infolge der Böswilligkeit der Einwohnerschaft war er dann, von Kummer und Herzeleid aufgerieben, gestorben und hatte seine Witwe in einer so schwierigen Lage zurückgelassen und in einer Folge von so verwickelten Prozessen, daß ihr ganzes Vermögen draufgegangen war. So war Sandoz' Mutter, eine geborene Burgunderin, den Provenzalen, denen sie Schuld an einer schleichenden Lähmung gab, an der sie litt, grollend, mit ihrem Sohn nach Paris geflohen, der sie, den Kopf voll literarischer Ruhmesträume, hier von den Einkünften einer bescheidenen Anstellung durchbrachte. Was Dubuche, den ältesten Sohn einer Plassanser Bäckerin, anbetraf, so war er, von seiner sehr strengen, ehrgeizigen Mutter angespornt, später den Freunden nachgekommen und besuchte als Architekt die Akademie. Er lebte schlecht und recht von den kärglichen hundert Sous, die seine Eltern ihm aussetzten, wobei sie mit dem versessenen Geiz von Juden seine Zukunft mit dreihundert Prozent diskontierten.
»Gottswetter!« murmelte Sandoz in das herrschende Schweigen hinein. »Deine Pose ist nicht gerade bequem; sie zerbricht mir jedes Gelenk ... Darf man sich nicht ein bißchen bewegen?«
Ohne zu antworten, ließ Claude ihn sich recken. Er war bei dem Sammetjackett, das er mit forschen Pinselstrichen bearbeitete. Er bog sich jetzt zurück, blinzelte und brach, von einer plötzlichen Erinnerung belustigt, in ein lautes Lachen aus.
»Weißt du noch, wie in der Tertia eines Tages Pouillaud im Schrank des Trottels Lalubie Kerzen ansteckte? Der Schreck, wie Lalubie, eh' er auf sein Katheder 'naufklomm, seinen Schrank öffnete, seine Bücher 'rausnehmen wollte und die strahlende Kapelle sah! ... Die ganze Klasse bekam fünfhundert Verse aufgebrummt.«
Von der Heiterkeit des Freundes angesteckt, hatte Sandoz sich auf der Chaiselongue herumgewandt. Er nahm jetzt seine Haltung wieder ein und sagte:
»Ah, das Vieh von Pouillaud! ... Weißt du, in dem Brief, den er mir heut morgen schrieb, zeigt er mir gerade an, daß Lalubie sich verheiratet hat. Der alte Waschlappen von Professor nimmt sich noch ein hübsches, junges Mädchen. Übrigens kennst du sie ja, die Tochter von Gallisard, dem Kurzwarenhändler, die kleine Blonde, der wir Ständchen brachten.«
Die Erinnerungen waren im Gange. Claude und Sandoz fanden kein Ende, wobei der eine wie gepeitscht, mit wachsendem Fiebereifer malte, während dem anderen, der, das Gesicht gegen die Wand, ihm den Rücken zukehrte, im Eifer des Erzählens die Schultern zuckten.