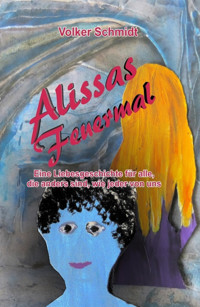3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Wunder des Tschambutschi" Ein visionäres Märchen auf dem Weg zum Frieden ist eine fantasievolle Traumgeschichte, angelegt im Gegensatz zwischen Kapitalismus und dem Wert des einfachen Lebens im Einklang mit der Natur. "Ich verzichte auf dein Paradies, denn es ist ein Paradies des Grauens". Mit diesen Worten lehnt Kamal, ein junger Inder, das Geschenk seines Vaters, des Maharadschas von Marwa, ab, der ihm sein ganzes Reich zu Füßen legen will. Was bedeutet der Begriff "Paradies" für uns Menschen? Ein symbolträchtiges, vielseitig hinterfragendes Märchen entführt uns in den altindischen Rentenkapitalismus vergangener Jahrhunderte. Doch in abgewandelter Form sind dessen Strukturen noch heute vielfältig in Indien zu finden, ja nicht nur dort, sondern überall, wo materialistische Denkstrukturen, rücksichtsloses Konkurrenzdenken und Zuwachs um jeden Preis die Gebote der Politik und das Wesen der Gesellschaft bestimmen. Unserer kapitalistischen Lebensweise steht in der märchenhaften Erzählung die Welt eines nach seinen traditionellen Überzeugungen lebenden Ökovolkes gegenüber. In Anlehnung an die Lebensstrukturen und die Geschichte des tatsächlich existierenden Bishnoi-Volkes in der Rajasthan-Wüste, kombiniert mit tiefgründigen Visionen, wird ein Lebensmodell ausgebreitet, welches uns in Staunen versetzt und herausfordert zugleich. Ein Miteinander allen Lebens voll Frieden und Würde bringt dort die Wüste zum Blühen, lässt sie kleiner werden, verschwinden. Vieles, was uns in der Erzählung märchenhaft erscheint, beruht auf authentischen Fakten, auf naturnahem Erleben, ist Beweis, dass andere Wege möglich sind. Der Konflikt zwischen dem Gefangensein im Bestehenden und der Sehnsucht nach etwas Frieden bringendem Neuen ist in unserer Gesellschaft offenkundig. Wen wundert es da noch, dass immer mehr nach Orientierung suchende, aufgeschlossene Menschen, besonders auch junge Leute, aufbrechen, um ihren eigenen, befreienden, naturnahen Weg zu finden. J
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Schmidt
Das Wunder des Tschambutschi
Ein visionäres Märchen auf demWeg zum Frieden
Unser Glück hängt nicht davon ab,wie viel wir haben, sondern davon,ob uns das, was wir haben,Würde und Frieden bringt.
Volker Schmidt
Der Autor
Volker Schmidt ist studierter Biologe, Geograph, Pädagoge und freier Journalist bei einer großen regionalen Tageszeitung. Sein literarisches Engagement gilt neben der Pressearbeit der Bewusstmachung der heute in vieler Weise problematischen Entwicklung von Natur, Mensch und Gesellschaft. Seine Bücher sind aktuell animierend und oft zugleich märchenhaft, wobei sein verständlicher Umgang mit den Inhalten Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen fasziniert.
Neben seinen Büchern schreibt Volker Schmidt umweltkritische Gedichte und Kurzgeschichten. Wegen seiner hintergründigen, bissigen Umweltlyrik hat ihn der Süddeutsche Rundfunk nicht zu Unrecht als „Robin Hood mit spitzer Feder“ bezeichnet.
Volker Schmidt ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und lebt zusammen mit seiner Frau in einem naturnahen kleinen Rosenparadies im Frankenland.
Impressum
Originalausgabe
1.Auflage 2016
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Alle Rechte vorbehalten, kein Text des Werkes darf in irgendeinerForm ohne schriftliche Genehmigung des Verlags oder des Autorsreproduziert oder verbreitet werden.
Verantwortlich für die Inhalte: Volker Schmidt, Landvogt HeinrichStraße 10, 91602 Dürrwangen
Satz und Umschlagsgestaltung: Hans Schmutterer OberkemmathenUmschlagsmotiv: Heide Büttner, Freiburg
ISBN e-Book 978-3-7345-3162-0
ISBN Taschenbuch 978-3-7354-3160-6
ISBN Hardcover 978-3-7354-3161-3
Inhalt
Unruhige Nacht
Zwischenfall
Atulana
Reichtum
Die blauen Pferde
Nächtlicher Spuk
Bei den Bishnoi
Unter dem Ketribaum
Sanitas Weg
Xeniola
Warum nur?
Amavasya-Tag
Tschambutschi
Tod und Leben
Monsun
Verbrannte Erde
Gebote
Die Entdeckung
Mulatango
Zwei Welten
Ängste
Wallfahrt
Unruhige Nacht
Nach Meinung der Dorfbewohner war eine Schlange in der Hütte nichts Außergewöhnliches. Sie brächte sogar Glück und diese hier, Mulatango, eine Kobra, habe sich bestimmt nur zufällig das Gebälk der Hütte als Unterschlupf ausgesucht, denn eigentlich mieden Schlangen die Nähe von Menschen. Überhaupt seien Schlangen jetzt in der Nacht, wo es schon recht kühl war, doch zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Kamal, ein junger Mann, der in der Hütte wohnte, könne sich also getrost zur Ruhe legen. Auch die kleinen Frösche, die sich immer wieder in die leicht gebauten Behausungen der Menschen verirrten, seien harmlose Glücksboten.
Kamal lag trotzdem wach, nicht nur wegen der Schlange. Er war zu aufgewühlt, um einschlafen zu können. Ruhelos starrte er in die Dunkelheit. Das raue Reisig seiner harten Lagerstatt drückte sich schmerzvoll in die weiche Haut seines Rückens und schon jetzt dachte Kamal mit Unbehagen daran, wie er morgen früh wieder mit schmerzenden Gliedern und obendrein noch halb erstarrt von der Kälte der Nacht aufstehen würde. Wie jeden Morgen und jeden Abend würde er widerwillig den Hirsebrei mit Pfeffersauce hinunterwürgen. Es schüttelte ihn bei dem Gedanken an die warme, trübe Brühe, die ihm als einziges Getränk, als »Wasser« - zum Stillen seines Durstes diente. An das lästige Nichtstun, die Monotonie der Tage konnte er sich auch nur schwer gewöhnen. Kamal fühlte sich wie ein Gefangener und doch hatte ihn niemand gefangen gesetzt und niemand hielt ihn fest.
Neben ihm lag die Frau, bei der er Unterschlupf gefunden hatte. Er spürte ihre Wärme durch das raue Tuch, in welches ihr Körper gehüllt war. Er roch die seltsame Duftmischung aus Lehm, Rauch und den Ausdünstungen einer Kuh, die in dem kleinen Stall stand, der ohne eine Türe mit dem einzigen Raum der Hütte verbunden war.
Kamal hörte Sanitas ruhigen Atem, doch auch sie konnte nicht schlafen. An den hohen Summton einzelner Mücken, der unvermittelt abbrach und dem unweigerlich lästige Stiche folgten, hatte sie sich längst gewöhnt. Auch das Schreien der Nachtvögel, das Lachen der Schakale und das Rascheln der Mäuse im Hirsespeicher waren ihr vertraut. Das, was ihr den Schlaf raubte, war der Mann, der neben ihr lag. Sie liebte Kamal von ganzem Herzen seit dem Moment, in dem er fast leblos unter einem Ketribaum gefunden worden war und ihn die Männer ins Dorf gebracht hatten. Sie war es, die ihm damals den ersten Schluck Wasser eingeflößt hatte. Anmutig, geheimnisvoll, fremdartig erschien er ihr und doch fühlte sie, dass sie ihm irgendwie seelenverwandt war. Aber je mehr Sanita über die Herkunft des Fremden erfuhr, umso verzagter wurden ihre Hoffnungen, umso unsicherer ihre Gefühle. Unüberwindbare Grenzen schienen die beiden zu trennen.
Kamal war dankbar für Sanitas liebevolle Pflege, für die Wärme ihrer Nähe, eine Wärme, wie er sie noch nie empfunden hatte. Doch alles, was ihm in dem kleinen Dorf der Bishnoi bisher widerfahren war, empfand er gleichzeitig als wohltuend und unfassbar fremd, als heilend und quälend.
Bilder der Vergangenheit, die durch die nächtliche Stille noch an Intensität gewannen, tauchten vor seinem inneren Auge auf.
Er sah sich in prächtigen Gewändern, sein weiches Lager mit Seidenkissen und prachtvoll bestickten Decken. Er sah verführerische Frauengestalten in aufreizenden Kleidern, die mit viel Geschick sinnliche Gefühle in ihm weckten. Eine mit köstlichen Speisen reich gedeckte Tafel tauchte auf, silbernes Tafelgeschirr und goldene Pokale, gefüllt mit kühlem, klarem Wasser und frischen Säften köstlicher exotischer Früchte.
Kamal sah seinen Vater, der als Maharadscha von Marwa von seinem prächtigen Palast aus sein großes Reich regierte. Er sah, wie dessen Macht und Reichtum ständig wuchsen, wie die edlen Künste und die Wissenschaften an seinem Hofe blühten. Er sah Schalen voller Edelsteine, träumte von Rassepferden, Gärten mit Springbrunnen und kostbaren Blumen. Er sah viele Menschen, die sich vor seinem Vater und auch vor ihm, dem Sohn des Herrschers, in den Staub warfen, die ihnen huldigten, ihnen zujubelten. Kamal sah sein fernes Paradies.
Das harte Lager, die Mückenstiche und das Schreien der Nachtvögel holten ihn von seinen Traumbildern zurück. Er, der reiche Sohn des großen Maharadschas von Marwa, war in einem Wüstenleben gefangen, um sich offenbar nur Menschen, für die es nichts anderes zu geben schien als Feldarbeit, die Pflege von Ziegen und Kühen und Hirsebrei mit Pfeffersauce. Tatenlos musste er hier warten, immer nur warten, bis irgendjemand in die einsame Abgeschiedenheit dieses Dorfes kam, der seine Heimat Marwa kannte, der ihm den Weg zurück nach Hause zeigen konnte, zurück in sein Paradies. Würde man ihn überhaupt jemals finden und wie lange würde das wohl dauern?
„Sanita, wann kommt endlich dieser Kaufmann aus der Ferne, der mir hoffentlich sagen kann, wo meine Heimat liegt. Ich will zurück, ich will wieder leben, verstehst du.“
„Vielleicht kommt er morgen“, antwortete Sanita traurig, „vielleicht in ein paar Tagen, vielleicht erst nach dem großen Regen. Ich weiß es nicht und eigentlich ist es auch nicht wichtig für mich, für unser Dorf, für alle Bishnoi.“
Kamal schwieg. Sanitas Antwort, so ruhig sie auch gesprochen war, machte ihn zornig. Er fühlte sich machtlos, hilflos und eingesperrt wie ein Tier in seinem Käfig.
„Sanita“, begann Kamal nach einer Weile, „warum lebt ihr nur dieses erbärmliche Leben ohne Freuden, ohne Genuss, ohne Zukunft, ohne Glück? Warum geht ihr nicht in die großen Städte, um reich zu werden? Spürt ihr denn nicht den Drang nach Wohlstand, nach Fortschritt, nach Macht? Habt ihr denn keine Sehnsucht nach einem besseren Leben? Wo ist euer Vorwärtsstreben, Sanita? Was seid ihr nur für seltsame Wesen!“
Vielleicht war Sanita nur müde, erschöpft von der harten Arbeit des Tages oder es war ein weiteres Stück Resignation, ein Stück Hoffnungslosigkeit für ihre Liebe. Nicht zum ersten Mal erlebte sie den seltsamen Fremden an ihrer Seite so aufgebracht.
„Unser Glück ist unsere Gemeinschaft, unser Wohlstand ist unsere Erde“, sagte sie zaghaft mit leiser Stimme, „und die Zukunft wird unseren Kindern und unseren Enkeln gehören. Unsere menschliche Würde, Kamal …“, Sanita stockte bei ihren Worten, als müsse sie nachdenken, „unsere Würde … hast du deine Würde eigentlich schon gefunden?“ Beide schwiegen lange und starrten ins Dunkle. „Kamal, ich bin müde. Ich möchte jetzt schlafen. Ich wünsche auch dir tiefen Schlaf, und dass er dir ein Stück Frieden bringt.“
Kamal war wütend über die tiefe Ruhe in Sanitas Worten, darüber, dass er den Sinn ihrer Worte nicht erfassen konnte und noch mehr darüber, dass sie jetzt nicht mit ihm diskutieren wollte. Doch er verstand, dass sie wirklich müde war. Außerdem war da noch etwas, was ihn schweigen ließ: Diese gütige, stabile Gelassenheit, mit der Sanita ihm, dem jungen, aufgebrachten Herrscher von Marwa, immer wieder begegnete, machte ihn unsicher und das wache, friedvolle Strahlen der Augen von ihr und allen Menschen des Dorfes weckte seine Neugier auf das Geheimnis, das aus diesen Blicken sprach. An Schlaf war für Kamal nicht zu denken. Neue Bilder, Erlebnisse aus vergangenen Tagen zogen an ihm vorüber.
Zwischenfall
Der ferne Schrei einer Eule durchschnitt die Stille der Nacht. Doch Kamal glaubte, ein fernes Fanfarensignal von einem der Wachtürme an der Festungsmauer des heimischen Palastes zu hören. Dann drang hektisches Rufen und das dumpf dröhnende Zuschlagen des schweren eisenbeschlagenen Tores, das zum Innersten der Palastanlage führte, an sein Ohr. Schon im nächsten Moment zerschnitt schauriges Kriegsgeschrei den Frieden. Das Klirren von Schwertern, heisere Kommandos und angstvolles Wiehern von Pferden war von jenseits der Mauern zu hören. Brennende Teerpfeile zischten durch die Luft und trafen an verschiedenen Stellen das Dach des Palastes. Die aufflackernden Brände wurden jedoch schnell von der aufgeregten Dienerschaft gelöscht.
Kamal und seinen Vater beunruhigte das, was sie hörten, wenig. Sie empfanden es nicht als Bedrohung, eher als Belästigung. Beide stiegen auf den höchsten Turm des Palastes, von wo aus sie durch schmale Sehschlitze das Geschehen vor den Mauern beobachten konnten. Es war, wie sie vermutet hatten: An der Ausrüstung und den Fahnen der Kämpfer war unschwer zu erkennen, dass es die räuberische Horde des benachbarten Maharadschas von Osis war, die versuchte, den Palast zu stürmen.
„Wieder einmal“, meinte der Vater verächtlich und sein hintergründig bitteres Lächeln zeigte, welchen Ausgang des Überfalls er erwartete. Kamal erinnerte sich, wie es dann weiterging, wie es jedes Mal weiter gegangen war, solange er denken konnte.
Da, der schneidende Befehl von einem der Türme: „Kanonen … Feuer!“ Wohl an die 30 Kugeln schlugen gleichzeitig ins Kampfgetümmel ein. Ein weiteres Mal erschallte der Befehl und noch einmal. Erstaunlich schnell verflog der Lärm der Schlacht. Stille trat ein. Ein Bild der Verwüstung tat sich vor Kamals Erinnerung auf: Die Einschlagkrater der Kanonenkugeln, zerfetzte, blutige Leiber, sich in Todesqualen wälzende Pferde, das Stöhnen der Verletzten, brennende Hütten und in der Ferne in wilder Flucht davonjagende feindliche Reiter, verfolgt von den eigenen Kämpfern.
„Bringt mir den Baldachin, die Sonne wird schon heiß“, hörte Kamal seinen Vater rufen. „Bringt Trauben und Pfirsiche und Mangos und kühles Rosenwasser, beeilt euch!“
Die Diener hasteten los, um die Wünsche ihres Herrn zu erfüllen, während unten vor den Mauern des Palastes der Tod sein eigenes Festmahl hielt. Da war kein auch noch so bescheidener Jubel über den Sieg.
Einer der Anführer der Soldaten trat auf den Balkon, um Meldung zu machen. Er war blass. Blut rann von seiner rechten Schläfe herab, um als langsam antrocknendes Rinnsal unter seinem Brustpanzer zu verschwinden. „27“, sagte er tonlos, „27 von uns sind gefallen, 42 verwundet, davon 16 schwer. Sie haben Frauen und 13 Kinder entführt. Heil dem großen Maharadscha, wir haben einen großen Sieg errungen.“
„Nur 27? Gut, ich hatte mit mehr gerechnet. Und so wenige Frauen und Kinder geraubt dieses Mal! Fantastisch, wirklich fantastisch! Ich wusste doch, dass unsere Waffen überlegen sind.“ Der Maharadscha lächelte zufrieden. „Meldet den Hinterbliebenen mein Mitgefühl. Sagt ihnen, ihre Väter und Männer seien als Helden gestorben. Gebt ihnen eine Extraportion Reis, an trockenen Fisch und Öl für die Totenfeier und dann …“ Sein Blick wanderte kalkulierend nach oben. „Dann macht euch auf in die Stadt, um Nachschub zu kaufen. Besorgt viele Kanonenkugeln und Schwerter. Kauft Männer und Frauen, wenn möglich auch ein paar Kinder. Es gibt Arbeit genug und dieser Krieg wird nicht der letzte gewesen sein.“
Später ließ der Maharadscha das große Tor öffnen. Er ritt hinaus, um die Schäden an der Palastanlage und in den Gärten zu betrachten: ein paar zerstörte Pavillons, geborstene Bewässerungsrohre, zertrampelte Blumenrabatten und – Wut und Entsetzen blitzten in seinen Augen auf – seine Falkenvoliere stand offen. Seine prächtigen Lieblinge waren gestohlen worden.
„Dieser Schuft!“, entquoll es halblaut seinen zornigen Lippen. „Dieser Schuft, mein Allerliebstes, mein Herzblut hat er mir gestohlen. Dafür soll er bitter bezahlen!“
Der Maharadscha ritt zum Palast zurück. Er ließ eilig eine Versammlung aller Prinzen einberufen und auch Kamal sah sich in der ehrwürdigen Runde sitzen. War es Erinnerung oder ein schrecklicher Traum, dieser grausame, ungleiche Krieg?
„Unsere Bewaffnung ist gut“, hörte der vor sich hin dösende Kamal im Halbschlaf seinen Vater stolz verkünden. „Einmal mehr haben wir den frechen Feind vernichtend geschlagen. Unsere Verluste sind gering und leicht zu ersetzen. Aber meine Falken, dass er mir meine Falken genommen hat, das werde ich ihm nie verzeihen! Rache schwöre ich ihm! Ich werde seine blühenden Büsche aus der Erde reißen und all seine Brunnen vergiften! Seine Weiber werde ich zu Sklavinnen machen und ich werde mir meine Falken zurückholen, meine und die seinen dazu. Rache werde ich nehmen bis zur völligen Vernichtung seines Reiches.“
„Rache bis zur völligen Vernichtung!“, schworen alle Prinzen gemeinsam, Rache schwor auch Kamal.
„Doch“, fuhr sein Vater mit zornigem Eifer fort, „wir werden unsere Bewaffnung noch weiter verbessern. Die neuesten Kanonen werden wir kaufen, die sichersten Rüstungen für unsere Soldaten. Die schärfsten Schwerter müssen wir besitzen und die besten Fechtmeister sollen unsere Lehrer sein, damit wir unschlagbar bleiben. Nur unsere Unbesiegbarkeit nimmt den anderen den Mut zum Angriff, bringt uns eine Zeit lang den Frieden und uneingeschränkte Macht.“
„Unsere Soldaten werden weiterkämpfen bis zum endgültigen Sieg über alle deine Feinde“, riefen die Prinzen und: „Hoch lebe der edle und weise Maharadscha von Marwa! Hoch soll er leben, er und sein junger Sohn, Kamal, der in kommenden Tagen unser Herrscher sein wird!“
Ja, er selbst würde später einmal der Herrscher sein, Herrscher über die Paläste, die Gärten, Sklaven und ein gewaltiges Heer. Er würde viele prachtvolle Falken besitzen, jene unbesiegbaren Jäger der Lüfte, denen keine auch noch so schnelle Taube im Flug entkommt. Kamal träumte von dieser herrlichen Zukunft. Wenn er doch nur bald wieder zu Hause wäre, zurück bei seinem Vater in seinem geliebten Marwa.
Die prunkvollen Bilder in rauschenden Farben vertrieben Kamal das Dunkel der Nacht in der ärmlichen Hütte.
Der Sieg war ein willkommener Grund gewesen, den Göttern zu danken, ihnen zu opfern, besonders Skanda, dem Gott des Krieges, Lakshmi, dem Gott des Glückes und Kubera, dem Gott, der Reichtum und Besitz bewahren hilft. Fanfarentöne verkündeten den Beginn der angeordneten Opferzeremonie. Er, sein Vater und die Prinzen schritten würdevoll zu dem großen prächtigen Tempel hinüber, der inmitten von blühenden Gärten lag.
In gebührendem Abstand vom Eingang hatten sich alle edlen Frauen versammelt, überreich mit Schmuck aus Gold, Perlen und Edelsteinen behängt und in wertvolle, bestickte Seidengewänder gekleidet. Verführerische Düfte nach Essenzen aus kostbaren Kräutern umwehten sie als Botschaft ihres königlichen Geblüts. Manche der Prinzessinnen spielten mit kleinen, quiekenden Äffchen, andere liebkosten bunte Papageien, welche auf ihren Schultern saßen.
Befehlsgemäß hatte sich außerdem die Dienerschaft versammelt. Scheu, ergeben schweigend und kaum wagend ihren Blick zu heben, stand sie am Rande des Geschehens.
Fünf Ehrfurcht erweckende Priestergestalten, gekleidet in leuchtendem Orange, entzündeten Opferfeuer, Fackeln und Räucherschalen, aus denen duftender, weißer Rauch aufstieg. Körbe mit wundervollen Blüten, köstlichen Früchten und erlesenen Speisen standen als Opfergaben bereit. Der Maharadscha gab jedem seiner Priester einen Beutel Gold und Kamal überreichte ihnen eine kleine Schatulle mit Edelsteinen. Dröhnend erklang ein großer goldener Gong, der am Eingang des Tempels aufgehängt war. Ehrfürchtig warfen sich die Diener auf den Boden und murmelten gehorsam ihre Gebete.
Aus dem geheimnisvollen, weihrauchschwangeren Dämmerlicht des Tempelinneren lächelten maskenhaft die Elfenbeingesichter riesiger Götterstatuen. Das schwere Silber ihrer Gewänder verlor sich im Halbdunkel des Allerheiligsten, das nicht einmal der Maharadscha betreten durfte. Nur für den Obersten der Priester gab es eine Ausnahme.
Ein weiterer kraftvoller Gongschlag erklang und während sich sein vibrierendes Schwingen allmählich zwischen den Bäumen des Parks verlor, sprachen alle, die Priester, die Herrschenden, die Prinzen und Prinzessinnen und das Volk, gemeinsam ihr Glaubensbekenntnis: „Wir alle sind nichts und unser Schicksal, mag es leicht oder schwer sein, ist von den großen Göttern gewollt. Es ist immer gut, was die Götter uns geben, denn nur die Götter kennen unseren Weg. Wenn wir das Schicksal von heute mit Würde ertragen, werden uns die Götter im nächsten Leben reichlich belohnen. Wir verehren Euch, Ihr Götter! Nehmt unseren ewigen, untertänigen Dank an! Wir verehren den göttlichen Maharadscha von Marwa und seinen Sohn, die uns von Euch gesandt sind, über unser Leben und unser Land zu herrschen.“
Mit Stolz wohnten Vater und Kamal den heiligen Zeremonien bei, sie, die nach dem Willen der Götter alle Macht in Händen hielten, allen Reichtum und alle Sorglosigkeit genießen durften.
Die Priester hielten ihre heiligen Zeremonien ab, von den Blicken der Menge scheu und voll Ehrfurcht begleitet und eingehüllt in die Messingklänge weiterer Gongschläge.
Nach einem längeren andächtigen Schweigen war die heilige Handlung beendet und alle gingen ihrer Wege.
„Jeder Anlass ist gut“, meinte der Vater zu Kamal, „der uns die Ergebenheit unserer Dienerschaft bestätigt, der unsere Macht sichert. Es ist wichtig, dem Volk immer wieder zu sagen, dass es die Götter sind, die alles so wollen, wie es ist. Für uns und für sie. Dieser Glaube und die Hoffnung auf ein besseres Schicksal im kommenden Leben ist die einzige Sonne ihres Daseins. Aber, vergiss das nie, mein Sohn, Vorsehung, das ist das, was ich plane, was du einmal planen wirst. Der göttliche Wille, das bist du, das sind deine Ziele und Wünsche. Die Priester sind die Gehilfen für deine Welt. Bezahle sie gut, denn du bist ihr wahrer Gott. Die Götterstatuen, das heilige Feuer, die Opfergaben und das Dunkel des Allerheiligsten, all das ist das Brot für die Seele, den Glauben und die friedfertige Untergebenheit der Armen.“
Das große Schauspiel des Krieges und der Zeremonien der Priester war vor Kamals innerem Auge vorbeigezogen. Bilder aus seiner Welt, in die er sich zurücksehnte. War das wirklich so? Sehnte er sich tatsächlich nach Kriegen und Rache? Waren blutige Siege und die Zeremonien der Priester wirklich notwendig, um das Reich seines Vaters zu sichern? Kamal verdrängte diese Fragen, doch ein bisher nie gekanntes Gefühl von Mitleid mit den Pferden, die auf den Schlachtfeldern elend verendeten, schlich sich in seine Gedanken.
Von draußen aus der Dunkelheit drang ein halblautes, sich mehrfach wiederholendes Brummen an sein Ohr. ›Eine Hirschziegenantilope‹, vermutete er. ›Vielleicht ist sie durch irgendetwas im Schlaf gestört worden.‹ Kamal musste an Atulana denken.
Atulana
Schon zweimal hatten sie das Tier in der weiteren Umgebung des Palastes des Maharadschas gesichtet. Schon zweimal war große Aufregung unter den Männern entstanden, das Jagdfieber ausgebrochen. Beide Male war man ausgerückt, doch Atulana hatte sich jedes Mal aufgelöst wie eine Fata Morgana in der Hitze eines Wüstentages. Man hatte Reisstroh ausgelegt und Hirsekolben, man hatte versucht, ihn mit großen Wasserschüsseln anzulocken, doch er war vorsichtig. Er mied die Nähe des Palastes und überall, wo Männer auftauchten, ergriff er die Flucht, lange bevor sie auf Pfeilnähe an ihn herankommen konnten.
Wenn Frauen und Kinder weit draußen zwischen den kleinen Hügeln die alten Wurzeln der letzten abgestorbenen Büsche als Feuerholz aus dem Sand gruben, stand Atulana manchmal unvermittelt in seiner prachtvollen Größe vor ihnen. Seine schwarzen Augen schienen voll Sanftmut und Traurigkeit zu sein. Die Frauen konnten dann beobachten, wie er mit seinen beiden langen, nach Korkenzieherart gedrehten Hörnern gegen Bäume oder Felsen schlug, wie er mit seinen gespaltenen Hufen im Wüstenstaub scharrte oder scheinbar erschöpft im Schatten eines Dornbusches stand. Das dunkle Braun seines glatten Felles sah dann aus wie die Erde um ihn herum, die hellen Flecken an Kopf und Bauch wie die Sonnenflecken zwischen den Zweigen. Eben noch sahen die Frauen wie er, der deutlich größer war als ein ausgewachsener Ziegenbock, sich ganz in der Nähe niedergelegte, doch im nächsten Moment war er nicht mehr zu finden. Atulana schien sich aufgelöst zu haben.