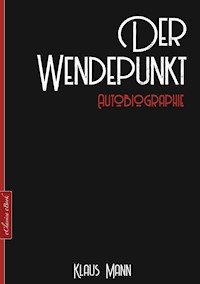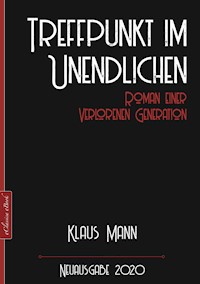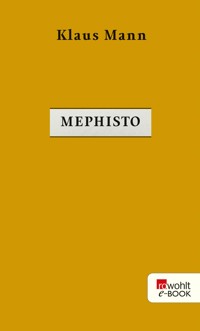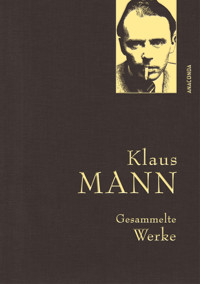9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Wunder von Madrid: Klaus Manns eindringliche Berichte über den Spanischen Bürgerkrieg und den Widerstand gegen den Faschismus In Das Wunder von Madrid, dem dritten Band seiner essayistischen Schriften, dokumentiert Klaus Mann die Zeit vom Herbst 1936 bis zum Sommer 1938. Der Schriftsteller pendelt zwischen Europa und den USA, hält Vorträge und schreibt Artikel, um eindringlich vor der wachsenden Bedrohung durch Nazi-Deutschland zu warnen. Im Sommer 1938 reist Mann als Korrespondent verschiedener Zeitungen nach Spanien, um über den dortigen Bürgerkrieg zu berichten. Der entschlossene Widerstand der republikanischen Truppen gegen die Franco-Faschisten erfüllt ihn trotz der schwierigen Lage mit neuer Hoffnung. Seine Reportagen sind ein bewegendes Zeugnis dieser turbulenten Epoche. Klaus Manns Texte, die literarische Essays, Reden und journalistische Berichterstattung umfassen, bieten eindringliche Einblicke in den Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus. Das Wunder von Madrid ist ein Schlüsselwerk für das Verständnis dieser prägenden Jahre aus der Perspektive eines scharfsinnigen Zeitzeugen und überzeugten Kriegsgegners.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Das Wunder von Madrid
Aufsätze, Reden, Kritiken 1936–1938
Herausgegeben von Uwe Naumann und Michael Töteberg
Über dieses Buch
Der dritte Band von Klaus Manns essayistischen Schriften umfasst den Zeitraum vom Herbst 1936 bis zum Sommer 1938. Der Schriftsteller pendelt zwischen Europa und Amerika. Hier wie dort hält er Vorträge und schreibt Artikel, um über die Gefahr aufzuklären, die aus Deutschland droht: den «Hakenkreuzzug» der Nazis, die ihren Machtbereich immer weiter ausdehnen. Im Sommer 1938 fährt Klaus Mann nach Spanien, um für verschiedene Zeitungen über den Bürgerkrieg zu berichten. Der aufopfernde, entschlossene Widerstand der republikanischen Truppen gegen die Franco-Faschisten erfüllt ihn mit neuer Hoffnung.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019
Copyright © 1993 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung tanatat/Shutterstock
Coverabbildung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
ISBN 978-3-644-00355-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Am Anfang steht ein Rückblick: Klaus Mann wollte sich dem amerikanischen Publikum vorstellen und nutzte diesen Anlaß, um Bilanz zu ziehen. Er reflektiert seine literarische Entwicklung und ortet sie im Kontext seiner Generation: Der Krieg war zu Ende, der Expressionismus hatte abgedankt, als die jungen Autoren sich erstmals zu Wort meldeten. Zunächst wählten sie erotische und religiöse Sujets, später erweiterten sie ihre Stoffe um die soziale Problematik. Die politischen Vorstellungen waren eher vage und idealistisch, bis Hitlers Machtergreifung kein Ausweichen mehr zuließ. Klaus Mann entschied sich für die Emigration. Seitdem lebt er «in allen europäischen Kapitalen – außerhalb Deutschlands».
Nicht Reiselust und Neugierde führen ihn im Oktober 1936 in die Neue Welt. Klaus Mann hat eine Vortragsreise zu absolvieren: ein lukrativer Nebenverdienst, der die bescheidenen Honorare aus der literarischen und publizistischen Arbeit entscheidend aufbessert. Er tingelt durch die Staaten, spricht vor Herren-Clubs und Hausfrauen-Vereinen, läßt anschließend geduldig alle «idiotischen Fragen» über sich ergehen. Mit bissiger Ironie kommentiert er seine neue Tätigkeit, die er zu den «Besonderheiten des amerikanischen Lebens» zählt, und reiht sich ein in eine illustre Gesellschaft: «Romanciers, Polarforscher, Politiker, exilierte Prinzen, Tennismeister, Religionsstifter, Köche, Medien, Blumenzüchter, Zeitungskorrespondenten, Psychoanalytiker sind im Nebenberuf ‹lecturers›», notiert er in seiner Autobiographie «Der Wendepunkt». Verschiedene Themen hat der Redner anzubieten; am beliebtesten ist – bald kann er den Text auswendig – der (in diesem Band erstmals gedruckte) Vortrag «A Family against a Dictatorship». Ein Stück Zeitgeschichte wird als «personal history» abgehandelt: Der engagierte Antifaschist weiß, wie er seine politische Botschaft einem Publikum nahebringt, das sich für die Ereignisse im fernen Europa nur mäßig interessiert. Als «distinguished son of a noted family», wie es auf dem Werbeblatt seines Agenten heißt, bedient Klaus Mann sich ohne Scheu des berühmten Namens seines Vaters, um die Amerikaner aufzuklären über «die deutsche Gefahr». Auch wenn er nach so manchem Auftritt abends in sein Tagebuch sarkastische Bemerkungen einträgt, seine Aufgabe bewältigt er trotz anfänglicher Sprachprobleme souverän. Ein paar Tage, bevor er am 10. Januar 1937 die USA wieder verläßt, schließt er einen Vertrag über eine neue Lecture-Tournee im nächsten Herbst.
Zurück in Europa, mischt er sich in die aktuellen politischen und literarischen Auseinandersetzungen. Der antifaschistische Kampf sollte alle Emigranten einen; auch Klaus Mann unterstützt das Volksfront-Konzept. In Wahrheit sind die Hitler-Gegner zerstritten und arbeiten gegeneinander. Klaus Mann steht zwischen den Fronten, er hält Kontakt zu den bürgerlichen Gruppierungen wie zu den Kommunisten. Politisch steht er links, ist jedoch zunehmend befremdet von den orthodoxen Marxisten. Er schlägt die in Moskau erscheinende, von Brecht, Bredel und Feuchtwanger herausgegebene Zeitschrift «Das Wort» auf und liest, daß Strindberg, Nietzsche und Joyce lediglich traurige Exempel der niedergehenden Bourgeoisie seien. Die materialistische Ästhetik, so undifferenziert und platt, wie sie in manchen dieser Blätter betrieben wird, erscheint ihm als unerträgliche Schulmeisterei der Kunst. Die sowjetamtlichen Berichte über die Schauprozesse in Moskau beschäftigen und beunruhigen ihn: «Ein sehr trübes Mysterium», notiert er im Tagebuch und fragt sich: « Wie sind diese phantastischen ‹Selbstbezichtigungen› zustande gekommen???» Parallel liest er, die geeignete Lektüre zu diesen Vorgängen, wieder einmal Kafka.
Der engagierte Zeitkritiker, der sich unerschrocken in aktuelle Kontroversen mischt, aber auch Kunstbetrachtungen und Feuilletons schreibt, löst unbeabsichtigt mit seinem Beitrag «Gottfried Benn. Die Geschichte einer Verirrung» eine Debatte aus, die hohe Wellen schlägt und auf die noch heute in der Realismus-Diskussion Bezug genommen wird. Benn – «diese alte Liebe, dieser neue Haß von mir» – beschäftigt Klaus Mann seit langem. Er verurteilt scharf und kompromißlos die Sympathien des Dichters für die Nazis, berauscht sich aber auch in den Jahren des Exils an dessen Gedichten, verspürt ein geradezu «sündhaftes Vergnügen» an diesen Versen. Die letzten politischen Äußerungen Benns – «ekelhaft», kommentiert Klaus Mann im Tagebuch – bilden den Anlaß, den noch längst nicht ausgestandenen Fall in einem Essay aufzugreifen und (auch für sich selbst) zu klären. «Das Wort» druckt den Aufsatz und stellt ihm einen zweiten Artikel an die Seite: Bernhard Ziegler – hinter diesem Pseudonym verbirgt sich der Kulturfunktionär Alfred Kurella – rechnet unter der Überschrift «‹Nun ist dies Erbe zuende … ›» pauschal mit dem Expressionismus ab. Seine These: «Heute läßt sich klar erkennen, wes Geistes Kind der Expressionismus war, und wohin dieser Geist, ganz befolgt, führt: in den Faschismus.» Ihm wird in den folgenden Heften nachdrücklich widersprochen; einschließlich Schlußwort provoziert die Debatte sechzehn Beiträge zum Thema. Am Ende nehmen in ausführlichen Beiträgen die beiden Antipoden Georg Lukács und Ernst Bloch Stellung. Klaus Mann hat ein Stichwort geliefert – plötzlich befindet er sich im Umkreis jener Dogmatiker, die unter der Losung «Der Formalismus: Hauptfeind einer Literatur, die wirklich zu großen Höhen strebt» (Ziegler/Kurella) ein vulgärmarxistisch verengtes Realismus-Konzept durchsetzen wollen. Irritiert verfolgt er die Kontroverse, greift öffentlich nicht ein, aber steht selbstverständlich auf der Seite Blochs.
Rastlos durchstreift er Europa: Zürich, Wien, Prag – am 25. März 1937 erhält der staatenlose Emigrant die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft –, Budapest, Paris, Amsterdam und wieder Zürich und wieder USA. Überall hält er Vorträge, trifft prominente Kollegen und Freunde, geht ins Kino oder Theater. Und schreibt: oft im Zug, gar im Schlafwagenabteil, oder im Hotelzimmer. Klaus Mann schreibt mit leichter Hand, das macht den Reiz seiner journalistischen Arbeiten aus. Zudem bewegt er sich nicht nur in Emigranten-Zirkeln, sondern ist stets aufgeschlossen für neue Erfahrungen und fremde Welten. Er ist beeindruckt von Orson Welles' Broadway-Auftritt, besucht in Hollywood die Probeaufnahmen zu dem Kultfilm «Vom Winde verweht» und sieht sich im Kino Walt Disneys Zeichentrickfilm «Schneewittchen» an. Das europäische Erbe, die Liebe zur Literatur verleugnet er dabei nicht : Auf dem Spaziergang zur Hollywood Bowl kommen ihm Verse von Rilke und Goethe in den Sinn, und während er die Front im Spanischen Bürgerkrieg inspiziert, liest er Hesses Buch über die drei schwäbischen Dichter Mörike, Waiblinger und Hölderlin.
In den Staaten spricht er über Deutschland; in Europa berichtet er von seinen amerikanischen Erlebnissen. Das Emigranten-Dasein ist Alltag geworden, doch die politische Entwicklung läßt ihn nicht zur Ruhe kommen. Die Nachrichten aus Spanien, wo die Faschisten die Stadt Guernica dem Erdboden gleichgemacht haben, bringen ihn in Rage: «Müßte man an die Front?» Diese Frage will er in einem Artikel klären, doch ist er viel zu aufgewühlt, um ihn schreiben zu können. Er bemüht sich um ein Visum und reist im Sommer 1938 als Journalist zusammen mit seiner Schwester Erika an die Front. Freunde haben ihm abgeraten: Die Sache sei verloren. Nach der Frühjahrsoffensive der (von deutschen und italienischen Faschisten unterstützten) Franco-Truppen ist das von den Republikanern beherrschte Gebiet in zwei Teile zerschnitten, die Niederlage nur noch eine Frage der Zeit. Klaus Mann fährt trotzdem; seine Artikelserie für die Exilpresse bildet den Abschluß dieses Bandes. Es sind Reportagen, aber auch Reflexionen über die ihn tief verunsichernde Problematik Pazifismus und antifaschistischer Kampf. Die Gegenseite, notiert Klaus Mann in seinem Spanischen Tagebuch, «zwingt uns ein neues Pathos auf, das ursprünglich keineswegs das unsere war». Er fühlt sich in seiner Rolle nicht wohl, das ist den Zeitungsartikeln deutlich anzumerken. Zugleich ist er beeindruckt, ja begeistert vom Widerstand des Volkes gegen die Franco-Truppen. Spanien wird für ihn zu einem Symbol: Erstmals hat ein Land sich nicht kampflos der Aggression ergeben. Erfüllt von «tausend Bildern dieser heroischen Wirklichkeit» kehrt Klaus Mann zurück nach Paris.
Doch «Das Wunder von Madrid» hält nicht an: Die spanischen Faschisten besiegen die Republik, noch bevor der Zweite Weltkrieg beginnt. Mit dem Münchner Abkommen wird im September 1938 auch das Schicksal der Tschechoslowakei besiegelt; schon vorher ist der «Anschluß» Österreichs an das Großdeutsche Reich erfolgt. Überall in Europa gewinnen die Faschisten an Boden. Den Emigranten bleibt nur die Hoffnung auf Amerika.
Hamburg, im April 1993 Uwe Naumann/Michael Töteberg
1936
Als wir anfingen
Als wir anfingen, waren wir unpolitisch. Das war im Jahre 1925, ich war damals 19 Jahre alt. Vorher – in den Jahren unmittelbar nach dem Kriege und während der Inflation – hatte in der deutschen Literatur der «Expressionismus» getobt wie ein Orkan. Unsere Reaktion auf den sehr lauten Expressionismus war, daß wir die etwas stilleren Töne reizvoller fanden. – Mein erstes Theaterstück – in dem ich 1925, mit meiner Schwester Erika zusammen, auch als Schauspieler auftrat – nannte ich «ein romantisches Stück». Es hieß «Anja und Esther», und es war voll Zärtlichkeit und Melancholie. Viele junge Menschen haben dieses Stück damals auf den deutschen Bühnen gesehen, und viele hatten es gerne. – Auch die Problematik meiner ersten Erzählungen und Romane war vor allem eine erotische und eine religiöse. (Von diesen frühen Arbeiten ist eine auch in amerikanischer Ausgabe erschienen: «The Fifth Child», bei Boni & Liveright, 1927.) – Diese Erzählungen handelten alle von jungen Menschen: ich hatte wohl den Ehrgeiz, einer der Sprecher der deutschen Nachkriegsgeneration zu sein. Meine Arbeiten, und die meiner Freunde, hatten den neugierigen, sehnsüchtigen, etwas spöttischen, sinnlichen, schwermütigen Blick des Jünglings aufs Leben. In ihnen war viel die Rede von den großen Verwirrungen, denen die europäische Jugend nach dem Kriege ausgesetzt war; sie versuchten zu berichten von neuen Schwierigkeiten – die die Generation vor uns kaum gekannt hatte –, aber auch von neuen Freuden.
Man lernte die Welt kennen; man reiste – in den Jahren 1927 und 28 reiste ich um die Welt und schrieb über diesen großen Ausflug ein kleines Buch: «Rundherum» –; man beschäftigte sich mit der Geschichte (im Jahre 1929 veröffentlichte ich meinen Roman über Alexander den Großen: «Alexander», der auch in Amerika erschienen ist); man erweiterte den Gesichtskreis: Die soziale Problematik drängte sich auf, man konnte ihr gar nicht ausweichen. Aber sie stand doch noch immer nicht im wirklichen Mittelpunkt unseres Interesses und unseres inneren Lebens. Wir haßten den Nationalismus; wir empfanden uns als eine europäische Jugend viel mehr denn als eine deutsche. Wir wollten ein geeinigtes, friedliches, gerecht regiertes Europa. Aber wir waren naiv genug zu glauben, daß dieses Europa gleichsam von selbst, und ohne daß wir viel dazu zu tun brauchten, zustande käme. Das waren in Deutschland die Jahre der Stresemann-Politik, des Optimismus, der großen und schönen – der trügerischen Hoffnungen …
Es mußte erst das Jahr 1933 – das Jahr des deutschen «Umsturzes» – kommen, um uns gründlich von allen Illusionen zu heilen; um uns zu verändern und zu belehren. Plötzlich erkannten wir, wer die feindlichen Mächte sind, die alles bedrohen und verderben, was uns das Leben erst lebenswert macht. Diese feindlichen Mächte – der extreme Nationalismus, der Imperialismus, der Militarismus, der terroristisch gewordene Kapitalismus – standen als der Faschismus vor uns.
Der Faschismus wurde zum großen Widersacher. Ich verließ Deutschland, als Adolf Hitler zur Regierung kam. Mein ganzes Leben änderte sich: ich verlor die deutsche Staatsbürgerschaft; ich lebte in allen europäischen Kapitalen – außerhalb Deutschlands. Ich war entschieden, für das zu kämpfen, was ich liebte und nicht verlieren wollte : für den ganzen Bestand meines geistigen Lebens. – Fast alles, was ich seit dem Jahre 1933 publiziert habe – drei Romane (von denen einer, «Journey into Freedom», in Amerika, bei A. Knopf, erschienen ist) und sehr viele Aufsätze – steht unter dem Zeichen des antifaschistischen Kampfes. Vor allem stand unter diesem Zeichen die Zeitschrift, die ich zwei Jahre lang in Amsterdam, beim Querido-Verlag, herausgegeben habe: «Die Sammlung», die unter dem Protektorat von André Gide, Heinrich Mann und Aldous Huxley stand. Diese monatlich erscheinenden Hefte unternahmen den Versuch, alle geistigen antifaschistischen Kräfte – die demokratischen, die katholischen, die sozialistischen – zusammenzufassen.
Der Nationalsozialismus – und alle anderen Faschismen – behaupten von sich, daß sie die jungen Menschen für sich hätten. Nun, ich bin selber jung, ich lebe unter jungen Menschen, und ich weiß, daß der Faschismus alle wertvollen jungen Menschen immer enttäuschen muß. Die Jünglinge, die ihm aus Unwissenheit zulaufen, suchen in ihm das Abenteuer. Aber der militärische Drill und schließlich der Krieg sind die einzigen Abenteuer, die der Faschismus zu bieten hat. Besteht die europäische Jugend wirklich nur noch aus Landsknechten ? Sind die Ansprüche der Jünglinge von Europa so gering geworden? Können sie leben ohne die schwierigeren Abenteuer des Geistes? Ohne das Recht, selbständig zu denken? Ohne den Genuß der Freiheit? – Die nationalistischen Diktaturen in Europa müssen durch ebenjene Jugend stürzen, von der die Diktatoren so gerne behaupten, daß sie ihre treueste Gefolgschaft sei. Die Jugend, die sich heute im Bombenwerfen und im Marschieren üben muß, sehnt sich nach anderen Aufgaben. Sie sehnt sich nach einer anderen und freieren Gemeinschaft – nach einer Gemeinschaft, die nicht mehr kontrolliert ist durch eine Geheime Staatspolizei und durch ein Heer von Spionen. Die europäische Jugend wird ihre Kräfte erst wieder entfalten und bewähren können, wenn das Gift des Faschismus aus Europa verschwunden – wenn der Erdteil frei und geeinigt ist. – Indem wir gegen den Faschismus kämpfen, kämpfen wir für ein freies, geeinigtes Europa. Für dieses zukünftige Europa arbeiten wir, und ich wage zu behaupten, daß die meisten von uns auch bereit wären, für diese Zukunft Europas zu sterben.
Können Deutschland und Frankreich Freunde sein?
Als ich ein Junge war, hatten die Städtenamen Paris, Nice, Marseille eine ungeheure Faszination für mich. Bei dem Wort Paris fuhr ich zusammen, wie man später, als erwachsener Mensch, bei der Nennung eines geliebten Namens zusammenfährt. Die Namen jener Städte, in denen die großen Abenteurer-Geschichten spielen, ließen mich ziemlich kalt: ich träumte nicht von Kairo, San Francisco, Bagdad oder Rio de Janeiro. Ich träumte auch nur selten von Rom, Venedig oder Athen. Meine knabenhafte Phantasie malte sich die Landschaft des französischen Südens – der Côte d'Azur – aus, unermüdlich und immer wieder begeistert versuchte sie, sich die Champs-Élysées, die grands boulevards und die Seine-Quais vorzustellen. Ich kannte Paris, Marseille und Nice schon ein wenig, ehe ich selber zum ersten Mal wirklich hinkam.
Während des Kriegs – und ich bin im Kriege ein Kind gewesen – durften wir keine französische Gouvernante haben: sie wäre auf den Straßen der Stadt München gesteinigt worden. Ich begann also erst auf dem Gymnasium, Französisch zu lernen. Das Gymnasium, das ich in München besuchte, war ein «humanistisches». Wir lasen Homer und Xenophon im Urtext; aber der Unterricht im Englischen und Französischen war miserabel. Unser Französisch-Lehrer – Gott hab ihn selig – hatte eine grausige Aussprache. Wir konnten mit Mühe sagen: «La maison de ma grandemère est très belle» – aber wirklich nicht viel mehr. Meist lernte ich in der Schule etwas weniger, als verlangt wurde. Aber im Französischen war ich ehrgeizig. Die Großmutter und ihr schönes Haus genügten mir nicht. Ich begann, mich mit der französischen Literatur zu beschäftigen – auf eigene Faust und ohne daß jemand mir dabei geholfen hätte. Unter eifriger Benutzung eines Lexikons las ich die Gedichte von Arthur Rimbaud und von Paul Verlaine. Ich war hingerissen von der Kraft Rimbauds, die alle Literatur wie ein Gefängnis empfand und sich aus diesem Gefängnis in die Wirklichkeit, in die Freiheit des Lebens rettete; ich war gerührt und bezaubert von der Melancholie und der problematischen Frömmigkeit Verlaines – des großen Sünders, der alle seine Sünden verführerisch besingt und der sie alle bereut. Ein paar Jahre später – ich war siebzehn Jahre alt – handelte der erste Aufsatz, den ich veröffentlichte, von Rimbaud und von seiner schwierigen Freundschaft mit Verlaine. Damals wußte ich schon etwas besser Bescheid in der Welt des französischen Geistes, und ich brauchte nicht mehr soviel das Lexikon zu benutzen, wenn ich Baudelaire oder Mallarmé, Stendhal oder Flaubert, Balzac oder Victor Hugo las.
Es war um diese Zeit, daß ich zum ersten Mal nach Frankreich kam. Den ersten Vorschuß, den mir ein Verleger gab, benutzte ich zu einer Reise nach Paris, Südfrankreich und dem französischen Nordafrika. Unvergeßliche erste Begegnung mit einer Landschaft und mit einem Volke, das mir so fremd und doch auch auf eine sonderbare Art so vertraut war! Es ist, wie wenn man eine Gegend in der Wirklichkeit sieht, die man schon aus Träumen und aus Vorstellungen kennt. Als ich zum ersten Mal vor einem Pariser Café mit einem Vermouth auf der Straße saß, kam ich mir vor wie zu Hause. Zum ersten Mal : der wundervolle Blick von der Place de la Concorde, die Champs-Elysées hinunter, zum Arc de Triomphe; zum ersten Mal, aus dem Fenster eines Hotelzimmers, die Aussicht auf den Vieux Port von Marseille; zum ersten Mal die schön geschwungene Kurve der Promenade des Anglais in Nice … Ich werde das Glück nie vergessen, mit dem ich alle diese Herrlichkeiten kennenlernte.
Dann kamen die Begegnungen mit den französischen Menschen: die Begegnung mit den einfachen Leuten, mit der Patronne des Hotels, mit den Kellnern in den Restaurants, den Matrosen auf den Schiffen, mit den Chauffeuren der Taxis und der Autobusse: Ich liebte es, mit allen diesen Menschen zu reden; ich war stolz darauf, daß ich ihre Sprache verstand und mich auch schon ein wenig in ihr ausdrücken konnte; ich interessierte mich für die Verhältnisse ihres Lebens ; ich freute mich an ihrer Intelligenz, ihrem Witz, ihrer natürlichen Liebenswürdigkeit. – Wenig später kamen Beziehungen zu der intellektuellen Elite des Landes hinzu. Ich habe viele Repräsentanten der modernen französischen Literatur gekannt, und mit einigen von ihnen bin ich befreundet. Männern wie André Gide, Edmond Jaloux, Jean Cocteau, Julien Green, Jean Giraudoux, André Malraux verdanke ich die bedeutendste intellektuelle Anregung. Auf Figuren wie Romain Rolland oder Henri Barbusse habe ich – nicht nur um ihres Werkes, sondern vor allem auch um ihrer menschlichen Haltung willen – immer mit Verehrung geschaut. Jahrelang war einer meiner besten Freunde ein junger französischer Dichter. Sein Werk und seine Person wurden geliebt und hatten Wirkung in einem Kreis von jungen Menschen, der zahlenmäßig klein war, aber in allen europäischen Ländern seine Vertreter hatte. Ich weiß nicht, ob die Bücher dieses jungen Dichters auch in den Vereinigten Staaten Leser hatten. Eine seiner letzten Absichten war, nach Amerika zu kommen und den Kontakt zu der Jugend dieses großen Landes zu suchen. Dieser Plan konnte nicht mehr ausgeführt werden. Mein französischer Freund ist tragisch zugrunde gegangen; der Name dieses jungen Dichters, der nicht mehr lebt, ist René Crevel.
Ich liebe Frankreich. Ich liebe die französischen Menschen, und ich liebe die französische Landschaft. Ich liebe die Städte Frankreichs, und ich liebe die Erde Frankreichs. Ich liebe die französische Kunst, und ich liebe die großen politischen Traditionen der französischen Politik. Ich habe immer geglaubt, daß ein Deutscher Frankreich, den westlichen Nachbarn, lieben darf und lieben soll. Ich habe immer geglaubt, daß ein Deutscher viel von Frankreich zu lernen hat – und, wie ich hinzufügen muß, ein Franzose vielleicht auch einiges von Deutschland. Ich habe viel gelernt, als ich in Frankreich lebte und als ich mich mit französischen Dingen beschäftigte. Dieses – wie gesagt – ist meine persönliche Angelegenheit und mein persönliches Erlebnis.
Aber es ist doch vielleicht auch ein Symptom. Es beweist, welch großen pädagogischen Einfluß die reiche französische Kultur auf einen jungen deutschen Intellektuellen ausüben kann. Keinem jungen deutschen Intellektuellen, der an Luther, Goethe und Nietzsche erzogen ist, wird es schaden, wenn er sich noch ein wenig durch Voltaire, Victor Hugo und Zola erziehen läßt.
Wenn ich also von meiner Liebe zu Frankreich spreche – einer Liebe, die mein ganzes Leben bis heute begleitet hat und es weiter begleiten wird –, erwähne ich sie, um hinzufügen zu können : Viele junge Menschen haben in Deutschland wie ich empfunden – und nicht nur junge. Die Deutschen, die zu meiner Altersklasse gehören oder noch jünger sind als ich, haben den Weltkrieg nicht miterlebt – oder sie waren doch Kinder während des großen Krieges und nicht dazu fähig, seinen Ernst und seine Furchtbarkeit zu begreifen. Als wir anfingen zu denken, war das erste, was wir uns klarmachten, daß der Krieg etwas Schauerliches gewesen war – etwas Schauerliches, das sich keinesfalls wiederholen durfte. Wir schworen uns : Es darf kein Krieg mehr sein, wir wollen an keinem mehr teilnehmen. Wir haßten den Krieg, und wir haßten die Männer, von denen wir glaubten, daß sie persönlich am Ausbruch des Krieges schuldig oder mitschuldig gewesen seien. Aber wir haßten kein einziges Volk, das am Kriege teilgenommen hatte. Vor allem waren wir nicht dazu zu bringen, Frankreich zu hassen, das man uns – in der Schule, als wir Kinder waren – als den Erbfeind dargestellt hatte. Wir glaubten nicht, daß es einen Erbfeind geben könnte. Wir machten uns lustig über diesen Begriff. In unserer Liebe zu Frankreich war wohl auch etwas Opposition gegen die Lehrer, die uns soviel vom Erbfeind erzählt hatten. Aber es waren nicht nur wir Jungen, die die unbedingte Versöhnung, die wirkliche Freundschaft mit Frankreich wollten und erstrebten. Viele Ältere dachten wie wir; einige wenige hatten sogar schon mitten während des Krieges so gedacht. Diese wenigen hatten den Krieg mit Frankreich immer als ein unseliges Mißverständnis, als einen tragischen europäischen Bruderkampf empfunden. Zu diesen Hellsichtigen – es waren ihrer nicht viele – hatte mein Onkel Heinrich Mann gehört. Seine erste literarische Arbeit während des Krieges war ein großer Essay über den französischen Romancier Emile Zola gewesen: eine kühne und gründliche Analyse und zugleich eine überschwengliche Huldigung an den großen Naturalisten – den eigentlichen Helden der Dreyfus-Affäre. Man mag sich vorstellen, daß die Publikation dieser Studie über den Franzosen im Jahre 1915 wie eine Bombe einschlug und fast von der gesamten Öffentlichkeit als eine ungeheure Provokation empfunden wurde, die man Heinrich Mann niemals ganz verziehen hat. Während des Krieges hatten nur wenige Schriftsteller die klare und mutige Gesinnung Heinrich Manns. Aber nach dem Kriege – etwa von 1918 bis 1925 – war fast die ganze deutsche Intelligenz pazifistisch und frankophil – oder behauptete es doch zu sein. (Später sollte sich herausstellen, daß diese Behauptung, in vielen Fällen, eine Lüge war.) Alle besseren Deutschen wollten um diese Zeit die vollkommene Versöhnung mit Frankreich und glaubten daran, daß sie möglich sei. Die maßgebenden Zeitungen des demokratischen deutschen Bürgertums – die «Vossische Zeitung» zum Beispiel oder das «Berliner Tageblatt» – waren durchaus franzosenfreundlich. Wir wurden in unserer europäischen Gesinnung gestärkt dadurch, daß wir wußten: In Frankreich empfand und dachte eine aufgeklärte Elite wie wir. Diese Elite liebte die deutsche Kultur – wie wir die französische Kultur und Zivilisation liebten und bewunderten. Die großen Schriftsteller der französischen Gegenwart beschäftigten sich mit Problemen, die Deutschland und die Versöhnung mit Deutschland betrafen, ich erinnere nur an das berühmte Theaterstück von Giraudoux «Siegfried», das die deutsch-französische Beziehung zum Thema hatte; die besten französischen Geister liebten die deutsche Musik – man denke an Romain Rolland und seine Beethoven-Biographie oder an seinen großen, nach deutschem Muster konzipierten Erziehungsroman «Jean Christophe». Führer der französischen Moderne bemühten sich darum, die deutschen Klassiker der französischen Jugend näherzubringen: André Gide übersetzte Teile aus dem Roman «Der grüne Heinrich» des Deutsch-Schweizers Gottfried Keller und Kapitel aus Goethes Roman «Die Wahlverwandtschaften». – Eine wirklich europäische Geistigkeit schien im Entstehen. Der eifrigen Bemühung der Geistigen um eine Verständigung der beiden großen Nationen entsprach die Arbeit der Politiker, der Stresemann und Briand. Es war die Zeit von Locarno. Man glaubte, der Augenblick, da Europa sich endlich einigen werde, sei nahe. Wir waren begeistert von den paneuropäischen Ideen des Grafen Coudenhove-Kalergi. Wir wußten alle, daß die erste und wichtigste Voraussetzung für eine Regelung der europäischen Angelegenheiten die echte und vorbehaltslose Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern, zwischen Frankreich und Deutschland war. Deutschland mußte auf die Idee einer «Revanche» gegen Frankreich verzichten. Frankreich mußte sich daran gewöhnen, ohne Mißtrauen auf seinen östlichen Nachbarn zu schauen – ein Mißtrauen, zu dem Deutschland der französischen Nation, wenige Jahre später, freilich erst recht Anlaß geben sollte. Wir glaubten, daß die deutsch-französische Freundschaft und damit die Vereinigung Europas möglich sei. Wir rechneten nicht genug mit dem unversöhnlichen Haß, mit der Aktivität, mit der furchtbaren Geschicklichkeit der Nationalisten in unserem Lande. Sie sangen «Deutschland, Deutschland über alles» und meinten damit «Deutschland gegen Frankreich». Sie wollten nichts von Versöhnung wissen, nur von Rache. Sie bereiteten den nächsten Krieg vor: den Krieg der Revanche. In diesem Sinne schrieben und redeten alle Nationalisten, denen die Idee eines «Großdeutschland» ungefähr das bedeutete, was uns die Idee eines Paneuropa war. Man weiß, wer allmählich zum Wortführer aller ultranationalistischen, imperialistischen, antipazifistischen Tendenzen in Deutschland wurde. Man weiß, wer den unversöhnlichsten Haß gegen Frankreich in tausend Versammlungen und in tausend Zeitungsartikeln gepredigt hat. Der Autor des berühmten Buches «Mein Kampf» haßte Frankreich ungefähr ebenso, wie er die Juden haßte. Seine demagogische Rhetorik war ebensosehr gegen Frankreich gerichtet wie gegen die Juden. Wenn Hitler und seine Trabanten einen deutschen Politiker, Schriftsteller oder Journalisten unmöglich machen wollten, so verdächtigten sie ihn nicht nur einer judenfreundlichen, sondern auch einer franzosenfreundlichen Gesinnung. Unter dem Vorwurf, er sei Frankreich zu freundlich gesinnt, hatte der Außenminister Gustav Stresemann schrecklich zu leiden: er wurde – wie man weiß – von den deutschen Nationalisten, und besonders von den Nazis, buchstäblich zu Tode geärgert. Den Schriftstellern, die eine Freundschaft mit Frankreich propagierten, erging es nicht besser. Georg Bernhard zum Beispiel, der Chef der «Vossischen Zeitung», oder Theodor Wolff, der politische Redakteur des «Berliner Tageblatts», wurden täglich mindestens einmal von Hitler, Goebbels und Rosenberg als «Landesverräter» bezeichnet. Besonders unbeliebt war bei den Nazis und bei allen, die mit ihnen sympathisierten, die Familie Mann: weil wir für die Demokratie, für den Frieden und für die Freundschaft mit dem französischen Nachbarn eintraten. Am unerbittlichsten gehaßt wurde Heinrich Mann. Gegen meinen Vater begann die nationalistische Kampagne, als er sich zum ersten Mal in aller Form zur Deutschen Republik – deren Präsident damals Ebert war – bekannt hatte. Diese Hetze gegen Thomas Mann steigerte sich, als er einen Besuch in Paris machte, um dort Vorträge zu halten. Über diese Reise veröffentlichte er damals ein kleines Buch, «Pariser Rechenschaft». Diese Broschüre – ein ziemlich unpolitisches Reisetagebuch – wurde womöglich noch heftiger angegriffen als seine Rede über die deutsche Republik. Auch ich bekam diese Wut zu spüren : als ich einem meiner ersten Bücher die Widmung an meinen französischen Freund René Crevel voransetzte. Schon diese Widmung wurde von der Nazi-Presse als eine Art von Landesverrat empfunden und angeprangert.
Natürlich war es von uns sehr falsch, uns über Angriffe dieser Art nur lustig zu machen. Wir hätten sie viel ernster nehmen sollen. Wie ernst sie in der Tat zu nehmen waren, sollte sich erst im Jahre 1933 herausstellen. Die meisten von uns verließen das Land. Viele, die für den Ruhm Deutschlands in der Welt mehr geleistet hatten als irgendeiner von den Nationalisten, mußten in die Verbannung. Manche, denen man um ihrer Liebe zu Frankreich willen nachgesagt hatte, sie liebten Deutschland nicht genug, waren nun gezwungen, die französische Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen.
Zwischen den deutschen Europäern und den Nazis gibt es nicht die Möglichkeit einer Verständigung. Wir reden verschiedene Sprachen. Niemals empfinde ich dies deutlicher, als wenn die Nazis versuchen, unsere, die europäische Sprache zu reden.
Die Internationale der Faschismen wird nie zustande kommen. Die nationale Machtgier, der unbegrenzte Egoismus der faschistischen Staaten wird diese Art von «Internationale» immer unmöglich machen.
Die Frage: «Ist eine Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich möglich?» – müssen wir also beantworten: Sie ist nicht möglich, solange einer von den beiden Staaten faschistisch ist. Da Frankreich nicht faschistisch ist und es, nach menschlichem Ermessen, nicht sein wird, kann unsere Antwort einfacher lauten : Sie ist nicht möglich, solange Deutschland nationalsozialistisch ist. Das extreme nationalistische Gefühl der Deutschen wird sich immer zunächst und vor allem gegen Frankreich richten. Man kann dieses nationale Pathos eine Zeitlang ablenken und es gegen eine andere Macht mobil machen, zum Beispiel gegen die Sowjet-Union. Es wird sich immer wieder, auf die Dauer, gegen Frankreich wenden. Mit einem nationalistischen Deutschland wird Frankreich nie in Frieden leben können.
Der Nationalsozialismus ist nicht nur die Karikatur des Nationalismus; er ist zugleich auch sein Grabgesang. Wenn die Nazis gestürzt sind – und irgendwann einmal werden sie stürzen –, wird in Deutschland ein ungeheurer Widerwille gegen den Nationalismus, ja, ein Ekel vorm Nationalismus einsetzen. Ein deutsches Volk, das der degoutanten Exzesse seines eigenen Nationalismus endlich müde ist, wird auch bereit und fähig sein zu einer wirklichen und dauerhaften Verständigung mit Frankreich.
Die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist nicht nur möglich; sie ist sogar notwendig. Europa wird krank sein – und zwar in einem gefährlichen und akuten Grade krank –, solange diese Freundschaft nicht zustande kommt. Jeder, der etwas von wirtschaftlichen Dingen versteht, weiß, daß die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich möglich und notwendig ist; jeder, der etwas von politischen Zusammenhängen versteht, weiß es ; und wir, die wir etwas von den kulturellen Dingen zu verstehen hoffen, wissen es erst recht.
Ein Deutschland, das sich endlich auf sein besseres Wesen besonnen hat, wird sich auch darauf besinnen, daß es zu Frankreich gehört – um seines eigenen Wohles und um des europäischen Wohles willen. Die deutsche Republik, die wir wollen, wird der französischen Republik die Hand reichen. Das Land Goethes und das Land Voltaires werden sich finden : Dies ist keine vage Utopie, sondern eine Hoffnung, ein Wunsch, der alle vernünftigen Gründe für sich hat und also einmal in Erfüllung gehen muß. Deutschland und Frankreich zusammen – die beiden befreundeten Länder – werden das Herzstück eines freien, geeinigten Europas bedeuten. Eines ist sicher: Europa wird nur diese Zukunft haben, oder keine.
Joseph in Ägypten
Bemerkungen anläßlich des dritten Bandes von Thomas Manns Roman «Joseph und seine Brüder»
Seit mehr als zehn Jahren darf ich nun, aus einer intimen Nähe, mit anschauen, wie ein großes Werk entsteht und größer und breiter wird, und – langsam, langsam – seinem Ende zuwächst. Wie sonderbar lange ist es schon her, seit wir die ersten Abschnitte dieses «Joseph» zu hören bekamen! Es fing an mit der «Höllenfahrt» – diesem höchst eigenartigen und eigensinnigen Prosastück, das wahrhaftig die Kraft hat, den Zuhörer oder Leser in die Tiefe zu locken und zu verführen; dieser – für mein Gefühl – sehr faszinierenden philosophischen Ouvertüre, die in sich schon den ganzen Themenkomplex der großen Roman-Komposition enthält – und klingen läßt.
Wann war das, daß wir zum ersten Mal zu dieser «Höllenfahrt» eingeladen und mitgenommen wurden? Der Tag scheint mir zu versinken «im Brunnen der Zeiten»: um in der Sprache des Romans selber zu reden. Damals war die Welt des Joseph-Romans uns noch fremd. Inzwischen ist sie uns ganz vertraut geworden – ohne dadurch übrigens an fremdartig-verwirrenden Reizen irgend einzubüßen. Wie oft und häufig wurde seitdem, in einer abendlich behaglichen Stube, für einen kleinen befreundeten Kreis der Mythos, heiter und tiefsinnig, beschworen! Oft waren es sehr schalkhafte Beschwörungsakte, und manchmal mußten wir über all die mythischen Drolligkeiten so lachen, wie wir früher gelacht hatten, wenn der Vater uns etwas Komisches vorgelesen, etwas von Andersen oder Hamsun oder von den Russen.
Seither ist eine ganze Welt eingestürzt – die also wohl schon vorher faulig war. Der Kontinent liegt in Zuckungen, und weiß Gott, was für schauerliche Abenteuer sich erst noch vorbereiten. Wir sind alle, auf eine finstere und spannende Art, abgelenkt – der Erzähler wie die Zuhörer. Aber die Erzählung geht weiter. Der große, ironisch-feierliche Bericht aus den frühen Tagen der Menschheit – die doch auch, dem Urteil der damals Lebenden nach, schon recht «späte» Tage waren – bricht nicht ab. Der Erzähler hält seinem großen Unternehmen die Treue …
War er, während all der Jahre, nur und ausschließlich mit ihm beschäftigt? Sicherlich – in irgendeiner sehr tiefen, sehr geduldigen, sehr abgeschlossenen Schicht seines Wesens. Aber andererseits war er doch gequält und beunruhigt von jedem Ereignis, das der Tag mit sich brachte; und er mischte sich tätig ein, sprach sein Wort; verstummte; sprach schließlich wieder. Ob er aber zu den gegenwärtigen Dingen heftig sprach oder bitter schwieg: der große Traum aus den Menschheitsfrühen wurde, mit Eigensinn und mit Witz, mit Innigkeit, mit Fleiß und liebender Phantasie, weitergeträumt – weitergeformt.
Nun kommt also hier – in New York – eines Tages dieses dicke Paket an: der dritte Band, «Joseph in Ägypten» … Ich wiege das Buch in der Hand; ich schlage es auf, blättre drin; komme ins Lesen. Und – außer der Bewunderung – wieviel Rührung empfinde ich da! Was steigt da auf – wie viele Abendstunden, während derer ich mit den Abenteuern und Schicksalen des jungen Joseph in Ägypterland zum ersten Mal bekannt und vertraut gemacht wurde: Abendstunden in München, in Lugano, in Sanary, am Zürichsee … Alles, was da vorgetragen wurde und uns amüsiert und nachdenklich gemacht hat, steht nun in diesem dicken Band … Mir kommt es vor, als ob er nicht nur die Geschichte Josephs und der Menschen, mit denen Joseph es zu tun hatte, enthielte, sondern auch etwas von unserer eigenen Geschichte, in mythisch-würdiger Maskierung …
Nein, ich darf dieses dicke Buch nicht «beurteilen», nicht «kritisieren» wie eine andere bedeutende Neuerscheinung. Andererseits kann ich – als einer «vom Fach» – natürlich doch nicht umhin, es als ein literarisches Produkt, als ein Erzeugnis höchst entwickelter, reifer und raffinierter Erzählungskunst zu betrachten – und zu genießen.
Wie viele Töne sind in diesen großen und mächtig breiten Teppich gewebt – wie mancherlei Stimmungen und Farben enthält er! Was für ein schönes, geistiges Vergnügen, ihn anzuschauen! Die Gedanken, die mit kluger Vielfalt in ihn eingesponnen sind, werden uns ebenso lebendig wie die sehr lebendigen Gesichter, die uns aus ihm anblicken : das Gesicht Josephs, des Schönen und Hübschen – etwas zu geschwind Plaudernden; etwas zu schlau Berechnenden, zu Kühlen, zu Unmenschlichen –; die Gesichter des bedürftig-rührenden, auf seine melancholische Art würdevollen Petepres, in dessen Haus Joseph den Dienst tut und aufsteigt; der beiden Zwerge und der «heiligen Eltern im Oberstock» – die in die mythische Sphäre des Werkes das märchenhafte Element bringen – und der süßen, schön hergerichteten Mut, die des Potiphars Weib ist und sehr stolz und fein, eine mondäne Priesterin; aber anfällig, wie sich herausstellen wird – anfällig bis zu dem Grade, daß die Katastrophe unausbleiblich wird: die berühmte, peinliche, ergreifende Liebeskatastrophe von Potiphars Weib, der sich Joseph, der Knecht, versagte. In der Geschichte dieser Liebe, zu der es aus sieben triftigen, wenngleich unsereinem nicht immer völlig einleuchtenden Gründen nicht kommen darf, kulminiert der große Bericht – und hier wird aus der Beschwörung des Mythos der große psychologische Roman, das Alte Testament begegnet sich gleichsam mit Marcel Proust, und die Effekte, die zustande kommen, darf man wohl als einzigartig bezeichnen.
Übrigens wird gerade an dieser erotischen Episode offenbar, wie unbedingt der «Joseph» – der aus dem Werke Thomas Manns ebensosehr herauszufallen und sich von ihm zu sondern scheint wie von der gesamten modernen Literatur – in den intimsten Zusammenhang ebendieses Werkes gehört: In dem breit ausgeführten, erotisch-nichterotischen Zwischenspiel sind die Anklänge an den «Tod in Venedig» – und nicht nur an ihn – reichlich und auffallend. Die Tragödie der Entwürdigung, die Aschenbach, der Alternde, gekannt hat, wiederholt sich bei der vornehmen Ägypterin, die dem hergelaufenen Sklaven verfällt.
Der Josephs-Roman ist ein Menschheitslied, dem Faust verwandt; gleichzeitig aber auch das persönlich geprägte, stellenweise intim konfessionelle Kunstwerk. Er hat die gewaltige Objektivität des wirklichen Epos – und er ist subjektiv bis zu dem Grade, daß in jeder einzelnen Figur, selbst in der scheinbar nebensächlichen, der Autor selber sich zu verstecken scheint: er ist der Vater und der Sohn, er ist Joseph und Jakob ; er ist die Gattin und der Gatte, Petepre und sein Weib Mut; er ist die Liebende und der Geliebte – noch einmal Joseph und noch einmal die arme, entwürdigte, von den Göttern bitterlich geschlagene Mut … Der Josephs-Roman wird noch viele Generationen beschäftigen – mehr und heftiger beschäftigen als irgendein anderes Buch des Schriftstellers Thomas Mann : ich weiß es und spüre es und spreche es aus, während ich hier, in dieser Stadt New York, in dem großen Buch blättre und mich an ihm ergötze.
Daß das heutige Deutschland sich mit ihm nicht beschäftigt, nicht beschäftigen darf – ja, daß eine solche Beschäftigung dem Geist, der dort herrscht, gefährlich wäre : das gehört zu den gewichtigen Beweisen gegen diesen Geist – wenn wir denn noch Beweise nötig hätten, um ihn als den Widergeist zu durchschauen und zu verachten.
Broadway, abends
Jeden Abend strahlt der Broadway wie zu einem Fest. Statt der Sterne und dem blassen Mond stehen über den Menschen der Stadt New York die Lichtreklamen und die erleuchteten Fenster der Wolkenkratzer. Die Gesichter der Menschen auf dem Broadway sind geschminkt von den roten, grünen und gelben Flammen des maßlos und spielerisch verschwendeten Lichtes. Dieser ungeheure, beispiellose Aufwand an zuckendem, laufendem, wirbelndem Licht soll die Menschen auf dem Broadway dazu verleiten, 20 Cents für den Ankauf einer Zahnpasta oder 80 Cents für den Besuch eines Kinos oder einer «Burlesque-Show» anzulegen.
Vor den Theatern, in denen es «Burlesque-Shows» gibt, stauen sich die Leute; es sind vor allem junge Männer – darunter viele in den Uniformen des Militärs oder der Marine –, die vor der Kasse bis weit hinaus auf die Straße Schlange stehen. Was ist denn eine «Burlesque-Show», und warum übt sie solche Anziehungskraft aus? Man muß sich das nur eine Viertelstunde angesehen haben, und man begreift, warum so vielen Tausenden aus Stadt und Land daran gelegen ist, ihr Kleingeld loszuwerden für solchen Zauber. Verglichen mit einer New Yorker «Burlesque-Show» ist die bunteste Pariser Revue eine Darbietung für fromme junge Damen. In der «Burlesque-Show» kriegt der Mann wirklich etwas für sein Geld zu sehen; er bekommt nämlich – immer und immer wieder, in unendlichen Variationen – gezeigt, wie schöne Damen – oder Damen, die der Mann aus der New Yorker Vorstadt doch schön findet – sich ausziehen! – Man mißverstehe mich nicht: Hier kommen nicht entkleidete Damen auf die Bühne – so einfach liegt die Sache hier nicht. Die Damen vielmehr entkleiden sich auf der Bühne – das ist der Trick und der Spaß. Zunächst treten sie, recht sittsam, im Pelzmantel auf – manche tragen sogar einen Muff. Der Muff fällt, der Mantel fällt, und dann fällt einfach alles. Was übrigbleibt, ist ein winziges Schürzchen und eine Exhibition von rosig gepudertem Fleisch, die das maskuline Publikum zu Beifallsstürmen entflammt. Inzwischen hat die Dame auch noch irgend etwas gesungen – ein kleines Lied, in dem die Worte «love» and «baby» häufig vorkommen; aber das spielt keine Rolle. Wenn das rosige Fleischgebilde – mit Schürzchen – abgetrippelt ist, klatschen die Männer im Parkett zunächst minutenlang. Dann besprechen sie miteinander die Details der interessanten Darbietung und hören auch nicht auf zu sprechen, während droben, auf der Bühne, eine komische Szene von ein paar biederen alten Komödianten dargeboten wird. Stille wird es im Saal erst wieder, wenn die nächste Dame an die Reihe kommt; sie trägt, zur Abwechslung, großen Strohhut und Sonnenschirm, aber man weiß ja schon: sie wird solchen Putz nicht lange tragen – noch einmal singt sie hastig: « I am your baby … », und dann zeigt sie strahlend ihre ganze Herrlichkeit.
Eine «Burlesque-Show» muß man gesehen haben, und sei es nur eine Viertelstunde lang. Nordamerika ist ein «puritanischer» Erdteil genannt worden – und ist es wohl auch, in mancher Hinsicht. Aber man muß Zeuge der naiven Sinnlichkeit gewesen sein, die sich in einer New Yorker «Burlesque-Show» manifestiert, um begreifen zu können, wie schief und einseitig allgemeine Charakterisierungen dieser Art meistens sind …
Die Auswahl an abendlichen Vergnügungen ist enorm, die meisten von ihnen sind nicht teuer, der Mann vom Broadway weiß nicht, für welche er sich zuerst entschließen soll – solange er noch einen Dollar in der Tasche hat.
Wie ist die Attraktion einer «Burlesque-Show» zu überbieten? Was kann noch erregender sein als die Damen, die sich auf offener Bühne so sehr privat benehmen? Ein Boxkampf? Oder wilde, schöne Pferde? – Boxkämpfe oder wilde, schöne Pferde gibt es im Madison Square Garden zu sehen, einem riesenhaften Gebäude an der 8. Avenue, halb Sportpalast und halb Zirkus. Ich wurde von einem Freund dorthin geführt, um die Cowboys – und -girls – aus dem Wilden Westen zu bewundern. Die große Darbietung wird «Rodeo» genannt; dies ist eine tolle, erstaunliche Sache. Die Cowboys zeigen alle ihre Künste, und sie können in der Tat mehr, als man einem sterblichen Wesen zutrauen möchte. Sie reiten nicht nur auf Pferden, die sich bäumen wie nicht gescheit, in einem schauerlichen Galopp um die Manege; sie reiten auch auf Stieren, und dem, der zusieht, wird es angst und bange. Eine Zuschauermenge, die den Riesenzirkus fast bis zum letzten Platz füllt, ergötzen sie mit allerlei gewagten Spielen: Ein Kalb muß vom Pferde aus mit dem Lasso eingefangen und möglichst schnell gefesselt werden ; es kommt darauf an, wer am geschwindesten die wilde, widerspenstige Kuh melken kann – und was dergleichen höchst schwierige und gefährliche Scherze mehr sind. Dazu spielt Blechmusik von einer hohen Estrade, und es riecht nach Zirkus; die Luft ist voll von diesem wunderbaren, scharfen Geruch, den irgend jemand den besten Geruch auf dieser Erde genannt hat – den besten Geruch außer dem des Meeres … Die Reiter aus dem Wilden Westen sind für drei Wochen in der Stadt New York. Sie sind angereist gekommen mit ihren Pferden, mit ihren bunten Hüten und Hosen. Sie zeigen den New Yorkern, was sie können. Und diese sind dankbar. Sie erscheinen in hellen Haufen im Madison Square Garden, zum «Rodeo»; sie klatschen, schreien und applaudieren …
Aus dem Westen kommen die wilden Reiter mit ihren abenteuerlichen Kunststücken und mit ihren schwermütigen Liedern. Was kommt aus Europa – außer beängstigenden politischen Neuigkeiten? – Am beliebtesten unter allen «kontinentalen» Nuancen ist hier zur Zeit die österreichische. Salzburg ist die große Mode, das Dirndlkleid der letzte Schrei. Von dieser amerikanischen Vorliebe für das österreichische Kolorit profitiert Erik Charell, der in einem der größten New Yorker Häuser mit Erfolg das «Weiße Rössl» zeigt. Die Amerikaner sind begeistert von den jodelnden Tirolerinnen und den schuhplattelnden Burschen; sie sind verliebt in dieses Weiße Rössl – dessen Welterfolg ja viel dazu beigetragen hat, daß Österreich beim großen angelsächsischen Publikum so populär wurde. Da Charell die große Revue inszeniert und da Stern sie ausgestattet hat, ist sie geschmackvoll bei allem Prunk; ja, manche Bilder haben sogar, über das konventionell Revuehafte hinaus, einen echten, volkstümlichen Charme und wirkliche Schönheit. Charell beweist noch einmal sein großes, eigentümliches Talent für die etwas monströse Form der Ausstattungsrevue – was ihm um so höher anzurechnen ist, als das schauspielerische Material, mit dem er es diesmal zu tun hat, manches zu wünschen übrigläßt.
Kommt neben den Entkleidungs-Effekten der «Burlesque-Show», neben den Sport-Rekorden des Madison Square Garden, neben dem unerhörten Aufwand der großen Revue und neben Filmen, die immer interessanter, immer lebendiger werden, das literarische Theater überhaupt noch in Frage? Aus Hollywood kommen jetzt beachtenswerte Dinge, die wohl auch den Anspruchsvollen nicht nur zu unterhalten, sondern geistig zu beschäftigen vermögen; ich denke dabei an Filme wie «Dodsworth» – eine sehr eindrucksvolle Darstellung des Eheromans von Sinclair Lewis. Was an einem Film wie diesem vor allem auffällt, ist, daß Hollywood beginnt, einen ernsteren, nachdenklicheren, strengeren Kontakt zur Realität des modernen Lebens zu nehmen. Man verzichtet allmählich – und sei es auch zunächst nur in einzelnen glücklichen Fällen – auf jene grundsätzliche und konsequente Verlogenheit, die jedes Ereignis, auch das bitterste, in der süßlichen Zurechtmachung zeigte. In «Dodsworth» treten nicht Puppen auf, sondern Menschen – die wirkliche Gesichter haben, nicht mehr Masken aus Schminke.
Wird ein Film, der sich zum Besseren, Höheren entwickelt, das literarische Theater allmählich ganz verdrängen? Es sieht nicht so aus – wenigstens in New York sieht es nicht so aus. Hier gibt es große Gruppen von Menschen, die sich beinahe nie einen Film ansehen, aber kein Theaterstück versäumen. Für sie bedeutet ein neues Schauspiel von O'Neill, Kingsley oder Clifford Odette oder der «Hamlet» mit Leslie Howard eine viel größere Sensation als ein neuer Film mit Harold Lloyd oder der Garbo. Nirgendwo auf der Welt – außer vielleicht in Moskau – wird jetzt soviel und fruchtbar im Theater experimentiert, nirgendwo sonst werden theatralische Experimente mit einem so starken öffentlichen Interesse verfolgt wie eben hier, in New York. Aber von diesem komplexen und sehr fesselnden Gegenstand – dem New Yorker Theater – will ich ein andermal reden.
Die Stadt ist groß. Hier finden sich Interessenten für alles. Im Augenblick aber interessieren sich alle hauptsächlich für eines : für den Ausgang der Präsidenten-Wahlen. Der entscheidungsvolle und bedeutende Kampf zwischen den beiden Männern Roosevelt und Landon – der zugleich die Auseinandersetzung zwischen zwei Gesinnungen ist – beschäftigt hier jeden. Keine Nachricht aus Europa – ob sie nun den spanischen Bürgerkrieg oder den Scheidungsprozeß der Mrs. Simpson betrifft – erregt die Gemüter annähernd so wie irgendein Detail des Wahlkampfes. Sogar in den Vergnügungsstätten – zum Beispiel im Kino – spielt der Wahlkampf seine dominierende Rolle. Vor jedem Film werden, im Vorprogramm, sowohl Landon als Roosevelt gezeigt; meistens sieht man sie mit ihren Enkelkindern – zuweilen auch auf Sportplätzen oder bei Massenmeetings. Die beiden großen Kandidaten lächeln und winken. Das Publikum applaudiert und zischt. Applaudiert es länger für Roosevelt oder für Landon? Es hängt von der Lage des Kinos ab und auch von den Eintrittspreisen, die es nimmt. In den teuren Kinos ist Landon beliebter als der gegenwärtig amtierende Präsident. An den großen, eleganten Wagen sieht man beinah immer das Schild mit Landons Namen.
Aber wenn diese Zeilen in Europa erscheinen, ist der große Kampf um den höchsten Posten der Vereinigten Staaten schon entschieden. Der wahrscheinliche Sieg Roosevelts wird schon auf dem Broadway ausgeschrien und bejubelt worden sein – auf diesem unglaublichen Broadway, der jeden Abend neu zu strahlen beginnt wie zu einem Fest!
Das Film-Museum
Filme haben eine kurze Lebensdauer. Ein paar Wochen lang – oder höchstens während einiger Wochen – werden sie von aller Welt gekannt, um dann von aller Welt vergessen zu werden. Manchmal erinnern wir uns mit Wehmut an schöne Filme aus der guten stummen Zeit. «Die freudlose Gasse», mit Asta Nielsen, Werner Krauß und mit einer Garbo, die noch etwas finster und unbeholfen wirkte … Die großen literarischen Experimente des stummen Films, die Nielsen als Hamlet, die Nielsen als Wedekinds Lulu. Wie lang ist das her! Wer erinnert sich noch? Irgendwo muß es einen Film-Friedhof geben. Film-Friedhöfe gibt es sicherlich viele: es sind alle die Orte, wo alte Filme vergessen werden und verstauben. Ich weiß aber nur von einem Film-Museum, von einer Film-Bibliothek. In New York hat man «The Museum of Modern Art Film Library» eingerichtet; denn man ist nicht ohne Sinn fürs Historische in diesem Erdteil mit der kurzen Historie. Den Leuten hier imponiert alles, was die Patina des Vergangenen hat – und wenn es auch nur eine dreißig oder vierzig Jahre alte Patina ist. Ein Film aus dem Jahre 1893: das ist wie ein Ungeheuer aus der Eiszeit. – Nicht ohne Feierlichkeit versammelt man sich eines Abends in den behaglichen Clubräumen des Film-Museums, um sich Ungeheuer solcher Art zu betrachten.
Es herrscht eine andächtige Stimmung, so wie wenn ein Künstler alte Musik auf den wunderlich schmalbrüstigen, edlen und unvollkommenen Instrumenten der versunkenen Epoche erklingen läßt. Sieh an ! – denkt man zunächst –: das hat die Menschen dieser längst dahingegangenen Zeit zu rühren vermocht! Und: sieh an – denkt man später –: es rührt auch uns noch, es erregt auch uns noch … Die Menschen haben sich vielleicht gar nicht so sehr viel verändert.
Der Vorführung folgen Reden. Ein junger Mann mit Brille–Direktor des Museums – gibt erläuternde Berichte über seine Tätigkeit. Nach ihm spricht ein alter Herr aus Hollywood – ehrwürdiger Veteran der Filmindustrie. Von der frühen Zeit des Films plaudert er wie von einer heroischen Epoche. Da er drollige Anekdoten über die Zwischentexte, auf die der stumme Film angewiesen war, zum besten gibt, wirkt es, als erzähle er von jenen Tagen, da man in die Kriege noch mit Pfeil und Bogen zog und über die Meere noch in Segelschiffen reiste. Der alte Herr spricht vorzüglich; überhaupt ist es bemerkenswert, wie diese Amerikaner öffentlich zu reden verstehen : nachlässig, die Hände in den Taschen, dabei pointiert und mit gutem Sinn für komische wie für pathetische Wirkungen. Die Kunst des öffentlichen Redens ist hier fast ebenso allgemein wie im neuen Rußland, wo jeder Arbeiter zu ihr erzogen wird … Aber, ich wollte von den alten Filmen erzählen.
«Die Enthauptung der Königin Mary von Schottland» («Produced by the Edison Co.») stammt aus dem Jahre 1893. Der ganze Schrecken dauert höchstens zwei Minuten lang. Man sieht die arme Königin auf die Knie sinken; man sieht einen Henker mit gräßlicher Gebärde das Beil schwingen. Dann fällt das Haupt des fürstlichen Opfers : man sieht das Haupt wirklich fallen, es ist eine recht geglückte und ziemlich grausige Trickaufnahme. Der Zuschauer sieht sich den krassen Vorgang an, wie eine bewegte Gruppe aus der Wachsfiguren-Schreckenskammer. In der Tat ist der kleine Film «The Execution of Mary Queen of Scots» eine Schaubuden-Angelegenheit. Etwas anderes war das Kino damals nicht und wollte es auch nicht sein.
Schaubuden-Angelegenheit – aber von der lustigen Sorte – ist auch der nächste Bildstreifen: «Waschtag-Aufregungen» (1895). Spielzeit: anderthalb oder zwei Minuten. Ein paar Weiber stehen bei ihren Waschtrögen; ein kleiner Junge springt die Treppe herunter und stößt – nicht aus Ungeschicklichkeit, sondern aus munterer Bosheit – den Waschtrog um; die Weiber schlagen – halb jammernd, halb lachend – die Hände über den Köpfen zusammen. Aus kleinen Scherzen so harmloser Art entwickelte sich allmählich die große Filmkomödie …
Der nächste Film, der uns vorgeführt wird, ist aus dem Jahre 1902 und hat schon ganz anderen Rang. Er heißt «Die Reise zum Mond» und ist inszeniert und ausgestattet von Georges Méliès. Der Fortschritt von den Zweiminuten-Scherzen zu Méliès' Filmphantasien ist erstaunlich. Der französische Regisseur antizipiert die Arbeiten seiner «surrealistischen» Pariser Kollegen von heute; andererseits aber auch den Typus des großen utopisch-konstruktiven Films, mit dem Fritz Lang seine Welterfolge hatte. Mit einem bewundernswerten Instinkt erkennt dieser wirkliche Pionier der Filmkunst die spezifisch filmischen Möglichkeiten für das Phantastische und das Groteske. Méliès' kleiner Märchenfilm hat ganz die Atmosphäre eines intimen Pariser Spektakels um die Jahrhundertwende: Ballettmädchen tanzen und werfen Kußhände, wenn das Projektil, in dem die Professoren mit komischen Bärten sitzen, zum Monde abgeschossen wird. Auch auf dem Monde gibt es gleich wieder Ballett – dort freilich einen Reigen von widrigen Mondteufeln, die sehr unheimlich hüpfen und springen, und sich in Rauch und Flammen auflösen, wenn man ihnen einen leichten Schlag versetzt. Auf alle scheinwissenschaftlichen Effekte à la Jules Verne wird konsequent verzichtet. Das Ganze ist heiter, leicht witzig. Es ist ein reizender kleiner Film; er gehört zu den wenigen poetischen Filmen, die ich je gesehen habe.
Während man die «Reise zum Mond» mit einem wirklichen und lebhaften Vergnügen sieht, betrachtet man den «Großen Zugüberfall» (1903, Edison Company) nur mit historischem Interesse. Dabei ist dieser «Great Train Robbery» technisch auf einem viel höheren Niveau als die liebenswürdige Phantasie des Georges Méliès. Die naive Mord- und Räubergeschichte hat schon viele Vorzüge des großen Wildwest-Reißers – die rapid fortschreitende Handlung, die unbekümmerte Derbheit des Humors –: nur alles noch unfertig, unausgebildet, mehr eine Möglichkeit als eine Erfüllung.
Ganz und gar grotesk – aber unabsichtlich grotesk – ist ein Pathéstreifen aus dem Jahre 1905: «Faust». Hier erscheint der Held der deutschen Tragödie als ein jammernder alter Rabbi – im Kaftan, mit spitzem Bart –; und er lamentiert über die Qual des zuviel und zuwenig Wissens wie ein Wucherer über das falsche Pfandstück, das man ihm gebracht. Gleich ist auch der Teufel da, und er ist ein fetter Ballettänzer, der die absurdesten Sprünge macht, und da er sich in einen Hund verwandelt, ist es nicht der Pudel, dessen Kern man kennt, sondern ein großer, treuherziger Schäferhund. Am schönsten wird es, wenn das Gretchen in Erscheinung tritt: sie ist noch dicker als selbst Mephisto, aber natürlich viel tugendsamer als der. Man möchte gerne das Schauspiel bis zum Ende sehen; leider bricht es ab, nachdem der alte Rabbi sich in einen schmucken Opernhelden in weißen Trikots verwandelt hat und nachdem der Böse, in einem Glorienschein aus bengalischen Flammen, in Gretchens Stube eingetreten ist, um dort das Kästchen mit Geschmeide zu deponieren.
Der «Faust», über den wir so gerne noch lange gelacht hätten, bricht ab ; die «Königin Elisabeth » aber dürfen wir bis zum Ende sehen. Und das ist gut: denn die Königin Elisabeth ist keine andere als Sarah Bernhardt, und eben dieser Film – er stammt aus dem Jahre 1911 – ist es, der aus dem Kino zum ersten Mal einen Ort machte, den ein anständiger Amerikaner, ohne sich zu schämen, betreten durfte. Der Ruhm der großen Sarah kam dieser neuen, zweifelhaften, noch nicht durchgesetzten Kunstart, dem Film, zugute. Der Film wurde plötzlich salonfähig, da die Bernhardt geruht hatte zu filmen. – Und wie dankbar sind wir ihr dafür, daß sie es tat! Wir haben Kainz nicht gesehen und die Duse nicht; nun sehen wir doch wenigstens – im Film-Museum – den Schatten der Sarah Bernhardt. Freilich: es ist nur ein Schatten, der sich auf eine wunderlich übertriebene, hastige, beinah zappelnde Art bewegt; und es fehlt die Stimme, und es fehlt der Blick – denn damals gab es ja noch keine Großaufnahme. Aber manchmal meinen wir doch – an irgendeiner Geste, irgendeiner Haltung – diese Schauspielerin zu erkennen, von deren Kunst Generationen erschüttert waren. Manchmal plötzlich steht sie da wie eine Königin – und sie ist doch schon ziemlich dick, und wenn sie geht, bemerkt man, daß mit ihrem Beine etwas nicht in Ordnung ist. Selbst in der Todesszene – bei diesem mit naivem Raffinement arrangierten Schauspiel ihres Sterbens, rührt sie uns und erschreckt uns fast. Umgeben von ihren Damen steht sie vor einem Lager aus Polstern, die man zurechtgelegt hat, eigens zu dem Zweck, daß die Königin auf ihnen stürbe. Sie hebt die Arme, sie klagt, und dann stürzt sie hin – stürzt einfach hin wie ein gefällter Baum und ist tot. Aber tot ist sie nur vorübergehend, nur einige Sekunden lang; denn gleich steht sie wieder auf und verneigt sich lächelnd vor ihrem Publikum – verneigt sich lächelnd vor uns, die wir, fünfundzwanzig Jahre später, den königlichen Akt ihres Sterbens bewundern. Der Film war reif, eine Kunst zu werden; denn die Sarah Bernhardt hatte gefilmt. – «Dieses ist meine einzige Chance, unsterblich zu werden», sprach, als man sie aufforderte zu filmen, kokett die unsterbliche Sarah Bernhardt.
Europas Maler in Amerika
Brief aus New York
Das Smith-College – in Northampton, Mass. – gehört zu den besten Universitäten für Mädchen in den Vereinigten Staaten. Junge Damen aus den guten Familien treiben dort Medizin, Altphilologie, Sternenkunde und Tennisspiel. Das Institut ist in einem sehr liberalen, aber durchaus bürgerlichen Geist geführt. Zu seinen Sehenswürdigkeiten zählt – neben Sportplatz, umfänglicher Bibliothek, Theatersaal und Schwimmbad – ein kleines Museum. Im oberen Stockwerk des Museums hängen ältere Bilder, zum Beispiel eine bemerkenswert gute Kollektion französischer Impressionisten. Im Souterrain gab es, gerade als ich im Smith-College zu tun hatte, eine besondere Ausstellung. Sie war angezeigt mit dem Worte «Krieg» – «War-Exhibition» stand zu lesen auf einem Plakat, dessen sich übrigens die anspruchsvollste moderne Kunstgalerie nicht hätte zu schämen brauchen. Als Affiche diente eine Kopie des «Berliner Tageblatts», Extra-Ausgabe («Gratis!»), vom Dienstag, dem 28. Juli 1914: «Die Kriegserklärung an Serbien … » Über dem etwas verblaßten historischen Text – «Auf Grund Allerhöchster Entschließung Seiner K. und K. apostolischen Majestät» – standen in fetten roten Lettern die drei Namen: Grosz. Kollwitz. Dix. – Ich ließ mich von dem jungen Direktor des Museums durch diese Kriegsausstellung führen – und ich war überrascht. Wie : solche Dinge wagt man jungen Damen aus den guten Familien hier zu zeigen – Dinge von solcher Kraßheit, solcher Gewagtheit, solchem künstlerischen und gesinnungsmäßigen Radikalismus? Man riskiert es, junge Mädchen, die Golf spielen und Plutarch lesen sollen, zu entsetzen mit allen Details dieser Hölle aus Dreck und aus Blut, mit den schauerlichen Einzelheiten des Nahkampfes, des Schützengrabens, der verkommenen Etappe? – Dem Leiter eines Colleges, der Unternehmen wie diese Kriegs-Ausstellung nicht nur duldet, sondern protegiert, ist pädagogischer Mut entschieden nicht abzusprechen.
Man erinnert sich des blutigen Witzes, der entsetzlichen Klage, des Hohns und des unendlichen Jammers auf den frühen – heute klassischen – Blättern des genialen George Grosz; man kennt die unerbittliche, fast dürerhafte Exaktheit, mit der Otto Dix das Inferno der modernen «Materialschlacht» – diese schlimme Landschaft des Stacheldrahts, der explodierenden Granaten und der verrenkten Glieder –schildert; und die hilflos trauervolle Gebärde, mit der, auf den Darstellungen der Käthe Kollwitz, die Weiber sich über ihre verstümmelten Männer, die Mütter sich über ihre hungernden Kinder neigen, wird für immer unvergessen sein. Und man erweist jungen Menschen – jungen Mädchen – die Ehre, ihnen solches vorzuführen, sie mit diesen Schrecken bekannt zu machen! Man warnt sie vor der Niedertracht des modernen Krieges, indem man ihnen solche Niedertracht zur künstlerischen Vision verdichtet und gesteigert vor Augen führt. Mögen sie sich schütteln und gruseln, die jungen Damen, ehe sie wieder auf ihre Tennisplätze gehen! Solches ist gelitten worden, solches ist glorifiziert worden als die «große Zeit», und die Künstler, die die «große Zeit» als das gebrandmarkt haben, was sie wirklich war – als eine grauenvoll heruntergekommene –, haben sie doppelt, haben sie hundertfach durchlitten; einmal als ihre Opfer und neunundneunzigmal als ihre Ankläger.
George Grosz lebt heute in der Nähe von New York. Er hat sich verändert; ein sehr langer und mit großer Leidenschaft geführter Kampf hat ihn müde werden lassen. Er ist «unpolitisch» geworden – oder er versucht es doch zu sein. Er behauptet, an den Wert, ja, an die Daseinsberechtigung der politisch-satirischen Kunst – die er selber zu einer Vollendung gebracht hat, die in Deutschland niemals gekannt und niemals anerkannt wurde – nicht mehr zu glauben. Er zeichnet nicht mehr; er malt. Er findet und erfindet sich eine neue und sehr zaubervolle Landschaft, in die er flieht – überdrüssig jener gespenstisch gar zu realen Sphäre, deren widrige Bewohner, schmatzende Spießer, verstümmelte Soldaten oder frierende Bettelkinder früher seine Modelle waren. Nun aber schwelgt er in einem farbigen Lyrismus. Auf seinen neuesten Bildern begegnen sich amerikanische Motive mit romantisch-europäischen; über dem Central Park von New York gehen Himmel auf, in denen die zartesten Farben mit den heftigsten spielen und sich miteinander vermischen, und vor der steilen Front der Wolkenkratzer blühen Gebüsche, deren Dolden aus anderen und lieblicheren Zonen zu stammen scheinen. – Es ist ein ergreifendes – und wenn man will auch melancholisches – Schauspiel: Diese Verwandlung des Mannes George Grosz – zu was ? Zum Künstler ? Aber das war er immer, auch als er noch spottete und kämpfte, oder gerade dann …
Sehr reizvoll ist zu beobachten, auf wievielerlei Arten die amerikanische Landschaft – oder die Landschaft der Stadt New York – den europäischen Maler, der hier lebt und arbeitet, beeinflußt. Seit einigen Wochen hält sich der Italiener Chirico hier auf, dessen Ausstellung in New York ein gewisses Aufsehen macht. Auf einigen seiner letzten Tafeln ragen die Konturen der New Yorker Hochbauten in den glasigen Himmel einer mythologischen Landschaft, in der bis jetzt nur Jünglinge – nackt, mit der phrygischen Mütze – erstarrt vor Trauer und Einsamkeit bei gestürzten Säulen und vor öden Tempeln standen. Die gestürzten Säulen und die öden Tempel sind geblieben – und die Einwohner der Stadt New York betrachten sich mit andächtig betretenen Mienen die wundervollen Pferde Chiricos – diese zugleich schweren und beflügelten Rosse, mit dem kostbaren Gelock ihrer Mähnen, mit der hochmütig-tragischen Drehung des breiten und edlen Halses. Verwundert blicken die Leute vom Broadway und von der Fünften Avenue auf jene Gruppen von Halbgöttern, deren eiförmige, leere Häupter mit einem unsagbaren Schmerz in den Himmel ragen und die in ihrem klaffend geöffneten Schoße das Mobiliar ganzer Tempel und kleinbürgerlicher Wohnungen sorgenvoll bergen. Was für eine fremde Gegend – diese Gegend einer verzauberten, starr und unbegreiflich gewordenen, traumhaft überklaren Antike! Aber weht aus diesem wunderlichen Traumgebiet die Leute vom Broadway und der Fifth Avenue nicht doch auch eine vertraute Luft an? Hat nicht diese steinerne Tempel-Landschaft auch Ähnlichkeiten und Zusammenhänge mit der Landschaft ihrer eignen steinernen, großen, traumhaft schönen und traumhaft entsetzlichen Stadt? …
Chirico ergreift durch die fast manische Treue, mit der er an bestimmte Themen, an gewisse Stimmungen gebunden bleibt. Das Phänomen der großen duktiven Unruhe ist Picasso – der auch