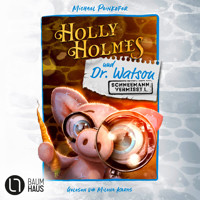9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Handbuch für alle, die Fantasy schreiben – ob deine erste Kurzgeschichte oder das große eigene Epos: Dieses Buch hat alles, was du brauchst, um deine Pläne in die Tat umzusetzen. Entwickle einen überzeugenden Plot, erwecke Figuren zum Leben, und ersinne Schauplätze, die dich und deine Leser begeistern. Bestsellerautor und Fantasy-Experte Michael Peinkofer führt dich durch das Einmaleins des Schreibens, verrät exklusive Tricks und begleitet dich auf deinem Weg zum erfolgreichen Autor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
www.piper-fantasy.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95515-7
© Auszüge aus »Das Buch von Ascalon« mit freundlicher Genehmigung von Bastei Lübbe, Köln
© 2011 by Michael Peinkofer und Bastei Lübbe
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2012
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Umschlagabbildung: Alan Lathwell
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Vorwort
Das ultimative Abenteuer
»Wie sind Sie Autor geworden?«
»Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?«
»Was muss man beachten, wenn man einen Verlag sucht?«
»Welche Tipps können Sie mir geben?«
Oft erreichen mich Zuschriften, in denen Fragen wie diese gestellt werden, und es vergeht kaum eine Lesung, in der ich nicht nach solchen Dingen gefragt werde. Das freut mich wirklich sehr, denn es zeigt, wie viel Inspiration vom phantastischen Genre ausgeht. Mehr noch als andere Leser scheinen Phantastik-Fans vor eigenen Ideen und Neugier regelrecht zu sprühen, und immer mehr von ihnen genügt es nicht, immer die Bücher anderer zu lesen – sie wollen selbst schreiben.
Für Autoren wie mich ist das eine schmeichelhafte Angelegenheit, denn letztlich bedeutet es ja nichts anderes, als dass wir andere Menschen durch unsere Arbeit dazu bewegen, selbst kreativ zu werden – und dieser Funke, diese Inspiration, die am Anfang eines jeden Romans steht, ist für mich immer wieder faszinierend. Wie kann es geschehen, dass etwas, das am Anfang nur ein Bild gewesen ist, allenfalls eine ungefähre Vorstellung, später zu etwas wird, das nicht nur eine zusammenhängende Geschichte abbildet, sondern auch zur Identifikation einlädt, zum Mitfiebern, zu einer Reise in Welten, die nie ein Mensch zuvor … ihr wisst schon.
Dieser Prozess, in dem aus einer zunächst noch vagen Idee ein konkretes Kunstwerk wird – wobei ich den Begriff »Kunst« hier nicht wertend meine, sondern nach seiner ursprünglichen Bedeutung einfach als etwas, das vorher noch nicht da war und künstlich geschaffen wurde – ist wirklich ziemlich magisch, sodass dieses Buch seinen Titel zu Recht trägt. Es geht nämlich um nicht mehr und nicht weniger als darum, selbst zum Zauberer zu werden, der kraft seiner Begabung und der ihm innewohnenden Freude am Erzählen aus anfangs noch weitgehend zusammenhanglosen Einfällen eine geschlossene Geschichte erschafft, ein Abenteuer, das von fernen Zeiten und exotischen Welten handelt und – im Idealfall – von Hunderten oder gar Tausenden Menschen gelesen wird.
Über diesen Vorgang zu sprechen, macht immer Freude, aber natürlich kann der Zeitrahmen einer Lesung niemals ausreichen, um genau zu erklären, wie man zum Schreiben kommt, wie man eine Geschichte schmiedet und glaubwürdige Charaktere formt. Oder welche Dinge Nachwuchsautoren beachten sollten, wenn sie sich auf die Suche nach einem Verlag oder Agenten begeben. Denn davon gibt es eine ganze Menge, und nicht alle von ihnen arbeiten seriös und zuverlässig, wie noch zu zeigen sein wird. Und so ist im Lauf der Zeit die Idee zu diesem Buch entstanden.
Natürlich kann kein Autorenhandbuch – auch dieses nicht – eine Garantie dafür liefern, dass man bei Befolgung aller Vorschläge einen Verlag findet und einen Bestseller landet. Aber es kann helfen, in die richtige Richtung zu gehen und häufige Fehler von vornherein zu vermeiden. Und natürlich kann ich auch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben, sondern nur von meinen Erfahrungen auf dem weiten Feld des Schreibens berichten, das ich nun seit fast zwanzig Jahren beackere.
Bei Licht betrachtet, ähnelt die Rolle des Autors jener des Fantasy-Helden, so wie der kreative Prozess mit all seinen Herausforderungen, seinen Widrigkeiten und Triumphen, auf manche Art der klassischen Queste gleicht, in der ein einsamer Held aus seinem gewohnten Umfeld gerissen wird und sich auf die Suche nach einem magischen Gegenstand begibt, den er nach langer Reise zu finden hofft. Beide, Autor und Fantasy-Held, begeben sich auf neues, ungewohntes Terrain; beide lassen sich auf ein Abenteuer ein, dessen Ende noch gar nicht absehbar ist; beide rüsten sich mit (mehr oder weniger) magischen Waffen, um den Herausforderungen des Weges zu begegnen; beide treffen unterwegs Verbündete, deren Eigenschaften sie sich zunutze machen können, aber auch auf Gegner, die ihre Pläne zu vereiteln suchen; und beide haben deutlich ein Ziel vor Augen, das sie erreichen wollen, auch wenn es bisweilen unendlich weit entfernt scheint.
In diesem Sinne lade ich euch, liebe Leserinnen und Leser, liebe Kollegen in spe (und erlaubt mir, dass ich euch als solche duze) ein, mir auf eine Reise zu folgen, die der eines meiner Romanhelden ähnelt (Granock heißt er, vielleicht kennt ihn der eine oder die andere) und die doch ganz eure eigene ist. Natürlich weiß ich nicht, was ihr daraus machen werdet, aber das wusste der Zauberer Farawyn auch nicht, als er seinen Schüler in die Geheimnisse der Magie einweihte. Welche Entscheidungen ihr trefft, ist ganz und gar euch überlassen. Es ist ein wenig wie in den Mitmach-Büchern, in denen der Leser selbst entscheiden darf, wie die Reise des Helden weitergeht. Das Schreiben ist nun das ultimative Mitmach-Abenteuer, die größte Pen and Paper-Queste aller Zeiten, denn niemand legt irgendwelche Vorgaben fest – niemand außer dir selbst. Und so unterschiedlich die Entscheidungen sind, die du triffst, so sehr unterscheiden sich auch deine Geschichten.
Ähnlich wie für die Helden der Fantasy geht es auch für Autoren letztlich stets darum, sich selbst zu erforschen, die eigene Vergangenheit, und aus ihr die Kraft und Inspiration zu beziehen, Neues zu formen.
In diesem Sinne können wir die Taue lösen, ablegen und uns auf die Reise begeben – seid ihr dabei?
Prolog
Granock verharrte in seiner Bewegung.
Es war, als hätte der Rachen eines Untiers den Stollen und alles, was sich darin befand, verschlungen. Schlagartig war es finster geworden, schwärzer als selbst in den dunkelsten Gassen Andarils. Und Granock wusste aus unheilvoller Erfahrung, wie finster es in mondlosen Nächten in Andarils Gassen werden konnte.
Die Hand des Zauberers schloss sich um den flasfyn in seiner Hand, und er versuchte, dem Elfenkristall am oberen Ende des Stabes ein wenig Licht zu entlocken.
Vergeblich.
Die Schwärze, in die der Stollen plötzlich gefallen war, war so abgrundtief und endlos, dass sie selbst die Dunkelheit verschluckt zu haben schien. Und sie war von solcher Bosheit und zerstörerischer Macht durchdrungen, dass sie jeden Zauber, jede Art von lichter Magie unterband. Was auch immer Granock am Ende dieses Stollens vorfand, er würde ihm so gegenübertreten müssen, wie er war.
Allein.
Unbewaffnet.
Seiner Fähigkeiten beraubt.
Die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, tastete sich der Zauberer vorsichtig weiter, einen Fuß vor den anderen setzend wie ein Traumwandler – gleichwohl wie einer, der einen grässlichen Albdruck durchlebte.
Die Schreie seiner beiden Gefährten, die ihn den schmalen Bergpfad herauf und bis zum Eingang des Stollens geführt hatten, klangen ihm noch im Ohr. Es war schnell gegangen, so schnell, dass er nichts dagegen hatte unternehmen können. Selbst seine Fähigkeit, den Fortgang der Zeit für einige Augenblicke aufzuhalten, hatte versagt angesichts der ungeheuren Gewandtheit, mit der die Kreatur zugeschlagen hatte. Woher sie gekommen war, wusste Granock noch immer nicht zu sagen. Ein grauer Schemen, mörderische Fänge, der übel erregende Geruch des Todes – das war alles, was er wahrgenommen hatte. Dazu jenes grässliche Geschrei, das er nicht mehr vergessen konnte und das ihn selbst in der absoluten Stille, die in der Finsternis herrschte, noch verfolgte.
Seine linke Hand, die er tastend ausgestreckt hatte, stieß plötzlich auf ein Hindernis. Es war kalt und von rauer Beschaffenheit, Felsgestein, das jedoch behauen worden war. Granocks Verdacht, es nicht mit einer natürlichen Höhle, sondern einem alten, vor langer Zeit verlassenen Mine zu tun zu haben, erhärtete sich. Es gehörte zur Natur der Zwerge, ihre Bergwerksstollen durch die Felsen und Klüfte des Scharfgebirges zu treiben, stets auf der Suche nach wertvollen Metallen und funkelndem Gestein. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass sie zu tief gegraben hatten …
Granock schloss die Augen, versuchte sich ein Bild von dem zu machen, was seine Hand in der Finsternis befühlte.
Leere Augenhöhlen … grässliche Hauer in den Winkeln eines weit aufgerissenen Mauls. Eine steinerne Fratze, fraglos in den Stein gemeißelt, um unvorsichtige Besucher vor dem Betreten dieses Stollens zu warnen.
Ein verwegenes Grinsen huschte über Granocks Gesicht.
Die Warnung kam zu spät.
Vorsichtig schlich er weiter, als er mit dem Fuß gegen ein Hindernis stieß. Ein kaltes, trockenes Klappern erklang und zerriss die Stille im Stollen. Granock stieß eine halblaute Verwünschung aus. Er kannte jenes Geräusch nur zu gut – es war das Klappern von Knochen, die den Stollenboden übersäten.
Offenbar war er nicht der Einzige, der die Warnung der Zwerge in den Wind geschlagen hatte …
Es war derselbe Moment, in dem er das Knurren hörte.
Die Kreatur war hier.
Ganz nah …
Stop.
Die Luft im Zimmer ist stickig geworden, ich muss das Fenster öffnen. Wieder zurück in unsere Welt kommen. Und dann eine Tasse Tee, während ich darüber nachdenke, wie der Kampf zwischen Granock und dem – ja, wem eigentlich? – weitergehen soll.
Worauf wird der aus Shakara verbannte Zauberer in jenem alten Zwergenstollen stoßen? Was treibt er überhaupt dort? Wer waren die Gefährten, von denen die Rede war und die am Eingang des Stollens offenbar ein ziemlich unangenehmes Ende ereilt hat?
Fragen über Fragen, die an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden können. Jedenfalls nicht von mir. Denn in diesem Buch, diesem Handbuch für kreative Zauberer, geht es nicht in erster Linie um die Weisen von Shakara, auch wenn sie immer wieder auftauchen und sich freundlicherweise (und ohne Honorar) bereit erklärten, als Anschauungsobjekte zur Verfügung zu stehen, sondern um euch; um all jene, die die schöpferische Ader in sich spüren. Die noch davon träumen oder es bereits ganz fest vorhaben, selbst zum Stift bzw. zur Tastatur zu greifen, ihre eigene Fantasy-Story zu ersinnen und so zum Zauberer zu werden, zum Magier der Worte in einem Reich der Phantasie.
Seid ihr bereit, euch der Herausforderung zu stellen?
Ein wenig warnen möchte ich schon. Es erfordert Mut, Durchhaltevermögen und nicht zuletzt eine gute Portion Begabung, aus einem einzelnen Gedanken eine komplexe Welt und aus einer einfachen Idee einen ganzen Roman zu formen – genau jene Eigenschaften also, die auch die Protagonisten der Geschichten auszeichnen, die wir alle so gerne lesen.
Ihr seid noch an Bord? Dann folgen wir ihnen also auf ihren abenteuerlichen Spuren.
Erstes Buch
EIN HELD WIRD GEBOREN
1
Brei mit Holzgehalt
In diesem Buch soll es nicht darum gehen, warum ich den armen Granock in diese prekäre, ja beinahe aussichtslose Situation geschickt habe (und nicht nur in diese, er verübelt mir das immer noch) – sondern wie du die Geschichte weiterspinnen würdest: Was lauert dort in der Dunkelheit? Wird es unserem Helden gelingen, die Kreatur zu besiegen? Und wenn ja, auf welche Weise? Und was erwartet ihn am Ende des Stollens? Welches Geheimnis hütet der Berg? Gilt es einen Schatz zu entdecken, verborgenes Wissen oder etwas ganz anderes?
In den Antworten auf diese Fragen verbirgt sich nicht nur der Fortgang dieser einen Geschichte, sondern, im übertragenen Sinn, das Gesetz eines ganzen Genres. Denn genau um diese Dinge geht es in der Fantasy: Um mystische Kreaturen, um das Entschlüsseln alter Rätsel, das Erkunden unbekannten Terrains und den Kampf gegen dunkle Mächte – mit anderen Worten genau jene Themen, die die Menschheit seit Anbeginn ihrer Geschichte beschäftigt und gefesselt haben.
Wie alt aber ist das Genre der Fantasy? Wo kommt es eigentlich her, doch nicht aus Hollywood? Oder gar aus Neuseeland? Und wieso ist es wichtig, dies als angehender Autor zu wissen? Die Antwort ist dieselbe, die wohl auch Farawyn seinem unentwegt Fragen stellenden Schüler Granock gegeben hätte: Weil es hilft, seine Wurzeln zu kennen.
Fantasy-Helden wissen oftmals nicht, wer sie in Wahrheit sind oder woher sie kommen, was nicht selten die Ursache dafür ist, dass sie Hals über Kopf in ein Abenteuer verwickelt werden und in tödliche Gefahr geraten – etwa wie die Elfin Alannah in DIE RÜCKKEHR DER ORKS, deren Gedächtnis durch einen Zauber gelöscht wurde und die erst ganz allmählich hinter das Geheimnis ihrer Herkunft kommt. Als Autoren sind wir glücklicherweise durchaus in der Lage, zumindest unsere literarischen Wurzeln nachzuvollziehen und uns zu vergegenwärtigen, wo unsere kreativen wie inhaltlichen Ursprünge liegen – umso leichter ist es dann, dem Vorausgegangenen Neues hinzuzufügen.
Die Wurzeln der modernen Fantasy liegen, das wird niemanden überraschen, in den Mythen der Vergangenheit. Nicht nur, was das Figurenpersonal betrifft – Elfen, Zwerge, Drachen und sogar Orks begegnen uns in zahlreichen keltischen und nordischen Mythen, welche hauptsächlich als Vorbilder dienen, zumindest solange wir uns im Genre der High Fantasy bewegen; auch die oft vorzufindende Suche des Helden nach einem magischen oder zumindest mächtigen Gegenstand, die Queste, steht im Mittelpunkt vieler bekannter Mythen – denken wir nur an die Gralssuche des Parzival oder die vielen Helden des klassisch griechischen Sagenkreises, die sich auf die Reise begeben, wie etwa Jason, der zusammen mit den Argonauten das Goldene Vlies im Lande Kolchis an sich bringen will, oder Herakles, der sich übermenschlichen Prüfungen stellen muss, um seine Zugehörigkeit zum Olymp unter Beweis zu stellen.
Überall begegnen sie uns, die Helden klassischen Zuschnitts, die aus ihrem herkömmlichen Umfeld treten (oder auch nicht selten getreten werden) und sich einer neuen, größeren Aufgabe stellen müssen, an deren Ende nicht nur die Erfüllung ihrer Mission und der Triumph über den Gegner, sondern auch die eigene Erneuerung steht. Das klingt jetzt etwas überhöht, aber was ich meine, ist: der Held ist nach seinem Abenteuer nicht mehr der gleiche wie zuvor.
Der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell hat diese legendäre »Reise des Helden« zum Gegenstand seiner Forschungen erhoben und anhand struktureller wie inhaltlicher Vergleiche zahlreiche Übereinstimmungen in den Mythen dieser Welt gefunden. Seine Schriften haben nicht nur George Lucas maßgeblich beeinflusst, als dieser in den frühen 70er-Jahren über dem Drehbuch zu einem unbedeutenden kleinen Film brütete, der später den Namen STAR WARS erhalten sollte, sondern sind, nicht zuletzt dank der Arbeit Christopher Voglers, der Campbells Forschungen auf die Praxis des Drehbuchschreibens bezogen und damit ein Standardwerk geschaffen hat, bis heute gängige Arbeitsgrundlage vieler Autoren. Letztendlich waren es aber die Mythen der Menschheit, die diese Regeln klassischen Erzählens hervorgebracht und über Jahrtausende hinweg geformt haben.
Wenn diese Geschichten jedoch offenbar überall auf der Welt, unabhängig von unserem politischen, kulturellen oder religiösen Hintergrund, als ansprechend empfunden werden, muss dies bedeuten, dass es eine Art kollektive Lust aufs Abenteuer gibt, ein gemeinsames Schicksal, an das wir Menschen gebunden sind und das dafür sorgt, dass wir gar nicht anders können, als uns mit jenen zu identifizieren, die den schützenden heimischen Hort verlassen und sich auf die Suche nach dem Feuer, dem Fortschritt zu begeben. Genau diese Mythen sind es, aus denen sich die Fantasy als der moderne Nachfolger jener alten Geschichten, jener Sagen und Märchen nährt, und das ist auch der Grund dafür, warum sie stärker als jedes andere Genre auf diese Archetypen des Erzählens Bezug nimmt.
Wer Fantasy schreibt, begibt sich also an diese Quelle der Inspiration, zum Urgrund all dessen, weswegen Menschen jemals Geschichten erzählt haben. Denn obwohl es oftmals um Magie und übernatürliche Dinge gehen mag, obschon die Abenteuer unserer Helden in fernen Ländern, zauberischen Welten oder in grauer Vorzeit spielen, und obwohl diese Welten von Kreaturen bevölkert sind, die es in der wirklichen Welt nicht gibt, geht es letzten Endes stets um tief greifende menschliche Erfahrungen – um Liebe und Hass, Sünde und Sühne, Tod und Erneuerung. DER HERR DER RINGE ist nicht deshalb ein Meisterwerk, weil er in einer fernen, dem Hier und Jetzt entrückten Welt angesiedelt ist, sondern weil es ihm gelingt, Mittelerde zu einem Ort zeitloser Relevanz zu machen, an dem Dinge geschehen, die für uns alle nachvollziehbar sind. Und HARRY POTTER war nicht deshalb ein solcher Erfolg, weil die Handlung so umwerfend neu gewesen wäre, sondern weil es J.K. Rowling gelang, die grundlegenden Erfahrungen des Erwachsenwerdens mit einer Portion Magie zu versehen und das Ganze auch noch spannend zu erzählen.
Insofern ist auch der Vorwurf des Eskapismus, der der Fantasy vonseiten »seriöser« Kritiker oftmals gemacht wird – also der Wirklichkeitsflucht in fiktive Welten –, nicht so einfach zu halten. Indem sie das Phantastische dazu nutzt, ihre Protagonisten auf eine Reise menschlicher Grunderfahrungen zu schicken, handelt die Fantasy allen Unkenrufen zum Trotz von sehr realen Dingen. Ähnlich wie im verwandten Genre der Science Fiction, wo ein erdachtes Szenario genutzt wird, um bestehende technische, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Verhältnisse weiterzudenken und dadurch nicht selten als Irrweg zu entlarven, nutzt die Fantasy das Phantastische, um die menschlichen Eigenschaften ihrer Helden nur umso deutlicher und unverfälschter herauszustellen. Ein Held, der gegen einen Feuer speienden Drachen antritt, führt den alten Überlebenskampf der Menschheit gegen die zerstörerischen Kräfte der Natur; und wenn Luke Skywalker am Ende von DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK Darth Vader zum Lichtschwert-Duell gegenübertritt, stellt er sich damit letztlich seinen ureigensten Ängsten.
Darüber hinaus bietet gerade das phantastische Element natürlich auch die Möglichkeit, aktuelle Zeitgeschehnisse auf geschickte Weise zu kommentieren – schon der griechische Dichter Aesop hat das getan, indem er in seinen Fabeln Tiere sprechen ließ und auf diese Weise die Mächtigen kritisierte. Während eines Aufenthalts in den Niederlanden, wo ich die holländische Ausgabe von DIE ZAUBERER vorstellte, wurde ich beispielsweise wiederholt gefragt, ob der doch recht bürokratisch und schwerfällig agierende Rat der Zauberer von Shakara eine Anspielung auf die Europäische Union und das Europäische Parlament seien; ich musste dies zwar verneinen, da ich mir tatsächlich mehr das glücklose Parlament der Weimarer Republik zum Vorbild genommen hatte, jedoch wird deutlich, dass die Fantasy durchaus das Potenzial zur zeitgeschichtlichen Anspielung und sogar zum kritischen Kommentar hat. Auch unter diesem Aspekt birgt sie so mehr innere Wahrheit als so manches andere als »realistisch« gerühmte Genre.
Dies wussten – natürlich – auch die Schriftsteller der Romantik mit ihrer Schwäche für alles Mittelalterliche und Mystische. Mehr und mehr bezogen sie das Phantastische in ihre Erzählungen ein und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der modernen Fantasy. Auch der große J.R.R. Tolkien, der DER HERR DER RINGE schrieb und damit zumindest das Genre der High Fantasy begründet hat, war letztlich auf der Suche nach einer Art mythischem Realismus, wie David Day in seinem Buch TOLKIENS WELT einleuchtend analysiert: Tolkien, der bekanntlich Professor für angelsächsische Literatur in Oxford gewesen ist, ging es darum, eine Art »Urmythos« zu schaffen, also eine Sage, die aus vorgeschichtlicher Zeit stammen und aus der sich alle anderen Mythen des keltischen bzw. nordischen Kulturkreises entwickelt haben könnten. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat er viele der verwendeten Motive und Namen (übrigens auch die Orks, die als orcneas in der BEOWULF-Sage auftauchen) aus alten Sagen übernommen und sie in einen neuen inhaltlichen Zusammenhang gebracht. Und nicht von ungefähr war er enttäuscht darüber, dass manche Leser Mittelerde in einer anderen Dimension oder gar auf einem anderen Planeten verorteten, ist Tolkiens Welt doch eine deutliche geografische Metapher auf die europäische Kulturgeschichte.
Tolkien konnte natürlich nicht ahnen, dass sein literarisches Werk am Anfang einer im wahrsten Wortsinn sagenhaften Erfolgsgeschichte stehen und nachfolgende (Autoren-)Generationen nicht weniger inspirieren sollte als das Nibelungenlied oder die Artussage. Aber genau das ist geschehen – und wer in Sachen Fantasy tätig ist und behauptet, von Tolkiens Werk in keiner Weise beeinflusst zu sein, der ist wohl nicht ganz aufrichtig. Denn ganz gleich, ob man DER HERR DER RINGE liebt oder hasst, ob man es schon beim ersten Mal geschafft hat, sich durch die gewissen Längen des ersten Bandes zu wühlen oder ob man (wie ich) dafür drei Anläufe gebraucht hat; ob man wie mein geschätzter Autorenkollege Helmut Pesch fließend Elbisch spricht oder lediglich die Filme von Peter Jackson im Kino gesehen hat – wer Mittelerde einmal besucht hat, den lässt der Reiz dieser fiktiven und dennoch so wirklich anmutenden Welt so bald nicht wieder los.
Zahllose Autoren der 70er- und 80er-Jahre wurden maßgeblich davon inspiriert, die wiederum die heutigen Schriftsteller beeinflusst haben. In besonderem Maße gilt dies natürlich für die größtenteils aus unseren Breiten stammende (inoffizielle) Reihe der »Völker«-Romane, die einst mit Markus Heitz’ DIE ZWERGE begann und zu der ich mit der ZAUBERER-Trilogie und den ORKS ebenfalls ein paar illustre Gestalten beisteuern durfte.
Doch obwohl es sich hier einmal mehr um das klassische Figurenpersonal der High Fantasy handelt, hat jeder Autor seine eigene Perspektive auf die Charaktere entwickelt und ein eigenständiges Universum vorgelegt, was letztlich auch die Wandlungsfähigkeit und Flexibilität des Genres zeigt. Auf einer Lesung von DIE ZAUBERER musste ich mir von einem Zuhörer, der persönlich weniger mit Fantasy anfangen konnte und seiner Tochter zuliebe gekommen war, den Vorwurf gefallen lassen, in der Fantasy ginge es doch stets um dieselben Dinge und Themen. Ich fragte ihn daraufhin, welches Genre er denn bevorzuge, und er sagte mir, dass er am liebsten Krimis lese – worauf ich fragte, ob es nicht dort so sei, dass jemand ins Jenseits befördert würde und ein mehr oder minder gewitzter Kriminaler dann herauszufinden versuche, wer der Mörder gewesen sei.
Klar ist: Jedes Genre hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und Regeln, nach denen gespielt wird. Rainer Delfs, der langjährige Cheflektor der Abteilung Spannungsromane bei Bastei Lübbe, pflegte stets zu sagen, dass Menschen, die ein Fußballspiel besuchen, zweiundzwanzig Spieler und einen Ball sehen wollen. Nicht mehr und nicht weniger. Was lernen wir daraus? Man muss das Rad nicht stets neu erfinden, um einen wirklich guten und spannenden Fantasy-Roman zu schreiben – die Kunst liegt darin, die bekannten Zutaten auf eigene Weise und mit neuen Elementen zu verknüpfen und dadurch bislang unbekannte Welten entstehen zu lassen, die den Leser in ihren Bann ziehen.
Gerade die Tatsache, dass die Fantasy sich nicht an realhistorische Ereignisse zu halten braucht und ihren eigenen Kosmos erschaffen kann, öffnet sie für alle möglichen Einflüsse, ob sie nun aus verwandten Genres wie Science Fiction, Horror oder Mystery kommen oder aus ganz anderen. Den Kombinationsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt, gerade die auf den ersten Blick abwegigsten Mischungen erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Wer hätte z.B. geglaubt, dass eine Mischung aus eher konventioneller Fantasy und Internatsabenteuer à la Enid Blyton zur erfolgreichsten Romanserie aller Zeiten avancieren könnte? Oder wer hätte vor TWILIGHT etwas auf einen Mix aus Teenager-Romanze und Vampir-Horror gegeben?
Die Idee, verschiedene Einflüsse zu mischen, ist freilich nicht neu. Schon in den frühen Tagen der Fantasy, als Pioniere wie E.R. Burroughs das Genre aus der Taufe hoben, versetzten sie ihre Geschichten mit Elementen nicht nur von Wildwest- und Abenteuergeschichten, sondern auch des im späten 19.Jahrhundert so beliebten Reiseromans – etwa, wenn eine Dschungelexpedition im dunkelsten Afrika auf Tarzan den Affenmenschen stößt oder es den Bürgerkriegsveteranen John Carter auf den fernen Mars verschlägt, wo er auf sechsbeinigen Tieren reiten und gegen weiße Affen kämpfen muss.
Gedruckt wurden diese Geschichten seinerzeit auf billigstem Papier, das aus einer breiigen Masse mit hohem Holzgehalt gewonnen wurde. Diese Masse nannte man in den USA »Pulp«, und sie war es auch, die dieser Art von Literatur ihren Namen gab. Die Pulps – in unseren Breiten gerne auch kaum charmanter Schund- oder Groschenheft genannt – erfreuten sich in den ersten vier Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, vor allem aber in den Jahren der Weltwirtschaftskrise größter Beliebtheit. Obwohl die thematische Bandbreite weitgefächert war und es neben Crime- und Wildwestgeschichten auch Detektivstorys, Piraten- und Dschungelabenteuer, Spionagegeschichten, Sporterzählungen und noch vieles andere gab, war es vor allem das phantastische Genre, das durch die Pulp-Magazine zu Ruhm gelangte und ihnen entsprechend viel zu verdanken hat.
Obwohl viele Pulphelden von einst längst vergessen sind, bevölkern einige von ihnen bis heute die Medienlandschaft, an vorderster Stelle natürlich Robert E. Howards CONAN, der zum Urgestein einer weiteren Spielart des Genres wurde, nämlich der Heroic Fantasy. Darin kämpfen sich schwertschwingende Barbaren durch archaische Welten und bekommen es mit wüsten Monstren, bösen Zauberern und betörend schönen Frauen zu tun, die ihnen reihenweise zu Füßen liegen – nach der politischen Korrektheit solcher Geschichten fragen wir an dieser Stelle nicht. Die enorme Popularität seines Helden, der erst unlängst wieder zu Leinwandehren gelangte, diesmal sogar in 3-D, hat Robert E. Howard nicht mehr miterlebt – die wirklich große Zeit seines Barbaren begann erst, als der New Yorker Verlag Lancer die Geschichten in den 60er-Jahren in Buchform auflegte und ein damals noch weitgehend unbekannter Künstler namens Frank Frazetta die Titelbilder beisteuerte. Bis heute ist der Stil, den Frazettas Cover prägten, für viele Fans untrennbar mit CONAN und der heroischen Fantasy verbunden, und man übertreibt sicher nicht, wenn man Lancer das Verdienst zukommen lässt, den modernen Fantasy-Roman aus der Taufe gehoben zu haben. Die Bilder des im Jahr 2010 verstorbenen Frazetta zeigten genau das, wovon Howards Romane handelten – kraftstrotzende Helden, schöne Frauen und miese Monster –, und sie entführten den Leser auch visuell in eine Welt, die so nie existiert hat und dennoch auf einmal greifbar schien. Fortan war die Gestaltung des Covers nicht mehr nur Nebensache, sondern wichtiger Bestandteil eines jeden Fantasy-Romans.
Weitere Pioniere, die dem Genre in seiner Anfangszeit zur Blüte verhalfen, sind Eric R. Eddison, dessen 1922 erschienenes Werk DER WURM OUROBOROS sogar dem großen Meister Tolkien als Vorbild gedient haben soll; Fritz Leiber mit dem Geschichtenkreis FAFHRD UND DER GRAUE MAUSLING, der die beiden ersten Antihelden des Genres präsentierte (Balbok und Rammar verneigen sich), und natürlich C.S. Lewis, der langjährige Weggefährte Tolkiens, dessen CHRONIKEN VON NARNIA ebenfalls erfolgreich verfilmt wurden und werden.
Die Herkunft der Fantasy aus den Niederungen der Unterhaltungsliteratur dürfte allerdings der Grund dafür sein, dass ihr lange Zeit jene Anerkennung verweigert wurde, die ihr aufgrund ihres kulturgeschichtlichen Ursprungs eigentlich zukommt. Offiziell respektiert wurde das Genre erst mit Tolkien, wobei sich die Zeitgenossen zunächst schwer damit taten, DER HERR DER RINGE einzuordnen. War Tolkiens DER HOBBIT noch an ein jüngeres Publikum gerichtet gewesen und konnte deshalb problemlos der Jugendliteratur zugeschlagen werden, war die Trilogie um den Ringkrieg in Komplexität und Erzählstil eindeutig an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Die 68er waren die Ersten, die das Buch mehrheitlich für sich entdeckten, vielleicht, weil sie sich wie Tolkiens Hobbits im Kampf gegen eine bedrohliche Großmacht wähnten und sich mit den beherzten Bewohnern des Auenlandes solidarisch erklärten. DER HERR DER RINGE avancierte zum Kultroman – dass er in englischsprachigen Ländern ein ganzes Genre begründet hatte, wurde hierzulande nur sehr eingeschränkt wahrgenommen. Zwar publizierten deutsche Verlage wie Heyne oder Pabel ab den frühen 70er-Jahren Fantasy in Deutschland, jedoch dauerte es noch eine ganze Weile, bis das Genre endgültig eine eigene Szene bekommen und sich aus seinem Nischendasein lösen sollte.
Der Fantasy-Boom der frühen 80er-Jahre, der übrigens auch damals schon durch eine Reihe von Kinofilmen angeheizt wurde, darunter KAMPF DER TITANEN, EXCALIBUR und DER DRACHENTÖTER, vor allem aber durch Dino de Laurentiis’ CONAN DER BARBAR, sorgte immerhin dafür, dass die damals führenden Taschenbuchverlage Heyne, Goldmann und Bastei eigene Fantasy-Labels einführten, die über einen langen Zeitraum bestehen blieben – bis zur Fantasy-Begeisterung heutiger Tage war es aber freilich noch ein weiter Weg. Vor allem als deutscher Autor hatte man es schwer, da das Genre fast ausschließlich durch anglo-amerikanische Autoren geprägt war. Dies änderte sich erst spät. Mit dazu beigetragen hat, neben dem eingangs erwähnten Fantasy-Boom der Jahrtausendwende, meiner Ansicht nach auch die deutsche Wiedervereinigung, die den potenziellen Leserkreis um knapp 20 Millionen Menschen erweiterte, deren popkulturelles Verständnis längst nicht in so erheblichem Maße durch englische bzw. amerikanische Vorbilder geprägt war wie im Westen Deutschlands. Innerhalb eines Jahrzehnts erwuchs dem deutschsprachigen Kulturraum auf diese Weise ein Selbstbewusstsein, wie es noch in den 80ern kaum denkbar gewesen war und das nach eigener popkultureller Identität, nach eigenen Inhalten, eigener Musik und eigenen Filmen verlangte – und auch nach eigenen Büchern, wofür man als deutschsprachiger Autor nur dankbar sein kann.
Noch als ich Mitte der 90er-Jahre mit dem Science Fiction- und Fantasy-Lektorat (die SF hatte damals noch einen ungleich größeren Stellenwert als heute) eines großen deutschen Verlags telefonierte, riet man mir einfühlsam, ich solle mein Ansinnen lieber vergessen, da in Deutschland nur ein einziger Autor mit dem Schreiben von Fantasy Geld verdienen könne. Gemeint war natürlich Wolfgang Hohlbein, der es schon in den 80er-Jahren geschafft hatte, sich allen Widerständen zum Trotz eine Stammleserschaft zu erobern. Von seiner Ausnahme abgesehen, wurde deutschsprachigen Autoren nur selten die Chance eingeräumt, in Sachen Phantastik tätig zu werden, geschweige denn von dieser Arbeit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Rund fünfzehn Jahre nach diesem Telefonat stellt sich die Sache glücklicherweise anders dar. Ein neues Publikum verlangt nach neuen Stoffen, und eine neue Generation deutschsprachiger Autoren hat gezeigt, dass »einheimische« Fantasy sehr wohl erfolgreich sein kann. Man ist sogar fleißig dabei, diese ins europäische Ausland zu exportieren, wo man auf »Fantasy made in Germany« aufmerksam geworden ist und Autoren wie Bernhard Hennen oder Christoph Hardebusch gerne ins Programm nimmt. Auch mir wurde mit DIE ZAUBERER und den ORKS die Ehre zuteil, in fremde Sprachen übersetzt zu werden, und es macht immer wieder Spaß, in Italien, den Niederlanden oder Tschechien zu weilen und dort die eigenen Bücher mit wundersamen Titeln und in andere Sprachen übersetzt zu entdecken. Herausragenden Kollegen wie Kai Meyer oder Markus Heitz ist es darüber hinaus sogar gelungen, ihre Werke nach England bzw. den USA zu verkaufen, was angesichts des enormen Pools an englischsprachigen Werken, der den dortigen Verlagen zur Verfügung steht und nicht erst kostenaufwendig übersetzt zu werden braucht, als ganz besonderer Erfolg für die deutschsprachige Fantasy zu werten ist.
2
Der Stoff, aus dem die Helden sind
Helden fallen nicht von den Bäumen – sie werden gemacht. Bei Autoren ist es übrigens genauso. Und davon handelt dieses Kapitel.
Die Entstehung des Helden – im amerikanischen Fachjargon gerne auch Origin genannt – nimmt in der Fantasy breiten Raum ein, und das aus langer Tradition.
Schon im Nibelungenlied erfahren wir, wie Siegfried beim Zwerg Mime in die Lehre geht, wie er den Drachen Fafnir erschlägt, in dessen Blut badet und dadurch unverwundbar wird; wir erfahren, wie der Junge Artus das Schwert aus dem Stein zieht und dadurch zum König von Britannien wird; und wir werden Zeugen, wie ein unscheinbarer Hobbit namens Bilbo Beutlin seine Heimat verlässt, um zusammen mit einem Zauberer und einer Schar Zwerge ein Abenteuer zu erleben, das nicht nur ihn, sondern auch seine Welt für immer verändern wird. Während sich andere Genres nur sehr bedingt dafür interessieren, wie der Held zu dem wurde, was er ist, stellt diese »Heldengenese« in der Fantasy einen wichtigen Bestandteil der Handlung dar. Viele Fantasy-Romane handeln gar ausschließlich davon, denn die Queste, die abenteuerliche Reise mit all ihren Herausforderungen und Gefahren, ist letztlich nichts anderes als die Entstehungsgeschichte eines Helden.
Wenn der recht nichtsnutzige Granock am Anfang von DIE ZAUBERER in den Straßen Andarils gefunden und vom Zauberer Farawyn in die Festung von Shakara mitgenommen und dort zum Magier ausgebildet wird, so ist dies der Beginn einer Entwicklung, die erst am Ende der Trilogie abgeschlossen sein wird (und in diesem besonderen Fall noch nicht einmal dann) und in deren Verlauf die Figur mehr und mehr zum Helden reift. Jener Frodo, der am Ende von DER HERR DER RINGE das Schiff zu den Grauen Anfurten besteigt, ist nicht mehr jener naive Jüngling, den Gandalf einst nach Bree schickte, und jener Artus, der das Schiff nach Avalon besteigt (kommt mir das jetzt irgendwie bekannt vor?), ist ein anderer als der, der einst das Schwert Excalibur aus dem Stein zog. Das Abenteuer des Helden ist gleichzeitig auch seine Entwicklung, der Prozess der Reifung, der zu Beginn der Geschichte nicht absehbar ist – insofern gleicht seine Reise in vielen Punkten der des Autors. Und wie die klassische Heldenfigur bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um gegen alle Widerstände zu bestehen und am Ende siegreich zu sein, sollten auch Fantasy-Autoren eine Reihe von Anforderungen erfüllen.
Talent gehört fraglos dazu, so wie das Verfügen über eine magische Gabe Bedingung für die Aufnahme in den Zauberorden von Shakara ist; aber eben auch eine ganze Reihe von Eigenschaften, die durchaus erlernbar sind, sowie eine gute Portion Beharrlichkeit und Fleiß. Wer sich auf das Abenteuer einlässt, einen eigenen Roman zu verfassen, steht am Beginn einer langen Reise, die manche Unwägbarkeit bereithält; ähnlich wie unsere Helden werden wir unterwegs auf Verbündete und Gegner treffen, und auch uns steht dabei ein Arsenal an Waffen zur Verfügung, mit denen wir uns unserer Haut erwehren können – und einige davon sind sogar (fast) magischer Natur.
Die Frage, warum jemand gerne schreiben möchte, erübrigt sich – ebenso gut könnte man Frodo fragen, warum er den Meisterring zum Schicksalsberg bringen musste. Wie der Held dem Zwang zum richtigen Handeln unterliegt, so unterliegt der Autor dem Zwang zum Geschichtenerzählen. Was genau es ist, das einen Autor vom »Normalo« unterscheidet, vermag ich nicht zu sagen. Warum können neunundneunzig von hundert Menschen ein Buch lesen und sich mit der Rolle des bloßen Rezipienten zufriedengeben, während der Hundertste fortwährend darüber nachdenkt, wie er diese Geschichte selbst erzählt hätte: Mit anderem Ausgang? Anderen Figuren? Einem anderen Gegner? Aber genau das ist es, was den Autor ausmacht und ihn vom Leser zum Schreiber werden lässt, vom Empfänger zum Sender – und damit zum Helden seiner ganz eigenen Geschichte.
Die Macht der Erinnerung
Auch der Fantasy-Protagonist verfügt häufig über Eigenschaften, die ihn aus der Masse hervorheben und ihn nicht selten zum Einzelgänger werden lassen. Oft genug wird er gar verspottet und ausgestoßen, ehe er seiner wahren Natur folgen und seine Fähigkeiten zur Entfaltung bringen kann – all jene, die ihrer schriftstellerischen Ambitionen wegen schon einmal mitleidig belächelt wurden, befinden sich also in guter Gesellschaft. Ganz ehrlich, auch ich habe früher eine ganze Menge argwöhnischer und an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifelnde Blicke geerntet, wenn ich erklärte, Bücher verfassen und mit dem Erzählen von Geschichten meinen Lebensunterhalt bestreiten zu wollen – für viele Zeitgenossen ist das halt schlechterdings nicht vorstellbar, und sie schließen von sich auf andere. Es passiert mir bis heute, dass Menschen, die ich von früher kenne und lange nicht gesehen habe, mir freimütig gestehen, dass sie mich damals – im Klartext gesprochen – für einen Spinner hielten und nicht gedacht hätten, dass ich meine Ziele verwirklichen würde. Es erfordert also auch ein wenig Mut, dem kreativen Impuls zu folgen und sich dazu zu bekennen, von Natur aus vielleicht mit ein wenig mehr Phantasie ausgestattet worden zu sein als andere, zumal dieses »Mehr« an Vorstellungsgabe nicht immer ein Zugewinn ist, sondern auch zur Bürde werden kann. Aber wer den kreativen Funken in sich verspürt, der kann gar nicht anders, als diesem Ruf zu folgen und wie Granock vor den Toren Shakaras um Einlass zu bitten.
Dabei hat jeder Held bzw. Autor seine ganz eigene Entstehungsgeschichte, die natürlich eng mit dem in Verbindung steht, was er gesehen, gehört, erlebt und natürlich gelesen hat. Unsere fiktiven Figuren statten wir mit Eigenschaften aus, die wir uns entweder ausdenken oder von real existierenden Personen entleihen; bei uns selbst ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Gemäß der altbekannten Regel, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile, sind wir alle das Ergebnis von dem, was uns in unserem Leben widerfahren ist plus dem, was wir selbst daraus gemacht haben – die Lektionen, die wir gelernt, die Schlüsse, die wir gezogen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ebenso verhält es sich mit unserer Kreativität: Auch sie ist das Ergebnis all dessen, was wir unserem hungrigen Geist zugeführt haben: Bücher, Bilder, Comics, Musik, Filme, Theaterbesuche und vieles mehr.
Eine besondere Rolle kommt dabei übrigens dem zu, was wir im Alter von ca. acht bis zwölf Jahren konsumiert haben. Eine alte Scherzfrage lautet deshalb auch: What ist the golden age of science fiction? Antwort: Twelve.
Da steckt viel Wahrheit drin. Wenn sich viele Fans der originalen STAR WARS-Trilogie für die Prequels nicht so erwärmen konnten, dann wohl auch deswegen, weil sie inzwischen zu alt geworden waren, um den Sense of Wonder noch im selben Maße zu spüren wie einst im Mai ’77. Fans der jüngeren Generation hingegen geben ohne Zögern die neue Trilogie als ihren Favoriten an. Nie mehr wieder sind wir so empfänglich für kreative Impulse wie in der frühen Jugend, manche Dinge, denen wir in diesem Lebensabschnitt begegnen, prägen uns für unser ganzes Leben, nicht nur als menschliche Individuen, sondern, und darum soll es uns in diesem Buch vor allem gehen, als Künstler.
Jeder Schreibwillige hat ein bestimmtes Quantum an Erinnerungen in seinem kreativen Gepäck: an Figuren, die ihn beeindruckt, an Motiven, die ihn geprägt, an Geschichten, die ihn verzaubert haben. Dies ist die Grundlage seiner individuellen Schaffenskraft, jenes Material, aus dem er Ansätze für eigene Geschichten gewinnen kann – zuzüglich dem, was seine Phantasie dann hinzufügt. Je reicher dieser Fundus ist, desto tiefer kann man aus ihm schöpfen, und desto vielfältiger sind die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben – wobei es irrig wäre anzunehmen, dass nur phantastische Literatur hier entsprechende Vorlagen liefert. Auch andere belletristische Genres bieten großartige Inspiration, und es gibt nicht wenige Fantasy-Autoren, deren Lieblingsschriftsteller nicht der Phantastik zugehörig sind. Meine Vorliebe z.B. gehört Max Frisch, dem großen Schweizer Literaten – zum einen vielleicht, weil seine süddeutsch geprägte Sprache mir nahesteht, zum anderen aber auch, weil Texten wie WILHELM TELL FÜR DIE SCHULE oder DER MENSCH ERSCHEINT IM HOLOZÄN eine Tiefe und Doppelbödigkeit innewohnt, die mir ein echtes Vorbild ist. Bei einem historischen Roman, den ich gegenwärtig plane, inspirierte mich hingegen ein berühmter Westernklassiker, dessen Personenkonstellation von genreübergreifender und zeitloser Bedeutung ist; und wer meine ORKS gelesen hat, der weiß, dass die ungleichen Ork-Brüder Balbok und Rammar eine Verneigung vor dem großen Komiker-Duo Stan Laurel und Oliver Hardy sind. So unterschiedlich all diese Einflüsse auch sein mögen – zusammen mit vielen anderen gehören sie zu meinem ganz persönlichen kreativen Hintergrund, so wie ihn auch jeder andere Autor hat. Denn ohne diesen Hintergrund, ohne die Macht der Erinnerung, wäre das Schaffen eines neuen Werks nicht möglich.
Was können wir daraus also lernen?
Es ist im Grunde ganz einfach: Lebe bewusst, halte die Augen offen und sei stets hungrig auf Neues! Wer den ganzen Tag in abgedunkelten Räumen sitzt und Filme sieht oder Spiele daddelt, kriegt nichts mit von all den Dingen, die für einen Schriftsteller zum notwendigen Rüstzeug gehören. Inspiration, auch für die Fantasy, ist buchstäblich überall zu finden, je mehr unterschiedliche Quellen sie nähren, desto besser. Entdeckt ganz bewusst eure Vorlieben und Abneigungen und formt daraus euren ganz eigenen, persönlichen Hintergrund, vor dem ihr arbeiten und neue Geschichten entwickeln könnt.
Sprühende Funken
All das, was uns von außen zugeführt wurde, was wir wahrgenommen und auf unsere eigene Weise verarbeitet haben, kann aber freilich nur das »Brennmaterial« des schriftstellerischen Feuerwerks sein, das wir abzubrennen gedenken, wenn wir uns an die Entwicklung eines neuen Romans machen – entzünden muss es der berühmte »kreative Funke«, dessen Entstehung nicht ohne Weiteres zu erklären ist.
Sicher gibt es Mittel und Wege, das Überspringen des Funkens zu fördern und auch ein wenig zu beschleunigen, dazu an späterer Stelle mehr; aber die Entstehung dieses allerersten Impulses von Schaffenskraft, der am Beginn eines jeden (nicht nur) schriftstellerischen Werkes steht, ist eine wahrhaft mysteriöse Angelegenheit, für die es eigentlich nur ein adäquates Wort gibt. Ihr wisst schon, ich wiederhole mich, aber es fühlt sich wirklich an wie – Magie.
Man kann es kaum beschreiben: Man hat eine Idee. Und dann noch eine. Und wieder eine. Wie Teile eines Puzzles liegen sie da, und man überlegt, wie sie zusammenpassen könnten – und dabei kommt nun jener ganz persönliche Erfahrungsschatz ins Spiel, denn die Art, wie wir eine Handlung entwickeln und ihre einzelnen Elemente miteinander kombinieren, hat natürlich viel mit unseren ganz persönlichen Vorlieben zu tun. Dieser Prozess kann eine ganze Weile dauern und mitunter sehr viel Energie in Anspruch nehmen. Bisweilen überlegt man Tag und Nacht, ein anderes Mal lässt man die Sache ruhen und kehrt erst zurück, wenn sie gereift ist. Nach und nach kommen dann weitere Ideen hinzu und fügen sich dort ein, wo zuvor noch Lücken klafften – und ganz plötzlich ergeben die Puzzleteile ein sinnvolles Muster, ist im Wirrwarr loser Ideen eine Struktur zu erkennen. Und schließlich ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild.
Für mich ist es der faszinierendste Prozess meiner Arbeit, wenn aus einer abstrakten Idee eine konkrete Geschichte wird, und ich vermag nicht wirklich zu erklären, wie es letztlich dazu kommt – vielleicht ist dies ja wirklich jene Magie von der ich sprach und die jeden kreativ arbeitenden Menschen, ganz gleich, ob er nun Bücher schreibt oder Bilder malt, Musik komponiert oder Formen gestaltet, und völlig unabhängig davon, ob er dies aus reiner Freude tut oder um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ein klein wenig zum Zauberer macht. Magische Begabung, reghas genannt, ist es, was in meinen ZAUBERER-Romanen die Weisen von Shakara von gewöhnlichen Elfen (und später auch Menschen) unterscheidet. Und so unterschiedlich die Gaben sind, mit denen die Helden Granock, Aldur und Alannah bedacht wurden, so unterschiedlich ist auch das, was sie daraus machen.
Auch in dieser Hinsicht hat der Fantasy-Autor etwas mit dem Helden seiner Geschichte gemein, denn auch das, was der kreative Funke hervorbringt, ist von Autor zu Autor ja ganz unterschiedlich. Mir als Verfasser dieses Buches müsste das nun eigentlich die Rolle eines Merlin oder gar Gandalf zuschieben, oder, um beim Beispiel von DIE ZAUBERER zu bleiben, des weisen Farawyn, aber dafür bin ich weder alt noch weise genug, und einen Rauschebart habe ich auch nicht. Dennoch möchte ich an dieser Stelle ebenso warnend den Zeigefinger erheben, wie es die vorgenannten Herren wohl täten – denn wie so ziemlich jede Gabe hat auch die Kreativität ihre Schattenseiten. Ist der Funke nämlich erst einmal übergesprungen, nehmen die Dinge fast unaufhaltsam ihren Lauf. Ein Autor, der von seinem Stoff Feuer gefangen hat (ist es nicht seltsam, dass es so viele »feurige« Metaphern zum Thema gibt?) kann den Brand so schnell nicht wieder löschen, gemeinhin erst dadurch, dass er die entsprechende Geschichte zu Ende erzählt und den Flammen so nach und nach ihre Nahrung entzieht. Was harmlos klingt, kann im Alltagstest ganz schön anstrengend sein, vor allem auch dann, wenn man noch nicht den Luxus für sich in Anspruch nehmen kann, vom Schreiben allein zu leben.
Ein Schriftsteller in einer »heißen« Phase seines Werkes ist oft kein ganz umgänglicher Mensch, und mitunter wird dem familiären Umfeld einiges an Toleranz und Nachsicht abverlangt. Dies zu wissen und wahrzunehmen gehört meines Erachtens ebenfalls zum Rüstzeug eines Autors, denn es befähigt einen dazu, nach getaner Arbeit wieder auf den Boden der Realität zurückzukehren und seine soziale Umgebung, die während der Schreibphasen manchmal leidet, wieder zu pflegen – denn auch wenn wir uns nichts Schöneres vorstellen können, als gerade mit unseren Helden in der Geschichte weiterzureisen, in der Realität möchte schließlich keiner von uns gerne als einsamer, an die Schreibmaschine geketteter Eremit enden.
Ende der Leseprobe



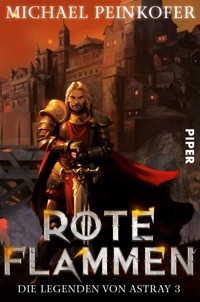
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)