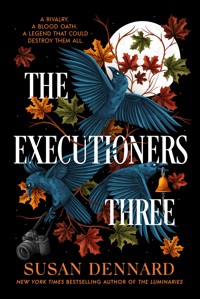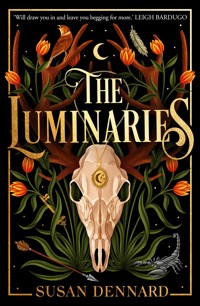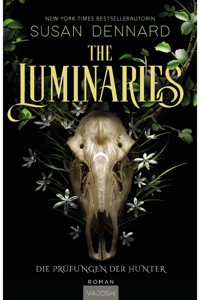9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Magislande
- Sprache: Deutsch
Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie.
Die Magislande stehen vor dem Krieg, während vier Menschen gegen ihre Bestimmung ankämpfen: Der ungestüme Kapitän Merik wird für tot erklärt, als sein Schiff zerstört wird. Doch Merik hat überlebt und wird sich mithilfe seiner Windmagie rächen. Gleichzeitig stellt der Blutmagis Aeduan die flüchtige Iseult, die ihm einen Pakt anbietet: Wenn es Aeduan gelingt, Iseults verschwundene Freundin Safi zu finden, erhält der Blutmagis das Vermögen zurück, das ihm gestohlen wurde. Doch Safi kämpft in einem Land voller Seeräuber um ihr Leben. Werden ihre Gefährten sie rechtzeitig finden – oder muss ihre Wahrmagie sie retten?
- »Zwei mutige Heldinnen, die sich selbst retten, statt gerettet zu werden – meisterhaft erzählt!« (Booklist)
- Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie.
- Freundschaft, Verrat, Magie und Romantik – epische Fantasy für die Fans von Kristin Cashore und Kendare Blake.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Die Magislande stehen vor dem Krieg, während vier Menschen gegen ihre Bestimmung ankämpfen: Der ungestüme Kapitän Merik wird für tot erklärt, als sein Schiff zerstört wird. Doch Merik hat überlebt und wird sich mit Hilfe seiner Windmagie rächen. Gleichzeitig stellt der Blutmagis Aeduan die flüchtige Iseult, die ihm einen Pakt anbietet: Wenn es Aeduan gelingt, Iseults verschwundene Freundin Safi zu finden, erhält der Blutmagis das Vermögen zurück, das ihm gestohlen wurde. Doch Safi kämpft in einem Land voller Seeräuber um ihr Leben. Werden ihre Gefährten sie rechtzeitig finden – oder muss ihre Wahrmagie sie retten?
Autor
Susan Dennard wuchs in einer Kleinstadt in Georgia, USA, auf. Als Meeresbiologin bereiste sie die Welt und hat schon sechs von sieben Kontinenten besucht, nur in Asien war sie bisher noch nicht. Heute lebt sie als hauptberufliche Autorin und Schreibtrainerin im Mittleren Westen der USA. Ihre Fantasyromane über die Magislande erreichten Spitzenplätze auf der New-York-Times-Bestsellerliste und begeistern Fans weltweit.
SUSAN DENNARD
DASZEICHENDES
STURMS
Roman
Deutsch von Vanessa Lamatsch
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Windwitch« bei Tor Teen, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © Susan Dennard 2017
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz, Inkcraft in Zusammenarbeit mit Oswin Neumann, oswinart.com
Karte: Maxime Plasse
BL · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21841-6V002
www.penhaligon.de
Für Jennifer und David
Was bisher geschah:
Safiya fon Hassrel, genannt Safi, – Spross einer cartorrischen Adelsfamilie und Wahrmagis im Untergrund – und ihre beste Freundin Iseult det Midenzi – eine Nomatsi – geraten nach einem missglückten Überfall in das Fadenkreuz des Blutmagis Aeduan – eines Carawen-Mönchs, der sich als Söldner verdingt hat. Dieser Mönch stellt Iseult vor ein Rätsel: Sie, die Strangmagis, kann in Aeduan keinerlei Stränge erkennen. Iseult muss im Anschluss aus der Stadt fliehen und gerät in ihrem Heimatdorf ins Visier eines Fluchmagis, ohne zu wissen, warum er sie vernichten will. Sie wird verletzt und kann sich nur mit Mühe aus dem Ort retten.
Safiyas Onkel Eron verbirgt Safi vor dem Blutmagis, zwingt sie aber trotz der Gefahr dazu, den großen Waffenstillstandskongress in Veñaza zu besuchen, wo sie zu ihrem unendlichen Schrecken zur Verlobten von Kaiser Henrick von Cartorra erklärt wird. Safi hat ihr Leben lang ihre Wahrmagie geheim gehalten, um eben nicht zum Spielball der Mächtigen zu werden, wie es unweigerlich der Fall sein wird, wenn bekannt wird, dass sie Lüge von Wahrheit unterscheiden kann. Safi flieht mit Hilfe ihres Onkels und sucht ihre Strangschwester Iseult. Die beiden finden sich wieder, doch der Blutmagis ist ihnen dicht auf den Fersen. Es kommt zum Kampf, in dem Iseult Aeduan fast tödlich verwundet, sein Leben jedoch verschont wird.
Dann werden sie von Prinz Merik von Nubrevna, der sich im Austausch gegen einen Handelsvertrag mit Onkel Eron bereiterklärt hat, Safi nach Lejna zu bringen, mit Hilfe seiner Windmagie und der Luftmagie seines Strangbruders Kullen auf sein Schiff geholt. Nur wenn Safi ihren Bestimmungsort unverletzt erreicht, wird der Handelsvertrag gültig, den das gebeutelte Königreich von Nubrevna so dringend braucht. Merik ist getrieben von dem Drang, Nahrung für Nubrevna zu beschaffen, unter anderem, um die gefährlichen Bestrebungen seiner Schwester Vivia im Keim zu ersticken, die vorhat, eine Piratenflotte auf die Meere zu schicken – ein klarer Verstoß gegen die Abmachungen des Zwanzigjährigen Waffenstillstands, der den gebeutelten Kontinent nach einem langen Krieg endlich Frieden verschafft hat.
Die schwer verletzte Iseult wird auf dem Schiff von Meriks Tante Evrane behandelt, die wie der Blutmagis zum Kloster der Carawen-Mönche gehört. In ihren Träumen erhält Iseult immer wieder beängstigende Besuche einer anderen Strangmagis, die sich selbst als Webermagis bezeichnet und wahrscheinlich die gefürchtete Puppenspielerin ist – eine Strangmagis, die fähig ist, die Stränge anderer Menschen zu kontrollieren oder zum Bersten zu bringen. Evrane kann Iseult nicht vollkommen heilen, dafür wäre ein Feuermagis-Heiler nötig. Auf See kommt es zu einer Begegnung mit einem marstokischen Kriegsschiff – anscheinend will auch Kaiserin Vaness unbedingt in Besitz der Wahrmagis kommen, deren Magie so einfach und doch so mächtig ist.
Meriks Schiff gelingt es, trotz einer Meuterei seiner Mannschaft zu entkommen, und Safi schafft es zusätzlich, einen Feuermagis-Heiler für Iseult aus der Mannschaft des marstokischen Schiffs zu entführen. Merik ist unendlich wütend auf Safi, die sich ihm von Anfang an immer wiedersetzt, doch gleichzeitig fühlen sich die beiden auch voneinander angezogen.
Die Freunde werden weiterhin verfolgt vom Blutmagis Aeduan, jetzt im Auftrag von Kaiser Henrick und begleitet von dessen Neffen Leopold. Aeduan kann nur Safi wittern, denn so wie Iseult seine Stränge nicht sehen kann, kann er das Blut des Nomatsi-Mädchens nicht wittern.
Merik rettet sein Schiff in eine versteckte Bucht, von wo aus er Safi und Iseult über Land nach Lejna bringen will. Die Carawen-Heilerin Evrane begleitet die beiden. Sie scheint zu vermuten, dass die beiden Mädchen die mystischen, wiedergeborenen Cahr Awen sind, und bringt sie zur versiegten Ursprungsquelle von Nubrevna. Als die Mädchen in die Quelle tauchen, geschieht etwas, auch wenn die beiden nicht ganz verstehen, was ihnen widerfährt.
Safi, die ihr Leben lang vor Verantwortung geflohen ist, erkennt, wie wichtig Merik der Handelsvertrag mit ihrem Onkel ist, und schwört, dass sie gegen alle Widerstände dafür sorgen wird, dass der Vertrag zum Tragen kommt. Dafür müssen sie jedoch nach Lejna, auch wenn der Blutmagis sie in Kaiser Hendricks Auftrag jagt und auf See die marstokische Flotte lauert.
Als Iseult und Safi Lejna erreichen, sind auch marstokische Schiffe bereits vor Ort. Zusätzlich beginnen die anwesenden marstokischen Magi plötzlich zu bersten. Diese Geborstenen fangen ebenfalls an, Safi zu jagen. Iseult vermutet dahinter einen Angriff der Puppenspielerin. Der Blutmagis Aeduan rettet Iseult das Leben, um seine Schuld bei ihr zu begleichen. Safi erreicht mit Mühe den im Handelsvertrag bezeichneten Pier, nur um direkt im Anschluss von der Kaiserin von Marstok persönlich gefangen zu werden. Safi erklärt sich bereit, Vaness zu dienen.
Meriks Strangbruder Kullen birst durch den Angriff der Puppenspielerin und fleht Merik an, ihn zu töten. Als Merik dies nicht möglich ist, verschwindet Kullen in einem riesigen Tornado. Aeduan rettet im letzten Moment seine Mentorin Evrane vor dem Tod, indem er sie zur wiedererweckten Ursprungsquelle von Nubrevna bringt. Dann macht er sich erneut auf die Suche nach Safi.
Noch mehr Informationen zu den Magislanden finden sich im Glossar am Ende des Buchs.
Vorher
Blut auf demBoden.
Es fließt zur Seite, sammelt sich in einem Fleck aus Mondlicht, bevor das sanfte Rollen des Schiffs es wieder in die andere Richtung schickt.
Der Prinz gibt das Schwert in seiner Hand frei und weicht mit rasendem Herzen zwei Schritte zurück. Er hat noch nie einem anderen Mann das Leben genommen und fragt sich, ob ihn diese Tat verändern wird.
Die Klinge bleibt aufrecht stecken, tief im Holz vergraben, obwohl der durchbohrte junge Mann versucht, sich zu erheben. Jedes Mal, wenn sich der Meuchelmörder bewegt, klafft die Wunde in seinem Bauch weiter auf. Seine Innereien glänzen im dämmrigen Licht wie Silberstücke.
»Wer bist du?«, krächzt der Prinz. Das erste Geräusch, das er erzeugt, seitdem er erwacht ist und einen Schatten in seiner Kabine entdeckt hat.
Noden sei gedankt für das Schwert seines Vaters, das über dem Bett hängt, immer in Reichweite für den Fall eines Angriffs.
»Sie … wartet auf dich«, antwortet der Möchtegernmörder. Erneut versucht er aufzustehen. Diesmal greift er mit seiner blutverschmierten linken Hand nach dem Heft des Schwerts.
Der kleine Finger fehlt, bemerkt der Prinz geistesabwesend, denn seine Aufmerksamkeit hängt an dem Wort Sie. Es gibt nur eine Sie, die so etwas tun würde. Nur eine Sie, die den Prinzen tot sehen will – was sie ihm unzählige Male selbst gesagt hat.
Der Prinz wendet sich ab, den Mund geöffnet, um Alarm zu schlagen. Doch dann hört er, wie der Mann hinter ihm lacht. Es ist ein abgehacktes Geräusch mit zu viel Tiefe. Zu viel Gewicht.
Er dreht sich wieder um. Die Hand des Mannes gleitet vom Schwert ab. Er fällt zurück auf den Boden, immer noch blutend, immer noch lachend. Mit der rechten Hand zieht er etwas aus einer Manteltasche. Ein Tontopf wird freigegeben und rollt über die Planken, in die Pfütze aus Blut und auf der anderen Seite darüber hinaus, sodass eine glitzernde Linie auf dem Kabinenboden entsteht.
Dann stößt der junge Meuchelmörder ein letztes keuchendes Lachen aus, bevor er flüstert: »Zünde.«
Der Prinz steht schwankend auf der kahlen Klippe und beobachtet sein brennendes Kriegsschiff.
Hitze schlägt ihm brüllend ins Gesicht, die schwarzen Flammen des Seefeuers auf dem Wasser sind fast unsichtbar. Nur ihr weißes alchemistisches Herz flackert hell.
Der Lärm verschlingt alles. Das gewalttätige Knacken und Knistern des geteerten Holzes, das mehr Stürme und Kämpfe gesehen hat als der Prinz Jahre.
Er sollte tot sein. Seine Haut ist schwarz verkohlt, sein Haar vollkommen verbrannt und seine Lunge versengt.
Er weiß nicht, wie er es geschafft hat, am Leben zu bleiben. Wie es ihm gelungen ist, das Seefeuer lang genug zurückzuhalten, bis jeder Mann und jede Frau das Schiff verlassen hatte. Vielleicht wird er nicht überleben. Er kann sich kaum auf den Beinen halten.
Seine Mannschaft beobachtet alles vom Strand aus. Manche schluchzen, andere schreien. Ein paar von ihnen suchen sogar die Küste ab, in den Wellen. Doch die meisten starren nur, so wie der Prinz auch.
Sie wissen nicht, dass ein Meuchelmörder an Bord war. Sie wissen nicht, dass sie auf die Nachricht von seinem Tod wartet.
Die Prinzessin von Nubrevna. Vivia Nihar.
Wenn sie erfährt, dass ihr Versuch gescheitert ist, wird sie erneut versuchen, den Prinzen zu töten. Dann werden seine Leute, wird seine Mannschaft erneut in Gefahr geraten. Das ist der Grund, aus dem er in dem Moment, als er zu Boden sinkt, beschließt, die Matrosen niemals wissen zu lassen, dass er noch am Leben ist. Sie müssen ihn für tot halten. Und auch Vivia muss ihn für tot halten.
Ein Leben im Austausch gegen viele.
Dunkelheit verengt sein Blickfeld. Seine Augen fallen zu, und er erinnert sich an etwas, das seine Tante einst gesagt hat: »Die Heiligsten fallen immer am tiefsten.«
So ist es, denkt er, und ich bin der perfekte Beweis dafür.
Dann sinkt Merik Nihar, Prinz von Nubrevna, in einen dunklen, traumlosen Schlaf.
Es hatte Vorteile, ein toter Mann zu sein.
Merik Nihar, Prinz von Nubrevna und ehemaliger Admiral der nubrevnanischen Marine, wünschte sich, er hätte schon vor langer Zeit erwogen, einfach zu sterben. Als Leiche konnte man einfach so viel mehr erledigen.
So wie im Moment. Er war aus gutem Grund zum Richtplatz im Herzen von Lovats gekommen, und dieser Grund versteckte sich in einer niedrigen Hütte – einem Anbau des Gefängnisses am Platz, in dem die Aufzeichnungen gelagert wurden. Besonders ein Gefangener interessierte Merik. Ein Gefangener, dem der linke kleine Finger fehlte und der jetzt jenseits des letzten Riffs residierte, tief in Nodens wässriger Hölle.
Merik duckte sich tiefer unter die Kapuze seines braunen Mantels. Sicher, sein Gesicht war dank der Verbrennungen kaum noch wiederzuerkennen, und sein Haar wuchs gerade erst nach, aber im Chaos des Gerichtsplatzes bot der Mantel trotzdem Sicherheit.
Oder dem Goshorn-Platz, wie er manchmal auch genannt wurde, wegen der riesigen Goshorn-Eiche in seiner Mitte.
Der fahle Stamm, dick wie ein Leuchtturm, war von hohen Höllenwassern gezeichnet, und seine Äste hatten schon seit Jahrzehnten kein Grün mehr gesehen. Dieser Baum, dachte Merik, während er den längsten Ast beäugte, sieht aus, als würde er sich mir bald im Tode anschließen.
Den gesamten Tag über ergoss sich Verkehr aus allen Richtungen über den Platz, angetrieben von Neugier. Wer würde der öffentlichen Schande ausgesetzt werden? Ohne Nahrung oder Gnade an die Steine gekettet werden? Wer würde den brennenden Biss eines Seils erleiden müssen – gefolgt vom kalten Kuss von Nodens Hexenfischen?
Verzweiflung trieb die Leute in Scharen heran. Familien kamen, um die nubrevnanischen Soldaten um Gnade für ihre Lieben anzuflehen, und die Obdachlosen kamen, um um Essen, Obdach oder irgendeine Art von Mitleid zu betteln.
Doch heutzutage hatte niemand Mitleid oder Gnade zu erübrigen. Nicht einmal Merik Nihar.
Er hatte bereits alles gegeben, was er konnte – hatte alles in seiner Macht Stehende für ein Handelsabkommen mit den Hasstrel-Ländereien in Cartorra getan. Fast hätte er auch ein Abkommen mit den Marstokern geschlossen, doch letztendlich hatte ihn der Tod zu früh ereilt.
Im Moment blockierte eine Familie Meriks Weg. Eine Frau und ihre zwei Jungen, die jedem ins Gesicht schrien, der vorbeikam.
»Hunger ist kein Verbrechen!«, riefen sie gemeinsam. »Befreit uns und nährt uns! Befreit uns und nährt uns!« Der ältere Junge, groß und so dürr wie ein Tangfaden, drehte sich zu Merik um.
»Hunger ist kein Verbrechen!« Er schob sich näher. »Befreit uns und nährt …«
Merik wich dem Jungen nach rechts aus, bevor er sich links an seinem Bruder vorbeischob und schließlich auch an der Mutter vorbeidrängte. Sie war die Lauteste der drei, mit sonnengebleichtem Haar und zornerfülltem Gesicht.
Merik kannte dieses Gefühl gut, denn es war Zorn, der ihn vorwärtstrieb, selbst während Schmerzen seinen Körper erfüllten und der grobe Stoff seiner Kleidung die Blasen auf seiner Brust aufrieb.
Andere in der Gegend nahmen den Ruf auf. Befreit uns und nährt uns! Hunger ist kein Verbrechen!
Merik stellte fest, dass sich seine Schritte dem Rhythmus des Sprechchors anpassten. So wenige Leute in den Magislanden waren magisch begabt, und noch weniger besaßen Magie, die tatsächlich von Nutzen war. Die meisten überlebten aus einer Laune der Natur – oder den Launen der Magi folgend – und durch ihre eigene Hartnäckigkeit.
Merik hatte den Galgen vor dem dicken Stamm der Eiche erreicht. Sechs Schlingen baumelten von einem Ast. Ihre schlaffen Seile schwankten in der Hitze des Vormittags. Gerade als Merik versuchte, die leere Tribüne zu umrunden, entdeckte er eine große Gestalt mit hellem Haar und vorgebeugter Haltung.
Kullen. Der Name bohrte sich wie ein Pfeil in Meriks Herz, nahm ihm die Luft zum Atmen, bevor sich sein Hirn einschalten konnte und sagte: Nein, nicht Kullen. Niemals Kullen.
Denn Kullen war vor zwei Wochen in Lejna geborsten. Er war vor zwei Wochen in Lejna gestorben. Er würde niemals zurückkommen.
Quasi ohne sein Zutun schoss Meriks Faust nach vorne. Sie traf die Plattform des Galgens. Schmerzen explodierten in seinen Knöcheln – und erdeten ihn mit ihrer Wahrhaftigkeit.
Wieder schlug er zu, diesmal härter, während er sich fragte, warum er so aufgewühlt war. Er hatte Kullens Geist die letzten Ehren erwiesen. Er hatte einen Schrein am Hügel gekauft – wofür er den letzten Goldknopf an seiner Admiralsjacke verwendet hatte – und zu den Hexenfischen gebetet, Kullen eine schnelle Reise hinter das letzte Riff zu gewähren.
Danach sollten die Schmerzen eigentlich enden. Sie sollten verklingen.
Irgendwann verschwand die große Gestalt, und die Pein von Meriks blutenden Knöcheln verdrängte die Schmerzen der Vergangenheit. Merik zwang sich weiterzugehen, die Ellbogen ausgeklappt, den Kopf gesenkt. Denn wenn Safiya fon Hasstrel diesen Pier in Lejna trotz Marstokern und Geborstenen in ihrem Weg erreicht hatte – wenn sie all das für eine Nation hatte tun können, die nicht mal ihre eigene war; für ein Handelsabkommen mit ihrer Familie –, dann konnte Merik sicherlich zu Ende bringen, wofür er hergekommen war.
Merik verfluchte seine Gedanken, weil sie in ihre Richtung gewandert waren. Seit der Explosion hatte er es vermieden, an Safi zu denken … seit seine alte Welt ein Ende gefunden und eine neue ihren Anfang genommen hatte. Nicht weil er nicht über Safi nachdenken wollte. Noden möge ihn retten … dieser letzte Moment, den er mit ihr geteilt hatte …
Nein, nein – Merik wollte sich damit nicht genauer befassen. Es lag kein Sinn darin, sich an den Geschmack von Safis Lippen auf seinen zu erinnern; nicht wenn seine Lippen jetzt zerstört waren. Nicht wenn sein gesamter Körper entstellt und schrecklich anzusehen war.
Außerdem hatten Tote angeblich keine Sorgen mehr.
Er schob sich weiter durch den Schmutz und die Körpergerüche. Durch eine widerspenstige Flut aus Leibern. Einen Sturm ohne Auge. Jede Berührung an Meriks Schultern oder Händen jagte Schmerzen durch seinen Körper.
Er erreichte die Eisen. Fünfzig Gefangene warteten dort, an die Felsen gekettet, von der Sonne verbrannt. Ein Zaun erhob sich um sie herum, der gleichgültig den Menschen standhielt, die sich von außen dagegendrängten.
Sie bettelten die Wachen an, ihren Söhnen Wasser zu geben. Ihren Ehefrauen Schatten. Ihren Vätern Freiheit. Doch die zwei Soldaten, die am Tor des Zauns standen – innerhalb des Pferchs, um nicht zertrampelt zu werden –, zeigten genauso wenig Interesse für die Hungernden von Lovats wie für die Gefangenen, die sie bewachen sollten.
Tatsächlich waren diese zwei Soldaten so gelangweilt, dass sie Taro spielten, um sich die Zeit zu vertreiben. Einer trug eine lilienblaue Binde um den Oberarm; ein Trauerband, um seinem toten Prinzen Respekt zu zollen. Der andere hatte sich das Band über das Knie gelegt.
Beim Anblick dieses Stofffetzens – der einfach unbenutzt dort lag – entzündete sich ein frischer, zorniger Wind in Meriks Brust. Er hatte so viel für Nubrevna gegeben, und mehr als das hatte es ihm nicht eingebracht: leere, falsche Trauer. Diese öffentlichen Zurschaustellungen – wie die Armbinden und die Bänder, die überall in der Stadt hingen – konnten nicht recht verbergen, wie wenig sich die Leute dafür interessierten, dass der Prinz tot war.
Dafür hatte Vivia gesorgt.
Noden sei Dank erreichte Merik kurz darauf die Hütte, denn er konnte seine Winde und sein Temperament nur für eine gewisse Zeit unter Kontrolle halten – und die Lunte war fast heruntergebrannt.
Die Menge spuckte ihn vor orangefarbenen Wänden aus, die mit Vogelkacke überzogen waren, und Merik hielt direkt auf eine Tür an der Südseite zu. Verschlossen, aber nicht undurchdringlich.
»Öffnet!«, brüllte Merik und klopfte gegen die Tür – ein Fehler. Sofort löste sich der frische Schorf an seinen Fingerknöcheln. »Ich weiß, dass ihr da drin seid!«
Keine Antwort. Zumindest keine, die Merik hören konnte. Doch das war in Ordnung. Er ließ die Hitze in seinem Körper aufsteigen. Sich verstärken. Herausbrechen wie eine Böe.
Dann klopfte er wieder, während er spürte, wie der Wind um ihn kreiste. »Schnell! Hier draußen herrscht der Wahnsinn!«
Der Riegel klapperte. Die Tür schwang nach innen … und Merik drängte sich in den Raum. Mit Fäusten, mit Gewalt, getrieben von seinem Wind.
Der Soldat auf der anderen Seite hatte keine Chance. Er fiel nach hinten. Die gesamte Hütte zitterte unter der Macht des Aufpralls. Bevor er sich wieder erheben konnte, hatte Merik die Tür hinter sich geschlossen. Er trat auf den Mann zu, seine Winde im Schlepptau. Es war so ein verdammt gutes Gefühl, die Papiere im Raum mit einem Zyklon zu zerreißen.
Es war eine Weile her, dass Merik seinen Winden erlaubt hatte, sich zu entfalten; seiner Magie gestattet hatte, sich weit zu strecken. Ein Feuer bildete sich in ihm, eine Wut, die kochend heiß röhrte. Die seinen Bauch gefüllt hatte, wie es Essen nicht gelungen war. Luft wirbelte um ihn herum, bewegte sich im Rhythmus seiner Atemzüge.
Der Soldat – im mittleren Alter, bleich – blieb auf dem Boden sitzen und hob die Hände, um sein Gesicht zu schützen. Offensichtlich hatte er beschlossen, dass Kapitulation die sicherste Variante war.
Zu dumm. Merik hätte sich über einen Kampf gefreut. Stattdessen zwang er sich, den Blick durch den Raum huschen zu lassen. Er setzte auch seine Winde ein und schickte sie aus. Ließ sich von den Vibrationen der Luft verraten, ob sich irgendwo vielleicht noch andere Körper versteckten. Andere Atemzüge wogten. Doch niemand verbarg sich in den dunklen Ecken, und die Tür zum Hauptgebäude des Gefängnisses blieb fest geschlossen.
Und so konzentrierte sich Merik letztendlich wieder auf den Soldaten. Seine Magie wurde nachgiebiger, ließ die Papiere zu Boden sinken. Erst dann schob er seine Kapuze zurück, verspannte sich gegen den Schmerz, der über seinen Kopf glitt.
Und Merik wartete, um herauszufinden, ob der Soldat ihn erkennen würde.
Nichts. Tatsächlich zuckte der Mann zusammen, kaum dass er die schützenden Hände gesenkt hatte. »Was bist du?«
»Wütend.« Merik trat einen Schritt vor. »Ich suche jemanden, der vor kurzer Zeit zum zweiten Mal aus den Eisen entlassen wurde.«
Der Mann warf einen unruhigen Blick durch den Raum. »Ich werde mehr Informationen brauchen, Sir. Sein Alter oder ein Verbrechen oder das Entlassungsdatum …«
»Das habe ich nicht.« Merik trat einen weiteren Schritt vor, und diesmal kämpfte sich der Soldat panisch auf die Beine, wich vor Merik zurück und griff nach den nächstgelegenen Papieren.
»Getroffen« – getötet – »habe ich diesen Gefangenen vor elf Tagen.« Merik hielt inne, dachte zurück an das dämmrige Licht des Mondes. »Er hatte braune Haut, langes schwarzes Haar und zwei tätowierte Streifen unter dem linken Auge.«
Zwei Streifen. Zwei Aufenthalte in den Eisen auf dem Richtplatz.
»Und …« Merik hob die linke Hand. Die Haut verheilte in Schattierungen von Rot und Braun … bis auf das frische Blut auf seinen Knöcheln. »Dem Gefangenen fehlte ein kleiner Finger.«
»Garren Leeri!«, rief der Soldat mit einem Nicken. »An ihn erinnere ich mich gut. Er gehörte zu den Neunen, damals, bevor wir hart gegen die Banden im Schlick vorgegangen sind. Als wir ihn allerdings zum zweiten Mal verhaftet haben, war es wegen eines Bagatelldiebstahls.«
»In der Tat. Und was genau ist mit Garren geschehen, nachdem er seine Zeit abgesessen hatte?«
»Er wurde verkauft, Sir.«
Meriks Nüstern blähten sich. Er hatte nicht gewusst, dass Gefangene verkauft werden konnten. Der Gedanke entfachte angewiderte Hitze in seiner Lunge. Merik kämpfte nicht dagegen an – er ließ seine Winde einfach ausströmen, bis die Papiere vor seinen Füßen flatterten.
Eines der Blätter wurde aufgewirbelt und traf das Schienbein des Soldaten. Sofort begann der Mann erneut zu zittern. »Es geschieht nicht oft. Sir. Dass Leute verkauft werden, meine ich. Nur wenn wir im Gefängnis keinen Platz haben – und wir verkaufen nur Leute, die wegen Bagatelldelikten verurteilt wurden. Sie arbeiten ihre Strafe stattdessen ab.«
»Und an wen« – Merik legte den Kopf schräg – »wurde dieser Mann namens Garrett verkauft?«
»An Pins Feste, Sir. Sie kaufen regelmäßig Gefangene für die Arbeit in der Klinik. Geben ihnen eine zweite Chance.«
»Ah.« Merik konnte sein Lächeln kaum unterdrücken. Pins Feste war eine Anlaufstelle für die Armen von Lovats. Sie war ein Projekt von Meriks Mutter gewesen, das nach dem Tod der Königin direkt an Vivia übergegangen war.
Wie einfach. So mühelos hatte Merik die Verbindung zwischen Garrett und Vivia gefunden. Ihm fehlten nur noch handfeste Beweise – etwas Greifbares, das er dem Hohen Rat übergeben konnte und was ohne Zweifel zeigte, dass seine Schwester eine Mörderin war. Dass sie nicht geeignet war zu herrschen.
Jetzt hatte er eine Spur. Eine gute.
Bevor Meriks Lächeln verblassen konnte, hallte das Geräusch von Metall auf Holz durch den Raum.
Als die Außentür aufschwang, drehte sich Merik um und fing den Blick eines überraschten jungen Wachmanns auf.
Sehr unglücklich.
Für den Wachmann.
Meriks Winde schossen nach vorne, packten den jungen Mann wie eine Puppe. Dann rissen sie ihn in den Raum, direkt auf Merik zu.
Der hob eine Faust.
Meriks aufgeplatzte Knöchel trafen das Kinn des Mannes mit voller Wucht. Ein Hurrikan gegen einen Berg. Der Wachmann wurde sofort bewusstlos. Als er schlaff in sich zusammensackte, warf Merik einen Blick zum ersten Soldaten.
Doch der alte Mann stand jetzt an der Tür zum Gefängnis, machte sich in verzweifelter Hast am Schloss zu schaffen und murmelte: »Ich bin zu alt für so was. Zu alt.«
Höllenwasser. Schuldgefühle flackerten in Merik auf. Er hatte bekommen, weswegen er gekommen war, und länger zu bleiben schrie nach Ärger. Also überließ er den Soldaten seiner Flucht und rannte in Richtung der offenen Tür und nach draußen.
Nur um auf halbem Weg zu stoppen, als eine kreischende Frau in den Raum stürmte. »Hunger ist kein Verbrechen! Befreit uns und nährt uns!«
Es war diese Frau. Ihre zwei Söhne trudelten hinter ihr her. Noden verdamme ihn, hatte er für einen Tag noch nicht genug Störungen ertragen?
Die Antwort lautete nein. Offenbar nicht.
Die Frau verstummte, als sie des bewusstlosen Wachmanns und Meriks unverhüllten Gesichts ansichtig wurde. Sie erstarrte förmlich. Er erkannte etwas in ihren blutunterlaufenen Augen, das an Hoffnung erinnerte.
»Ihr«, hauchte sie. Dann stolperte sie vorwärts, die Arme ausgestreckt. »Bitte, Furie, wir haben nichts Falsches getan.«
Sie packte Meriks Hände. »Bitte, Furie!«, wiederholte sie.
Innerlich zuckte Merik bei dem Titel zusammen. Sah er tatsächlich so grotesk aus?
»Bitte, Sir! Wir waren anständig und haben Eurem Schrein immer Respekt erwiesen! Wir verdienen Euren Zorn nicht – wir wollen nur unsere Familien ernähren!«
Merik riss sich von ihr los. Seine Haut platzte unter ihren Fingernägeln auf. Jeden Moment würden Soldaten aus dem Registerraum stürmen, und auch wenn Merik gegen diese Jungs und ihre Mutter hätte kämpfen können, hätte das doch nur Aufmerksamkeit erregt.
»Befreit uns und nährt uns, hast du gesagt?« Merik riss einen Schlüsselring vom Gürtel des bewusstlosen Wachmanns. »Nimm die hier.«
Die verfluchte Frau wich vor Meriks ausgestreckter Hand zurück.
Ihm lief die Zeit davon. Draußen erklang das vertraute Dröhnen einer Windtrommel. Schickt Soldaten, sagte der Trommelschlag, auf den Richtplatz.
Also warf Merik die Schlüssel dem nächsten Sohn an die Brust, der sie ungeschickt auffing. »Befreit die Gefangenen, wenn ihr wollt, aber beeilt euch. Denn jetzt wäre für uns alle der richtige Zeitpunkt zur Flucht.«
Dann drängte sich Merik durch die Menge, tief geduckt und schnell. Denn auch wenn der Frau und ihren Söhnen die Vernunft zur Flucht zu fehlen schien, galt das nicht für Merik Nihar.
Schließlich konnten selbst Tote ein Leben besitzen, das sie nicht verlieren wollten.
Das war nicht Azmir.
Safiya fon Hasstrel mochte in Erdkunde schlecht gewesen sein, aber selbst sie wusste, dass diese halbmondförmige Bucht nicht die Hauptstadt von Marstok war. Auch wenn sie sich Wieselpisse noch mal wünschte, sie wäre es.
Alles wäre interessanter gewesen, als auf dieselben türkisfarbenen Wellen zu starren, die sie jetzt schon seit einer Woche beobachtete und die in solchem Kontrast zu dem dunklen, dichten Dschungel dahinter standen. Denn hier, am östlichsten Rand der Umkämpften Lande – einer lang gestreckten Halbinsel von Niemandsland, die nicht ganz den Piratenfraktionen in Saldonica gehörte und auch nicht wirklich einem der Reiche –, gab es überhaupt nichts Interessantes zu sehen.
Papier raschelte hinter Safi, fast im Rhythmus der Meereswellen, und darüber erklang die unendlich ruhige Stimme der Kaiserin von Marstok. Den ganzen Tag arbeitete sie sich an dem niedrigen Tisch in der Mitte ihrer Kabine durch Sendschreiben und Botschaften, wobei sie nur innehielt, um Safi über irgendwelche komplizierten politischen Allianzen oder kürzliche Verschiebungen der südlichen Grenze ihres Reichs zu informieren.
Es war unerträglich langweilig. Die einfache Wahrheit lautete, zumindest Safis Meinung nach, dass man hübschen Menschen niemals erlauben sollte, Vorträge zu halten. Nichts erzeugte schneller Langweile als Schönheit.
»Hört Ihr mir zu, Domna?«
»Natürlich tue ich das, Eure Majestät!« Safi wirbelte herum, sodass sich ihr weißes Kleid blähte. Gleichzeitig klimperte sie unschuldig mit den Wimpern.
Vaness kaufte es ihr nicht ab. Ihr herzförmiges Gesicht wirkte hart. Safi vermutete allerdings, dass sie sich nicht nur einbildete zu sehen, wie sich der eiserne Gürtel der Kaiserin wand und bewegte wie zwei Schlangen.
Laut den Gelehrten war Vaness die jüngste und mächtigste Kaiserin in der gesamten Geschichte der Magislande. Den Legenden zufolge war sie außerdem die stärkste und grausamste Eisenmagis aller Zeiten, die bereits im Alter von gerade mal sieben Jahren einen gesamten Berg zum Einsturz gebracht hatte. Und, natürlich war sie, laut Safi, die schönste, eleganteste Frau, die die Welt jemals mit ihrer Gegenwart beehrt hatte.
Doch all das spielte keine Rolle, denn Götter in der Tiefe … Vaness war öde.
Keine Kartenspiele, keine Witze, keine aufregenden Geschichten über die Flammen von Feuermagi – einfach gar nichts, um das Warten erträglicher zu machen. Sie hatten vor einer Woche hier Anker geworfen. Zu Beginn, um sich vor einem cartorrischen Kutter zu verbergen. Dann vor einer cartorrischen Armada. Alle hatten sich auf eine Seeschlacht vorbereitet …
Die nie gekommen war. Und auch wenn Safi wusste, dass das gut war – Krieg war sinnlos, wie Habim immer gesagt hatte –, hatte Safi doch auch gelernt, dass den ganzen Tag warten ihre persönliche Form der Hölle darstellte.
Besonders, nachdem ihr gesamtes Leben vor zweieinhalb Wochen auf den Kopf gestellt worden war. Eine überraschende Verlobung mit dem Kaiser von Cartorra hatte sie in einen Zyklon aus Verschwörungen und Flucht gerissen. Sie hatte erfahren, dass ihr Onkel – den sie ihr ganzes Leben über verabscheut hatte – hinter einem riesigen, breit angelegten Plan steckte, den Magislanden Frieden zu bringen.
Dann, weil Safis Leben ja noch nicht kompliziert genug war, hatte sie entdeckt, dass sie und ihre Strangschwester Iseult vielleicht die mythischen Cahr Awen waren, deren Aufgabe darin bestand, die Magie in den Magislanden zu heilen.
Die Kaiserin räusperte sich und riss damit Safi wieder in die Gegenwart.
»Mein Abkommen mit den Baedyed-Piraten ist unglaublich wichtig für Marstok.« Vaness zog streng die Augenbrauen hoch. »Es hat Jahre gedauert, eine Einigung mit ihnen zu verhandeln, und Tausende Leben werden dadurch gerettet werden – Ihr hört mir nicht einmal jetzt zu, Domna!«
Das war nicht ganz falsch, und doch störte sich Safi am Tonfall der Kaiserin. Schließlich hatte sie ihr bestes Ich-bin-eine-perfekte-Schülerin-Gesicht aufgesetzt, und Vaness hätte das anerkennen müssen. Es war ja nicht so, als hätte sich Safi bei ihren Mentoren Mathew und Habim je die Mühe gemacht, eine solche Miene aufzusetzen. Nicht mal bei Iseult.
Safis Kehle wurde eng. Instinktiv griff sie nach dem Strangstein, der zwischen ihren Schlüsselbeinen ruhte. Alle paar Minuten zerrte sie den ungeschliffenen Rubin unter dem Stoff ihres Kleids heraus und starrte in seine flackernden Tiefen.
Er sollte aufleuchten, wenn Iseult in Gefahr war. Doch bis jetzt hatte er nicht einmal geblinkt. Kein einziges Mal. Zuerst hatte das Safi beruhigt – nur daran hatte sie sich klammern können. Das war ihre einzige Verbindung zu ihrer Strangschwester. Ihrer besseren Hälfte. Ihrer logischen Hälfte, die Safi aus Schwierigkeiten befreite. Diejenige, die niemals zugelassen hätte, dass Safi zustimmte, sich der Kaiserin anzuschließen.
Rückblickend konnte Safi erkennen, was für einen schlechten Handel sie damit eingegangen war, als sie ihre Wahrmagie angeboten hatte, damit die Kaiserin die Korruption an ihrem Hof eindämmen konnte. Safi hatte sich für ach so nobel und ach so aufopfernd gehalten, denn durch ihr Einverständnis, sich Vaness anzuschließen, half Safi der sterbenden Nation von Nubrevna, Handelsbeziehungen zu gewinnen.
Doch die Wahrheit lautete, dass sie gefangen war. Auf einem Schiff. In der Mitte des Nirgendwo. Mit nur der Kaiserin der Langeweile als Gesellschaft.
»Setzt Euch zu mir«, befahl Vaness und riss Safi damit aus den Betrachtungen über ihr selbstverschuldetes Leid. »Nachdem euch Baedyed-Politik offensichtlich nichts bedeutet, könnte Euch diese Botschaft vielleicht ansprechen.«
Safis Interesse war geweckt. Eine Botschaft. Damit war der heutige Nachmittag bereits fesselnder als der gestrige.
Sie ließ ihre Hände auf ihrem eisernen Gürtel ruhen, während sie die schwankende Kabine durchquerte, um sich auf der leeren Bank gegenüber der Kaiserin niederzulassen. Vaness grub sich durch einen Stapel verschieden großer Papiere, ihr Blick ein wenig finster.
Das erinnerte Safi an ein anderes Gesicht, das oft finster dreinblickte. An einen anderen Anführer der – wie die Kaiserin von Marstok – das Leben seiner Leute über sein eigenes stellte.
Merik.
Safi atmete tief durch. Ihre verräterischen Wangen begannen zu brennen. Sie hatten nur einen Kuss geteilt, also konnte dieses Erröten jetzt wirklich aufhören.
Wie als Antwort auf ihre Gedanken entdeckte Safi einen einzelnen Namen auf der Seite, die Vaness nun hervorzog: Merik, Prinz von Nubrevna. Ihr Pulsschlag beschleunigte sich. Vielleicht war es das – vielleicht würde sie endlich Nachrichten aus der Welt erhalten, von den Menschen, die sie zurückgelassen hatte.
Doch bevor sie etwas erfahren oder weitere Worte lesen konnte, wurde die Tür zur Kabine der Kaiserin aufgerissen. Ein Mann eilte in den Raum, in Marstok-Grün gekleidet wie ein Matrose. Er entdeckte Safi und Vaness, und zwei Augenblicke lang starrte er sie nur an.
Falsch. Das Wort glitt rau über ihre Wirbelsäule. Ihre Wahrmagie kribbelte. Eine Warnung, dass das, was sie sah, eine Lüge war. Dass falsches Spiel getrieben wurde, als er die Hand hob.
»Vorsicht!« Safi versuchte, die Kaiserin zur Seite zu stoßen; versuchte, sie beide zu Boden zu ziehen. Doch sie war zu langsam. Der Matrose hatte den Abzug seiner Pistole bereits gedrückt.
Die Waffe ging mit einem Knall los.
Doch der Schuss traf nie. Die Kugel stoppte mitten in der Luft, ein sich drehender Ball aus Eisen, nur Zentimeter vor dem Gesicht der Kaiserin.
Dann bohrte sich eine Klinge in den Rücken des Angreifers, und eine blutige Stahlspitze drang aus seinem Bauch. Es war ein summender Schlag, der die Wirbelsäule genauso zerstörte wie Organe und Haut.
Das Schwert wurde zurückgerissen. Die Leiche fiel zu Boden. Der Anführer von Vaness’ persönlicher Garde erschien, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, die Klinge blutverschmiert.
Die oberste Natter. »Meuchelmörder.« Er sprang das Wort ganz ruhig aus. »Ihr wisst, was Ihr zu tun habt, Eure Majestät.«
Ohne ein weiteres Wort verschwand er.
Endlich fiel die eiserne Kugel. Klappernd knallte sie auf die Planken und rollte über den Boden, das Geräusch verloren im plötzlichen Stimmengewirr von draußen.
»Komm«, sagte Vaness nur. Dann, als fürchte sie, dass Safi ihr nicht zuhörte, straffte sie den eisernen Gürtel um Safis Taille und riss sie mit ihrer Magie in Richtung Tür.
Safi blieb keine andere Wahl, als hinter der Kaiserin herzueilen, trotz ihres aufsteigenden Entsetzens. Trotz der Fragen, die in ihrem Kopf kreisten.
Sie erreichten den Meuchelmörder. Vaness verlangsamte ihre Schritte gerade lang genug, um einen Blick nach unten zu werfen. Sie schnaubte herablassend, raffte ihre schwarzen Röcke und trat über die Leiche. Ihre Füße hinterließen blutige Spuren auf der anderen Seite.
Safi dagegen achtete darauf, um die Leiche herumzugehen.
Außerdem sorgte sie dafür, dass sie dem toten Mann nicht in die Augen sah, die blau und leer an die geteerte Decke starrten.
Draußen regierte das Chaos, doch Vaness stellte sich dem ohne jegliches Gefühl. Nach einer kurzen Bewegung ihrer Hände schmolzen die eisernen Schellen an ihren Handgelenken, um vier dünne Wände um sie und Safi zu bilden. Ein Schild. Danach bog die Kaiserin nach links ab. Stimmen schrien auf Marstokisch, gedämpft und irgendwie blechern.
Aber trotzdem verständlich. Es wurde vermutet, dass sich noch ein zweiter Meuchelmörder an Bord befand. Die Nattern und die Mannschaft bemühten sich, ihn aufzuspüren.
»Schneller«, befahl Vaness, dann zerrte der Gürtel Safi noch heftiger vorwärts.
»Wo gehen wir hin?«, schrie Safi zurück. Innerhalb des Schilds konnte sie nichts sehen als den vollkommen klaren blauen Himmel über ihnen.
Bald schon bekam Safi ihre Antwort. Sie erreichten das Landungsboot des Kriegsschiffs, das achtern befestigt war, jederzeit bereit, in die Wellen abgelassen zu werden. Vaness verformte ihr vorderes Schild zu einer Reihe aus Stufen, die sie sofort nach oben stieg.
Dann befanden sie sich in dem schwingenden Boot. Eisen breitete sich an den Rändern aus – Wände, um ihre Sicherheit zu garantieren. Doch es gab kein Dach, keinen Schutz gegen die Stimmen, die jetzt brüllten: »Er ist unter Deck!«
Vaness suchte Safis Blick. »Festhalten«, warnte sie. Dann hob sie die Hände. Ketten klirrten, und das Beiboot fiel.
Sie knallten auf die Wellen. Safi wurde fast von ihrem Sitz geworfen, und Gischt traf sie – gefolgt von einer klebrigen salzigen Brise, als sie sich aufrichtete. Hier unten war es so ruhig, so leise. Ihre Knie zuckten – wie konnte hier unten solche Gleichmut herrschen, während über ihnen Gewalt tobte?
Die Ruhe war eine Lüge, denn schon einen Augenblick später blitzte ein gleißendes Licht über den Schilden auf, glitzernd von Glas und Macht. Das Boot wurde zur Seite geschleudert und kippte gefährlich.
Als Letztes folgte der Donner. Gewalttätig. Kochend heiß. Lebendig.
Das Schiff war explodiert.
Flammen brandeten gegen die Schilde, doch die Kaiserin hielt dem Ansturm stand. Die Schilde wurden papierdünn, um das gesamte Beiboot zu umschließen. Um Vaness und Safi vor der brennenden Hitze und dem Lärm des Höllenfeuers zu schützen.
Blut tropfte aus der Nase der Kaiserin, und ihre Muskeln zitterten. Ein Hinweis darauf, dass sie das Schild gegen den Wahnsinn nicht unbegrenzt halten konnte.
Also schnappte sich Safi die Ruder aus dem Rumpf des Boots. Sie dachte keinen Moment darüber nach, ob sie das Richtige tat – so wie sie keinen Moment darüber nachgedacht hätte, in einer Sturmflut zu schwimmen.
Als Vaness erkannte, was Safi vorhatte, öffnete sie zwei Löcher für die Ruder in den Seiten der Schilde. Rauch und Hitze drangen ein.
Safi ignorierte es, obwohl ihre Finger brannten und ihre Lunge sich mit salzigem Rauch füllte.
Einen Schlag nach dem anderen entfernten sich Vaness und sie vom Tod, bis das Beiboot schließlich mit einem Knirschen auf den grauen Kies des Strands fuhr. Bis die Kaiserin ihr Schild endlich senkte. Das Metall zog sich in die dekorativen Schellen um ihre Handgelenke zurück und erlaubte Safi den ersten Blick auf die schwarzen Flammen, die vor ihnen brannten.
Seefeuer.
Sein finsterer Durst konnte nie gestillt werden. Wind konnte die Flammen nicht ausblasen. Wasser ließ die harzigen Flammen nur höher schlagen.
Safi schlang ihre Arme um die ermüdete Kaiserin und zog sie beide in die sanften Wellen. Sie fühlte keine Erleichterung darüber, diesen Angriff überlebt zu haben. In ihr wallte keinerlei Befriedigung auf, weil sie es an die Küste geschafft hatten. Sie spürte nur eine anwachsende Leere in sich. Eine sich vertiefende Dunkelheit. Das war jetzt ihr Leben. Nicht Langweile und Vorträge, sondern Höllenflammen und Meuchelmörder. Massaker und endlose Flucht.
Und niemand außer Safi selbst konnte sie davor retten.
Ich könnte in diesem Moment fliehen, dachte sie, während sie die lange Küstenlinie beäugte – die Mangroven und die Palmen, die sich dahinter erhoben. Die Kaiserin würde es nicht einmal bemerkten. Wahrscheinlich wäre es ihr auch egal.
Wenn sich Safi Richtung Südwesten hielt, würde sie irgendwann die Piratenrepublik von Saldonica erreichen. Das einzige Stück Zivilisation – wenn man es denn so nennen konnte – in dieser Gegend, und die einzige Möglichkeit, ein Schiff zu finden. Doch sie war sich fast sicher, dass sie in diesem Sündenpfuhl nicht allein überleben konnte.
Ihre Finger fanden ihren Strangstein – denn ausgerechnet jetzt, während Safis Überleben auf Messers Schneide stand, hatte er angefangen zu leuchten.
Wäre Iseult bei ihr gewesen, wäre Safi ohne auch nur nachzudenken in den Dschungel gerannt. Mit Iseult an ihrer Seite konnte Safi tapfer sein. Stark und furchtlos. Doch Safi hatte keine Ahnung, wo ihre Strangschwester sich aufhielt, wusste nicht einmal, wann sie sie wiedersehen würde – oder ob sie Iseult jemals wiedersehen würde.
Also standen Safis Chancen für den Moment besser, wenn sie bei der Kaiserin von Marstok blieb.
Sobald das Kriegsschiff zu einem glühenden Skelett verbrannt war und die Hitze des Angriffs nachgelassen hatte, drehte sich Safi zu Vaness um. Die Kaiserin stand wie angewurzelt, so unbeweglich wie das Eisen, das sie kontrollierte.
Asche verunzierte ihre Haut. Zwei dunkle Linien aus getrocknetem Blut leuchteten unter ihrer Nase.
»Wir müssen uns verstecken«, krächzte Safi. Götter in der Tiefe, sie brauchten Wasser. Kühles, beruhigendes Süßwasser. »Das Feuer wird die cartorrische Armada zu uns führen.«
Langsam, unendlich langsam, löste die Kaiserin den Blick vom Horizont und richtete ihn auf Safi. »Es könnte«, knurrte sie, »Überlebende geben.«
Safis Lippen wurden dünn, doch sie widersprach nicht. Und vielleicht war es dieser mangelnde Widerspruch, der dafür sorgte, dass Vaness’ Schultern nach unten sanken.
»Wir gehen nach Saldonica«, sagte die Kaiserin von Marstok schließlich. Dann schritt sie über den kiesigen Stand auf die Dunkelheit des Dschungels zu, und Safi folgte ihr.
Ruhe, ermahnte sich Iseult det Midenzi zum tausendsten Mal seit Sonnenaufgang. Ruhe in deinen Fingerspitzen und deinen Zehen.
Nicht dass sie ihre Finger oder Zehen spüren könnte. Sie rannte jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit in diesem eiskalten Bergbach bergab. Zweimal war sie hingefallen, und zweimal war sie dabei klatschnass geworden.
Aber sie durfte nicht anhalten. Sie musste einfach weiterlaufen. Wohin allerdings, das war eine wiederkehrende Frage. Wenn sie ihre Karte vor all diesen Stunden richtig gelesen hatte – bevor die Geborstenen ihre Witterung und die Jagd auf sie aufgenommen hatten –, musste sie sich irgendwo in der Nähe der nördlichsten Spitze der Umkämpften Lande befinden.
Was bedeutete, dass es keine Siedlungen gab, in denen sie Zuflucht suchen könnte. Keine Menschen, die sie vor dem retten konnten, was sie jagte.
Seit einer Woche hielt Iseult nun auf Marstok zu. Die öden Ebenen um Lejna lagen hinter ihr. Jetzt befand sie sich in hügeligem, steilem Gelände. Iseult hatte sich noch nie irgendwo aufgehalten, wo sie den Himmel nicht sehen konnte. Oh, sie hatte Abbildungen von schneebedeckten Gipfeln und zerklüfteten Hügeln gesehen, und sie hatte gehört, wie Safi solche Landschaften beschrieben hatte … aber sie hatte sich nie vorgestellt, wie klein sie sich fühlen würde, wenn Berge ihr die Sicht auf den Himmel nahmen. Wie abgeschnitten und eingeschlossen.
Und alles wurde noch schlimmer durch die vollkommene Abwesenheit von Strängen. Als Strangmagis konnte Iseult die Stränge sehen, die binden, die Stränge, die brechen. Die Verbindungen zwischen den Menschen. Tausende Farben, die in jedem Moment um sie herum schimmerten. Nur dass es ohne Menschen keine Stränge gab – und ohne Stränge keine Farben, um ihre Augen und ihren Geist zu füllen.
Iseult war vollkommen allein, und das seit Tagen. Sie war über Teppiche aus Kiefernnadeln marschiert, wo ihr nur Hunderte Bäume Gesellschaft leisteten, die im Wind knarrten. Doch egal wie das Gelände aussah, Iseult hatte sich vorsichtig bewegt. Ohne ein Zeichen ihrer Anwesenheit zu hinterlassen, ohne Spur, und immer in Richtung Osten.
Bis heute Morgen.
Vier Geborstene hatten sich auf Iseults Fährte gesetzt. Sie hatte keine Ahnung, woher sie kamen oder wie sie ihr hatten folgen können. Der Salamanderstoff-Mantel, den der Blutmagis Aeduan ihr vor zwei Wochen gegeben hatte, sollte ihre Witterung eigentlich vor den Geborstenen verbergen, und doch hatte er versagt. Iseult konnte die schwarze Verderbtheit der geborstenen Stränge immer noch hinter sich spüren.
Und mit jeder Minute, die verging, holten sie auf.
Ich sollte den Strangstein einwickeln, dachte Iseult vage, ein leises Selbstgespräch, das sich mit ihren stampfenden, platschenden Schritten verband. Ihn mit einem Stück Stoff umwickeln, damit er beim Laufen nicht ständig gegen meine Brust schlägt.
Sie hatte diesen Gedanken mindestens schon hundert Mal gedacht, nachdem dies nicht das erste Mal war, dass sie über unebenen Waldboden laufen musste. Doch immer, wenn sie endlich die Zeit gefunden hatte, innezuhalten und sich hinter einen Stamm zu kauern, war sie so sehr darauf konzentriert gewesen, wieder zu Atem zu kommen oder ihre Strangmagie nach den sie verfolgenden Strängen zu strecken, dass sie vergessen hatte, den Strangstein einzuwickeln. Zumindest, bis er wieder anfing, gegen ihre Brust zu schlagen.
Zu anderen Zeiten war Iseult so tief in Tagträumereien versunken, dass sie ihre Umgebung vollkommen vergessen hatte. Dann malte sie sich aus, wie es wohl wäre, tatsächlich ein Teil der Cahr Awen zu sein.
Iseult und Safi hatte das Becken der Ursprungsquelle von Nubrevna besucht. Sie hatten die eigentliche Quelle tief im Becken berührt, und ein Erdbeben hatte das Land erschüttert. Ich habe die Cahr Awen gefunden, hatte Mönch Evrane Iseult und Safi daraufhin mitgeteilt, und ihr habt die Wasserquelle zum Leben erweckt.
Für Safi ergab dieser Titel Sinn. Sie war Sonnenschein und Schlichtheit. Natürlich wäre sie die Lichtbringer-Hälfte der Cahr Awen. Doch Iseult war nicht das Gegenteil von Safi. Sie war weder Sternenlicht noch Komplexität. Sie war eigentlich gar nichts.
Außer, ich bin es doch. Außer, ich kann es sein.
Wann immer Iseult einschlief, wärmten sie diese Gedanken.
Heute allerdings war der erste Tag, an dem der Strangstein zu leuchten begonnen hatte – ein Zeichen, dass sich Iseult wirklich in Gefahr befand. Sie konnte nur hoffen, dass Safi – wo auch immer sie sich befinden mochte – beim Anblick ihres eigenen blinkenden Steins nicht in Panik verfiel.
Außerdem hoffte Iseult, dass der Stein nur ihretwegen brannte; denn wenn er leuchtete, weil auch Safi bedroht war …
Nein, diese Sorgen durfte sich Iseult nicht machen. Im Moment konnte sie nichts anderes tun als rennen.
Dabei war es erst zwei Wochen her, seit in Lejna die Hölle ausgebrochen war … seit Iseult Safi an die Marstoker verloren, Merik aus einem eingestürzten Gebäude gerettet und entschieden hatte, dass sie ihrer Strangschwester um jeden Preis folgen würde.
Danach hatte Iseult die Geisterstadt von Lejna durchsucht, bis sie Mathews verlassenes Kaffeehaus gefunden hatten. In der Küche lag Essen, und es gab auch sauberes Wasser. Sie hatte sogar einen Sack voller Silbermünzen im Keller entdeckt.
Als allerdings nach acht Tagen immer noch niemand gekommen war, um sie zu holen, hatte Iseult davon ausgehen müssen, dass auch niemand mehr auftauchen würde. Dom Eron hatte vermutlich gehört, dass Safi von der Kaiserin von Marstok entführt worden war; Habim, Mathew und Eron folgten ihr wahrscheinlich gerade.
Womit Iseult keine andere Wahl blieb, als sich stetig nach Nordosten zu bewegen, um tagsüber zu schlafen und nachts zu reisen. Denn es gab nur zwei Sorten Menschen in den Wäldern der Magislande: diejenigen, die versuchten, einen umzubringen, und diejenigen, die einen wirklich umbrachten. Beiden Fraktionen ging man besser aus dem Weg.
Doch in der Dunkelheit, in der Iseult reiste, warteten andere Dinge. Schatten und Windböen und Erinnerungen, die sie nicht verdrängen konnte. Sie dachte an Safi. Dann dachte sie an ihre Mutter. Sie dachte an Corlant und seinen verfluchten Pfeil, der sie fast das Leben gekostet hatte. Sie dachte an die Geborstenen von Lejna und die tropfenförmige Narbe, die sie auf ihrer Haut hinterlassen hatten.
Und dann dachte sie an die Puppenspielerin, die ohne Unterlass versuchte, in Iseults Träume einzudringen. Webermagis, so bezeichnete sie sich selbst, und beharrte darauf, dass Iseult genauso war wie sie. Doch die Puppenspielerin brachte Magi zum Bersten und kontrollierte ihre Stränge. Das könnte – würde – Iseult niemals tun.
Überwiegend aber dachte Iseult über den Tod nach. Über ihren eigenen Tod. Schließlich war sie nur mit einem Entermesser bewaffnet und hielt auf eine Zukunft zu, die vielleicht gar nicht existierte.
Eine Zukunft, die schon sehr bald enden könnte, falls die Geborstenen auf ihren Fersen sie einholten. Wenn sie sie einholten, denn Iseult war einfach nicht gut im Fliehen. Deswegen verließ sie sich so sehr auf Safi – deren unruhige Beine intuitiv den richtigen Weg einschlugen und die immer entkommen konnte, indem sie allein ihren Instinkten folgte. In halsbrecherischen Situationen, wenn Angst ihre Strangmagis-Vernunft unter sich begrub, war Iseult ihr eigener schlimmster Feind.
Bis sie die Ackerwinden entdeckte. Einen ganzen Teppich davon, direkt neben dem Bach. Scheinbar wild. Scheinbar harmlos.
Aber diese Pflanzen wuchsen nicht wild. Sie waren nicht harmlos.
Schon einen Augenblick später hatte Iseult den Bach verlassen. Ihre tauben Füße rutschten weg, während sie die Uferböschung nach oben krabbelte. Sie fiel. Fing sich mit den Händen, die Handgelenke überdehnt.
Sie bemerkte es nicht. Es war ihr egal. Denn überall, wo sie hinschaute, wuchs Ackerwinde. Fast unsichtbar in den gefleckten Schatten, aber unübersehbar, wenn man wusste, wonach man Ausschau halten musste. Unübersehbar, wenn man eine Nomatsi war.
Obwohl der Pfad vor ihr wirkte, als wäre er ein unschuldiger Wildwechsel zwischen den Kiefern, erkannte Iseult eine Nomatsi-Straße, wenn sie eine sah. Darauf ausgelegt, die Nomatsi-Stämme vor anderen zu schützen, bedeuteten diese mit Fallen gespickten Wege den sicheren Tod für jeden, den der betreffende Stamm nicht eingeladen hatte.
Iseult war gewiss nicht eingeladen, doch sie würde als gebürtige Nomatsi sicherlich auch nicht als »anderer« gesehen werden.
Mit schnellen Schritten entfernte sie sich vom Bach. Jetzt durfte sie nicht mehr rennen, denn ein falscher Schritt konnte den giftmagischen Nebel auslösen, vor dem die Ackerwinde warnte.
Da. Sie entdeckte einen Ast auf dem Boden, in Form einer Wünschelrute, deren einer gebogener Arm nach Norden zeigte, der andere nach Süden.
Der Weg, der aus der Nomatsi-Straße führte. Oder tiefer hinein.
Iseult wurde noch langsamer, schob sich vorsichtig um eine Kiefer nach der anderen herum. Sie glitt über moosbedeckte Steine. Sie ging auf die Zehenspitzen, sprang, atmete kaum.
Die Geborstenen waren ihr jetzt so nahe. Gespannte schwarze Stränge drängten sich in ihr Bewusstsein, hungrig und abstoßend. In wenigen Minuten würden ihre Häscher sie erreicht haben.
Aber das war in Ordnung, denn direkt vor ihr war das nächste Stück Holz in den Boden gebohrt, unauffällig im Wald. Bärenfallen voraus, warnte der Ast.
Die Geborstenen allerdings ahnten davon nichts. Nicht bevor ihre Beine nicht in gezackten Eisenzähnen gefangen waren, die zu fest saßen, um sie zu lösen.
In Iseult brannte der Drang zu rennen. An den Bärenfallen vorbei auf die farnbewachsene Lichtung zu eilen, die sich vor ihr auftat. Sie umklammerte ihren Strangstein, drückte ihn fest und hielt ihre Schritte gleichmäßig. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sie zählte sechs Fallen, bevor sie die Lichtung hinter sich ließ.
Dann lag das Hindernis hinter ihr. Jetzt konnte sie laufen. Und gerade rechtzeitig, denn hinter ihr erwachte die Nomatsi-Straße zum Leben. Giftmagischer Nebel explodierte, eine heiße Wolke in der Ferne. Die Druckwelle schoss durch die Luft, glitt über Iseults Rücken.
Die Geborstenen hatten ihn ausgelöst, doch der Nebel hatte keine Auswirkungen. Die Jäger drangen weiter vor.
Iseult warf sich in einen schnelleren Sprint. Ihr Atem ging keuchend. Wenn sie nur noch ein wenig weiterrannte, konnte sie vielleicht wirklich entkommen.
Die Bärenfallen erwachten zum Leben, klirrten wie mitternächtliche Glocken. Ein Heulen erklang aus grauenhaften Kehlen. Vier Sätze Stränge zuckten und kämpften gegen den Stahl, der ihre Beine hielt.
Iseult wurde nicht langsamer. Sie musste weiter, solange es noch möglich war, denn ihr Vorteil würde vielleicht nicht lange halten. Farne und Kiefernnadeln knirschten unter ihren Füßen. Sie hatte keine Ahnung, wo ihre Füße als Nächstes landen würden. Sie sah nur die Stämme von Kiefern. Schösslinge, Stämme, Wurzeln – sie rannte einfach hindurch. Verdrehte sich die Knöchel und schlug sich die Knie auf.
Geschwindigkeit war ein Fehler. Nomatsi-Straßen waren nicht dazu gedacht, schnell passiert zu werden. Sie verlangten Respekt.
Also hätte es Iseult nicht überraschen dürfen, als sie eine weitere Lichtung erreichte und der Boden plötzlich nachgab. Es hätte sie nicht überraschen dürfen, als ein Netz nach oben schoss, um sie in die Bäume zu reißen.
Sie jaulte auf. Dann wurde sie in die Höhe gezerrt, um irgendwann baumelnd und schwingend zu stoppen.
Keuchend holte Iseult Luft, stieß sie zischend aus. Zumindest, dachte sie vage, habe ich noch mein Entermesser. Auch wenn ihr das kaum helfen würde, nachdem sie sechs Meter hoch in der Luft hing.
Auch nicht gegen den Geborstenen, der jetzt in einer Spur aus schwarzem Blut in die Mitte der Lichtung trat. Ihm fehlte ein halber Fuß, und seine Haut zuckte von der wie auch immer gearteten Magie, die eingesetzt worden war, um ihn zum Bersten zu bringen. Und doch bewegte er sich mit ungewöhnlicher Zielstrebigkeit. Ohne die geistlose, hektische Gewalttätigkeit, die sonst für die Geborstenen typisch war.
Und dann verstand Iseult, warum. Gebrochene Stränge schwankten träge über ihm, streckten sich zum Himmel. Fast unsichtbar.
Die Puppenspielerin. Genau wie sie es in Lejna mit den marstokischen Nattern und Matrosen getan hatte, musste die Puppenspielerin diese Männer aus der Ferne geborsten haben. Und kontrollierte sie auch jetzt.
Gerade als ihr das klar wurde, erloschen die ersten Stränge. Einer nach dem anderen starben die Geborstenen, die in den Bärenfallen gefangen waren. Als hätte die Puppenspielerin beschlossen, dass ihre Zeit abgelaufen war. Als hätte sie ihre gebrochenen Stränge durchgeschnitten.
Doch der Mann unter Iseult lebte noch. Er schlich über die Lichtung, womit Iseult nur eine Chance blieb. Sie musste sich befreien und den Geborstenen töten, bevor er sie töten konnte.
Iseult kam nie dazu, ihren Plan durchzuführen, da der Jäger über eine zweite Falle stolperte. Ein Netz wurde aus dem Boden gezogen, riss ihn in die Luft. Seile knirschten. Er kämpfte und wehrte sich und heulte, kaum zwei Meter von Iseult entfernt, bis seine Schreie abrupt verklangen, weil seine schwarzen Stränge sich mit einem Zischen auflösten.
Die Puppenspielerin hatte ihn getötet, sodass Iseult ganz allein auf der Nomatsi-Straße zurückblieb.
Iseult konnte nicht anders: Sie lachte. Endlich war ihr die Ruhepause vergönnt, die sie so dringend brauchte. Sie war ihren Verfolgern endlich entkommen – und jetzt hing sie hier fest.
Ihr Lachen verklang schnell, vertrieben von der Kälte, die sich in ihr ausbreitete.
Denn wenn Esme diese Geborstenen ausgeschickt hatte, um sie zu jagen, musste Iseult davon ausgehen, dass sie es wieder tun würde.
Mach dir deswegen später Sorgen, erklärte sie sich selbst. Für den Moment gab es keine Gegner mehr – und die größte Herausforderung lag darin, sich aus dem schwingenden Netz zu befreien, ohne sich dabei die Knochen zu brechen.
»Oh Ziegentitten«, murmelte sie – einer von Safis beliebtesten Flüchen. Sie umklammerte ihren Strangstein – er blinkte nicht mehr –, um die Kraft aus ihm zu ziehen, die er ihr in ihrer Einbildung schenkte.
Dann – ohne einen weiteren Gedanken und nur mit der Konzentration einer Strangmagis auf ihrer Seite – machte sich Iseult daran, das Netz zu durchtrennen.
Als sich Merik seinen Weg durch den Falkenweg bahnte – eine belebte Straße, die sich von einem Ende von Lovats bis zum anderen am Fluss Timetz entlangschlängelte –, betete er darum, dass der Sturm erst in ein paar Stunden hereinbrechen würde. Dass ihm genug Zeit blieb, um einen ordentlichen Unterschlupf zu finden. Vielleicht sogar genug Zeit, um etwas Anständiges zum Essen aufzutreiben.
Er musste erst wieder Kraft sammeln, bevor er zu Pins Feste aufbrach.
Jeder Atemzug, den Merik tat, schmeckte nach dem kommenden Regen. Donner grollte im Akkord mit den Schlägen der Windtrommeln über Lovats hinweg. Soldaten gebraucht auf dem Richtplatz.
Zum Glück für Merik befand er sich inzwischen einen guten Kilometer vom Richtplatz entfernt, verborgen im Chaos des Falkenwegs mit seinen kreuzenden Brücken und den gewundenen Seitenstraßen. Die Gebäude lehnten sich über die Straße wie Matrosen nach einer durchzechten Nacht, und an jeder Kreuzung erstreckten sich Girlanden aus trockenen Eichenblättern von einer Ecke zur anderen.
Die braunen und gelben Farben zogen Meriks Blick jedes Mal an, wenn er an ihnen vorbeikam. In einem großen Teil der Nihar-Ländereien hatte es nie eine Herbsternte – oder ein Wiedererwachen im Frühling – gegeben, zumindest nicht in den Jahren, die Merik dort gelebt hatte. Ein so großer Teil des Erdbodens war immer noch mit dalmottischem Gift verseucht.
Doch das Gift hatte Lovats, das so weit im Nordosten lag, nie erreicht, also war es hier noch möglich, Eichenblätter zusammen mit Salbei und Minze zu Girlanden zu binden, mit Akzenten aus Feuerfarben und Grün. Diese Girlanden wiesen auf die königliche Beerdigung in sechs Tagen hin. Auf Meriks Beerdigung.
Was für einen verdrehten Sinn von Humor Noden doch hatte.
Merik eilte weiter, immer noch begleitet vom trommelnden Ruf nach Soldaten, bis er die abgetretenen Granitstufen zu einem alten Tempel neben dem Falkenweg hinauflief. Der Tempel war so alt wie Lovats selbst, und die Zeit hatte die sechs Säulen vor dem schattigen Eingang abgeschliffen.
Die Hexenfische. Nodens Boten, mit der Aufgabe, die Toten hinter das letzte Riff zu führen und danach tief unter die Wellen zum Hof des Gottes auf dem Meeresgrund. Doch übrig geblieben waren von den Figuren nur eiserne Ringe auf Hüfthöhe und die vagen Konturen der Gesichter hoch oben.
Merik folgte einem Lichtstrahl in den Innenraum, dann hielt er auf die Rückwand des Tempels zu. Mit jedem Schritt wurde die Luft kühler, die Windtrommeln leiser. Nach und nach verglomm das Sonnenlicht, ersetzt durch den Schein zweier schwacher Lampen, die über einem steinernen Noden auf seinem Thron im Herz des Tempels hingen.
Zu dieser Tageszeit war das Gebäude fast leer. Nur zwei alte Damen befanden sich darin, und sie verließen den Tempel gerade.
»Ich hoffe, es gibt Brot bei der Beerdigung«, sagte eine der Frauen. Ihre dünne Stimme wurde vom der Götterstatue aus Granit zurückgeworfen. »Die Lindays haben zur Beerdigung der Königin Brot ausgegeben – erinnerst du dich?«
»Freu dich nicht zu früh«, murmelte ihre Begleiterin. »Ich habe gehört, es gibt vielleicht gar keine Beerdigung.«
Das erregte Meriks Aufmerksamkeit. Er glitt hinter den Thron und lauschte. »Mein Neffe Rayet ist Page im Palast«, fuhr die zweite Frau fort. »Er hat mir erzählt, dass die Prinzessin überhaupt nicht reagiert hat, als sie die Nachricht vom Mord am Prinzen gehört hat.«
Natürlich hatte sie das nicht. Merik verschränkte die Arme vor der Brust, grub die Finger in seine wunden Oberarme.
»Weiß dein Neffe, wer den Prinzen getötet hat? Dieser Metzger am Ende des Falkenwegs hat erklärt, es wären die Marstoker gewesen, aber dann hat meine Nachbarin behauptet, die Cartorrer wären verantwortlich …« Ihre Stimme verklang. Merik versuchte nicht, den Frauen zu folgen.
Er hatte genug gehört. Mehr als genug. Natürlich würde Vivia die Beerdigung absagen. Er konnte ihre gedehnte Stimme geradezu hören: Wieso sollten wir Essen auf das Volk verschwenden, wenn es stattdessen für die Truppen gebraucht wird?
Vivia war nur an der Macht interessiert. An der Krone, die der Hohe Rat ihr, Noden sei Dank, immer noch nicht verliehen hatte. Aber wenn sich die Krankheit des Königs verschlimmerte – wenn er starb, wie Merik es der allgemeinen Annahme nach getan hatte –, dann gäbe es keine Möglichkeit, Vivia vom Thron fernzuhalten.
Merik löste sich von der Statue des Gottes und ging zu den zwei Fresken an der Rückwand des Tempels.
Zur Rechten stand Lady Baile, Schutzpatronin der Veränderung, der Jahreszeiten und der Kreuzungen. Nodens Rechte Hand wurde sie genannt. Das Licht der Lampen glänzte auf den goldenen Weizenähren in ihrer rechten Hand und der silbernen Forelle in ihrer linken. Ihre Haut war dunkel wie der Nachthimmel, schwarz mit kleinen weißen Punkten, während die fuchsförmige Maske über ihrem Gesicht blau leuchtete. Sie stand in einem grünen Feld. Die Farben ihres Freskos waren vor kurzer Zeit aufgefrischt worden, genauso wie die goldenen Worte zu ihren Füßen:
Auch wenn der Segen des Verlusts
Sich uns nicht immer zeigt.
Die Gabe der Lady Baile ist Stärke,
Und sie wird uns nie im Stich lassen.
Meriks Blick huschte zu einer Kupferurne vor der Wand, in der sich hölzerne und silberne Münzen stapelten. Opfergaben an Lady Baile. Ein Flehen darum, dass sie in Nodens Ohr flüsterte: Hilf ihnen.
Vor der Urne lagen in Haufen Kränze aus den Blättern des letzten Jahres, aus Salbei und Minze und Rosmarin – Gaben, um die Toten zu ehren. Merik fragte sich, ob wohl auch Kränze für Kullen niedergelegt worden waren.
Dann verkrampfte sich seine Brust. Er wandte sich ab, richtete den Blick auf das zweite Fresko. Auf Nodens linke Hand. Den Schutzpatron der Gerechtigkeit, der Rache, des Zorns.
Die Furie.
So hatte die Frau auf dem Richtplatz Merik genannt. Sie hatte es als Titel verwendet. Sie hatte es als Gebet gemeint.
Kahl, vernarbt und ungeschlacht trug der Heilige aller zerstörten Dinge nur den Namen seiner wahren Natur. Seiner einzigen Bestimmung. Er errang Gerechtigkeit für diejenigen, denen Unrecht geschehen war; brachte den Frevlern ihre Strafe. Und während Lady Baile so schön war wie das Leben selbst, sah die Furie noch grotesker aus als selbst die Hexenfische.
Die schwarzen und scharlachroten Pigmente seines Körpers waren verblasst. Die Farbe wurde niemals aufgefrischt, auch nicht in der klaffenden Höhlung hinter ihm – genauso wenig die Worte unter den krallenbewehrten Füßen der Furie:
Wieso hältst du ein Rasiermesser in einer Hand?
Damit die Menschen sich erinnern, dass ich so scharf bin wie jede Schneide.
Und warum hältst du ein zerbrochenes Glas in der anderen?
Damit die Menschen sich erinnern, dass ich alles sehe.
»Und das«, murmelte Merk leise, »ist es, womit die Frau mich verwechselt hat.« Das war das Monster, das sie erkannt hatte, als sie ihn angesehen hatte.
Er musterte die leere Urne vor den Füßen der Furie. Sie war immer leer, denn niemand wollte aus Versehen die Aufmerksamkeit der Furie erregen, aus Furcht, selbst gerichtet zu werden.
Außerhalb des Tempels brach der Sturm schließlich los. Regen prasselte zu Boden, laut genug, dass Merik ihn hören konnte. Doch als er zum Eingang sah, in Erwartung von Menschen auf der Suche nach Schutz, entdeckte er nur eine einzelne Gestalt, die in den Raum huschte. Bei jedem ihrer langen Schritte tropfte Wasser auf den Boden.
Cam. Meriks einzige Verbündete.