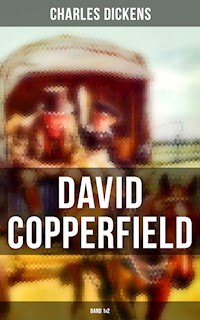
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In Charles Dickens' Werk 'David Copperfield' entführt der Autor die Leser in das viktorianische England des 19. Jahrhunderts. Das Buch ist eine Autobiografie des jungen David Copperfield, der von seinem gewalttätigen Stiefvater und seiner harten Kindheit geprägt ist. Dickens' literarischer Stil zeichnet sich durch seine detaillierte Beschreibung der sozialen Missstände der Zeit aus, während er gleichzeitig eine emotionale und mitfühlende Erzählung bietet. Das Werk reflektiert die Klassenschranken und den sozialen Realismus der Epoche und setzt sich kritisch mit den gesellschaftlichen Normen auseinander. Charles Dickens selbst war ein engagierter Schriftsteller, der durch seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen inspiriert wurde, soziale Ungerechtigkeiten anzuprangern. 'David Copperfield' spiegelt die persönlichen Kämpfe und Triumphe des Autors wider, die er in seinem Werk subtil verarbeitet hat. Dickens' lebendige Charaktere und fesselnde Handlung machen das Buch zu einem Klassiker der Weltliteratur. Für Liebhaber der viktorianischen Literatur und der gesellschaftskritischen Romane des 19. Jahrhunderts ist 'David Copperfield' von Charles Dickens ein absolutes Muss. Tauchen Sie ein in die facettenreiche Welt von Dickens' Protagonisten und lassen Sie sich von seiner beeindruckenden Erzählkunst fesseln. Ein zeitloses Werk, das die Leser mit seinem tiefgründigen Inhalt und seiner literarischen Brillanz begeistern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1727
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Copperfield
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil.
Erstes Kapitel.
Meine Geburt.
Ob ich schließlich der Held meines eigenen Lebens werde, oder ob jemand anders diese Stelle einnehmen wird, das sollen diese Blätter zeigen. Um mit dem Anfang meines Lebens zu beginnen, berichte ich, daß ich (wie man mir später erzählt hat und wie ich auch glaube) an einem Freitag um zwölf Uhr mitternachts geboren bin. Wie man sagt, fing zu gleicher Zeit die Uhr zu schlagen und ich zu schreien an.
In Anbetracht von Tag und Stunde meiner Geburt erklärten die Wärterin und einige weise Frauen, die sich schon seit Monaten lebhaft für mich interessiert hatten, noch bevor die Möglichkeit einer persönlichen Bekanntschaft vorhanden war, erstens, daß ich im Leben kein Glück haben, und zweitens, daß mir die Fähigkeit beschieden sein würde, Geister und Gespenster zu sehen, denn beide Gaben würden unabänderlich allen unglücklichen Kindern beiderlei Geschlechts verliehen, die um Freitag Mitternacht zur Welt kämen.
Über ersteres brauche ich nichts zu sagen, denn meine Lebensgeschichte beweist besser als alles andere, ob sich diese Prophezeiung erfüllt hat oder nicht. Was die zweite Fähigkeit betrifft, so muß ich dies Erbteil entweder als bewußtloser Säugling verscherzt haben oder es ist mir noch nicht zugefallen. Aber ich beklage mich durchaus nicht, daß mir dieser Besitz bisher vorenthalten worden ist, und sollte sich jetzt ein anderer seiner erfreuen, so gönne ich ihm den herzlich gern.
Ich wurde mit einer Glückshaube geboren, und man bot sie in der Zeitung zu dem niedrigen Preise von fünfzehn Guineen aus. Ob damals die seefahrende Bevölkerung sehr arm an Geld oder arm an Glauben war und daher Korkjacken vorzog, weiß ich nicht, aber jedenfalls erfolgte nur ein einziges Angebot. Es kam von einem Notar her, einem Wechselmakler, der zwei Pfund Sterling bar anbot und das übrige in Sherry geben wollte, aber die Sicherheit gegen das Ertrinken zu keinem höheren Preise erkaufen mochte.
Ich erblickte in Blunderstone in Suffolk das Licht der Welt oder dort herum, wie sie in Schottland sagen. Ich bin ein nachgebornes Kind. Die Augen meines Vaters schlossen sich sechs Monate eher, als sich die meinigen öffneten. Noch jetzt kommt mir der Gedanke seltsam vor, daß er mich niemals gesehen habe, und noch seltsamer erscheint mir aus meiner ersten Kindheit die dunkle Erinnerung an den weißen Grabstein auf dem Kirchhofe, und meine innige Trauer bei dem Gedanken, daß er dort draußen allein liege in der dunklen Nacht, während unser kleines Wohnzimmer warm und hell war von Feuer und Licht; und daß die Haustür vor ihm verschlossen und verriegelt war, kam mir manchmal fast grausam vor.
Eine Tante meines Vaters, also eine Großtante von mir, über die ich noch viel zu erzählen haben werde, war die angesehenste Person in unsrer Familie. Miß Trotwood oder Miß Betsey, wie meine arme Mutter sie stets nannte, wenn sie die Scheu vor dieser gefürchteten Dame hinlänglich überwand, was nur selten geschah, war mit einem Gatten verheiratet gewesen, jünger als sie und sehr schön, nur nicht im Sinne des biedern Sprichworts: »Schön ist, wer schön handelt« – denn er stand im starken Verdachte, Miß Betsey geprügelt zu haben, und einmal sogar soll er einer Summe Geldes wegen in der Hitze nur zu deutliche Anstalten gemacht haben, sie zum Fenster im zweiten Stocke hinauszuwerfen. Diese Unerträglichkeit der Gemütsart veranlaßte Miß Betsey, sich von ihm loszukaufen und in eine Trennung durch gegenseitige Übereinkunft zu willigen. Er ging mit seinem Kapital nach Ostindien, und dort will man ihn nach einer abenteuerlichen Familiensage einmal mit einem Affen auf einem Elefanten haben reiten sehen; aber ich glaube, es wird wohl eine indische Äffin gewesen sein. Soviel ist sicher, daß zehn Jahre später aus Indien die Nachricht von seinem Tode eintraf. Was meine Tante dabei fühlte, weiß niemand, denn sie hatte unmittelbar nach der Trennung ihren Mädchennamen wieder angenommen und sich ein Landhäuschen in einem weit entlegenen Flecken an der Seeküste gekauft; dort lebte sie mit einer einzigen Dienerin in äußerster Zurückgezogenheit.
Mein Vater war früher einmal ihr Liebling gewesen, aber sie fühlte sich tödlich beleidigt durch seine Heirat, weil meine Mutter ein »Wachspüppchen« war. Sie hatte meine Mutter zwar nie gesehen, wußte aber, daß sie noch nicht zwanzig Jahre alt war. Mein Vater und Miß Betsey sahen sich seitdem nie wieder. Er war doppelt so alt wie meine Mutter, als er sie heiratete, und von zarter Gesundheit. Ein Jahr darauf starb er, wie gesagt, sechs Monate vor meiner Geburt.
Dies war der Stand der Dinge am Nachmittag jenes, wie ich mir wohl erlauben darf zu sagen, wichtigen und ereignisvollen Freitags. Ich kann natürlich keinen Anspruch darauf erheben, zu wissen, wie die Sachen damals standen; oder das, was hier folgt, aus eigener Anschauung zu berichten.
Meine Mutter saß am Kamin, sehr leidend und niedergedrückt, schaute durch ihre Tränen in das Feuer und sann trübe über ihr und des vor der Geburt Verwaisten Schicksal nach, zu dessen Empfang schon oben in einem Schubkasten einige Gros Nadelklammern bereit lagen, während sonst die Welt seinem Erscheinen mit ziemlichem Gleichmut entgegensah. Es war also ein heller, windiger Märznachmittag, und sie saß betrübt, niedergeschlagen und von bangen Zweifeln erfüllt, ob sie glücklich die zu erwartende schwere Prüfung durchmachen werde, am Kaminfeuer, als sie, ihre Augen trocknend, aufblickte, und durch das gegenüberliegende Fenster eine fremde Dame zum Garten hereintreten sah. Beim ersten Blick schon hatte meine Mutter die sichere Ahnung, daß es Miß Betsey sei. Die untergehende Sonne warf ihre Strahlen über die Garteneinzäunung auf die fremde Dame, und diese näherte sich der Tür mit einer so unbeugsamen Strenge in Gesicht und Haltung, wie sie nur ihr angehören konnte.
Als sie das Haus erreicht hatte, gab sie noch einen andern Beweis ihrer Identität. Mein Vater hatte nämlich oft erwähnt, daß sie sich selten wie ein gewöhnlicher Christenmensch benehme, und dies tat sie auch diesmal; denn anstatt die Glocke zu ziehen, trat sie ans Fenster und drückte ihre Nase mit solcher Heftigkeit gegen das Glas, daß meine arme gute Mutter nachher immer erzählte, die Nase sei urplötzlich ganz platt und weiß geworden.
So sehr erschrak meine Mutter über sie, daß ich immer überzeugt gewesen bin, ich verdanke es der Miß Betsey, an einem Freitag geboren worden zu sein.
In ihrem Schreck war die Mutter aufgestanden und hinter den Stuhl in eine Ecke getreten. Miß Betsey sah sich indes langsam und forschend im Zimmer um, wobei sie am andern Ende der Stube anfing, und wendete maschinenmäßig, wie ein Türkenkopf auf einer holländischen Wanduhr, ihren Kopf, bis ihre Blicke endlich auf meiner Mutter haften blieben. Dann zog sie die Stirne kraus und winkte meiner Mutter wie eine, die das Befehlen gewohnt ist, die Tür aufzumachen. Meine Mutter gehorchte.
»Mrs. David Copperfield, wie ich vermute«, sagte Miß Betsey. Der Nachsatz galt wohl der Trauerkleidung und dem Zustande meiner Mutter.
»Ja«, sagte meine Mutter schüchtern.
»Miß Trotwood«, sagte der Besuch. »Sie haben von ihr gehört, hoffe ich.«
Meine Mutter entgegnete, sie habe das Vergnügen gehabt, und hatte dabei das unangenehme Bewußtsein, nicht danach auszusehen, als ob es ein überwältigendes Vergnügen gewesen sei. »Jetzt steht sie vor Ihnen«, erklärte Miß Betsey. Meine Mutter verbeugte sich und bat sie einzutreten.
Sie trat in die Wohnstube, wo meine Mutter gesessen hatte, denn das Besuchszimmer auf der andern Seite des Flures war dunkel und war nicht erleuchtet gewesen seit meines Vaters Leichenbegängnis; und als sie beide Platz genommen hatten und Miß Betsey nichts sagte, fing meine Mutter, nach vergeblichem Bemühen sich zu fassen, zu weinen an.
»O still doch, still!« sagte Miß Betsey beschwichtigend. »Nur das eine nicht! Bitte, bitte!«
Aber meine Mutter konnte doch nicht anders, und ihre Tränen flossen, bis sie sich ausgeweint hatte.
»Nehmen Sie die Trauerhaube ab, Kind,« sagte Miß Betsey, »daß ich Sie ansehen kann.«
Meine Mutter war zu sehr eingeschüchtert, um dieses wunderliche Verlangen abzuschlagen, selbst wenn sie es gewollt hätte. Daher entsprach sie dem Wunsche, tat es aber mit so zitternden Händen, daß ihr das Haar, das sehr üppig und schön war, wirr über das Gesicht fiel.
»Ach mein Himmel, du bist ja noch ein wahres Kind!« rief Miß Betsey aus, in das Du verfallend.
Allerdings sah meine Mutter selbst für ihre Jahre noch ungewöhnlich jung aus, und nun ließ sie den Kopf sinken, als ob es ihre Schuld wäre, und sagte schluchzend, daß sie freilich befürchte, sie sei ein wahres Kind von einer Witwe, und werde wohl auch ein Kind von einer Mutter sein, falls sie am Leben bliebe. In der kurzen Pause, die hierauf folgte, kam es ihr fast vor, als ob Miß Betsey ihr Haar berühre und zwar mit keiner unsanften Hand; aber als sie schüchtern hoffend aufblickte, saß die Dame steif da, ihr Kleid aufgenommen, die Hände über ein Knie gefaltet, die Füße auf den Kaminvorsetzer gestemmt und mit grimmigem Blick ins Feuer schauend.
»Aber in des Himmels Namen«, sagte Miß Betsey plötzlich. »Warum Krähenhorst?« »Meinen Sie das Haus, Madame?« fragte meine Mutter.
»Warum Krähenhorst?« sagte Miß Betsey. »Hühnerstall oder dergleichen wäre passender gewesen, wenn ihr beide überhaupt Begriffe vom praktischen Leben gehabt hättet.«
»Mr. Copperfield hat den Namen gewählt«, erwiderte meine Mutter »Als er das Haus kaufte, war ihm der Gedanke lieb, daß Krähen in der Nähe waren.«
Der Abendwind fegte in diesem Augenblick so heftig durch die alten, hohen Ulmen am Ende des Gartens, daß sowohl meine Mutter als Miß Betsey ihre Augen dorthin wandten. Als sich die Ulmen so gegeneinander neigten wie Riesen, die sich Geheimnisse zuflüsterten, dann, nachdem sie einige Sekunden so niedergebeugt verharrt hatten, in heftige Bewegungen gerieten und mit ihren phantastischen Armen in die Luft emporfuhren, als ob diese Geheimnisse zu gräßlich wären für ihre Seelenruhe, wurden auf ihren höchsten Zweigen ein paar alte, vom Sturm zerzauste Krähennester wie Wracks auf stürmischer See hin und her geschleudert.
»Wo sind die Vögel?« fragte Miß Betsey.
»Wie?« Meine Mutter hatte bereits an etwas anderes gedacht.
»Die Krähen – wo sind sie hingekommen?« fragte Miß Betsey.
»Seit wir hier sind, haben wir keine gesehen«, sagte meine Mutter. »Wir glaubten – Mr. Copperfield glaubte, es sei ein großer Krähenhorst, aber die Nester waren alt, und die Vögel haben sie seit langer Zeit verlassen,«
»Ganz David Copperfield’sch!« sagte Miß Betsey. »Der echte wirkliche David Copperfield; nennt ein Haus einen Krähenhorst, wenn keine Krähe in der Nähe ist, und hält die Vögel im guten Glauben für vorhanden, weil er die Nester sieht!«
»Mr. Copperfield ist tot,« gab meine Mutter zur Antwort »und wenn Sie es wagen, unfreundlich über ihn zu sprechen mir gegenüber –« Ich glaube, meine arme Mutter hatte einen Augenblick wirklich die Absicht, sich an meiner Tante tätlich zu vergehen, die sie leicht mit einer Hand bezwungen hätte, selbst wenn meine Mutter in einer bessern Verfassung für einen solchen Kampf gewesen wäre, als heute abend. Aber beim Aufstehen verging die Anwandlung und sie setzte sich wieder sehr demütig hin und sank in Ohnmacht.
Als sie wieder zu sich kam, oder als Miß Betsey sie zu sich gebracht hatte, sah sie letztere am Fenster stehen. Die Dämmerung war inzwischen bereits zur Dunkelheit geworden, daß sich die beiden Frauen beim Scheine des Feuers noch gerade erkennen konnten.
»Nun?« sagte Miß Betsey und trat wieder an den Stuhl, als ob sie nur einen Augenblick habe hinaussehen wollen, »und wann, meinst du –?«
»Ich zittere an allen Gliedern«, stammelte meine Mutter. »Ich weiß nicht, was mir fehlt, ach, ich sterbe sicherlich,«
»Nein, nein, nein!« sagte Miß Betsey. »Trink eine Tasse Tee.«
»Ach Gott, ach Gott! Meinen Sie, daß mir das gut sein wird?« rief meine Mutter in weinerlichem Tone und ganz hilflos.
»Natürlich«, sagte Miß Betsey. »Es ist alles nur Einbildung. – Wie heißt denn das Mädchen?«
»Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen sein wird«, sagte meine Mütter unschuldig. ^
»Gott segne dich mein Kind«, rief Miß Betsey und zitierte unwillkürlich die Inschrift auf dem Nadelkissen, das auf der Kommode lag, nur meinte sie mit dem Kind meine Mutter und nicht mich. – »Das meine ich nicht. Ich meine das Dienstmädchen.«
»Peggotty«, sagte meine Mutter.
»Peggotty!« wiederholte Miß Betsey mit einiger Entrüstung. »Willst du damit sagen, Kind, daß ein Mensch jemanden in einer Christenkirche Peggotty habe taufen lassen?«
»Es ist ihr Vatersname«, sagte meine Mutter schüchtern. »Mr. Copperfield nannte sie so, weil sie den gleichen Taufnamen mit mir hat.«
»Heda, Peggotty!« rief Miß Betsey hinaus, indem sie die Stubentür öffnete. »Tee! Deine Herrschaft ist ein bißchen unwohl. Aber rasch ein bißchen!«
Nachdem sie diesen Befehl so herrisch gesprochen hatte, als ob sie von jeher die anerkannte Gebieterin des Hauses gewesen wäre, und die erstaunte Peggotty gemustert hatte, die verwundert über die fremde Stimme mit einem Lichte in der Hand in den Flur hinausgetreten war, machte Miß Betsey die Tür wieder zu und nahm Platz wie vorhin, die Füße abermals auf den Kaminvorsetzer gestemmt, das Kleid etwas aufgenommen, und die Hände über ein Knie gefaltet.
»Du meinst also, es könnte ein Mädchen werden«, sagte Miß Betsey. »Ich zweifle gar nicht daran, ich habe eine Ahnung, daß es ein Mädchen sein muß. Also, Kind, von dem Augenblick der Geburt des Mädchens an –«
»Oder vielleicht Knaben«, erlaubte sich meine Mutter einzuwerfen.
»Ich sage dir ja, ich ahne gänzlicher, daß es ein Mädchen ist«, entgegnete Miß Betsey. »Widersprich mir also nicht! Von dem Augenblick der Geburt dieses Mädchens an, Kind, will ich seine Freundin sein. Ich will seine Patin werden, und sie soll Betsey Trotwood Copperfield heißen. Mit dieser Betsey Trotwood Copperfield muß im Leben alles gut gelingen. Mit ihren Gefühlen soll nicht frevelhaft gespielt werden. Sie muß gut auferzogen und in acht genommen werden, damit sie ihr Vertrauen nicht törichterweise an Unwürdige verschenkt. Und das soll meine Sorge sein!«
Miß Betsey warf bei jedem dieser Sätze den Kopf zur Seite, als ob das erlittene Unrecht vergangener Zeiten in ihr wieder lebendig würde, und sie jede noch deutlichere Anspielung darauf nur mit großer Anstrengung zurückhielte. So dachte wenigstens meine Mutter, als sie sie bei dem schwachen Feuerschein beobachtete, aber sie war von Miß Betsey zu sehr eingeschüchtert, selbst zu verlegen, und von dem Besuch zu bestürzt, als daß sie hätte genau beobachten oder etwas sagen können.
»Und war David gut gegen dich, Kind?« fragte Miß Betsey, als sie eine Weile geschwiegen hatte und die Bewegungen ihres Kopfes allmählich ausgehört hatten. »Habt Ihr Euch immer gut vertragen?«
»Wir lebten sehr glücklich«, sagte meine Mutter. »Mr. Copperfield war nur zu gut gegen mich.«
»Ah, er hat dich also verzogen?« erwiderte Miß Betsey.
»Ich fürchte sehr, er hat mich insofern verzogen, als es mir schwer sein wird, ganz allein und ohne Stütze wieder in die rauhe Welt zu treten«, schluchzte meine Mutter.
»Na, na, schon gut, nur nicht weinen!« sagte Miß Betsey. »Ihr wart eben nicht passend verheiratet, Kind – wenn man überhaupt passend verheiratet sein kann – und deshalb frage ich. Du warst ja Wohl eine Waise, Kind, nicht wahr?«
»Ja!«
»Und Gouvernante?«
»Ja, zweite Gouvernante in einer Familie, die Mr. Copperfield als Gast häufig besuchte. Mr. Copperfield war immer sehr freundlich und aufmerksam gegen mich und machte mir zuletzt einen Heiratsantrag. Und ich sagte: Ja. Und so wurden wir Mann und Frau«, sagte meine Mutter ganz schlicht und treuherzig.
»Hm! armes Kind!« murmelte Miß Betsey und sah immer noch grimmig ins Feuer. »Verstehst du denn etwas?«
»Was beliebt, Madame?« entgegnete meine Mutter.
»Na, z.B. von der Wirtschaft?« fragte Miß Betsey.
»Ich fürchte, nicht viel«, erwiderte meine Mutter. »Nicht so viel wie ich wünschen möchte. Aber Mr. Copperfield unterwies mich darin –«
»Verstand selber recht viel davon«, schaltete Miß Betsey ein.
»– Und ich hätte sicherlich Fortschritte darin gemacht, da ich sehr eifrig im Lernen und er sehr geduldig im Lehren war, wenn nicht das große Unglück seines Todes« – meine Mutter verlor wieder die Fassung und konnte nicht weiter sprechen.
»Nun ja, nun ja!« begütigte Miß Betsey.
»Ich führte mein Wirtschaftsbuch regelmäßig und schloß es mit ihm gewissenhaft jeden Abend ab«, rief meine Mutter, in einem neuen Ausbruch des Schmerzes aufschluchzend.
»Nun, nun, weine nur nicht mehr!« sagte Miß Betsey.
»Und es fiel niemals auch nur das kleinste Wort der Uneinigkeit darüber, außer wenn Mr. Copperfield tadelte, daß ich die Drei und Fünf einander so ähnlich und an die Sieben und die Neun Schleifen machte«, schluchzte meine Mutter weiter und sah sich immer wieder von Tranen unterbrochen.
»Du wirst dich noch krank machen«, sagte Miß Betsey fürsorglich, »und das ist weder für dich noch für mein Patchen gut. Komm, komm! «Du mußt das unterlassen!«
Diese Begründung trug einiges zur Beruhigung meiner Mutter bei, obgleich ihr zunehmendes Übelbefinden einen größern Anteil daran hatte. Es folgte eine Pause des Schweigens, das nur unterbrochen würde von einem gelegentlichen »Hm!« der Miß Betsey, die immer noch dasaß, die Füße auf den Kaminvorsetzer gestemmt.
»David hatte sich für sein Geld eine Leibrente gekauft«, sagte sie nach einer Weile. »Was hat er für dich getan?«
»Mr. Copperfield«, sagte meine Mutter mit einiger Anstrengung, »war so rücksichtsvoll und gut gegen mich, mir einen Teil der Leibrente zu sichern.«
»Wieviel?« fragte Miß Betsey.
»Hundertundfünf Pfund jährlich«, sagte meine Mutter.
»Es hatte übler kommen können«, sagte meine Tante.
Das war eine in doppelter Hinsicht treffende Bemerkung, denn der Zustand meiner Mutter hatte sich so sehr verschlimmert, daß Peggotty, die soeben mit Teebrett und Lampe hereintrat und auf den ersten Blick ihren Zustand erkannte, – was Miß Betsey natürlich schon längst bemerkt hätte, wenn das Zimmer nicht so finster gewesen wäre –- daß sie also Peggotty so rasch wie möglich in die Stube hinauf brachte und sofort Ham Peggotty, ihren Neffen, der seit einigen Tagen als immer verfügbarer Bote für unvorhergesehene Fälle im Hause verborgen gewesen war, nach der Hebamme und dem Doktor schickte.
Diese verbündeten Mächte wunderten sich nicht wenig, bei ihrer kurz hintereinander erfolgenden Ankunft eine unbekannte Dame von gewichtigem Aussehen vor dem Feuer sitzen zu sehen, die den Hut an dem zusammengeknüpften Bande über den linken Arm hängen hatte und sich die Ohren mit einer seinen Watte zustopfte. Da Peggotty nichts von ihr wußte und meine Mutter sich über sie nicht geäußert hatte, so blieb sie ein vollständiges Geheimnis in der Wohnstube, und die rätselhafte Tatsache, daß sie ein ganzes Wattemagazin in der Tasche zu haben schien und sich Watte auf besagte Art in die Ohren stopfte, schmälerte die Feierlichkeit ihrer Anwesenheit nicht im mindesten.
Nachdem der Doktor oben gewesen und wieder heruntergekommen war, und nun vermutete, daß er wahrscheinlich mit der unbekannten Dame einige Stunden würde beisammen bleiben müssen, so schickte er sich an, höflich und gesellig zu sein. Es war der sanfteste seines Geschlechts und der gutmütigste aller Männer. Er schob sich immer nur seitwärts durch die Tür, wenn er kam oder ging, um weniger Raum einzunehmen. Er ging so leise wie der Geist im Hamlet, nur noch langsamer. Er trug den Kopf auf eine Seite geneigt, halb in bescheidener Herabsetzung seiner selbst, halb in bescheidener Höflichkeit gegen andere. Er hatte noch nie jemandem ein böses Wort gesagt, selbst einem Hunde nicht! Er hatte kein böses Wort für einen tollen Hund. Ein sanftes Wörtchen höchstens würde er zu ihm gesagt haben, aber ein rauhes Ware ihm unter keiner Bedingung möglich gewesen.
Mr. Chillip sah meine Tante mit dem auf die Seite geneigten Kopfe sanft an, machte eine zierliche Verbeugung und sagte, auf die Watte anspielend, indem er leise sein linkes Ohr berührte: »Lokale Störung, Madame?«
»Was«, entgegnete meine Tante, und riß die Watte wie einen Korkpfropfen aus dem Ohre.
Mr. Chillip erschrak so sehr über ihr barsches Wesen (wie er später meiner Mutter erzählte), daß er schier die Fassung verlor. Aber er wiederholte verbindlich:
»Lokale Störung, Madame?« .
»Unsinn!« erwiderte meine Tante, und stöpselte das Ohr energisch wieder zu.
Mr. Chillip konnte nun weiter nichts tun, als sie schüchtern anzusehen, während sie dasaß und in das Feuer stierte, bis man ihn wieder hinaufrief. Nach viertelstündiger Abwesenheit kehrte er zurück.
»Nun?« sagte meine Tante und nahm die Watte aus dem ihm zugekehrten Ohre.
»Nun, Madame,« entgegnete Mr. Chillip, »es geht langsam vorwärts, Madame.«
»Pa – a – ah!« sagte meine Tante, mit einem vollständigen Triller die verächtliche Ausrufung verlängernd, und schloß ihren Gehörgang wieder zu, wie vorhin.
Wahrhaftig, wahrhaftig (wie Mr. Chillip später meiner Mutter erzählte), er war geradezu entsetzt gewesen. Aber dennoch blickte er sie fast zwei Stunden lang an, wie sie dasaß und ins Feuer starrte, bis man ihn wieder rief.
Nach abermaliger Abwesenheit kehrte er nochmals zurück.
»Nun!« sagte meine Tante und nahm den Wattepfropfen wieder aus demselben Ohr heraus.
»Nun, nun, Madame,« erwiderte Mr. Chillip, »es geht langsam vorwärts, Madame.«
»Wirklich also –« sagte meine Tante in so barschem Tone, daß es Mr. Chillip nun nicht länger aushalten konnte. Es war wirklich danach angetan, ihn ganz kleinlaut und verzagt zu machen, äußerte er später. Er ging lieber hinaus und setzte sich draußen im Dunkeln bei starkem Zug auf die Treppe, bis man wieder nach ihm schickte.
Ham Peggotty, der die Stadtschule besuchte und im Katechismus so fest war, daß er als glaubwürdiger Zeuge betrachtet werden kann, berichtete am nächsten Tage, er habe eine Stunde später zur Stubentür hineingeguckt und sei sofort von Miß Betsey, die in großer Aufregung auf und ab gegangen, bemerkt und erwischt worden, bevor er habe flüchten können. Er berichtete ferner, man habe zuweilen Fußtritte und Summen in den oberen Zimmern gehört, die von der Watte wohl nicht genügend gedämpft worden seien, wie er dies aus dem Umstände geschlossen hätte, daß ihn die Dame ersichtlich als ein Opfer festhielt, an dem sie ihrer überströmenden Aufregung, wenn die Töne am lautesten waren, Luft machen konnte, daß sie ihn beim Kragen gepackt gehalten und in der Stube auf und ab geführt (als ob er zuviel Laudanum genossen), ihn alsdann geschüttelt, ihm in das Haar gefahren, den Kragen zerzaust und die Ohren verstopft, als ob sie diese mit ihren eigenen verwechselte, und ihn auf andere Weise mißhandelt habe. Diese Erzählung wurde teilweise durch seine Tante bestätigt, die ihn halb ein Uhr kurz nach seiner Befreiung sah, wo er so rot ausgesehen haben solle wie – ich.
Der sanfte Mr. Chillip konnte niemand etwas nachtragen, am allerwenigsten zu einer solchen Zeit. Er trat durch die halbgeöffnete Tür ins Zimmer, sobald er nur abkommen konnte, und sagte in seiner sanftesten Weise zu meiner Tante:
»Madame, es freut mich, Sie beglückwünschen zu können.«
»Wozu?« sagte meine Tante scharf.
Mr. Chillip wurde wieder verlegen bei der außerordentlichen Schroffheit meiner Tante; er machte daher eine zierliche Verbeugung und verzog sein Gesicht zu einem sanften Lächeln, um sie zu besänftigen.
»O über diesen Mann, was er nur macht!« rief meine Tante ungeduldig. »Kann er nicht sprechen?« »Seien Sie ruhig, meine liebe Madame«, flötete er mit seiner sanftesten Stimme. »Es ist durchaus keine Ursache mehr zur Besorgnis vorhanden, Madame, beruhigen Sie sich bitte.«
Man hat es damals fast als ein Wunder betrachtet, daß ihn meine Tante nicht umschüttelte, um das, was sie hören wollte, aus ihm herauszuschütteln. Sie schüttelte nur das eigene Haupt, aber auf eine Art, die ihn zittern machte.
»Nun, Madame«, begann Mr. Chillip von neuem, sobald er wieder etwas Mut gefaßt hatte. »Es freut mich, Sie beglückwünschen zu können, alles ist nun vorbei, Madame, und glücklich vorbei.«
Während der fünf Minuten, die Mr. Chillip zu dieser Rede brauchte, sah ihn meine Tante scharf an.
»Wie befindet sie sich?« fragte sie und kreuzte ihre Arme, an deren einem immer noch der Hut hing, vor der Brust übereinander.
»Nun, Madame, sie wird sich bald ganz Wohl befinden, hoffe ich,« erwiderte Mr. Chillip, »so wohl, als wir von einer jungen Mutter und unter so betrübten häuslichen Umständen erwarten können. Es steht gar nichts im Wege, wenn Sie sie jetzt besuchen wollen, Madame. Es dürfte ihr gut tun.«
»Und sie? Wie geht es ihr?« sagte meine Tante kurz.
Mr. Chillip legte den Kopf noch ein wenig mehr auf die eine Seite und sah meine Tante an wie ein gezähmtes Vögelchen.
»Das Kind, das Mädchen«, sagte meine Tante. »Was macht es?«
»Madame,« erwiderte Mr. Chillip, »ich glaubte, Sie wüßten es schon. Es ist ein Junge.«
Meine Tante sagte kein Wort, sondern packte ihren Hut wie eine Schleuder beim Bande, führte damit einen Streich gegen Mr. Chillips Kopf, stülpte den Hut auf und verschwand und kam nicht wieder. Sie verschwand wie eine beleidigte Fee oder wie eines jener übernatürlichen Wesen, die ich dem Volksglauben nach zu schauen die Gabe hatte, und kehrte nie wieder zurück.
Nein. Ich lag in meinem Korbe, und meine Mutter lag in ihrem Bette. Aber Betsey Trotwood Copperfield war für immer hinüber geschwunden in das Land der Träume und Schatten, in jene geheimnisvolle Region, aus der ich vor so kurzer Zeit gekommen war; und das Licht, das durch das Fenster unseres Zimmers hinausschien, erleuchtete den irdischen Bezirk unserer Mitpilger aus diesen Gefilden und schien auf den Hügel über dem Staube und der Asche dessen, ohne den ich nie gewesen wäre.
Zweites Kapitel.
Ich beobachte.
Die ersten Gegenstände, die deutlich vor meinem Geiste erscheinen, wenn ich weit zurück in das Dunkel meiner ersten Kinderjahre blicke, sind meine Mutter mit ihrem schönen Haar und der jugendschlanken Gestalt, und Peggotty ohne alle Figur und mit so dunkeln Augen, daß sie alles in ihrer Nähe zu verdunkeln schienen, und mit so roten und drallen Backen und Armen, daß es mich wunderte, warum die Vögel nicht lieber daran als an den Äpfeln pickten.
Ich glaube die beiden noch heute in nächster Nähe von mir zu sehen, wie sie sich klein machten oder auf den Boden hinkauerten, wählend ich mit taumelnden Schütten von der einen zur andern trippelte. ^
Ich habe auch noch einen dunkeln Eindruck behalten, den ich von wirklicher Erinnerung nicht unterscheiden kann, eine Vorstellung von Peggottys Zeigefinger, den ich anfaßte und der von der Nadel so rauh war wie ein kleines Muskat-Reibeisen.
Das beruht vielleicht auf Einbildung, obgleich ich meine, daß das Gedächtnis der meisten Menschen in eine viel fernere Kinderzeit zurückreicht, als man gewöhnlich annimmt, ebenso wie ich glaube, daß die Beobachtungsgabe bei vielen kleinen Kindern an Schärfe und Genauigkeit ganz wunderbar ist. In der Tat bin ich der Ansicht, daß die meisten Erwachsenen, die sich in dieser Beziehung auszeichnen, richtiger gesagt, jene Gabe nur nicht verloren, aber sich diese später nicht angeeignet haben, um so mehr, als man an jenen Leuten eine gewisse Frische, Liebenswürdigkeit und Genußfähigkeit bemerkt die auch ein aus ihrer Kindheit herübergerettetes Erbteil find.
Vielleicht gerate ich mit dieser Bemerkung in den Verdacht des Abschweifens, aber sie läßt mich doch sagen, daß ich diese Schlüsse zum gewissen Teil auf meine eigene Erfahrung aufbaue, und, wenn aus irgend etwas in dieser Erzählung hervorgeht, daß ich ein scharf beobachtendes Kind war und als Mann ein lebhaftes Gedächtnis an meine Kindheit bewahrt habe, daß ich fraglos Anspruch auf diese beiden Eigenschaften erhebe.
Wenn ich also in das früheste Kindheitsdunkel zurückblicke, so sondern sich aus dem Wirrwarr von allerlei Dingen zunächst die beiden Gestalten meiner Mutter und Peggottys ab. Was weiß ich sonst noch? Wir wollen einmal sehen. –
Da taucht aus dem Nebel der Erinnerung unser Haus in seiner, mir von frühester Erinnerung her vertrauten Gestalt hervor. Im Erdgeschoß ist Peggottys Küche, die auf den Hinterhof hinausgeht, wo in der Mitte ein Taubenhaus auf einer Stange steht, aber ohne Tauben, eine große Hundehütte in einer Ecke, aber kein Hund darin, und eine, Anzahl Hühner, die mir schrecklich groß vorkamen, stolzierten drohenden und wilden Wesens darin herum. Ein Hahn fliegt auf einen Pfosten, um zu krähen, und scheint sein Auge ganz besonders auf mich zu werfen, wie ich ihn durch das Küchenfenster ansehe, und darüber zittere ich vor Furcht, weil er so kampflustig aussieht. Von den Gänsen draußen am Seitentürchen, die mir mit lang ausgestreckten Hälsen nachwatscheln, wenn ich vorbeigehe, träume ich nachts, wie ein Mann, der in der Nähe von wilden Tieren lebt, von Löwen träumen mag. Dann ist da ein langer Gang – in meiner Erinnerung eine endlose Perspektive – der von Peggottys Küche nach der vorderen Haustür führt. Eine dunkle Vorratskammer mündet auf diesen Gang – wo ich nachts stets nur vorbeihusche, denn wer weiß was hinter diesen Krügen, Tonnen und alten Teekisten stecken mochte, wenn niemand mit einer matt leuchtenden Kerze darin ist – und eine dumpfige Luft strömt heraus, in der sich der Geruch von Seife, Pickles, Pfeffer, Lichtem und Kaffee vermischt. Dann sind unten die beiden Wohnzimmer: das eine, in dem wir, meine Mutter, ich und Peggotty, abends sitzen – denn Peggotty leistet uns Gesellschaft, wenn sie ihre Arbeit gemacht hat und wir allein sind – und das gute Zimmer, wo wir Sonntags sitzen – feierlich, aber nicht so traulich. Für mich hat dies Zimmer etwas Wehmütiges, denn Peggotty hat mir erzählt – ich weiß nicht mehr wann, aber es muß lange, lange her sein – wie mein Vater begraben wurde und hier die Leichenträger ihre schwarzen Mäntel umhingen. Und eines Sonntags abends liest meine Mutter Peggotty und mir vor, wie Lazarus auferstand von den Toten. Und ich ängstige mich so sehr darüber, daß sie mich aus dem Bette herausnehmen und mir aus dem Schlafzimmerfenster den stillen Kirchhof zeigen müssen, wo die Toten alle in feierlichem Mondlicht friedlich im Grabe ruhen.
Kein Grün dünkte mir jemals so grün wie das Gras auf diesem Kirchhofe, keine andern Bäume auch nur halb so schattig, und nichts so lautlos still wie die Grabsteine dort. Wenn, ich frühmorgens in meinem Bettchen knie, das in einer Wandnische in der Schlafstube meiner Mutter steht, so sehe ich die Schafe dort grasen, und die Morgenröte die Sonnenuhr bestrahlen, und ich denke im geheimen: Ob sie sich wohl freut, wieder einen Tag verkünden zu können?
Da ist unser Kirchenstuhl. Was er für eine hohe Lehne hat! Und ein Fenster ist in seiner Nähe, durch das man unser Haus sehen kann; und wie oft während des Frühgottesdienstes sieht Peggotty hinüber, ob sich keine Diebe einschleichen oder kein Feuer ausbricht. Aber obschon sie ihre Augen fleißig herumschweifen läßt, nimmt sie es doch sehr übel, wenn ich es so mache und steht mich stirnrunzelnd an, wenn ich auf meinen Sitz steige, um den Geistlichen anzuschauen. Aber ich kann ihn doch nicht immer anschauen – ich kenne ihn ja ohne das weiße Zeug da, das er anhat, und fürchte, daß er sich wundert, warum ich ihn so anstarre, und er dann am Ende gar seine Predigt unterbricht und mich fragt, warum ich das täte – und – was soll ich dann tun? Das Herumgaffen ist wahrhaftig nicht hübsch – aber ich muß doch etwas tun! Ich sehe meine Mutter an: sie tut, als ob sie mich nicht sähe. Ich schaue nach einem Knaben auf dem Chore: der schneidet mir Gesichter. Ich sehe das Sonnenlicht zur offenen Kirchenpforte hereinfallen und ein einzelnes verirrtes Schaf davor, ich meine keinen Sünder damit, sondern einen Hammel, der nicht übel Lust verrät, der Kirche einen Besuch abzustatten. Ich muß fortsehen, denn es ist mir ganz so, als müßte ich laut zu ihm sprechen, und dann – wehe mir! Ich sehe nach den steinernen Gedächtnistafeln an der Wand und bemühe mich an das verstorbene Mitglied dieser Gemeinde Mr. Bodgers zu denken, und an Ms. Bodgers’ Trauer, »denn gar schwerer Krankheit Walten hat er christlich ausgehalten; hilflos war der Arzte Kunst.« Ich überlegte, ob sie Mr. Chillip gehabt hätten, und ob der auch »hilflos« gewesen, und ob es ihm lieb ist, allsonntaglich daran erinnert zu werden? Von Mr. Chillip mit seiner Sonntagskrawatte sehe ich wieder zur Kanzel empor und denke, was das für ein schöner Spielplatz wäre, was für eine feine Burg, um sie zu verteidigen, wenn ein anderer Junge die Stufen zum Angriff hinaufstürmte, und ich ihm das Samtkissen mit den Troddeln an den Kopf werfen könnte. Allmählich schließen sich meine Augen, ich glaube in der Schwüle den Geistlichen noch in schläfrigem Tone ein einschläferndes Lied singen zu hören, und dann höre ich nichts mehr, bis ich mit lautem Gepolter von meinem Sitze falle und von Peggotty, mehr tot als lebendig, aufgehoben werde. Und jetzt sehe ich die Außenseite unseres Hauses mit den offenen Jalousien des Schlafzimmers, damit die herrlich duftende Luft hinein kann, und im Hintergrunde des vorderen Gartens immer noch in den hohen Ulmen die zerfetzten alten Krähennester hängen. Jetzt bin ich in dem Garten hinter dem Hofe mit dem leeren Taubenhaus und der Hundehütte – ein wahrer Park für Schmetterlinge, wo die Früchte dicht gedrängt und reifer und schöner, als ich sie irgendwo gesehen, an den Zweigen hängen, und wo meine Mutter in ein Körbchen Obst pflückt, während ich dabei stehe und heimlich ein paar entwendete Stachelbeeren rasch in den Mund stecke, und mich bemühe, ein unschuldiges Gesicht zu machen. Ein starker Wind erhebt sich, und in einem Augenblick ist der Sommer verweht. Wir spielen in dem Winterzwielicht und tanzen in der Stube herum. Wenn meine Mutter außer Atem ist und in einem Lehnstuhle ausruht, so sehe ich, wie sie ihre schönen Locken um den Finger wickelt und das Leibchen glatt zieht, und niemand weiß so gut wie ich, daß sie sich freut, so wohl auszusehen, und stolz ist, so hübsch zu sein.
Das sind so einige meiner frühesten Eindrücke, das und ein Bewußtsein, daß wir uns beide ein wenig vor Peggotty fürchteten und in den meisten Dingen ihrer Meinung folgten, war einer meiner Schlüsse – wenn man es so nennen kann – die ich aus dem zog, was ich sah.
Peggotty und ich saßen eines Abends allein in der Wohnstube vor dem flackernden Kamin. Ich hatte Peggotty von Krokodilen vorgelesen, und ich muß mit sehr vielem Ausdruck gelesen haben, oder das arme Ding muß sehr wenig interessiert gewesen sein, denn ich erinnere mich, als ich fertig war, hatte sie so eine Idee, daß Krokodile eine Art Gemüse wären. Darauf war ich des Lesens müde und sehr schläfrig, aber da ich besonderer Ursache halber Erlaubnis hatte, aufzubleiben, bis meine Mutter von einem Abendbesuche nach Hause kam, so wäre ich natürlich lieber auf meinem Posten gestorben, als zu Bett gegangen. Ich hatte jetzt jenen Grad von Schläfrigkeit erreicht, wo Peggotty mir immer größer und größer zu werden schien. Ich hielt meine Augenlider mit den beiden Zeigefingern offen und sah sie fest und lang an, wie sie auf ihrem Stuhle saß und unermüdlich arbeitete, sah dann das kleine Stückchen Wachslicht an, mit dem sie ihren Zwirn wichste – das ganz mit Rillen und Furchen durchackerte Wachsklümpchen! – sah das strohgedeckte Häuschen an, worin ihr Ellenbandmaß wohnte, ihr Arbeitskastchen mit dem Schiebedeckel, worauf die St. Paulskirche (die Kuppel rosenrot!) gemalt war, dann ihren messingenen Fingerhut und endlich sie selbst, die mir gar lieblich vorkam. Ich war so schläfrig, daß ich fühlte, so wie ich nur einen Augenblick meine Augen abwendete, würde ich einschlafen.
»Peggotty,« fragte ich plötzlich, »bist du einmal verheiratet gewesen?«
»Herjeh, Master Davy«, entgegnete Peggotty. »Wie kommst du aufs Heiraten?«
Sie fuhr bei meiner Frage so überrascht auf, daß ich darüber ganz wach wurde. Dann hielt sie aber im Nähen inne und sah mich an, indem sie den Faden, so lang er war, straff anzog.
»Aber bist du einmal verheiratet gewesen, Peggotty?« fragte ich. »Du bist doch sehr hübsch, nicht wahr?«
Allerdings war ihr Typus ein anderer als der meiner Mutter; aber in einer andern Art von Schönheit hielt ich sie für ein vollkommenes Muster, In unserer Putzstube war nämlich ein Fußbänkchen von rotem Samt, auf das meine Mutter einen Strauß gemalt hatte. Dieser Samt und Peggottys Teint schienen mir zum Verwechseln gleich zu sein, Die Fußbank freilich war glatt und weich, und Peggotty war rauh, aber das machte keinen Unterschied.
»Ich hübsch, Davy?« sagte Peggotty. »Ach du meine Güte, liebes Kind! Aber wie kommst du nur aufs Heiraten?«
»Ich weiß nicht! – Aber du darfst nicht mehr als einen auf einmal heiraten, nicht wahr, Peggotty?« »Gewiß nicht«, sagte Peggotty mit sicherer Entschiedenheit.
»Aber wenn du jemand heiratest und der jemand stirbt, dann kannst du einen andern heiraten, nicht wahr, Peggotty?«
»Man kann, wenn man Lust hat, liebes Kind«, sagte Peggotty. »Das ist Meinungssache.«
»Aber was ist deine Meinung, Peggotty?« sagte ich und blickte sie bei dieser Frage neugierig an, weil sie mich so forschend ansah.
»Meine Meinung ist,« sagte Peggotty, als sie nach einiger Unschlüssigkeit ihre Augen von mir abgewendet und wieder zu arbeiten angefangen hatte, »daß ich niemals verheiratet gewesen bin, Master Davy, und daß ich nicht glaube, jemals zu heiraten. Weiter kann ich nichts darüber sagen.«
»Du bist doch nicht böse, Peggotty?« sagte ich, nachdem ich ein Weilchen still dagesessen hatte.
Ich glaubte wirklich, daß sie es wäre, denn so kurz war sie gewesen, aber ich irrte mich ganz und gar, sie legte ihre Arbeit (einen ihrer Strümpfe) beiseite, öffnete ihre Arme, nahm meinen lockigen Kopf und drückte ihn derb an sich. Daß sie mich derb herzhaft an sich drückte, weiß ich, denn da sie sehr wohlbeleibt war, so pflegten stets, wenn sie ganz angekleidet eine kleine Anstrengung machte, ein paar Knöpfe hinten von ihrem Rocke abzuspringen. Und ich besinne mich, daß diesmal zwei in die andere Ecke des Zimmers flogen, wahrend sie mich umarmte.
»Na, nun lies mir noch etwas von den Korkodilliens vor,« sagte Peggotty, »denn ich habe noch lange nicht genug davon.«
Ich begriff damals nicht, warum Peggotty so versessen auf ihre Korkodilliens war, aber mit neuer Frische meinerseits kehrten wir also zu den Ungeheuern zurück, ließen sie ihre Eier in den Sand legen und von der Sonne ausbrüten, rissen vor ihnen aus, entrannen ihnen durch plötzliches Umwenden, was sie wegen ihrer Ungelenkigkeit nicht rasch tun konnten, verfolgten sie als Eingeborene bis ins Wässer, steckten ihnen scharf zugespitzte Stücke Holz in den Rachen: kurz und gut, wir nahmen die Krokodile von A bis Z durch. Ich wenigstens tat es, aber über Peggotty hatte ich meinen Zweifel, denn sie stach mit ihrer Nadel gedankenvoll in verschiedene Teile ihres Gesichts und ihrer Arme.
Nachdem wir mit den Krokodilen fertig waren, hatten wir mit den Alligatoren angefangen, als es am Gartentür klingelte. Wir gingen hinaus, und draußen stand meine Mutter, die mir ungewöhnlich hübsch vorkam, und neben ihr ein Herr mit schönem schwarzen Haar und schwarzem Backenbart, der uns schon am vorigen Sonntag aus der Kirche nach Hause begleitet hatte.
Als meine Mutter auf der Schwelle stehen blieb und mich in ihre Arme nahm und küßte, sagte der Herr, ich sei glücklicher als ein Fürst oder etwas ähnliches. Denn ich merke, hier kommt mir mein späteres Verständnis zu Hilfe.
»Was heißt das?« fragte ich ihn über ihre Schulter hinweg.
Er klopfte mich auf den Kopf, aber ich konnte weder ihn noch seine tiefe Baßstimme leiden, und es erregte meine Eifersucht, daß seine Hand mich anfaßte und dabei gleichzeitig die meiner Mutter berührte. Und ich schob sie hinweg, so weit ich’s vermochte.
»Aber Davy!« ermahnte meine Mutter.
»Der liebe Junge!« sagte der Herr. »Ich kann seine Zärtlichkeit schon begreifen.« , .
Noch nie hatte ich meiner Mutter Antlitz so schön erröten sehen. Sie schalt mich sanft aus wegen meiner Unfreundlichkeit, und sprach, indem sie mich dicht an sich hielt, ihren Dank gegen den Herrn aus, daß er so gütig gewesen war, sie nach Hause zu begleiten. Sie reichte ihm ihre Hand, und als er sie nahm, kam es mir vor, als ob sie mich von seitwärts her rasch anblickte.
»Nun laß auch uns gute Nacht sagen, mein kleiner Mann«, sagte der Herr zu mir, nachdem er sich–ich sah es ganz deutlich – über den zierlichen Handschuh meiner Mutter gebeugt hatte.
»Gute Nacht!« sagte ich.
»Komm! Wir müssen die besten Freunde von der Welt werden!« sagte er lachend. »Gib mir die Hand!« Meine rechte Hand lag in der linken meiner Mutter, deshalb gab ich ihm die andere.
»Das ist ja aber die falsche Hand, Davy!« sagte der Herr lachend.
Meine Mutter zog meine rechte Hand hervor, aber ich war entschlossen sie ihm nicht zu geben; und tat es auch nicht. Ich reichte ihm die andere, er schüttelte sie kräftig und sagte, ich sei ein wackerer Junge, und ging fort.
Noch jetzt sehe ich ihn, wie er sich in der Gartentür umdrehte und uns noch einmal mit seinen unangenehmen schwarzen Augen ansah, ehe sich das Gitter hinter ihm schloß,
Peggotty, die kein Wort gesprochen und keinen Finger gerührt hatte, schob sofort den Riegel vor, und wir gingen alle in das Wohnzimmer. Anstatt sich wie gewöhnlich in den Lehnstuhl neben das Feuer zu setzen, blieb meine Mutter heute am andern Ende des Zimmers stehen, und sang dabei leise vor sich hin.
»Hoffentlich haben Sie einen angenehmen Abend verlebt, Ma’am«, sagte Peggotty, die so steif wie ein Stock in der Mitte des Zimmers stand und einen Leuchter in der Hand hielt.
»Ich danke, Peggotty«, erwiderte meine Mutter mit sehr heiterer Stimme. »Ich habe einen sehr angenehmen Abend verlebt.«
»Etwas Fremdes gibt eine angenehme Abwechselung«, bemerkte Peggotty.
»Eine sehr angenehme Abwechselung, gewiß«, entgegnete meine Mutter.
Da Peggotty regungslos in der Mitte des Zimmers stehen blieb, meine Mutter wieder zu singen anfing, schlief ich ein, obgleich ich nicht so fest schlief, daß ich nicht Stimmen hören konnte, wiewohl ich nicht verstand, was sie sagten. Als ich aus diesem unbehaglichen Schlummer halb erwachte, sah ich, daß Peggotty und meine Mutter in großer Aufregung miteinander sprachen und dabei weinten.
»So einer wie dieser hätte Mr. Copperfield nicht gefallen«, behauptete Peggotty. »Das sage ich und das schwöre ich!«
»Guter Gott,« rief meine Mutter, »du wirst mich noch zur Verzweiflung treiben! Ist jemals ein armes Mädchen von ihrem Dienstboten so mißhandelt worden! Aber warum tue ich mir das Unrecht, mich ein Mädchen zu nennen? Bin ich niemals verheiratet gewesen, Peggotty?«
»Gott weiß, daß es wahr ist, Ma’am«, entgegnete Peggotty.
»Wie kannst du dann wagen,« sagte meine Mutter – »das heißt, ich meine nicht, wie du es wagen kannst, Peggotty, sondern wie du es auch nur übers Herz bringen kannst, mir solches Unbehagen zu bereiten und so böse Worte zu sagen, da du doch recht gut weißt, daß ich draußen auf der ganzen Welt keinen einzigen Freund habe.«
»Um so mehr habe ich Grund zu sagen, daß es nicht geht«, entgegnete Peggotty. »Nein, es geht nicht, nein; um keinen Preis, nein, nein!« – Ich glaube wahrhaftig, Peggotty wollte den Leuchter hinschleudern, so dramatisch deklamierte sie damit.
»Wie kannst du mich nur so ärgern,« sagte meine Mutter und fing von neuem an zu weinen, »und mich so ungerecht verklagen? Wie kannst du reden, als ob alles schon abgemacht wäre, Peggotty, wenn ich dir immer und immer wieder sage, du böses Mädchen, daß außer den gewöhnlichsten Höflichkeiten nichts vorgefallen ist? Du sprichst von Bewunderung – was soll ich tun? Wenn Leute so töricht sind, Bewunderung zu fühlen, ist das meine Schuld? Was soll ich dagegen tun, frage ich dich? Soll ich mir etwa das Haar abscheren lassen, soll ich mir das Gesicht schwärzen, oder mich mit einem Brandfleck oder heißem Wasser oder etwas ähnlichem verunstalten? Ich glaube, du könntest das verlangen, Peggotty, ja ich glaube, du würdest dich noch darüber freuen.«
Peggotty schienen diese Zumutungen nicht sonderlich zu Herzen zu gehen.
»Und mein lieber Bubi,« rief meine Mutter und kam an meinen Stuhl und liebkoste mich, »mein lieber kleiner Davy! Willst du etwa sagen, es fehle mir an Liebe für mein kostbares Goldkind, für den besten kleinen Buben auf der Welt?«
»Kein Mensch hat jemals an so etwas gedacht«, sagte Peggotty.
»Du hast es getan, Peggotty!« gab meine Mutter zurück. »Ich weiß, daß du es gemeint hast! Was anders soll ich aus deinen Worten entnehmen, du böses Mädchen, da du doch recht gut weißt, daß ich mir nur seinetwegen im letzten Vierteljahr keinen neuen Sonnenschirm kaufen wollte, obgleich der alte grüne obenherum ganz schlecht ist und die Fransen entzwei sind: Das weißt du, Peggotty, und das kannst du nicht leugnen!« Dann wendete sie sich zärtlich an mich, schmiegte ihre Wange an die meine und sagte: »Bin ich eine böse Mama, Davy? Bin ich eine hartherzige, selbstsüchtige, schlechte Mama? Sage ja, Kind, sage ja, liebes Herz, dann wird dich Peggotty lieben und Peggottys Liebe ist viel, viel besser, als die meine, Davy. Ich liebe dich ja gar nicht, nicht wahr?«
Bei diesen Worten fingen wir alle zu weinen an, und soviel ich mich besinnen kann, war ich der lauteste von den dreien, aber wir meinten es sicherlich alle drei gleich aufrichtig. Ich war wie aufgelöst, und ich glaube, daß ich in den ersten Aufwallungen verletzter Zärtlichkeit Peggotty ein Scheusal nannte. Ich besinne mich noch, wie das gute Mädchen in die tiefste Betrübnis geriet und bei dieser Gelegenheit alle ihre Knöpfe verloren haben muß, denn eine ganze Ladung davon sprang ins Zimmer, als sie, nach Versöhnung mit meiner Mutter vor meinen Stuhl hinkniete und das gleiche mit mir tat.
Wir gingen alle sehr niedergeschlagen zu Bett. Mein Schluchzen hielt mich noch lange Zeit wach, und als mich ein starker Seufzer im Bette ordentlich in die Höhe hob, sah ich, daß meine Mutter auf dem Gestell saß und sich über mich beugte. Ich schlummerte nun in ihren Armen ein und schlief fest.
Ob ich, schon am folgenden Sonntag den Herrn wieder sah oder ob ein größerer Zeitraum dazwischen lag, dessen kann ich mich nicht mehr entsinnen. In der Zeitrechnung bin ich nicht ganz zuverlässig. Aber er war wieder in der Kirche und begleitete uns dann nach Hause, Er kam auch in die Stube, um sich ein schönes Geranium anzusehen, das im Fenster stand. Er schien es nicht besonderer Aufmerksamkeit zu würdigen, aber ehe er uns verließ, bat er meine Mutter, ihm eine Blüte davon zu geben. Sie sagte, er solle sich selbst eine aussuchen, aber das wollte er nicht – ich konnte nicht begreifen, warum – und so pflückte sie eine Blüte ab und gab sie ihm. Er sagte, er werde sich nun und niemals von ihr trennen, und ich dachte, er müsse ein rechter Narr sein, um nicht zu wissen, daß die Blätter in ein oder zwei Tagen verwelkt sein würden.
Peggotty fing jetzt an, uns abends weniger oft Gesellschaft zu leisten als früher. Meine Mutter besprach zwar mancherlei mit ihr – viel mehr als gewöhnlich, wie mir schien – und wir vertrugen uns vortrefflich, aber es war doch zwischen uns dreien anders geworden, und wir befanden uns nicht mehr so behaglich wie früher. Manchmal kam es mir vor, Peggotty habe etwas dagegen, daß meine Mutter jetzt immer ihre besten Kleider hervorholte und anzog, die in ihrem Kleiderschränke hingen, dann wieder, daß ihr Mutters häufige Besuche in der Nachbarschaft zuwider waren: doch ich konnte mir nicht klar darüber werden, was es eigentlich war.
Allmählich gewöhnte ich mich an den Anblick des Herrn mit dem schwarzen Backenbart. Er gefiel mir nicht besser als von Anfang an, und ich fühlte immer noch in bezug auf ihn dieselbe unbestimmte Eifersucht. Aber wenn ich überhaupt einen Grund dafür hatte, abgesehen von instinktiver kindischer Abneigung, und von der allgemeinen Überzeugung, daß Peggotty und ich meine Mutter auch ohne fremde Hilfe beherrschen konnten: jedenfalls geschah es nicht aus dem Grunde, den ich herausgefunden hatte, wenn ich älter gewesen wäre. Das kam mir nie, auch nicht im entferntesten in den Sinn. Ich vermochte meine Beobachtungen gewissermaßen nur stückweise anzustellen, doch aus diesen Bruchstücken ein Netz zu machen und darin irgendeinen zu fangen, das ging noch über meine Kräfte.
An einem Herbstmorgen war ich mit meiner Mutter in dem Garten vor dem Hause, als Mr. Murdstone (ich kannte ihn jetzt unter diesem Namen) vorbeigeritten kam. Er hielt sein Pferd an, um meine Mutter zu begrüßen, und sagte, er ritte nach Lowestoft, um einige Freunde zu besuchen, die dort eine Jacht hätten, und machte scherzend den Vorschlag, mich vor sich aus den Sattel zu nehmen, wenn ich an dem Ritt Gefallen fände.
Das Wetter war so wunderschön und die Luft so milde, und dem Pferde selbst schien die Aussicht auf den Ritt sehr zu gefallen, weil es schnaubend und stampfend vor der Gartentür stand, daß ich große Lust fühlte, mitzureiten. Die Mutter schickte mich daher mit Peggotty hinauf, Um Schmuck gemacht zu werden, und unterdessen stieg Mr. Murdstone ab und ging, die Zügel über den Arm geworfen, langsam vor der Hagebuttenhecke auf und ab, während meine Mutter ihm zur Gesellschaft auf der inneren Seite mit ihm Schritt hielt. Ich erinnere mich noch, wie Peggotty und ich aus meinem kleinen Fenster auf sie hinabguckten, ich besinne mich auch noch, wie eifrig sie bei ihrem Spaziergange in den Hagebuttenbusch spähten, und wie Peggotty, die vorher in der besten Laune gewesen war, plötzlich ganz ärgerlich wurde und mein Haar recht derb gegen den Strich bürstete.
Mr. Murdstone und ich waren bald unterwegs und trabten auf dem grünen Rasenstreifen neben der Landstraße dahin. Er hielt mich leicht mit einem Arm umfaßt, und ich glaube nicht, daß ich besonders unruhig war; aber ich konnte mich nicht entschließen, vor ihm sitzen zu bleiben, ohne den Kopf umzuwenden und ihm ins Gesicht zu sehen. Er hatte jene Art von seichten schwarzen Augen– ich habe kein besseres Wort für ein Auge, das keine Tiefe hat, in die man hineinblicken könnte – die durch ein eigentümliches Spiel des Lichts zu schielen scheinen, wenn sie nachsinnend blicken. Mehrmals, wenn ich ihn ansah, bemerkte ich mit einer Art Scheu diesen Blick, und fragte mich, worüber er wohl nachdenken möge. Sein Haupthaar und sein Bart waren, in der Nähe betrachtet, noch schwärzer und dichter, als ich je geglaubt hätte. Die eckigstarken Kinnladen und die bläulichen Schatten, die von dem sorgfältig rasierten Barte übrig blieben, erinnerten mich an eine Wachsfigur, die vor einem halben Jahre in unserer Gegend gezeigt worden war. Dieses, seine regelmäßigen Augenbrauen und das schöne Weiß, Schwarz und Braun seines Teints – verwünscht sei sein Teint und sein Gedächtnis! – all dieses machte, daß ich ihn trotz meiner bangen Ahnungen für einen sehr schönen Mann hielt. Ich bezweifle gar nicht, daß meine arme Mutter ganz derselben Meinung war.
Wir gingen nach einem am Meere belegenen Gasthofe, wo zwei Herren in einem eigenen Zimmer Zigarren rauchten. Jeder von ihnen räkelte sich auf mindestens vier Stühle hingestreckt und hatte eine zottige Matrosenjacke an. In einem Winkel lagen auf einem Haufen übereinander Überröcke und Schifferjacken und eine Flagge,
Sie stolperten beide schwerfällig in die Höhe, als wir eintraten, und riefen: »Holla, Murdstone! Wir dachten, Ihr wäret tot!«
»Noch nicht«, sagte Mr. Murdstone.
»Und wer ist dieser kleine Mann?« sagte einer der Herren, und faßte mich beim Arme.
»Das, ist Davy«, gab Mr. Murdstone zur Antwort.
»Davy Wer?« sagte der Herr. »Jones?«
»Copperfield«, sagte Mr. Murdstone.
»Was? ein Sprößling der himmlischen Mrs. Copperfield?« rief der Hell. »Von der reizenden kleinen Witwe?«
»Quinion, sagte Mr. Murdstone, »bitte mit Vorsicht, Jemand ist schlau.« ^
»Wer?« fragte der Herr lachend. Ich blickte rasch auf, denn ich war neugierig es zu erfahren.
»Ach, nur Brooks von Sheffield«, sagte Mr. Murdstone.
Ich fühlte mich ordentlich erleichtert, als ich erfuhr, daß es nur Brooks von Sheffield sei, denn anfangs glaubte ich wirklich, man meine mich.
Mr. Brooks von Sheffield schien aber außerordentlich komische Erinnerungen zu erregen, denn beide Herren lachten recht Herzlich, als sie seinen Namen hörten, und auch Mr. Murdstone amüsierte sich köstlich darüber. Nach einigem Lachen sagte der Herr, den er Quinion genannt hatte:
»Und was ist des Mr. Brooks von Sheffield Meinung über das beabsichtigte Geschäft?«
»Hm! Ich weiß nicht, ob Brooks vorderhand viel davon weiß,« entgegnete Mr. Murdstone; »aber ich glaube im allgemeinen ist er dem Plan nicht besonders günstig.«
Darüber wurde viel gelacht, und Mr. Quinion sagte, er wolle nach Sherry klingeln, um auf Brooks Gesundheit zu trinken. Das tat er, und als der Wein kam, schenkte er mir ein Gläschen voll ein, hieß mich aufstehen und vor dem Trinken sagen: »Daß dich der Deixel – Brooks von Sheffield!« Der Toast wurde mit großem Beifall und so schallendem Gelächter aufgenommen, daß ich selbst mitlachen mußte, worüber sie noch mehr lachten. Kurz, wir waren sehr vergnügt miteinander.
Wir gingen danach auf den Klippen des Strandes spazieren und fetzten uns ins Gras und guckten nach verschiedenen Dingen durch das Teleskop – ich konnte nichts sehen, als sie es mir vor das Auge hielten, obgleich ich so tat – und dann kehrten wir nach, dem Gasthofe zurück, um zeitig zu Mittag zu essen. Während unseres Spazierganges rauchten die beiden Herren in einem fort – was sie, nach dem Dufte ihrer Schifferjacken zu urteilen, unaufhörlich seit dem Tage getan haben mußten, an dem sie die Jacken vom Schneider erhielten. Ich darf auch nicht zu berichten vergessen, daß wir die Jacht besuchten, wo sie alle drei in die Kajüte hinabgingen und sich mit einigen Papieren zu tun machten. Ich sah sie damit sehr eifrig beschäftigt, als ich durch das offene Lukenfenster hinabblickte. Diese ganze Zeit über ließen sie mich in Gesellschaft eines sehr netten Mannes mit einem starken Schopf roter Haare und einem sehr kleinen lackierten Hut darauf; er trug ein buntgestreiftes Hemd, mit dem Worte »Seemöve« in großen Buchstaben quer über die Brust. Ich glaubte, es sei sein Name und er schreibe ihn auf die Brust, weil er auf dem Schiffe wohnte und daher seinen Namen an keine Haustür schlagen könnte; als ich ihn aber Mr. Seemöve nannte, sagte er, das Schiff heiße so.
Den ganzen Tag über bemerkte ich, daß Mr. Murdstone ernster und gesetzter war, als die andern beiden Herren. Diese waren sehr lustig und ungeniert; sie trieben ihren Scherz miteinander, aber selten mit ihm. Er schien mir klüger und kälter als sie, und sie mochten ihn ziemlich mit denselben Gefühlen einer gewissen Scheu betrachten wie ich. Auch kann ich mich nicht erinnern, daß Mr. Murdstone den ganzen Tag über gelacht hätte, außer über den Witz mit Brooks von Sheffield – und das war, beiläufig gesagt, sein eigener Witz.
Zeitig gegen Abend traten wir wieder den Heimweg an. Es war ein sehr schöner Abend, und meine Mutter und er machten einen zweiten Spaziergang am Hagebuttenstaket, während sie mich zum Tee hinauf schickte. Als er fort war, fragte mich meine Mutter begierig aus über das, was ich den Tag über gesehen und gehört hätte. Ich erzählte, was sie über sie geäußert hatten, und sie lachte und sagte, es wäre unverschämtes, junges Volk, das Unsinn schwatze, – aber ich wußte, daß es ihr Vergnügen machte; ich wußte es damals gerade so gut wie jetzt. Darauf fragte ich sie, ob sie einen gewissen Mr. Brooks von Sheffield kenne, aber sie erwiderte, nein, sie glaube indessen, es müsse wohl ein Stahlwarenfabrikant sein.
Soviel Grund ich auch habe, mich ihres nachmals so veränderten Gesichts, zu erinnern – kann ich sagen, daß es in seiner unschuldsvollen, mädchenhaften Schöne für immer dahin ist, wenn ich es jetzt noch so leuchtend klar vor mir stehen sehe, wie das des nächsten besten Menschen, der mir im Straßengewühl begegnet? Wenn ich noch jetzt den Hauch ihres Mundes auf meiner Wange zu verspüren glaube, wie ich ihn an jenem Abende verspürte? Darf ich sagen, daß sie sich je verändert hat, wenn sie mir meine Erinnerung immer nur so wieder ins Leben zurückruft und, treuer der Jugendliebe als ich oder ein Mann es je gewesen ist, die damals geliebte Gestalt noch immer festhält? …
Ich schildere sie mit denselben Zügen, wie sie war, als ich nach dieser Unterhaltung zu Bett gegangen war und sie noch einmal zu mir kam, um mir gute Nacht zu sagen. Sie kniete neben meinem Bett nieder, legte das Kinn auf ihre Hände und fragte lachend:
»Was sagten sie, Davy? Sage es noch einmal! Ich kann es nicht glauben,«
»Die Himmlische –« fing ich an.
Meine Mutter legte mir die Hand auf den Mund.
»Die Himmlische gewiß nicht«, sagte sie lachend. »Himmlisch kann es nicht gewesen sein, Davy. Das weiß ich jetzt ganz bestimmt, daß es nicht so ist!«
»Doch! Die Himmlische Mrs. Copperfield,« wiederholte ich standhaft, – »und reizend!«
»Nein, nein, reizend gewiß nicht, nicht reizend!« unterbrach mich meine Mutter und legte mir wieder die Hand auf den Mund.
»Und sie sagten es doch. ›Die reizende kleine Witwe!‹«
»Was für närrische, unverschämte Menschen!« rief meine Mutter lachend und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. »Wie lächerlich! Nicht wahr? Lieber Davy –«
»Ja, Ma.«
»Sage Peggotty nichts davon; sie könnte sonst böse auf die Herren werden. Ich bin auch sehr böse auf sie; aber es ist besser, Peggotty erfährt nichts davon.« Ich versprach es natürlich, wir küßten uns noch vielmals zur »Guten Nacht«, und bald lag ich in festem Schlafe.
Es kommt mir jetzt noch so vor, als ob mir Peggotty schon am Tage darauf den seltsamen Vorschlag gemacht hatte, den ich sogleich erzählen will; aber wahrscheinlich geschah es erst zwei Monate später.
Wir saßen wieder eines Abends, als meine Mutter auf Besuch war, in Gesellschaft mit dem Strumpfe, dem Ellenmaß, dem Stückchen Wachslicht und dem Arbeitskästchen mit der St. Paulskirche auf dem Deckel, und dem Krokodilenbuch, als Peggotty, nachdem sie mich mehrmals angeblickt und den Mund aufgetan hatte, als ob sie sprechen wollte, ohne dazu zu kommen – was ich für Gähnen hielt, sonst hätte es mich beunruhigt –endlich mit schmeichelnder Stimme sagte:
»Master Davy, wie wäre es denn, wenn du mit mir auf vierzehn Tage meinen Bruder in Darmouth besuchtest? Wäre das nicht herrlich?«
»Ist dein Bruder ein netter Mann, Peggotty?« fragte ich vorsichtigerweise.
»O was für ein netter Mann«, rief Peggotty und hielt die Hände in die Höhe. »Dann ist das Meer da und die Boote und Schiffe und die Fischer und der Strand und Ham als Spielkamerad –«
Ham war jener Neffe Peggottys, der schon in meinem ersten Kapitel vorgekommen ist, und den sie stets um seinen Anfangsbuchstaben verkürzte.
Ihre Aufzählung dieser Genüsse von Darmouth versetzte mich ganz in Aufregung, und ich erwiderte, daß es freilich herrlich wäre, aber was wohl die Mutter dazu sagen würde.
»Ich will eine Guinee wetten,« sagte Pegotty, mich dabei scharf prüfend, »daß sie uns Erlaubnis zur Reise gibt. Wenn du willst, frage ich sie, sobald sie nach Hause kommt.«
»Aber was soll sie machen, während wir dort sind?« sagte ich und stemmte meine kleinen Ellbogen auf den Tisch, um die Sache gründlich durchzusprechen. »Sie kann doch nicht allein bleiben!«
Wenn Peggotty ganz plötzlich nach einem Loche im Hacken des Strumpfes fahndete, so muß es wahrhaftig ganz, ganz klein und des Stopfens nicht wert gewesen sein,
»Peggotty! Ich sage, sie kann doch nicht allein bleiben!«
»O du meine Güte!« sagte Peggotty und sah mich endlich wieder an. »Weißt du es noch nicht? Sie geht auf vierzehn Tage zum Besuch zu Mrs. Grayper. Mrs. Grayper bekommt viele, viele Gäste.«
O! wenn sich die Sache so verhielt, dann war ich ganz bereit zur Reise. In der größten Ungeduld wartete ich, bis meine Mutter von Mrs. Grayper (denn das war die Nachbarin) nach Hause kam, um zu erfahren, ob sie mit dem hochfliegenden Plane einverstanden sei? Ohne so überrascht zu sein, wie ich erwartet hatte, ging meine Mutter bereitwillig darauf ein, und die Sache wurde diesen Abend noch abgemacht und festgesetzt, was an Wohnung und Kost für mich während der vierzehn Tage zu bezahlen sei.
Der Tag der Abreise kam bald. Er war so nahe angesetzt, daß er selbst für mich bald kam, obgleich ich von fieberhafter Ungeduld erfüllt war und fast fürchtete, ein Erdbeben oder ein feuerspeiender Berg oder der Eintritt einer andern großen Katastrophe könnte die Reise verhindern. Wir sollten mit einem Fuhrmann reisen, der immer morgens nach dem Frühstück abfuhr. Ich hätte viel Geld für die Erlaubnis gegeben, mich über Nacht in den Mantel wickeln und schon reisefertig mit Hut und Stiefeln schlafen zu dürfen.
Es rührt mir jetzt noch das Herz, obgleich ich es in kalten Worten erzähle, wenn ich daran denke, wie ungeduldig ich mich von dem glücklichen heimischen Herd wegsehnte und wie wenig ich ahnte, wieviel ich auf immer verlieren sollte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























