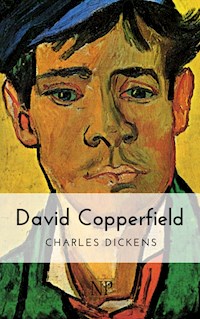
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
"David Copperfield" ist einer der bekanntesten Bildungsromane überhaupt. Viele Elemente der Geschichte folgen Ereignissen aus Dickens' eigenem Leben, "David Copperfield" gilt daher als der am stärksten autobiografisch geprägte Roman seines Gesamtwerkes. Dickens selbst bezeichnete "David Copperfield" als seine Lieblingsgeschichte. Erzählt wird die Lebensgeschichte von David Copperfield. Man erfährt von seinem Werdegang und langsamem Erwachsenwerden. Nach dem frühen Tod der Eltern wächst David bei seinem brutalen Stiefvater auf, schon mit 10 Jahren wird er zum Arbeiten in die Fabrik geschickt (auch hier Parallelen zu Dickens' Leben). Er flieht, um den unerträglichen Bedingungen zu entkommen. Die Erzählung lebt von den zahlreichen (berühmt gewordenen) Figuren, die seinen Weg kreuzen, ihn eine Zeit lang begleiten, verschwinden und wieder auftauchen. In bekannter Dickens-Manier - mit viel Witz in den Nebensätzen - bekommen die Hauptfiguren schließlich, was sie verdienen. Nur wenige Erzählfäden bleiben unaufgelöst. In diesen Zeilen zeigt sich Dickens' großartiges Können um die Schilderung von Erlebnissen und Gefühlen der Kindheit. Wie die meisten Werke Dickens' wurde auch "David Copperfield" zunächst als mehrteilige, monatliche Fortsetzungsgeschichte verfasst und später vom Autor überarbeitet. Dickens ist der trotz aller gelegentlichen Rührsamkeit königlichste englische Erzähler mit seinem gütigen Herzen und seiner prachtvollen Laune, von ihm müssen wir mindestens die Pichwickier und den Copperfield haben. [Quelle: Bibliothek der Weltliteratur] Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1545
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Charles Dickens
David Copperfield
Vollständige Fassung in zwei Bänden
Charles Dickens
David Copperfield
Vollständige Fassung in zwei Bänden
(The Personal History, Adventures, Experience & Observation of David Copperfield, the Younger)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · info@null-papier.deÜbersetzung: Gustav Meyer EV: Albert Langen Verlag, München, 1910 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-50-0
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Autor und Werk
Band 1
1. Kapitel – Ich komme zur Welt
2. Kapitel – Ich beobachte
3. Kapitel – Eine Veränderung
4. Kapitel – Ich falle in Ungnade
5. Kapitel – Man schickt mich fort
6. Kapitel – Ich erweitere den Kreis meiner Bekanntschaft
7. Kapitel – Mein erstes Semester in Salemhaus
8. Kapitel – Meine Ferien – Ein glücklicher Nachmittag
9. Kapitel – Ein denkwürdiger Geburtstag
10. Kapitel – Ich werde vernachlässigt, und man – bringt mich unter
11. Kapitel – Ich beginne ein Leben auf eigne Faust und finde keinen Gefallen daran
12. Kapitel – Da mir das Leben auf eigne Faust nicht gefällt, fasse ich einen großen Entschluss
13. Kapitel – Die Folgen meines Entschlusses
14. Kapitel – Meine Tante kommt zu einem Entschluss über mich
15. Kapitel – Ich fange wieder von vorn an
16. Kapitel – In mehr als einer Hinsicht bin ich ein Neuling in der Schule
17. Kapitel – Ein Mann taucht auf
18. Kapitel – Ein Rückblick
19. Kapitel – Ich halte die Augen offen und mache eine Entdeckung
20. Kapitel – Bei Steerforth
21. Kapitel – Die kleine Emly
22. Kapitel – Alte Umgebungen und neue Menschen
23. Kapitel – Ich sehe, dass Mr. Dick recht hatte, und wähle einen Beruf
24. Kapitel – Meine erste Ausschweifung
25. Kapitel – Gute und böse Engel
26. Kapitel – Ich gerate in Gefangenschaft
27. Kapitel – Tommy Traddles
28. Kapitel – Mr. Micawber wirft seinen Fehdehandschuh hin
29. Kapitel – Mein zweiter Besuch in Steerforths Haus
30. Kapitel – Ein Verlust
31. Kapitel – Ein noch größerer Verlust
Band 2
32. Kapitel – Der Anfang einer langen Reise
33. Kapitel – Wonne
34. Kapitel – Eine große Überraschung
35. Kapitel – Niedergeschlagenheit
36. Kapitel – Enthusiasmus
37. Kapitel – Eine kalte Dusche
38. Kapitel – Eine Trennung
39. Kapitel – Wickfield und Heep
40. Kapitel – Der Wanderer
41. Kapitel – Doras Tanten
42. Kapitel – Unheil
43. Kapitel – Wieder ein Rückblick
44. Kapitel – Unser Haushalt
45. Kapitel – Mr. Dick erfüllt die Prophezeiung meiner Tante
46. Kapitel – Nachricht
47. Kapitel – Marta
48. Kapitel – Häusliches
49. Kapitel – Ein Geheimnis hält mich in Atem
50. Kapitel – Mr. Peggottys Traum geht in Erfüllung
51. Kapitel – Der Anfang einer langen Reise
52. Kapitel – Ich wohne einer Explosion bei
53. Kapitel – Wieder ein Rückblick
54. Kapitel – Mr. Micawbers Geschäfte
55. Kapitel – Sturm
56. Kapitel – Die neue Wunde und die alte
57. Kapitel – Die Auswanderer
58. Kapitel – Unterwegs
59. Kapitel – Rückkehr
60. Kapitel – Agnes
61. Kapitel – Zwei interessante Reuige werden vorgeführt
62. Kapitel – Ein Lichtstrahl fällt auf meinen Weg
63. Kapitel – Ein Besuch
64. Kapitel – Ein letzter Rückblick
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
»David Copperfield« ist einer der bekanntesten Bildungsromane überhaupt. Viele Elemente der Geschichte folgen Ereignissen aus Dickens’ eigenem Leben, »David Copperfield« gilt daher als der am stärksten autobiografisch geprägte Roman seines Gesamtwerkes. Dickens selbst bezeichnete »David Copperfield« als seine Lieblingsgeschichte.
Erzählt wird die Lebensgeschichte von David Copperfield. Man erfährt von seinem Werdegang und langsamem Erwachsenwerden. Nach dem frühen Tod der Eltern wächst David bei seinem brutalen Stiefvater auf, schon mit 10 Jahren wird er zum Arbeiten in die Fabrik geschickt (auch hier Parallelen zu Dickens’ Leben). Er flieht, um den unerträglichen Bedingungen zu entkommen.
Die Erzählung lebt von den zahlreichen (berühmt gewordenen) Figuren, die seinen Weg kreuzen, ihn eine Zeit lang begleiten, verschwinden und wieder auftauchen.
In bekannter Dickens-Manier – mit viel Witz in den Nebensätzen – bekommen die Hauptfiguren schließlich, was sie verdienen. Nur wenige Erzählfäden bleiben unaufgelöst. In diesen Zeilen zeigt sich Dickens’ großartiges Können um die Schilderung von Erlebnissen und Gefühlen der Kindheit.
Wie die meisten Werke Dickens’ wurde auch »David Copperfield« zunächst als mehrteilige, monatliche Fortsetzungsgeschichte verfasst und später vom Autor überarbeitet.
Dickens ist der trotz aller gelegentlichen Rührsamkeit königlichste englische Erzähler mit seinem gütigen Herzen und seiner prachtvollen Laune, von ihm müssen wir mindestens die Pichwickier und den Copperfield haben. [Quelle: Bibliothek der Weltliteratur]
Autor und Werk
Charles John Huffam Dickens (als Pseudonym auch Boz; geb. 7. Februar 1812 in Landport bei Portsmouth, England; gest. 9. Juni 1870 auf Gad’s Hill Place bei Rochester, England) ist ein englischer Schriftsteller und Journalist.
Er gilt als einer der herausragendsten Autoren seiner Zeit und als einer der Ersten, die in realistischen Schilderungen das Leid einer unterprivilegierten Bevölkerung aufzeichneten.
Zu seinen bekanntesten Werken gehören »Oliver Twist«, »David Copperfield«, »Eine Geschichte aus zwei Städten«, »Große Erwartungen« sowie »Eine Weihnachtsgeschichte«. Dickens verwendet einen blumigen und poetischen Stil, der viele humoristische Elemente besitzt. Besonders seine Seitenhiebe auf die Britische Aristokratie sind weit verbreitet und beliebt.
Dickens ist das Zweite von acht Kindern von John Dickens (1786–1851), einem mittellosen Marineschreiber. 1823 kann der Vater die hungrige Familie nicht mehr ernähren und kommt ins Schuldgefängnis von London. Eine Tragödie, die den Jungen Charles Dickens fürs Leben prägt - nicht umsonst kritisiert er in seinen Schriften den ungerechten Umgang mit schuldlos Verschuldeten. Charles muss schon mit 12 Jahren als Lager- und Fabrikarbeiter seine Familie unterstützen; auch diese Erfahrung fließt in sein Werk um »David Copperfield« ein.
Als sein Vater 1824 aus dem Gefängnis entlassen wird, geht Charles bis 1826 zurück in die Schule und wird 1827 als Schreiber bei einem Rechtsanwalt angestellt. Er arbeitet sich bis zum Parlamentsstenografen hoch (1929).
1836 heiratet Dickens Catherine Hogarth (1816–1879), von der er sich 1858 trennt. Das Ehepaar hat zehn Kinder.
Ab 1831 verdient Dickens seinen Lebensunterhalt als Journalist für verschiedene Zeitungen. 1836–37 erscheinen in monatlichen Heften die »Pickwick Papers«, durch die Dickens rasch Bekanntheit als Schriftsteller erlangt. Ebenso seine folgenden Romane entstehen als Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen. Oft schreibt er an mehreren gleichzeitig.
Aber Dickens will nicht nur literarischen Erfolg, sondern auch auf gesellschaftliche Missstände hinweisen und den Weg für soziale Reformen ebnen. 1838 erscheint »Oliver Twist« und Dickens wird Herausgeber der liberalen Tageszeitung »Daily News«.
Auf einer erfolgreichen Lesereise in die Vereinigten Staaten bringt Dickens, der unter nicht autorisierten Veröffentlichungen auf dem amerikanischen Kontinent leidet, die Idee eines weltweiten Urheberrechtes auf, aber erntet dafür keine Unterstützung.
1843 veröffentlicht Dickens seine bekannte »Weihnachtsgeschichte«, in der er eine fantastische Handlung mit der moralischen Idee von Solidarität und Nächstenliebe verknüpft.
1856 erlauben ihm seine Einkünfte, den Landsitz Gad‘s Hill Place in Rochester zu erwerben. Am 9. Juni 1865 überlebt Dickens den schweren Eisenbahnunfall von Staplehurst. Diesen übersteht er körperlich unversehrt, wird aber zeitlebens an den Erinnerungen leiden.
1869 macht er eine letzte Lesereise durch Großbritannien, auf der er während einer Lesung einen Schlaganfall erleidet. Am 9. Juni 1870 stirbt Charles Dickens auf seinem Landsitz an einem zweiten Schlaganfall. Er wird am 14. Juni in der Westminster Abbey beigesetzt.
Dickens ist einer der meistgelesenen Schriftsteller der englischen Literatur. Der als Kind Mittelose hinterlässt bei seinem Tode ein stattliches Vermögen.
Charles Dickens bei Null Papier:
www.null-papier.de/dickens
Band 1
1. Kapitel – Ich komme zur Welt
Ob ich mich in diesem Buche zum Helden meiner eignen Leidensgeschichte entwickeln werde oder ob jemand anders diese Stelle ausfüllen soll, wird sich zeigen.
Um mit dem Beginn meines Lebens anzufangen, bemerke ich, dass ich, wie man mir mitgeteilt hat und wie ich auch glaube, an einem Freitag um Mitternacht zur Welt kam. Es heißt, dass die Uhr zu schlagen begann, gerade als ich zu schreien anfing.
Was den Tag und die Stunde meiner Geburt betrifft, so behaupteten die Kindsfrau und einige weise Frauen in der Nachbarschaft, die schon Monate zuvor, ehe wir noch einander persönlich vorgestellt werden konnten, eine lebhafte Teilnahme für mich gezeigt hatten…
erstens: Dass es mir vorausbestimmt sei, nie im Leben Glück zu haben, und
zweitens: Dass ich die Gabe besitzen würde, Geister und Gespenster sehen zu können. Wie sie glaubten, hingen diese beiden Eigenschaften unvermeidlich all den unglücklichen Kindern beiderlei Geschlechts an, die in der Mitternachtsstunde eines Freitags geboren sind.
Über den ersten Punkt brauche ich nichts weiter zu sagen, weil ja meine Geschichte am besten zeigen wird, ob er eingetroffen ist oder nicht.
Was den zweiten anbelangt, will ich nur feststellen, dass ich bisher noch nichts bemerkt habe. – Vielleicht habe ich schon als ganz kleines Kind diesen Teil meiner Erbschaft angetreten und aufgebraucht. Ich beklage mich auch durchaus nicht, falls mir diese schöne Gabe vorenthalten bleiben sollte. Und wenn sich irgendjemand anders ihrer vielleicht bemächtigt hat, mag er sie in Gottesnamen behalten.
Ich kam in einem Hautnetz zur Welt, das später um den niedrigen Preis von fünfzehn Guineen in den Zeitungen zum Verkauf ausgeschrieben wurde. Ob damals die Seereisenden gerade knapp bei Kasse waren oder schwach im Glauben und daher Korkjacken vorzogen, weiß ich nicht; ich weiß bloß so viel, dass nur ein einziges Angebot einlief, und zwar von einem Anwalt, der zugleich Wechselagent war und zwei Pfund bar und den Rest in Sherry geben wollte und es entschieden ablehnte, um einen höhern Preis diese Garantie gegen das Ertrinken zu erwerben. Die Annonce wurde zurückgezogen – denn was Sherry anbelangte, so wurde meiner armen lieben Mutter eigner Sherry gerade damals versteigert.
Das Hautnetz wurde zehn Jahre später in unserer Gegend in einer Lotterie unter fünfzig Personen ausgeknobelt; je fünfzig Bewerber zahlten eine halbe Krone per Kopf, und der Gewinner hatte noch fünf Schillinge daraufzulegen. Ich selbst war gegenwärtig und erinnere mich, wie unbehaglich und verlegen mir zu Mute war, als ein Teil meines eignen Selbsts auf diese Weise veräußert wurde. Ich weiß noch, dass eine alte Dame mit einem Handkorb das Netz gewann und die ausgemachten fünf Schillinge in lauter Halfpennystücken zögernd herausholte.
Es fehlten damals noch zwei und ein halber Penny, was man ihr nur mit einem großen Aufwand an Zeit und Arithmetik begreiflich machen konnte. Tatsache ist, dass die alte Dame wirklich nie ertrank, sondern triumphierend im Bette starb; zweiundneunzig Jahre alt.
Ich ließ mir erzählen, dass sie sich bis an ihr Ende außerordentlich damit brüstete, in ihrem ganzen Leben niemals auf dem Wasser gewesen zu sein, höchstens auf einer Brücke, und dass sie bei ihrem Tee, dem sie sehr zugetan war, stets ihre Entrüstung über die Gottlosigkeit der Seeleute aussprach, die sich auf dem Meere »herumtrieben«.
Es war vergebens, ihr vorzustellen, wie viele Annehmlichkeiten wir, den Tee zum Beispiel mit inbegriffen, dieser Unsitte verdanken. Stets erwiderte sie mit noch größerm Nachdruck und mit instinktivem Bewusstsein von der Gewalt ihres Einwandes: »Man hat sich trotzdem nicht herumzutreiben.«
Um mich aber nicht selbst herumzutreiben und abzuschweifen, will ich wieder zu meiner Geburt zurückkehren.
Ich erblickte in Blunderstone in Suffolk oder daherum, wie man in Schottland sagt, das Licht der Welt. Ich bin ein nachgebornes Kind. Meines Vaters Augen schlossen sich sechs Monate früher, als die meinigen sich öffneten.
Es liegt etwas Seltsames für mich in dem Gedanken, dass mein Vater mich niemals gesehen hat, und noch Seltsameres in der schattenhaften Erinnerung aus meiner ersten Kinderzeit an den weißen Grabstein auf dem Kirchhof. Ich empfand unsäglichen Kummer, dass er dort draußen allein liegen musste in der dunklen Nacht, während unser kleines Wohnzimmer warm und hell war von Feuer und Licht und das Tor unseres Hauses – fast grausam kam es mir manchmal vor – für ihn verriegelt und verschlossen.
Eine Tante meines Vaters, folglich eine Großtante von mir, von der ich bald mehr zu erzählen haben werde, galt als die angesehenste Person in unserer Familie. Miss Trotwood oder Miss Betsey, wie meine arme Mutter sie immer nannte, wenn sie ihre Angst vor dieser schrecklichen Persönlichkeit so weit überwand, sie überhaupt zu erwähnen, war verheiratet gewesen mit einem Manne, der jünger als sie selbst und sehr hübsch war. Allerdings nicht in dem Sinn des Sprichworts, »hübsch ist, wer sich hübsch beträgt«, – denn er stand stark in dem Verdacht, dass er Miss Betsey durchzuprügeln pflegte und einmal sogar wegen einer strittigen Unterstützungsfrage schnelle, aber entschlossene Vorbereitungen getroffen hätte, sie aus einem Fenster im zweiten Stock hinauszuwerfen.
Diese offenkundigen Beweise unverträglicher Gemütsart bewogen schließlich Miss Betsey, ihn mit Geld abzufertigen und eine Scheidung auf gegenseitige Übereinkunft durchzusetzen.
Er ging mit dem Kapital nach Indien und wurde dort nach einer wilden Legende in unserer Familie einmal auf einem Elefanten reiten gesehen in Gesellschaft eines Babu. Es wird wohl ein Pavian gewesen sein – oder eine Begum! Wie dem auch sei, ehe zehn Jahre um waren, kam aus Indien die Kunde von seinem Tod.
Wie meine Tante es aufgenommen hat, weiß niemand. Gleich nach der Scheidung nahm sie ihren Mädchennamen wieder an, kaufte sich ein Häuschen in einem Weiler weit draußen an der Seeküste und lebte dort mit einer einzigen Dienerin in unerbittlicher Zurückgezogenheit.
Mein Vater musste einst ihr Liebling gewesen sein, aber seine Heirat hatte sie tödlich beleidigt, da meine Mutter nach ihrer Ansicht nur eine »Wachspuppe« war. Sie hatte meine Mutter wohl nie gesehen, wusste aber, dass sie sehr jung war – noch nicht zwanzig.
Mein Vater und Miss Betsey sahen einander nie wieder. Er war doppelt so alt als meine Mutter, als er sie heiratete, und von zarter Gesundheit. Ein Jahr darauf starb er; wie ich schon gesagt habe, sechs Monate, ehe ich zur Welt kam.
So lagen die Dinge an jenem, wie ich wohl sagen darf, ereignisvollen und wichtigen Freitag. Ich weiß natürlich über sie nichts aus eigner Anschauung und stütze meine Erinnerungen auch nicht auf eigne Sinneswahrnehmung.
Meine Mutter saß am Feuer, körperlich schwach und geistig sehr niedergedrückt, schaute, die Augen voll Tränen, in das Feuer und sann trübe nach über das Schicksal des vor der Geburt verwaisten Kindes, dessen Ankunft binnen kurzem erwartet wurde, und über ihre eigene Zukunft.
Es war ein heller, windiger Herbstnachmittag, und sie saß betrübt und niedergeschlagen da und von bangen Zweifeln erfüllt, ob sie wohl glücklich die zu erwartende schwere Stunde überstehen werde, als sie, ihre Augen trocknend, aufblickte und durch das gegenüberliegende Fenster eine fremde Dame in den Garten hereinkommen sah.
Beim zweiten Blick hatte meine Mutter schon die sichere Ahnung, dass es Miss Betsey wäre. Die untergehende Sonne schien über den Gartenzaun auf die fremde Dame, und diese schritt auf die Türe zu mit einer so unbeugsamen Strenge in Gesicht und Haltung, dass es niemand anders sein konnte.
Als sie das Haus erreichte, lieferte sie noch einen anderen Beweis ihrer Identität. Mein Vater hatte oft erwähnt, dass sie sich selten wie ein gewöhnlicher Christenmensch benehme; und nun trat sie wirklich, anstatt die Glocke zu ziehen, an das nächste Fenster und drückte ihre Nase mit solcher Energie gegen das Glas, dass diese im Augenblick ganz platt und weiß wurde, wie meine Mutter oft erzählte.
Sie bekam darüber einen solchen Schrecken, dass ich es meiner Überzeugung nach nur Miss Betsey zu danken habe, wenn ich an einem Freitag zur Welt kam.
Meine Mutter war in ihrer Aufregung aufgestanden und hinter den Stuhl in eine Ecke getreten. Miss Betsey sah sich durch die Scheiben langsam und forschend im Zimmer um, wobei sie am anderen Ende der Stube anfing, und wendete automatenhaft wie ein Türkenkopf auf einer Schwarzwälderwanduhr das Gesicht, bis ihre Blicke auf meiner Mutter haften blieben. Dann zog sie die Brauen zusammen und winkte wie jemand, der zu befehlen gewohnt ist, dass man ihr die Türe aufmachen solle. Meine Mutter gehorchte.
»Mrs. David Copperfield vermutlich«, sagte Miss Betsey mit einer Emphase, die sich wahrscheinlich auf die Trauerkleider meiner Mutter und auf ihren Zustand bezog.
»Ja«, antwortete meine Mutter schüchtern.
»Haben Sie schon von Miss Trotwood gehört?« fragte die Dame.
Meine Mutter entgegnete, sie habe das Vergnügen gehabt, hatte aber dabei das unangenehme Gefühl, nicht danach auszusehen, als ob es ein überwältigendes Vergnügen gewesen wäre.
»Jetzt steht sie vor Ihnen«, sagte Miss Betsey. Meine Mutter verbeugte sich und bat die Dame, einzutreten.
Sie gingen in das Wohnzimmer, aus dem meine Mutter gekommen, denn das Besuchzimmer auf der anderen Seite des Ganges war nicht geheizt und nicht geheizt gewesen seit meines Vaters Leichenbegängnis. Als sie beide Platz genommen hatten, Miss Betsey aber nichts sprach, fing meine Mutter, nach einem vergeblichen Bemühen sich zu fassen, zu weinen an.
»O still, still, still!« sagte Miss Betsey hastig. »Nur das nicht. Lass das, lass das!«
Meine Mutter aber konnte sich nicht helfen, und ihre Tränen flossen, bis sie sich ausgeweint hatte.
»Nimm deine Haube ab, Kind«, sagte Miss Betsey, »damit ich dich sehen kann.«
Meine Mutter war viel zu sehr eingeschüchtert, um dieses seltsame Verlangen abzuschlagen, selbst wenn sie gewollt hätte. Daher entsprach sie dem Wunsche und tat es mit so zitternden Händen, dass ihr Haar, das sehr reich und schön war, sich löste und auf ihre Schultern herabfiel.
»Gott bewahre!« rief Miss Betsey, »du bist ja noch ein wahres Wickelkind.«
Allerdings sah meine Mutter selbst für ihre Jahre noch sehr jugendlich aus. Sie ließ den Kopf hängen, als ob es ihre Schuld wäre, und sagte schluchzend, dass sie auch fürchte, sie sei ein wahres Kind von einer Witwe und werde auch ein Kind von einer Mutter sein, wenn sie am Leben bliebe.
In der kurzen Pause, die darauf folgte, kam es ihr fast vor, als ob Miss Betsey ihr Haar berührte, und zwar nicht mit unsanfter Hand; aber wie sie schüchtern hoffend aufblickte, hatte sich die Dame mit aufgeschürztem Kleid bereits hingesetzt, die Hände über ein Knie gefaltet, die Füße auf das Kamingitter gestützt, und starrte grimmig ins Feuer.
»Um Gotteswillen?« fragte Miss Betsey plötzlich. »Warum eigentlich Krähenhorst?«
»Sie meinen das Haus, Madame?«
»Warum Krähenhorst?« fragte Miss Betsey. »Hühnerhof wäre passender gewesen, wenn ihr beide einen Begriff vom praktischen Leben gehabt hättet.«
»Mr. Copperfield hat ihm den Namen gegeben«, erwiderte meine Mutter. »Als er das Haus kaufte, meinte er, es müsste hübsch sein, wenn Krähen darin nisten würden.«
Der Abendwind fegte in diesem Augenblick so gewaltig durch die alten hohen Ulmen im Garten, dass sowohl meine Mutter wie Miss Betsey unwillkürlich hinaussahen. Als sich die Bäume zueinander neigten wie Riesen, die sich Geheimnisse zuflüsterten, und gleich darauf in heftige Bewegung gerieten und mit ihren zackigen Armen wild in der Luft herumfuhren, als ob diese Geheimnisse zu grässlich für ihre Seelenruhe wären, wurden ein paar alte, vom Sturm zerzauste Krähennester auf den höchsten Zweigen wie Wracks auf stürmischer See hin und hergeworfen.
»Wo sind die Vögel?« verhörte Miss Betsey.
»Was?« Meine Mutter hatte an etwas anderes gedacht.
»Die Krähen – wo sie hingekommen sind?«
»Es waren überhaupt nie welche da, seit wir hier gelebt haben«, sagte meine Mutter. »Wir dachten – Mr. Copperfield dachte, es sei ein großer Krähenhorst, aber die Nester waren alt und von den Vögeln längst verlassen.«
»Echt David Copperfield«, rief Miss Betsey. »David Copperfield, wie er leibt und lebt! Nennt das Haus Krähenhorst, wo gar keine Krähe da ist, und nimmt die Vögel auf guten Glauben, weil er die Nester sieht.«
»Mr. Copperfield ist tot«, gab meine Mutter zur Antwort, »und wenn Sie sich unterstehen, unfreundlich über ihn zu sprechen –«
Ich glaube, meine arme, liebe Mutter hatte einen Augenblick die Absicht, sich an der Tante tätlich zu vergreifen. Diese hätte sie wohl leicht mit einer Hand bezwungen, selbst wenn meine Mutter in einer bessern Verfassung für einen solchen Kampf gewesen wäre als an diesem Abend. Aber es blieb bei einem schüchternen Aufstehen. Dann setzte sich meine Mutter wieder schwach nieder und fiel in Ohnmacht.
Als sie wieder zu sich kam, sah sie Miss Betsey am Fenster stehen. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden, und so undeutlich sie einander unterschieden, hätten sie doch auch das nicht ohne den Schein des Feuers können.
»Nun?« fragte Miss Betsey und trat wieder zu dem Stuhl, als hätte sie bloß einen Blick aus dem Fenster geworfen, »und wann erwartest du –?«
»Ich zittere am ganzen Leibe«, stammelte meine Mutter. »Ich weiß nicht, was es ist, ich sterbe sicherlich.«
»Nein, nein, nein«, sagte Miss Betsey; »trink eine Tasse Tee!«
»Ach Gott, ach Gott, meinen Sie, dass mir das guttun wird?« rief meine Mutter in hilflosem Tone.
»Selbstverständlich!« sagte Miss Betsey. »Es ist alles bloß Einbildung. Wie heißt denn das Mädchen?«
»Ich weiß doch nicht, ob es ein Mädchen sein wird, Madame«, sagte meine Mutter unschuldsvoll.
»Gott segne dieses Kind!« rief Miss Betsey aus, unbewusst den Sinnspruch auf dem Nadelkissen in der Schublade des oberen Stocks anführend, aber nicht mit Anwendung auf mich, sondern auf meine Mutter. »Das meine ich doch nicht. Ich meine doch das Dienstmädchen.«
»Peggotty«, sagte meine Mutter.
»Peggotty!« wiederholte Miss Betsey entrüstet. »Willst du damit sagen, Kind, dass ein menschliches Geschöpf in eine christliche Kirche gegangen ist und sich hat Peggotty taufen lassen?«
»Es ist ihr Familienname«, sagte meine Mutter schüchtern. »Mr. Copperfield nannte sie so, weil ihr Taufname derselbe ist wie meiner.«
»Heda, Peggotty!« rief Miss Betsey und öffnete die Zimmertür. »Tee! Deine Herrschaft ist ein bisschen unwohl, aber rasch!«
Nachdem sie diesen Befehl so gebieterisch ausgesprochen, als wäre sie von jeher Herrin dieses Hauses, und aus dem Zimmer hinausgespäht hatte, um nach der erstaunten Peggotty zu sehen, die bei dem Klang einer fremden Stimme mit einem Licht den Gang entlangkam, schloss sie die Tür wieder und setzte sich nieder wie zuvor, die Füße am Kamingitter, das Kleid aufgeschürzt und die Hände über ein Knie gefaltet.
»Du meintest, es werde ein Mädchen werden«, sagte Miss Betsey. »Ich zweifle keinen Augenblick daran. Ich habe ein Vorgefühl, dass es ein Mädchen wird. Nun, Kind! Von dem Moment der Geburt dieses Mädchens an –«
»Vielleicht ists ein Knabe«, erlaubte sich meine Mutter, sie zu unterbrechen.
»Ich sagte dir bereits, ich habe das Vorgefühl, dass es ein Mädchen ist«, entgegnete Miss Betsey. »Widersprich mir nicht immer. Also von dem Augenblick der Geburt dieses Mädchens an werde ich seine Freundin sein, Kind. Ich will seine Patin sein, und sie hat Betsey Trotwood-Copperfield zu heißen. Mit dieser Betsey Trotwood-Copperfield soll es im Leben glattgehen. Mit ihren Gefühlen darf nicht gespielt werden. Armes Kleines. Sie muss gut erzogen und in acht genommen werden, dass sie ihr Vertrauen nicht auf törichte Weise jemand schenkt, der es nicht verdient. Das lass meine Sorge sein.«
Bei jedem dieser Sätze zuckte Miss Betsey mit dem Kopf, als ob das erlittene Unrecht vergangener Zeiten in ihr wieder lebendig würde und sie einen deutlicheren Hinweis darauf nur mit Überwindung unterdrückte. So vermutete wenigstens meine Mutter, als sie sie beim schwachen Schimmer des Feuers beobachtete, aber zu sehr von ihrem Wesen erschreckt war und innerlich viel zu unruhig und zu verwirrt, um überhaupt irgendetwas klar beobachten zu können.
»Und war David gut gegen dich, Kind?« fragte Miss Betsey, nachdem sie eine Weile geschwiegen und die Bewegung ihres Kopfs allmählich aufgehört hatte. »Habt ihr euch gut vertragen?«
»Wir waren sehr glücklich«, sagte meine Mutter. »Mr. Copperfield war viel zu gut zu mir.«
»Er hat dich also verzogen?«
»Allein und verlassen zu sein und ohne Stütze in dieser rauen Welt dazustehen«, schluchzte meine Mutter, »dazu hat er mich wohl nicht erzogen.«
»Gut. Weine nicht«, sagte Miss Betsey. »Ihr passtet eben nicht zusammen, Kind, – zwei Menschen können überhaupt nicht zusammenpassen – deshalb fragte ich. Du warst eine Waise, nicht wahr?«
»Ja.«
»Und Gouvernante?«
»Ich war Bonne in einer Familie, die Mr. Copperfield häufig besuchte. Mr. Copperfield war sehr freundlich und aufmerksam gegen mich und machte mir zuletzt einen Heiratsantrag. Und ich sagte ja. Und so wurden wir Mann und Frau«, sagte meine Mutter einfach.
»Ha! Armes Kind!« murmelte Miss Betsey und sah immer noch grimmig ins Feuer. »Verstehst du etwas?«
»Ich bitte um Verzeihung, Madame?« stammelte meine Mutter.
»Von der Wirtschaft zum Beispiel«, sagte Miss Betsey.
»Ich fürchte, nicht viel. Nicht so viel, wie ich möchte. Aber Mr. Copperfield unterrichtete mich –«
»Weil er selber so viel davon verstand«, warf Miss Betsey hin.
»– und ich glaube, ich hätte bald Fortschritte gemacht, denn ich war eifrig im Lernen und er ein sehr geduldiger Lehrer, wenn nicht das große Unglück –«, meine Mutter verlor wieder die Fassung und konnte nicht weitersprechen.
»Schon gut, schon gut«, sagte Miss Betsey.
»Ich führte mein Wirtschaftsbuch regelmäßig und schloss es mit Mr. Copperfield pünktlich jeden Abend ab«, rief meine Mutter mit einem neuen Ausbruch des Schmerzes.
»Schon gut, schon gut«, rief Miss Betsey. »Hör endlich auf zu weinen.«
»Und es war nie ein Wort des Streites dabei oder der Uneinigkeit, außer wenn Mr. Copperfield tadelte, dass meine Dreier und Fünfer einander zu ähnlich sähen, oder dass ich meinen Siebnern und Neunern krause Schwänze gäbe«, begann meine Mutter von Neuem und wieder von einer Tränenflut unterbrochen.
»Du wirst dich krank machen«, sagte Miss Betsey. »Du weißt doch, dass das weder für dich noch für mein Patenkind gut ist. Komm, du musst das bleiben lassen.«
Dieses Argument trug einigermaßen dazu bei, meine Mutter zum Schweigen zu bringen, obgleich ihr zunehmendes Übelbefinden die Hauptursache sein mochte. Eine längere Stille trat ein, die nur unterbrochen wurde von einem gelegentlichen »Ha!« Miss Betseys, die immer noch mit den Füßen auf dem Kamin dasaß.
»David hat sich mit seinem Geld eine Leibrente gekauft«, sagte sie endlich, »und wie hat er für dich gesorgt?«
»Mr. Copperfield«, sagte meine Mutter mit Anstrengung, »war so vorsichtig und gut, mir die Anwartschaft auf einen Teil davon zu sichern.«
»Wie viel?« fragte Miss Betsey.
»Hundertundfünf Pfund jährlich.«
»Er hätte es noch schlimmer machen können«, sagte meine Tante.
Das Wort passte gut für den Augenblick. Meiner Mutter ging es so viel schlimmer, dass Peggotty, die eben mit dem Teebrett und Lichtern hereinkam und auf den ersten Blick sah, wie krank sie war, – Miss Betsey hätte es schon eher sehen können, wenn es hell genug gewesen wäre, – sie so rasch wie möglich in die obere Stube hinaufbrachte und sofort Ham Peggotty, ihren Neffen, der seit einigen Tagen ohne Wissen meiner Mutter als Bote für unvorhergesehene Fälle im Hause verborgen gehalten wurde, nach der Hebamme und dem Doktor schickte.
Diese verbündeten Mächte, die sich im Verlauf weniger Minuten zusammenfanden, waren sehr erstaunt, eine fremde Dame von strengem Aussehen vor dem Feuer sitzen zu sehen, den Hut am linken Arm hängend, und sich die Ohren mit Juwelierbaumwolle zustopfend.
Da Peggotty nichts über sie wusste und meine Mutter nichts über sie hatte fallenlassen, blieb sie ein ungelöstes Rätsel in der Wohnstube, und der Umstand, dass sie ein Baumwollenmagazin in der Tasche trug und sich die Watte auf besagte Weise in die Ohren stopfte, raubte ihr nichts von ihrem Ansehen.
Nachdem der Doktor oben gewesen und wieder heruntergekommen war und offenbar vermutete, dass er mit der unbekannten Dame einige Stunden würde zusammenbleiben müssen, bemühte er sich, höflich und gesellig zu erscheinen. Er war der sanfteste seines Geschlechts, der mildeste aller kleinen Männer. Er drückte sich beim Ein- und Ausgehen seitwärts durch die Türen, um möglichst wenig Raum einzunehmen. Er ging so leise wie der Geist des Hamlet, aber noch viel langsamer. Er trug den Kopf auf eine Seite geneigt, teils aus Bescheidenheit, teils aus Entgegenkommen. Es wäre zu wenig gesagt, dass er nicht einmal für einen Hund ein böses Wort gehabt hätte. Er hätte nicht einmal einem tollen Hund ein böses Wort sagen können. Höchstens ein sanftes oder ein halbes oder ein Bruchstück davon, – denn er sprach so langsam, wie er ging, – aber er würde nicht grob gegen ihn gewesen sein. Nicht einmal ein rasches, nicht um alles in der Welt.
Mr. Chillip sah also meine Tante, den Kopf auf die Seite geneigt, sanft an, machte eine kleine Verbeugung und sagte, auf die Watte anspielend, indem er sein linkes Ohr berührte:
»Lokale Reizung, Madame?«
»Was?« fragte meine Tante und zog die Baumwolle wie einen Kork aus einem Ohr.
Mr. Chillip erschrak so sehr über ihr barsches Wesen, wie er später meiner Mutter erzählte, dass es noch ein Glück war, dass er die Fassung nicht verlor. Er wiederholte sanft:
»Lokale Reizung, Madame?«
»Unsinn!« antwortete meine Tante und verstopfte sofort das Ohr wieder.
Mr. Chillip konnte nun weiter nichts tun, als Platz nehmen und sie schüchtern ansehen, wie sie so dasaß und ins Feuer starrte, bis er wieder hinaufgerufen wurde.
Nach viertelstündiger Abwesenheit kehrte er wieder zurück.
»Nun?« fragte meine Tante und nahm die Watte aus dem ihm am nächsten liegenden Ohre.
»Nun, Madame«, antwortete Mr. Chillip, »wir – wir machen langsam Fortschritte.«
»Ba-a-ah«, sagte meine Tante, den verächtlichen Ausruf förmlich hervorstoßend, und verstopfte sich wieder wie vorhin.
In der Tat – in der Tat, Mr. Chillip war geradezu bestürzt, – wie er später meiner Mutter gestand; – natürlich bloß vom ärztlichen Gesichtspunkt aus. Aber trotzdem starrte er Miss Betsey fast zwei Stunden lang an, bis er von Neuem gerufen wurde. Nach längerer Abwesenheit kehrte er wiederum zurück.
»Nun?« fragte meine Tante und nahm abermals die Watte aus dem gleichen Ohr.
»Nun, Madame«, antwortete Mr. Chillip, »wir – wir machen langsam Fortschritte, Madame.«
»Ja-a-a«, knurrte meine Tante Mr. Chillip derart an, dass er es fürwahr nicht länger mehr aushalten konnte. Es war fast danach angetan, ihm allen Mut zu nehmen, äußerte er später.
Darum ging er lieber hinaus und setzte sich draußen im Dunkeln auf die zugige Treppe, bis man wieder nach ihm schickte.
Ham Peggotty, der in die Volksschule ging und wie ein Drache über seinem Katechismus zu sitzen pflegte und deshalb sicher als glaubwürdiger Zeuge gelten kann, erzählte am nächsten Tag, er hätte eine Stunde später zur Stubentür hereingeguckt und wäre sogleich von Miss Betsey, die in großer Erregung auf und ab gegangen, erspäht und gepackt worden, ehe er die Flucht habe ergreifen können. Er berichtete ferner, dass man zuweilen das Geräusch von Fußtritten und Stimmen in den oberen Zimmern gehört hätte, das wahrscheinlich die Watte nicht ganz abhielt, wie er aus dem Umstände schloss, dass ihn die Dame wie ein Opfer festhielt und an ihm ihre überströmende Aufregung ausließ, wenn die Geräusche am lautesten waren. Sie hätte ihn am Kragen gepackt gehalten und in der Stube auf- und abgeführt (als ob er zu viel Laudanum genossen), hätte ihn geschüttelt, ihm die Wäsche zerzaust und die Ohren verstopft, als ob es ihre eignen gewesen wären, und ihn auf andere Weise misshandelt. Sein Bericht wurde zum Teil von Peggotty bestätigt, die ihn um halb ein Uhr, kurz nach seiner Befreiung, noch ganz rot gesehen hatte.
Der sanfte Mr. Chillip konnte niemand böse sein und wenn überhaupt je, so am allerwenigsten in solcher Stunde. Er drückte sich deshalb in das Wohnzimmer, sobald er abkommen konnte, und sagte zu meiner Tante in seinen mildesten Tönen:
»Madame, es freut mich, Sie beglückwünschen zu können.«
»Wozu?« fragte Miss Betsey mit Schärfe.
Mr. Chillip, wiederum verwirrt durch die außerordentliche Schroffheit meiner Tante, machte ihr eine kleine Verbeugung und lächelte sie an, um sie zu besänftigen.
»O dieser Mensch, was er nur macht«, rief meine Tante ungeduldig, »kann er denn nicht sprechen!«
»Beruhigen Sie sich, meine teuere Madame«, sagte Mr. Chillip mit seinen weichsten Lauten. »Es ist nicht länger Ursache zur Besorgnis mehr vorhanden, Madame. Beruhigen Sie sich.«
Man hat es später für ein Wunder angesehen, dass meine Tante ihn nicht schüttelte, um das, was er zu sagen hatte, aus ihm herauszuschütteln. Was sie schüttelte, war nur der Kopf, den aber so drohend, dass es den Doktor erzittern machte.
»Nun, Madame«, begann Mr. Chillip von Neuem, sobald er wieder Mut gefasst, »es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Alles ist nun vorbei, Madame, und glücklich vorbei.«
Während der fünf Minuten, die Mr. Chillip zu dieser Rede brauchte, sah ihn meine Tante lauernd und scharf an.
»Wie befindet sie sich?« fragte meine Tante und verschränkte ihre Arme, an deren einem immer noch der Hut hing.
»Nun, Madame, sie wird bald wieder ganz wohl sein, hoffe ich«, antwortete Mr. Chillip, »so wohl, wie wir es von einer jungen Mutter unter so getrübten häuslichen Verhältnissen nur erwarten können. Wenn Sie sie sogleich sehen wollen, steht dem nichts im Wege, Madame. Vielleicht tut es ihr sogar gut.«
»Und sie? Wie geht es ihr?«
Mr. Chillip neigte seinen Kopf noch ein bisschen mehr auf die Seite und sah meine Tante an wie ein liebenswürdiger Vogel.
»Das Baby?« sagte meine Tante, »wie geht es ihr?«
»Madame«, erwiderte Mr. Chillip. »Ich nahm an, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe.«
Meine Tante sprach kein Wort, nahm ihren Hut an den Bändern wie eine Schleuder, führte einen Streich damit gegen Mr. Chillips Kopf, stülpte ihn aufs Haupt, schritt hinaus und kam niemals wieder.
Sie verschwand, wie eine unzufriedene Fee oder wie eins jener übernatürlichen Wesen, die ich nach dem Volksglauben berechtigt war, sehen zu können; ging hin und ward nicht mehr gesehen.
Ich lag in meiner Wiege und meine Mutter im Bett. Betsey Trotwood-Copperfield aber blieb für immer im Lande der Träume und Schatten, in jener grauenvollen Region, die ich jüngst durchwandert. Und das Licht unseres Zimmers schien hinaus auf das irdische Ziel aller Wanderer aus dieser Region: auf den Hügel über der Asche und dem Staube dessen, der einst hienieden geweilt, und ohne den ich nie geworden wäre.
2. Kapitel – Ich beobachte
Die ersten Gegenstände, die bestimmte Umrisse vor mir annehmen, wenn ich weit zurück in die Leere meiner Kindheit blicke, sind meine Mutter mit ihrem schönen Haar und den jugendlichen Formen und Peggotty mit überhaupt gar keiner Form und mit so dunkeln Augen, dass sie ihre Umgebung im Gesicht dunkel zu machen scheinen, und mit Armen und Backen so rot, dass ich mich stets wunderte, warum die Vögel nicht lieber an ihnen statt an den Äpfeln herumpickten.
Ich glaube, mich noch daran erinnern zu können, wie die beiden Frauen in kleiner Entfernung voneinander auf dem Boden knieten, und ich unsicher von einer zur anderen wankte. Ich habe auch noch eine dunkle Erinnerung an Peggottys Zeigefinger, der von der Nadel so rau war wie ein Taschenmuskatnussreibeisen.
Das mag Einbildung sein, aber ich glaube, dass das Gedächtnis der meisten Menschen weiter in die Kinderzeit zurückreicht, als man gewöhnlich annimmt; ebenso glaube ich, dass die Beobachtungsgabe bei vielen kleinen Kindern an Schärfe und Genauigkeit ganz wunderbar ist. Ich glaube sogar, dass man von den meisten Erwachsenen, die in dieser Hinsicht bemerkenswert sind, viel eher sagen könnte, sie hätten diese Fähigkeit nicht verloren, als, sie hätten sie erst später erworben; umso mehr, als solche Menschen überdies eine gewisse Frische und Sanftmut und eine Fähigkeit, sich über irgendetwas zu freuen, besitzen, lauter Eigenschaften, die sie ebenfalls aus der Kindheit mit herübergenommen haben.
Wenn ich also, wie gesagt, in die Leere meiner frühesten Jugend zurückblicke, sind die ersten Gegenstände, deren ich mich erinnern kann, und die aus dem Wirrwarr der Dinge hervorstechen, meine Mutter und Peggotty. Was weiß ich sonst noch? Wollen mal sehen.
Es scheidet sich aus dem Nebel unser Haus in seiner mir in frühester Erinnerung vertrauten Gestalt. Im Erdgeschoss geht Peggottys Küche auf den Hinterhof hinaus; da sind: in der Mitte ein Taubenschlag auf einer Stange, aber ohne Tauben; eine große Hundehütte in einer Ecke, aber kein Hund darin, und eine Anzahl Hühner, die mir erschrecklich groß vorkommen, wie sie mit drohendem und wildem Wesen herumstolzieren. Ein Hahn fliegt auf einen Pfosten, um zu krähen, und scheint sein Auge ganz besonders auf mich zu richten, wie ich ihn durch das Küchenfenster betrachte; und ich zittere vor Furcht, weil er so bös ist. Von den Gänsen außerhalb der Seitentür, die mir mit langausgestreckten Hälsen nachlaufen, wenn ich vorbeigehe, träume ich die ganze Nacht, wie ein Mann, den wilde Tiere umgeben, von Löwen träumen würde.
Dann ist ein langer Gang da – für mich eine endlose Perspektive –, der von Peggottys Küche zum Haupttor führt. Eine dunkle Vorratskammer mündet auf diesen Gang; – so recht ein Ort, um des Nachts daran scheu vorbeizulaufen –, denn ich weiß nicht, was zwischen diesen Tonnen und Krügen und alten Teekisten stecken mag –, wenn sich nicht gerade jemand mit einem brennenden Licht in der Kammer befindet. Eine dumpfige Luft, mit der sich der Geruch von Seife, Mixed-Pickles, Pfeffer, Kerzen und Kaffee vermischt, strömt heraus. Dann sind die beiden Wohnzimmer da: Das eine, in dem abends meine Mutter, ich und Peggotty sitzen, – denn Peggotty leistet uns Gesellschaft, wenn wir allein sind, und sie ihre Arbeit gemacht hat, – und das Empfangszimmer, wo wir Sonntags sitzen, prunkvoll, aber nicht so traulich. Für mich hat dieses Zimmer etwas Schwermütiges, denn Peggotty hat mir erzählt, – ich weiß zwar nicht mehr, wann, aber es muss lange her sein – als mein Vater begraben wurde, wären die Trauergäste drin mit schwarzen Mänteln umhergegangen. Dort liest jeden Sonntag abends meine Mutter Peggotty und mir vor, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Und ich ängstige mich so sehr darüber, dass sie mich dann aus dem Bette herausnehmen und mir aus dem Schlafzimmerfenster den stillen Kirchhof zeigen müssen, wo die Toten im feierlichen Mondlicht in ihren Gräbern ruhen.
Auf der ganzen Welt, so viel ich weiß, ist nirgends das Gras nur halb so grün wie auf diesem Kirchhof, nirgends sind die Bäume halb so schattig, und nichts ist so still wie die Grabsteine. Die Schafe weiden dort, wenn ich früh morgens in dem kleinen Bett in dem Alkoven hinter meiner Mutter Schlafzimmer knie und hinausschaue, und ich sehe das rötliche Licht auf die Sonnenuhr scheinen und denke bei mir: Freut sich die Sonnenuhr, dass sie die Zeit angeben kann?
Dann ist unser Betstuhl in der Kirche da. Was für ein hochrückiger Stuhl! Daneben ist ein Fenster, von dem aus man unser Haus sehen kann. Und oftmals während des Morgengottesdienstes blickt Peggotty hinaus, um sich zu vergewissern, ob nicht eingebrochen oder etwas in Brand gesteckt wird. Wenn sie selbst auch ihre Augen umherwandern lässt, so wird sie doch böse, wenn ich dasselbe tue, und winkt mir zu, wenn ich auf dem Sitz stehe, dass ich den Geistlichen anblicken solle. Aber ich kann ihn doch nicht immerfort ansehen – ich kenne ihn doch sowieso auch ohne das weiße Ding, das er umhat, und fürchte immer, er könne plötzlich wissen wollen, warum ich ihn so anstaune, und vielleicht gar den Gottesdienst unterbrechen, um mich darüber zu befragen, – und was sollte ich dann tun?
Es ist etwas Schreckliches, zu gähnen. Aber irgendetwas muss ich doch machen. Ich blicke meine Mutter an, aber sie tut, als ob sie mich nicht sähe. Ich schaue einen Jungen im Seitenschiff an; er schneidet mir Gesichter. Ich sehe auf die Sonnenstrahlen, die durch die offne Tür hereinfallen, und da erblicke ich ein verirrtes Schaf, ich meine nicht einen Sünder, sondern einen Hammel, der Miene macht, in die Kirche zu treten. Ich fühle, dass ich nicht länger hinschauen kann, denn ich könnte in Versuchung kommen, etwas laut zu sagen, und was würde dann aus mir werden. Ich blicke auf die Gedächtnistafeln an der Wand und versuche, an den verstorbenen Mr. Bodgers zu denken, und welcher Art wohl Mrs. Bodgers Gefühle gewesen sein mögen, als ihr Mann so lange krank lag und die Kunst der Ärzte vergebens war. Ich frage mich, ob sie auch Mr. Chillip vergeblich gerufen haben und wenn, ob es ihm recht ist, daran jede Woche einmal erinnert zu werden. Ich schaue von Mr. Chillip in seinem Sonntagshalstuch nach der Kanzel hin und denke, was für ein hübscher Spielplatz das sein müsste, und was das für eine feine Festung abgeben würde, wenn ein anderer Junge die Treppen heraufkäme zum Angriff, und man könnte ihm das Samtkissen mit den Troddeln auf den Kopf schmeißen. Und wenn sich nach und nach meine Augen schließen, und ich anfangs den Geistlichen in der Hitze noch ein schläfriges Lied singen höre, vernehme ich bald gar nichts mehr. Dann falle ich mit einem Krach vom Sitze und werde mehr tot als lebendig von Peggotty hinausgetragen.
Und dann wieder sehe ich die Außenseite unseres Hauses, und die Fensterläden des Schlafzimmers stehen offen, damit die würzige Luft hineinströmen kann, und im Hintergrund des Hauptgartens hängen in den hohen Ulmen die zerzausten Krähennester. Jetzt bin ich in dem Garten hinter dem Hof mit dem leeren Taubenschlag und der Hundehütte – ein wahrer Park für Schmetterlinge – mit seinem hohen Zaun und seiner Türe mit Vorhängschlössern, und das Obst hängt dick an den Bäumen, reifer und reicher als in irgendeinem anderen Garten, und meine Mutter pflückt die Früchte in ein Körbchen, während ich dabeistehe und heimlich ein paar abgezwickte Stachelbeeren rasch in den Mund stecke und mich bemühe, unbeteiligt auszusehen.
Ein starker Wind erhebt sich, und im Handumdrehen ist der Sommer weg. Wir spielen im Winterzwielicht und tanzen in der Stube herum. Wenn meine Mutter außer Atem ist und im Lehnstuhl ausruht, sehe ich ihr zu, wie sie ihre glänzenden Locken um die Finger wickelt und sich das Leibchen glatt zieht, und niemand weiß so gut wie ich, dass sie sich freut, so gut auszusehen, und stolz ist, so hübsch zu sein.
Das sind so einige von meinen frühesten Eindrücken. Das und ein Gefühl, dass wir beide ein bisschen Angst hatten vor Peggotty und uns in den meisten Fällen ihren Anordnungen fügten, gehört zu den ersten Schlüssen, – wenn ich so sagen darf, – die ich aus dem zog, was ich sah.
Peggotty und ich saßen eines Abends allein in der Wohnstube vor dem Kamin. Ich hatte Peggotty von Krokodilen vorgelesen. Ich muss wohl kaum sehr deutlich gelesen haben, oder die arme Seele muss in tiefen Gedanken gewesen sein, denn ich erinnere mich, als ich fertig war, hatte sie so eine Idee, Krokodile wären eine Art Gemüse. Ich war vom Lesen müde und sehr schläfrig, aber da ich die besondere Erlaubnis bekommen hatte, aufzubleiben, bis meine Mutter von einem Besuch nach Hause käme, wäre ich natürlich lieber auf meinem Posten gestorben als zu Bett gegangen. Ich war bereits auf einem Stadium von Schläfrigkeit angekommen, wo Peggotty mir immer größer und größer zu werden schien. Ich hielt meine Augen mit den beiden Zeigefingern offen und sah sie ununterbrochen an, wie sie auf ihrem Stuhle saß und arbeitete, betrachtete dann das kleine Stückchen Wachslicht, mit dem sie ihren Zwirn wichste – wie alt es aussah mit seinen Runzeln kreuz und quer –, das Hüttchen mit dem Strohdach, worin das Ellenmaß wohnte, das Arbeitskästchen mit dem Schiebedeckel und einer Ansicht darauf von der St.-Pauls-Kirche mit einer purpurroten Kuppel, den messingnen Fingerhut und sie selbst, die mir ungemein schön vorkam. Ich war so müde, dass ich fühlte, ich würde einschlafen, wenn ich nur einen Augenblick meine Augen abwendete.
»Peggotty«, sagte ich dann plötzlich: »Bist du einmal verheiratet gewesen?«
»Herr Gott, Master Davy!« erwiderte Peggotty, »wie kommst du nur aufs Heiraten?«
Sie antwortete so überrascht, dass ich ganz wach wurde. Dann hielt sie inne in ihrer Arbeit und sah mich an, den Faden in seiner ganzen Länge straffgezogen.
»Aber du warst doch einmal verheiratet, Peggotty?« fragte ich. »Du bist doch wunderschön, nicht wahr?« Ich hielt sie allerdings für eine andere Stilart als meine Mutter, aber nach einer anderen Schule von Schönheitsbegriff gesehen, kam sie mir als vollkommenes Muster vor. In unserm Empfangszimmer war ein rotsamtenes Fußbänkchen, auf das meine Mutter einen Blumenstrauß gemalt hatte. Dieser Samt und Peggottys Haut schienen mir ganz gleich. Die Fußbank war glatt und weich und Peggotty rau, aber das machte keinen Unterschied.
»Ich, schön, Davy!« sagte Peggotty. »O Gott, nein, mein liebes Kind. Aber wie kommst du aufs Heiraten?«
»Ich weiß nicht. – Du darfst nicht mehr als einen auf einmal heiraten, nicht wahr, Peggotty?«
»Gewiss nicht«, sagte Peggotty mit größter Entschiedenheit.
»Aber wenn du einen Mann heiratest und er stirbt, dann geht’s, nicht wahr, Peggotty?«
»Es geht schon, wenn man will, liebes Kind«, sagte Peggotty. »Das ist dann eben meine Sache.«
»Aber was ist deine Meinung«, fragte ich.
Bei dieser Frage blickte ich sie neugierig an, weil sie mich so seltsam musterte.
»Meine Meinung ist«, sagte Peggotty, als sie nach kurzem Zögern ihre Augen von mir abgewendet und wieder zu arbeiten begonnen hatte, »dass ich selbst niemals verheiratet gewesen bin, Master Davy, und dass ich auch nicht daran denke. Das ist alles, was ich von der Sache weiß.«
»Du bist doch nicht böse, Peggotty?« fragte ich, nachdem ich eine Weile still gewesen.
Ich glaubte es wirklich, so kurz hatte sie mich abgefertigt, musste aber wohl im Irrtum sein, denn sie legte ihr Strickzeug weg, öffnete ihre Arme, nahm meinen lockigen Kopf und drückte mich fest an sich. Dass sie mich derb an sich presste, wusste ich, denn da sie sehr beleibt war, so pflegten stets, wenn sie angekleidet war, bei jeder kleinen Anstrengung ein paar Knöpfe hinten an ihrem Kleid abzuspringen. Und ich erinnere mich, dass zwei Stück in die entgegengesetzte Zimmerecke flogen, als sie mich umarmte.
»Nun lies mir noch etwas von den Krorkingdilen vor«, sagte Peggotty, die in diesem Namen noch nicht recht sattelfest war, »ich habe noch lange nicht genug von ihnen gehört.«
Ich konnte nicht begreifen, warum Peggotty so wunderliche Augen machte und durchaus wieder von den Krokodilen hören wollte. Mit großem Eifer meinerseits kehrten wir jedoch wieder zu den Ungeheuern zurück und ließen die Sonne ihre Eier im Sande ausbrüten, rissen vor ihnen aus und entrannen ihnen durch plötzliches Umkehren, was sie ihres ungeschlachten Baues wegen nicht so rasch nachmachen konnten, verfolgten sie als Eingeborene ins Wasser und steckten ihnen scharfgespitzte Holzstücke in den Rachen, kurz, ließen sie förmlich Spießruten laufen. Ich wenigstens tat es, hatte aber betreffs Peggottys so meine Zweifel, denn ich sah, wie sie sich die ganze Zeit über in Gedanken versunken mit der Nadel in verschiedene Teile ihres Gesichts und ihrer Arme stach. Wir hatten endlich die Krokodile erschöpft und begannen eben mit den Alligatoren, als die Gartenglocke läutete. Wir gingen hinaus und fanden da meine Mutter, die mir ungewöhnlich hübsch vorkam, und bei ihr stand ein Herr mit schönem, schwarzem Haar und Backenbart, der schon am letzten Sonntag mit uns aus der Kirche nach Hause gegangen war.
Als meine Mutter mich auf der Schwelle in ihre Arme nahm und mich küsste, sagte der Herr, ich sei glücklicher als ein König – oder etwas Ähnliches –; ich fühle wohl, dass mir mein späteres Verständnis hier zu Hilfe kommt.
»Was heißt das?« fragte ich ihn über ihre Schulter hinweg.
Er klopfte mich auf den Kopf, aber ich konnte ihn und seine tiefe Stimme nicht leiden und war eifersüchtig, dass seine Hand die meiner Mutter berührte, und ich stieß ihn weg, so gut ich konnte.
»Aber Davy«, ermahnte mich meine Mutter.
»Der liebe Junge«, sagte der Herr. »Ich kann mich über seine Liebe nicht wundern.«
Noch nie hatte ich meiner Mutter Gesicht so schön rot gesehen. Sie schalt mich milde aus wegen meiner Unhöflichkeit und sprach, indem sie mich fest an sich drückte, ihren Dank dem Herrn aus, der so freundlich gewesen, sie nach Hause zu begleiten. Sie reichte ihm ihre Hand hin bei diesen Worten, und als er sie nahm, kam es mir vor, als ob sie mich anblickte.
»Jetzt wollen wir uns gute Nacht wünschen, mein hübscher Junge«, sagte der Herr zu mir, als er sein Gesicht, wie ich wohl bemerkte, auf meiner Mutter kleinen Handschuh neigte.
»Gute Nacht«, sagte ich.
»Wir müssen noch die besten Freunde von der Welt werden«, lachte der Herr, »gib mir die Hand.«
Meine rechte Hand lag in meiner Mutter Linken, und so gab ich ihm die andere.
»Aber das ist ja die falsche, Davy«, sagte er wieder lachend.
Meine Mutter zog meine rechte Hand hervor, aber ich war entschlossen, sie ihm nicht zu geben und tat es auch nicht. So reichte ich ihm die andere und er schüttelte sie und sagte, ich sei ein braver Junge, und ging fort.
Und noch jetzt seh ich ihn, wie er sich im Garten umdrehte und uns einen letzten Blick aus seinen unangenehmen, schwarzen Augen zuwarf, ehe er das Tor schloss.
Peggotty, die kein Wort gesprochen und keinen Finger gerührt hatte, schob sofort den Riegel vor, und wir gingen alle in das Wohnzimmer. Anstatt sich wie gewöhnlich in den Lehnstuhl neben den Kamin zu setzen, blieb meine Mutter am anderen Ende des Zimmers und sang vor sich hin.
»– hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend verlebt, Ma’am«, sagte Peggotty, die mit einem Leuchter in der Hand steif wie eine Tonne mitten im Zimmer stand.
»Danke schön, Peggotty«, erwiderte meine Mutter sehr aufgeräumt. »Ich habe einen sehr angenehmen Abend verbracht.«
»Eine neue Bekanntschaft ist immer eine angenehme Abwechslung«, bemerkte Peggotty.
»Eine sehr angenehme Abwechslung«, erwiderte meine Mutter.
Peggotty blieb regungslos in der Mitte des Zimmers stehen, meine Mutter fing wieder zu singen an, und ich schlief ein, wenn auch nicht so fest, dass ich nicht noch hätte Stimmen hören können, ohne aber zu verstehen, was sie sagten. Als ich aus diesem unbehaglichen Schlummer halb erwachte, sah ich, dass meine Mutter und Peggotty beide weinten und in großer Aufregung miteinander sprachen.
»So einer wie dieser hätte Mr. Copperfield nicht gefallen«, sagte Peggotty. »Das ist meine Meinung und die beschwör ich.«
»Gott im Himmel!« rief meine Mutter. »Du wirst mich noch wahnsinnig machen. Wurde jemals ein armes Mädchen von seinen Dienstboten so misshandelt. Warum füge ich mir das Unrecht zu und nenne mich ein Mädchen? War ich vielleicht niemals verheiratet, Peggotty?«
»Gott weiß, dass Sie es waren, Ma’am«, erwiderte Peggotty.
»Wie kannst du es dann wagen«, sagte meine Mutter, »du weißt, ich meine nicht, wie du es wagen kannst, Peggotty, sondern wie du es übers Herz bringen kannst, mich so zu verstimmen und mir so böse Worte zu sagen, wo du doch recht gut weißt, dass ich außer dem Hause nicht einen einzigen guten Freund habe.«
»Umso mehr Grund für mich, Ihnen zu sagen, dass es nicht geht«, entgegnete Peggotty. »Nein, es geht nicht, nein, um keinen Preis. Nein!« Ich dachte schon, Peggotty würde den Leuchter wegwerfen, so energisch schwang sie ihn.
»Wie kannst du es nur so aufbauschen«, sagte meine Mutter und fing von Neuem an zu weinen, »und so ungerecht sein. Du tust so, als wenn alles schon abgemacht wäre, Peggotty, und ich sage dir doch immer und immer wieder, du grausames Ding, dass außer den gewöhnlichsten Höflichkeiten nichts vorgefallen ist. Du sprichst von Bewunderung. Was kann ich dafür, wenn die Leute so albern sind, solchen Gefühlen nachzugeben, ist das meine Schuld? Was soll ich denn tun, frage ich dich? Willst du vielleicht, dass ich mir die Haare schneiden oder das Gesicht schwärzen oder mich durch einen Brandfleck oder heißes Wasser oder sonst etwas Ähnliches verunstalten soll? Ich glaube, du wärst es imstande, Peggotty. Ich glaube, du würdest dich sogar drüber freuen.«
Peggotty schien sich diese Zumutung sehr zu Herzen zu nehmen, wie mir vorkam.
»Und mein lieber Junge«, schrie meine Mutter, kam zu mir in den Lehnstuhl und liebkoste mich. »Mein einziger kleiner Davy! Lasse ich es vielleicht an Liebe für mein Herzblatt fehlen? Für den allerbesten kleinen Jungen, den es je gegeben hat?«
»Kein Mensch hat das behauptet«, sagte Peggotty.
»Ja du, Peggotty«, gab meine Mutter zurück, »du weißt es ganz gut. Was soll ich denn anderes aus deinen Worten schließen, du unfreundliches Geschöpf, wo du doch recht gut weißt, dass ich mir bloß seinetwegen keinen neuen Sonnenschirm gekauft habe, obwohl der alte, grüne ganz abgeschoben ist und gar keine Fransen mehr hat. Du weißt es, Peggotty, und kannst es nicht leugnen.« Dann wandte sie sich wieder zärtlich zu mir, legte ihre Wange an meine. »Bin ich dir eine nichtsnutzige Mama, Davy? Bin ich eine hartherzige, grausame, selbstsüchtige, schlechte Mama? Sag Ja, mein Kind, und Peggotty wird dich lieben, und Peggottys Liebe ist viel besser als meine, Davy. Ich liebe dich gar nicht, nicht wahr?«
Darüber fingen wir alle an zu weinen. Ich glaube, ich war der lauteste von ihnen, aber ich weiß sicher, wir meinten es alle gleich aufrichtig. Ich war tief unglücklich und habe, fürchte ich, in der ersten Aufwallung verletzter Zärtlichkeit Peggotty ein »Biest« genannt. Ich erinnere mich noch, das ehrliche Geschöpf geriet in die tiefste Betrübnis und muss bei dieser Gelegenheit ganz knopflos geworden sein, denn eine ganze Salve dieser Geschosse flog ab, als sie vor meinem Stuhle niederkniete, um sich mit meiner Mutter und mir zu versöhnen.
Wir gingen sehr niedergeschlagen zu Bett. Mein Weinen hielt mich lange wach, und wenn mich ein besonders heftiges Schluchzen in die Höhe riss, sah ich, dass meine Mutter auf dem Bettrand saß und sich über mich beugte. Dann schlummerte ich in ihren Armen fest ein.
Ob schon am folgenden Sonntag der Herr wieder kam, oder ob ein längerer Zeitraum dazwischen lag, ist mir nicht mehr erinnerlich. In der Zeitrechnung bin ich meiner nicht ganz sicher. Aber er war in der Kirche und begleitete uns dann nach Hause.
Er trat auch zu uns herein, um ein schönes Geranium anzusehen, das im Fenster stand. Es kam mir nicht so vor, als ob er es besonders beachtete, aber ehe er ging, bat er meine Mutter, ihm eine Blüte davon zu geben. Sie bat ihn, sich selbst eine auszusuchen, aber das wollte er nicht – warum, war mir unbegreiflich –, und so pflückte sie ihm denn eine Blüte und gab sie ihm in die Hand. Er sagte, er werde sich niemals im Leben davon trennen, und ich dachte mir, er müsse sehr dumm sein, weil er nicht wisse, dass die Blätter in ein oder zwei Tagen ausfallen würden.
Peggotty fing an, uns abends weniger Gesellschaft zu leisten als früher. Meine Mutter gab ihr in sehr vielen Dingen nach, mehr noch als gewöhnlich, wie mir schien, und wir blieben alle drei die allerbesten Freunde.
Aber doch war es zwischen uns anders geworden, und es war uns nicht mehr so behaglich zu Mute. Manchmal kam es mir so vor, als ob Peggotty nicht recht zufrieden wäre, wenn meine Mutter die schönen Kleider anzog, die sie im Schrank hängen hatte, und so oft die Nachbarn besuchen ging. Aber ich war ganz froh, dass ich mir keine Gedanken darüber zu machen brauchte.
Allmählich gewöhnte ich mich daran, den Herrn mit dem schwarzen Backenbart zu sehen. Er gefiel mir nicht besser als am Anfang, und ich fühlte immer noch dieselbe unbestimmte Eifersucht. Aber wenn ich später einem instinktiven, kindlichen Widerwillen und dem Gedanken im Allgemeinen, dass Peggotty und ich vollkommen ausreichen müssten, meine Mutter ohne weitern Beistand glücklich genug machen zu können, noch einen anderen Grund dafür hatte, war es doch gewiss nicht der, den ich im reifern Alter für meine Abneigung herausgefunden hätte. Nichts Derartiges fiel mir ein. Ich konnte wohl stückweise beobachten, aber aus solchen Fäden ein Netz zu machen und darin jemand zu fangen, das ging und geht noch jetzt über mein Können hinaus.
An einem Herbstmorgen stand ich mit meiner Mutter in dem Vorgarten, als Mr. Murdstone, ich kannte jetzt seinen Namen, vorbeigeritten kam. Er hielt sein Pferd an, um meine Mutter zu begrüßen, und sagte, er ritte nach Lowestoft, um einige Freunde zu besuchen, die dort eine Jacht hätten, und machte den lustigen Vorschlag, mich vor sich auf den Sattel zu nehmen, wenn ich reiten wollte.
Das Wetter war so wunderschön, und das Pferd schnaubte und stampfte so munter vor der Gartentür, dass ich große Lust dazu hatte. Meine Mutter schickte mich daher zu Peggotty hinauf zum Anziehen, und mittlerweile stieg Mr. Murdstone ab und schritt, die Zügel über dem Arm, langsam vor der Rosenhecke auf und ab, während meine Mutter an der innern Seite neben ihm herging. Ich erinnere mich noch, wie Peggotty und ich aus dem kleinen Fenster hinabsahen, erinnere mich auch noch, wie eifrig meine Mutter und Mr. Murdstone die Rosenhecke zwischen sich zu betrachten schienen, während sie daran entlangschlenderten, und wie Peggotty, die vorher in wahrer Engelslaune gewesen, plötzlich ganz ärgerlich wurde und mein Haar wütend gegen den Strich bürstete.
Mr. Murdstone und ich waren bald unterwegs und trabten auf dem grünen Rasen neben der Landstraße dahin. Er hielt mich leicht mit einem Arm, und ich glaube nicht, dass ich besonders unruhig war. Aber ich konnte mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit den Kopf zu wenden und ihm ins Gesicht zu sehen.
Er hatte jene Art seichter schwarzer Augen – ich finde keinen bessern Ausdruck dafür –, die, wenn sie nachsinnen, durch irgendeine sonderbare Lichtbrechung zu schielen scheinen. Verschiedene Male, wenn ich ihn ansah, bemerkte ich das mit einer Art Scheu und hätte gern gewusst, worüber er so tief nachdenke. Sein Haar und sein Bart waren in der Nähe noch schwärzer und dichter, als ich geglaubt. Das starke Kinn und die schwarzen Punkte, die von dem sorgfältig rasierten Barte übrig blieben, erinnerten mich an eine Wachsfigur, die vor einem halben Jahr in unserer Gegend gezeigt worden war. Dieses, seine regelmäßigen Augenbrauen und das reiche Weiß, Schwarz und Braun seines Teints verwünscht sei sein Teint und verwünscht sein Andenken – machten, dass ich ihn trotz meiner Abneigung für einen schönen Mann hielt. Ich zweifle nicht, dass meine arme, liebe Mutter ganz derselben Meinung war.
Wir gingen in ein Gasthaus am Meere, wo zwei Herren in einem Zimmer Zigarren rauchten. Jeder von ihnen lag auf mindestens vier Stühlen und hatte eine weite zottige Jacke an. In einer Ecke lagen auf einem Haufen übereinander Röcke und Bootsmäntel und eine Flagge. Beide Herren richteten sich schwerfällig auf, als wir eintraten, und riefen: »Hallo, Murdstone! Wir dachten schon, du wärest tot.«
»Noch nicht«, sagte Mr. Murdstone.
»Was ist das für ein Gelbschnabel?« fragte einer der Gentlemen und fasste mich am Arm.
»Das ist Davy«, antwortete Mr. Murdstone.
»Was für ein Davy?« fragte der Herr Jones.
»Copperfield«, sagte Mr. Murdstone.
»Was? Der himmlischen Mrs. Copperfield Beigabe? Der reizenden kleinen Witwe?«
»Quinion«, sagte Mr. Murdstone, »nimm dich in acht, man ist schlau.«
»Wer denn?« fragte der Gentleman lachend.
Ich blickte rasch auf, denn ich hätte es auch gern gewusst.
»Bloß Brooks von Sheffield«, sagte Mr. Murdstone.
Ich fühlte mich ordentlich erleichtert, dass es bloß Brooks von Sheffield sei, denn anfangs hatte ich wirklich geglaubt, man meine mich.
Mr. Brooks von Sheffield musste wohl jemand sehr Komisches sein, denn die beiden Gentlemen lachten herzlich, als sein Name fiel, und Mr. Murdstone war auch sehr belustigt. Nach längerem Lachen sagte der Herr, der Quinion hieß: »Und wie ist Mr. Brooks’ von Sheffield Meinung in betreff des geplanten Geschäftes?«
»Hm, ich weiß nicht, ob Brooks vorderhand viel davon versteht«, entgegnete Mr. Murdstone, »aber ich glaube, im Allgemeinen ist er ihm nicht besonders günstig.«
Darüber wurde noch viel mehr gelacht, und Mr. Quinion sagte, er wolle nach Sherry klingeln, um auf Brooks Gesundheit zu trinken. Das tat er dann, und als der Wein kam, gab er mir ein wenig davon und ein Biskuit, und bevor ich trank, stand er auf und sagte: »Verwirrung komme über Brooks von Sheffield.«
Der Toast wurde mit großem Beifall und so herzlichem Gelächter aufgenommen, dass ich selbst mitlachen musste, worüber sie dann noch mehr lachten. Kurz, es war sehr lustig.
Wir gingen hierauf an den Klippen des Strandes spazieren und setzten uns ins Gras und schauten durch ein Fernrohr – ich konnte nichts sehen, als sie es mir vor das Auge hielten, behauptete aber, ich könnte es – und dann gingen wir zurück in das Hotel, um zeitig zu Mittag zu essen.
Während unseres Spazierganges rauchten die beiden Herren unaufhörlich, was sie – nach dem Geruch ihrer zottigen Röcke zu schließen – wohl seit dem ersten Tage an gemacht haben mussten, seit sie sie vom Schneider bekommen hatten. Ich darf nicht vergessen, dass wir auch an Bord der Jacht gingen, wo sie alle drei in die Kajüte hinunterstiegen und sich eifrig mit verschiedenen Papieren beschäftigten. Ich sah sie angestrengt arbeiten, wenn ich durch das offene Lukenfenster hinunterblickte.
Die ganze Zeit über ließen sie mich in Gesellschaft eines sehr netten Mannes mit einem großen Kopf voll roter Haare und einem sehr kleinen lackierten Hut. Er hatte ein buntgestreiftes Hemd an, mit dem Worte »Feldlerche« in großen Buchstaben quer über der Brust. Ich dachte, es sei sein Name und er schreibe ihn auf die Brust, weil er auf dem Schiffe wohnte und kein Haustor hatte, worauf er ihn hätte anschlagen können. Als ich ihn aber Mr. Feldlerche nannte, sagte er, das Schiff hieße so.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























