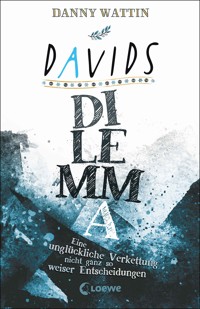
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schlamassel kommt selten allein Eigentlich wollte David doch nur den Sportunterricht schwänzen … Und jetzt das: Seine Klassenkameraden haben sein größtes Geheimnis erfahren. David ist Jude. Eine Neuigkeit, die sofort Neonazis auf den Plan ruft. Gleichzeitig hat David aber auch das Gefühl, endlich nicht mehr unsichtbar zu sein. Vor allem für die Aktivistin Maja. Daher tut er alles, um sie zu beeindrucken und der Diskriminierung zu entgehen. Und so verstrickt sich David zunehmend in Lügen und reitet sich immer tiefer in den Schlamassel … Ein schwarzhumoriger Roman über Antisemitismus Davids Dilemma ist ein schwarzhumoriger Own-Voice-Roman über Antisemitismus, Diskriminierung und Rassismus mit jüdischem Protagonisten, vor allem aber auch über Selbstfindung, Toleranz und den Kampf gegen Vorurteile. Satirisch zeigt Wattin die Relevanz dieses Themas unter Jugendlichen der heutigen Zeit auf und erschafft dadurch eine Coming-of-Age-Geschichte, die zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Anmerkung des Verlags
Vorwort
1Outing im Sportunterricht – das Mobbingopfer und der heimliche Jude – nur die Eingeweihten verstehen – das vierthübscheste Mädchen der Schule
2Wenig genug, um keine Bedrohung zu sein – Kundgebung gegen Israel – die Dicke Cissi und ich – späte Nachrichten
3Jüdische Mütter hören alles – peinliche Eltern – Micke und ich fantasieren – Antisemitismus laut Opa – die mieseste Minderheit der Welt
4Geoutet – alles die Schuld von Jesus – Krilles großer Bruder – ich esse, also geht es mir gut – gezeichnet
5Das Basketballspiel – die Kunst des Mobbens – das Hässlichste, was man tun kann – das Todesurteil
6Wie sinnlos es ist, ein rassistisches Vergehen anzuzeigen – zu Hause bei der Dicken Cissi – nichts ist so schlimm, dass es nicht noch schlimmer werden kann
7Du sollst deine Eltern nicht enttäuschen – einmal Sündenbock, immer Sündenbock – ich werde sichtbar – heja, Palästina
8Der Feigste in der Stadt – romantisch-politische Fantasien – Gruß in der Dusche – die haben es zu Hause ein bisschen schwer gehabt
9Zu Hause bei Oma – ich erzähle alles – der jüdische Frauenverein – Androhung von Gewalt ist ihre beste Waffe
10Das Aktivistentreffen – ich habe eiserne Prinzipien – Orangen aus Jaffa – wir räumen auf
11Die Verwandlung – meine Familie erlaubt das nicht – die Rache meiner Schwester
12Minoritätenwoche – lieber mobben als gemobbt zu werden – wir tanzen Hora – Statuserhöhung – dieselbe Stimme wie, als Palme ermordet wurde
13Geänderte Pläne – Autofahrt mit Mickes Mutter – ein Jude für einen anderen – der Stolz der Familie – ein richtiger Volksparteiler
14Ich falle in den neunten Kreis – die andere Gefahr – Jungs sind so verdammt dumm
15Ich werde Kriegsheld – mein Besuch beim Rektor – das rassistische Herz des Wachmanns
16Die Geschichte verbreitet sich und mutiert – wenn es schlimmer wird, dann ziehen wir weg – Micke und ich schießen mit dem Luftgewehr
17Liebt mich oder liebt mich nicht? – die Dicke Cissi rennt – der unangenehme Tonfall
18Beerdigung und Reuben Sandwich – in Angst mariniert – höchstens fünf Scheiben – ich verspreche, nie wieder Angst zu haben
19Micke ist schwer zu verkaufen – ein unbehagliches Treffen – ich erhalte ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann
20Ich bereite mich auf das Schlimmste vor – das Treffen im Vereinsheim – der Alibi-Jude – man kann sagen, was man will, aber feiern können sie
21Orthodox cool – alles, was etwas wert ist, hat seinen Preis – mehr als nur ein bisschen Vielfalt – die Gesichter des Kampfes
22Arische Zukunft – meine Schwester kriegt Wind von der Sache – den Affen spiele ich nicht für mich allein
23Ausflug entlang der blauen Linie – die besten Kichererbsen wachsen in Freiheit – ich muss Spießruten laufen
24Eine bewusste Provokation – Schluss mit der Maskerade – Songs, zu denen man rummachen kann
25Noch mehr Lügen – Elin wird misstrauisch – ich schieße meinen Wingman ab
26Die Suche nach Micke – mir brennen alle Sicherungen durch – drei Variablen, die man berücksichtigen muss
27Treffen am Bahnhof – der unfreiwillige Fahnenträger – derselbe Dresscode wie gewöhnlich
28Eine moderne Jeanne d’Arc – ich möchte die Zeit anhalten – sie glaubt, dass sie liebt
29Eine hoffnungslose Situation – wer sich wie ein Opfer benimmt, bleibt ein Opfer – ich verstehe (exakt) alles
30Ich stoße Judas vom Sockel – nicht die Frau am Strand – überall Blut – Alvik hatte keine Chance
31Drittes Zimmer links – sagen Sie, dass mir alles leidtut
32Ich erzähle alles – wir gehen zur Polizei – Papa kommt in Schwung – ein mickriger kleiner Beitrag – der beste Rat, den er geben konnte
33Ein halbes Jahr später – Umstellungsschwierigkeiten – ein Stein für Opas Grab – das dritthübscheste Mädchen der Klasse
Content Note
Anmerkung des Verlags
Liebe Leser*innen,
in diesem Buch werden verschiedene Dimensionen von Antisemitismus gezeigt. Darunter der Verschwörungsmythos, dass Jüdinnen*Juden die Medien regieren würden, viel Macht besäßen und sehr reich seien, sowie israelbezogener Antisemitismus. Dabei spielt auch der Nahostkonflikt eine Rolle.
Bitte beachtet, dass der Antisemitismus, der David entgegenschlägt, aus seiner Sicht geschildert und daher nicht auf den ersten Blick sichtbar widerlegt wird. Wenn ihr euch mehr über Antisemitismus informieren wollt, schaut bei Organisationen wie der Amadeu Antonio Stiftung vorbei.
Die Handlung spielt in den späten 80er-Jahren. So lassen sich bestimmte Ausdrucksweisen und eine z.T. drastische Sprache erklären, die wir heute so nicht mehr benutzen würden.
Zudem enthält der Roman weitere Inhalte, die potenziell triggernd sein könnten. Deshalb findet ihr am Ende des Buchs eine Content Note.
VORWORT
Der Text dieses Buches, das ihr in der Hand haltet, hat unter ungewöhnlichen Umständen zu mir gefunden. Ich war gerade dabei, ein Buch zu schreiben, das ich für wichtig hielt, mir aber keine sonderliche Freude machte. Immer wieder steckte ich fest, und anstatt zu arbeiten, erwischte ich mich selbst dabei, wie ich lange, ziellose Spaziergänge unternahm und an anderes dachte. An Dinge, denen ich sehr lange keinen einzigen Gedanken gewidmet hatte, wie zum Beispiel meine Kindheit und Jugend in einem Vorort von Stockholm.
Ich weiß nicht, warum es mir so schwerfiel, mich zu konzentrieren, oder warum meine Gedanken in diese Richtung herumwanderten. Allerdings habe ich den dringenden Verdacht, es lag daran, dass das Buch, an dem ich eigentlich schrieb, nicht sonderlich gut war. Denn eins habe ich in diesem Leben gelernt: Wenn sich was nach Zwang anfühlt und nicht nach Spaß, dann kann man sich die Mühe sparen. In eine solche Geschichte Leben bringen zu wollen, ist, als würde man einem toten Pferd die Sporen geben. Vielleicht habe ich damals auch deswegen so viel über die Vergangenheit nachgedacht – weil es sich anfühlte, als hätte ich den Kontakt zu jenem Teil von mir verloren, der wusste, was wirklich wichtig ist. Als schriebe ich inzwischen nur noch um des Schreibens willen – genau, wie ich mir einmal selbst geschworen hatte, es nie zu tun.
Meine Spaziergänge endeten oft in einem Café, wo ich Zeitung las oder ein Gespräch mit irgendeinem Bekannten begann, sofern zufällig einer dort war. Und bei einer dieser Gelegenheiten hörte ich das erste Mal von David. Ein alter Freund aus Kindertagen, der in derselben Stadt gelandet ist wie ich, erzählte mir diese unglaubliche Geschichte bei ein paar Tassen Kaffee. Was er sagte, faszinierte mich, auch wenn ich ihn erst nicht richtig ernst nahm. Das Ganze schien viel zu unwahrscheinlich, um so nah an dem Ort geschehen zu sein, an dem ich aufgewachsen war. Davon hätte ich doch schließlich hören müssen.
Im Grunde wusste ich, wer David war: ein schweigsamer, zurückhaltender Typ, einige Jahre jünger als ich. Aber mir war nicht klar, dass er auch Jude war. Ich hatte immer angenommen, der einzige in der ganzen Gegend zu sein. Genau wie ich musste er seine religiöse Identität lange geheim gehalten haben, und als sich die Ereignisse abspielten, von denen mein Jugendfreund erzählte, waren meine Familie und ich bereits aus dem Vorort in die Stadt gezogen. Bestimmt sei das der Grund, weshalb ich davon nichts wusste, meinte mein Freund.
Ich war ganz entschieden skeptisch, konnte die Sache aber trotzdem nicht vergessen. Denn wenngleich die Geschichte abwegig klang, brachte sie doch eine Saite in mir zum Klingen. Es steckte so viel darin, was ich wiedererkannte. So vieles, das eine Verbindung zu meiner eigenen Jugend schlug. Dinge, die ich selbst gefühlt, erlebt oder die mich beunruhigt hatten.
Je mehr ich an die Sache dachte, desto besessener wurde ich davon. Es dauerte nicht lange, dann gab ich mein eigenes Buch auf und verwandte meine ganze Zeit darauf, Klarheit in das zu bringen, was mein Freund erzählt hatte. Ich wühlte in Archiven nach alten Zeitungen aus den späten Achtzigerjahren und blätterte durch Jahrgangsbücher aus der Grundschule, um die Namen von Leuten zu finden, zu denen ich Kontakt aufnehmen könnte. Und zu meinem großen Erstaunen bestätigte, was ich las und hörte, dass die Geschichte meines Freundes womöglich wahr sein könnte.
Natürlich versuchte ich auch, David und seine Familie zu erreichen, doch das war hoffnungslos. Wie sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte nicht die geringste Spur von ihnen finden. Keine Information, keine Adresse, nichts. Und das, obwohl ich eine Zeit lang alle anschrieb, die vielleicht eine Verbindung zu der Familie hatten. Trotz aller Anstrengungen meldete sich niemand. Nach einer Weile sah ich ein, dass ich da nicht weiterkommen würde, und beschloss, das Ganze loszulassen. Ich hörte auf zu forschen und begann wieder zu schreiben: ein Buch über meine eigene, bedeutend weniger erlebnisreiche Jugend.
Als ich ungefähr die Hälfte meiner Geschichte fertig hatte, landete plötzlich dieses Kuvert im Briefkasten. Laut Poststempel kam es aus Neuseeland und es enthielt eine Ansichtskarte von einem Strand sowie ein dickes Heft mit dem Titel: »Das Protokoll des nicht so weisen David«.
Folgendes stand auf der Karte: »Ich habe gehört, du interessierst dich für das, was damals passiert ist. Hier steht alles drin. Mach damit, was du willst. Lies es, schmeiß es weg oder lass es drucken. Ist mir egal. Das ist so lange her, dass es genauso gut ein anderes Leben gewesen sein könnte.«
Auf dem Kuvert stand weder ein Name noch eine Adresse, aber ich ging mal davon aus, dass es von David stammte. Und wie ihr seht, habe ich mich dafür entschieden, es zu veröffentlichen. Denn selbst wenn wir eine in vieler Hinsicht ähnliche Jugend hatten, musste ich den Text doch nur rasch überfliegen, um zu begreifen, dass seine Geschichte so viel interessanter war als meine. Alles, wovor ich immer Angst hatte, ist David nämlich wirklich passiert.
Ich hoffe, ihr findet sein Geständnis ebenso aufschlussreich wie ich.
Danny Wattin, Uppsala im April 2021
1
Outing im Sportunterricht – das Mobbingopfer und der heimliche Jude – nur die Eingeweihten verstehen – das vierthübscheste Mädchen der Schule
Es begann im Sportunterricht. Wir hatten Orientierungslauf und es regnete, war matschig, grau und kalt. Ein Tag, an dem man eigentlich zu Hause sitzen und heiße Schokolade trinken sollte. Aber Sport-Mats scherte sich nicht ums Wetter. Er war den ganzen Vormittag im Wald draußen gewesen und hatte die Strecke vorbereitet und jetzt sollten alle laufen. Na ja, alle außer Helle, Lotta und Karro, die sagten, sie hätten ihre Tage – was sie immer behaupteten, wenn Sportunterricht war. Soll heißen, zweimal die Woche.
»Und los!«, schrie Sport-Mats und schickte Olof und Krille mit Karte und Kompass in der Faust auf die Strecke.
Ich stand ganz hinten in der Schlange und träumte mich weg. So einer war ich. Ein Träumer. Das hatte ich bisher noch in jedem der vierteljährlichen Lehrergespräche meiner Schullaufbahn gehört: Dass es nicht schaden würde, wenn ich mich ein bisschen weniger auf meine Gedanken und etwas mehr auf das, was im Unterricht passierte, konzentrieren würde. Das Problem war nur, dass meine Träume so viel interessanter waren. Derzeit handelten sie meist von Mädchen. Ich war ständig verliebt und wurde von einer romantischen Fantasie nach der anderen verschlungen. Einmal war ich mit Karro in meiner Klasse zusammen und dann wieder lag ich halb nackt mit dem vierthübschesten Mädchen der Schule an einem Strand – Maja aus der B.
Leider spielte sich so was bloß in meinem Kopf ab. In der Wirklichkeit hatte ich keine Chance. Ich war schüchtern, unsicher und spätentwickelt, und wenn eine von denen erfahren würde, was ich fühlte, dann würde die ganze Schule mich auslachen. Die Mädchen im Einserjahrgang, dem ersten der drei Gymnasiumsjahre, waren nicht interessiert. Sie wollten ältere Jungs und Hockeytypen mit dicken Muskeln. Solche, die dank der vielen Anabolika, die sie in sich hineingestopft hatten, früh durch die Pubertät gegangen waren.
Da meiner Verwandtschaft die üblichen Grenzen der Scham unbekannt sind, werde ich zu Hause oft über mein Liebesleben ausgefragt. Und wenn sich herausstellt, dass es nicht existiert, dann sehen mich alle für gewöhnlich mitleidig an, als ob mit mir irgendwas ernsthaft nicht stimmt. Außer Oma. Sie ergreift stets meine Partei und sagt, ich solle mir keine Sorgen machen. Es gebe schon für jeden eine, sogar für einen Schmock wie mich.
»Sieh dir nur ihn an«, sagt sie immer und zeigt auf meinen Vater. »Wenn er es geschafft hat, eine zu finden, dann musst du dir gar keine Sorgen machen. Obwohl es kein Schaden gewesen wäre, wenn er ein bisschen gewartet hätte.«
»Mama!«, schimpft Papa dann und wirft meiner Oma einen warnenden Blick zu.
»Aber er musste ja unbedingt die Erstbeste heiraten, die ein bisschen Interesse zeigte«, fährt Oma daraufhin fort. »Die verwöhnte kleine Tochter von Sara Kaminski. Hat es dir nie zu denken gegeben, dass kein anderer sie haben wollte?«
Wie Oma zu meiner Mutter stand, war ebenso wenig ein Geheimnis wie, was meine Mutter von ihrer Schwiegermutter hielt: Sie verabscheuten einander mit derselben glühenden Leidenschaft und verlangten alle beide die absolute Loyalität meines Vaters. Was wiederum zu einiger Zerrissenheit führte, sowohl in unserer Familie als auch in Papas Innerem. Doch das war meiner Oma egal.
»Hab nur Geduld, David«, beendete sie diese Gespräche für gewöhnlich immer. »Und sieh zu, dass du Arzt wirst. Dann werden die Mädchen Schlange stehen.«
Doch es war noch lange hin, bis ich einen Arztkittel würde überziehen können. Erst musste ich die drei Jahre auf dem Gymnasium überstehen und dann ein weiteres halbes Leben an der Uni – vorausgesetzt, dass ich es überhaupt ins Medizinstudium schaffte. Bis dahin musste ich schon echt viel Zeit und Mühe investieren, um bei den Mädchen irgendwie zu landen. Und der erste Schritt zu diesem Ziel war, das Schulhalbjahr und die Sportstunde des heutigen Tages mit einer akzeptablen Note zu überstehen.
Vor mir schickte Sport-Mats immer noch meine Klassenkameraden jeweils zu zweit auf den Weg. Weil ich spät gekommen war, hatten alle anderen sich bereits zu Teams zusammengefunden, was bedeutete, dass ich allein würde laufen müssen. Das war im Grunde nichts Ungewöhnliches. Ich hatte nicht viele Freunde und war oft für mich allein. Sonst hing ich meistens mit Micke aus der Parallelklasse rum. Der hatte um diese Zeit eine Freistunde und es war ihm auf wundersame Weise gelungen, den Billardtisch in der Cafeteria zu belegen. Wahrscheinlich stand er jetzt gerade dort und versuchte so auszusehen, als würde er auf einen Freund warten. Da würde er allerdings lange warten müssen, denn der einzige Freund, den er hatte, war ich.
»Na, David«, sagte Sport-Mats. »Willst du nicht laufen?«
Ich schaute aus meinen Träumen auf und bemerkte, dass nur noch ich übrig war. Der Rest der Klasse war bereits im Wald verschwunden. Und zu meinem Erstaunen hörte ich mich selbst sagen, dass ich nicht mitmachen könnte.
»Was?«, fragte Sport-Mats. »Warum nicht? Geht es dir nicht gut?«
Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, elend auszusehen. Normalerweise widersetzte ich mich den Lehrern nicht, doch es war ein Scheißwetter und es fühlte sich einfach ungerecht an, dass den Mädchen das alles erspart blieb, nur weil Sport-Mats keine Ahnung hatte, wie der Menstruationszyklus funktionierte.
Er sah mich kurz an und reichte mir dann eine eingeschweißte Karte. »Du siehst nicht krank aus«, stellte er fest. »Los, ab mit dir.«
Für gewöhnlich dachte ich mir nicht einfach was aus, aber an diesem Tag ging es mit mir durch.
»Ich kann nicht«, sagte ich. »Es … es ist Schabbat.«
Fragt mich nicht, warum ich das gesagt habe. Der Schabbat begann erst bei Sonnenuntergang. Und außerdem feierten wir ihn nicht. Wir waren schließlich die am wenigsten religiösen Juden im Großraum Stockholm.
»Du bist Jude?«, fragte Sport-Mats erstaunt.
Ich bereute sofort, etwas gesagt zu haben. Niemand in der Schule wusste, dass ich Jude war, und ich wollte auch nicht, dass es jemand erfuhr.
»Wie interessant«, fuhr er fort und betrachtete mein Gesicht wie ein Entdeckungsreisender, der auf eine neue, exotische Art gestoßen war. Ich wartete nur darauf, dass er etwas im Stil von »aber deine Nase ist ja gar nicht so groß« sagen würde und dann vielleicht noch irgendwas über Geld.
»Ja«, erwiderte ich. »Aber verraten Sie es niemandem.«
»Du solltest stolz darauf sein, wer du bist«, erwiderte Sport-Mats. »Die Juden sind ein kluges Volk. Fast alle Nobelpreisträger sind Juden.«
Er gab sich eindeutig Mühe, dem Ganzen etwas Positives abzuringen. So waren die Leute manchmal: Wenn sie nicht in die eine Richtung übertrieben, dann in die andere. Wenn wir Juden nicht die Medien kontrollierten und die Weltwirtschaft beherrschten, dann waren wir besser darin, klassische Musik zu spielen, und hatten einen höheren IQ.
Wie auch immer, mein Trick funktionierte, denn nachdem er da eine Weile gestanden und geglotzt hatte, rief Sport-Mats ein fröhliches »Mazel tov« und rannte in den Wald hinein, um zu kontrollieren, ob auch niemand schummelte. Ich hingegen ging in die Cafeteria, wo tatsächlich Micke stand und mit sich selbst Billard spielte.
»Tach«, sagte ich. »Sollen wir eine Partie spielen?«
»Ich dachte, du hättest Sport.«
»Bin abgehauen.«
Micke legte die Kugeln zurecht und stieß an. Er war ein Einzelgänger. Einer, den die Herde sehr früh ausgestoßen hatte. Warum, weiß ich nicht. Das hatte schon am allerersten Schultag in der Grundschule angefangen und seitdem hielten wir zusammen – das Mobbingopfer und der heimliche Jude.
»Guck mal«, sagte er. »Verdammt, ist die hübsch.«
Auf der anderen Seite des großen Fensters, draußen auf dem Hof, drückte Karro ihre Zigarette aus und warf sich in die Arme eines Typen aus dem Abschlussjahrgang.
»Schade, dass sie so dumm ist«, fuhr er fort, »sonst könnten wir zusammen sein. Sie mag mich. Das erkennt man daran, wie sie mich ansieht. Als wäre sie scharf auf mich.«
Manchmal machte Micke das. Dachte sich Sachen aus, die nicht einmal ein Fünfjähriger glauben würde. Aber weil er mein Freund war, sagte ich nichts.
»Aber wahrscheinlich ist sie sowieso nicht so gut zu ficken«, sagte er. »Zum Glück kenne ich ältere Frauen. Die wissen, was sie wollen im Bett.«
Noch so eine von Mickes Fantasien. Um seine Lügen zu unterfüttern, erzählte er ab und zu von den Dingen, die seine erfundenen Liebhaberinnen mit ihm machten. Dieses Wissen hatte er aus einer Sammlung Softpornos, die er im Nachttisch seiner Mutter gefunden hatte. (Das weiß ich, weil ich auch einmal darin gelesen hatte, als ich in Mickes Zimmer auf ihn wartete, während er beim Abendessen war.)
Wir spielten eine Runde. Vor dem Fenster hatten Karro und ihr Typ angefangen zu knutschen. Das war wirklich nicht gerecht. Dass die Idioten alle Mädchen kriegten.
»Hör auf zu glotzen, du Pervo«, sagte Micke und legte die Kugeln auf den Tisch. »Wir spielen noch eine Runde.«
Und das machten wir, bis Krille, Olof und Bengtsson der Hässliche vom Sport zurückkamen und meinten, jetzt wären sie dran.
»Ihr habt euch nicht eingetragen«, entgegnete Micke.
»Haben wir wohl«, sagte Krille und nahm ihm das Queue aus der Hand. »Haut ab, ihr Tunten.«
»Selber Tunte«, entgegnete Micke.
»Scheiß auf dich«, erwiderte Krille und boxte ihn.
»Was zum Teufel?«, fragte Micke.
Mit einem Mal wurde er wütend und das gefiel den anderen. So machten Krille und Olof es immer. Reizten Micke, bis er explodierte oder sich auf sie stürzte, sodass sie ihn verprügeln konnten, ohne Schuld zu haben.
»Komm«, sagte ich, »wir gehen.«
»Hör auf deinen Lover«, sagte Olof.
»David ist nicht mein Lover.«
»Hört ihr, was die Schwuchtel sagt?«, mischte sich Bengtsson der Hässliche ein und lachte laut. So war er. Ganz in Ordnung, wenn er alleine war, aber widerlich in Kombination mit Olof und Krille. Einer, der sein Fähnchen nach dem Wind hängte.
»Ich bin nicht schwul!«, schrie Micke fast. »Ich hab schon jede Menge Mädchen gehabt.«
»Deine Mutter zählt nicht«, erwiderte Krille. »Und deine Oma auch nicht.«
»Halt die Schnauze«, blaffte Micke, woraufhin ich ihn am Pullover packte und wegzog. Ich war von Natur aus feige und wollte mich mit niemandem prügeln, am allerwenigsten mit Krille, der nicht nur groß und stark war, sondern auch noch einen Neonazi zum Bruder hatte. In den Köpfen dieser ganzen Familie stimmte irgendetwas nicht und ich wollte mich nicht mit denen anlegen.
Stattdessen bugsierte ich Micke zu einem Tisch ein Stück den Flur hinunter, wo wir bis zum Beginn der nächsten Schulstunde Karten spielten. Meine Klasse hatte Religion. Das war das langweiligste Fach der ganzen Woche und die Lehrerin war eine christliche kleine Tante, die nach Knoblauch roch, Jesus liebte und so aussah, als wäre sie mindestens hundert Jahre alt. An diesem Tag war sie ganz außer sich und erzählte, dass bald die Minoritätenwoche in der Schule stattfinden würde. Fünf ganze Tage, an denen wir die Samen, die Finnlandschweden, die Roma, die Tornedalinger und die Juden feiern würden.
»Das wird so herrlich, mehr über die Sitten und Bräuche all dieser Gruppen zu lernen«, sagte sie und sah dabei komplett friedensbewegt aus.
So glücklich sie darüber war, so desinteressiert waren wir. So lief es immer. Was die Schüler hassten, liebten die Lehrer.
»Wir haben uns gedacht, dass wir eine Roma-Band einladen, um ein paar ihrer wunderbaren Lieder zu lernen«, fuhr sie fort.
»Na, super«, sagte Socke ironisch. Er war ein hochgewachsener Junge, der ganz hinten saß und so viele aufgekratzte Pickel im Gesicht hatte, dass er an einen Mondkrater erinnerte.
»Und dann sollten wir eine Trommelreise unternehmen«, fuhr sie fort. »Und den israelischen Volkstanz Hora tanzen. Vielleicht gibt es ja sogar jemanden hier, der weiß, wie man das macht?«
Die Klasse lachte und ich auch, um so zu tun, als hätte ich keine Ahnung, wie man Hora tanzte. Die Religionslehrerin sagte nichts, sondern stand nur schweigend da und ließ den Blick über alle Witzbolde gleiten, bis er auf mir landete. Sie glotzte so, dass es richtig unbehaglich war – als würde sie erwarten, dass ich etwas sagte. Aber das tat ich nicht. Ich starrte nur geradeaus, ohne ihrem Blick zu begegnen, bis sie schließlich aufgab und zum Unterricht zurückkehrte.
Ihr Verhalten beunruhigte mich und ich verfluchte mich selbst, weil ich Sport-Mats meine geheime religiöse Identität offenbart hatte. Das sollte man niemals tun. Ja, vielleicht, wenn man in New York wohnte oder an einem vergleichbaren Ort, wo es noch mehr von uns gab, aber nicht hier. Das wusste jeder. Und wer es doch tat, der war selbst schuld. So wie meine Tante Hannah, die in einer Schule südlich der Stadt gearbeitet hatte und während einer Geschichtsstunde Holocaustleugner in der Klasse dadurch überzeugen wollte, indem sie erzählte, was unserer Familie in der Hitlerzeit passiert war. Leider erntete sie nicht das erhoffte Verständnis. Stattdessen begrüßten die Schüler sie danach im Vorbeigehen mit dem Hitlergruß und riefen, dass sie vergast gehöre. Außerdem kriegte sie so viele widerliche Telefonanrufe und unverschämte Briefe nach Hause, dass sie am Ende kündigte und nach Göteborg umzog. Die Leute begriffen das einfach nicht. All die wohlmeinenden Erwachsenen, die sagten, man solle stolz auf seine Herkunft sein. Sie kapierten nicht, wie die Konsequenzen aussahen. Deshalb schwieg ich, wenn die anderen Judenwitze rissen und »Sieg Heil!« riefen. Weil ich bedeutend mehr Angst hatte als Stolz.
Den Rest der Unterrichtsstunde saß ich vor Sorge, entlarvt zu werden, total verkrampft da. Und als Religion zu Ende war, schlich ich schnell in den Korridor hinaus, ehe die Lehrerin mich noch so was fragen konnte wie, ob ich beschnitten war oder ob ich koscheres Essen zum Mittag haben wollte. Auf dem Weg nach draußen kam ich an der Cafeteria vorbei, wo Maja und ihre linksradikalen Freunde saßen und sich auf eine weitere Demonstration vorbereiteten. Sie hatten Schals und indische Kleider an und auf dem Tisch lag eine selbst gebastelte palästinensische Flagge, die sie gerade bunt anmalten.
»Hallo, David«, sagte sie, als ich vorbeiging.
»Hallo«, sagte ich erstaunt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass sie überhaupt wusste, wer ich war.
»Heute ist in Stockholm eine Kundgebung gegen Israel«, erklärte sie. »Kommst du mit? Wir müssen so viele Leute wie möglich für den Kampf zusammenkriegen.«
2
Wenig genug, um keine Bedrohung zu sein – Kundgebung gegen Israel – die Dicke Cissi und ich – späte Nachrichten
Zum Glück konnte Papa mich nicht sehen, wie ich da zusammen mit Maja und den anderen Demonstranten in der Bahn nach Stockholm saß.
»Wissen die nicht, dass die Hamas das jüdische Volk vernichten will?«, hätte er gefragt. »Das steht sogar in ihren Statuten: Siehst du einen Juden sich hinter einem Stein verstecken, dann komm und töte ihn.«
»Möchte noch jemand Haferbrei?«, hätte Mama dann geantwortet, weil sie für gewöhnlich keine Lust hatte, sich in unlösbare geopolitische Konflikte einzumischen.
»Die verüben die ganze Zeit Terroranschläge in Israel. Schicken Selbstmordattentäter los und benutzen das eigene Volk als menschliche Schutzschilde. Und trotzdem kriegen immer wir die Schuld.«
»Wer wir?«, hätte Mama geantwortet.
»Die arabischen Staaten können machen, was sie wollen, ihre eigene Bevölkerung ermorden und Andersdenkende ins Gefängnis werfen. Die schwedische Regierung schleimt sich trotzdem bei ihnen ein. Aber sowie die einzige Demokratie des Nahen Ostens versucht, sich zu verteidigen, hat sie die ganze Welt gegen sich. Und wisst ihr, warum? Na, weil wir eine unbedeutend kleine Wählergruppe sind. Zu wenige, um eine Bedrohung zu sein …«
»… und genug, um als Sündenbock herhalten zu müssen«, hätte dann der Rest der Familie im Chor ergänzt, weil wir diese Argumentation schon so viele Male gehört hatten, dass wir sie im Schlaf runterbeten konnten.
Solche Standpunkte nahm man allerdings nur zu Hause ein. Draußen unter anderen Menschen schwieg man besser. Das war am sichersten. Vor allen Dingen, wenn man wie ich gerade mitten zwischen den lautesten Kritikern des israelischen Staates saß.
»Ich begreife nicht, wie die so böse sein können«, sagte Majas Freundin Elin und schielte zu einem älteren Typen hin, der auf der anderen Seite des Waggons mit einem Plakat saß, auf dem »Israelis = Mörder« stand.
»Ja, oder?«, stimmte ihre andere Freundin Lina zu. »Selbst sind sie von den Nazis verfolgt worden und jetzt machen sie das Gleiche mit anderen.«
Beide gingen zusammen mit Micke in eine Klasse. Er hasste sie. Meinte, sie seien falsch und eingebildet, was er immer behauptete, wenn Mädchen nichts mit ihm zu tun haben wollten.
»Der sieht ganz schön gut aus«, flüsterte Elin und nickte zu dem Typen mit dem Plakat. »Ob er wohl eine Freundin hat?«
»Das solltest du vielleicht mal checken«, flüsterte Maja zurück.
Mich hatten sie völlig vergessen, wie ich da eingeklemmt zwischen dem Fenster und einem verschwitzten Typen in Batikklamotten saß. Es war ein Fehler gewesen mitzugehen, so viel stand fest. Aber jetzt war es zu spät. Also blieb ich auf meinem Platz sitzen und träumte von Maja und wie sie eines Tages erkennen würde, dass ich fantastisch war. Und wie wir zusammenkommen und glücklich und zufrieden in einem Haus am Mittelmeer leben würden, das groß genug war, um unseren Freunden und zukünftigen Kindern Platz zu bieten.
Ich wurde aus meinen Tagträumen gerissen, als die Bahn an der nächsten Haltestelle anhielt und eine große Schar Demonstranten hereinströmte.
»Tariq!«, brach es aus Maja hervor und sie lächelte einen Typen mit dunkler Haut und kräftigem Stoppelbart an, der aussah, als wäre er mindestens zwanzig.
»Hallo, Maja«, sagte er und umarmte sie. Mehr hörte ich nicht, weil ihr Gespräch im Geschnatter der anderen Demonstranten unterging. Die waren echt aufgeregt, standen dicht gedrängt zwischen den Türen und redeten von der Besatzungsmacht und Übergriffen, während sie einander scharf abcheckten, um herauszukriegen, wer Single war. Nach einer Weile gingen Plastikflaschen mit Alkohol im Waggon herum. Die enthielten eine höllische Mischung aus Gin und irgendetwas, das Orangenlikör gewesen sein könnte. Es schmeckte schrecklich, aber ich würgte trotzdem ein paar große Schlucke herunter. Danach fühlte ich mich ein wenig ruhiger und das war auch gut so, weil die Demonstranten immer aggressiver wurden, je näher wir der Stadt kamen. Sie schrien Parolen darüber, dass man die israelische Davis-Cup-Mannschaft und verschiedene landwirtschaftliche Produkte boykottieren solle. Und eine Gruppe aus der sozialdemokratischen Jugend begann zu grölen, dass »der Zionismus zerschlagen« gehöre. Je aggressiver die Stimmung in der Bahn wurde, desto mehr Alkohol schüttete ich in mich hinein, und als wir am Hauptbahnhof ankamen, war ich ziemlich betrunken.
Ich konnte Maja nicht sehen, ging aber einfach hinter ihren Aktivistenfreunden her und folgte ihnen zum Sergels torg, einem der belebtesten Plätze in der Innenstadt. Dort trafen wir auf eine große Menschenmenge, die schrie und mit Flaggen wedelte. Außerdem gab es da eine Bühne, auf der diverse Politiker Reden hielten, während die Demonstranten unten Flaschen kreisen ließen und We Shall Overcome sangen. Ich griff mir eine Weinflasche und nahm ein paar Schluck. Und auf einmal stand ich einfach nur da und nahm alles auf – alle Lieder und Parolen und die aufgebrachten Stimmen. Aber vor allem schaute ich zu den Aktivistenmädchen. Sie waren so unfassbar hübsch, und wenn es stimmte, dass Gegensätze sich anziehen, dann hätten sie mich lieben müssen.
Ich muss ganz in Gedanken gewesen sein, denn als ich das nächste Mal wieder aufsah, war ich von einer Gruppe hochgewachsener Männer aus dem Nahen Osten umgeben. Sie sahen wütend aus und schrien etwas, was ich nicht richtig verstand, das aber wahrscheinlich von Juden handelte. Ich meinte nämlich das Wort »Yahudi« zu hören und dann etwas, was zumindest ein bisschen wie »töten« klang. Ich bekam einen Riesenschreck und das mussten die Männer gemerkt haben, denn plötzlich konnte ich geradezu spüren, wie sie mich anstarrten. Um die Situation zu retten, begann ich auch zu brüllen, dass man die Juden erschießen und steinigen und dahin zurückschicken solle, wo sie hergekommen waren. Und da verstummten die Männer und sahen mich an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank, woraufhin ich die Gelegenheit ergriff und schnell davonschlich.
Da ich nirgends mehr die anderen von der Schule entdecken konnte, verließ ich die Demonstration und setzte mich auf dem Friedhof in der Nähe des Hauptbahnhofs auf eine Bank, wo ich die Flasche leerte. Dann fuhr ich mit der S-Bahn nach Hause. Ich stieg an unserer Station aus, pinkelte in einen Busch hinter dem Bahnhofsgebäude und torkelte zur Bushaltestelle, wo ich mich auf eine Bank fallen ließ. Dann muss ich eingeschlafen sein, denn das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass mich jemand in die Seite pikte.
»Wach auf, David. Der Bus ist da.«
Es war die Dicke Cissi. Sie stand da und glotzte mich mit schmachtendem Blick an, als wäre sie Aschenputtel und ich ihr Prinz.
»Was?«, fragte ich.
»Willst du nicht mitfahren?«
»Doch«, antwortete ich, »klar.«
Cissi nahm mich am Arm und half mir auf. Dann umarmte sie mich. Das machte sie immer, wenn wir uns sahen, und zwar, weil sie in mich verliebt war. Darüber tratschen ihre Klassenkameradinnen schon seit Ewigkeiten. Das war so typisch: Jeder wollte genau den haben, den er nicht kriegen konnte. Ich wollte Maja, Elin, Lina und im Grunde genommen alle anderen im Einserjahrgang, die nicht direkt abstoßend waren. Und die Einzige, die mich haben wollte, war die Dicke Cissi.
Sowie wir im Bus saßen, begann sie zu quasseln. Redete davon, wie toll es doch war, mich zu sehen, was sie in der Stadt gemacht hatte und was sie machen würde, wenn sie mit dem Gymnasium fertig war. Reisen und Jura studieren. Ich starrte auf ihre Lippen, während die Worte in mein eines Ohr hinein und aus dem anderen wieder heraus rauschten. Wenn ich so richtig verzweifelt war, dachte ich manchmal darüber nach, ob ich mit der Dicken Cissi schlafen sollte, einfach nur, um es hinter mir zu haben. Als eine Art Übung für den Tag, an dem ich die Chance bekommen würde, es mit einer zu tun, die ich mochte. Aber das war keine gute Idee. Einerseits, weil es gemein wäre, sie auszunutzen, und andererseits, weil sich alle über mich lustig machen würden, wenn das je rauskam. Aber trotzdem konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, als ich da neben ihr saß und ihre Lippen sich so nah vor meinem Gesicht bewegten. Ich konnte den Gedanken irgendwie nicht abschütteln. Er biss sich die ganze Fahrt über in mir fest und auch noch, als wir den Bus verließen und das letzte Stück nach Hause gingen. Und dann führte irgendwie eins zum anderen und plötzlich standen wir einfach da, vor Cissis Haus, und knutschten. Es war, als würde es ganz von selbst geschehen. Die Zunge, die in ihrem Mund herumwirbelte, und die Hand, die auf ihrer Brust landete. Ich dachte nicht einmal darüber nach, was ich da tat, so betrunken war ich. Erst als sie sich an mich drückte und ihren Mund auf mein Ohr presste, wurde ich aus meiner Trance geweckt.
»Es ist niemand zu Hause«, flüsterte sie. »Du kannst mit reinkommen. Ich weiß, wo Papa seine Kondome hat.«
Und da schlug die Panik zu. Ich riss meine Hand zurück, als hätte ich mich verbrannt, und machte einen schnellen Schritt rückwärts.
»Ich muss gehen«, sagte ich.
»Jetzt?«, fragte Cissi.
»Ich habe meinen Eltern versprochen, ihnen mit einer Sache zu helfen. Meine Großeltern kommen morgen und wir müssen …«
»Aber …«, begann sie.
»Oh, verdammt!«, rief ich und sah auf die Uhr. »Ich hätte schon vor ein paar Stunden zu Hause sein sollen.«
Hastig wich ich von Cissi zurück und hinaus auf die Straße. Erst sah sie enttäuscht aus, aber dann lächelte sie mich aus ihrem großen, runden Gesicht an.
»Vielleicht können wir uns am Wochenende sehen?«, schlug sie vor. »Mama und Papa fahren am Sonntag weg.«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Vielleicht.«
Und damit drehte ich mich um und rannte, so schnell meine betrunkenen Beine mich trugen.
Als ich nach Hause kam, saß Papa im Wohnzimmer und schaute die Spätnachrichten.
»Das kann doch wohl nicht wahr sein«, zeterte er. »Jetzt waren die Idioten wieder draußen unterwegs und haben protestiert. Haben rumgebrüllt, dass man Apfelsinen boykottieren sollte. Wissen die nicht, dass Israel inzwischen ein Technikstaat ist?«
Auf dem Fernseher liefen Bilder von der Kundgebung, auf der ich gewesen war. Ich stellte mich ein Stück entfernt hin, damit Papa nicht riechen konnte, dass ich getrunken hatte. Aber ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Er war so von den Nachrichten gefesselt, dass er nicht mal gemerkt hätte, wenn ich in Flammen aufgegangen wäre.
»Wo warst du eigentlich?«, fragte er, als der Beitrag vorbei war und der Wetterbericht folgte.
»In der Stadt.«
»In der Stadt! Wusstest du nicht, dass die demonstrieren würden? Dir hätte es übel ergehen können.«
»Hab nicht mehr dran gedacht«, antwortete ich. »Aber es war kein Problem.«
»Ganz schöne Idioten, was?«
»Ja«, erwiderte ich.
Und dann sahen wir schweigend die Vorhersage für die nächsten fünf Tage.
»Du«, sagte ich, »ich geh dann mal schlafen.«
»Bist du krank?«
»Nur ein bisschen müde. Bis morgen.«
Ich lief in mein Zimmer, legte mich aufs Bett und erst da begriff ich, wie betrunken ich wirklich war. Denn das Zimmer fing an, herumzukreiseln wie das übelste Kettenkarussell auf Gröna Lund. Und zwar nicht eins von denen, die Spaß machten. Das war wahrscheinlich meine Strafe dafür, dass ich »Erschießt die Juden« geschrien und der Dicken Cissi an die Brust gefasst hatte.
Es gelang mir, die Übelkeit unter Kontrolle zu halten, bis Mama und Papa sich auch schlafen gelegt hatten. Dann schlich ich vorsichtig hinaus ins Badezimmer, klappte den Klodeckel hoch und kotzte so leise, wie ich nur konnte.





























