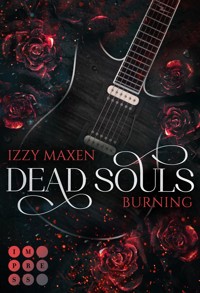5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Er ist mein Feind. Aber vielleicht ist eine gewisse Annäherung keine schlechte Idee – Vertrauen kann nützlich sein.« James Daily will meinen Tod. Und ich seinen. Die Unterschiede zwischen uns könnten größer nicht sein – denn ich bin eine Inmorti, eine Untote, und James ist der Anführer unserer Jäger. Eigentlich wollten wir durch ein Rockkonzert mit unserer Band Dead Souls ein Zeichen setzen für Versöhnung zwischen Inmorti und Menschen. Doch James und seine Anhänger stürmten die Show in Sydney und er nahm mich gefangen. Nun aber offenbart er plötzlich eine ganz andere Seite. Und obwohl ich ihn mit jeder Faser meines Körpers hassen sollte, ist da etwas an ihm, das mich anzieht wie die Motte das Licht. Auch wenn ich nur ein Pfand in seinen Händen bin und nicht mehr – oder? Diese düstere Romantasy entführt in die Abgründe der Unsterblichen – eine in Bann ziehende Story über die Anziehung des Verbotenen und eine Liebe, die stärker ist als alle Gesetze. »Dead Souls Falling« ist eine spannende Enemies to Lovers-Romantasy, in der Forced Proximity auf Forbidden Love trifft. Dies ist der zweite Band der Trilogie. Er ist unabhängig vom ersten Band lesbar, für ein besseres Verständnis empfiehlt es sich jedoch, in chronologischer Reihenfolge zu beginnen. //Alle Bände der »Dead Souls«-Reihe: -- Band 1: Dead Souls Burning -- Band 2: Dead Souls Falling -- Band 3: Dead Souls Loving//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Izzy Maxen
Dead Souls Falling (Dead Souls 2)
»Er ist mein Feind. Aber vielleicht ist eine gewisse Annäherung keine schlechte Idee – Vertrauen kann nützlich sein.«
James Daily will meinen Tod. Und ich seinen. Die Unterschiede zwischen uns könnten größer nicht sein – denn ich bin eine Inmorti, eine Untote, und James ist der Anführer unserer Jäger. Eigentlich wollten wir durch ein Rockkonzert mit unserer Band Dead Souls ein Zeichen setzen für Versöhnung zwischen Inmorti und Menschen. Doch James und seine Anhänger stürmten die Show in Sydney und er nahm mich gefangen. Nun aber offenbart er plötzlich eine ganz andere Seite. Und obwohl ich ihn mit jeder Faser meines Körpers hassen sollte, ist da etwas an ihm, das mich anzieht wie die Motte das Licht. Auch wenn ich nur ein Pfand in seinen Händen bin und nicht mehr – oder?
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Playlist
Danksagung
© Sarah Kastner Fotografie
Izzy Maxen ist Autorin, Lektorin, Mama, Ehefrau, Freundin, Leseratte, Fastnachter, Shoppingqueen und ganz klar schokoladensüchtig. Sie wohnt mit ihren fünf Männern im hektischen Rhein-Main-Gebiet und freut sich über jede Minute, die sie Zeit für ihre Bücher findet. Darin spielt sie gern mit Klischees und gibt direkt zu, dass sie den Bad Boys echt verfallen ist.
Playlist
Smells Like Teen Spirit – Nirvana
Pushed Again – Die Toten Hosen
Good Time – Danko Jones
Overdrive – Ofenbach
Ex’s & Oh’s – Elle King
The Sound of Silence – Disturbed
Ain’t Gonna Drown – Elle King
Breaking the Habit – Linkin Park
Blindside – James Arthur
Vois sur ton chemin – Bennet
S&M – Rihanna
Prolog
Boston 1790
Bonnie
Ich wollte sterben. Ich hasste mein Leben. Und ich würde ihm nie verzeihen, dass er mich gerettet hatte.
Mein Tod war ein Unfall. Wir waren auf dem Rückweg von einem Empfang im Upperhill House, ich hatte zu viel Champagner gehabt und der Gentleman, dessen Begleitung ich an diesem Abend war, fing an, mich in der Kutsche zu begrapschen. Zumindest bis zu dem Moment, in dem ich seinen Revolver aus der Tasche zog, den Abzug betätigte und das Scheißding explodierte. In meiner Hand, direkt vor meinem Gesicht.
Ich erinnere mich an Schmerzen. Grausame, brennende Schmerzen, die sich anfühlten, als hätte mir jemand die Haut vom Knochen gezogen. Überall war Blut, Bentley brüllte.
Während es in meinen Ohren rauschte, fragte ich mich noch, warum er mir nicht half. Dann fiel ich kraftlos auf den Holzboden der Kutsche. Irgendjemand packte mich, vermutlich Bentley, und schleifte mich hinaus bis zum Straßengraben.
Es war Winter und weiße Schneeflocken rieselten auf mein blutrotes Kleid. Ein Geschenk meines letzten Gönners, die Spitze hatte er extra aus Paris importiert. Der neuste Schrei in Boston, der Stadt, die sich in den letzten Jahren zum strahlenden Stern der neuen vereinigten Staaten von Amerika entwickelt hatte. Nun ja, und zu einem Moloch von Emporkömmlingen, wie Bentley einer war. Jung, erfolgreich und zum Abwinken hässlich, weshalb er auf die Dienste einer Kurtisane zurückgriff, die ihn begleiten sollte. Eine meiner Beschäftigungen, eine von vielen, die ich in den letzten Monaten gehabt hatte, um zu überleben.
Denn diese ach so tolle neue Welt war vor allem eines: grausam. Wenn du kein Geld hattest, warst du am Arsch. Als Frau erst recht, denn in dem wundervollen Amerika kam nur weiter, wer einen Namen hatte, das nötige Kleingeld oder wenigstens ein paar Kontakte. Ich besaß nichts von alledem. Mein Vater war im Krieg gestorben, meine Mutter versoff alles Geld, was er uns hinterlassen hatte. Mir blieb lediglich mein hübsches Gesicht und meine wohlklingende Stimme. Also lernte ich, wie man einen Schwanz lutschte, damit die Kerle am Ende des Abends auch zahlten.
Diese Sache mit Bentley hatte ich allerdings falsch eingeschätzt.
Zitternd robbte ich weiter durch den Schnee, schrie der Kutsche nach, die mit ihm in der Nacht verschwand. Mir war kalt, ich fühlte meine Hände nicht mehr. Meine Zehen. Nur noch dieses Brennen im Gesicht. Irgendwann blieb ich liegen. Es würde sowieso nichts mehr ändern. Die Kälte schwappte über mich hinweg. Sagte man nicht, dass einem warm wird, wenn man erfriert? Konnte ich nicht bestätigen, mir war arschkalt.
»Verfluchter Pisser«, presste ich hervor und spuckte einen Schwall Blut aus. In einem anderen Leben würde ich ihn dafür umbringen, dass er mich einfach am Straßenrand hatte liegen lassen.
Nur dass mir kein anderes Leben mehr blieb.
Ich fühlte, wie die Kraft aus meinen Gliedern wich, wie das Klappern meiner Zähne langsam verebbte. Wie dann doch Wärme in meinen Fingerspitzen kribbelte und ich plötzlich das Bedürfnis verspürte, mir dieses beschissene Kleid vom Körper zu reißen. Penny Hemsworth hatte mich den ganzen Abend angestarrt. Vermutlich war sie neidisch auf die Spitze. Tja, dann sollte sie sich einen anderen Emporkömmling suchen, wenn ihrer nicht ordentlich bezahlte.
Mit letzter Kraft drehte ich mich auf den Rücken. Über mir spannte sich der dunkle Nachthimmel, einzelne Sterne blitzten auf. Einzelne Schneeflocken legten sich auf meinen Körper. Bis morgen früh würde ich verschwunden sein.
Langsam atmete ich aus. Das war’s dann also. Verreckt am Straßenrand, aufgrund einer verfickten explodierten Pistole.
Ich lächelte träge. Weit entfernt hörte ich meine Mum schimpfen, dass ich wieder Mist gebaut hatte. Wie ich immer Mist baute, weil ich nichts anderes konnte. Aus diesem Grund war ich mit dreizehn von zu Hause abgehauen. Nach Boston, um wie alle anderen in dieser Stadt mein Glück zu finden. Nur ich offensichtlich nicht. Wäre ich doch in dem kleinen Kaff in New Hampshire geblieben. Dann hätte ich jetzt vielleicht einen Ehemann, Kinder, ein Leben.
Ja, Mum, im nächsten Leben höre ich auf dich. Vielleicht. Nicht.
»Hey, du Schönheit.«
Fuck! Konnte man nicht mal in Ruhe sterben?
Erneut schwappte Blut über meine Lippen. Ich musste würgen.
»Hm. Deine Lunge hat was abbekommen. Und dabei … ist das echt bedauerlich. Du bist hübsch. Aber irgendetwas sagt mir, dass dir dieses Kleid nicht gehört. Hast du das geklaut?«
Ich blinzelte. »Was …« Die Worte gingen in einem Hustenanfall unter.
Über mir ragte ein Schatten auf. Der Statur nach ein Mann mit Zylinder, dessen Gesicht ich nicht erkennen konnte. Nur … zwei goldene Augen, die in die Dunkelheit strahlten. Scheiße, was war das?
Ein Zittern ging durch meinen Körper. Ich drehte mich weg … okay, ich wollte mich wegdrehen, aber mein Arm gehorchte mir nicht mehr.
»Lass es. Du stirbst sowieso gleich.« Die dunkle Stimme klang verflucht spöttisch.
Mit letzter Kraft hob ich die andere Hand und streckte dem Kerl den blutigen Mittelfinger entgegen.
Er lachte leise auf. Dunkel, aber irgendwie ehrlich.
»Verschwinde«, nuschelte ich.
»Du bist anders. Lass mich das nicht bereuen!«
Er tat irgendwas mit seinem Arm. Eine schnelle Bewegung, der ich nicht folgen konnte. Kurz darauf wurde mir schwarz vor Augen. Die Kälte verschwand, ich fühlte mich in wohlige Watte gepackt. So fühlte es sich also an zu sterben.
Ich war tot.
Bestimmt mehrere Minuten lang.
Dann riss ich den Mund auf und rang panisch nach Luft. Prompt verschluckte ich mich, spuckte eine ekelhafte Flüssigkeit aus, die plötzlich in meinem Mund war.
»Trink!«
Was?!
Ich wollte den Kopf wegdrehen, versuchte mich zu bewegen, ihn wegzuschieben, aber mein Körper gehorchte mir nicht mehr. Meine Lider wurden schwer, eine unsichtbare Kraft zog mich nach unten. Mir war heiß und kalt. Ich fror und verbrannte. Und ich bekam keine Luft mehr, weil dieses unbekannte Arschloch seinen Arm auf meinen Mund presste.
Ohne darüber nachzudenken, streckte ich die Zunge aus. Glitt über sein Handgelenk, wollte ihn wegschieben und … erstarrte. Meine Zungenspitze kribbelte und ein süßer Geschmack breitete sich darauf aus, rann meine Kehle hinunter, tanzend, belebend. Und mit einem Mal veränderte sich irgendetwas. Ein heißes Prickeln durchströmte meinen Magen, flüssiges Feuer, das durch meine Adern glitt.
Mit einem Ruck packte ich den Arm des Fremden. Er lachte auf und fluchte im selben Moment, als ich in seine Haut biss. Meine Zunge leckte gierig über die Wunde, aus der sein Blut drang, direkt in meinen Mund und in meinen Körper. Und ich trank. Scheiße, ich saugte sein Blut aus ihm heraus.
Und es schmeckte wie der süßeste Honig, den ich je getrunken hatte.
Hitze flutete meinen Körper, füllte mich aus. Eine unglaubliche Lebendigkeit überwältigte mich, ich hatte das Gefühl, als würden tausend Ameisen durch meine Adern jagen.
»Das reicht.« Mit Gewalt zog er seinen Arm weg.
Keuchend rang ich um Luft. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich in den sternenklaren Nachthimmel.
Ich war Feuer. Hitze. Tod.
Alles in einem, zu viel und zu wenig.
Ich wusste nicht mehr, wo mein Körper anfing, wo er aufhörte, fühlte meine Glieder nicht mehr. Da war nur noch diese allumfassende Hitze unter meiner Haut, die mich verbrannte.
Ein Schrei durchbrach die Nacht. Meiner?
Luft füllte meine Lunge. Saubere, klare Nachtluft. Ich schmeckte Blut auf meiner Zunge, meines, seines.
Ich blinzelte. Das war unmöglich. Das alles hier.
Vorsichtig bewegte ich die Finger. Die Fußzehen. Den Arm.
Meine Haut spannte, mein ganzes Gesicht kribbelte. Ich leckte mir über die Lippen und fühlte – perfekte, unverletzte Haut.
Mit einem Ruck setzte ich mich auf. Der Fremde stand über mir und sah auf mich herab. Noch immer ging dieses merkwürdige goldene Schimmern von seinen Augen aus. Blonde Strähnen schimmerten unter seinem Hut hervor, während seine helle Haut in hartem Kontrast zu dem dunklen Mantel stand, den er trug.
Er war jung, Anfang zwanzig und doch verriet das teuflische Grinsen in seinem Gesicht, dass er sehr viel mehr erlebt haben musste als jeder andere in seinem Alter.
Irritiert tastete ich über mein Gesicht. Ja, da war Blut, aber mehr auch nicht. Keine zerfetzte Haut, keine Brandblasen, nichts Ungewöhnliches. Es fühlte sich beinahe so an, als hätte sich mein Körper selbst regeneriert. Doch das war unmöglich. Noch immer hörte ich die explodierende Pistole, spürte, wie mich die Kraft verließ, wie die Dunkelheit mich zu sich zog und einhüllte. Ich war gestorben, verflucht. Und doch füllte sich meine Lunge mit Luft und ich atmete.
»Was hast du getan?«, flüsterte ich.
Das Grinsen des Fremden wurde breiter. Teuflisch.
»Willkommen zurück, Beauty.«
»Was hast du getan?« Meine Stimme überschlug sich. Mühsam rappelte ich mich hoch, da mein Kleid nach wie vor blutgetränkt war. Ich fühlte mich erstaunlich ausgeruht, ja, fast euphorisch. Wie nach einem langen Spaziergang im Park oder gutem Sex, wenn der ganze Körper vor Energie kribbelte und man am liebsten weitermachen würde.
Nur definitiv nicht mit dem Kerl vor mir, der jetzt eine leichte Verbeugung andeutete.
»Nichts für ungut, aber ich habe dir gerade ein Leben geschenkt.«
Seine Worte machten etwas mit mir. Ich wusste, dass er die Wahrheit sagte, obwohl ich es nicht verstand.
»Meine Verletzungen sind …«
»Verschwunden. Und das werden sie auch bleiben, wenn wir schnell handeln.« Er neigte den Kopf und trat einen Schritt zurück. Die Straße lag im Dunkeln und erst jetzt stellte ich mir die Frage, woher er auf einmal gekommen war.
»Weißt du, wer dir das angetan hat?«, fragte er.
Bilder blitzten vor meinen Augen auf, das Gefühl der Schmach, Wut und Ausweglosigkeit. Bentley.
»Ja.«
»Und weißt du auch, wo wir ihn finden?«
»Vermutlich ist er im Kings Club in Boston.«
Der Fremde hielt mir eine Hand hin. »Er ist nur ein Mensch, Beauty. Das musst du dir stets sagen. Du hingegen wirst etwas Besonderes sein.«
Ich verstand immer weniger, was er sagte. Aber vielleicht lag das auch an dem Abend, der durch und durch bizarr war.
»Wer bist du?«
Seine Hand war warm. Keine Schwielen, als hätte er noch nie arbeiten müssen.
»Rome.«
»Und weiter?«
»Nichts weiter. Einfach nur Rome.«
»Und wohin werden wir gehen, einfach nur Rome?«
»Bis ans Ende der Welt, Beauty. Und ich werde immer da sein und dich beschützen.«
Kapitel1
Bonnie
Rome hat gelogen. So viele Male. Und weil er sein Versprechen gebrochen hat und nicht da war, um mich zu beschützen, bin ich durch die Hölle gegangen.
Doch gerade heute kann und will ich den finsteren Erinnerungen nicht zu viel Raum geben. Und so streiche ich mir energisch über das Gesicht, um sie fortzuwischen. Dabei ist mir bewusst, dass sie niemals gänzlich verschwinden werden. Sie lauern in den Schatten meiner Gedanken und warten nur darauf, mich zurück in die Dunkelheit zu ziehen.
Meine Kopfhaut ziept unangenehm und ich spüre, wie sich Druck in meiner Brust aufbaut. Ich blinzle. Atme tief durch. Und konzentriere mich wieder auf den flackernden Fernsehbildschirm in meinem Wohnzimmer – dem größeren Problem, seit James Daily in einem verschissenen Interview aller Welt von uns Inmorti erzählt hat.
»Ich stehe hier am Sydney Square und direkt hinter mir hat sich eine Menschenmenge eingefunden, die Antworten von der Regierung fordert«, fährt die junge Fernsehmoderatorin fort. Ihre blonden Haare sind vom Wind zerzaust, ihre Augenlider flattern nervös. »Sie wollen mehr über die sogenannten Inmorti erfahren. Wissen, ob diese Wesen eine Gefahr für die Menschheit darstellen und was die Regierung für unseren Schutz tut. Inzwischen sind bereits Stimmen laut geworden, die eine Gefangennahme aller Inmorti fordern. Ebenso die der Assertoren, der radikalen Gruppe, die offenbar gegen diese neuartigen Wesen kämpft.« Die Moderatorin wird durch laute Rufe unterbrochen. Hinter ihr haben sich Menschen versammelt, die Gesichter geschminkt wie Totenköpfe. Bizarr, grausam. Die Schilder in ihren Händen zeigen die Illustrationen von Leichen, Zombies; alles, was das Internet so hergibt. Schriftzüge begleiten sie, die unsere Ausrottung verlangen.
Mir wird schlecht. Lichtblitze flackern vor meinen Augen auf, ich fühle, wie sich Kälte durch meine Adern frisst.
Ich will sterben.
Ich bin kein Inmorti.
Die Welt ist schön.
Ein weißes Leuchten erfüllt mein Umfeld. Plötzlich höre ich eine Männerstimme, vertraut und doch fremd. Nein, er kann nicht bei mir sein. Das ist unmöglich. Hektisch blinzle ich, versuche hierzubleiben, in Sydney, in meinem Apartment, aber ich versinke in den Erinnerungen. Bilder flackern vor meinem geistigen Auge auf. Ich meine einen Stich an meinem Arm zu spüren. Nur eine kleine Wunde, trotzdem reagiert das Selen sofort. Es brennt, kämpft gegen das verfluchte Eisen, das durch die Nadel in meine Adern fließt. Doch bei diesem Metall ist das Zaubermittel, das uns am Leben hält, machtlos. Eisen zerfrisst unseren Körper und verhindert, dass wir heilen. Zu viel davon würde mich töten.
»Untote Menschen, das ist abartig«, brüllt jemand aus dem Fernseher und reißt mich damit zurück in die Realität. »Tote sollten nicht leben. Und wie ernähren sie sich – von unseren Gehirnen wie Zombies? Wir müssen sie abschlachten, bevor sich diese Seuche weiterverbreitet.«
Schwankend stehe ich wieder in meinem Wohnzimmer in Paddington, die Mittagssonne scheint durch das Fenster und ich rieche den Duft nach Pancakes. Trotzdem fühle ich das Eisen nach wie vor in meinem Körper. Mühsam ringe ich nach Luft, ein Frösteln läuft über meinen Rücken.
»Mach das aus!« Rome tritt an mir vorbei, greift nach der Fernbedienung in meiner Hand und schaltet die Nachrichten ab. »Wir wissen auch so, was in der Stadt passiert.«
Für einen Moment schließe ich die Augen. Versuche mich zu konzentrieren, versuche die Bilder in meinem Kopf in den Griff zu bekommen. Die Gefühle, die durch mich hindurchrasen und meinen Verstand auseinanderzerren. Ich glaube zu schwanken, zu brechen. Energisch balle ich die Hand zur Faust. Nein, nicht noch einmal. Ich darf das nicht zulassen.
»Cy hat angerufen. Wir sollen heute zu Hause bleiben.« Rome steht nach wie vor neben mir. Seine Körperwärme kitzelt auf meinen nackten Armen.
»Geht es dir gut?« Sanft legt er seine warmen Finger an mein Kinn, um meinen Kopf zu drehen, bis ich ihn ansehen muss. In seinen dunkelbraunen Augen hängt der Schlaf, seine hellblonden Haare sind ein wüstes Chaos. Auf seiner Wange befindet sich der Abdruck seines Kopfkissens. Er muss eben erst aufgestanden sein, trotzdem blitzt hellwache Sorge in seinem Gesicht auf.
»Nein«, sage ich ehrlich. Rome zu belügen hat noch nie funktioniert.
Er seufzt. »Es tut mir leid, dass du das miterleben musst.«
»Das musst du doch auch.« Ich drehe den Kopf, sodass seine Hand von meiner Haut gleitet.
»Ja, aber ich kann damit umgehen. Für mich sind die da unten nicht mehr als ein paar irre Spanner.«
»Die da unten?« Alarmiert sehe ich auf und gehe zum Fenster. Ich war so in Gedanken, dass ich die lauten Rufe ausgeblendet habe. Doch jetzt entdecke ich die Menschentraube vor der Eingangstür unseres Apartmenthauses sofort. Journalisten mit Kameras sind darunter, allerdings auch Maskierte mit Hassplakaten in den Händen. Zwei Polizeiautos parken die Straße hinunter, während mehrere Beamte vor den Eingangstüren stehen und ein gewaltsames Eindringen verhindern. Das erklärt zumindest, warum noch niemand durch unsere Wohnungstür gestürmt ist.
»Seit wann stehen die da?« Meine Stimme klingt zu dünn. Angst schwappt in ihr mit. Seit wir die Dead Souls gegründet haben, bin ich Menschenmassen gewohnt. Gerade in den letzten Jahren hatten wir nach Konzerten oder auch bei Marketing-Events immer mit Fans zu tun. Aber das heute ist etwas anderes. Die Menschen sind nicht hier, weil sie meine Musik lieben. Oder mich. Ganz im Gegenteil.
»Seit heute Nacht. Ich wollte dich nicht wecken.«
»Verdammt, Rome!« Aufgebracht fahre ich herum. »Hör auf, mich beschützen zu wollen. Das kannst du nicht. Wann verstehst du das endlich?«
Mein Bruder verzieht das Gesicht, als hätte ich ihn geschlagen. Was ich tatsächlich schon einmal getan habe, nur gerade treffen ihn meine Worte härter. Auch wenn Rome nicht mein leiblicher Bruder ist, verhält er sich meist wie einer. Im Laufe der Jahre – der Jahrhunderte – sind er und Asher zu den Geschwistern geworden, die ich nie hatte. Wir stehen füreinander ein, kümmern und sorgen uns umeinander, hassen und lieben uns. Und nutzen es zuweilen aus, dass wir nicht wirklich miteinander verwandt sind.
»Nein, aber vielleicht wäre es gut, du würdest endlich mal jemandem diese Rolle zugestehen. Es ist wichtig, dass du über das sprichst, was passiert ist. Du musst das aufarbeiten, wenn die …«
»Und das soll ich ausgerechnet mit dir tun?«, schnauze ich, bevor er ihren Namen aussprechen kann. Er weiß, dass ich nicht hören will, was passiert ist. Viel zu gut.
»Nein.« Er neigt den Kopf und streicht sich durch die Haare. Dann geht er durch das lichtdurchflutete Wohnzimmer zur offenen Küchenzeile und schaltet die Kaffeemaschine ein.
Rome ist der Typ Kerl, der selbst morgens um neun schon einen Whiskey trinkt. Aber offenbar sind selbst ihm die Geschehnisse der letzten Tage auf den Magen geschlagen.
Ich lege den Kopf in den Nacken und atme tief durch. Ein neuer feiner Riss zieht sich durch die weiß getünchte Decke, ein Zeichen dafür, dass selbst in diesem Apartment etwas ganz und gar nicht stimmt.
»Es tut mir leid«, sage ich leise, weil Rome meine Wut nicht verdient hat. »Es ist nur …« Die Situation? Die Menschen da draußen, die unseren Tod fordern? Das Gefühl, eingesperrt zu sein? »Es ist alles gerade.«
Mit zwei Tassen Kaffee kommt Rome zu mir zurück. Wortlos reicht er mir eine, dann zieht er mich mit der freien Hand zu sich heran und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Seine Lippen sind weich und kurz fühle ich das vertraute Kribbeln, das seine Nähe in mir auslöst.
»Ich weiß«, murmelt er in meine Haare.
Ich drehe mich herum, sodass er hinter mir steht, und nippe an meinem Kaffee. Einen Arm um meine Taille gelegt, zieht er mich zu sich heran, während auch er einen Schluck nimmt.
Zwischen Rome und mir war vom ersten Moment an diese Spannung, die mir unter die Haut gegangen ist. Ich kann noch nicht einmal genau sagen, was es ist – klar, der Kerl ist unfassbar attraktiv, aber nur daran liegt es nicht. Rome hat mich gewandelt. Er hat mir seine Welt erklärt, mir Möglichkeiten offenbart, von denen ich nie zu träumen gewagt habe. Trotzdem konnte er mir nie das geben, was ich wirklich gesucht habe. Die Liebe zwischen ihm und mir ist anders, heiß und kribbelnd, sie heilt mein Herz jedoch nicht. Auch deshalb habe ich dieser Spannung nie nachgegeben, bin nie weitergegangen, als ihn zu küssen, aus Angst, dass der Schritt kaputtmachen würde, was zwischen uns ist.
»Was tun wir jetzt?«, frage ich und werfe einen vorsichtigen Blick aus dem Fenster. Die Meute ist natürlich nicht verschwunden, es sind eher noch weitere Menschen dazugekommen. »Woher wissen die überhaupt, dass wir auch Inmorti sind? Und wo wir wohnen?«
»Keine Ahnung. Vielleicht hat Juniper was gesagt.«
Dafür fängt er sich einen Ellenbogenstoß.
»Hey«, protestiert er und knurrt unzufrieden.
»June würde uns nie verraten. Ich weiß, dass du sie nicht magst, doch sie ist loyal. Sie hat sich für uns entschieden – und sie liebt Asher. Das würde sie niemals tun.« Mit meiner Menschenkenntnis ist es sonst nicht weit her, aber bei Juniper bin ich mir sicher. Seit dem Tod ihres Vaters wohnt sie bei Asher und zerreißt sich vor Vorwürfen, dass die Situation eskaliert ist. Der Tod ihrer älteren Schwester hat ihr schwer zugesetzt. Und dass ihr eigener Bruder die Schuld daran trägt, dass Menschen patrouillierend durch die Straßen Sydneys ziehen und unseren Tod fordern, macht die Sache nicht besser.
»Ich habe nie gesagt, dass ich sie nicht mag«, erwidert Rome und reibt über meinen Bauch.
Ich drehe den Kopf, sodass ich ihn ansehen kann, und hebe eine Augenbraue.
Er fletscht die Zähne. »Ich mag Menschen nicht sonderlich. Das hat nichts mit ihr persönlich zu tun.«
Ich gehe nicht auf seine Aussage ein, denn das ist der falsche Zeitpunkt, um darüber zu diskutieren. Und mit Romes Abneigung gegen die Menschheit habe ich mich schon vor vielen Jahren abgefunden.
»Vielleicht war es ihr Bruder.« Erneut wandert mein Blick zu dem Fernseher. Der Bildschirm ist schwarz, trotzdem meine ich, James’ Gesicht zu erkennen. Den harten Ausdruck auf seiner Miene, die vor Wut und Hass verzerrten Augen. Er sieht June unglaublich ähnlich, sogar die Haarfarbe ist dieselbe, was nicht verwundert, immerhin ist er ihr Zwillingsbruder. Wie alle Assertoren ist er sportlich gebaut, selbst in dem schwarzen Hoodie hat man seine Muskeln erkannt. In einem anderen Leben, ja, da fände ich ihn scheiße attraktiv und er wäre genau der Mann gewesen, dem ich mein Leben anvertraut hätte.
Nur nicht in diesem.
Einem Leben, in dem ich mir vor zwei Wochen mit Entsetzen sein Video auf TikTok habe ansehen müssen. Gefolgt von weiteren Malen, weil ich einfach nicht glauben konnte, was er da sagt. Dass er uns Inmorti bloßstellt und sich offen als Assertor zu erkennen gibt. Er hat alles ruiniert, die ganze Welt ins Chaos gestürzt. Und ich bezweifle, dass ihm bewusst war, was er da eigentlich tut.
»Lass uns von hier verschwinden«, sage ich und reiße meinen Blick vom Fernseher los.
»Aber Cy …«
»Scheiß auf Cy. Du hast noch nie das getan, was er wollte. Fang jetzt nicht damit an.«
Ein Grinsen hebt Romes Mundwinkel, bis seine makellosen Zähne aufblitzen. Schalk fängt sich in seinem Augenwinkel und für einen kurzen Moment erinnert er mich wieder an den Gentleman aus der Nacht vor zweihundert Jahren, der mich gewandelt hat.
»Wo möchtest du denn hin, Beauty?« Er wählt die Worte bewusst.
»Ans Ende der Welt«, sage ich und grinse ebenfalls. »Und weit darüber hinaus.«
***
Das Ende der Welt ist in dem Fall ein Club in der King Street. Rome und ich sind über den Balkon unseres Apartments auf das angrenzende Dach gesprungen; der Rest war ein Kinderspiel. Gekleidet in kurze Shorts, T-Shirt, Basecap und Sonnenbrille sind wir an den Journalisten vorbei zu unserem Auto in der Seitenstraße gelaufen. Einer der Vorteile, wenn man ein Inmorti ist – deine Sinne sind schärfer als die der Menschen. Und zu allem Überfluss konnten wir auch noch ihre notgeile Neugierde und ihren abgrundtiefen Hass auf uns nutzen, um uns zu nähren. Ihre Gefühle aufzunehmen ist für uns ein Leichtes – und für die Menschen harmlos. Sie spüren höchstens ein feines Kribbeln, das so unscheinbar ist, dass sie es im Normalfall nicht bemerken. Außer Rome eskaliert und saugt einen Menschen aus, dann kann es in der Tat gefährlich werden – wenn nicht sogar tödlich.
Die Ironie der Situation, dass wir die hetzende Meute als Snack genutzt haben, lässt mich selbst jetzt, eine Stunde später, noch grinsen.
»Hier, dein Wein.« Der Barkeeper stellt ein neues Glas Chardonnay vor mich – mein mittlerweile drittes –, während Rome einen Whiskey nach dem anderen herunterkippt. Dabei sieht er immer wieder auf sein Handy.
Das Licht im Three Monkeys ist trotz der Mittagsstunde gedimmt, was vor allem an den mit Stickern zugeklebten Fenstern liegt. Durch die Ritzen dringt nur wenig Sonnenlicht, was der Atmosphäre des Clubs aber keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil. Die Flecken auf dem mit Teppich ausgelegten Fußboden versinken so in den Schatten und der abgewetzte Tresen bekommt einen nostalgischen Touch. Selbst der Barkeeper mit seinem dunklen Vollbart und den Piercings in Augenbraue und Nase passt zum Ambiente. Einem Ambiente, das ich wirklich liebe. Vielleicht weil ich hier das erste Mal vor Publikum gesungen habe.
»Cy will, dass wir das Konzert kommende Woche absagen.« Rome feuert sein Handy auf die Theke. Es knackt verdächtig.
»Er will, dass wir uns verstecken, oder?« Ich nippe an dem Wein und lasse meinen Blick durch den Club gleiten. Außer uns sind nur wenige Gäste da, die uns bisher nicht beachtet haben.
»Ja«, knurrt Rome.
Von uns allen hat er am meisten mit Cys Führung zu kämpfen. Er hat sich dem Clan angeschlossen, weil ich darauf bestanden habe. Weil ich zu irgendwem gehören wollte und nach … nun ja, ich habe Sicherheit gebraucht. Ein Zuhause. Einen Ort, an dem ich mich wieder traue, auf die Straße zu gehen, ohne bei dem kleinsten Geräusch zusammenzuzucken. Cy bietet mir das. Oder zumindest hat er das, bis die Assertoren durchgeknallt sind.
»Vielleicht sollten wir das tun. Vielleicht sollten wir wirklich unsere Sachen packen und Sydney verlassen. Was hält uns hier?«
Rome zieht die Sonnenbrille von seiner Nase und fährt sich durch die blonden Haare. Seine dunklen Augen blitzen, während sein scharf geschnittener Kiefer hervortritt. Obwohl Rome weit über dreihundert Jahre alt ist, hat er sich einen jugendhaften Charme erhalten. Allerdings würde niemand den Fehler begehen, ihn als Jungen zu bezeichnen. Eine dunkle Aura haftet an ihm, die jeden einen Schritt zurücktreten lässt, der ihm begegnet.
»Sei nicht so naiv, Bonnie. Die ganze Welt hat von uns erfahren. Es gibt keinen Platz mehr, an dem wir uns verstecken können.«
»Und unsere Bekanntheit als Band trägt ihr Übriges dazu bei.«
Er flucht leise. »Ich werde mich nicht verstecken.«
Nachdenklich ziehe ich die Unterlippe zwischen die Zähne. Mein Blick bleibt an der Ecke hängen, in der abends oft eine Band spielt. Die Instrumente fehlen, aber Mikros und Verstärker stehen an der Wand. Einem Impuls folgend rutsche ich von meinem Barhocker und gehe dorthin. Die Mikros sind angeschlossen und als ich eines anschalte, hallt ein kurzer hoher Piepton durch die Bar.
»Hey«, sage ich laut.
Rome hebt eine Augenbraue. Die anderen wenigen Gäste wenden sich mir zu. Sie fangen an zu tuscheln, eine junge Frau deutet auf mich.
Ich hole Luft und horche in mich hinein. Das Lied ist alt, viel älter als die Dead Souls. Aber gerade jetzt fühle ich es.
»I was walking on a road in the middle of nowhere.
The sun was shining bright, heat burning on my skin.
I can still hear their screams, feel their pain.
But I walked on a road, leaving behind ashes and sin.«
Rome dreht sich auf seinem Barhocker herum, bis er mir gegenübersitzt. Ein spöttisches Grinsen zupft an seinen Lippen, dann legt er den Kopf in den Nacken und flucht.
Hitze kribbelt auf meiner Haut und für einen Moment könnte ich schwören, wirklich die sonnenverbrannte Erde zu riechen.
»I was in a city, in the middle of nowhere.
It was dark and cold, snow in my hair.
I still feel their blows, see their hate.
But I fled from that city, behind me fire and care.«
Ich schließe die Augen. Fliege durch die Vergangenheit, zurück nach Boston in den Winter 1795. Ich war allein in diesem Jahr, weil Rome etwas in New York zu erledigen hatte. An einem Abend bin ich an den falschen Mann geraten. Er wollte mich umbringen – nur dass man uns nicht so einfach töten kann. Sein Pech, am Ende der Nacht hatte ich Geld und eine Leiche. Und mehrere Zeugen, die mich durch die Straßen jagten und denen ich lediglich durch Glück entkommen bin. Rome habe ich erst zwei Jahre später wiedergefunden. Als Witwer der Frau, die er geheiratet und sich ihrer dann entledigt hatte.
»I was in a country«, singe ich, »at the world’s end.«
Es kommen immer mehr Menschen in den Clubraum, drängen sich um die Bar, deuten auf mich. Rome hat sich in eine Ecke verzogen, trotzdem fixiert er mich.
Ich blende alles aus. Die neugierigen, fragenden Blicke, in denen Angst hängt, weil die Leute mich anders sehen. Vielleicht zum ersten Mal wirklich. Sie begreifen, dass unsere Texte sehr viel wahrer sind, als wir bisher behauptet haben.
»I was in a country, at the world’s end«, wiederhole ich und schreie die Worte förmlich heraus. Fühle die Musik in meinem Inneren, durch die ich endlich einen Kanal gefunden habe, meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Und den lasse ich mir nicht mehr nehmen.
»Red sand under my feet, free wind in my hair.
I feel my dreams in the songs, feel the music in the air.
A stranger in the middle of nowhere, but for the first time free.
I’m in a country and sing my songs. For the first time for me.«
Das Lied habe ich geschrieben, direkt nachdem wir in Australien ankamen. Gebrochen und gehetzt, weil es keinen anderen Ort mehr für uns gab.
Meine Stimme verklingt. Ich bleibe auf der improvisierten Bühne stehen, das Mikro immer noch in der Hand. Ein zynisches Lächeln zwingt meine Lippen auseinander und bevor ich weiter darüber nachdenken kann, verbeuge ich mich tief. Theatralisch und bewusst übertrieben.
Ein harter Klatschlaut hallt durch den Clubraum. Dann bricht Getöse los. Die Begeisterung der Menschen schwappt auf mich über, das Selen in meinem Körper jubiliert. Ein elektrisierendes Kribbeln jagt durch meine Adern und mein Grinsen wird breiter.
»Danke!«, brülle ich ins Mikro.
»Bist du nicht Bonnie Campbell von den Dead Souls?«, fragt eine junge Frau über das Klatschen hinweg. Sie trägt eine Jeansjacke über einem weißen Top und kurze schwarze Shorts.
»Ja, das bin ich. Willst du ein Foto?« Das Selen ist im Rausch und ich mit ihm.
»Klar!« Sie kommt zu mir, zieht ihr Handy aus der Hosentasche und drückt sich an mich. Zusammen grinsen wir in die Kamera.
»Danke, großartig!« Ihre Aufregung lässt ihre Stimme flattern. »Du bist echt der Knaller, du bist meine Lieblingssängerin. Not breaking for you ist mein absoluter Lieblingshit.«
Kurz schießt ein Stich durch mich hindurch, weil es genau das Lied ist, das so viel von mir verrät. Oder eben nicht, da ich danach … nach dieser Zeit an dem Ort, über den ich nicht nachdenken will … jemand anderes war.
»Cool. Der Song ist was Besonderes.« Ich grinse tapfer, die Euphorie zerbricht.
»Das spürt man.« Sie lächelt. In ihrer Lippe glänzt ein Piercing. »Sag mal, bist du wirklich unsterblich?«
Ich zucke zusammen. Das ist das erste Mal, dass mich das jemand direkt fragt.
»Ja, das bin ich.« Mit geschürzten Lippen ziehe ich die Sonnenbrille ab und blicke sie an. Aus goldglänzenden Augen, die sich in ihren spiegeln. Normalerweise fällt den Menschen das nicht auf, da sie das einfach für eine ungewöhnliche Färbung der Iriden halten. Doch jetzt wissen sie es besser.
Die Kleine legt den Kopf schief und mustert mich. Neugierig, aber völlig ohne Angst. »Ultracool!«
Ein Lachen bricht aus mir heraus und mein Lächeln wird echt. »Wenn du magst, erzähle ich dir ein bisschen was darüber.«
Sie klatscht in die Hände. Begeisterung dringt ihr aus jeder Pore.
Ein junger Mann tritt zu uns, seine Haut hebt sich auffällig blass von seinem schwarzen T-Shirt ab. »Wäre es okay, wenn ich zuhöre? Und gibst du mir vielleicht noch ein Autogramm?«
Ich lecke mir über die Lippen, hebe den Kopf und suche mit den Augen nach Rome. Dieser lehnt im Schatten neben der Bar, ein weiteres Glas Whiskey in der Hand. Als sich unsere Blicke treffen, hebt er es an und prostet mir zu. Er nickt und lächelt, trotzdem erkenne ich den Argwohn in seinen Augen.
Das hier ist neu für uns. Für uns alle.
Aber in diesem Augenblick entscheide ich, dass wir uns nicht verstecken werden. Ich will nicht mehr weglaufen, ich will mich nie wieder klein fühlen.
Für keinen Menschen und schon gar nicht wegen eines Assertoren.
Kapitel2
James
Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich mich einmal in einem Filmstudio wiederfinden würde, geblendet vom Licht der Kameras. Doch genau heute lässt mich dieses den Kopf zur Seite drehen, um in das Gesicht der Fernsehmoderatorin zu blicken. Hillary Smith ist das bekannteste Gesicht im australischen Morgenfernsehen. Nur aus diesem Grund sitze ich überhaupt hier und verschanze mich nicht in meinem Haus, wie ich es die letzten zwei Wochen getan habe. Denn seit meiner Offenbarung über die Inmorti und Assertoren steht die Welt Kopf.
Journalisten belagern unser Haus, genauso wie Menschen, die Antworten wollen. Außerdem die Polizei, seit zwei Tagen sogar das Militär. Ich habe telefoniert, mit der Präsidentin Australiens, mit Journalisten, Rechtsanwälten, Ärzten. Irgendwann sogar mit dem Vorsitzenden für interne Sicherheit.
Mein Onkel Carl koordiniert das alles, die Offenbarungskampagne, wie er es nennt. Für ihn ist es der einzige Weg, diese Seuche endlich auszurotten.
Und ich gebe ihm recht. Allerdings habe ich unterschätzt, was das mit mir macht. Ich fühle mich gefangen, schuldig, weil so viel außer Kontrolle gerät. In den Augen der Menschen sind wir nicht die Helden dieser Geschichte, was wir – zumindest für mich – aber immer waren. Doch die Hassnachrichten über die Assertoren, die ich täglich über Twitter verfolge, sprechen eine klare Sprache. Hinzu kommt, dass mich die Trauer um meinen Dad und auch Summer zerreißt. Mein Dad war der Puffer, der sich vor mich gestellt hat. Er war der Anführer der Assertoren, nun bin ich es. Ich bin nicht mehr James, der Typ, der Grafikdesign studiert und gerne surft, nein. Jetzt bin ich das Aushängeschild der Assertoren und habe kein Privatleben mehr.
»Also, James. Ich darf doch James sagen, oder?«
»Natürlich.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln, das so falsch ist wie Hillarys faltenfreies Gesicht.
»Sie haben mit Ihrem Video vor zwei Wochen ja ganz schön für Wirbel gesorgt. Und seitdem haben Sie sich nicht weiter geäußert, obwohl wir alle verständlicherweise Fragen haben.« Lächelnd deutet sie ins Publikum.
Uns gegenüber, versteckt durch die grellen Scheinwerfer, die mir die Sicht nehmen, sitzen im Halbkreis rund zweihundert Gäste im Studio. Zwischen ihnen rennen Kamerateams hin und her, um Reaktionen einzufangen und Hillary und mich in Szene zu setzen.
Schweiß sammelt sich unter meinen Armen und ich verfluche meinen Onkel ein weiteres Mal dafür, dass er mich hierzu zwingt. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Scheinbar gelassen streiche ich mir eine Strähne des rotbraunen Haares aus der Stirn. Hillary lächelt mich immer noch an, allerdings wirkt sie verkrampft und mir wird klar, dass sie nach wie vor auf eine Antwort wartet.
»Ich habe in den letzten Wochen sehr viele Interviews geführt und mich bemüht, alle Fragen zu beantworten. Aber ich verstehe, dass Sie weiterhin unsicher sind. Der Gedanke, dass es da draußen Wesen gibt, die stärker sind als wir, schneller, leistungsfähiger, und die im Gegensatz zu uns nicht sterben können, ist gruselig. Und ich verstehe, dass man sich gegen diese Vorstellung wehrt, weil sie alles aushebelt, was uns die Wissenschaft bisher gelehrt hat.«
Hillary nickt zufrieden. Mein Onkel hingegen, der neben einem Kamerateam am Rand steht, schenkt mir einen unzufriedenen Gesichtsausdruck. Er hebt eine Hand und gibt mir mit den Fingern ein Zeichen.
In meiner Brust zieht sich etwas zusammen; mein Herz, das in den letzten Wochen trotz allem einfach nicht aufgehört hat zu schlagen. Ich weiß, was er von mir will. Und ich hasse ihn dafür. Doch gibt es immer noch Menschen, auf die die Inmorti eine gewisse Faszination ausüben. Und auch diese müssen davon überzeugt werden, dass die Unsterblichen ausgerottet werden müssen. Sie sind die Feinde. Nicht wir.
»Sie haben von sich selbst behauptet, ein Assertor zu sein. Was genau ist das?«
Ich greife nach dem bereitgestellten Glas Wasser und nippe daran. Es klirrt leise, als ich es auf den Beistelltisch zurückstelle. »Wir sind eine Geheimorganisation, wenn Sie so wollen«, erkläre ich und wiederhole die Worte, die Carl mir eingetrichtert hat. »Die Assertoren haben sich vor etwa dreihundert Jahren gegründet, als auch die ersten Inmorti aufgetaucht sind. Wie die Unsterblichen sind wir weltweit vernetzt und unser Ziel ist es, die Untoten auszurotten.«
»Stehen Sie dabei in Kontakt zu anderen Regierungen? Oder Organisationen?«
»Natürlich. Es kommt immer wieder zu Vorfällen, wie beispielsweise der Angriff auf den Firesoul Club kürzlich, wo wir eng mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten.« Was eine glatte Lüge ist, die Polizei hat absolut keine Ahnung, was da vor sich gegangen ist. Sie hält das für einen Kampf unter zwei verfeindeten Gangs.
Hillary schürzt die rot geschminkten Lippen. »Ich frage mich nur … Warum haben Sie uns Bürger nie früher über die drohende Gefahr informiert? Immerhin dienen wir diesen Untoten – wenn ich es richtig verstanden habe – als Nahrungsquelle.«
Meine Gesichtszüge spannen sich an. Genau wegen dieser Frage sitze ich hier und nicht Carl. Weil ich diese Scheiße aus dem Dreck ziehen muss und nicht er, der zu glatt und unsympathisch rüberkommt. Und es auch einfach ist.
»Hillary«, sage ich und lehne mich ein wenig vor. Ich lächle reumütig, sorgenvoll und verstecke meine wahren Gefühle. »Die Sicherheit der Menschheit hat für uns oberste Priorität. Wir Assertoren sind gut in dem, was wir tun. Schnell, effizient und ohne dass es sonst jemand mitbekommt. Schauen Sie sich an, was gerade passiert. Meine Offenbarung hat unnötige Ängste geschürt. Ja, ich finde es wichtig, dass alle über mögliche Gefahren informiert sind. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, an die Öffentlichkeit zu treten. Dennoch brauchen Sie keine Angst haben. Wir sind da. Überall, ohne dass Sie uns sehen. Und wir werden Sie beschützen.«
Ich lehne mich noch ein wenig weiter vor und lege eine Hand auf ihr Knie. Sie trägt einen kurzen Rock und keine Strumpfhose, sodass die Wärme ihrer Haut in meine Fingerspitzen dringt und droht, die Kälte in meinem Inneren aufzubrechen. Doch ich zwinge mich, sie liegen zu lassen. Drei Sekunden, damit die Kameras die Geste auch sicher einfangen.
»Das ist beruhigend.« Hillary lächelt und ich ziehe meine Hand fort. »Was empfehlen Sie uns?«
»Machen Sie weiter wie bisher. Gehen Sie zur Arbeit, genießen Sie Ihr Leben. Nur Nachtclubs, Diskotheken, Casinos oder auch Bordelle sollten Sie meiden. Viele dieser Etablissements werden von Inmorti betrieben, die bei dieser Gelegenheit die Gefühle von uns Menschen abgreifen.« Ich lehne mich in die Polster des Ledersessels zurück und trinke erneut einen Schluck Wasser.
»Und was ist mit Rockkonzerten?«
Meine Hände verkrampfen um das Wasserglas. »Gegen Rockkonzerte spricht generell nichts. Außer natürlich dem der Dead Souls. Da ist der Name leider Programm.«
Hillary zieht interessiert die Augenbrauen hoch, während ein Raunen durch das Publikum geht.
Ich blinzle gegen die Scheinwerfer, doch das Lächeln will einfach nicht auf meine Lippen treten. Die Dead Souls. Diese verfluchte Rockband hat mein Leben zerstört. Die Inmorti haben mir alles genommen, meine gesamte Familie. Die Wut kommt schnell und heiß, sodass das Wasser in dem Glas in meiner Hand über den Rand schwappt. Schnell stelle ich es zurück, Hillary hat es trotzdem bemerkt.
»Es stimmt also«, sagt sie, »dass die erfolgreichste Rockband Australiens aus Untoten besteht. Allein das ist ein Skandal. Aber wenn man sich vorstellt, wie viele Konzerte sie gespielt haben, wie vielen Menschen sie ohne deren Einwilligung ihre Gefühle absorbiert haben.« Sie schüttelt sich demonstrativ. »Unfassbar. Unmenschlich. Gefühle sind persönlich, privat. Niemand hat das Recht, sie einfach auszuspionieren, viel schlimmer noch, sie uns zu nehmen.«
Hier hat jemand im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Wenn ich raten müsste, würde ich auf Carl setzen. Er war es auch, der der Presse gesteckt hat, dass die Dead Souls Inmorti sind. Obwohl mein Hass auf diese Gruppe unendlich ist, hätte ich das für mich behalten. Nicht wegen Asher oder den anderen. Sondern für sie. Juniper.
»Da haben Sie absolut recht, Hillary. Es ist ein offener Angriff gegen unsere Menschenwürde.« Unauffällig lockere ich meine Schultern, aber die Anspannung in meinem Nacken bleibt. Krallt sich an mir fest und spült all die schlechten Gefühle nach oben, die mich seit zwei Wochen begleiten. Ohne das Training meines Vaters, der meinen Schwestern und mir eingetrichtert hat, unsere Gefühle zu verstecken, hätte ich hier verloren. Doch so sitze ich da und lächle, obwohl der Drang, Hillary das falsche Lächeln aus dem Gesicht zu wischen, immer größer wird.
»James, eine persönliche Frage.«
Lächeln.
»Stimmt es, dass Ihre Schwester Juniper mit einem Bandmitglied der Dead Souls liiert ist?«
Lächeln. Verdammt.
»Ich habe keine Schwester mehr«, presse ich hervor.
Ich werde sie umbringen. Wenn nicht direkt vor laufenden Kameras, dann, sobald diese ausgeschaltet sind. Wie kann sie mir so eine Frage stellen?
»Oh.« Hillary legt sich bestürzt die Hand auf den Mund. »Entschuldigen Sie bitte, da war ich falsch informiert. Ich wusste, dass Ihr Vater … erschossen wurde, aber dass Ihre Zwillingsschwester ebenfalls …«
Langsam ziehe ich Luft durch die Nase, blinzle gegen die verfickten Scheinwerfer, die viel zu grell sind. Schweiß läuft mir mittlerweile über die Wangen, mein weißes Hemd fühlt sich feucht an.
»Meine Schwester lebt, sie ist nicht gestorben. Nur für mich.«
»Ah, ach so.« Hillary wirkt verwirrt. »Mein Beileid zum Tod Ihres Vaters.«
Ich winke ab. »Danke.« Der Mord an meinem Vater ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Polizei ist auf Spurensuche, noch gibt es keine konkreten Verdächtigen. Ich habe darauf verzichtet, Namen zu nennen. Was mein Vater getan hat, war nicht richtig. Und wenn herauskommen sollte, dass er meine Schwester Summer auf dem Gewissen hat, ist der Ruf der Assertoren für immer zerstört. Allerdings weiß ich, was geschehen ist. Ich weiß, wer geschossen hat – und ich werde Asher das niemals verzeihen.
»Ein letztes Thema für heute Morgen.« Hillary streicht sich eine blonde Locke zurück. »Es werden immer mehr Stimmen laut, die auch die Assertoren zur Verantwortung ziehen wollen. Immerhin haben Sie die Menschheit im Ungewissen gelassen und jeder sollte das Recht haben zu erfahren, was dort draußen ist.«
Die Aussage ist so lächerlich, dass ich mich wundere, dass sie nicht rot wird. Als ob wir alle wüssten, was die Regierungen und Organisationen dieser Welt vor uns verbergen.
»Es ging niemals darum, irgendwem zu schaden, es ging immer nur um den Schutz der Menschen. Um unseren Schutz«, betone ich, denn trotz des Tattoos am rechten Handgelenk und der täglichen Dosis Eisen, um mich vor den Übergriffen der Inmorti zu schützen, bin ich nach wie vor ein Mensch.
»Das sehen aber einige anders …«, sagt sie und ich werden den Verdacht nicht los, dass sie dazugehört.
»Die Bevölkerung sollte uns dankbar sein, dass wir diesen Kampf gegen die Inmorti seit Jahrhunderten führen. Viele von uns sind dafür gestorben. Uns jetzt anzuprangern, trifft die Falschen.«
Ich sehe zu Carl. Er hat die Arme vor der Brust verschränkt, sein rechter Fuß wippt unruhig. Ihm gefällt die Wendung nicht, die dieses Gespräch genommen hat, und mir noch viel weniger. Zeit, etwas Hass zu schüren.
»Um kurz auf die Dead Souls zurückzukommen.« Ich sehe zum gesichtslosen Publikum. »Diese widernatürlichen Kreaturen haben uns ausgenutzt. Sie haben uns mit ihrer Musik gelockt und sich schamlos an uns gelabt. Das müssen wir unterbinden. Es ist falsch, solchen Wesen überhaupt die Erlaubnis zu erteilen, auf die Straße zu gehen, geschweige denn Konzerte zu spielen.«
»Aber sie werden weitere spielen«, unterbricht mich Hillary.
Mein Kopf schnellt zu ihr herum. »Was?« Laut meinen Informationen wurde die groß angekündigte Tour abgesagt.
»Sie haben entschieden, die Tour zu spielen, nachdem der Protest der Fans zu laut wurde. Kennen Sie den Hashtag #deadsoulsforever nicht? Der stürmt gerade die sozialen Netzwerke.«
Mir wird übel. So richtig scheißübel. Meine Finger fangen an zu zittern. »Das wagen sie nicht«, zische ich.
»Doch. Und sie spielen sogar ein zusätzliches Konzert am Wochenende, hier in Sydney.«
Diese verdammten Schweine. Wie können sie es wagen … wie können Menschen dorthin gehen? Freiwillig? Mit dem Wissen, das jetzt die ganze Welt hat?
»Das ist … interessant«, antworte ich vage. In meinen Gedanken arbeitet es bereits. Eine Idee ploppt auf und ich sehe zu Carl. Mein Onkel nickt.
O ja. Sie haben uns da gerade einen Köder hingeworfen. Und wir wären bescheuert, diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen zu lassen.