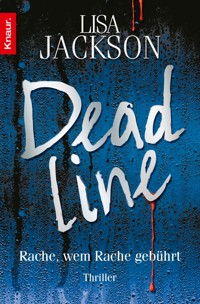
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die San-Francisco-Reihe
- Sprache: Deutsch
In Kalifornien ist eine Serienkillerin am Werk. Die kaltblütige Mörderin ist eine Verwandlungskünstlerin und nennt sich selbst nur Elyse. Ihr erstes Opfer, eine äußerst wohlhabende ältere Dame, stürzt sie über ein Treppengeländer in den Tod. Ihr zweites Opfer, einen jungen Mann, der in einem Pflegeheim sein Dasein fristet, ermordet sie, indem sie eine tödliche Lebensmittelallergie auslöst. Ihr drittes Opfer, eine junge Frau, erschießt sie kaltblütig. Wer sind diese Menschen? Was haben sie getan? Und was verbindet sie? Deadline von Lisa Jackson: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Lisa Jackson
Deadline
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Meiner Schwester Nan – Du [...]
Danksagung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Epilog
Meiner Schwester Nan – Du hattest recht:
Eins nach dem anderen …
Danksagung
Ich kann denen, die mir bei diesem Roman geholfen haben, gar nicht genug danken. Mit meiner Schwester, Nancy Bush, will ich den Anfang machen, deren Ermutigung mir stets weitergeholfen hat, dann folgt mein Lektor, John Scognamiglio. Seine zahlreichen Anregungen machen diesen Roman meiner Meinung nach einzigartig. Danke, Nan und John.
Natürlich haben noch sehr viele andere einen Beitrag geleistet. Meine Agentin, Robin Rue, steht ganz oben auf der Liste, denn sie macht mir immer Mut und sorgt für jede Menge Spaß, und auch der Kensington-Belegschaft gilt mein Dank für viel Geduld, Kreativität und Unterstützung.
An der Heimatfront stehen meine hilfreichen Asse: Matthew Crose, Michael Crose und Nikki Wilkins sowie Marilyn Katcher und Kathy Okano, Roz Noonan und Alexis Harrington, die alle zum Zustandekommen dieses Romans beigetragen haben (und dafür gesorgt haben, dass ich immer bei Verstand geblieben bin).
Prolog
Bayside Hospital
San Francisco, Kalifornien
Zimmer 316
Freitag, 13. Februar
JETZTZEIT
Sie glauben, dass ich sterben werde.
Ich entnehme es ihrem Flüstern.
Sie glauben, ich könnte sie nicht verstehen, aber ich höre sie, und ich lausche auf jede einzelne Silbe, die sie von sich geben.
»Nein!«, will ich schreien. »Ich lebe. Ich gebe nicht auf. Ich werde mich wehren.«
Aber ich kann nicht sprechen.
Bekomme nicht ein einziges verdammtes Wort heraus.
Meine Stimme ist tonlos, meine Augen wollen sich nicht öffnen. Sosehr ich mich anstrenge, ich kann die Lider nicht heben.
Ich weiß nur, dass ich in einem Krankenhausbett liege, und ich weiß, dass ich gerade noch am Leben bin. Ich höre das Flüstern, die Bemerkungen, die Schritte weicher Sohlen auf dem Fußboden. Alle meinen, ich läge im Koma, wäre nicht fähig, sie zu hören, zu reagieren, aber ich weiß, was vor sich geht. Ich kann mich nur nicht bewegen, nicht kommunizieren. Irgendwie muss es mir gelingen, sie darauf aufmerksam zu machen. Sie behaupten, mein Zustand wäre höchst bedenklich. Ich verstehe Begriffe wie Milzriss, Beckenbruch, Gehirnerschütterung, Hirntrauma, aber, verdammt noch mal, ich kann sie doch hören! Ich spüre die Haut auf meinem Handrücken, wo die Kanüle steckt, rieche Parfüm, Medizin und Resignation. Das Stethoskop ist eiskalt, die Manschette des Blutdruckmessgeräts zu eng, und ich strenge mich höllisch an, ihnen durch irgendein Zeichen verständlich zu machen, dass ich bei Bewusstsein bin, dass ich fühlen kann. Ich versuche, mich zu bewegen, will nur einen Finger heben oder ein Stöhnen von mir geben, aber ich kann es einfach nicht.
Das macht mir Todesangst.
Ich bin an Maschinen angeschlossen, die meinen Herzschlag und meine Atmung und Gott weiß was noch alles steuern. Nicht, dass es etwas nutzen würde. All diese Hightechmaschinen, die Körperfunktionen aufzeichnen, liefern dem Klinikpersonal keinen Hoffnungsschimmer, keinen Hinweis darauf, dass ich weiß, was hier vor sich geht.
Ich bin in meinem Körper gefangen, und es ist die Hölle auf Erden.
Noch einmal biete ich alle Kräfte auf … konzentriere mich darauf, den Zeigefinger meiner rechten Hand anzuheben, auf denjenigen zu zeigen, der als Nächster durch die Tür tritt. Hoch, denke ich, heb die Fingerspitze von der verdammten Bettdecke. Die Anstrengung ist schmerzhaft … so schwer.
Achtet denn niemand auf den verdammten Monitor? Er muss doch einen erhöhten Puls, beschleunigten Herzschlag, irgendwas anzeigen!
Aber nein.
All die Mühe. Vergebens.
Schlimmer noch, ich habe ihr Gerede gehört; ein paar Krankenschwestern sind der Meinung, es wäre besser für mich, tot zu sein … Aber sie kennen die Wahrheit nicht.
Ich höre Schritte. Schwerer als die üblichen. Und jetzt weht schwacher Zigarrenduft herüber. Der Arzt! Er war schon einmal hier.
»Dann wollen wir mal schauen, ja?«, sagt er zu der Person, die ihn begleitet, vermutlich die Schwester mit den kalten Händen und der nervtötend munteren Stimme.
»Sie reagiert nach wie vor nicht.« Klar doch, die Muntere. »Ich habe keinerlei Veränderungen zum Positiven feststellen können. Vielmehr … Nun, sehen Sie selbst.«
Was meint sie damit? Und warum klingt ihre Stimme so resigniert? Wo ist ihre gespielte Lebhaftigkeit geblieben?
»Hmmm«, sagt der Arzt mit seiner Baritonstimme. Dann liegen seine Hände auf mir. Er berührt mich sanft, zieht mein Augenlid hoch und leuchtet mit einem grellen Strahl direkt in meine Pupille. Es blendet, und mein Körper muss doch irgendeine Reaktion zeigen. Ein Blinzeln oder Zucken oder …
»Anscheinend haben Sie recht«, sagt er, schaltet das Licht wieder aus und tritt vom Bett zurück. »Sie baut rapide ab.«
Nein! Das stimmt nicht. Ich bin da. Ich lebe. Ich werde wieder gesund!
Ich kann nicht glauben, was ich da höre, und müsste bei diesen Worten eigentlich hyperventilieren, einen Herzstillstand erleiden. Seht ihr denn nicht, dass ich unter Stress stehe? Zeigen die verdammten Monitore nicht, dass ich lebe und bei Bewusstsein bin und weiterleben will? O Gott, wie sehr ich leben will!
»Die Familie hat nachgefragt«, drängt die Schwester, »wie lange es noch dauern wird.«
Meine Familie? Sie haben mich schon abgeschrieben? Das kann nicht sein! Ich glaube es nicht. Ich lebe noch, um Himmels willen! Wie konnte es so weit kommen? Nun, ich weiß schon, wie. Allzu lebhaft erinnere ich mich an jeden Augenblick meines Lebens und an die Ereignisse, die zu meinem jetzigen Zustand geführt haben.
»Herr Doktor?«, flüstert die Schwester.
»Sagen Sie ihnen, vierundzwanzig Stunden«, antwortet er ernst. »Vielleicht sogar weniger.«
1
Vier Wochen zuvor
Klick!
Das leise Geräusch reichte aus, um Eugenia Cahill aus dem Schlaf zu reißen. In ihrem Lieblingssessel im Wohnzimmer des ersten Stocks in ihrem Landhaus schlug sie blinzelnd die Augen auf. Verwundert darüber, dass sie tatsächlich eingedöst war, rief sie nach ihrer Enkelin. »Cissy?« Sie rückte ihre Brille zurecht und warf einen Blick auf die antike Uhr über dem Kamin, in dem Gasflammen leise zischend an den schwarzen Keramikscheiten leckten. »Cissy, bist du das?«
Natürlich war es Cissy. Sie hatte vorhin angerufen und ihren gewohnten wöchentlichen Besuch angekündigt. Sie wollte ihr Baby mitbringen … Doch der Anruf lag Stunden zurück. Cissy hatte versprochen, gegen 19.00 Uhr da zu sein, und jetzt … Tja, die Stadtuhr im Foyer schlug gerade mit leisen, beruhigenden Tönen die achte Abendstunde. »Coco«, sagte Eugenia mit einem Blick auf das Körbchen, in dem ihr kleiner weißer Schoßhund schlummerte, der daraufhin kaum den Kopf hob. Das arme Ding wurde auch langsam alt, verlor bereits Zähne und litt an Arthritis. »Wenn man alt wird, geht man vor die Hunde«, sagte Eugenia und lachte über ihr eigenes kleines Wortspiel.
Warum war Cissy nicht gleich heraufgekommen, in den Wohnbereich, wo Eugenia den Großteil des Tages verbrachte? »Ich bin hier oben«, rief sie laut, und als keine Antwort kam, verspürte sie ein erstes kleines Kribbeln der Angst, das sie rasch abschüttelte. Die Furchtsamkeit einer alten Frau, weiter nichts. Doch sie hörte keine eiligen Schritte auf der Treppe, kein Rumpeln des alten Aufzugs, der von der Garage aus knirschend hinauffuhr. Sie stemmte sich aus dem Queen-Anne-Sessel hoch, griff nach ihrem Stock und wurde von einem leichten Schwindelgefühl erfasst. Das war ziemlich untypisch für sie. Steifbeinig ging sie zum Fenster, durch dessen feuchte Scheibe sie die Straße und die Stadt überblicken konnte. Obwohl eine Nebelbank langsam über die Stadt hinwegzog, war die Aussicht aus dem Fenster, wie auch aus den meisten anderen des alten Hauses, atemberaubend – eines Hauses, erbaut um die Jahrhundertwende, na ja, um die vorletzte Jahrhundertwende, auf den höchsten Kuppen des Mt. Sutro in San Francisco. Der alte Ziegelbau im Stil eines Landklubhauses erhob sich drei Stockwerke hoch über einer an den Berg gebauten Garage. Vom Wohnzimmer im ersten Stock aus konnte Eugenia an klaren Tagen die Bucht sehen, und sie verbrachte viel Zeit damit, die übers graugrüne Wasser gleitenden Segelboote zu beobachten.
Doch manchmal erschien ihr dieses alte Haus in den Parnassus Heights so schrecklich leer. Eine alte Festung mit elektronisch gesteuerten Toren und zugewucherten Gärten voller Rhododendron und Farn. Das Grundstück stieß zwar an das weitläufige Gelände der medizinischen Fakultät, es wirkte aber trotzdem manchmal sehr isoliert vom Rest der Welt.
Oh, sie war nicht wirklich allein. Natürlich verfügte sie über Personal, doch wie es aussah, hatte die Familie sie verlassen.
Um Himmels willen, Eugenia, reiß dich zusammen. Du bist schließlich nicht irgendeine alte Frau. Du willst hier wohnen, als eine Cahill, wie es schon immer war.
Hatte sie sich nur eingebildet, unten ein Schloss klicken zu hören? Hatte sie womöglich geträumt? Neuerdings drangen ihre Träume, wenngleich sie es sich ungern eingestand, selbst bis in ihr Wachbewusstsein vor, und darin wurzelte die unausgesprochene Angst, dass sie sich vielleicht schon im Frühstadium einer Demenz befand. Lieber Himmel, hoffentlich nicht! In ihrer Familie war bisher nie Alzheimer aufgetreten; ihre eigene Mutter war mit sechsundneunzig gestorben, im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte, bevor ein schwerer Schlaganfall sie dahinraffte. Aber an diesem Abend fühlte sich Eugenia doch ein bisschen benommener als gewöhnlich.
Ihr Blick wanderte nach draußen, zur Straße hinter dem elektronisch gesteuerten Tor, dahin, wo der Zivilwagen der Polizei beinahe vierundzwanzig Stunden lang gestanden hatte. Jetzt war der Chevy in der Parkbucht knapp außerhalb des bläulichen Lichtkegels der Straßenlaterne nicht mehr zu sehen.
Wie merkwürdig.
Warum hatten sie sich so schnell wieder entfernt, nachdem sie ihr vorgeworfen hatten, ihrer Schwiegertochter bei der Flucht aus dem Gefängnis geholfen zu haben? Diese unhöflichen Detectives, die vor ihrer Tür gestanden und behauptet hatten, sie würde einer Kriminellen Unterschlupf gewähren. So ein Quatsch! Sie waren geblieben, hatten das Haus beobachtet und waren ihr, wie sie vermutete, heimlich gefolgt, als Lars sie zum Friseur fuhr, zum Bridge spielen und zum Cahill House, wo sie ihre Zeit opferte, um Zuflucht suchenden, unverheirateten Schwangeren im Teenageralter oder knapp darüber zur Seite zu stehen.
Natürlich hatte die Polizei nichts herausgefunden.
Weil sie vollkommen unschuldig war. Trotzdem war sie nach wie vor darüber verärgert.
Eugenia blickte in die Nacht hinaus – und fror plötzlich. Sie sah ihr eigenes Spiegelbild, das gespenstische Bild einer kleinen Frau vor dem weichen Licht antiker Lampen, und es überraschte sie, wie alt sie aussah. Ihre Augen, vergrößert durch die Brille, die sie seit ihrer Staroperation vor ein paar Jahren trug, erinnerten an eine Eule. Ihr einstmals leuchtend rotes Haar war jetzt adrett frisiert und eher blass apricotfarben als rötlich blond. Sie schien um Zentimeter geschrumpft, kaum noch eins fünfzig groß zu sein. Ihr Gesicht war zwar erstaunlich faltenlos, doch es begann schlaff zu werden, und das verabscheute sie. Sie verabscheute es, alt zu werden. Verabscheute es, zum alten Eisen gezählt zu werden. Sie hatte schon erwogen, sich die Augen »machen« oder das Gesicht »straffen« zu lassen, hatte sogar schon an Botox gedacht, aber warum eigentlich?
Eitelkeit?
Nach allem, was sie durchgestanden hatte, erschien es ihr banal.
Gut, sie war schon über achtzig. Na und? Sie wusste, dass sie nicht mehr jung war, ihre arthritischen Knie waren Beweis genug, aber sie war noch längst nicht reif für irgendeine Art von betreutem Wohnen oder eine Seniorenresidenz. Noch nicht.
Knaaarrr!
Das Geräusch einer sich öffnenden Tür?
Ihr Herzschlag beschleunigte sich.
Dieses letzte Geräusch entsprang nicht ihrer Einbildung. »Cissy?«, rief sie erneut und warf einen Blick auf Coco, der auf das Geräusch hin kaum sein müdes Köpfchen hob und kein warnendes Bellen von sich gab. »Liebes, bist du das?«
Wer sonst?
Sonntag- und montagabends war sie gewöhnlich allein; ihre »Gesellschafterin«, Deborah, fuhr dann meistens zu ihrer Schwester aufs Land, das Hausmädchen ging um 17.00 Uhr, und Elsa, die Köchin, hatte zwei Tage frei. Lars machte jeden Abend um 18.00 Uhr Feierabend, es sei denn, sie benötigte seine Dienste, und normalerweise störte sie es nicht, allein zu sein. Sie genoss den Frieden und die Stille. Aber an diesem Abend …
Auf ihren Stock gestützt, ging sie in den Flur, der den Wohnbereich von ihrem Schlafzimmer trennte. »Cissy?«, rief sie die Treppe hinunter. Sie schimpfte sich einen Angsthasen. Brachte ihr fortgeschrittenes Alter etwa auch Verfolgungswahn mit sich?
Doch der Zweifel fuhr mit kaltem Finger über ihren Rücken und sagte etwas anderes, und obwohl die Heizung summte, kroch eine Kälte, eisig wie das tiefe Wasser der Bucht, bis in ihre Knochen. Sie hatte das Geländer erreicht, hielt sich an dem glatten Treppenlauf aus Rosenholz fest und spähte hinunter ins Erdgeschoss. Im abendlichen Dämmerlicht sah sie den glänzenden Fliesenboden, den Louis-XVI-Intarsientisch und die Ficus Benjamini vor den abgeschrägten Fenstern neben der Haustür.
Alles war wie immer.
Aber Cissy war nicht da.
Merkwürdig, dachte Eugenia erneut und rieb sich die Arme. Noch merkwürdiger war, dass ihr Hund sich so passiv verhielt. Coco war zwar alt und litt unter Arthrose, aber er hörte noch gut und brachte gewöhnlich genug Energie auf, um beim geringsten Geräusch zu knurren und zu bellen. Doch an diesem Abend lag er nur träge in seinem Körbchen neben Eugenias Strickbeutel, mit offenen Augen, aber leerem Blick. Beinahe, als stünde er unter Drogen …
Ach, um Himmels willen! Sie ließ sich gehen, ließ ihrer lebhaften Phantasie allzu sehr die Zügel schießen. Innerlich gab sie sich einen Ruck. Das hatte man davon, wenn man sich fünf Abende hintereinander Alfred-Hitchcock-Filme ansah.
Also, wo zum Teufel steckte Cissy?
Sie kramte in der Tasche ihres dicken Pullovers nach dem Handy. Nicht da. Das verflixte Ding war weg; wahrscheinlich hatte sie es auf dem Tisch bei dem Strickzeug liegen gelassen.
Als sie sich wieder zum Wohnzimmer umwandte, hörte sie das leise Scharren von Schritten, Ledersohlen auf Holz.
Ganz nahe.
Der Duft eines Parfüms, den sie fast vergessen hatte, wehte ihr in die Nase, und es sträubten sich ihr die Nackenhaare.
Ihr Herz blieb beinahe stehen, als sie einen Blick über die Schulter zurückwarf. Im Schatten des unbeleuchteten Flurs vor ihrem Schlafzimmer bewegte sich etwas. »Cissy?«, fragte sie wieder, doch es war kaum mehr als ein Flüstern, und ihr Puls raste vor Angst. »Bist du das, Liebes? Du, das ist nicht witzig …«
Die Worte blieben ihr im Halse stecken.
Eine Frau, halb im Dunkeln verborgen, trat plötzlich triumphierend hervor.
Eugenia erstarrte.
Die Zeit schien stillzustehen.
»Du!«, schrie sie. Panik ergriff ihren ganzen Körper, und die Frau vor ihr lächelte, ein Lächeln, so kalt und niederträchtig wie das Herz des Satans.
Eugenia wollte davonlaufen, fliehen, doch bevor sie noch einen Schritt tun konnte, sprang die jüngere Frau auf sie zu, packte sie mit kräftigen Händen, stemmte sie mit ihren muskulösen Armen hoch.
»Nein!«, schrie Eugenia. »Nein!« Sie hob den Stock, doch das verflixte Stück entglitt ihrer Hand und klapperte nutzlos die Treppe hinunter. Jetzt endlich begann Coco wild zu bellen.
»Tu’s nicht!«, schrie Eugenia.
Doch es war zu spät.
Einen Herzschlag später wurde sie übers Treppengeländer gehievt und in den Freiraum gestoßen, wo der Kronleuchter hing. Eugenia schrie, schlug mit den Armen um sich, hörte ihren Hund knurren – und stürzte hinab.
Der Louis-XVI-Tisch und der Fliesenboden des Foyers rasten auf sie zu.
Vor Entsetzen blieb beinahe ihr Herz stehen, als sie mit einem dumpfen, übelkeiterregenden Aufprall auf dem Boden aufschlug. Knack! Schmerz explodierte in ihrem Kopf. Eine halbe Sekunde lang blickte sie hinauf zu ihrer Angreiferin. Siegesbewusst stand die Frau auf dem Treppenabsatz, hielt Coco im Arm und streichelte sein dichtes Fell.
»Rache ist süß, oder?«, höhnte die Frau.
Dann umgab Eugenia nur noch Finsternis …
»Schschsch! Beejay, alles ist gut, okay? Alles ist gut!« Cissy Cahill beugte sich über das Laufgitter und hob sich ihren achtzehn Monate alten Sohn auf die Hüfte. Sein Gesicht war vom Weinen gerötet, Tränen strömten über die runden Wangen, seine Nase lief und lief. »Ach, Schätzchen, wie du aussiehst!« Cissys Herz schmolz auf Anhieb dahin, und sie küsste seinen blonden Scheitel, während sie nach einem Papiertaschentuch griff, um ihm die Nase zu putzen. »Alles wird wieder gut, versprochen«, sagte sie und holte sein Jäckchen und die Mütze, die er hasste wie die Pest. Irgendwie gelang es ihr, ihn anzuziehen, die Windeltasche zu greifen und zur Tür des alten viktorianischen Hauses hinauszugehen, in dem sie seit fast zwei Jahren lebte. Beejay war schon den ganzen Nachmittag über quengelig. Wahrscheinlich zahnte er, und als dann der Pizzalieferant erschien, hatte Beejay sich aus irgendeinem unerfindlichen Grund in wahre Wut hineingesteigert. Cissy hatte keine Ahnung, was ihn so verstörte. Die Zähne? Fror er, weil die verdammte Heizung ausgegangen war? War ihm zu warm, weil seine Mutter ihm zu viel angezogen hatte? Was auch immer der Grund sein mochte, Cissy war überzeugt davon, dass es nichts Ernstes war, der Kleine würde darüber hinwegkommen müssen. Sie war bereits spät dran, und ihre Großmutter würde verärgert sein.
»Das ist der Preis dafür, eine Cahill zu sein«, beklagte sie sich bei ihrem Sohn, schloss die Haustür hinter sich und ging mit ihm zur Zufahrt, wo ihr Auto, eine silberne Acura-Limousine, stand. Die Pizza, die im Karton auf dem Boden vor dem Beifahrersitz lag, war bestimmt schon kalt. Beejay, genauso schlechter Laune wie schon den ganzen Tag über, heulte und zerrte an seiner Mütze, als Cissy ihn im Fond des Wagens in seinem Kindersitz anschnallte und sich selbst dann auf den Fahrersitz fallen ließ. Es war dunkel, ein sanfter Regen fiel und verwischte die Lichter der Stadt. Sie blickte zur anderen Straßenseite hinüber, wo ein Zivilwagen der Polizei geparkt hatte, seit bekannt geworden war, dass ihre Mutter aus dem Gefängnis ausgebrochen war, doch zu ihrer Überraschung stand er nicht mehr da.
Und auch der Ü-Wagen war verschwunden, der stundenlang an der Straße gestanden hatte. Dreimal hatte ein Reporter an ihrer Tür geklingelt und sie um ein Interview gebeten. Als ob sie sich jemals der Presse gegenüber äußern würde! Cissy hatte darum gebetet, dass sie fortgingen, und an diesem Abend war ihr Wunsch erfüllt worden.
Gut so.
Sie hatte es satt, behandelt zu werden, als wäre sie eine Art Kriminelle, obwohl sie doch nichts Böses getan hatte. Absolut nichts! Es war nicht ihre Schuld, dass ihre Mutter leider ein narzisstisches, mordlustiges Miststück war – und das war noch die netteste Bezeichnung, die Cissy für Marla finden konnte. Cissys Meinung war: Je strikter sich ihre egozentrische verrückte Mutter von ihr und Beejay fernhielt, umso besser.
So darfst du nicht denken … schüttle die negativen Gedanken ab … zähle langsam bis zehn … Die Stimme ihres Therapeuten ertönte in ihrem Kopf, doch Cissy ignorierte sie. An diesem Abend war sie keineswegs nachsichtig gestimmt, sie war nur dankbar, dass die Polizei ihr nicht zum Grundstück der Cahills folgte, wo ihre Großmutter residierte, seit sie vor beinahe fünfzig Jahren in die Familie eingeheiratet hatte. Cissys Leben war ohnehin schon viel zu sehr in Aufruhr geraten, sie musste sich nicht auch noch mit den Bullen herumärgern. Wenn es nach ihr ging, hatte sie genug Melodrama und Schmerz für ein ganzes Leben hinter sich – dank Marla Amhurst Cahill, ihrer idiotischen Mutter.
»Tja, Beejay, das ist deine Nana«, sagte sie, während sie die Straßen entlangfuhr, die an den Alamo Square angrenzten. »Die Psycho-Oma.« Im Rückspiegel warf sie einen Blick auf ihren Sohn, der nun nicht mehr quengelte und weinte und sich nicht mal mehr gegen die Mütze wehrte.
Erleichtert, weil der Wutanfall vorüber war, zwinkerte sie ihm zu. »Siehst du, du wolltest einfach nur gern mit Mom in einem tollen Schlitten fahren, nicht wahr?«
Die Ampel vor ihr sprang auf Gelb um, und sie trat auf die Bremse. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da wäre sie auch noch bei Dunkelorange weitergefahren, aber seit sie Beejay hatte, war sie zu einer vorbildlichen Verkehrsteilnehmerin und überbehütenden Mutter mutiert. Wer hätte das gedacht?
Ihr knurrender Magen und die Uhr auf dem Armaturenbrett erinnerten sie daran, dass sie sich verspätete. Toll.Zweifellos stand ihr mal wieder eine Gardinenpredigt bevor. Als hätte sie nicht längst genug davon gehört. Du liebe Zeit, sie war schließlich eine erwachsene Frau.
Noch einmal schaute sie in den Rückspiegel. Dieses Mal prüfte sie den nachfolgenden Verkehr und hielt Ausschau nach einem Polizeiauto. Es war weit und breit keines zu sehen. Angesichts der Tatsache, dass die Polizei seit der Flucht ihrer Mutter ihre Haustür nicht aus den Augen gelassen hatte, war es schon eigenartig, dass ihr jetzt niemand folgte. Die Detectives waren zwar überaus nett gewesen, doch sie wusste, dass sich hinter ihren besorgten Worten und dem nachsichtigen Lächeln Misstrauen verbarg.
Als ob ihre Mutter Kontakt zu ihr aufnehmen würde.
Als ob sie einer Frau, die sie hasste, Unterschlupf gewähren würde.
»Ausgeschlossen, verdammt noch mal«, flüsterte sie. Jeder Muskel in ihrem Körper spannte sich an. Als Kind hatte sie Marlas kühle, distanzierte Haltung ihr gegenüber ertragen müssen. Das hatte sie akzeptiert, wie auch die Tatsache, dass ihre gesamte Familie ein Haufen eiskalter Sonderlinge war. Um zu überleben, hatte sie lediglich auf jede nur erdenkliche Art rebelliert.
Doch jetzt, als sie selbst Mutter war, konnte Cissy sich nicht vorstellen, dass eine Mutter sich ihrem Kind nicht eng verbunden fühlen konnte. Als sie ihren Sohn zum ersten Mal gesehen hatte, war sie ein neuer Mensch geworden. In diesem goldenen Moment hatte sich ihr Leben verändert. Während der gesamten Schwangerschaft hatte sie mit dem Baby geredet, ihren Leib gestreichelt, hatte den Embryo wegen ihres Heißhungers auf Tacos und andere mexikanische Gerichte zu jeder Tages- und Nachtzeit sogar Juan genannt, doch das war nichts im Vergleich zu dem Gefühl, als sie ihn im Krankenhaus im Arm hielt und schreien hörte. Ja, sie waren ein Team. Unzertrennlich.
Doch wo steckte ihre Mutter?
Wie um alles in der Welt hatte sie den Ausbruch aus dem Gefängnis bewerkstelligt?
Waren Gefängnisse nicht angeblich ausbruchssicher?
Was machst du, wenn sie plötzlich vor deiner Haustür steht?
»Gar nicht daran denken«, ermahnte sie sich selbst. Noch mehr Schwierigkeiten konnte sie im Moment nicht brauchen. War es nicht schon schlimm genug, dass sie sich im Frühstadium einer Scheidung befand und ihr Sohn mit Riesenschritten aufs Trotzalter zustrebte, was man daran erkennen konnte, dass er die ganze Woche über unausstehlich gewesen war? Und dass die Heizung gerade jetzt den Geist aufgegeben hatte, war auch kein Trost. Alles in allem waren die letzten sieben Tage die Hölle gewesen.
Die Ampel hatte auf Grün geschaltet, und Cissy fuhr den Landzipfel entlang bis zur Stanyan Street und dann hinauf in die Berge. Ihr Handy klingelte, als sie gerade eine steile Serpentine hinauf zum Mt. Sutro bewältigte. Sie zog das Gerät aus dem Seitenfach ihrer Handtasche und schaute aufs Display. Sie hätte das Handy an einen Zugang auf dem Armaturenbrett anschließen und frei sprechen können, doch die Nummer auf dem Display ließ sie die Stirn runzeln.
»Nicht heute Abend«, sagte sie laut. Sie wollte sich jetzt nicht mit Jack befassen – diesem verlogenen, treulosen Mistkerl. O ja, das war er, und er war immer noch ihr Mann. Tja, aber nicht mehr lange. Sie verstaute das Handy wieder in seinem Fach und konzentrierte sich auf die schmale Straße, die unentwegt aufwärtsführte, vorbei an eleganten alten Häusern, erbaut vor hundert Jahren, umgeben von gepflegten Gärten. Vor dem Haus ihrer Großmutter angekommen, betätigte sie den elektronischen Toröffner und fuhr langsam weiter, als sich das alte schmiedeeiserne Tor ächzend öffnete. Sie hielt vor der Garage, drückte die Taste erneut und überlegte, als das Tor wieder geschlossen war, wie sie Beejay zusammen mit dem Pizzakarton, der Wickeltasche und ihrer Handtasche aus der Garage nach oben schleppen sollte, ohne das Baby fallen zu lassen oder überall geschmolzenen Käse und Tropfen von Marinarasoße zu hinterlassen.
»Du hast gewonnen, Beejay. Du kommst als Erster mit«, sagte sie und warf ihre Handtasche in die übergroße Wickeltasche. Sie legte sich den Riemen über die Schulter, ging um den Wagen herum, ohne auf den appetitanregenden Knoblauch- und Peperoniduft zu achten, und befreite ihren Sohn aus dem Kindersitz. »Du kannst bei deiner Großmutter bleiben, wenn ich noch einmal hierher zurückkomme«, erklärte sie dem Jungen. Sie setzte ihn sich auf die Hüfte, mit der sie zuvor die Wagentür zugestoßen hatte. Als sie ihre Nase an seinem Ohr rieb, hörte sie ihn glucksen. »Also los.«
Manchmal war es eine regelrechte Plage, Eugenia zu besuchen, wenn ihr Personal freihatte. Der Aufenthalt in dem alten Herrenhaus wäre so viel einfacher für Cissy, wenn jemand anwesend wäre, der sich um das Baby kümmern konnte. Dann würde sich auch die Frage des Abendessens erledigen und das schlechte Gewissen, weil die alte Dame, wenn Cissy nicht erschien, enttäuscht sein würde.
Mit Beejay, der laute, schmatzende Geräusche von sich gab, nur um sich selbst zu hören, auf der Hüfte, folgte sie dem gepflasterten Weg zwischen den Rhododendren und Farnen, die noch vom Regen tropften, obwohl dieser bereits vor einer Stunde aufgehört hatte. Dieses alte Haus, in dem sie aufgewachsen war, beherbergte eine Menge Erinnerungen. Vielleicht zu viele. Manche gute und viele weniger gute, doch die Mauern aus Backstein und Mörtel, die Erker und spitzen Giebel hatten zwei Erdbeben und eine Generation von Cahills nach der anderen überdauert. Seit weit über hundert Jahren stand das Haus am Abhang des Mt. Sutro und bot einen weiten Ausblick über die Stadt und die Bucht. Cissy wusste nicht recht, ob sie das alte Haus nun liebte oder hasste.
Ach, nun werde mal nicht sentimental, dachte sie und schob den Schlüssel in das alte Schloss.
»Hallohoo«, rief sie, als die Tür sich öffnete. »Entschuldige die Verspätung, aber … O Gott!« Sie erstickte einen Schrei und wandte sich ab, schützte ihren Sohn vor dem Anblick ihrer Großmutter, die auf dem Marmorboden lag, den Kopf in einer Blutlache. »O Gott, o Gott, o Gott!«, flüsterte sie. Sie ließ die Schlüssel und die Windeltasche fallen und kramte, indem sie Beejay fest an sich drückte, in ihrer Handtasche nach dem Handy. Sie zitterte am ganzen Körper, ihre Finger versuchten vergeblich, das Handy zu fassen. »Schon gut, schon gut, schon gut«, sagte sie leise immer und immer wieder, bis sie das Handy fand und die Notrufnummer wählte.
Beejay spürte instinktiv ihre Bestürzung und begann zu heulen. Cissy riss sich zusammen und setzte ihn auf eine Bank auf der Veranda. »Bleib einen Moment hier sitzen, Schätzchen«, wies sie ihn an.
»Nein!«, schrie er und kletterte sofort wieder von der Bank herunter, kaum dass sie ins Haus eilte.
»Gran!« Cissy ließ sich auf ein Knie nieder und suchte, das Handy ans Ohr gepresst, mit den Fingern der anderen Hand am Hals ihrer Großmutter nach dem Puls. Sie spürte nichts unter den Fingerspitzen, keinen Hinweis auf ein klopfendes Herz. »Oh, Gran, bitte, sei nicht tot.« Ihr Magen krampfte sich zusammen; sie glaubte, sich übergeben zu müssen.
»Notrufzentrale, Polizei.«
»Hilfe! Ich brauche Hilfe!«, schrie Cissy. »Es geht um meine Großmutter!«
»Ma’am, bitte nennen Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Notrufs.«
»Es hat einen … einen … Unfall gegeben. Einen schrecklichen Unfall. Meine Großmutter ist die Treppe hinuntergestürzt! Sie ist verletzt. Schwer verletzt. Überall ist Blut. O Gott, ich glaube, sie ist tot! Schicken Sie schnellstens jemanden her! O Gott! Ich finde keinen Puls!«
»Die Adresse bitte?«
»Schicken Sie sofort Hilfe!«
»Ich benötige die Adresse und den Namen des Opfers.«
»Es ist … es ist …« Cissy rasselte die Adresse herunter, während sie immer noch nach dem Puls tastete und auf ein wenn auch noch so schwaches Atemgeräusch lauschte. »Meine Großmutter heißt Eugenia Cahill. Oh, bitte schicken Sie jemanden her … Beeilen Sie sich!« Sie warf einen Blick über die Schulter zurück, zur Tür, und sah ihren Sohn nicht mehr auf der Bank sitzen. »Beejay!«, schrie sie voller Angst.
»Ma’am. Ihr Name bitte?«
»Cissy Holt … ähm, Cissy Cahill. Ich bin zum Abendessen hergekommen, und da habe ich Gran gefunden, und jetzt ist mein Sohn … Beeilen Sie sich bitte!«
»Ein Streifenwagen ist unterwegs. Wenn Sie bitte bei dem Opfer bleiben würden …«
»Ich muss meinen Sohn suchen!« Sie legte auf und schrie: »Beejay!« Doch kein zartes Stimmchen antwortete. »Beejay! Wo steckst du?« Verzweifelt rannte Cissy hinaus in die Dunkelheit. Es hatte wieder zu regnen begonnen. Für ihre Großmutter konnte sie nichts mehr tun. Eugenia war tot. Cissy wusste es. Aber ihr Kind … O Gott, wo war der Kleine? Er konnte doch nicht weit gekommen sein. Sie hatte ihn doch nur für den Bruchteil einer Sekunde aus den Augen gelassen. Panik durchdrang sie bis in die tiefste Seele, während sie das nachtdunkle Grundstück absuchte. Sie bemühte sich um einen ruhigen Tonfall, während sie innerlich fast wahnsinnig wurde vor Angst. »Beejay? Schätzchen? Wo bist du?« Sie versuchte, das Zittern ihrer Stimme, das pure Entsetzen zu unterdrücken. »Beejay?« Lieber Gott, wohin konnte er so schnell verschwunden sein? Das Tor war verschlossen … oder? Es war doch hinter ihrem Wagen zugeschlagen.
Oder nicht?
»Nein«, flüsterte Cissy und lief den Fußweg hinunter. Neuerliche Panik packte sie. »Beejay! Bryan Jack! Wo bist du?«
In der Ferne hörte sie Sirenen jaulen. »Beeilt euch, verdammt noch mal«, sagte Cissy. Ihr Herz hämmerte, sie konnte vor Angst keinen klaren Gedanken fassen. Keine Panik. Er ist hier, das weißt du. Er hat genauso große Angst wie du. Beruhige dich. Vergiss, dass du gerade deine tote Großmutter gesehen hast, vergiss, dass du den Unfall womöglich hättest verhindern können, wenn du rechtzeitig hier gewesen wärst, vergiss, dass deine Mutter, die Psycho-Zicke, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, aber FINDE Beejay!
2
Sie konnte es nicht fassen, dass sie es tatsächlich durchgezogen hatte!
Adrenalin prickelte in ihren Adern.
Als die alte Frau sie schließlich angesehen hatte, wäre sie fast durchgedreht, doch irgendwie hatte sie dann doch die innere Kraft gefunden, ihren Plan auszuführen.
Jetzt hämmerte ihr Herz wie wild, während die Scheibenwischer gegen den Regen kämpften. In ihrem Siegestaumel fiel es ihr schwer, den Fuß vom Gaspedal ihres Taurus zu nehmen. Einen Strafzettel wegen zu hoher Geschwindigkeit, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen, das konnte sie sich nicht leisten. Nicht jetzt.
Beruhige dich. Du kannst das alles später auskosten …
Ihre Finger in den Handschuhen umklammerten das Lenkrad, doch sie konnte den Nervenkitzel des Tötens und jenes Moments, bevor sie die Frau über das Geländer stieß, dieses präzisen, herrlichen Moments des Erkennens, als Eugenia Blickkontakt zu ihr aufnahm, nicht ganz aus ihrem Bewusstsein verbannen, nicht einmal für einen Augenblick.
In diesem Bruchteil einer Sekunde war Eugenia Haversmith Cahill klargeworden, dass sie im Begriff war, ihrem Schöpfer gegenüberzutreten, dass sie ihrem Tod ins Auge sah. Dennoch hatte die alte Hexe wohl nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde. Wahrscheinlich hatte sie noch geglaubt, dass Zeit blieb zu reden, zu drohen, sich freizukaufen.
Pech gehabt.
Sie grinste vor sich hin, schaltete das Gebläse ein, das warme Luft gegen die Innenfläche der beschlagenen Windschutzscheibe blies, was die Feuchtigkeit aufsaugte, während sie auf die Heckleuchten des sportlichen kleinen BMW blickte, der vor ihr dahinraste. Mit röhrendem Motor fuhr er Slalom im dichten Verkehr. Nur zu, du Idiot, dachte sie. Hol dir deinen Strafzettel.
Sie dachte an das Entsetzen der alten Frau, als sie übers Geländer stürzte. Oh, Eugenia hatte sich gewehrt, hatte geschrien, doch sie hatte sich nicht retten können. Ihr kleiner Körper war auf dem Marmorboden aufgeschlagen, und das Krachen der Knochen war ein ekelerregendes, befriedigendes Geräusch.
Jetzt schaltete sie das Radio ein und summte einen alten Sheryl-Crow-Song mit. Ohne das Tempolimit zu verletzen, überquerte sie die Brücke über das nachtdunkle Wasser der Bucht und folgte dem stetigen Fluss der Heckleuchten nach Oakland hinein.
Immer noch im Bann eines gewissen Verfolgungswahns sah sie ab und zu in den Rückspiegel und vergewisserte sich, dass sie nicht verfolgt wurde.
Sie durfte nicht erwischt werden. Noch nicht. Nicht, solange noch so viel zu tun, so viel zu erreichen war. Sie blinzelte gegen das grelle Licht der Scheinwerfer im Spiegel und entdeckte nichts Außergewöhnliches, kein rotierendes rotblaues Licht als Hinweis darauf, dass ein Streifenwagen sie verfolgte.
Du liebe Zeit, kein Mensch verfolgt dich! Kein Mensch weiß, was du getan hast.
Bleib ruhig!
Du hast es durchgezogen! Und die Bullen … die sind Schwachköpfe.
Vergiss das nicht.
Auf der Ostseite der Bucht angelangt, fuhr sie in nördlicher Richtung nach Berkeley und wurde bereits ein wenig ruhiger. Sie lockerte ihren Griff um das Lenkrad und fühlte sich nicht mehr so durchgedreht, ängstlich oder berauscht. Sie atmete zur Beruhigung tief durch und durchfuhr die Vorstädte in Richtung Wildcat Canyon, wo die dichte Besiedlung zu Bungalows und stillen, von Bäumen gesäumten Straßen wechselte. Ein letztes Mal, bevor sie in die Straße zu ihrem kleinen, gemieteten Haus einbog, sah sie in den Rückspiegel. Sicherheitshalber bog sie noch ein paar Mal rechts ab und behielt den Rückspiegel im Auge. Dann, in der Gewissheit, nicht verfolgt zu werden, fuhr sie rückwärts in die enge Straße hinter dem Drei-Zimmer-Häuschen hinein, das sie unter falschem Namen angemietet hatte. Sie dachte daran, wie sie der Maklerin ihre gefälschten Papiere vorgelegt und sich vor Angst in die Unterlippe gebissen hatte, überzeugt davon, dass die Frau bei näherem Hinsehen den gefälschten, in Oregon ausgestellten Führerschein erkennen würde. Stattdessen reichte sie ihr nach kurzem Tippen auf ihrer Computertastatur zur Bestätigung der Liquidität und der Berufslaufbahn der Elyse Hammersley, zuletzt wohnhaft in Gresham, Oregon, und nach dem Empfang eines Bankschecks ihr, Elyse Hammersley, die Schlüssel. Wunderbar! Inzwischen betrachtete sie sich selbst als Elyse. Nun, sie war Elyse. Warum auch nicht? Es war perfekt!
Leise in sich hineinlachend, fuhr sie die Zufahrt hinauf. Der Bungalow hatte den typischen Nachkriegsgrundriss, zwei kleine Schlafzimmer, ein Bad, einen Wohnbereich, ein Durchgangszimmer als Esszimmer, eine winzige Küche und eine Treppe, die zu dem für sie wichtigsten Teil des Hauses führte: zum Keller. Mit speziellen Einrichtungen.
Der Keller war es, der dieses Haus, das sich ansonsten nicht von den anderen in diesem Wohnblock unterschied, interessant machte. Er war perfekt für ihre Bedürfnisse.
Jetzt jedoch musste sie ihrem frisch eingezogenen Gast gegenübertreten.
Marla Amhurst Cahill.
Oder, wie sie die Frau, der sie beim Ausbruch geholfen hatte, gern bezeichnete: Marla, die Vermisste, oder Marla, die Flüchtige. Was sie ihrer reizbaren neuen Mitbewohnerin natürlich niemals offen sagen würde.
Die Wochen vor dem Ausbruch waren nervtötend gewesen; sie hatten über diverse Parteien miteinander Kontakt gehalten. Nicht ein einziges Mal hatte sie Marla im Gefängnis besucht. Nicht ein Mal hatte sie sie angerufen. Diejenigen, die Botschaften überbracht hatten, wussten nichts von ihrem Plan, kannten nicht einmal ihren Namen. Elyse fühlte sich sicher in ihrer Anonymität. Um das Glück nicht herauszufordern, kreuzte sie jedoch trotzdem die Finger und wappnete sich für die bevorstehende Konfrontation.
Obwohl sie den Ausbruch über zwei Jahre hinweg geplant hatten und obwohl alles reibungslos vonstattengegangen war, war Marla, wie gewöhnlich, nicht zufrieden gewesen.
Manchmal fragte sich Elyse, ob es die Sache wirklich wert war.
Aber natürlich! Es geht um Millionen! Vergiss das nicht!
Sie warf sich den Riemen ihrer Handtasche über die Schulter, stieg aus dem Wagen und schloss ihn ab. Nervös wie eine Katze sah sie sich nach allen Seiten um, spähte in die Ecken der Garage, auf die Mülltonne, über die langgezogene Veranda hinweg und rechnete beinahe mit einem Hinterhalt von FBI-Agenten, die ihre Dienstmarken aufblitzen ließen und Waffen auf sie richteten.
Dreh jetzt nicht durch! Du hast es geschafft.
Sie huschte den überwucherten Betonweg entlang zur hinteren Veranda, wo sich eine mittlerweile kahle Clematis strohig am Fallrohr emporrankte. Sie hantierte mit ihrem Schlüsselbund, bis sie endlich den gewünschten Schlüssel fand und ins Schloss schob.
Klick.
Der Schlüsselbund klimperte, als sie zitternd vor Nervosität den Schlüssel fürs zweite Schloss erwischte, ihn drehte und ein wenig hin- und herbewegte, bis der uralte Riegel mit metallischem Knirschen zurückfuhr. Mit der Schulter schob sie die klemmende Tür auf und wurde von einem muffigen, abgestandenen Geruch empfangen. Sie nahm sich vor, irgendeinen Lufterfrischer zu besorgen, denn das Häuschen war acht Monate lang unbewohnt gewesen. Vielleicht konnte sie sogar Marla dazu bewegen, ihren Hintern hochzukriegen und zu Lysol und Mopp zu greifen. Es war zwar nicht so, dass Marla in dem großen Haus nicht auch solche Arbeiten verrichtet hätte, aber sie fühlte sich immer noch verfolgt und hatte Angst, dass jemand sie sehen könnte.
»Ich gehe nie wieder zurück«, hatte sie Elyse anvertraut. »Nie im Leben. Vorher müssten sie mich umbringen.«
Und Elyse glaubte ihr.
Sie schloss die Tür hinter sich ab und warf ihre Ledertasche, der sie einen weißen Beutel entnahm, auf den Treppenabsatz. Eine halbe Treppe höher befand sich die Küche, wo ein undichter Wasserhahn tropfte und eine altmodische Wanduhr die Sekunden ihres Lebens zählte. Doch was sich dort oben abspielte, interessierte sie nicht. Vielmehr vergewisserte sie sich noch einmal, dass beide Schlösser verriegelt waren, und stieg dann die knarrende Treppe hinab in den muffigen, stets feuchten Keller. Die Decken waren so niedrig, dass ein hochgewachsener Mann sich unter den Balken ducken musste, und in den dunklen Ecken der Balkendecke hatte sie zahlreiche Spinnennetze gesehen.
Obwohl das Haus für ihre Zwecke perfekt war, verursachte es ihr jetzt eine Gänsehaut.
Vorbei an einer verrosteten Waschmaschine und einem Trockner näherte sie sich der hinteren Wand des feuchten Raums. Die war jedoch nicht das, was sie zu sein schien. Im Lauf des letzten halben Jahrhunderts hatte einer der Hausbesitzer an einem Ende des Kellers eine Mauer gezogen und so Raum für einen verborgenen Weinkeller geschaffen. Was an sich sonderbar war, denn der Keller war viel zu feucht, um hier das richtige Klima für irgendetwas Trinkbares schaffen zu können.
Allerdings benutzte sie den geheimen Raum ja auch nicht zur Lagerung ihrer Lieblingsflaschen Pinot gris, Chardonnay oder Merlot.
Diese Wand mit ihren verstaubten Regalen und der verborgenen Tür war das perfekte Versteck, wenn nicht für kistenweise Wein, dann doch zumindest für eine Ausbrecherin aus einem Gefängnis, dem es an Sicherheitsvorkehrungen mangelte.
Darauf bedacht, nicht zu viel Lärm zu machen, für den Fall, dass Marla schlief, klopfte sie leise an die Regalwand. Marla war offenbar erschöpft von der anstrengenden Planung und Ausführung ihrer Flucht.
Elyse wartete einen Moment und zog dann einen verborgenen Hebel. Mit einem Klick hob sich der Riegel, und ein Teil der Regalwand ließ sich in den kleinen Raum dahinter schieben.
Sie flüsterte: »Hey, hier bin ich«, und schlüpfte in das fensterlose Zimmer, das im Augenblick nur vom flackernden bläulichen Schein des Fernsehbildschirms und von einer kleinen Nachttischlampe erhellt wurde. Der Raum war kahl: Es gab keine Bilder an den Wänden, die Einrichtung bestand lediglich aus einem Sessel, einem Bett, einem Nachttisch und der Kommode, auf der der Fernseher stand.
Marla hob nicht einmal den Kopf zur Begrüßung.
O Gott, sie war schlechter Laune.
Toll.
Die Euphorie nach der gelungenen Flucht hatte sich offenbar gelegt. »Willst du das wirklich ansehen?«, fragte Elyse, als sie sah, dass im stumm geschalteten Fernseher eine beliebte Realityshow lief.
Wortlos bedachte Marla sie mit einem Blick, der alles sagte. Im Gefängnis hatte Marla offenbar eine Sucht nach allen möglichen schrägen Fernsehsendungen entwickelt. »Mir gefällt das. Es ist Eskapismus«, hatte sie mit der Andeutung eines Lächelns gesagt, hinter dem die alte, gerissene Marla für einen Moment zum Vorschein kam.
»Okay, wie du willst. Aber ich dachte, du wolltest gern mal hier raus.«
»Und wohin?«
»Nach oben.«
»Jemand könnte mich sehen«, sagte sie in einem Tonfall, als spräche sie mit einer Schwachsinnigen.
»Du kannst die Vorhänge geschlossen lassen, aber es wäre doch zumindest nicht so …«
»Wie in einer Zelle?«, fragte Marla, ohne die Lippen zu bewegen.
»Ja. Wie in einer Zelle. Morgen besorge ich Reinigungsmittel, dann machen wir sauber. Etwas Mobiliar ist ja schon vorhanden.«
Marla schnaubte verächtlich, und ihr Blick schweifte zurück zu einer in einem fensterlosen Haus eingesperrten Gruppe. Tja, das konnte Marla wohl gut nachvollziehen.
»Sieh mal, ich habe dir was zu essen mitgebracht.« Elyse hielt ihr eine weiße Papiertüte entgegen. »Ein Hamburger, ich habe ihn besorgt, bevor ich zum Haus fuhr. Tut mir leid, dass er schon kalt ist, aber hinterher wollte ich nicht mehr anhalten.«
»Zum Haus?« Plötzlich war Marlas Interesse erwacht, wogegen der Hamburger sie offenbar nicht im Geringsten reizte.
»Ja, das Haus. Auf dem Mt. Sutro.« Sie trat näher an den Sessel heran, beugte sich herab und flüsterte in Marlas Ohr: »Heute Abend habe ich Eugenia umgebracht. Wie wir es geplant haben. O Gott … es war … perfekt. Sie hat mich sogar erkannt, die alte Hexe.«
»Du hast Eugenia umgebracht? Als Erste?« Marla ignorierte die Tüte in ihrem Schoß und sah Elyse wütend an. »So hatten wir es nicht geplant.«
»Hey! Die Gelegenheit war günstig, okay? Und ich habe sie beseitigt. Ich verstehe nicht, welchen Unterschied es macht, wann oder wie sie sterben, solange sie eben sterben!«
»Du kleine …«
»Lass es«, warnte Elyse. »Ich habe für dich meinen verdammten Hals riskiert, da könntest du wenigstens Interesse zeigen oder ›danke‹ sagen oder ›gut gemacht‹, aber nein. Hör gut zu, versuch nur nicht, mich kleinzumachen. Das lasse ich mir nicht gefallen.«
»Wir sind ganz schön reizbar, wie?«, knurrte Marla.
»Ja, sind wir. Wir beide!«
Marla nahm sich zusammen. »Schon gut«, sagte sie gedehnt. »Ich wollte dich nicht anfahren. Ich bin es nur so verdammt satt, hier eingesperrt zu sein.«
»Das wird sich bald ändern.«
»Nicht bald genug.«
Elyse schob sich frustriert das Haar aus dem Gesicht. Das Problem mit Marla war ihre verdammte Launenhaftigkeit. »Hör zu, es tut mir leid. Ich hätte es dir sagen sollen, aber ich musste rasch handeln, als ich hörte, dass Eugenia allein zu Hause sein würde. Verdammt, es ist eben nicht so einfach, verstehst du?«
»Für mich ist es auch nicht einfach. Ich war schließlich im Gefängnis, und jetzt … jetzt sitze ich hier fest.«
»Du wusstest, dass du dich für eine Weile bedeckt halten musst.«
Marla runzelte die Stirn, widersprach jedoch nicht, Gott sei Dank. »Ich glaube, ich brauche nur etwas Zeit, um mich einzugewöhnen.«
»Ja, nun, ich auch. Mach schon, iss etwas und schau fern …«, sie warf einen Blick auf die Mattscheibe, »… was immer das hier für eine Sendung sein mag.«
»Hausarrest.«
»Perfekt.«
Marla lachte über die darin enthaltene Ironie.
»Ich komme wieder. Morgen oder übermorgen, wann immer ich mich freimachen kann, dann bringe ich die Sachen mit, die wir zu deiner Tarnung brauchen. Und dann kannst du es wagen, wieder auszugehen. Wie findest du das?«
»Schon besser«, stimmte Marla zu. Die Fernsehshow wurde durch irgendeine Bierwerbung unterbrochen. »Wenn du das nächste Mal kommst, achte darauf, dass das Essen wenigstens noch lauwarm ist.«
»Klar.«
Als Elyse ging, fragte sie sich, warum sie sich überhaupt mit dieser Zicke abgab.
Wegen des Geldes, hast du das vergessen? Das Cahill-Vermögen? Du musst sie nur noch eine kleine Weile ertragen. Sie ist dein Fahrschein zum Reichtum.
Aber du hast recht: Sie ist eine Zicke ersten Grades.
Damit musst du leben.
Das Herz klopfte ihr bis zum Halse, als Cissy ihren achtzehn Monate alten Jungen suchte. Bitte, ihm darf nichts passiert sein. Bitte!
»Beejay? Schätzchen? Wo bist du?« Angst pochte in ihren Schläfen, Dutzende grauenhafter Szenarien rasten an ihrem inneren Auge vorbei, während Cissy das Grundstück ihrer Großmutter absuchte. Ihr Blick streifte das Gestrüpp, forschte in der Dunkelheit. Mit Macht setzte der Regen wieder ein.
Und wenn sie ihn nicht fand?
Wenn er irgendwie durch die Gitterstäbe des Tors geschlüpft war?
Er war so klein … so unschuldig.
Lieber Gott, lass ihn gesund und wohlbehalten sein!
»Beejay?«
Wo blieben die verdammten Bullen? Die konnten helfen!
Zwei Tage lang hatten sie hier herumgelungert und nun … Gott sei Dank! Sie sah die ersten rotierenden, rot und blau blitzenden Lichter am Fuß des Berges. Das Sirenengeheul kam näher, und im selben Moment erspähte sie ihren kleinen Jungen, der unter einer Azalee kauerte. »Oh, Beejay.« Sie stapfte durch die kalten Pfützen im Garten, zog ihn in ihre Arme und drückte ihn fest an sich. Er war schmutzig. Klammerte sich an sie. Und weinte. Die Mütze hatte er sich schief über ein Ohr gezogen, das Bändchen lag wie eine Schlinge um seinen Hals. Sie knüpfte es auf und zog ihm die Mütze vom Kopf. Er war in Sicherheit. Wohlbehalten. Sie atmete diesen besonderen Beejay-Duft tief ein und schluckte den Kloß in ihrem Hals herunter.
»Angst«, sagte er und zitterte in ihren Armen.
»Ich hatte auch Angst, Schätzchen.« Sie küsste seinen inzwischen nassen Scheitel und presste ihn an sich. Bei der Vorstellung, dass sie ihn hätte verlieren können, brannten Tränen in ihren Augen. »Aber jetzt ist alles wieder gut. Mommy ist bei dir. Alles wird wieder gut!« Sie ging zum Torpfosten, tippte auf der elektronischen Tastatur den Code ein, und als das Tor sich öffnete, röhrte der erste Polizeiwagen – ein alter Cadillac mit der Signallampe auf dem Dach – den Berg herauf, hielt in merkwürdigem Winkel auf der Straße an und blockierte die Zufahrt. Der zweite Wagen, ein Streifenwagen, fand einen Parkplatz an der engen Straße. Dahinter quälten sich ein Feuerwehrauto und ein Notfallwagen die kurvenreiche schmale Straße herauf.
»Die Helfer in der Not«, sagte Cissy zu ihrem Sohn, obwohl das schlachtschiffartige erste Fahrzeug ein ungutes Gefühl in ihr hervorrief. Es brachte Erinnerungen zurück, die sie nicht wollte, Erinnerungen an eine andere schlimme Zeit in ihrem Leben, vor zehn Jahren, an die grauenhaften Vorfälle, die ihre Mutter ins Gefängnis brachten.
Als der erste Polizist auf der Fahrerseite des Cadillacs ausstieg, sank ihr Mut. Er brauchte ihr nicht seine Dienstmarke vorzuweisen oder seinen Namen zu nennen. Sie kannte ihn, denn Detective Paterno hatte die Ermittlungen geleitet, deren Ergebnisse ihre Mutter dann ins Gefängnis gebracht hatten. Sein Jagdhundgesicht wies mehr Falten auf, und sein dichtes Haar war stärker von Grau durchzogen, doch ansonsten hatte er sich, wie sein Wagen, wenig verändert.
»Sie sind Cissy«, sagte er.
»Ja. Das ist mein Sohn, Beejay oder Bryan Jack. Kommen Sie. Hier entlang.« Sie sah an Paterno vorbei, auf die Sanitäter. »Vielleicht besteht noch die Chance, Gran wiederzubeleben«, sagte sie, und in ihrem Herzen blühte ein wenig Hoffnung auf, obwohl sie ziemlich sicher war, dass sie zu spät kamen. Beejay fest im Arm, als hätte sie Angst, ihn noch einmal zu verlieren, lief sie hastig den Plattenweg herauf zur Haustür. Paterno und seine Partnerin, eine große, männlich wirkende Frau mit schlichter Brille und Kurzhaarschnitt, folgten ihr auf den Fersen, die Sanitäter und Feuerwehrleute ein paar Schritte hinter ihnen.
»Warten Sie hier«, sagte Paterno und wies auf eine Bank auf der Veranda, während seine Partnerin, die sich als Janet Quinn vorstellte, durch die offene Tür ins Haus trat. »Himmel, was ist denn hier passiert?«
»Ich weiß es nicht. Ich war nicht hier, als sie stürzte … O Gott.« Cissy schluckte heftig, drückte Beejay fest an die Brust und wiegte sich vor und zurück.
»Mama traurig«, sagte Beejay, und sie nickte.
»Sehr traurig.«
»Mama weint?«
»Oh, vielleicht.« Sie lächelte unter Tränen und küsste sein Köpfchen. Sie schirmte ihren Sohn vor der offenen Tür ab und versuchte, auch selbst nicht ins Foyer zu blicken. Sie hatte schon genug gesehen.
Die Erste-Hilfe-Kräfte, ein Mann und eine Frau, stürmten mit ihrer Ausrüstung an ihr vorbei.
»Vorsicht. Es könnte der Schauplatz eines Verbrechens sein«, sagte Paterno, als sie eintraten.
»Kapiert, Detective«, sagte die Sanitäterin. »Treten Sie zurück. Lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Ach, zum Teufel … sie ist tot.«
Cissys Hoffnung erlosch.
»Es bleibt uns nichts mehr zu tun, als sie in den Leichensack zu stecken«, bemerkte der Sanitäter so emotionslos, dass Cissy nach Luft schnappte. Es ging hier schließlich um ihre Großmutter! Nicht um irgendeine unbekannte, von niemandem beanspruchte, ungeliebte Leiche! Die Frau, über die sie redeten, war Eugenia Cahill, eine kleine, spitzzüngige, freche Frau, die Firmen geleitet, Bridge gespielt und im Vorstand von … Ach Gott, was zählte es schon, in welchen Vorständen sie gesessen hatte? Sie war tot.
»Kein Hinweis auf gewaltsames Eindringen«, sagte Quinn. »Wir prüfen, ob Raub ein Motiv sein könnte.«
Cissy, immer noch auf der Veranda, wandte sich von dem Drama ab, das sich im Hausinneren abspielte. Die Szene war unwirklich, und Cissy, ihren Sohn im Arm, sah zu, wie der Regen vom Nachthimmel fiel, und wurde sich zum ersten Mal und mit aller Klarheit dessen bewusst, dass sie ihre Großmutter nie wieder lebend sehen würde. Sie kämpfte blinzelnd gegen den erneut drohenden Tränenstrom an. Ihre Beziehung war nicht gerade liebevoll gewesen, vielmehr hatten sie sich, als sie als Teenager noch hier lebte, reichlich oft zermürbende, zähe Kämpfe geliefert, doch sie hatte Eugenia geliebt, und abgesehen von einem Onkel und einer Tante in Oregon und einem weiteren Onkel in einer Anstalt war Eugenia ihre einzige Verwandte. Und sie war ganz gewiss, neben ihrem Halbbruder James, ihre engste Verwandte.
Abgesehen von Marla. Hast du sie vergessen? Deine Mutter? Die verdammte ausgebrochene Strafgefangene. Sie musst du mitzählen.
Und was ist mit Jack?
Sie wollte jetzt nicht an ihren Mann, diese Zecke, denken. Als sie doch noch einen Blick ins Foyer riskierte, sah sie, wie die Sanitäter den Kopf schüttelten. Cissy schluckte krampfhaft. Seit dem Augenblick, als sie Eugenia gesehen hatte, wusste sie, dass die alte Dame tot war, doch die Bestätigung ihrer Vermutung traf sie so viel härter.
Paterno kam nach draußen. »Ihre Großmutter …«
»Ich weiß schon.« Innerlich zitterte sie, doch es gelang ihr einigermaßen, die Ruhe zu bewahren. Ihre Gedanken wirbelten wild durcheinander, trotzdem versuchte sie, sich auf den Detective mit dem nüchternen Gesicht und den dunklen Augen zu konzentrieren. »Aber warum … Warum sind Sie gleich gekommen? Na ja, Sie arbeiten in der Mordkommission, dachte ich.« Bevor er noch antworten konnte, hatte sie schon begriffen. »Oh, ich verstehe. Es hat mit meiner Mutter zu tun, nicht wahr?«
»Wir müssen sie finden.«
Sie schauderte, als sie an Marla Amhurst Cahill in Freiheit dachte. Wenngleich Cissy keine voreiligen Schlüsse ziehen wollte, erschien es ihr doch als zu viel des Zufalls, dass ihre Großmutter ausgerechnet ein paar Tage nach Marlas Ausbruch die Treppe hinuntergestürzt war.
Ihre Mutter war clever. Gerissen. Aber hierherzukommen wäre pure Dummheit gewesen. Die Polizei hatte vom Tor aus das Haus beschattet … Oder nicht? Gestern noch hatte ihre Großmutter sich darüber beklagt, aber wo steckten die Polizisten jetzt?
Eiseskälte breitete sich in ihrer Magengrube aus.
»Warum hat es so lange gedauert, bis Sie hier waren? Ich dachte, das Haus würde beschattet. Gran sagte, ein paar Detectives säßen an der Straße in ihrem Wagen.«
»Ja, ein Wagen war hier«, gab er zu. »Aber die Beamten sind abberufen worden. Es wurde eine Schießerei gemeldet, ein Stück die Straße hinunter.«
»Zur gleichen Zeit, als meine Großmutter die Treppe hinunterstürzte?«, fragte sie fassungslos. Ein Zufall? Ihre Großmutter stirbt kurz nach Marlas Flucht, und genau zu dieser Zeit werden die Beamten, die das Haus bewachen sollen, plötzlich abberufen? »Haben Sie die Beteiligten erwischt?«
Paternos langes Gesicht verriet nichts. »Noch nicht.«
»Das heißt, es ist gerade erst passiert?«
»Vor etwa einer Stunde.«
»Vor einer Stunde.« Ihr Herz klopfte heftiger, je mehr Zufälle zusammentrafen. »Gran ist noch nicht lange tot. Sie war … war«, Cissys Stimme brach, »… sie war noch warm, als ich nach einem Puls getastet habe …«
»Wie sind Sie ins Haus gekommen?«
»Ich besitze einen Schlüssel«, erklärte Cissy matt. Es war schwer zu verkraften.
Paterno sah Beejay an. »Wollen Sie nicht lieber im Wagen warten? Wo es warm und trocken ist? Es könnte sein, dass wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen müssen, und das Haus gilt zunächst einmal als Tatort.«
»Sie ist die Treppe hinuntergestürzt. Wo ist da ein Verbrechen?« Doch Cissy hatte längst begriffen, was er andeuten wollte, und der Gedanke, dass ihre Mutter damit zu tun haben könnte, drehte ihr fast den Magen um. Das konnte doch nicht sein. Und doch stand sie da, mit weichen Knien und dem Gefühl, ein außerkörperliches Erlebnis zu haben.
»War jemand bei ihr im Haus?«, fragte Paterno und begleitete sie von der Veranda herunter.
Auf dem Weg zum Wagen lief ihr der Regen in den Nacken. »Nein … Das heißt, ich glaube nicht.« Bei ihrem Acura angekommen, begann Beejay in ihren Armen zu quengeln, und sie flüsterte ihm liebevoll zu: »Schon gut, Schätzchen. Schschsch.«
Paterno öffnete ihr die Fahrertür, und eine Wolke von Tomaten-, Oregano- und Knoblauchduft schlug ihr entgegen. Sie schob den Fahrersitz nach hinten, um mehr Beinfreiheit zu haben, und setzte sich, das Kind auf dem Schoß, hinters Steuer, während Paterno auf der Beifahrerseite einstieg und mit einem Fuß versehentlich auf dem Deckel des Pizzakartons landete.
Zu spät zog er den Fuß zurück. »Tut mir leid.«
»Macht nichts.« Im Moment war ohnehin alles egal. Cissy war wie betäubt. Abgesehen von ihrem Baby war ihr alles gleichgültig.
Zum Glück gefiel Beejay sein Platz hinterm Steuer; er spielte Autofahren und patschte mit seinen kleinen Händen auf das Lenkrad.
Die Füße zu beiden Seiten des lädierten Pizzakartons, saß Paterno da und zog einen Stift und ein kleines Notizbuch aus seiner Jackentasche. »Sie wollten Ihrer Großmutter das Abendessen bringen?«
Sie nickte. »Ich besuche sie eigentlich jeden Sonntag, weil sie dann allein ist. Ich bringe immer etwas zu essen mit, etwas, das sie mag, richte es für sie an, und dann sehen wir zusammen fern, irgendeine Show, Sie wissen schon, mit Coco …« Sie unterbrach sich und hob ruckartig den Kopf. »Wo ist der Hund?«
»Was?«
»Gewöhnlich ist Gran am Sonntag allein, bis auf Coco. Ihr kleiner weißer Schoßhund, den sie über alles liebt. Ich habe den Hund im Haus nicht gesehen, und das ist schon äußerst merkwürdig. Grandma nimmt Coco überall mit hin. Sie sind praktisch unzertrennlich.« Sie ließ den Blick über das Grundstück schweifen, als hätte der Hund irgendwie durch die Tür entwischen können.
»Wir werden ihn finden«, sagte Paterno und notierte etwas in seinem Büchlein. Er berührte ihren Arm. »Sie sagten … Sie sehen dann fern …«
»Heute Abend sollte es Pizza geben, weil ich spät dran war …« Cissy senkte den Blick auf die zertretene weiße Schachtel und konnte nicht glauben, dass sie sich noch vor weniger als einer halben Stunde Gedanken darüber gemacht hatte, wie sie ihrer Großmutter erklären sollte, dass sie keine Zeit gehabt hatte, selbst etwas zu kochen, weil ihre Großmutter das lieber mochte als Pizza zum Mitnehmen von Dino. Jetzt saß sie mit einem Bullen, dem sie nicht traute, in ihrem Auto, und ihre Großmutter war tot. Sie räusperte sich, versuchte klar zu denken. »Wie auch immer, gewöhnlich sind wir drei allein. Grandma, Beejay und ich. Deborah, die Frau, die als Gesellschafterin gilt, ist dann nicht dabei; hm, verstehen Sie, sie ist eigentlich keine ›Pflegerin‹.« Cissy zeichnete mit den Fingern Gänsefüßchen in die Luft. »Auf eine Pflegerin würde Gran sich nie einlassen, wohl aber auf eine Gesellschafterin. Deborah hat sonntags und montags frei, und das Hausmädchen, Paloma, macht gegen fünf Uhr nachmittags Feierabend, soviel ich weiß. Elsa, die Köchin, arbeitet nur montags bis freitags, es sei denn, Gran hat Gäste … und … und, ach ja, Lars, der Chauffeur, arbeitet bis, ich weiß nicht … fünf, sechs Uhr ungefähr? Außer, wenn Grandma ihn braucht, dann sprechen sie sich ab.« Sie versuchte, alles genau auf die Reihe zu bekommen, wusste jedoch, dass sie wirres Zeug redete. »Also, dann sehen wir uns irgendeine stumpfsinnige Show an und … und … ach, zum Teufel.« Sie fing wieder an zu weinen und wischte sich, wütend auf sich selbst, angewidert die Tränen von den Wangen.
»Mommy?«, fragte Beejay und drehte den Kopf, um sie anzusehen.
Sie brachte ein Lächeln zustande. »Alles in Ordnung mit Mommy.« Eine himmelschreiende Lüge. »Dürfen wir jetzt fahren?«, fragte sie den Detective gerade in dem Moment, als das Fahrzeug der Spurensicherung einfuhr und die Blockierung der Zufahrt vervollständigte. Schlimmer noch, durchs offene Tor sah sie, wie einige Nachbarn draußen auf der Straße standen und sich unter den weitläufigen Ästen einer großen Eiche zusammendrängten. Cissy stöhnte auf und stöhnte erneut, als ein Übertragungswagen den Berg hinaufdröhnte und ein paar Häuser entfernt in zweiter Reihe einparkte. »Es wird ja immer schöner.«
»Ich kann Sie nach Hause bringen. Leider dauert es aber noch ein bisschen. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie mir eine Liste der hier Beschäftigten geben könnten, also Namen und Adressen.«
»Ich habe so etwas nicht, aber Gran besaß so eine Liste. Ich kann Ihnen nur ein paar Telefonnummern geben, die ich in meinem Handy gespeichert habe, Deborahs und Lars’. Die restlichen kenne ich nicht, ich habe wohl aber die Adressen von einigen ihrer Freunde zu Hause auf meinem Computer.«
»Ich brauche alles, was Sie finden können.«
Sie kramte ihr Handy aus der Handtasche, scrollte durch ihr Telefonbuch und rasselte die gefragten Nummern herunter. »Deborah Kraft, hier ist sie.« Sie nannte die Nummer. »Und Lars Swanson; ich weiß genau, dass ich seine Nummer gespeichert habe, denn er fährt manchmal auch Beejay und mich.« Und sie gab ihm auch diese Nummer. »Paloma heißt mit Nachnamen Perez, und ich … ich glaube, sie wohnt in Oakland. Ihr Mann heißt Estevan. Und ein Mädchen namens Rosa hat seit Jahren immer mal wieder für Gran gearbeitet. Sie heißt mit Nachnamen Santiago. Ich weiß nicht, wo sie wohnt, aber ich glaube, Gran bewahrt ihr Adressenverzeichnis in der Bibliothek auf. Beim Telefon. Auf Karteikarten, nicht im Computer … Sie hat ihren PC nur selten benutzt.« O Gott, sie faselte schon wieder.
»Wir sehen nach. Danke.«
»Können wir jetzt fahren?«
»Jetzt noch nicht, aber bald. Versprochen«, sagte er ernst. »Ich bin in ein paar Minuten zurück, dann können wir hier Schluss machen, und wenn ich noch Fragen an Sie habe, rufe ich an oder komme zu Ihnen, oder Sie kommen ins Präsidium, falls das einfacher ist.«
»Mehr kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht sagen – und ich muss unbedingt mit meinem Sohn nach Hause.«
»Ja, natürlich. Ich beeile mich.« Paterno stieg aus und wandte sich jemandem zu, der gerade aus dem Fahrzeug der Spurensicherung ausstieg. Gemeinsam gingen sie raschen Schritts den Pflasterweg entlang, auf dem es mittlerweile von Polizisten und Sanitätern wimmelte. Auf keinen Fall wollte sich Cissy von dem Detective heimfahren lassen. Sie mussten sich halt etwas einfallen lassen, um die Zufahrt frei zu bekommen. Im Augenblick jedoch saß sie wohl fest, was sie maßlos ärgerte. »Okay, Schatz«, sagte sie zu Beejay »Ich kann nichts dagegen tun. Wir zwei sind allein. Wie wär’s, wenn wir im Auto essen?«
»Ich fahre.«
»Mhm. Später.«
Beejay fing an zu nörgeln, als sie ihn von ihrem Schoß hob, doch sie ignorierte den bevorstehenden Wutanfall, schnallte ihn auf dem Beifahrersitz an, entnahm dem Handschuhfach ein paar zusätzliche Servietten und öffnete den Pizzakarton.
Sie reichte ihm ein kleines Stück, und schon hörte er auf zu schreien. Gestern noch hätte sie um ihre Ledersitze gefürchtet. An diesem Abend wurde ihr bewusst, dass so etwas nicht wichtig war. Verschmierte Tomatensoße oder Mozzarellakäse ließen sich abwischen. Ihre Großmutter würde sich nie wieder über Flecken beklagen können.
Während Beejay eine Peperoni von seinem Pizzastück nahm und sie eingehend betrachtete, bevor er sie sich in den Mund schob, blickte Cissy durch die regenfleckige Windschutzscheibe auf das alte Haus. Seine Backstein- und Ziegelmauern erhoben sich drei Stockwerke über der unterirdisch gelegenen Garage, sie waren flankiert von Rhododendren, Azaleen und Farnen, die jetzt den Regen auffingen und im Wind schaukelten. Die Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock waren beleuchtet – warme Lichtflecke, die das Grauen im Hausinnern leugneten. Sie hob den Blick zum zweiten Stock und dem Erker ihres früheren Zimmers, des Orts, an dem sie den Großteil ihrer trübsinnigen Teeniejahre verbracht hatte.
Damals hatte sie das Leben in der Stadt gehasst, war lieber auf der Ranch gewesen. Das hatte sich natürlich geändert.
Vielleicht hätte Cissy wieder hier einziehen sollen, wie ihre Großmutter vorschlug, als sie Jack rausgeworfen hatte. Doch Cissy hatte ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben wollen. Und außerdem beherbergte dieses alte, weitläufige Haus keine allzu guten Erinnerungen für sie.
Jetzt war Gran tot.
Ihre Kehle schnürte sich schmerzhaft zusammen. Ihr gesamtes Leben schien auseinanderzubrechen. Ihre Mutter war aus dem Gefängnis ausgebrochen, ihre Großmutter tot, ihr Mann … Ach, an ihn wollte sie gar nicht denken. Sie sah ihr Kind an, das zufrieden auf der Peperoni herumkaute, und brach ein Stückchen von der Käsekruste ab. Sie reichte es Beejay; er ergriff es eifrig und zerquetschte es dann in seiner kleinen Faust.
Sie war so in Gedanken verloren, dass sie nicht bemerkte, wie ein Schatten am Wagen vorbeistrich und jemand durch das Fenster der Fahrertür spähte, bis mit den Knöcheln an die Scheibe geklopft wurde. Sie fuhr zusammen und drehte sich so hastig um, dass der Rest der Pizza um ein Haar auf dem Steuerrad gelandet wäre. Jack Holt sah sie an.
»Himmel!«, sagte sie mit klopfendem Herzen und fügte dann leise hinzu: »Tja, Beejay, sieh mal, wer da gekommen ist.« Sie konnte es nicht glauben. »Daddy ist hier.«
3
Das Letzte, was Cissy im Moment brauchte, aber wirklich das Allerletzte, war eine Konfrontation mit ihrem Ex-Mann in spe. Widerwillig ließ sie das Fenster herunter. Mit einem Schwall regenfrischer Luft nahm sie einen Hauch von seinem Aftershave wahr, der eine Menge unerwünschter Erinnerungen weckte. So aufgewühlt sie auch war, bemerkte sie doch den leichten Bartschatten auf seinem ausgeprägten Kiefer und die laserartige Intensität seiner blauen Augen.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.





























