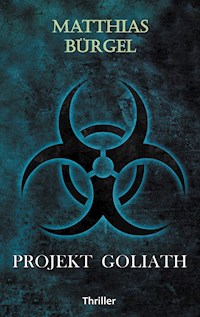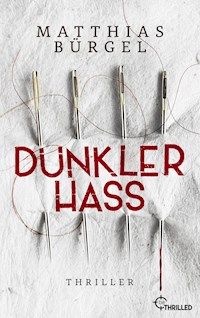7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fallanalytiker Falk Hagedorn
- Sprache: Deutsch
Der Täter ist näher, als du denkst ...
Die Weihnachtszeit ist alles andere als besinnlich in Konstanz: Die Besucher des Weihnachtsmarkts erwartet ein grauenvoller Anschlag. Ein Amokfahrer fährt in die Menge und lässt viele Tote zurück - und acht Überlebende.
Eigentlich wollte Falk Hagedorn sich von den Ermittlungen fernhalten. Doch der Trauma-Therapeut und ehemalige LKA-Fallermittler soll den Überlebenden helfen, das grausame Attentat zu verarbeiten. Aber er gelangt bei der Arbeit mit der Selbsthilfegruppe an seine Grenzen, denn ihn holt seine eigene Vergangenheit ein. Auch bei den Teilnehmern tun sich ungeahnte Abgründe auf. Und der Täter ist ihm näher, als Hagedorn denkt ...
Abgründig, verstörend, hochspannend. Der letzte Fall für den Profiler Falk Hagedorn.
eBooks von beThrilled - mörderisch gute Unterhaltung!
»Ein echter Ermittler, der authentisch und auch noch verdammt spannend schreiben kann. Hut ab!« Leo Born, Spiegel-Bestseller-Autor
»Brutal. Schonungslos. Emotional.« Ivar Leon Menger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Epilog
Danksagung
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Der Täter ist näher, als du denkst ...
Die Weihnachtszeit ist alles andere als besinnlich in Konstanz: Die Besucher des Weihnachtsmarkts erwartet ein grauenvoller Anschlag. Ein Amokfahrer fährt in die Menge und lässt viele Tote zurück – und acht Überlebende.
Eigentlich wollte Falk Hagedorn sich von den Ermittlungen fernhalten. Doch der Trauma-Therapeut und ehemalige LKA-Fallermittler soll den Überlebenden helfen, das grausame Attentat zu verarbeiten. Aber er gelangt bei der Arbeit mit der Selbsthilfegruppe an seine Grenzen, denn ihn holt seine eigene Vergangenheit ein. Auch bei den Teilnehmern tun sich ungeahnte Abgründe auf. Und der Täter ist ihm näher, als Hagedorn denkt ...
Abgründig, verstörend, hochspannend. Der letzte Fall für den Profiler Falk Hagedorn.
Matthias Bürgel
Deine größte Angst
Prolog
Konstanz, Altstadt
1. Dezember, 16 Uhr 30
Mit Blut besudelte Menschen rannten ziellos, schreiend und kreischend durcheinander. Instinktiv warf Hagedorn schützend die Arme über den Kopf, als jemand oder etwas über ihn hinwegsprang, gerade in dem Moment, als er vom Sitz seines Rollstuhls glitt und sich zu dem Jungen niederließ.
Auf den Unterarmen robbte er neben ihn, die gelähmten Beine nutzlos hinter sich herschleifend, schob seinen Unterarm vorsichtig unter den Nacken des Jungen und zog ihn behutsam zu sich heran. Hob ihn an seine Brust. Eisiger Schneematsch kroch durch seine Hose und den Saum seines Anoraks.
»Macht doch endlich diese scheiß Musik aus«, schrie er in die Menge.
Aus verborgenen Lautsprechern säuselten die letzten Takte von Bing Crosbys White Christmas, um übergangslos durch Chris Reas Driving Home for Christmas abgelöst zu werden.
Gleich einer rostigen Saugpumpe, die leerlief, rasselten und blubberten die Atemstöße des Jungen. Er hustete gequält.
Fäden aus Speichel, Rotz und Blut hingen an seinen Mundwinkeln herunter. Hagedorn wischte sie mit dem Ärmel seiner Jacke weg.
Die dürren Beine zertrümmert, unnatürlich verwinkelt und verdreht. Knochensplitter ragten wie Dolche aus der durchlöcherten Jeans.
Doch noch etwas anderes ragte aus ihm heraus. Der rot-weiß lackierte Absperrpfosten hatte sich in die Brust des Jungen gebohrt, Organe zerfetzt, die Wirbelsäule zertrümmert und ihn komplett durchschlagen. Als er eine Hand an das Metall des Pfostens legte, glaubte er, darin den schwächer werdenden Herzschlag des Jungen vibrieren zu spüren.
Die Blicke des Jungen suchten ihn.
»Du hast schöne Augen«, flüsterte Hagedorn. »Wie heißt du denn, mein Junge?«
»Leon«, antwortete er flüsternd.
»Das ist ein toller Name.« Er legte ihm die Hand an die Wange. »Weißt du, was Leon bedeutet? Hm? Der Starke, der Kämpfer. Wusstest du das?« Leon blinzelte. Für ein Lächeln reichte es nicht. »Du bist ein Kämpfer, nicht wahr, Leon? Das bist du doch?«
Erneut ein schwaches Blinzeln. Schneeflocken rieselten herab und verfingen sich in den feinen, beinahe durchsichtig blonden Wimpern, schmolzen auf der bleichen Gesichtshaut des Jungen, vermischten sich mit dem Blut und rannen in filigranen Schlieren die Wange herunter.
»Hörst du, Leon? Hilfe ist unterwegs. Du musst nur noch ein wenig durchhalten. Willst du das für mich tun?«
Leon nickte fast unmerklich. Unablässig fixierten ihn die eisblauen Augen, während die Lippen lautlose Worte formten.
»Ich weiß.« Hagedorn streichelte sanft seine Wange. »Du bist ein Kämpfer. Wie ich. Wir sind beide Kämpfer.«
Die Rettungswagen konnten nicht mehr weit weg sein, und doch schienen sich die Sekunden zu einer Ewigkeit auszudehnen, als das Sirenengeheul quälend langsam näher kroch.
»Komm schon, Leon. Halte durch! Gleich kommt der Arzt.«
Hagedorn spürte, wie sich der schmächtige Körper in seinen Armen aufbäumte. Leons Unterbewusstsein schien sich trotzig zur Wehr zu setzen, dennoch wurden die Atemwölkchen vor Leons Mund unregelmäßiger und dünner. Verloren immer mehr an Substanz. Bis die einzig verbliebene Wolke Hagedorns kondensierender Atem war, der sich in der kalten Dezemberluft verlor.
»Atme doch, verdammt!«
Zitternd tasteten seine Fingerspitzen vergeblich suchend über die Halsschlagader des Jungen.
Seiner Kehle entfuhr ein Schrei, dem seine ganze Verzweiflung, Wut und Schmerz innewohnten. Denjenigen, die ihn vernahmen, würde er sich für alle Zeiten in die Seele brennen. Untrennbar verschmolzen mit den verklingenden Harmonien von Driving Home for Christmas.
Kapitel 1
Irgendwo in Konstanz
1. Dezember, 17 Uhr 15
Die Erregung, die von ihm Besitz ergriffen hatte, ließ ihn erzittern. Seine Beine fühlten sich teigig an, und er fiel aufs Sofa. Den Unterarm über die Augen gelegt, lief wie ein innerer Film die Fahrt vor ihm ab.
Er versuchte sich seiner widerstreitenden Gefühle klar zu werden. Gewissensbisse und ein nie gekanntes Hochgefühl fochten unerbittlich miteinander. Aber es war abzusehen, dass die Euphorie die Oberhand gewinnen würde.
Ruckartig setzte er sich auf und kramte in der Jacke nach der Kamera, die er danach hastig in eine der beiden Innentaschen gestopft hatte. Das Gehäuse zu öffnen war schon kniffliger. Besonders wenn man klamme und zittrige Hände hatte.
Mit spitzen Fingern klaubte er die Karte aus dem Slot und legte sie neben die Dash-Cam auf den niedrigen Couchtisch. Die Kamera war nichts Besonderes. Keine dieser sündhaft teuren Action-Cams, für die man mehrere Hunderter hinlegen musste. Knapp fünfzig Euro hatte er bei einem großen Internetshop dafür bezahlt. Einfach, ohne viel technische Gimmicks, aber mit einer hohen Auflösung. Das war ihm wichtig gewesen.
Polternd stürmte er die Treppe nach oben und kehrte wenige Augenblicke später aus seinem Zimmer im Dachgeschoss zurück.
Unter dem Arm das MacBook und ein Kartenlesegerät, das er sogleich mit dem Laptop verband und das Gerät hochfahren ließ.
Über den Finder wählte er die Speicherkarte an und klickte auf die einzige darauf abgespeicherte Datei.
Waren es wirklich nur vier Minuten gewesen? Ungläubig runzelte er die Stirn. Es war ihm viel länger vorgekommen.
Erwartungsvoll schwebte sein Zeigefinger über dem Touchpad. Dann öffnete er die Datei.
»Geh zur Seite, Mann«, drang seine eigene Stimme aus den integrierten Lautsprechern des MacBooks. Sie klang nervös und angespannt. Wenn er sich darauf konzentrierte und gefasst war, hatte er es gut unter Kontrolle. War er hingegen nervös oder hektisch, schlug sein Sprachfehler durch.
Einige Passanten wichen widerwillig zur Seite, andere wiederum bedachten ihn mit Beschimpfungen und obszönen Gesten.
Von der Oberen Laube kommend, war er über die Paradiesstraße über den Obermarkt in die Kanzleistraße eingefahren. Der Motor des Vito, den er in der Nacht zuvor in der Schweiz etwas außerhalb von Kreuzlingen aufgebrochen und kurzgeschlossen hatte, lief ruhig. Weiß sollte der Wagen sein und ohne Werbeaufdrucke. Einfach weil er die Farbe mochte. Sie hatte keine tiefergehende symbolische Bedeutung für ihn.
Seit der Amokfahrt auf dem Breitscheidplatz vor fast genau sieben Jahren, suggerierte man den Menschen Sicherheit. Man türmte überdimensionierte, an Legosteine erinnernde Bauklötze aus Beton auf, die eine Wiederholung eines solchen Anschlags vereiteln sollten.
Für gewisse Fahrzeuge mochte das Umfahren solcher Blockaden tatsächlich hinderlich sein, weshalb er sich bewusst für einen Kleintransporter entschieden hatte.
Das Bild ruckelte, als der Vito über eine Bordsteinkante holperte.
Vielen Kommunen und Ausstellern hatte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit die Pandemie-Verordnungen gelockert wurden, kehrten Volksfeste, kulturelle Veranstaltungen und eben auch die Weihnachtsmärkte zurück und erfreuten sich größter Beliebtheit. Obwohl das Münchner Oktoberfest mit einer Million Besuchern unter den Erwartungen geblieben war, spürte man dennoch, dass die Menschen es leid waren eingesperrt zu sein und nach Geselligkeit und Ausgelassenheit gierten.
Mit über einhundertfünfzig Ausstellern, die ihre Waren und Speisen in zauberhaft dekorierten Holzhütten präsentierten, zählte der Weihnachtsmarkt in Konstanz zu einem der größten in Deutschland. Vom Obermarkt dehnte er sich über die Kanzleistraße, über die gesamte Marktstätte bis zum Hafen und dem dort vor Anker liegenden Weihnachtsschiff aus. Einhunderttausend installierte Glühbirnen schufen eine weihnachtliche Stimmung.
Ihm war das gleichgültig. Weihnachten hatte für ihn schon vor Jahren seine Bedeutung verloren. Das Gefühl, das er in diesem Moment verspürte, kam einer vorweihnachtlichen Stimmung noch am nächsten.
Der letztjährige Weihnachtsmarkt musste, wegen steigender Inzidenzen, bereits nach fünf Tagen seine Pforten wieder schließen.
Seit Jahrzehnten frönten seine Eltern der vorweihnachtlichen Tradition des Marktbesuches.
Ohne Magenbrot, gebrannte Mandeln, heiße Maronen und reichlich Feuerzangenbowle oder Glühwein sei die Adventszeit keine richtige Adventszeit, pflegte seine Mutter zu betonen. Und fromm, wie sie war, zelebrierte sie die Abfolge des Kirchenjahres.
Viele Jahre schon hielten sie dabei einem bestimmten Standbetreiber die Treue. Weil dort der Glühwein angeblich am besten schmecke. Persönlich hatte er dem Gesöff nie etwas abgewinnen können. Er bekam davon nur Kopfschmerzen.
»Verpiss dich, Alter!«, blaffte er einen Passanten an, der provokativ langsam vor dem Vito über die Kanzleistraße schlenderte.
»Hab ich euch«, hörte er sich sagen. Seine Stimme mochte er genauso wenig wie sein Aussehen.
Siebzig Meter oder weniger war die Gruppe noch entfernt, die er als Erstes ins Visier nahm. Eingemummelt in dicken Schals, standen die Leute neben einem der Heizpilze, jeder einen dampfenden Glühweinbecher in der Hand.
Dann heulte der Motor auf. Mit durchdrehenden Reifen beschleunigte der Wagen, vollführte einen bockigen Satz vorwärts. Schlingerte, fand wieder in die Spur und hielt auf den Glühweinstand zu. Körper schlugen dumpf gegen die Karosserie, prallten daran ab. Noch vierzig Meter. Menschen sprangen zur Seite, brachten ihre Kinderwagen in Sicherheit.
Dreißig Meter. Wumm! Ein Mann im Nikolauskostüm knallte gegen die Front des Vitos, wurde zurückgeworfen und mähte ein halbes Dutzend Passanten nieder, als er sie mit sich riss. Holpernd überrollte er den Nikolaus.
Das stakkatoartige Mahlen und Knirschen berstender Knochen klang wie die irrwitzige Soloeinlage des Drummers Lars Ulrich von Metallica, seiner Lieblingsband.
Noch fünfzehn Meter. Er schaltete in den Dritten, beschleunigte weiter, hielt auf die Personengruppe zu, die nun, zu Salzsäulen erstarrt, des herannahenden Unheils harrte.
»Hallo zusammen!« Die Stimme aus den Lautsprechern des Macs klang beinahe fröhlich.
Ein hochgeschossener Kerl erwachte als Erster aus seiner Starre und versuchte vergeblich, die anderen hinter den Stehtisch mit dem Heizpilz zu ziehen.
Er stieß ein grimmiges Lachen aus. Als wenn sie das vor ihm bewahrt hätte.
Noch drei Meter. Zwei. Einen. Das angstvoll verzerrte Gesicht einer älteren Frau zerplatzte vor ihm auf der Windschutzscheibe. Den überrascht dreinschauenden Blick des hochgewachsenen Mannes zerriss es nur Millisekunden später. Hirnmasse, Blut und Speichel klebten zäh auf der Scheibe, das die Wischerautomatik gleichmäßig vor seinem Blickfeld verschmierte.
Kreischen und laute Rufe mischten sich unter die dumpfen Geräusche der auf der Karosserie aufschlagenden Körper. Ungebremst raste er die Marktstätte hinunter und hielt auf die Unterführung zu. Knochen knackten und zerbarsten unter den Rädern, immer wieder schlugen Leiber polternd gegen den Unterboden.
Um den Brunnen zu umrunden, musste er vom Gas gehen und bremsen.
»Fuck!«, hörte er sich ungläubig ausrufen.
Ein Arm schob sich durch das geöffnete Seitenfenster und packte das Lenkrad. Aus den Augenwinkeln nahm er die blaue Uniform wahr.
Eine Frau steckte darin, die ihm etwas zubrüllte. Er verstand kein Wort davon.
»Lass los, Bitch!«, brüllte er, hieb mit dem linken Ellbogen nach ihr und beschleunigte. Irgendwann würde sie schon loslassen.
Wieder und wieder schlug er nach der Frau, bis ihr Griff sich löste und das Lenkrad schließlich freigab.
Als er sich der Unterführung näherte, wurde ihm klar, dass die Hütten zu dicht und zu eng beieinanderstanden. Die Gefahr, sich darin zu verkeilen und danach nicht mehr aus dem Van steigen zu können, war zu groß. Er riss das Lenkrad nach rechts, hielt auf den Bahnhofsplatz zu, als sich ihre Blicke trafen. Eine Mischung aus Unverständnis und blankem Entsetzen lag in den eisblauen Augen des Jungen, als er ihn direkt ansah. Seine Hand krallte sich um das abgerundete Ende des Absperrpfostens, gegen den er sich eben noch locker gelehnt hatte. In seinem Gesicht die bittere Erkenntnis, dass er einem Aufprall nicht würde entgehen können. Der Junge schloss die Augen.
In der nächsten Sekunde rammte er den Jungen, riss den Pfosten aus seiner Verankerung und schleuderte beide gegen die Wand eines Gebäudes.
Im selben Moment, wie der Player die Aufnahme beendete, kam er zum Höhepunkt.
Kapitel 2
Psychotherapeutische Praxis Hagedorn & Szegeny
8. Dezember, 17 Uhr 30
»Mein Mann hört mir nie zu. Ich kann ihm auch nie etwas recht machen. Ständig meckert er an meiner Haushaltsführung herum. Dabei rührt er im Haus keinen Finger, der Idiot«, jammerte die Frau seit vollen dreißig Minuten.
Eine einfach gestrickte, ungepflegte Mittvierzigerin, die seit vier Wochen zu ihm in die Therapie kam. Versuche, ihr Fragen zu stellen, wie sie sich damit fühle oder sie in der Vergangenheit mit den Konflikten in ihrer Ehe umgegangen war, hatte er schnell aufgegeben. Hagedorn war sich nicht sicher, ob nicht der Ehegatte der Bedürftigere von den beiden war. Unentwegt beklagte sie sich über ihn, fühlte sich dabei aber in der Opferrolle. Ohne ihn je zu Gesicht bekommen zu haben, empfand er beinahe Mitleid mit dem armen Kerl.
»Bitte, Frau Scholz«, entschuldigte sich Hagedorn. »Mir geht es heute nicht besonders gut. Ich würde unsere Sitzung gerne vertagen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Wenn es sein muss«, quengelte die Frau genervt.
Ostentativ geschäftsmäßig, damit sie sein Augenrollen nicht mitbekam, wandte er sich dem Monitor zu und begann ihr Termine vorzuschlagen, um mögliche Einsprüche im Keim zu ersticken.
»Okay, Mittwoch geht es bei Ihnen nicht, sagen Sie. Passt es nächsten Freitag? Halb elf?«
Gleichmütig zuckte die Frau mit den Achseln. »Das geht«, erwiderte sie knapp.
»Gut. Und bis dahin möchte ich Sie bitten, über den weiteren Fortgang unserer Sitzungen nachzudenken.«
»Hä? Wie meinen Sie das?«
Gott, war die Frau begriffsstutzig!
»Na ja ...« Er überlegte kurz, wie er es ihr beibringen sollte. »Sie haben mir bislang nur von Ihrem Mann erzählt. Aber nur sehr wenig über sich selbst.«
»Wenn er aber doch das Problem ist? Ich habe den Eindruck, Sie wollen mir überhaupt nicht helfen«, meinte sie trotzig.
»Dann will ich es anders formulieren, Frau Scholz.« Hagedorn faltete die Hände, stützte das Kinn darauf und sah sie scharf an. »Sie vergeuden meine Zeit und verpulvern Ihr Geld. Was Sie brauchen, ist eine Eheberatung und kein Psychotherapeut. Und jetzt bitte ich Sie zu gehen.«
Hagedorn hatte keinen Nerv mehr für diese Frau.
»Dann sehen wir uns nächsten Freitag?«, erkundigte sie sich verschüchtert.
»Nein, tun wir nicht.«
»Jasmin?«, rief er in den Vorraum, nachdem die Frau beleidigt aus der Praxis gestapft war. »Bring mir bitte einen Kaffee und ein paar Aspirin.«
Jasmin war seit einem Jahr seine Praxis-Assistentin. Zu Beginn war sie ihm mit ihrer quirligen Art tierisch auf die Nerven gegangen, aber sie hatte sich als wahre Bereicherung entpuppt. Für seinen Partner Darius, die Praxis, aber auch für ihn persönlich.
Das Mahlwerk des Kaffeevollautomaten setzte sich in Bewegung.
»War sie wieder sehr anstrengend?« Jasmin brachte ein Glas Wasser mit zwei Aspirin und stellte beides vor ihm ab.
»Danke. Frau Scholz ist immer anstrengend.«
»Ich würde heute gern etwas früher gehen.«
»Aber erst wenn ich meinen Kaffee habe«, flachste er.
Jasmin deutete einen Knicks an. »Selbstverständlich, Mylord.«
»Los verschwinde«, sagte er lachend.
Für heute standen keine weiteren Termine an. Er rührte in seinem Kaffee und überlegte, ob er am Abend kochen oder essen gehen sollte. Schlagartig fiel ihm ein, dass in seinem Kühlschrank gähnende Leere herrschte, was die verbliebenen Optionen einschränkte. Morgen würde er dringend seine Vorräte auffüllen müssen.
Für einen Moment schloss er die Augen und genoss das Nachlassen des schmerzhaften Pochens in den Schläfen. Die beiden Aspirin begannen ihre Wirkung zu entfalten. Mit dem Daumen drückte er den Steuerhebel seines elektrischen Rollstuhls und fuhr zum Fenster, wo er die Gardine ein wenig zur Seite schob und kritisch den bleiernen Himmel betrachtete. Schneeregen verwandelte die Marktstätte, an der seine Praxis lag, in einen matschigen Sumpf. Nur wenige Hütten, die bei der Amokfahrt unversehrt geblieben waren, hatten geöffnet. Wobei er sich die Frage stellte, für wen eigentlich? Kaum einer war unterwegs. Der Schock saß tief in der Konstanzer Bevölkerung, und die Anteilnahme für die Opfer war beeindruckend.
Die wenigen Menschen, die sich trotz des Sauwetters auf die Marktstätte wagten, gingen mit gesenktem Kopf, legten Blumen nieder oder zündeten eine Kerze an. Tausende Teelichter, Kuscheltiere aller Art und Trauerkränze türmten sich auf den Stufen der Marktstättenunterführung. Die Konstanzer Kirchengemeinden wetteiferten mit Trauer- und Gedenkfeiern, während im Stadtrat die Fetzen flogen.
Man streite, so berichtete die Lokalpresse, ob es noch vertretbar sei, den Weihnachtsmarkt geöffnet zu lassen.
Letztlich, da war sich Hagedorn sicher, würden finanzielle Interessen die Oberhand gewinnen, und man würde den Weihnachtsmarkt bis zum 24. Dezember weiterlaufen lassen. Natürlich mit den gewohnt salbungsvoll um Mitgefühl heischenden Worten. Gerade schlenderte zum dritten Mal das Kamerateam eines großen deutschen Privatsenders über den Platz. Eine für die Witterung völlig unpassend gekleidete Reporterin streckte jedem, der ihr über den Weg lief, ein Mikrofon mit pelzigem Überzug unter die Nase.
Offenbar schien sie wenig Erfolg damit zu haben, da alle, bei denen sie es probierte, sich kopfschüttelnd abwandten und schnell das Weite suchten.
Hagedorn fuhr zusammen, als die Praxisklingel schrillte. Er musste ein Stück zurücksetzen, um an den Taster für den Türöffner zu gelangen, den er sich auf der Schreibtischplatte hatte installieren lassen.
Er spähte in den Empfangsbereich.
»Marius!«, rief er freudig. »Schön, dich zu sehen.«
Erster Kriminalhauptkommissar Marius Bannert stampfte sich übertrieben den Schneematsch von den Schuhen und schlüpfte aus dem Anorak, den er, ordnungsliebend, wie er war, akkurat an einen Bügel hängte.
Der Fall eines Serienmörders hatte sie vor vier Jahren zusammengeführt. Damals hatte der geistesgestörte Verwaltungschef der Konstanzer Klinik junge Frauen entführt, getötet, skalpiert und ihnen die Geschlechtsorgane entfernt, um sich damit zu schmücken. Ihn fröstelte bei der Erinnerung daran. Damals lebte er noch in Stuttgart, als Bannert völlig verzweifelt, eine Akte unter den Arm geklemmt, vor der Haustür seines Siedlungsreihenhauses gestanden und um seine Mithilfe gebeten, ja ihn regelrecht angefleht hatte.
Einem ersten Impuls folgend hatte er ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen, mit dem freundlichen Hinweis, sich zum Teufel zu scheren. Heute dachte er freilich anders darüber.
Er würde es Marius gegenüber nie eingestehen, aber möglicherweise hatte er es ihm zu verdanken, dass er aus einer Lethargie befreit worden war, die er selbst vielleicht nie hätte überwinden können.
Nachdem der Fall erfolgreich abgeschlossen war, hatte er das Haus in Stuttgart verkauft und mit dem beträchtlichen Erlös dafür ein Häuschen im Konstanzer Musikerviertel erstanden, das er nach seinen Bedürfnissen umgestaltet hatte.
Nicht nur, dass er Bannert sein Leben verdankte, zwei weitere Fälle hatten sie noch enger zusammengeschweißt. Sie waren Freunde geworden und er Patenonkel von Bannerts Tochter.
Hagedorn griff nach dem Telefonhörer, als der Apparat klingelte, während er aus der Rezeption die Jura-Maschine erneut mahlen hörte.
»Ich schau derweil mal nach dem Kaffee. « Bannert ließ Hagedorn allein telefonieren.
»Hagedorn«, meldete er sich. »Guten Abend, Herr Oberbürgermeister.«
Hagedorn lauschte stumm.
»Ihre Anfrage ist zwar sehr schmeichelhaft, aber ich lehne dankend ab. Guten Abend!« Hagedorn legte auf.
Bannert hatte inzwischen wieder das Büro betreten, den Kaffeebecher mit beiden Händen umfassend.
»Was wollte denn der OB von dir?« Bannert ließ sich auf die Zweierledercouch fallen und nippte vorsichtig am heißen Kaffee.
»Ach egal. Was verschafft mir das Vergnügen deines Besuchs? Lass mich raten. Du warst den Bürokaffee leid und wolltest mal wieder eine gute Tasse Kaffee bei mir genießen. Hab ich recht?« Hagedorn grinste breit.
»Nein, ich wollte einfach mal sehen, wie’s dir geht.«
»Danke.«
»Wie danke?«, echote Bannert.
»Danke, dass du nach mir siehst.« Hagedorns Gesichtsausdruck wurde ernst. »Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie es mir geht. Ich habe viel zu tun, und das lenkt mich ab.«
»Hm, verstehe«, brummte Bannert. »Hast du mal darüber nachgedacht, selbst eine Therapie zu machen?«
Hagedorn warf mit gespielter Entrüstung die Arme in die Höhe. »Warum sollte ich eine Therapie machen?«
»Falk.« Bannerts Blick hatte etwas Bohrendes. »Deine Gefangenschaft in Burgers Jagdhütte, Karinas und Laras Tod, dein Erlebnis letzte Woche. Wären das nicht Gründe genug, deine Traumata aufzuarbeiten?«
»Möglich«, ging es Hagedorn widerstrebend durch den Kopf. Härter als Laras Tod hatte ihn der Tod seiner Tochter getroffen.
Lara, Dr. Lara Geermann, war die verantwortliche Rechtsmedizinerin gewesen, mit der sie am letzten Fall zusammengearbeitet hatten. Obwohl sie sich nur kurze Zeit gekannt hatten, war daraus eine Liaison entstanden. Mit dem Ergebnis, dass er sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte. Bis sie auf tragische Weise ums Leben gekommen war.
Die Bilder hatten sich ebenso unauslöschlich in sein Gedächtnis gebrannt wie der Schusswechsel am Stuttgarter Flughafen, in dessen Kugelhagel seine Tochter Karina den Tod gefunden hatte.
Keine Nacht verging seitdem, in der er nicht schweißgebadet erwachte, um danach mit Sam, seinem Golden Retriever, rastlos durch die Nacht zu streifen.
»Keine Ahnung, Marius. Vielleicht hast du recht.«
Bannert richtete sich überrascht auf. »Ich habe recht? Seit wann gibst du mir bei einer Sache recht? Das ist ja eine ganz neue Seite an dir.«
Hagedorn wischte mit der Hand durch die Luft und unterstrich damit, dass er seine angeblich neue Seite nicht näher vertiefen wollte.
»Weshalb bist du wirklich hier, Marius?«
»Echt jetzt, Falk? Wieso sollte ich dich nicht einfach mal so besuchen? Ich muss doch wissen, wie es dir geht.«
»Lass das. Dafür hast du ein Handy mit meiner Nummer drauf. Weswegen bist du also hier?«
»Na schön ...« Bannert atmete einmal tief durch. »Wir kommen in der Soko Vito nicht weiter.«
Hagedorn schürzte die Lippen. »Vito — wie kreativ«, spöttelte er. »Wegen des Tatfahrzeugs?«
»Hm«, summte Bannert zustimmend. »War nicht meine Idee.«
Hagedorn verkniff sich die Frage, wem der kreative Erguss entsprungen sein mochte.
»Brandl wäre nicht so verkehrt, aber Nadine fehlt mir sehr. Und ich sage das nicht nur, weil sie die beste Vorgesetzte war, die ich je hatte.«
»Ich weiß, was du meinst«, bestätigte Hagedorn. »Also, um dein Anliegen vorwegzunehmen ...«
»Du weißt doch noch gar nicht, was ich will«, empörte sich Bannert.
»Meine Antwort ist Nein. Ich kann euch nicht helfen, und ich werde es auch nicht.«
»Wieso?« Bannerts Tonfall hatte etwas von einem quengelnden Kleinkind, dem man das Lieblingsspielzeug weggenommen hat.
»Weil ich befangen bin, du Hornochse«, tadelte ihn Hagedorn.
»Ach komm schon, Falk. Als wenn du das in anderen Fällen nicht auch schon gewesen wärst. Ich erinnere nur an den Fall Zahnert.«
Hagedorn wusste, worauf er anspielte. Der Serienkiller Gernot Zahnert, der vier junge Frauen ermordete, hatte sich Hagedorns Tochter bemächtigt. Und dennoch hatte er sich nicht von dem Fall abziehen lassen. Nur mit knapper Not waren Karina und er dem Tod entronnen.
»Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass ich das gar nicht mehr will?«
Bannert sah ihn überrascht an.
»Was glaubst du, wie viel die Psyche eines Menschen ertragen kann, bevor sie daran zugrunde geht? Alles hat Grenzen.«
»Also gibst du zu, dass du traumatisiert bist?«
»Das will ich damit nicht sagen«, widersprach Hagedorn. »Vielleicht will ich es einfach nicht herausfinden, okay?« Hagedorn legte die Hände in den Schoß und knetete sie. »Außerdem –«
»Schon gut«, unterbrach ihn Bannert. »Ich nerv nicht weiter.«
Einige Sekunden herrschte Schweigen.
»Was wollte nun der Oberbürgermeister von dir?«
»Ach.« Hagedorn schnaubte verächtlich. »Offenbar sieht man sich seitens der Stadtverwaltung bemüßigt, aktive Opferhilfe zu leisten. Er will, dass ich eine Opfergruppe betreue.«
»Das ist doch gut.«
»Einen Scheiß ist es«, widersprach Hagedorn. »Man will damit doch nur weiteren Schaden durch Zivilklagen oder teure Folgebehandlungen verhindern. Letztlich geht es immer nur um Geld und Publicity. Sind nicht OB-Wahlen im kommenden Jahr?«
»Richtig«, pflichtete Bannert bei.
»Da hast du es.«
Bannert schien einen Augenblick zu überlegen. »Vielleicht solltest du das Angebot trotzdem annehmen«, schlug er vor. »Abgesehen davon, dass es eine gute Werbung für deine Praxis wäre, zwingt es dich, deine eigene Trauerarbeit in die Hand zu nehmen.«
»Das ist das Letzte, was ich will«, knurrte Hagedorn.
»Was? Werbung für deine Praxis zu betreiben oder endlich zu trauern?«
»Quatsch! Ich meine, ich will in keiner Weise von dem Massaker profitieren, das sich da draußen vor einer Woche abgespielt hat.«
Bannert fürchtete schon, sein Gegenüber würde sich in Rage reden, aber umso ruhiger fuhr Hagedorn fort: »Bitte, Marius.« Hagedorns Stimme war zu einem Flüstern geworden. »Versprich mir, dass ihr den Drecksack festnagelt.«
»Versprochen!« Bannert zeichnete ein Kreuz über dem Herzen. »Auch wenn ich dich gerne dabeigehabt hätte.«
»Ich kann nicht«, seufzte Hagedorn.
»Okay, anderes Thema: Was machst du eigentlich an Heiligabend?«
Kapitel 3
Polizeipräsidium Konstanz
9. Dezember, morgens
Sam hob den Kopf und knurrte etwas vor der Terrasse an.
»Ruhig, mein Guter.« Hagedorn hob den Arm und tätschelte den Kopf des Hundes. »Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Du weißt doch, dass wir ein Paar davon als Untermieter in unserem Garten beherbergen. Ich will auch nicht, dass du sie jagst. Verstanden? Eine gute Nachbarschaft ist mir wichtig.«
Sam legte den Kopf schief und stieß ein zustimmendes Bellen aus.
»Sehr gut. Dann haben wir uns ja verstanden.«
Nachdem Hagedorn am Abend zuvor direkt von der Praxis ins Brauhaus Albrecht gefahren war, um eine kleine Mahlzeit einzunehmen, war er später völlig erschöpft auf der Couch eingeschlafen. Er hatte die Kraft nicht mehr aufbringen wollen, sich in den Treppenlift zu hieven, damit nach oben zu fahren und sich bettfein zu machen.
Er stemmte den massigen Körper in den elektrischen Rollstuhl und hielt damit auf die Küchenzeile zu. Aus einem Tupper-Gefäß schüttete er die letzten Bohnen in den Behälter seines Kaffeeautomaten. Eine Tasse, mehr würden die Bohnen nicht mehr hergeben, und die würde er schwarz trinken müssen, da Milch und Zucker ebenfalls schon seit Tagen aufgebraucht waren. Er würde heute dringend einkaufen müssen.
Suchend sah er sich in der Küche um, bis er das letzte Blatt eines ohnehin bald abgelaufenen Bildkalenders abriss, es umdrehte und darauf aufzulisten begann, was er über die Weihnachtsfeiertage benötigen würde.
»Ja, mein Großer, Hundefutter habe ich auch auf der Liste.«
Sam sah ihm mit heraushängender Zunge vom Wohnzimmer aus zu.
»Wenn du das machst, siehst du völlig verblödet aus. Das weißt du hoffentlich?« Augenblicklich, als hätte der Hund jedes Wort verstanden, verschwand die Zunge im Maul.
»Na bitte. So siehst du wie ein halbwegs intelligenter Hund aus. Na? Begleitest du mich und hilfst mir die Einkäufe nach Hause zu bringen?«.
Sam trottete schwanzwedelnd auf ihn zu.
»Aber zuerst brauche ich eine Dusche. So trau ich mich nicht aus dem Haus. Warte so lange im Garten, verstanden?«
Sam zwängte sich durch den Spalt, schneller als Hagedorn die Schiebetür öffnen konnte und sprang in den Garten hinaus, in dem Schneereste zu einem pampigen Teppich zusammengeschmolzen waren.
»Du weißt, was ich dir über die Eichhörnchen gesagt habe?«, rief er ihm mit erhobenem Zeigefinger hinterher.
Nachdem er sich rasiert, geduscht und angezogen hatte, fuhr er zu einem nahe gelegenen Supermarkt. Sam war es gewohnt, neben dem Rollstuhl herzutraben und vor dem Laden geduldig zu warten.
Die Ikea-Nylontasche war prall gefüllt und wog schwer. Wegen ihrer langen Schlaufen passte sie hervorragend an die Lehne des Rollstuhls, wenngleich es jedes Mal ein schierer Kraftakt war, die Tasche dort zu befestigen. Eine andere Lösung musste her. Vielleicht würde er heute noch einen Zweiradhändler wegen einer Anhängerkupplung aufsuchen. Gleich nachdem er im Präsidium vorbeigeschaut hatte, würde er sich darum kümmern.
Hagedorns Blick wanderte über die Whiteboards im Soko-Raum.
Bilder furchtbar entstellter Männer, Frauen und Kinder waren mit Klebestreifen daran befestigt. Mehrere Aufnahmen des weißen Mercedes Vito, mit dem der Täter über den Weihnachtsmarkt gerast war. Der Interims Kripo-Chef Kurt Brandl hatte Hagedorn hierhergeschickt.
»Da finden sie Bannert am ehesten«, hatte er gemeint. Womit er falschgelegen hatte. Der Soko-Raum war verlassen. Leere Kaffeetassen, Pizza- und Burgerschachteln, verströmten den Duft durchgearbeiteter Nächte. Inständig hoffte er, dass sie nicht ergebnislos geblieben sein mochten.
»Übel, oder?«
Hagedorn fuhr herum. »Marius?« Er nickte ihm zu. »Zeit für einen Kaffee?«
»Für dich immer, mein Freund.« Bannert verschwand und kehrte wenig später mit einer Thermoskanne und zwei frischen Tassen zurück. »Milch und Zucker sind leider ausverkauft.«
»Geht auch so«, zerstreute er Bannerts Einwand, während er zusah, wie er die beiden Tassen füllte.
Hagedorn nippte am Kaffee, verzog das Gesicht, enthielt sich aber eines Kommentars.
»Hast du es dir anders überlegt?«, fragte Bannert schließlich. »Oder was verschafft mir die Ehre deines Besuches?«
»Red nicht so geschwollen daher.« Hagedorn deutete auf die Tafeln. »Nicht wirklich viel für eine Woche Arbeit, oder?«
»Wem sagst du das?« Bannert fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. »Wir haben Spuren«, fuhr er fort. »Jede Menge Spuren. Tonnen von Spuren. Haare, Fasern, Fingerabdrücke, DNA. Die ganze Bandbreite. Aber keine Vergleichsproben. Keine einzige Datei spuckt einen Treffer aus. Der Drecksack wurde noch nie erkennungsdienstlich behandelt.«
»Hm«, summte Hagedorn nachdenklich. »Ein unbeschriebenes Blatt also. Islamismus?«
»Können wir ausschließen. Zumindest hat bislang keine islamistische Terrorgruppe den Anschlag für sich proklamiert.«
»Was habt ihr sonst noch?«
Bannert stöhnte. »Wo fange ich an? Der Van wurde in der Nacht vor der Tat in der Schweiz von einem Privatparkplatz entwendet. Die meisten Spuren haben wir im Fahrzeug gesichert. An der Windschutzscheibe war mit Saugfuß eine Handy- oder Navihalterung befestigt, die nicht den Eigentümern gehörte und mutmaßlich vom Täter zurückgelassen wurde.«
»Hm. Vielleicht eine Dash-Cam?«, dachte Hagedorn laut.
»Nicht schlecht. Das würde bedeuten, dass der Täter die Amokfahrt gefilmt hat.«
»Genau«, stimmte er Bannert zu. »Du solltest jemanden darauf ansetzen, ob das Video irgendwo gepostet wurde. In den gängigen sozialen Netzwerken oder im Darknet.«
Bannert zog einen Kugelschreiber aus der Brusttasche seines Hemds und kritzelte Notizen auf ein leeres Blatt Papier.
»Die Kennzeichen, die am Van angebracht waren, wurden in derselben Nacht in einem Konstanzer Parkhaus entwendet. Offenbar war der Diebstahl bis zur Tatzeit unentdeckt geblieben.«
»Zeugenaussagen?«
»Ja. Aber allesamt unbrauchbar. Männlich, zwischen zwanzig und vierzig, etwa einen Meter achtzig groß. Plus minus. Soll eine FFP2-Maske und einen ins Gesicht gezogenen schwarzen Hoodie getragen haben. Nachdem er an der Ausfahrt der Marktstätte den Absperrpfosten gerammt hat, muss er den Wagen abgewürgt haben und flüchtete danach zu Fuß. Im Bereich der Hafenstraße ist er in der Menge untergetaucht.«
Hagedorn sah Leon vor sich. Und den Metallpfosten, der den Jungen gepfählt hatte. Für ihn war jede Hilfe zu spät gekommen.
»Alles in Ordnung, Falk?« Bannert schaute ihn mitfühlend an.
»Ja, alles okay.«
»Ist es der Junge?«
Hagedorn nickte stumm.
»Hast du dich schon entschieden?«, fragte Bannert und unterbrach die Stille.
»Bezüglich?«
Bannert hob bedeutungsvoll die Hände. »Die Gruppentherapie? Meine Einladung zum Weihnachtsessen? Deine eigene Therapie? Such dir was aus.«
»Oh. Ja. Wegen der Einladung zu Heiligabend? Lass mir noch ein paar Tage Zeit, okay?«
Bannert wartete darauf, dass er fortfuhr.
»Ich werde das Angebot des OBs annehmen«, sagte Hagedorn. »Obwohl ich kein gutes Gefühl dabei habe.«
»Wieso machst du es dann?«
Hagedorn zögerte bei der Antwort. »Für mich.«
Kapitel 4
Praxis Hagedorn & Szegeny
9. Dezember, früher Nachmittag
Nachdem Hagedorn eine Kupplung am Rollstuhl hatte anbringen lassen und einen Anhänger für die Einkäufe erstanden hatte, schaute er in der Praxis vorbei.
Darius’ Büro war verwaist. Worüber er nicht unglücklich war. Der gebürtige Ungar war vor neun Monaten Teilhaber seiner Praxis geworden und erwies sich als ausgezeichnete Verstärkung. Wenn er bedachte, dass er die Entscheidung besoffen getroffen hatte, war das umso erfreulicher. Darius war fleißig und nahm ihm viel ab. Gerade die für Hagedorn unangenehmen Dinge wie die Erstellung schriftlicher Gutachten. Nichts hasste er mehr.
Mit einer frischen Tasse Kaffee, die er zwischen den Schenkeln eingeklemmt hatte, umrundete er den Schreibtisch, stellte sie darauf ab und wählte die Nummer, die er am Abend zuvor eilig auf einen Zettel gekritzelt hatte.
»Guten Tag, Herr Zimmermann! Hagedorn hier.«
»Ah. Herr Hagedorn. Schön, dass Sie zurückrufen. Haben Sie es sich anderes überlegt?« Der Oberbürgermeister kam gleich zur Sache.
»Unter gewissen Voraussetzungen wäre ich bereit, die Opferbetreuung zu übernehmen.«
»Und die wären?«, fragte Zimmermann lauernd.
»Zuallererst benötige ich einen Raum, in dem wir ungestört arbeiten können. Mit ungestört meine ich, dass außer mir und Ihnen niemand weiß, wo die Gruppensitzungen stattfinden. Na ja und die Betroffenen natürlich.«
»Ich verstehe nicht ganz ...«
Hagedorn rollte mit den Augen. »Was ist denn daran nicht zu verstehen? Ich möchte ausschließen, dass mir oder den Gruppenteilnehmern die Medien vor oder nach den Sitzungen auflauern. Das meine ich damit.«
»Gut, das lässt sich einrichten. Was noch?«
»Am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir uns einige Tage irgendwo zusammenfinden könnten, aber das wird sich vermutlich nicht machen lassen, oder?«
»Puh, schwer«, stöhnte Zimmermann.
»Okay. Sie sorgen dafür, dass für alle Getränke und eine Kaffeemaschine vorhanden sind.«
»Kein Problem.«
»Und ich benötige die Daten derer, die bereit sind, an der Gruppensitzung teilzunehmen.«
»Auch das!«, bestätigte der Oberbürgermeister.
»Das wäre alles. Ach, noch eine Sache. Ich hoffe nicht, dass Sie von mir erwarten, Ihnen zu berichten, was in der Gruppe besprochen wird.«
Zimmermann schwieg einige Sekunden. Hagedorn vermutete, dass er genau das von ihm erwartet hatte.
»Nein, ist mir schon klar, dass Sie der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen«, beeilte sich Zimmermann zu betonen.
»So ist es«, stimmte er Zimmermann zu. »Ich sehe meine Aufgabe darin, der Gruppe die Möglichkeit zu bieten, sich über ihre Traumata, Ängste und Verluste auszutauschen. Zu beurteilen, ob und wer weiterer Therapie bedarf. Ich werde Empfehlungen aussprechen, aber ich kann nicht alle therapieren. Ich hoffe, Sie verstehen das?«
»Selbstverständlich, Herr Hagedorn. Ich freue mich, dass Sie die Aufgabe übernehmen, und bedanke mich schon jetzt dafür.«
»Warten Sie meine Honorarrechnung ab«, erwiderte Hagedorn.
Als er sich schon verabschieden und den Hörer zurück auf den Apparat legen wollte, hob er den Hörer wieder an sein Ohr.
»Ach, Herr Zimmermann. Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen?«
»Das Zentrum für Psychiatrie hat Sie mir empfohlen. Noch was?«
»Nein.«
Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, nahm Hagedorn einen Schluck des mittlerweile lauen Kaffees und dachte über die Unterhaltung nach.
Er hätte nicht damit gerechnet, dass Zimmermann sich so widerstandslos auf seine Forderungen einlassen würde. Aber vielleicht tat er ihm unrecht, und es lag ihm wirklich in erster Linie daran, den Opfern zu helfen.
Kaum eine psychologische oder psychiatrische Praxis im Landkreis hatte freie Kapazitäten, und diejenigen Therapeuten, die auf die Behandlung schwerer psychischer Traumata spezialisiert waren, noch viel weniger. Nicht selten mussten Patienten sechs Monate auf die Vergabe eines Termins warten. Falls sie nicht auf einer Warteliste landeten und irgendwann in Vergessenheit gerieten. Im Falle der Betroffenen der erst eine Woche zurückliegenden Amokfahrt auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt hätte dies fatale Folgen. Posttraumatische Belastungsstörungen würden auftreten, sich manifestieren und wären im Nachhinein ungleich schwieriger zu therapieren, als die Traumatisierten schnell zu entlasten.
Sollte sich Zimmermann jedoch dazu hinreißen lassen, ihn und die Gruppenarbeit für seine Wiederwahl zu instrumentalisieren würde er es bereuen. Und wer ihn kannte, wusste, dass es klüger war, sich ihn nicht zum Feind zu machen.
Das Ping! des Mailprogramms kündigte den Eingang einer neuen Nachricht an.
»Oh«, entfuhr es ihm. »Das ging ja schnell.«
Zimmermann nahm in seiner kurzen Nachricht noch einmal Bezug auf ihr geführtes Telefonat, bedankte sich überschwänglich und wies unnötigerweise darauf hin, dass die beigefügten Opferdaten vertraulich zu behandeln seien.
»Depp!«, schnaubte Hagedorn. »Als ob ich das nicht wüsste.«
Er öffnete die angehängten Dateien und überflog die Namen und Daten derer, die sich der Gruppensitzung anschließen wollten.
»Nur acht?«, murmelte er. In Anbetracht der Toten und Schwerverletzten hatte er mit mindestens fünfzehn gerechnet.
Nachdem er die Liste ausgedruckt und in eine Mappe gelegt hatte, widmete er sich dem lokalen Tagesgeschehen.
Er fuhr mit dem Mauszeiger in seinem Internet-Browser auf den Favoritenlink der Online-Ausgabe des Südkuriers, den er seit letzter Woche gespeichert hatte. Eine Schlagzeile erregte seine Aufmerksamkeit. Er begann zu lesen.
Weiteres Todesopfer zu beklagen!
Wie der Chefarzt der hiesigen Kinderklinik vor
einer Stunde mitteilte, ist das jüngste Opfer
der schrecklichen Amokfahrt vom ersten Dezember
seinen schweren Verletzungen erlegen. Man habe
Tag und Nacht um das Leben des vier Monate alten
Säuglings gekämpft. »Wir sind alle erschüttert
und fassungslos. Unser Mitgefühl gilt allen
Betroffenen, besonders den Eltern«, so der
leitende Mediziner Doktor Luschenko.
Hagedorn würgte den Kloß im Hals hinunter und wischte sich über die feuchten Augen.
Die Zahl der Toten hatte sich damit auf siebzehn erhöht. Ein Wunder, dass es nicht noch mehr Tote gab, dachte er bitter. Wenngleich einige der Verletzten, die man mittlerweile, sofern sie transportfähig waren, auf umliegende Traumazentren verteilt hatte, immer noch um ihr Leben rangen.
Für jeden, der das schreckliche Attentat miterlebt, überlebt hatte, würde Weihnachten eine ganz andere Bedeutung gewinnen. Einige mochten vielleicht an eine weihnachtliche Wunderrettung glauben.
Für diejenigen aber, denen Körperteile, ein geliebter Mensch, das eigene Kind entrissen wurde, würde Weihnachten immer mit Schmerz und Trauer verbunden bleiben.
Weihnachten war scheiße. Religion ein geistiger Virus. Musste Gott nicht ein grenzenloser Zyniker sein, dass er seinen einzigen Sohn für die Menschheit geopfert hatte? Davon abgesehen, dass sie dieses Opfer gar nicht verdient hatte.
Sollte bis vor einer Woche noch ein Funken Religiosität in seiner verdorrten und ohnehin verlorenen Seele geflackert haben, dann war er in jenem Augenblick auf der Marktstätte unwiederbringlich erloschen.
Weihnachten, das Fest der Liebe? Dass er nicht lachte. Zu keiner anderen Zeit im Jahr, gingen sich die Leute derart an die Gurgel, als in der Weihnachtszeit. Es wurde gesoffen und gestritten, was das Zeug hält. Die Kneipen, die an Heiligabend geöffnet hatten, würden mit einsamen, desillusionierten notorischen Säufern überfüllt sein.
Im trauten Kreise der Familie mästete man sich mit fetttriefenden Weihnachtsgänsen, stopfte sich mit Weihnachtsgebäck voll, leerte Flasche um Flasche schweren Weins oder füllte sich mit Punsch ab. Völlig überteuerte Geschenke, die mehr oder weniger nützlich waren, wechselten vom Schenker zum Beschenkten, nur um sie in der ersten Januarwoche umzutauschen oder bei Ebay zu verhökern.
Verborgene Zwistigkeiten, unausgesprochener Groll oder einfach der Frust darüber, die Tage mit der verhassten Schwiegermutter zubringen zu müssen, brachen sich an den Weihnachtsfeiertagen Bahn. Warum ihm gerade jetzt solche Dinge durch den Kopf schossen, wusste er nicht.
Weihnachten war die gefährlichste Zeit des Jahres. Für brave Hausfrauen, devote Ehemänner und auch für Kinder. Er hasste Weihnachten.
Kapitel 5
Konstanz, Schloss Seeheim, erste Gruppensitzung
18. Dezember, 14 Uhr
Mit vorherrschend mulmigem Gefühl rollte Hagedorn in den kleinen Theatersaal des Schlosses Seeheim. Die Reifen des Rollstuhls verursachten leise Quietschgeräusche auf dem Holzparkett, wenn er die Richtung änderte.
Die Decke des rot gestrichenen Raums war hoch und an seinen Rändern mit schweren Stuckreliefs verziert. In der Deckenmitte baumelte ein gewaltiger Lüster. Wie versprochen, hatte Zimmermann dafür Sorge getragen, dass ein Stuhlkreis im Zentrum des Raums aufgestellt war.
Auf einem Beistelltisch standen ein brandneuer Saeco-Kaffeevollautomat mit einem Milchaufschäumer und mehrere Flaschen Wasser, Apfel- und Orangensaft. Sogar einige Schachteln mit Spritzgebäck lagen darauf.
Hagedorn war beeindruckt. Ebenso sehr wie von der Aussicht auf den See. Schon einige Male war er auf seinen Ausfahrten an dem Gebäude vorbeigekommen und hatte sich das Innere des schlossartigen Bauwerks vorzustellen versucht.
Für die Gruppentherapie hatten mehrere Objekte zur Verfügung gestanden, waren aber allesamt weiter außerhalb gelegen. Nur dem Umstand, dass die Hotelzimmer und das Restaurant des Schlosses zurzeit renoviert wurden, war es zu verdanken, dass sie hier zusammenkommen konnten.
Abseits gelegen und doch für alle gut zu erreichen. Er selbst legte die Strecke mit dem Rolli in weniger als fünfzehn Minuten zurück.
Für die kommenden Tage oder Wochen, ja nachdem wie die Gruppe mitarbeiten würde, wäre hier nun sein Arbeitsplatz.
Für den ersten Tag wollte er der Gruppe nicht zu viel zumuten. Er würde sich darauf beschränken, die Teilnehmer sich selbst vorstellen zu lassen.
Nachdem er den Kaffeeautomaten eingeschaltet und sich einen Cappuccino zubereitet hatte, zog er die Teilnehmerliste aus der Innentasche seines Sakkos.
1. AKAY, Cigdem, 28, Polizeibeamtin
2. KURATH, Fiona, 21, Sportstudentin
3. ROMANO, Franco, 57, Bauschlosser
4. MÜHLBRANDT, Esther, 81, pensionierte Lehrerin
5. STÜRMER, Udo, 40, Finanzbeamter
6. GLASER, Tim, 23, Verwaltungsangestellter
7. ZERR, Ivanka, 42, Hausfrau
8. ZERR, Viktor, 48, Straßenbauer
Laut dem Oberbürgermeister waren es deshalb nicht mehr Teilnehmer, weil einige aus anderen Landkreisen oder Bundesländern stammten und dort betreut wurden. Zwei Betroffene sahen für sich keinen Grund, therapiert zu werden, wie sie sich der Stadtverwaltung gegenüber geäußert hatten. Hagedorn war es recht. Mit einer kleinen Gruppe war effektiver zu arbeiten.
»Hallo?«, kam es vom Eingang her. »Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin ...«
Die junge Frau hatte langes schwarzes Haar und sah zu ihm herüber. Sie stützte sich auf zwei Krücken.
»Kommen Sie herein«, forderte er sie freundlich auf. »Sie müssen Frau Akay sein?«
»Hm, und Sie sind Falk Hagedorn?«
Hagedorn konnte seine Überraschung nicht verhehlen. »Kennen wir uns?«
»Nein«, sagte sie kopfschüttelnd. »Nicht persönlich, aber auf dem Polizeipräsidium sind Sie eine Legende.«
»Ich mag es nicht, als Legende betitelt zu werden.« Hagedorn verzog angesäuert das Gesicht. »Schön, dass Sie schon wieder auf den Beinen sind«, fuhr er anerkennend fort. »Entschuldigen Sie bitte«, fügte er rasch hinzu, als er einen Blick auf das hochgesteckte rechte Hosenbein warf.
»Nicht schlimm. Aber ja. Ich bin wieder auf dem Bein.«
»Sie gehen erstaunlich gut damit um.«