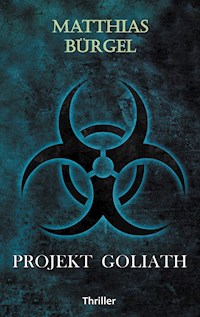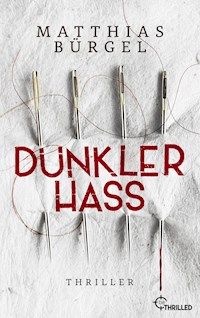7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fallanalytiker Falk Hagedorn
- Sprache: Deutsch
In Konstanz wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, ihr Körper ist kunstvoll als Statue inszeniert - und tiefgefroren. Und es bleibt nicht bei einer Leiche ... Offenbar tötet ein Serienmörder, um seine Opfer anschließend spektakulär in Szene zu setzen! Die ungewöhnliche Mordserie weckt das Interesse von Fallanalytiker Falk Hagedorn. Nach anfänglichem Zögern willigt er ein, die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Ein erster Verdächtiger ist schnell gefunden und in Untersuchungshaft. Doch Hagedorn ist überzeugt: Der wahre Täter läuft noch frei herum - und wird weiter morden ...
»Atmosphärisch, spannend und düster. Auch der dritte Roman rund um Matthias Bürgels unkonventionellen Fallanalytiker Falk Hagedorn hat mich begeistert und gefesselt und mir einige schlaflose Nächte beschert.« (Bestseller-Autor Uwe Laub)
eBooks von beThrilled - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Zitat
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Epilog
Nachwort / Danksagung
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Über dieses Buch
In Konstanz wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, ihr Körper ist kunstvoll als Statue inszeniert – und tiefgefroren. Doch es bleibt nicht bei einer Leiche ... Offenbar tötet ein Serienmörder, um seine Opfer anschließend spektakulär in Szene zu setzen! Die ungewöhnliche Mordserie weckt das Interesse des Fallanalytikers Hagedorn, und nach anfänglichem Zögern willigt er ein, die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Ein erster Verdächtiger ist schnell gefunden und in Untersuchungshaft. Doch Hagedorn ist überzeugt, dass der wahre Täter noch frei herumläuft – und dass er weiter morden wird ...
Matthias Bürgel
Kalte Körper
Thriller
»Wenn es eine Freude ist, das Gute zu genießen, ist es eine größere, das Bessere zu empfinden, und in der Kunst ist das Beste gut genug.«
Johann Wolfgang von Goethe
Prolog
Irgendwo in Konstanz
Einige Wochen früher
Kühl, grandios unspektakulär und funktional war der Raum, in dem er arbeitete. Kurz überlegte er, ob das nicht auf sein gesamtes Leben zutraf.
»Mag sein«, dachte er mit einem tiefen Seufzer.
Die Möglichkeit, dass sich eine Frau, abgesehen von spontanen sexuellen Avancen, ernsthaft für ihn interessieren könnte, schien ihm so abwegig wie der Beruf, den er ergriffen hatte. Und doch! Seit vier Monaten traf er sich mit einer hübschen Brünetten, die er vom letzten Weihnachtsmarkt kannte. Es störte sie offensichtlich nicht, womit er seine Brötchen verdiente.
Mit einer lustigen grünen Elfenmütze auf dem Kopf und angeklebten Spitzohren hatte sie in der Verkaufsbude der katholischen Frauengemeinschaft gestanden und verführerisch duftende Waffeln gebacken. Nebst dem Verzehr mehrerer Waffeln und zwei gut gefüllten Bechern Glühwein hatte sie ihm das Versprechen eines gemeinsamen Kinobesuchs abgerungen. Alles ließ sich gut an. Die Treffen wurden regelmäßiger, die Abstände kürzer, und er hatte zum allerersten Mal das Gefühl, so etwas wie eine Beziehung zu führen.
»Es ist dreiundzwanzig Uhr. Hier sind die Nachrichten«, schnarrte es aus dem kleinen Weltempfänger auf dem Fenstersims. Das einzig überflüssige Accessoire im Raum.
Der deckenhoch geflieste Raum maß vier mal vier Meter, und er nannte ihn Vorbereitungsraum. Die korrekte Bezeichnung lautete Versorgungsraum oder Präparationsraum. Eitlere aus seiner Gilde sprachen gar von einem Atelier.
Nein, nicht er. Weder versorgte er hier kleinere Blessuren, noch präparierte er etwas. Das erinnerte ihn zu sehr an das Ausstopfen erlegter Tiertrophäen. Er maß seinem Tun eine wesentlich größere Bedeutung bei. Anfangs hatte er ernsthaft an seinem Geisteszustand gezweifelt, als er vor einem Jahr, etwa zur selben Uhrzeit, seine erste Leiche vorzubereiten begann. Mittlerweile war das zu seiner gewohnten Zeit geworden. Kein Telefon, keine lästigen Anfragen oder Vertreter, die ihn unterbrechen konnten, während er konzentriert zu arbeiten versuchte. So wie heute.
In diesem Fall war es nicht einfach gewesen, die beiden Halsschlagadern freizulegen und die Schlauchdrainage einzuführen. Er korrigierte den Lichtkegel des an der Decke angebrachten Schwenkarmstrahlers und überprüfte erneut die Dichtigkeit der Drainage, ehe er sich der Pumpe zuwandte und sie einschaltete. Er wischte sich die Hände an der Schürze ab und lauschte gespannt. Leise zischend begann das Aggregat die Lösung in den leblosen Körper zu pumpen. Sein ureigenes Rezept, das mehrheitlich aus Wasser, Formalin und zwei geheimen Zutaten bestand, die mögliche Arterienverschlüsse lösten und der Haut ihre rosige Farbe zurückgeben sollten. In wenigen Augenblicken würde sich zeigen, ob er sauber gearbeitet hatte.
Weitere Sekunden vergingen. Der Kreislauf schien geschlossen. Erleichtert atmete er auf, als er zusah, wie zähflüssiges Leichenblut aus dem Ablaufschlauch zu fließen begann und in kurvigen Schlieren über den mattierten Edelstahl, der Schwerkraft folgend, blubbernd im Abfluss verschwand.
Eine Stunde würde es dauern, bis der Flüssigkeitsaustausch abgeschlossen sein würde.
Seine latexbehandschuhten Finger glitten über die Extremitäten, massierten die Lösung in das Gewebe ein. Zufrieden lächelte er, als die Haut sich rosig zu färben begann.
Das Geräusch der Pumpe änderte sich. Rasch warf er einen prüfenden Blick auf den Behälter, der sich bis auf einen kleinen Rest geleert hatte. Der Flüssigkeitstransfer war abgeschlossen.
Er hatte sich angewöhnt, alle Instrumente und Materialien sorgsam vorzubereiten, bevor er mit der Arbeit begann. Skalpelle, Scheren, Klemmen, unterschiedliche Nadeln und Faden lagen nach ihrer Größe sortiert auf dem Instrumententisch.
Tastend glitten seine Finger das Brustbein bis zu dessen Ende entlang. Zwei Fingerbreit unterhalb drang er mit dem Skalpell ein. Der Schnitt musste nicht groß sein, nur so breit, dass er mit dem Trokar würde eindringen können. Mit dem kleinen Finger bohrte er in die Öffnung und vergewisserte sich, dass sie groß und tief genug war.
Den Hydroaspirator hatte er bereits am Wasserhahn angeschlossen.
Kraftvoll stieß er den metallenen Dorn, dessen Spitze ebenso scharf wie seine Skalpelle war, in den Brustraum, stocherte darin herum, spürte den Widerstand und stach die Lanzette ins Herz. Schlürfend begann das Gerät das verbliebene Herzblut abzusaugen. Der Lunge und dem Magen-Darm-Trakt würde er sich danach widmen.
Erst wenn alles Verderbliche entfernt war, würde er mit seiner eigentlichen künstlerischen Arbeit beginnen können. Gebrochene Knochen verleimen, Schnitte und Risswunden verschließen. Einige würden sich mit Cyanacrylat-Klebstoff abdichten lassen, andere würde er vernähen müssen.
Mehr Kopfzerbrechen bereitete ihm der deformierte Schädel. Aber auch den würde er letztendlich perfekt rekonstruieren können.
Kapitel 1
Konstanz, Rheinpromenade
Montag, 26. August
Viertel nach fünf. In einer halben Stunde würde die Sonne aufgehen und die nächtliche Kühle erneut einer drückenden Hitze weichen. Dieser August hatte es wirklich in sich. Bis auf ein, zwei bewölkte Tage, die nur wenig Linderung gebracht hatten, brannte die Sonne unbarmherzig.
Die Schwüle ließ ihn keinen Schlaf finden. Aber nicht nur die Hitze war daran schuld.
Mit arretierten Bremsen saß Hagedorn im Rollstuhl und blickte auf den gemächlich dahinfließenden Rhein hinunter. Die über einhundert sechzig Meter lange und vier Meter breite Fahrradbrücke überspannte den Fluss in einer sanften Wölbung. Sie verband den Herosé-Park im Stadtteil Petershausen mit der linksrheinisch gelegenen Altstadt und dem Konstanzer Paradies.
Die Unterarme auf dem Geländer abgestützt, das Kinn in der Armbeuge ruhend, betrachtete er die Lichtreflexe, die sich auf der kräuselnden Wasseroberfläche funkelnd brachen. Zwischen seinen Fingern glimmte ein bis zum Filter abgebrannter Zigarettenstummel.
Sein Begleiter, ein Golden Retriever, legte den Kopf schräg und sah ihn hechelnd an, als er über das Geländer spuckte und die Kippe hinterherschnippte. Wieder hatte er zu viel getrunken. Was versprach er sich davon? Die betäubende Wirkung funktionierte bei ihm nicht wie erhofft. Weder nahm ihm der Alkohol die schmerzenden Erinnerungen, noch ließ er ihn besser schlafen. Monate waren vergangen, seit er das letzte Mal mehr als vier Stunden am Stück durchgeschlafen hatte. Wenn ihn die Unruhe und Rastlosigkeit überwältigten, fuhr er mit seinem Hund durch die Nacht. Nicht selten legten sie dabei mehrere Kilometer zurück. Dem Hund war die Ziellosigkeit seines Herrchens dabei herzlich egal, er genoss die nächtlichen Ausflüge sehr.
Die Hundemarke klimperte, als der Retriever sich schüttelte und sich mit einem Grunzen neben dem Rollstuhl niederließ.
Er fragte sich, wie lange diese Niedergeschlagenheit noch anhalten würde. Aus seinem Studium und seiner Praxiserfahrung wusste er um die verschiedenen Phasen des Trauerns. Die Phasen des Leugnens, des Zorns, des Verhandelns, der Depression bis zur Akzeptanz. Theoretisch war ihm das alles bewusst, und dennoch fühlte er sich gefangen in einer Depression. Nein! Er sah sich außerstande, seinen Verlust nur ansatzweise zu akzeptieren. Das kam ihm einem Verrat gleich. Zumindest empfand er das so.
Er blies die Luft aus und wischte sich die Tränen aus den Augen. Wie einfach es wäre, dachte er. Sich über die Brüstung zu beugen und einfach fallen zu lassen. Wie lange könnte ich mich an der Oberfläche halten ohne meine Beine? Wie lange, bis mir die Kraft ausgeht, die vollgesogene Kleidung und die Unterströmung mich hinabzieht? Die Strömung würde mich einfach mitreißen, vielleicht sogar hinunter bis zum Rheinfall in der Schweiz. Der Gedanke hatte etwas Tröstliches und doch: Davon war er noch weit entfernt. Ertrinken war ein schmerzhafter, qualvoller Tod. Dazu fehlte ihm schlicht der Mut.
Er beugte sich hinab und strich mit den Fingern über die Kruppe des Hundes.
»Wollen wir nach Hause gehen, hm?«
Widerwillig erhob sich das Tier.
Da ertönte ein Schrei aus dem nahen Park.
»Hast du das auch gehört, Sam?« Dem Hund sträubte sich das Nackenfell. Leise grollend bleckte er die Fänge.
»Lasst mich in Ruhe!«, schrie eine weibliche Stimme.
Bevor er die Bremsen des Rollstuhls löste, legte er dem Hund die Leine an, die mit dem Gestänge seines Gefährts verbunden war, stieß die Greifreifen an und hielt auf den Park zu, aus dem die Schreie kamen. Er nutzte das Gefälle der Brücke und beschleunigte weiter.
Zwei Männer machten sich an einer jungen Frau zu schaffen, die wild um sich trat und sich verzweifelt zu wehren versuchte. Als er sich ihnen näherte, erkannte er, dass sie höchstens fünfzehn oder sechzehn sein konnten. Sie trugen Baggies, Windelhosen, wie er sie nannte, weite T-Shirts und identische Basecaps, auf denen das Graffiti-Tag irgendeiner lokalen Gang eingestickt war. Der Anblick der beiden erinnerte ihn unwillkürlich an die Propheten Jay und Silent Bob aus dem Film Dogma.
»Hey, ihr Arschlöcher! Lasst sie in Ruhe!« Instinktiv glitt seine Hand zu einem Teleskopschlagstock, den er vor Wochen mittels einer Fahrradpumpenhalterung und zwei Kabelbindern an einer seiner Beinstützen angebracht hatte.
Überrascht fuhr der Kopf des Kleineren der beiden herum.
»Alter, was willst du?«, spuckte der Teenager ihm verächtlich entgegen.
»Ich will, dass ihr die Frau in Ruhe lasst«, versuchte er eine weitere Eskalation zu verhindern. Der Hund ließ ein tiefes, kehliges Knurren erklingen, was Jay, wie er den Kerl getauft hatte, überhaupt nicht zu beeindrucken schien, da er sich ihm bis auf wenige Schritte näherte. Jay ließ die Hand aus seiner Hosentasche fahren und öffnete klackend ein bedrohlich aussehendes Klappmesser.
»Mach dich vom Acker, du dreckiger Penner!«, zischte Jay gepresst. »Sonst mach ich dich fertig!«
Er bezweifelte, dass sein Gegenüber die Drohung wirklich ernst meinte, dennoch konnte er darauf verzichten, sich auf einen Clinch mit ein paar Halbstarken einzulassen.
»Komm schon, Junge! Steck das Messer weg!«
»Sag mal, Alter! Schnallst du es nicht? Verpiss dich!«
Die Knöchel knackten, als er die Hand fester um den gummierten Griff des Schlagstocks schloss. Drohend trat der Junge einen weiteren Schritt auf ihn zu.
Aus dem Augenwinkel sah er, dass Silent Bob, der andere, kräftigere Kerl, die junge Frau an der Gurgel gepackt hielt und sie gegen einen Baum drückte.
Als Jay einen weiteren Schritt auf ihn zukam, riss er den Schlagstock aus der Halterung und ließ ihn mit einer geschmeidigen Bewegung des Handgelenks ausfahren.
»Ich habe keine Zeit und keinen Nerv, euch Manieren und Anstand beizubringen.« Soweit es im Rollstuhl möglich war, beugte er sich vor und schlug Jay mit einer blitzartigen Bewegung gegen die Messerhand. Es knackte. Jaulend ließ der Junge das Messer fallen und starrte ungläubig auf seinen verkrümmt abstehenden Daumen.
Jay hüpfte wie ein Känguru auf und ab, die Hand zwischen die Beine geklemmt und heulte. Hätte sich Silent Bob in diesem Moment nicht von der Frau gelöst und eine bedrohliche Haltung eingenommen, hätte er laut aufgelacht.
»Du verdammter Krüppel!«, schnaubte Silent Bob und kam mit ausladenden Schritten auf ihn zugestürzt.
Sam bellte und zerrte wie ein Berserker an der kurzen Leine, als Bob zu einem gewaltigen Schwinger ausholte. Geschickt parierte er mit der Linken und ließ den Schlagstock krachend auf Bobs Unterarm niedersausen. Etwas brach mit einem widerlichen Knacken. Bob stieß die Laute eines brunftigen Hirsches aus, als er seinen Arm gegen die Brust presste. Für einen Moment schielte der Junge zu dem Messer und rechnete seine Chancen aus, wie schnell er sich danach bücken und ihn damit angreifen konnte.
»Haut endlich ab!«, brüllte er und riss Bob damit aus seinen Überlegungen.
Während Bob sich geschlagen gab und mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rückzug antrat, stieß Jay wüste Drohungen aus.
»Du dreckiger Krüppel! Irgendwann sehen wir dich in der Stadt, und dann bist du fällig!«
Jay wich eingeschüchtert zurück, als er nur leicht seine Reifen anstieß und ein Stück auf ihn zurollte, den Schlagstock über dem Kopf schwingend.
»Verschwinde endlich!«, knurrte er drohend.
Jay spie aus, wandte sich um und folgte stolpernd seinem Kumpel.
Die junge Frau sammelte schluchzend ihre Habseligkeiten ein, als er sich ihr langsam näherte, die Waffe schlagbereit über den Schenkeln liegend. Wer wusste schon, ob die Idioten mit Verstärkung zurückkamen?
»Ist alles okay?«, erkundigte er sich. Er bückte sich nach einem Lippenstift, der mit dem Rest des Inhalts ihrer Handtasche verstreut auf der Wiese lag.
»Kennst du die Typen?«, erkundigte er sich.
Sie richtete sich auf und sah ihn aus verheulten Augen an. »Nein! Noch nie gesehen. Danke, dass Sie mir geholfen haben.«
Erst als er sie in voller Größe vor sich stehen sah, erkannte er eine etwa zwanzigjährige Südländerin. Ein Träger ihres knielangen Sommerkleids war über die Schulter gerutscht. Immer noch zitternd atmete sie mit geschlossenen Augen, gegen den Baum gelehnt, tief ein und aus.
»Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Sie nicht gekommen wären«, sagte sie leise mit leichtem Akzent.
»Wie ist dein Name?«, erkundigte er sich. Ihr wachsamer Blick verriet, dass sie abzuschätzen versuchte, ob von ihm eine neue, andere Gefahr ausgehen würde.
»Valbona.« Allmählich ließ das Zittern nach. »Ich bin auf dem Weg zur Arbeit.«
»Wo arbeitest du denn?«, wollte er wissen.
Valbona deutete mit dem Kopf die Uferpromenade hinab. »Ich bin Kassiererin in der Tankstelle an der Reichenaustraße. Frühschicht«, fügte sie hinzu und schielte auf den Schlagstock, den er immer noch auf den Schenkeln liegen hatte.
Er betätigte einen Knopf im Griffstück, fuhr den Teleskopschlagstock ein und steckte ihn in die Halterung an seiner Beinstütze zurück.
»Ich begleite dich ein Stück«, sagte er bestimmt. »Es könnte sein, dass die Typen noch mal auftauchen.«
»Das ist nett von Ihnen.« Sorgenvoll ließ sie den Blick durch den Park schweifen. »Und es macht Ihnen wirklich nichts aus?«
»Ich habe denselben Weg«, schwindelte er. »Ich brauche noch Zigaretten.«
Geduldig wartete er, bis sie ihre Habseligkeiten in der Handtasche verstaut und sich Haare und Kleid gerichtet hatte.
»Sie glauben nicht, wie froh ich bin, dass Sie zufällig im Park waren«, begann sie, nachdem sie eine Weile schweigend gegangen waren.
»Was wollten die Kerle? Geld? Dein Handy?«
»Nein! Ich vermute, die wollten mir einfach nur an die Wäsche«, kommentierte sie nüchtern.
»Du solltest sie anzeigen«, riet er.
»Ach, was bringt das schon. Das waren ja fast noch Kinder. Wahrscheinlich sind sie nicht einmal strafmündig. Außerdem ist ja nichts passiert. Dank Ihnen.«
Er konnte ihr nicht widersprechen. Schließlich hatte er seine Erfahrungen mit dieser Klientel. Vermutlich waren Jay und Silent Bob Stammgäste bei der hiesigen Polizei und Staatsanwaltschaft.
»Nichts zu danken«, entgegnete er stattdessen. »Geht’s dir wieder besser?«
»Ja! Sehr viel besser!«
»Das freut mich!«, antwortete er aufrichtig und fingerte umständlich die letzte Zigarette aus einer zerknautschen Packung.
Sie erreichten das Bodenseeforum, ein vor einigen Jahren errichtetes Gebäude, das sich als Tagungs- und Eventstätte zunehmender Bekanntheit erfreute.
Valbona deutete auf einen Weg, der am Gebäude vorbeiführte. »Ich muss hier lang. Nochmals vielen Dank.«
»Noch mal, gern geschehen«, murmelte er abwesend. Etwas oder jemand in einiger Entfernung hielt seinen Blick gefangen.
Er kniff die Augen zusammen und versuchte sich darauf zu konzentrieren.
»Was zum Geier ...!«, murmelte er.
»Wie heißen Sie eigentlich?«, fragte Valbona, die sich bereits von ihm abgewandt hatte.
»Was?«, brummte er geistesabwesend.
»Ihr Name?«
Er griff in die Reifen und stieß seinen Rollstuhl an. »Hagedorn. Mein Name ist Hagedorn.«
Angezogen von dem, was er entdeckt hatte, ließ er die junge Frau zurück, die ihm kopfschüttelnd hinterherblickte, ehe sie ihren Weg fortsetzte.
»Machen Sie’s gut, Herr Hagedorn«, rief sie. Er hörte ihre Worte nicht mehr.
Achtlos schnippte er die Zigarette weg, als er wenig später mit offenem Mund vor dem dampfenden Gebilde stand.
»Verdammte Scheiße!«
Kapitel 2
Konstanz, Rheinpromenade, Bodenseeforum
Montag, 07:30 Uhr
Erster Kriminalhauptkommissar Marius Bannert pellte sich umständlich aus dem Mercedes und trat die Fahrertür ungehalten ins Schloss.
»Wie ich die Kiste hasse«, maulte er.
Eine junge Streifenbeamtin trat auf ihn zu und nickte zum Gruß.
»Was stimmt denn mit dem Auto nicht?«, erkundigte sich die uniformierte Brünette.
»Die Blechbüchse mag für kleinere Menschen angehen.« Bannert reichte ihr flüchtig die Hand. »Außerdem sitzt man darin so tief, dass man einen Schuhlöffel zum Aussteigen braucht.«
Ihre zierliche Hand versank vollständig in seiner. Bannert überragte die Beamtin um mehr als einen Kopf. Eingeschüchtert sah sie zu ihm auf.
»Sie sind Hauptkommissar Bannert?«, fragte sie unsicher.
»Hm!«, brummte er zustimmend. »Kennen wir uns?«
»Ähm, nein«, sagte sie irritiert. »Reiser, Mirjam Reiser. Einfach nur Mirjam, oder Miri. Ich sollte hier auf Sie warten und Sie sofort zum Tatort bringen, sobald Sie eingetroffen sind«.
»Bist du sicher, dass es der Tatort ist?«
»Na gut! Dann eben der Fundort«, korrigierte sie sich.
Bannert war nicht entgangen, wie sie ihn ansah. Er war sich der Wirkung seiner Augen bewusst und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Kontaktlinsen«, witzelte Bannert.
»Echt jetzt?« Die Beamtin fühlte sich ertappt.
»Nein. Ein Scherz! Bringst du mich jetzt hin, oder soll ich mich selbst auf die Suche machen?«
»Ähm, natürlich! ’tschuldigung!«
»Und nenn mich Marius«, bat er.
»Freut mich, Marius«, entgegnete sie strahlend, wandte sich um und ging ihm voraus.
Abgesehen von der Pistole, die Bannert im Gürtelholster trug, wies ihn nichts als Kriminalbeamten aus. Wenn es nach ihm ginge, könnte er auch auf das Tragen der Waffe verzichten. Die neue Chefin bestand jedoch vehement darauf, dass ihre Mitarbeiter, wenn sie das Dienstgebäude verließen, gefälligst die Dienstwaffe und Schutzweste mitzuführen hätten. Bannert dachte jedoch nicht im Traum daran, die kugelsichere Weste zu tragen. Einer der letzten Augusttage versprach ein schwülheißer Tag zu werden, und er würde sich damit nicht noch zusätzlich belasten.
Schweigend folgte er der jungen Beamtin.
Sie umrundeten das Bodenseeforum und näherten sich über die Promenade der Gebäuderückseite.
»Wann wurde sie gefunden?«, erkundigte sich Bannert.
»Vor etwa zwei Stunden. Wir waren relativ schnell vor Ort. Obwohl um diese Zeit schon viele Leute unterwegs sind, die ihre Hunde ausführen oder joggen, wurde sie erst kurz nach Sonnenaufgang entdeckt.«
»Wann war das?«
»Hm ...« Reiser überlegte kurz. »Kurz nach halb sechs?«
»Ist das eine Frage oder eine Feststellung?« Bannerts Stimme klang harscher als beabsichtigt.
»Sorry! Es war ziemlich genau fünf Uhr dreißig.«
Das Gelände war großräumig mit Flatterband abgesperrt. Bannert zählte nicht weniger als drei Mannschaftstransportwagen der Bereitschaftspolizei, deren Einsatzkräfte den Fundort weiträumig absperrten.
Bannert kannte das Bodenseeforum nur von einem zufälligen Besuch. Er lächelte, als er sich erinnerte, vor drei Jahren mit einer Staatsanwältin das Forum für eine Live-Lyrix-Veranstaltung eines Radiosenders besucht zu haben. Sie hatte zwei Tickets für das Event, und angeblich war ihre Freundin kurzfristig abgesprungen. Im Anschluss daran waren sie die Promenade entlanggeschlendert und hatten wie Teenager auf einer Bank im Herosé-Park rumgeknutscht.
Vermutlich, weil er damals nur Augen für die attraktive Staatsanwältin und weniger für die neu angelegte Promenade gehabt hatte, konnte er sich an den Anblick, der sich ihm jetzt bot, nicht erinnern.
Kriminaltechniker tänzelten um eine Statue herum, die damals definitiv nicht dort gestanden hatte.
Ein Mann Ende fünfzig kam auf ihn zu und begrüßte ihn herzlich. Karsten Kieferle, der leitende Kriminaltechniker. Bannert kannte keinen besseren. Kieferles Schädel war wie immer in letzter Zeit frisch rasiert und schimmerte wie eine frisch gewachste Bowlingkugel in der morgendlichen Sonne.
»Marius. Gut, dich wieder im Team zu haben.«
»Danke!«, entgegnet Bannert abwesend. Er konnte kaum den Blick von der grotesken Statue abwenden.
»Als du sagtest, die Leiche sei tiefgefroren, konnte ich mir kein Bild machen«, sagte Bannert leise, als er umständlich ein Paar Einweg-Handschuhe aus der Gesäßtasche fingerte.
»Ja, die Leiche ist hart wie Stein«, kommentierte Kieferle.
»Wo ist der Rechtsmediziner?«, erkundigte sich Bannert.
»Ist auf dem Weg. Nadine sollte in wenigen Minuten auch hier eintreffen.«
»Gut!«
Während Bannert die Finger in das Nitril zwängte, ging er langsam auf die Statue zu. Einen Meter davor hielt er inne. Der Anblick war bizarr und faszinierend zugleich. Unmittelbar vor der betonierten Kaimauer erhob sich auf einem kleinen Marmorsockel die Leiche einer in Eis erstarrten hübschen jungen Frau, die nicht viel älter als sechs- oder siebenundzwanzig Jahre alt zu sein schien. Bis auf einen weißen Tutu-Rock war sie nackt.
Die wärmenden Sonnenstrahlen hüllten den Körper in eine dampfende Aura diffundierenden Eises.
Die Beine überkreuzt, die Arme hoch über den Kopf erhoben und zu einem fast perfekten Kreis geformt, strahlte sie eine grazile Anmut aus. Das Kinn leicht erhoben, verlor sich ihr nach oben gerichteter Blick im wolkenlosen Himmel.
»Eine Ballerina?«, hörte er Kieferle neben sich mutmaßen.
»Jupp! In der fünften Position.«
»Was?«
»Ballett! Die fünfte Position. Eine von fünf Grundstellungen im Ballett« klärte Bannert ihn auf.
»Klugscheißer!«, spöttelte Kieferle. »Wieso kennst du dich denn mit Ballett aus?«
»Ich musste meine kleine Schwester öfter, als mir lieb war, ins Ballett begleiten.«
»Aha?« Kieferle grinste breit, der offenbar Bilder eines Ballett tanzenden, jungen Bannerts vor dem inneren Auge hatte.
»Idiot!«, brummte Bannert. »Hör auf, so blöd zu grinsen.«
Kieferle wand sich kichernd ab und ging auf das Tatortfahrzeug der Kriminaltechnik zu.
»He!«, rief Bannert ihm hinterher. »Kannst du etwas über die Todesursache sagen?«
»Nö, du wirst dich gedulden müssen, bis die Rechtsmedizin eintrifft.«
»Seid ihr fertig mit der Spurensicherung?«
Kieferle reckte den erhobenen Daumen in die Höhe.
Bannert seufzte, wandte sich der Statue zu und ließ den Blick akribisch über den nackten, toten Frauenkörper gleiten. Er konnte nicht erkennen, ob sie mit dem Marmorsockel verbunden war oder sich, perfekt ausbalanciert, alleine trug. Von den Knöcheln bis zu ihrer Scham wanden sich filigrane Ornamente. Bannert vermochte nicht zu beurteilen, ob sie in das gefrorene Fleisch gebrannt, geprägt oder geschnitzt worden waren. Die Verzierungen waren so fein, so kunstvoll, dass es den Anschein erweckte, als würde sie eine gemusterte Feinstrumpfhose tragen.
Im Abstand von wenigen Zentimetern ließ er seine offene Hand über ihrer Brust schweben.
Die Frau war nicht einfach nur tiefgekühlt – sie war weit über den Gefrierpunkt hinaus kryostatisch konserviert.
Sie zu berühren, wagte er nicht. Zu groß waren seine Befürchtungen, dass sie kippen und in mehrere Teile zerbrechen könnte.
Nachdem Bannert die eisige Statue einmal umrundet hatte, zog er ein kleines Diktiergerät aus der Brusttasche seines Hemds und verschränkte nachdenklich die Arme vor der Brust.
»Weiblicher Leichnam, circa fünfundzwanzig bis dreißig Jahre alt, augenscheinlich keine äußeren letalen Verletzungen«, diktierte er gedämpft in das Gerät.
»Stimmt!«, pflichtete ihm Kieferle bei, der unbemerkt zurückgekehrt war. »Sind dir ihre Beine aufgefallen?«
»Natürlich«, entgegnete Bannert. »Die Muskeln sind atrophiert.«
»Komisch. Was kann das sein?« Die uniformierte Beamtin war Kieferle gefolgt.
»Hast du nichts Besseres zu tun?«, fuhr Kieferle sie an.
»Irgendetwas absperren oder Reporter im Zaum halten?«
Beleidigt wandte sich die uniformierte Beamtin um und ging eilig den Weg zurück, den sie zuvor mit Bannert gekommen war.
»Findest du nicht, dass du etwas forsch zu ihr warst, Karsten?«
Kieferle schnaubte entnervt.
»Mirjam ist ein liebes Mädel, aber sie kann echt nervtötend sein.«
»Wieso?«
»In den vergangenen neun Monaten hat sie sich insgesamt viermal bei der Kripo beworben. Sie möchte unbedingt zur Kriminaltechnik.«
»Wo liegt das Problem?«
»Sie ist mir zu unerfahren. Sie ist nach dem Abitur direkt in den gehobenen Dienst eingestiegen, hat das Studium an der Fachhochschule absolviert und ist noch nicht mal ein Jahr im Streifendienst.«
»Bei den derzeitigen Nachwuchsproblemen sollten wir nehmen, was wir kriegen können«, bemerkte Bannert beiläufig, der nun auf allen vieren um den Sockel krabbelte.
»Vielleicht hast du recht, Marius. Du findest, ich sollte sie nehmen?«
»Wieso fragst du mich das?«, knurrte Bannert. »Wo bleibt denn der Rechtsmediziner, Herrgott noch mal!«
»Wenn Sie auch mit mir vorliebnehmen, stehe ich gerne zu Verfügung«, mischte sich eine weibliche Stimme ein.
Immer noch kniend, hob Bannert den Kopf, und sein Blick fiel geradewegs auf ein Paar pinkfarbener Leinensneaker. Perfekt geformte Beine steckten in einer Dreivierteljeans. Hastig erhob er sich und sah in das grinsende Gesicht einer attraktiven Frau in den Vierzigern. Ihr Gesicht war sonnengebräunt, das schulterlange blonde Haar wurde von einer Sonnenbrille gehalten, die sie auf dem Kopf trug.
»Doktor Lara Geermann, Rechtsmedizin Freiburg«, stellte sie sich ihm immer noch grinsend vor.
Bannert zog schnalzend die Gummihandschuhe ab, wischte sich die Hände an der Hose trocken und reichte ihr die Hand.
»Hallo, Frau Doktor«, erwiderte er lächelnd. »Schön, dass Sie kommen konnten. Bannert, Marius Bannert, Morddezernat.«
»Das ist ja abgefahren!«, entfuhr es ihr, als sie die Leichenstatue anstarrte und dabei Kieferle nur knapp die Hand schüttelte. »Weiß man schon, wer sie ist?«
»Nein.« Kieferle schüttelte beleidigt den Kopf. »Meine Leute checken gerade die Vermisstenmeldungen der letzten Wochen.«
Doktor Geermann stellte den Aluminiumkoffer, den sie bei sich trug, auf der Kaimauer ab, ließ die Schlösser aufschnappen und zog ein Paar schwarzer Latexhandschuhe aus einer Pappschachtel.
Bannert ging einige Meter zurück, steckte sich einen Kaugummi in den Mund und beobachtete sie.
Nachdem sie den Leichnam ebenso akribisch wie zuvor er begutachtet hatte, streifte sie sich die Latexhandschuhe von den Händen.
»Und? Was denken Sie?«, hob Bannert an.
»So etwas habe ich noch nie gesehen.«
»Können Sie etwas zur Todesursache sagen?«
Sie bedachte ihn mit einem mitleidigen Blick.
»Herr Bannert, wie lange machen Sie das Geschäft schon?«
»Ja, schon gut«, lächelte er. »Mir ist klar, dass Sie, ohne die Leiche geöffnet zu haben, keine seriöse Aussage treffen können. Deutet wenigstens äußerlich etwas auf eine mögliche Todesursache hin?«
»Außer einer feinen Punktion der Haut an ihrer Halsschlagader konnte ich nichts feststellen. Möglicherweise wurde sie sediert. Jedenfalls finde ich keine Anzeichen äußerlicher Traumata.«
»Was können Sie mir zu den Beinen sagen?«
»Richtig! Die sind massiv atrophiert.« Um seiner Nachfrage vorzugreifen, fuhr sie fort. »Es gibt mehrere Ursachen, die einen derart massiven Muskelschwund hervorrufen können. Vielleicht eine genetische Erkrankung, wie zum Beispiel eine spinale Muskelatrophie oder ALS.«
»Oder eine Querschnittslähmung?«
»Auch das wäre denkbar«, pflichtete sie Bannert bei. »Haben Sie für mich auch einen?«, bat sie auf Bannerts Mund deutend.
»Klar«, brummte er und hielt ihr das Päckchen entgegen, aus dem sie einen Streifen zog.
»Hm, ich frage mich nur, wie wir die Leiche unbeschadet und unverändert in die Pathologie bekommen?«, rätselte sie und schob sich den Kaugummi zwischen die Zähne.
»Das habe ich schon organisiert«, schaltete sich Kieferle ein und schielte auf seine Armbanduhr. »In etwa zehn Minuten sollte ein kleiner Kühllaster eintreffen. Wir hatten geplant die Leiche samt Sockel auf Paletten abzulegen und zu verladen.«
»Hervorragend!«, lobte Doktor Geermann. »Bevor Sie sie kippen und ablegen, decken sie die Leiche bitte mit einer Folie ab. Ich will vermeiden, dass Fremdspuren übertragen werden.«
»Keine Sorge. Niemand wird die Leiche ohne entsprechende Schutzausrüstung berühren.«
»Danke. Im Augenblick gibt es für mich hier nichts mehr zu tun, ich fahre jetzt wieder nach Freiburg zurück«, sagte sie. »Sobald die Leiche im Institut ist, beginne ich mit der Obduktion. Das heißt, sobald sie aufgetaut ist.«
Sie verabschiedete sich, eilte den Weg zurück und hielt auf einen Wagen mit Freiburger Autokennzeichen zu.
Gedankenverloren blickte Bannert ihr nach, als sie ins Auto stieg und davonfuhr. Er konnte sich nicht erinnern, je mit ihr zu tun gehabt zu haben. Wahrscheinlich war sie neu am Institut.
»Guten Morgen, Marius.«
Bannert fuhr herum. »Guten Morgen! Ich habe dich gar nicht kommen hören.«
Nadine Adler sah wie frisch aus dem Ei gepellt aus. Die langen dunkelblonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, dezent aufgelegtes Make-up. Entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten war sie heute, wie Bannert feststellte, leger mit Jeans, T-Shirt und einem Paar dieser neumodischen Merino-Wool-Sneakern bekleidet. Bannert überlegte, was ihr Outfit wohl gekostet haben mochte.
»Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. War das die Rechtsmedizinerin?«, erkundigte sich Adler.
»Hm!«, bestätigte Bannert.
»Kennst du sie?«
»Nein, aber sie macht einen kompetenten Eindruck.«
In wenigen Sätzen brachte Bannert sie auf den aktuellen Stand.
»Konnte man die Tote schon identifizieren?«
Bannert verneinte kopfschüttelnd. »Karsten hat aber schon ein paar Leute auf die Vermisstenmeldungen angesetzt«, fügte Bannert hinzu.
»Wer hat die Tote aufgefunden?«, wollte Adler wissen.
Bannert zuckte überfragt mit den Achseln und sah sich suchend um.
»Miri!«, rief er der uniformierten Beamtin zu, die gelangweilt neben dem Gebäude des Bodenseeforums auf und ab gegangen war. Als sie ihn hörte, beschleunigte sie ihren Schritt und näherte sich ihnen.
»Miri, wer hat die Leiche eigentlich gefunden?«, erkundigte sich Bannert, als Mirjam Reiser sie erreicht hatte.
»Ein ziemlich abgerissener Typ im Rollstuhl. Den Namen hat ein Kollege meiner Schicht bestimmt notiert. Ich meine, er hatte einen beigefarbenen, mittelgroßen Hund dabei. Im Herosé-Park ...« Sie deutete die Promenade hinunter. »Da treiben sich ja ständig Obdachlose rum. Hinterlassen ihren Müll und machen uns jede Nacht ...«
»Wie sah er aus?« Bannert und Adler fielen ihr unisono ins Wort.
»Was?« Der Blick der Beamtin pendelte unsicher zwischen Bannert und Adler hin und her.
»Wie sah der Penner aus?«, drängte Bannert.
»Na ja, wie ein Penner halt.«
»Geht es vielleicht etwas präziser, Frau ...?«
»Mein Name ist Reiser, Mirjam Reiser, Frau Adler.«
»Also, Frau Reiser?«
»Der Typ war groß, sehr groß, hatte lange, dunkle, zottelige Haare. Und einen nicht minder ungepflegten Vollbart. Ich glaube, er trug eine Jogginghose und ein buntes T-Shirt. Ach ja«, fügte sie hastig hinzu. »Seine Augen waren irgendwie komisch.«
Bannert und Adler tauschten einen vielsagenden Blick.
»Willst du, oder soll ich?«, fragte Nadine Adler, wobei die Frage eher rhetorisch klang.
»Ich kümmere mich darum«, gab Bannert klein bei.
Verwirrt blickte die Beamtin zwischen den beiden hin und her.
»Kennen Sie den Mann?«
»Allerdings!«, konstatierte Bannert.
»Na dann. Viel Glück, Marius!« Bannert vermochte Adlers schiefes Grinsen nicht zu deuten.
»Danke, Glück allein wird dazu nicht ausreichen.« Er kramte den Schlüssel seines Dienstwagens aus der Hosentasche, nickte Adler und Reiser zu und ging.
Kapitel 3
Konstanz, Universität, Gebäude H
Zehn Monate zuvor
»Was ist Kunst? Was macht Kunst aus?«, fragte er in die Runde der etwas mehr als ein Dutzend Zuhörer, die förmlich an seinen Lippen hingen.
»Kunst ist nicht, nackt mit Schweineblut besudelt über eine am Boden liegende Leinwand zu robben«, fuhr er fort, ohne eine Antwort abzuwarten.
»Oder seinen Pimmel, wahlweise die Brüste, mit Farbe zu bestreichen und so lange gegen eine Leinwand zu klatschen, bis hernach etwas Abstraktes dabei herauskommt«.
Ein Kichern ging durch die Reihen.
»Das, meine Damen und Herren, hat mit Kunst nichts, aber auch rein gar nichts, zu tun. Zumindest nicht nach meinen Maßstäben. Wenn Sie also glauben, der Aktionskunst etwas abzugewinnen, sind Sie in meiner Vorlesung fehl am Platz.«
Geduldig ließ er seine Worte wirken und war gespannt, ob jemand den Saal verlassen würde. Nicht dass es jemals vorgekommen wäre.
»Kunst, meine Damen und Herren, erfordert Talent und jahrelange Übung. Nur gut zu zeichnen, ein Gespür für die Komposition von Farben zu besitzen oder Geschick im Umgang mit einem Feinmeißel zu haben, das macht aus Ihnen noch lange kein Künstler.«
Langsam schritt er die erste Reihe ab und sah dabei jedem einzelnen Studenten in die Augen.
»So wahr Sie hier vor mir sitzen, sage ich Ihnen, dass es statistisch gesehen höchstens einem von Ihnen gelingt, als Künstler oder Künstlerin erfolgreich zu sein. Und dem Rest möchte ich dringend davon abraten, meine Augen und die der Welt mit schnöder Aktionskunst zu beleidigen. Ich wiederhole mich. Das ist keine Kunst! Das ist der jämmerliche und bemitleidenswerte Versuch, auf geschmacklose Art und Weise mit seiner Talentlosigkeit Schlagzeilen zu machen.«
Ein Student rutschte unruhig auf seinem Platz hin und her.
»Haben Sie etwas zu meinen Ausführungen anzumerken?«, sprach er den jungen Mann an.
»Ist Kunst nicht ungeachtet dessen, was Kritiker, Sachverständige oder Galeristen für wertvoll erachten, all das, worin der Künstler sich mit seiner ganzen Hingabe eingebracht hat?«
»Diese Wikipedia-Definition haben Sie aber schön rezitiert«, lobte er spöttisch. Wieder machte ein Kichern die Runde.
Der junge Student senkte errötet den Kopf.
»Aber Sie haben recht«, fuhr er fort. Das Kichern verstummte augenblicklich.
»In seinem Schaffen versucht jeder Künstler vergängliches Leben zu verewigen, indem er totem Material Leben einhaucht und dabei seine Lebenszeit und oftmals sich selbst opfert. Ganz egal, ob Sie eine Leinwand befüllen, aus einem Sandsteinblock eine Statue herausarbeiten oder ein Stück Holz bearbeiten. Jedes Werk, das Sie künftig erschaffen, muss Ihre Seele widerspiegeln, muss Zeugnis Ihrer inneren und äußeren Konflikte sein, damit der Betrachter sich im besten Fall durch Identifikation selbst darin wiederfinden kann. Das, und nichts weniger, erwarte ich von Ihnen!«
Kapitel 4
Konstanz – Musikerviertel
Montag, 26. August, 08:20 Uhr
Nach seinem letzten Fall, bei dem ein Serienkiller junge Frauen getötet, ausgeweidet und sich damit geschmückt hatte, war Marius Bannert auf eigenen Wunsch in die Verwaltung versetzt worden, was ihm nur selten die Möglichkeiten eines Außeneinsatzes bot.
Nachdem man den vorherigen Leiter wegen unzähliger Vergehen aus dem Dienst entfernt hatte, war die Führung des Kriminalkommissariats Konstanz erst vor drei Monaten wieder besetzt worden. Mit Nadine Adler, einer noch jungen Kriminaloberrätin, deren Bekanntschaft er vor knapp einem Jahr gemacht hatte. Monatelang hatte sie ihn bearbeitet, wieder ins Kommissariat zu wechseln. Wenn er es recht bedachte, hatte er nicht lange mit sich ringen müssen. Aber es hatte ihm gefallen, wie sie sich um ihn bemüht hatte. Das machte es ihm leichter, seine Rückkehr ins Kommissariat an einige Bedingungen zu knüpfen, auf die sie überraschenderweise schnell eingegangen war. Nie wieder wollte er die Leitung einer Ermittlungsgruppe oder Sonderkommission übertragen bekommen. Eine junge Frau war gestorben, an deren Tod er sich die Schuld gab. Und sein bester Freund hätte ebenfalls beinahe sein Leben verloren.
Bannerts Zeigefinger schwebte über dem Klingelknopf, als es im Lautsprecher knackte und Hagedorns sonore Stimme durch die Türsprechanlage drang.
»Verschwinde, Marius! Lass mich in Ruhe!«
»Komm schon, Falk. Lass mich rein!«
Hagedorn schien mit seinem Kommen gerechnet zu haben.
Jedoch überraschte und kränkte ihn dessen jähe Abweisung. Seit mehr als drei Jahren waren sie gute Freunde, zumindest waren sie das bis vor nicht allzu langer Zeit gewesen. Wenngleich Hagedorn immer betont hatte, ihm keine Schuld an Karinas Tod zu geben, tat er es unterbewusst wahrscheinlich doch.
Ein neuerliches Knacken aus dem Lautsprecher ließ erkennen, dass die Konversation für Hagedorn offenbar beendet war.
Scheiße! Banner stieß einen tiefen Seufzer aus. Er trat aus dem Hauseingang zurück und betrachtete die Fassade des Häuschens. Bannert beneidete ihn um dieses zauberhafte Schmuckkästchen. Hagedorn hatte es vor etwas mehr als einem Jahr gekauft und aufwendig an seine Bedürfnisse angepasst. Nie würde er sich so ein kleines Haus leisten können, schon gar nicht in dieser ufernahen Lage.
Nicht einmal eine Eigentumswohnung in Konstanz lag in seinem Budget.
Bannert begann langsam das Anwesen zu umrunden. Fast alle Rollläden daran waren geschlossen.
Was genau in Hagedorn vorging, konnte er nur vermuten, aber die zunehmend verwilderte Außenanlage spiegelte offenbar seinen Seelenzustand wider. Die Ligusterhecke gehörte wie der kniehohe Rasen dringend geschnitten. Sträucher und Buschwerk wucherten über den Staketenzaun und ragten in den Gehsteig. Offensichtlich machte Hagedorn sich nicht einmal mehr die Mühe, Sams Hundehaufen auf dem Rasen zu beseitigen, da Bannert beim Übersteigen der Staketen beinahe in eine enorme Hinterlassenschaft des Golden Retrievers trat. In der Hoffnung, die Terrassentüren offen vorzufinden, kämpfte er sich durch das Dickicht einer Forsythie. Sam, der einmal Karinas Hund gewesen war, stand schwanzwedelnd und mit heraushängender Zunge erwartungsvoll auf der mit Bangkirai belegten Terrasse. Wie erhofft, waren die beiden mächtigen Schiebetüren zu Hagedorns Wohnzimmer zurückgeschoben. Bannert strich Sam im Vorbeigehen über die Stirn, der sich sogleich trollte und an einem der Sträucher das Bein hob. Als er sich der Schwelle näherte, stieg ihm muffige, abgestandene Luft in die Nase. Kalter Zigarettenrauch hatte sich in den vom Nikotin vergilbten Gardinen eingenistet. Vorsichtig spähte er in das abgedunkelte Innere des Hauses. Geleerte Whiskey- und Wodkaflaschen reihten sich auf dem kleinen Couchtisch.
Dass es so schlimm um Hagedorn stand, hatte Bannert nicht erwartet. Ein Geräusch aus der Küche ließ ihn herumfahren. Hagedorn hockte im Dunkeln in seinem Rollstuhl und suchte klirrend in dem sich türmenden Geschirr nach einer sauberen Tasse.
»Falk?«, rief Bannert zögerlich in die dunkle Behausung hinein.
»Mach dich vom Acker, Marius! Und ich sage es nicht noch einmal.«
»Einen Scheiß werde ich!«. Bannert spürte, wie seine Fassungslosigkeit einem Zorn wich, wie er ihn lange nicht mehr verspürt hatte. »Von mir aus kannst du dich hier weiter eingraben und totsaufen. Das ist deine Sache. Ich bin dienstlich hier. Übrigens, hier stinkt es wie in einem Puma-Gehege.«
Hagedorn war fündig geworden und knallte eine Tasse unter den Kaffeevollautomaten und drückte einen Knopf. Das Mahlwerk setzte sich ratternd in Betrieb.
»Wie du schon sagtest. Es ist meine Sache, und nun scher dich raus!«
Hagedorns massiger Umriss schälte sich aus der ihn umgebenden Dunkelheit, als er die Greifreifen seines Rollstuhls anstieß und langsam auf ihn zurollte.
»Die Kollegin hat dich ziemlich treffend beschrieben«, sagte Bannert kopfschüttelnd.
Bannert vermochte kaum den Abscheu bei seinem Anblick zu verbergen.
»Ah, ja? Wie hat sie mich denn beschrieben?«, knurrte Hagedorn.
»Wie einen Penner. Und offen gestanden riechst du auch wie einer.«
Hagedorns schulterlanges Haar stand verfilzt und wirr in alle Richtungen ab.
Ein ebenso verfilzter Vollbart, den graue Fäden durchwoben, umrahmte das kantige Gesicht. Obwohl er etliche Kilos verloren haben musste, wirkte sein Körper immer noch athletisch und muskulös. Hagedorn war groß. Er maß fast an die zwei Meter, und seine frühere Karriere als Gewichtheber sah man ihm immer noch an.
Vor seinem Unfall, der ihn seitdem an den Rollstuhl fesselte, war er ein Hüne von einem Mann gewesen. Schon damals hatte man im LKA gefrotzelt, wenn Hagedorn einen Raum betrete, würde er die Sonne verdunkeln.
Nun saß er da im Rollstuhl vor ihm, ein Häufchen Elend. Bekleidet mit einem verblichenen, ärmellosen Shirt, einer speckigen grauen Jogginghose und offenen Gummi-Crocs an den dürren Füßen.
»Was ist nur aus dir geworden?«, flüsterte Bannert.
»Stell deine Fragen, und dann verschwinde wieder!«
Bannert versuchte sich zu fassen. »Du hast die Leiche gefunden?«
»Bescheuerte Frage! Wenn du das nicht wüsstest, wärst du nicht hier!«, knurrte Hagedorn gereizt. Er entnahm der Kaffeemaschine die mittlerweile gefüllte Tasse und rollte damit an Bannert vorbei auf die Terrasse hinaus. Hagedorn umgab die olfaktorische Aura eines säuerlichen Gemischs aus Schweiß, Alkohol und Urin. Bannert rümpfte angewidert die Nase.
»Ist dir in ihrer Umgebung irgendetwas Verdächtiges aufgefallen?«
»Nein! Aber auch das habe ich den Streifenbeamten schon mitgeteilt.«
Hagedorn griff unter sich und förderte eine Schachtel L&M und ein Feuerzeug zutage.
Bannert beobachtete, wie er zitternd die Flamme zur Zigarette führte, tief inhalierte und den Rauch in den morgendlichen Himmel blies.
»Ist dir an der Toten selbst etwas aufgefallen?«
»Lass es, Marius! Mich interessiert das nicht mehr.«
»Komm schon. Du hast sie sicher eingehend angesehen«, mutmaßte Bannert.
»Sie ist mir nur aufgefallen, weil an der Stelle noch nie eine Statue gestanden hat, ich habe den Notruf gewählt, und das war es! Sind wir dann fertig?«
Hagedorns Zigarettenspitze deutete zum Gartenzaun. »Nimm denselben Weg zurück!«
Bannert versuchte es ein letztes Mal. »Was ist eigentlich los mit dir?«
Hagedorn sah ihn nur durchdringend an und neigte den Kopf, als verstünde er nicht, wovon Bannert sprach.
»Du warst ein brillanter Ermittler und herausragender Fallanalytiker. Und was ist aus dir geworden? Ein abgefuckter, stinkender Penner in schmutzstarrenden Klamotten, der sich einigelt und in Selbstmitleid suhlt.« Bannert drohte sich immer weiter in Rage zu reden. Ihm war klar, dass Hagedorn keinem anderen diese Direktheit und Wortwahl ungestraft durchgehen lassen würde.
Stoisch lächelnd schnippte Hagedorn die Asche von der Zigarette und sog daran.
Bannerts Kopf war hochrot angelaufen. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt, während Hagedorn ihn nur mit demselben überheblichen Grinsen ansah.
»Was erwartest du? Dass ich oder Nadine Adler auf Knien angekrochen kommen und dich um deine Mithilfe anflehen? Hast du dir das so vorgestellt? Nein, mein Freund. Wir brauchen dich nicht.«
Bannert überlegte kurz, ehe er fortfuhr. »Wenn ich mich recht erinnere, sind noch keine neun Monate vergangen, seit ich dir einen durchaus lukrativen Posten in der operativen Fallanalyse angeboten habe. Du hattest nicht mal den Anstand abzusagen.«
Bannert fuhr sich wütend mit den Fingern durch die Haare.
»Was mir ja prinzipiell gleichgültig ist. Aber du hast dich nicht ein einziges Mal in den vergangenen sechs Monaten gemeldet, hast auf keine meiner Nachrichten oder Anrufe reagiert. Aber weißt du, was am miesesten von dir war? Nicht zur Taufe der kleinen Karina zu erscheinen. Ich bereue, dich gebeten zu haben, die Patenschaft für meine Tochter zu übernehmen.«
Bannert sah zu Boden, weil er Hagedorn nicht sehen lassen wollte, dass ihm Tränen des Zorns und der Enttäuschung in den Augen standen.
»Weißt du noch, was du deiner Tochter ein Leben lang gepredigt hast? Hm? Weißt du es noch?« Bannert wandte sich ab und ging auf eine Lücke zwischen den Forsythien zu, an denen der Zaun leichter zu übersteigen sein würde, und spürte im selben Moment etwas Weiches unter seinem Schuh.
»Aufgeben ist niemals eine Option! Das war immer dein Credo, Falk. Aber es sagt sich leichter, als es selbst zu leben. Nicht wahr? Karina würde sich in Grund und Boden schämen, dich so zu sehen.«
»Verschwinde!«, zischte Hagedorn.
»Leck mich, Falk!«
Kapitel 5
Konstanz, Seestraße
Sechs Wochen zuvor
José Garcia hievte sich schwer atmend in seinen Elektrorollstuhl. Dabei achtete er sehr darauf, dass die Bremsen angezogen waren. Ein Sturz würde ihm gerade noch fehlen.
In der Kanzlei brauchte er den Rolli nicht. Kurze Distanzen wie zur Toilette oder zur Kaffeemaschine konnte er problemlos auf eigenen Beinen zurücklegen. Weitere Wege brachten ihn jedoch derart außer Atem, als würde er den Nanga Parbat ohne Sauerstoffgerät besteigen.
In den vergangenen Wochen hatte sich seine Kurzatmigkeit besorgniserregend verschlimmert. Mit einem Stofftaschentuch tupfte er sich den Schweiß von der Stirn und versuchte seinen Atem auf eine normale Frequenz zu drosseln.
Der Sommer schien sich dieser Tage noch ein letztes Mal aufbäumen zu wollen, denn die Luft war drückend heiß, und es roch nach Gewitter.
»Hoffentlich hält das Wetter noch zwei Stunden«, murmelte er.
Nach einem letzten prüfenden Blick durch das Büro betätigte er den Kippschalter neben der Tür und ließ die elektrischen Jalousien herunter. So wie er es immer tat, seit fünfzehn Jahren. Gerade als er sich abwenden wollte, klingelte das Telefon. Er ließ den Rollstuhl um die eigene Achse rotieren und war für einen kurzen Augenblick versucht, den Anruf anzunehmen, überlegte es sich jedoch anders.
Für siebzehn Uhr hatte er für sich in einem der besten Restaurants in Konstanz einen Tisch auf der Terrasse reservieren lassen.
»Normalerweise reservieren wir keine Tische auf der Terrasse«, war die häufigste Antwort auf Gästeanfragen.