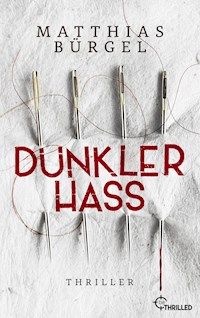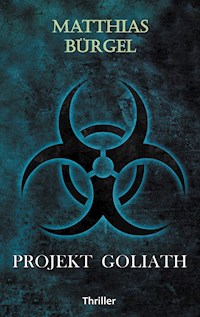
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein führender IS-Terrorist, dessen Ziel die Etablierung eines globalen Gottesstaates ist, gelangt in den Besitz eines todbringenden Erregers. Damit infizierte IS-Kämpfer tragen das tödliche Virus, unerkannt in der Masse des Flüchtlingsstroms, nach Europa. Eine Pandemie ungeahnten Ausmaßes bedroht die Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Danksagung
Besonders danken möchte ich meiner Frau und
meiner Familie, die mir nicht nur den Rücken frei
hielten, sondern auch für ihre Unterstützung und
aufmunternden, bestärkenden Worte.
Danke, mein Sohn, für Deine Expertise und Überarbeitung
der fachspezifischen, biologischen Hintergründe.
Ebenso meiner Lektorin Karin Krauer-Arpagaus
und meiner Tochter für die Gestaltung
des Covers.
Der größte Dank jedoch gilt Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, dass sie sich für den Kauf meines
ersten Romans entschieden haben. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß und spannende Lesestunden!
Anmerkung des Autors
In diesen Roman flossen meine Erfahrungen und Kenntnisse meiner langjährigen polizeilichen Praxis und meiner Auslandseinsätze ein.
Das Europäische Seuchenschutzzentrum (ECDC) ist eine real existierende Einrichtung der Europäischen Union. Ebenso handelt es sich bei den Handlungsorten um reale Orte.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Faktizität, obwohl reale Unternehmen erwähnt und realistische Abläufe thematisiert werden, die es so oder so ähnlich geben könnte.
Die beschriebenen Personen, Begebenheiten, Gedanken und Dialoge sind fiktiv.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Solna – Stockholm
Damaskus – Syrien
Ravensburg
Stockholm
ECDC
Ravensburg
ECDC
Stockholm
ECDC
Ravensburg
ECDC
Damaskus
Stockholm
ECDC
Außerhalb von Södertälje
Stockholm – Wivalliusgatan
Hotel Birkastan, Solna
Stockholm – Wivalliusgatan
Hotel Birkastan, Solna
Stockholm – Wivalliusgatan
Hotel Birkastan, Solna
ECDC
Hotel Birkastan, Solna
Ankara
ECDC
Adana – Türkei
Stockholm
Aleppo – Syrien
Stockholm
Ravensburg
Damaskus
Stockholm – Wivalliusgatan
Stockholm
Wivalliusgatan
Damaskus
Wivalliusgatan
SäPo – Stockholm
Wivalliusgatan
ECDC
SäPo – Stockholm
ECDC
SäPo – Stockholm
ECDC
SäPo – Stockholm
ECDC
SäPo – Stockholm
ECDC
SäPo – Stockholm
SäPo – Stockholm
ECDC
SäPo – Stockholm
Wivalliusgatan
Köszeg – Ungarn
Amman – Jordanien
Passau
Damaskus
Jordanien
Passau
Syrien
Passau
Damaskus
Passau
Stockholm
Damaskus
Passau
Damaskus
SäPo – Stockholm
Passau
Damaskus
SäPo – Stockholm
Passau
SäPo – Stockholm
Damaskus
Passau
Damaskus
Passau
Damaskus
Passau
Damaskus
Passau
Damaskus
Passau
Syrien
Passau
Berlin
Syrien
Berlin
Passau
Libanon
Passau
Libanon
Passau
Libanon
Passau
Libanon – Tripolis
Passau
Tripolis
Passau
Tripolis – Libanon
Passau
Epilog
Prolog
Juan dos Santos Alvarez kotzte sich, als würde sich sein Innerstes nach außen kehren, die Seele aus dem Leib. Jedes Mal, wenn er glaubte, es ginge wieder, überkam ihn ein neuer Brechreiz. Er würgte und sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Hustend spuckte er, wie er annahm, die letzten Reste seines Mageninhaltes, gemischt mit bitterer Galle, aus.
Ein Gemisch aus Blut und Erbrochenem rann zäh in den Ablauf des Edelstahlwaschbeckens.
Seit gut einer Stunde belegte er nun schon die Bordtoilette. Die Anschnallzeichen und Anweisungen der Bordcrew hatte er ignoriert. Es war ihm in seinem Zustand einfach nicht möglich und nach einiger Zeit war auch das wütende Klopfen der Purserin verebbt. Sie befanden sich im Landeanflug auf Madrid. Es kostete ihn seine ganze verbliebene Kraft, sich gegen die Schwerkraft des sich im Sinkflug befindlichen Jets zu stemmen. Vor vierzehn Tagen hatte ihn seine Firma, als leitenden Ingenieur für Energieanlagenbau, zu Verhandlungen nach Sierra Leone geschickt. Verhandlungen über den Bau eines Solarparks, welcher dem Land weitere sechs Megawatt Leistung bringen und so die Stromversorgung Sierra Leones sichern sollte. Die Gespräche gestalteten sich zäher, als er erwartet hatte. Schon beim ersten Treffen mit den verantwortlichen Projektleitern in Freetown wurde ihm bewusst, dass es ihn, beziehungsweise seine Firma einiges kosten würde, den Vertrag für den Bau des Solarparks an Land zu ziehen.
Also machte er großzügige Geschenke, führte sie zum Essen in die gediegensten Restaurants Freetowns aus und Abend für Abend feierten sie mit Edelnutten in einem teuren Nachtclub unweit des Regierungsgebäudes. Nach neun Tagen hatte er sie schließlich so weit, dass sie die Verträge unterzeichneten. Der größte Abschluss seiner Karriere.
Der Vorstand in der Madrider Zentrale war mehr als zufrieden. Gerne hätte er seinen Erfolg gebührend gefeiert, aber als er schließlich in sein Hotelzimmer zurückkam, fühlte er sich matt und fiebrig.
Er schrieb es den langen Tagen und noch längeren Nächten der vergangenen zwei Wochen zu und entschied, sofort nach seiner Ankunft in Madrid seinen Erfolg ordentlich zu begießen.
Ein Ruckeln durchfuhr die Maschine, als diese mit quietschenden Reifen auf dem Rollfeld aufsetzte.
»Herrgott, reiß dich zusammen, Juan!«, ermahnte er sich und wandte sich dem Spiegel zu. Das Gesicht war fahl und wächsern, dunkle Ringe unter den Augen. So gut es ging, spritzte er sich mit beiden Händen Wasser in sein Gesicht, während die Maschine rapide an Geschwindigkeit verlor und eine langgezogene Kurve beschrieb. Beinahe hätte er das Gleichgewicht verloren. Gerade als er sich das Gesicht trocken getupft und die Krawatte zurechtgerückt hatte, kam das Flugzeug mit einem sanften Ruck zum Stillstand. Er wandte sich der Tür zu und griff nach der Entriegelung.
»Por Dios…«, fluchte er. Ungläubig betrachtete er das Blut an seinen Händen. Langsam wandt er sich seinem Spiegelbild zu und erschrak zu Tode. Blut troff aus seinen Augen, das in dicken, zähen Tränen seine Wangen hinablief, ebenso rannen kleine Rinnsale Blutes aus seinen Ohren. Als er an sich hinunterblickte, hatte sich eine Pfütze schmutzig braunen, übel riechenden Blutes zu seinen Füßen gebildet, welches warm an seinen Beinen hinunterlief.
Eine Angst, die er noch nie gespürt hatte, nahm Besitz von ihm. Todesangst! Die enge WC-Kabine begann sich wild um ihn zu drehen. Schien schlagartig alle Konturen und Farben verloren zu haben. Ihm wurde schwarz vor Augen. Verzweifelt versuchte er, irgendwo Halt zu finden. Seine Hände griffen jedoch ins Leere.
Juan dos Santos Alvarez verlor das Bewusstsein und schlug hart auf der Toilette auf. Die Welt wurde dunkel.
Solna – Stockholm
Der Verkehr floss zäh an diesem Morgen. Patrick Sprenger scherte abrupt aus der Kolonne aus und lenkte den Wagen an den rechten Straßenrand. Wie jeden Morgen hielt er an dem kleinen Laden in der Torsgatan, um sich einen Cappuccino und eine deutsche Tageszeitung zu kaufen. Hell bimmelte die kleine, blaue Glocke über der Tür, als er die Ladentür öffnete. Er mochte das Glöckchen. Es war so nostalgisch wie der Rest des Ladens. Er war, wie man sich einen Tante-Emma-Laden vorstellte. Auf einem Regal hinter dem Tresen standen die verschiedensten Tiegel, Dosen und Gläser mit Gewürzen, von denen er nicht mal die Hälfte kannte. Es roch nach frisch Gebackenem. Aus dem Hinterzimmer trat eine ältere Frau, die ihn freundlich anlächelte, als sie ihn erkannte.
»Guten Morgen!«, trällerte sie auf Englisch. »Wie jeden Morgen?«
Sie wusste mittlerweile, dass er kein Schwedisch sprach.
»Ja, gerne eine ›Frankfurter Allgemeine‹«, bat er. Mit flinken Fingern bediente sie geübt die alte Kolbenmaschine, schäumte die Milch auf, während sich der Kaffee grunzend und gurgelnd in einen Pappbecher unter dem Kolben ergoss. Routine und festgefahrene Rituale waren ihm eigentlich zuwider, aber der morgendliche Besuch in diesem Laden war in den letzten Monaten zu einer festen Gewohnheit geworden, die nur durch die Wochenenden unterbrochen wurde. Es war dort ausgesprochen heimelig und es linderte sein Heimweh, das er in den letzten Wochen phasenweise verspürte. Die alte Ladenbesitzerin reichte ihm den Cappuccino über den Tresen und er stellte sich an einen der beiden Stehtische, die an einem der großen Fenster standen.
Gedankenverloren nippte er an dem heißen Kaffee und beobachtete den Verkehr und die Fußgänger, die vorbeieilten. Er würde sich schon an die neue Situation gewöhnen. Das Heimweh würde nachlassen. Trotz der Euphorie und Freude, ans ECDC berufen worden zu sein, vermisste er seine Eltern und Freunde sehr. Vor sechs Monaten war er nach Stockholm gekommen. Nachdem er das Haus, das ihm das ECDC in Solna, einem Stadtteil Stockholms besorgt hatte, eingerichtet hatte, zogen Alina und Chloé zu ihm nach. Chloé war zur Welt gekommen, als er noch am Max-Planck-Institut in Tübingen an seiner Promotion arbeitete. Alina hatte ihr Studium bereits abgeschlossen und arbeitete halbtags als Lehrerin. Das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten war vermutlich aufgrund einiger seiner Publikationen in Fachjournalen auf ihn aufmerksam geworden. Er hatte sich am Max-Planck-Institut nie unwohl gefühlt und sicherlich hätte ihm das Kuratorium nach seiner Dissertation eine lukrative Stelle angeboten, aber das Angebot des ECDC war einfach zu verlockend gewesen. Selbst Alina, der der Gedanke, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, ein Grauen war, musste eingestehen, dass das Angebot, für die größte und wichtigste europäische Gesundheitsbehörde zu arbeiten, ungeahnte Chancen und Möglichkeiten eröffnete. Einige Abende hatten sie darüber diskutiert. Schließlich willigte sie ein, stellte aber die Bedingung, dass sie wieder stundenweise arbeiten wolle.
Eine Woche später teilte er der Direktorin des ECDC mit, dass er sich geehrt fühle und das Angebot gerne annehme. Schon wenige Wochen später fand Alina eine Stelle an einer deutschen Schule in Stockholm, an der sie fünfzehn Stunden die Woche Deutsch unterrichtete.
Das Hupen eines vorbeifahrenden LKW riss ihn aus seinen Gedanken. Er lächelte still in sich hinein. Nie hätte er gedacht, nach dem Studium eine solche Stelle zu bekommen. Seine größte Sorge galt immer seiner kleinen Familie. Würde er nach dem Studium in der Lage sein, sie angemessen zu versorgen? Durch die staatlichen Studien- und Lehrförderungen waren beachtliche Schulden zusammengekommen. Klar, vielen Akademikern erging es ähnlich, dennoch bereitete es ihm Unbehagen und ließ ihn zuweilen schlecht schlafen. Mit dem Gehalt, das das ECDC ihm zahlte, war ihm diese Sorge genommen.
Ein Blick auf die Uhr verriet, dass er noch genügend Zeit hatte. Er würde das ECDC in weniger als zehn Minuten erreicht haben. Klimpernd ließ er einige Münzen in die Glasschale auf dem Tresen fallen, bedankte sich und verließ den Laden.
Die Ladenbesitzerin lächelte ihm nach.
Damaskus – Syrien
– Einige Tage zuvor –
Er hatte soeben sein Nachmittagsgebet beendet und saß zufrieden im Schneidersitz auf dem Sitzkissen. Draußen herrschte immer noch eine drückende Hitze, weshalb er sich gebot, im Haus zu verweilen. Früher liebte er die Wärme, mittlerweile setzten ihm der Staub und die Hitze mehr zu, als er sich eingestehen wollte. Wie immer zu den Gebeten waren der Lärm und das Treiben für eine kurze Zeit verstummt. Aber bald würde das übliche Treiben auf den Straßen Damaskus’ wieder einsetzen und der damit verbundene Lärm aufbranden.
Er klatschte in die Hände und ein sehr junger Diener eilte in den Raum.
»Hukka und Çay«, raunte er.
Wenige Augenblicke später kehrte der Junge zurück und servierte seinem Herrn Tee und eine Wasserpfeife, welches er beides vorsichtig auf einem kleinen Holztischchen neben ihm abstellte und sich wortlos entfernte.
Mit Daumen und Zeigefinger nahm er das Glas auf und inhalierte mit geschlossenen Augen den Duft des mit Ceylon Zimt aromatisierten Tees.
Er betrachtete die rissige braune Ledermappe, die vor ihm lag. Bedächtig öffnete er den Verschluss und entnahm ihr einen Stapel Papier, den er sorgfältig vor sich ausbreitete.
Paffend studierte er die Unterlagen, die Salim ihm gemailt hatte. Vor ihm lagen mehrere Seiten eng beschriebenen Papiers, Ausdrucke von Stadtplänen und Bilder mehrerer Gebäude. Er hatte Salim beauftragt, ihm so viel wie möglich an Informationen zu beschaffen, und Salim hatte gute Arbeit geleistet. Langsam blies er den Rauch seiner Pfeife aus und nippte an seinem Teeglas. Mit spitzen Fingern griff er sich eines der Fotos, die zu seinen Füßen lagen, und studierte eingehend das Gesicht des jungen Mannes darauf. Eine blonde, auffallend schöne Frau stand eng an seiner Seite und hielt strahlend ein Kleinkind im Arm. Ein Lächeln spielte um seinen Mund. Nickend brummte er zufrieden.
Ravensburg
Froh, endlich zu Hause zu sein, warf David achtlos seinen Schlüsselbund auf die Bar in der Küche, streifte seine Umhängetasche ab und ließ sich im Esszimmer auf einem Stuhl nieder. Er beugte sich vorn über, um seine Stiefel aufzuschnüren. Etwas behinderte ihn. Ihm wurde bewusst, dass er noch seine Waffe trug, und ärgerte sich, dass er vergessen hatte, sie auf der Dienststelle im Waffenfach zu verstauen. Seufzend erhob er sich, zog die Waffe aus dem Holster, ließ das Magazin aus dem Griff gleiten und verstaute sie im Tresor im Büro. Den Wandtresor hatte er während der Bauphase einmauern lassen.
Damals noch Mitglied eines Mobilen Einsatzkommandos war es oft unvermeidbar, seine Dienstwaffe mit nach Hause nehmen zu müssen.
Er trat gerade aus dem Büro, als sich ein Schlüssel im Schloss der Haustür drehte.
»Hallo, Schatz!«, schlug es ihm entgegen.
Seine Frau kam zwischen den Bezirken, in denen sie Briefe zustellte, oftmals kurz nach Hause, um noch einen Kaffee zu trinken, bevor sie die nächste Tour begann.
»Hallo, Schatz!«, entgegnete David.
»Wie war dein Nachtdienst?«, sagte sie und küsste ihn auf die Stirn.
»Chaotisch!«
»Wieso, was war?« Sie betätigte den Knopf der Kaffeemaschine, die sofort zu brummen begann.
»In der Asylunterkunft in Ravensburg sind zwei Männer mit Messern aufeinander los. Kaum waren wir dort fertig, haben sich dreißig Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen in die Wolle bekommen.
Gab einige Verletzte. Nicht genug damit, hatten wir in der Oberschwabenklinik noch eine Krankenhausleiche.«
»Oje, dann gehst du jetzt erst mal ins Bett. Du kannst mir ja heute Mittag davon erzählen. Ich muss auch gleich wieder los, ich habe viele Briefe heute und jede Menge Werbung.«
Sie hob die Tasse zum Mund. »David, wir sollten heute noch dringend einkaufen!«
»Hm«, brummte er müde.
»Ich muss los. Willst du meinen Kaffee weitertrinken?«
Sie griff nach ihrer Jacke und verschwand so schnell, wie sie gekommen war.
Er saß noch eine Weile und blickte dumpf in die dampfende Tasse in seiner Hand. Seit über fünfundzwanzig Jahren war er Polizist mit Leib und Seele. Nach seiner Zeit beim MEK war er acht Jahre Ermittler in einem OK-Dezernat und wechselte vor drei Jahren zum Kriminaldauerdienst. Er hatte befürchtet, dass ihm die Umstellung vom Tages- auf den Schichtdienst mehr zu schaffen machen würde. Es war auch nicht der Schichtdienst, der ihm in der letzten Zeit an die Substanz ging. Tausende von Flüchtlingen waren in den letzten Wochen über Deutschlands Grenzen gekommen. Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Eritrea, Somalia, Ägypten, Pakistan, selbst aus den Balkanländern, welche alle über die Balkanroute, letztlich über Ungarn und Österreich, wie eine gewaltige Welle in Deutschland anbrandeten und das Land, nach Meinung vieler, schier überfluteten. Keines der europäischen Länder war für einen Ansturm dieser Größenordnung gewappnet. Die Bundespolizei stieß personell seit Langem an ihre Grenzen und war nur noch mit der Registrierung der Flüchtlinge beschäftigt. Es verging kein Tag, an dem nicht irgendwo irgendwelche Schleuser Flüchtlinge auf die Straße entließen und sie einem ungewissen Schicksal überließen. Deutschland war gespalten und in vielen schwelte eine diffuse Angst, die nicht recht zu fassen war. Hieß man die Flüchtlinge willkommen, galt man als konform, äußerte man sich jedoch nur leise kritisch über die hohen Flüchtlingszahlen oder brachte seinen Unmut zum Ausdruck, lief man Gefahr, politisch denunziert zu werden. Die Angst war groß, nicht offensichtlich, aber doch latent vorhanden. Er konnte sich dieser Angst nicht entziehen. Obwohl seine Angst eine andere war. Mit den steigenden Flüchtlingszahlen schnellten in allen Bundesländern explosionsartig die Zahlen der registrierten Straftaten in die Höhe. Auf politischer Ebene wurde das natürlich negiert. Die Zahl der Gewaltdelikte schlug hierbei besonders zu Buche. Was ihn so erschreckte war weniger die Quantität als vielmehr die Qualität der Delikte. Es erschütterte ihn, mit welch einer Brutalität und menschenverachtenden Grausamkeit hierbei vorgegangen wurde. Immer häufiger erreichten ihn auch Berichte, in denen Frauen anzügliche Bemerkungen bis hin zu sexuellen Beleidigungen über sich ergehen lassen mussten oder gar sexuell angegangen wurden. Das alles machte ihm zu schaffen.
Stockholm
Salim klappte den Deckel seines Laptops zu. Ein zufriedenes Lächeln umspielte seine Lippen. Die Antwort auf seine Mail, mit der er die Dokumente verschickt hatte, war endlich eingegangen. Noch größere Freude bereitete ihm der Eingang der Zahlung auf seinem Schweizer Online-Konto.
Salim saß in seinem Zimmer der winzigen Wohnung in den Hårdsgängen. Sie war nichts Besonderes und billig war sie auch nicht. Aber sie bot den Vorteil, dass sie nur knapp zehn Gehminuten von der Uni entfernt lag. Die Wohnung teilte er sich mit einem anderen Studenten, einem Schweden, der irgendwo aus der Nähe von Malmö stammte. Vor fünfzehn Monaten war Salim nach Stockholm gekommen, nachdem er ein Stipendium bekommen hatte. Er entstammte einer großen und angesehenen Familie. Sein Vater, ein Kaufmann, hatte es mit dem Handel von erlesenen Gewürzen zu stattlichem Wohlstand gebracht. Sie lebten in Ithrat, einer kleinen Stadt nahe der jordanischen Grenze.
Er hasste die Kleinstadt inmitten des Nirgendwo und war froh, als sein Vater ihn nach Riad schickte, um zu studieren. Von all seinen Brüdern galt er als der Vielversprechendste. Sein älterer Bruder würde bald in die Fußstapfen seines Vaters treten und dessen Geschäfte weiterführen, die anderen würden im Geschäft seines Vaters mitarbeiten. Salim war glücklich gewesen, Ithrat endlich verlassen zu können. Er hatte sich für Biologie eingeschrieben und hatte drei Jahren später seinen Bachelorabschluss mit Auszeichnung in der Tasche, was ihm auch das Stipendium einbrachte. Das Stipendium bot ihm die Möglichkeit, an einer europäischen Universität seiner Wahl seinen Master-Abschluss zu machen. Der Bereich der Humanbiologie, besonders die Epidemiologie, die Disziplin, die sich mit der Ursache und Verbreitung von Krankheitserregern beschäftigt, hatte es ihm besonders angetan.
Salim war in Hochstimmung und überlegte, was er heute Abend tun könnte, als sein Handy klingelte.
»Salam Aleikum.«
»Aleikum salam, Bruder«, grüßte Salim zurück.
Es war Ahmad, der an seiner Uni im vierten Semester Informatik studierte.
»Schon was vor heute Abend?«, fragte Ahmad.
»Ich will feiern. Und ich will ficken«, entgegnete Salim.
»Dann lass uns ins Pet gehen«, schlug Ahmad vor.
»Das Pet?«, entgegnete Salim.
»Eine Rockbar in der Altstadt. Geiles Bier und geile Weiber, Bruder.«
»Dann sehen wir uns heute Abend?«
»Alles klar! Bis heute Abend.« Salim raffte seine Jacke und verließ die Wohnung.
ECDC
Patrick Sprenger stellte seinen Wagen auf dem noch leeren Parkplatz in der Nähe des Haupteingangs ab, betrat das Gebäude und chippte sich an einem der Terminals ein. Es ging hierbei weniger um die Erfassung der Arbeitszeit als vielmehr um das Personalmanagement, um im Krisenfall sofort einen Überblick zu haben, wer alles im Haus war. Die Direktorin des Zentrums gestattete ihnen, die Arbeitszeiten sehr liberal zu gestalten. So gab es Kollegen, die so wie er sehr früh kamen, und einige andere, die erst gegen neun oder zehn Uhr im ECDC eintrafen. Er drückte auf die Taste am Fahrstuhl und die Türen glitten beinahe geräuschlos auseinander. Es war ein beeindruckendes Gebäude, neu und modern. Das ECDC war erst im Mai 2005 eröffnet worden. Nach dem Vorbild des US-amerikanischen Pendants wurde die europäische Seuchenschutzbehörde als Agentur der EU eingerichtet. Das ECDC war weltweit mit den bedeutendsten Laboren und Instituten vernetzt.
Seit neun Monaten leitete er nun schon die SRS Unit, die Surveillance and Response Support Unit.
Ein Team, bestehend aus acht Seuchenexperten, garantierte eine 24-stündige Bereitschaft, das im Fall des Ausbruchs einer unbekannten Krankheit vor Ort entsandt würde, um die Krankheit zu spezifizieren und wenn möglich einzudämmen.
In den überwiegenden Fällen bekamen sie aus den europäischen Mitgliedsländern Proben zur Spezifikation übersandt, welche von seinem Team analysiert, mit Datenbanken abgeglichen, katalogisiert und eingelagert wurden. Der Job im ECDC hatte ihn von Anfang an gereizt. Die Vorstellung, in der reinen Forschung in irgendeinem Labor zu versauern, behagte ihm nicht. Er wollte etwas Bedeutenderes, etwas verändern, etwas bewegen. Und die Möglichkeit zu reisen kam ihm dabei noch zugute.
Die Lifttüren glitten auseinander und er betrat seinen Arbeitsbereich in der vierten Etage. Er tippte seinen achtstelligen Code in das Keypad und betrat sein Büro am Ende des Ganges, ein schöner, lichtdurchfluteter Raum. Bedauerlicherweise war es ihm noch immer nicht gelungen, dem Raum eine etwas persönlichere Note zu verleihen, außer einem Ficus, den er am Fenster platziert hatte. Er streifte sich das Jackett ab und drapierte es über die Lehne seines Bürosessels.
Es war ungewöhnlich ruhig an diesem Morgen. Üblicherweise hörte man aus einigen Büros schon Stimmen oder Musik. Er nahm seinen Pappbecher mit dem mittlerweile lauwarmen Cappuccino und ging den Gang hinunter zum Sicherheitslabor. Hier herrschten wesentlich höhere Sicherheitsstandards. Mit seiner Key-Karte und der Eingabe eines weiteren zehnstelligen Codes öffnete sich klickend die Stahltür. Der Laborbereich bestand aus einem großen fensterlosen Raum. Darin befand sich ein durch dickes Sicherheitsglas getrenntes Hochsicherheitslabor, ein an sich nicht mehr als acht mal acht Meter messender Glaskasten. Darüber befand sich ein spezielles Belüftungs- und Absaugsystem. Dem Laborkasten konnte quasi im Ernstfall die komplette Atmosphäre entzogen werden. Hier befanden sich diverse technische Laborgeräte, wie Brutschränke, Zentrifugen, Mikroskope und sterile Werkbänke. Dem eigentlichen Laborraum vorgelagert, war ein Schleusensystem mit hochtechnisierten Dekontaminationsanlagen. Als er den vorgelagerten Arbeitsbereich betrat, erkannte er durch die Panzerscheibe zwei seiner Teamkollegen, die sich zu unterhalten schienen.
Sie trugen blaue Vollschutzanzüge mit autarker Pressluftversorgung. Er trat an die Scheibe und drückte die Sprechtaste der Gegensprechanlage.
»Guten Morgen, P.A., guten Morgen, Helena!«, begrüßte er sie auf Englisch.
Unisono kam ein »Guten Morgen« aus der Sprechanlage zurück. Helena winkte ihm lächelnd zu.
»Haben wir was?«, fragte er.
»Mit dem letzten Kurier kam heute Nacht eine Probe aus Spanien. In einer Madrider Klinik liegt ein Patient auf der Isolierstation. Die Ärztin, warte, eine Dr. Velasquez, vermutet einen Ebola-Erreger. Zumindest deute laut Infektionsverlauf alles darauf hin.« P.A. blätterte durch einige Unterlagen. »Ja warte, hier. Patient nach Afrikareise in der Remissionsphase mit grippeähnlichen Symptomen eingeliefert worden. Stationäre Aufnahme erfolgt… bla, bla, bla…, Ausbildung von Petechien und Ekchymosen, dorsal und abdominal, hämorrhagisches Fieber mit Schleimhautblutungen und so weiter so fort. Deutet schon alles darauf hin«, kommentierte P.A.
»Wie steht es um den Patienten?«, erkundigte sich Patrick Sprenger.
»Nicht gut«, entgegnete Helena. »Er ist zwar stabil, aber laut Befund versagen nach und nach die Organe.«
Patrick nippte an seinem Pappbecher und verzog angewidert das Gesicht. Der Cappuccino war mittlerweile kalt geworden.
»Konntet ihr die virale RNA schon sequenzieren?«
Helena kam P.A. zuvor. »Wir haben die Probe vorhin schon aufgereinigt für eine RT-PCR. Die Reaktion läuft gerade und sobald wir so weit sind, starten wir die Gelelektrophorese. Erst anschließend können wir die Probe sequenzieren.«
»O. k.«, nickte Patrick zustimmend. »In was habt ihr die Lösung angesetzt?«
»Aufgereinigt in Chloroform und Isopropanol, gelöst in RNAse-freiem Wasser«, schnarrte P.A.s Stimme aus der Gegensprechanlage.
»Gut, lasst mich wissen, wenn ihr so weit seid.«
Dieses Verfahren diente dem Zweck, den Virus anhand seiner genetischen Sequenz eindeutig zu identifizieren, die anders als bei Pflanzen und Tieren nicht in Form von DNA, sondern einer kompakteren Form, der RNA, vorliegt. Die virale RNA musste also erst einmal biochemisch in die stabilere DNA umgewandelt werden, damit die genetische Sequenz ausgelesen werden konnte.
Er wollte sich schon abwenden, als Helena gegen die Scheibe klopfte. Erneut drückte er den Knopf der Sprechanlage.
»Du gehst nicht zufällig in der Cafeteria vorbei?«
»Du Nervensäge!«, lachte er. »Was willst du denn, du neunköpfige Hydra?«
»Die haben montags immer diesen leckeren Käsekuchen. Und der ist mittags meistens schon ausverkauft. Bringst du mir ein Stück mit?«
»Klar! P.A. willst du auch was?«
Ohne von seinen Unterlagen aufzusehen, grummelte P.A. etwas, das er als »Nein« interpretierte.
Die Cafeteria lag nun nicht gerade zufällig auf seinem Weg. Aber er musste zugeben, dass der Käsekuchen aus der Cafeteria wirklich ein Gedicht war, erst mit Helenas Erwähnung desselben bekam er Appetit darauf.
Er verließ das Labor und ging den Gang hinunter. Patrick mochte die beiden sehr. Helena, eine Griechin, die an der Piräus Universität in Athen studiert und in Biochemie promoviert hatte, war, wenn er sich recht entsann, bereits seit drei Jahren am ECDC. Über P.A., eigentlich Peer Arne Larsson, wusste er sehr wenig. Was er jedoch wusste, war, dass P.A. es hasste, Peer Arne genannt zu werden, und dass er einen sehr trockenen Humor besaß.
Der Schwede war ein Hüne und wirkte in den Laboren oft deplatziert. Patrick war der einzige Deutsche am ECDC. Er hatte seine Kollegen zu Beginn gefragt, ob jemand Deutsch spräche, was allgemein verneint worden war. Kaum zwei Wochen nachdem er am Zentrum angefangen hatte, sprach ihn P.A. eines Morgens auf Deutsch an. »Hey, Patrick. Hast du eigentlich Haare in die Nase?«
Verdutzt und überrumpelt ob der Tatsache, von P.A. auf Deutsch angesprochen zu werden, antwortete er: »Ja, bestimmt, wieso?«
»Weil, ich hab welche am Arsch, die können wir ja zusammenknoten.« Im Labor brach schallendes Gelächter aus.
Auf die Frage, seit wann er denn Deutsch spreche, gab P.A. zurück, dass »Das Boot« einer seiner Lieblingsfilme sei und dies der einzige Satz auf Deutsch sei, den er könne.
Patrick gefiel P.A.s Affinität für Filme, da er selbst ein großer Filmfan war. In den folgenden Wochen machten sie sich oft einen Spaß daraus, zu diversen Gelegenheiten Filmzitate zu rezitieren.
Die Lifttüren glitten auseinander. Sein Handy piepte in dem Augenblick, als er den Aufzug betrat. Eine Nachricht von Alina, in der sie fragte, ob er Zeit habe, kurz zu telefonieren.
Er wählte ihre Nummer und wartete auf das Freizeichen. Nach dem zweiten Klingeln hörte er ihre Stimme.
»Hi, Schatz. Alles klar bei dir?«
»Ja, bei mir ist alles klar. Seid ihr gut aus dem Bett gekommen, ihr beiden?«
»Die Kleine war schon etwas quengelig heute Morgen und wollte sich nicht anziehen lassen.«
»Wann musst du los?«, wollte er wissen.
»Ich warte noch auf Arjona. Sie müsste jeden Moment kommen, dann fahre ich los.«
Arjona war das Kindermädchen, das sie, seit Alina ihre Lehrtätigkeit an der DSS-Schule in Stockholm aufgenommen hatte, für die wenigen Stunden engagiert hatten.
»Wie viele Stunden hast du heute?«
»Nur vier Stunden Deutsch in zwei Klassen.«
»Gut, dann sehen wir uns heute Abend. Sollen wir essen gehen?«
»Oh ja, das wäre schön.«
»Prima, ich freue mich auf dich. Ich liebe dich und gib der kleinen Maus einen Kuss von mir.«
»Das mache ich. Ich liebe dich auch.«
»Bye, Schatz.«
Mit einem hellem »Bing« kam der Lift zum Halt und die Türen glitten auseinander. In der Cafeteria bestellte er drei Stücke des Käsekuchens, da er vermutete, dass P.A. nicht würde widerstehen können, wenn er den Kuchen sah.
Zurück in seinem Büro angekommen, startete er den Rechner und wartete, bis das Betriebssystem hochgefahren war. Sein Mailprogramm wies ihn auf den Eingang von sechsundvierzig neuen Mails hin. Er startete das Programm und begann zu lesen.
Ravensburg
David hatte unruhig geschlafen, obwohl er um sieben Uhr völlig erschlagen ins Bett gegangen war, nachdem er den Kaffee seiner Frau ausgetrunken und dabei eine Zigarette geraucht hatte. Es war kurz vor elf. Er überlegte, ob er sich noch einmal umdrehen sollte, entschied sich aber dagegen. Er würde eh nicht mehr richtig schlafen und wenn, Gefahr laufen, mit Kopfschmerzen zu erwachen.
Er schlug die Bettdecke zurück, zog den Rollladen nach oben und öffnete das Fenster. Es versprach, ein schöner Tag zu werden. Ende September war das hier in der Gegend keine Selbstverständlichkeit. Durch den nahe gelegenen Bodensee gab es häufig Nebel, der sich hartnäckig zu halten vermochte, auch wenn andernorts die Sonne schien.
Er stieg die Treppe ins Erdgeschoss hinunter, betrat die Küche und startete die Kaffeemaschine. Er legte ein Kaffee-Pad in die Halterung, schob die Tasse darunter und drückte den Startknopf. Gurgelnd troff der Kaffee in die Tasse.
»Die pfeift auch langsam auf dem letzten Loch«, ging es ihm durch den Kopf. Sie würden nicht umhinkommen, bald eine neue Maschine kaufen zu müssen.
Mit dem Becher Kaffee in der Hand setzte er sich auf die Teakbank vor dem Haus, zündete sich eine Zigarette an und inhalierte den Rauch. Er ließ den Blick durch den Garten schweifen. Der Rasen sollte mal wieder gemäht werden, die Hecken sollte man stutzen und das Unkraut schuf sich auch immer mehr Raum. Er gemahnte sich, das in den nächsten Tagen zu erledigen.
Auf der anderen Seite drängte es ihn vielmehr, das schöne Wetter für eine Motorradausfahrt zu nutzen. Er schaltete sein Handy ein, checkte, ob er irgendwelche Mails bekommen hatte.
»Immer diese scheiß Spam-Mails«, brummte er missmutig.
Er öffnete seinen Messenger und schickte seinem Sohn eine Nachricht.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. »Klar können wir heute Abend telefonieren, Paps. Gegen neunzehn Uhr?«
Obwohl es keinen Tag gab, an dem sie sich nicht die eine oder andere Nachricht schickten, freute er sich sehr darauf, wieder seine Stimme zu hören.
Im Telefonbuch seines Handys suchte er die Nummer eines Kollegen heraus und wählte.
»Hey, Piwi, hast du Lust, ne Runde laufen zu gehen? Du hast doch auch frei heute, oder?«
»Prima, bis gleich.«
Pit Wilkens war ein Kollege von der Bundespolizei. Sie hatten sich 2000 im Auslandseinsatz im Kosovo kennengelernt. Pit, der aus Niedersachsen kam, war zu dieser Zeit noch bei der GSG 9 in St. Augustin.
Beide hatten sie für eine kurze Zeit zusammen in einer Sondereinheit der UN-Polizei in Priština Dienst gemacht, aber irgendwie hatten sie sich nach dem Kosovoeinsatz aus den Augen verloren, bis sie sich nach fast vier Jahren zufällig in Konstanz bei einer Razzia auf eine Drogendisco wiedertrafen. Pit hatte seine Dienstzeit bei der GSG 9 altershalber beenden müssen und war auf eigenen Wunsch hin nach Konstanz zur Grenzschutzinspektion versetzt worden. Er hatte schon immer Hunde geliebt und auch besessen, weshalb er sich beim Bundespolizeipräsidium zum Hundeführer ausbilden ließ.
Für die Razzia war er mit seinem Drogenspürhund angefordert und zugeteilt worden.
Piwi hatte über achtzehn Dienstjahre bei der Grenzschutzgruppe 9 zugebracht und in dieser Zeit viel erlebt und gesehen. David hatte Piwi mehrfach, bei dem einen oder anderen Bier, zu überreden versucht, von seinen Einsätzen zu erzählen.
Piwi hatte immer nur gelacht und gesagt: »Ich könnte dir natürlich davon erzählen, müsste dich aber anschließend sofort liquidieren.«
David hatte es dann dabei belassen, aber er wusste, dass Piwi in diesen achtzehn Jahren viel in der Welt herumgekommen war. Libyen, Tschad, Libanon, Saudi-Arabien, Jemen, Oman, Algerien, Somalia und Bolivien. Während er 2010 noch einmal für ein Jahr im Kosovoeinsatz war, hatte es Piwi 2011 und 2013 als Ausbilder nach Afghanistan verschlagen. In den beiden Jahren bildete er dort Sondereinheiten an der Polizeiakademie in Kabul aus.
Piwi war ein Brummbär, der wenig redselig war und der nach seiner Scheidung vor einem Jahr, kurz nachdem er 2014 aus Afghanistan zurückkam, quasi in seine Nachbarschaft gezogen war. Er hatte schnell eine Wohnung gebraucht, da Piwis »Nachfolger« schon eingezogen war.
David konnte ihm ein paar Straßen weiter eine Wohnung vermitteln.
David leerte seinen Kaffee und ging ins Haus, um sich die Joggingklamotten anzuziehen.
Kaum dass er in seine Laufschuhe geschlüpft war, klingelte es schon an der Tür.
»Na, alles fit im Schritt?«, fragte Piwi breit grinsend, als David die Tür öffnete.
»Nö«, gab er zurück. »Aber dir laufe ich allemal davon, alter Mann.«
Er zog die Tür hinter sich ins Schloss und sie trabten los.
ECDC
Es war beinahe Mittag, bis er schließlich alle Mails gelesen, beantwortet oder weitergeleitet hatte. Die meisten waren unwichtige oder für ihn bereits obsolet gewordene Meldungen.
Patrick lehnte sich in seinem Stuhl zurück und überlegte gerade, wohin sie heute Abend essen gehen könnten, als sein Telefon ihn aus seinen Überlegungen riss.
»Sprenger«, meldete er sich.
»Helena hier, die neunköpfige Hydra.« Er konnte sie förmlich grinsen hören.
»Hast du meinen Käsekuchen?«
»Klar hab ich den. Hab ich dich schon mal vergessen?«
Ihre Antwort war ein herzliches Lachen.
»Wo treffen wir uns?«, fragte er sie.
Helena schlug vor, auf die Dachterrasse zu sitzen. Sie würde den Kaffee mitbringen.
Zehn Minuten später saßen er, Helena und P.A. auf der Dachterrasse. Der Sonnenaufgang vom Morgen hatte vermuten lassen, dass es ein milder, sonniger Spätsommertag werden würde. Irgendjemand hatte in der Vergangenheit vier Plastikstühle auf das Dach des Gebäudes gebracht. P.A., der die Dachterrasse für eine gelegentliche Rauchpause nutzte, hatte die Stühle entdeckt. Vermutlich waren diese schon seit Langem in Vergessenheit geraten.
Es war so, wie er vermutet hatte.
Als er den Kuchen aus dem Papier wickelte und P.A. sah, dass ein drittes Stück auf der Pappunterlage war, fingen seine Augen an zu leuchten.
»Dachte ich’s mir doch.«
Patrick musste unweigerlich grinsen.
Er reichte jedem ein Stück Kuchen. In diesem Moment fühlte er sich unheimlich wohl.
Sie genossen die Sonne, den Kuchen und den Kaffee, den Helena aufgebrüht hatte. Sie hielt nichts von Kapselkaffee oder Kaffeepads. Sie war der Ansicht, dass Kaffee nur gut sein könne, wenn er aufgebrüht wurde. Patrick konnte das nicht so gut beurteilen, da er eigentlich nicht der klassische Kaffeetrinker war. Klar, früh morgens nach dem Aufstehen half es ihm, auf Touren zu kommen. Zumindest bildete er sich das ein. Aber Helenas Kaffee schmeckte wirklich wunderbar.
»Wie weit seid ihr mit der Probe aus Madrid?«, erkundigte er sich.
»Helena hat die DNA sequenziert. Die DNA des Virenstamms selbst hat mit dem Stamm des Ebola-Virus, welches letztes Jahr in Guinea aufgetreten war, eine starke Ähnlichkeit. Ich habe sie mit allen vier den uns bekannten Stämmen abgeglichen. Der Stamm ist ähnlich, aber doch nicht derselbe«, erklärte P.A.
Die Ebola-Viren gehören zur Familie der Filoviridae, welche sich durch eine fadenförmige Struktur auszeichnen – hierzu wird auch das seltenere, aber mindestens genauso gefährliche Marburg-Virus gezählt. In der Vergangenheit hatte man die Viren ihrer Herkunft nach in die vier Stämme, Sudan, Zaire, Elfenbeinküste und Reston, spezifiziert.
»Habt ihr schon eine quantitative Analyse durchgeführt?«, wollte Patrick wissen.
»Ich habe bereits eine Zellkultur angelegt und sie mit dem Virus infiziert. In zwei Stunden sollten wir mehr wissen«, entgegnete P.A.
»Hast du die NCBI-Datenbank mal mit diesen Sequenzen durchsucht?«
»Ja klar«, sagte P.A., »ich habe die Sequenzen in die Suchdatenbank eingegeben.«
»Und?«
»Dort bin ich leider nicht fündig geworden. Allerdings habe ich im hauseigenen Katalog über CLC eine Primärstruktur gefunden, die in ihrer Grundstruktur schon noch die des uns bekannten Ebola-Erregers ist. Aber, wie gesagt, anders.«
»Das müssen wir uns auf jeden Fall genauer anschauen«, antwortete Patrick.
»Lasst uns ins Labor zurückgehen.«
Stockholm
Salim erwachte kurz vor zehn Uhr. Orientierungslos blickte er sich zunächst um, bis ihm klar wurde, dass er in seinem Bett lag. Er konnte sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wann und wie er nach Hause gekommen war. Entgegen seinen Gewohnheiten hatte er mehr getrunken, als er beabsichtigt hatte. Er erschrak, als er plötzlich eine Bewegung neben sich wahrnahm. Als er die Decke etwas zur Seite hob, sah er einen blonden Haarschopf. Und noch viel weniger konnte er sich an diese fremde Frau erinnern, die da neben ihm nackt in seinem Bett lag und sich nun zu ihm umdrehte.
»Guten Morgen«, sagte sie verschlafen.
Schweigend entstieg er dem Bett und watschelte nackt ins Badezimmer, klappte die Klobrille hoch und erleichterte sich. Da ihm schwindelig war, musste er sich mit einer Hand an der Wand abstützen. Nachdem er gespült hatte, trat er vor den Spiegel und betrachtete kritisch sein unrasiertes Gesicht. Seine Züge waren fein geschnitten und er hatte einen dunklen, orientalischen Teint.
Die Augen waren groß und von einem für seinen Volksstamm völlig untypischen Blaugrün. Seine jordanische Mutter hatte blaue Augen, die sie selbst offenbar von ihrem amerikanischen Vater geerbt hatte. Er kam sich selbst fremd vor ohne seinen Vollbart, den er über Jahre gepflegt hatte. Auch die Haare musste er sich kurz schneiden, was ihm jedoch leichter fiel, als sich den Bart abzunehmen.
Egal, bald würde er ihn wieder stehen lassen können. Salim hatte sich freiwillig gemeldet, aber alles hier war ihm fremd, unwirklich und verhasst. Ihre ganze gottlose, frevel- und lasterhafte Lebensart. Und erst recht die ganzen ehrlosen, unzüchtigen Frauen. Sie alle waren dreckige Huren, die sich für ein paar spendierte Drinks und ein paar geheuchelte Komplimente bereitwillig von ihm ficken ließen.
Sie alle waren nur Schweine, die sie schon in naher Zukunft zur Schlachtbank führen würden. Schon sehr bald! Er wandte sich vom Spiegel ab und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Das Pling seines Handys signalisierte ihm, dass eine Nachricht eingegangen war. Ohne die Frau in seinem Bett zu beachten, setzte sich Salim auf die Bettkante.
»Raus!«, forderte er.
Verwirrt sah sie ihn an.
»Schau mich nicht so blöd an, verpiss dich endlich.«
Hastig sprang sie aus dem Bett und raffte ihre Kleider zusammen, die überall im Zimmer verstreut lagen, und verschwand im Badezimmer.
Salim entsperrte sein Handy und las stirnrunzelnd die kurze Nachricht.
»Sehr gut«, murmelte er. »Jetzt endlich geht es los.«
Er öffnete seinen WhatsApp-Messenger und tippte die Nummer, die er auswendig kannte, in das Adressfeld. In das Textfeld schrieb er nur ein einziges Wort: Inshallah. Dann drückte er auf Senden.
Er sah aus dem Fenster und war von einer undefinierbaren Spannung erfüllt. Klackend fiel die Wohnungstür ins Schloss. Die Hure war gegangen.
ECDC
Helena, P.A. und Patrick stiegen gerade die Treppe vom Dach ins Labor hinab, als das Handy in seiner Tasche vibrierte. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, bei der Arbeit sein Handy auf lautlos zu stellen. Persönlich empfand er es als unhöflich, wenn in Gegenwart anderer ständig ein Handy klingelte oder ein Pling den Eingang von mehr oder weniger wichtigen Nachrichten verkündete. Patrick war kein Feind der modernen Kommunikationstechnik. Ganz im Gegenteil. Er selbst nutzte die sozialen Netzwerke und diversen Messenger regelmäßig, um mit Freunden, Bekannten und seiner Familie in Kontakt zu bleiben. Dennoch fand er es belästigend, wenn ständig irgendwelche Handys piepten.
Patrick entschuldigte sich bei Helena und P.A. und ließ sich etwas zurückfallen. Er wischte über das Display und nahm das Gespräch an.
»Hey, Schatz! Hast du Sehnsucht nach mir?«
»Nein! Doch natürlich, aber deswegen rufe ich nicht an. Hat Arjona dich angerufen und gesagt, dass sie mit Chloé rausgeht?«
»Nein, wieso hätte sie das tun sollen?«
»Sie waren nicht da, als ich heimgekommen bin.«
»Hat sie keine Nachricht hinterlassen?«
»Nein«, sagte Alina.
»Vielleicht machen die beiden nur einen Spaziergang oder sind auf den Spielplatz gegangen.«
»Hm, könnte sein. Na ja, sie werden bestimmt bald da sein. Duuuu«, säuselte sie ins Telefon, »ich freue mich schon sehr auf heute Abend und auf dich. Soll ich Arjona fragen, ob sie heute Abend zwei oder drei Stunden auf die Kleine aufpassen kann?«
»Das wäre großartig! Ja, frag sie mal. Ich freu mich auch, Schatz. So wie es bis jetzt aussieht, werde ich auf jeden Fall pünktlich zu Hause sein. Bis heute Abend.«
Ravensburg
Die letzten zweihundert Meter legten sie im Sprint zurück. David stieß einen triumphierenden Schrei aus, als er als Erster die Haustür erreichte. Piwi schnaubte verächtlich.
»Du brauchst dich gar nicht so zu brüsten, du bist schließlich ein ganzes Stück größer als ich.«
»Was soll das denn jetzt heißen?«
»Na, dass ich wesentlich mehr Schritte laufen muss als du.«
David verdrehte die Augen und lachte.
»Wasser oder Bier?«
»Blöde Frage, ein Bier natürlich.«
David schloss die Tür auf, während Piwi sich schwer atmend auf der Teakbank niederließ.
Wenig später kehrte er mit zwei Flaschen Bier zurück und setzte sich neben Piwi.
»Fuck, wir werden alt, oder?!«, stellte David fest.
»Ist das eine Frage oder eine Feststellung?«, lachte Piwi.
»Ja, wir werden alt. Ich spüre das schon lange. Der Raubbau an meinem Körper in jungen Jahren rächt sich langsam. Überall fängt es an zu zwicken und zu reißen.«
David erhob sein Bier, prostete Piwi zu und sagte:
»Aber wir stehen immer noch gut im Strumpf.«
»So isses.« Piwi nahm einen tiefen Schluck und rülpste herzhaft.
Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander.
»Sag mal, fehlt dir das?«, fragte David.
»Fehlt mir was?«
»Na, die Gruppe?«
»Klar fehlt mir das. Mir schlafen in Konstanz die Füße ein. Es ist schon o. k., mit dem Hund immer unterwegs zu sein. Keiner redet mir rein… und ich kann ziemlich frei arbeiten. Aber es langweilt mich zu Tode.«
»Gehst du nochmal in einen Auslandseinsatz?«
»Würde ich gerne«, entgegnete Piwi, »aber ich bin gesperrt.«
»Wieso gesperrt?«
»Bei unserem Verein haben sie vor ein paar Jahren die Regelung eingeführt, dass jeder Beamte nur fünf Mal in eine Auslandsverwendung darf, dann eben nicht mehr.«
»Was ist das denn für ein Bullshit?«
»Eben«, maulte Piwi.
»Völlig bescheuerte Regelung.«
»Du warst zweimal im Kosovo, zweimal in Afghanistan und das fünfte Mal?«
»Sechs Monate in Ramallah.«
»Und das rechnen sie als volle Missionszeit an?«
»Offensichtlich«, grummelte Piwi. »Na ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dem deutschen Kontingentsleiter in Kabul die Nase gebrochen habe.«
David musste lauthals lachen.
»Würdest du nochmal gehen?«, hakte Piwi nach.
»Hm, weiß nicht. Würde mich schon nochmal reizen, aber Beate würde nicht mehr wollen, dass ich wieder ein Jahr weg bin.«
»Bea ist eine feine Frau. Du solltest das respektieren.«
»Mache ich ja«, sagte David. »Ich sagte ja nur, dass es mich reizen würde.«
Piwi leerte sein Bier und erhob sich. »So, Buddy, ich schlepp mich mal nach Hause. Ich brauche eine Dusche. Tust du mir einen Gefallen? Lass es bei unserem nächsten Lauf etwas lockerer angehen. O. k.?«
»Versprochen!« David grinste über beide Ohren.
ECDC
Patrick eilte den beiden ins Labor hinterher. Mittlerweile war auch der Rest seines Teams im Labor geschäftig zugange. Er begrüßte jeden einzelnen mit Handschlag und fragte, wie es ihnen ginge. Er streifte sich einen Laborkittel über und trat zu Helena und P.A.
»Also, was haben wir?«
P.A. saß vor einem Monitor und studierte eine Tabelle.
»Zeig Patrick mal die Basensequenz, die wir aus der Zellkultur sequenziert haben«, forderte Helena P.A. auf.
Auf dem Bildschirm erschien eine Buchstabenfolge, welche die dekodierte DNA des extrahierten Erregers zeigte.
»Wir haben die Kultur analysiert und können aktuell davon ausgehen, dass der Virus an Pathogenität zugenommen hat. Eine erneute Sequenzierung hat das ergeben, was du hier auf dem Schirm siehst. Das ist ein kleiner, fieser Zeitgenosse.«
Patrick starrte lange auf die Grafik. Etwas daran kam ihm seltsam bekannt vor.
»Welche Proteine werden durch diese Sequenz codiert? Hast du deine Suche auch auf unsere eigene Datenbank ausgeweitet?«, fragte er an P.A. gewandt.
»Nein, noch nicht, aber das mach ich sofort.«
P.A. wechselte die Anwendung und kopierte die DNA-Sequenz, fügte sie in das Suchfeld ihres Datenverwaltungsprogrammes ein und betätigte die Enter-Taste.
Das Programm durchforstete die Datenbank.
Wenige Sekunden später piepte der PC und auf dem Monitor erschien die Meldung:
Similar Match found
P.A. klickte die Datei an und auf dem Bildschirm erschien die Anzeige:
3‘ ntr – NP – VP35 – VP40 – GP – VP30(.99) – VP24 – L – ntr 5‘
(1995_Ebola_Kikwit_)
Die erste Code-Reihe bezeichnete die Abfolge der viralen Strukturproteine, die sich auf dem Genom befanden. Diese Proteine, die zwischen dem 3’-Ende und dem 5’-Ende lagen, hatten wichtige Funktionen für die Replikation der DNA sowie die Transkription der Gene, also das Auslesen der genetischen Information, inne. Zudem steuerten sie diese Prozesse und bedienten sich dabei oft der Strukturen der infizierten Wirtszelle.
»Hm«, brummte Patrick. »Diese Sequenz habe ich schon mal gesehen.«
»Du kennst unseren kleinen Freund hier?«, fragte Helena erstaunt.
»Nicht direkt. Im Rahmen meiner Forschungen, die ich damals am Robert-Koch-Institut durchführte, war ich sechs Wochen im Kongo unterwegs. Dort habe ich Bekanntschaft mit einem Epidemiologen gemacht, der 1995 im noch damaligen Zaire war, als dort in einem Dorf, namens Kikwit, Ebola-Verdachtsfälle bekannt wurden. 310 Menschen waren innerhalb kürzester Zeit infiziert. 282 starben. Das Virus hatte eine Letalitätsrate von über neunzig Prozent. Der Kollege schilderte mir, dass die Inkubationszeit neun bis zwölf Tage betrug.
Später hat man festgestellt, dass die Infektionsdosis bei nur ein bis zehn Viruspartikeln lag. Der Krankheitsverlauf war rasend schnell.« Patrick legte eine ausgedehnte Pause ein und blickte in die aufmerksamen Gesichter seiner Kollegen, ehe er fortfuhr.
»Also, was wissen wir? Wir haben einen ähnlichen Virenstamm, aber das Virus scheint mutiert zu sein. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben wir laut Sequenzabgleich in der fünften Sequenz beim Nukleokapsidprotein VP30 zur Madrider Probe eine Veränderung.«
Diese Veränderung wurde durch das Programm eindeutig durch die Kommazahl hinter der Proteinbezeichnung angegeben.
»Viel kann sich hier jedenfalls nicht verändert haben«, dachte Patrick, »die Sequenzen gleichen sich zu neunundneunzig Prozent.«
»Helena, kontaktiere bitte diese Ärztin, wie war noch ihr Name, Velasquez, in Madrid. Sie soll den Patienten absolut isoliert halten. Und sie soll nochmal Proben seines Blutes schicken. Ich will das einhundertprozentig verifiziert haben.«
»Schon so gut wie erledigt, Chef!«, entgegnete sie schelmisch. »Wäre es nicht auch ratsam, die Ärztin nach weiteren Informationen bezüglich der Afrikareise des Infizierten zu fragen?«
»Das wäre mir fast entgangen. Danke, Helena! Sie soll zudem ihre nationale Seuchenschutzbehörde benachrichtigen, wenn sie es nicht schon getan hat. Möglicherweise müssen wir mit weiteren Infizierten rechnen. Was denkst du, wann haben wir die Proben?«
Helena zuckte mit der Schulter.
»Weiß nicht genau, wenn es gut läuft, sollten sie am späten Abend hier sein. Sonst morgen Vormittag.«
»Alles klar! P.A., du spielst bitte die DNA-Sequenz aus der Madrider Probe in die Datenbank ein. Solange wir nicht wissen, wo in Afrika sich der Patient infiziert hat, klassifizierst du es mit der Bezeichnung:
2015_09_21_EBOV_Madrid
»Ich muss ein paar Anrufe tätigen. Danke euch, das war super Arbeit.«
In sein Büro zurückgekehrt, ließ Patrick sich in seinen Sessel fallen und rief sich ins Gedächtnis, wen er vorrangig informieren musste.
Es war 12:32 Uhr. Er fragte sich, ob er sie um die Mittagszeit überhaupt in ihrem Büro erreichen würde. Patrick wählte die Nummer der Direktorin. Blanka Gergely, eine Ungarin Anfang fünfzig und seit vier Jahren Leiterin des ECDC. Als Medizinerin war sie viele Jahre für Ärzte ohne Grenzen und zuletzt für die WHO in allen Teilen der Welt unterwegs. Sie war es auch, die ihn für das ECDC angeworben hatte.
Er war noch immer nicht dazu gekommen, sie zu fragen, wie genau sie auf ihn aufmerksam wurde oder was zu der Entscheidung geführt hatte, ihn ans ECDC zu holen.
Gergely nahm beim ersten Klingeln den Hörer ab.
»Ja, bitte?!«, meldete sie sich.
»Sprenger hier. Hallo, Frau Gergely. Ich wollte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass es in einer Madrider Klinik einen Ebola-Verdachtsfall gegeben hat. Wir haben eine übersandte Probe analysiert und können nach der Erstanalyse den Ebola-Verdacht bestätigen. Ich habe in Madrid für eine Verifizierung weitere Proben anfordern lassen.«
»Wurde die spanische Seuchenschutzbehörde schon informiert?«
»Das klärt Dr. Nikiforos gerade ab. Sollte das seitens der Klinik in Madrid noch nicht erfolgt sein, werden wir das veranlassen.«
»Danke. Sehr gut, halten Sie mich auf dem Laufenden.«
Damaskus
Er hatte seine engsten Vertrauten zusammenrufen lassen. In kleiner Runde saßen sie zusammen, tranken Tee und aßen Baklava. Die Mittagssonne brannte erbarmungslos. Die Luft vor dem Fenster flirrte. Behäbig drehte sich der Ventilator an der Decke, verschaffte aber nur wenig Linderung. Er blickte in die Runde und musterte die Männer, die seit vielen Jahren seine Kampfgenossen und Brüder im Glauben waren. Einige kannte er von Kindesbeinen an. Ihnen konnte er bedingungslos vertrauen und jeder Einzelne von ihnen würde auf sein Geheiß, ohne zu zögern, für ihn in den Tod gehen. Nur die Männer, die hier saßen, kannten seine wahre Identität. Für den Rest der Welt war er ein Schatten, ein Phantom. Er hatte notgedrungen zu einem Meister der Tarnung und Täuschung werden müssen, eine Notwendigkeit, zu der er gezwungen war, um das zu Ende zu bringen, was er vor vielen Jahren begonnen hatte. Trotz seines Alters hatte er einen messerscharfen Verstand. Auch wenn er die modernen technischen Errungenschaften verachtete, war er doch damit vertraut. Er war der einzige Sohn eines ägyptischen Diplomaten und seiner libanesischen Frau. Bereits im Alter von sechs Jahren war er in der Lage, den Koran zu lesen und auswendig zu rezitieren. Er hätte es gerne vorgezogen, weiter den Koran zu studieren, sein Vater jedoch war der Ansicht, dass sein Sohn Medizin studieren sollte. Den Wunsch seines Vaters respektierend, studierte er in Ägypten Medizin. Er war ein brillanter Student und hatte letztlich seine Dissertation mit summa cum laude abgelegt, danach war er einige Jahre in Großbritannien und den USA, um klinische Erfahrung zu sammeln.
Sein Hass erreichte 1983 seinen Höhepunkt. Im Weißen Haus saß seinerzeit dieser unfähige republikanische Dilettant Ronald Reagan. Das einzig Gute an seiner Außenpolitik war seine zutiefst antikommunistische, anti-russische Haltung. 1984 hatte er den Vereinigten Staaten den Rücken gekehrt, war nach Afghanistan gereist und sich und seine Fähigkeiten in die Dienste der Mudschaheddin gestellt. Schnell hatte er sich einen Namen als tapferer Kämpfer und unverzichtbaren Mitstreiter im Kampf gegen die russischen Aggressoren gemacht.
Seinen Verhandlungen war es letztlich zu verdanken, dass die Mudschaheddin durch die CIA mit Waffen und FIM-92 Stinger-Raketen versorgt wurden. 1986 begegnete er erstmals Usāma ibn Muhammad ibn Awad ibn Lādin. Der gesamten westlichen Welt geläufiger unter dem Namen Osama bin Laden. In Usāma fand er seinen Bruder im Geiste, den er so lange gesucht hatte.
In den folgenden Jahren wurde er zu bin Ladens engstem Vertrauten. Sie wurden zu Guerilla-Experten und setzten der russischen Armee enorm zu. Nachdem die Kämpfe 1988 langsam zur Ruhe kamen, wurden die russischen Truppen im Februar 1989 aus Afghanistan abgezogen. Sie hatten gesiegt. Bereits im Kampf gegen die Russen hatte er sich als brillanter Stratege und Planer erwiesen, weshalb ihm Usāma die Steuerung und Koordination aller späteren Operationen übertrug.
Nur mit knapper Not war er aus Pakistan entkommen, als Spezialkräfte der US-Marines am 2. Mai 2011 in das sichere Haus, zumindest bis dahin sichergeglaubte Haus, in Abbottabad eindrangen und Usāma und einige seiner Wachen erschossen. Er verlor seinen Bruder im Geiste. Dieser Verlust schmerzte ihn bis heute.
Für diesen Frevel schwor er Rache.
Die erste von ihm akribisch geplante und durchgeführte Operation war am 26. Februar 1993. Mit dem ersten Anschlag auf das World Trade Center hatten sie die US-amerikanische Bevölkerung bis ins Mark erschüttert und deren Verletzlichkeit vor Augen geführt. In den Jahren danach folgten weitere achtzehn Anschläge. Das Herausragende waren die Anschläge vom 11. September 2001, erneut auf das World Trade Center. Die Planung hatte ihn vor diverse logistische Herausforderungen gestellt.
Alle übrigen Anschläge danach waren nur noch Nadelstiche, welche der Welt vor Augen führen sollten, dass die Bedrohung allgegenwärtig war.
Sie wollten Angst säen und das hatten sie erreicht.
Der jüngste Anschlag auf die blasphemische Pariser Zeitung »Charlie Hebdo« am 7. Januar 2015 war ein Selbstläufer einer seiner Pariser Zellen, der ohne seine Autorisierung erfolgt war. Nachdem seine Glaubensbrüder bei der anschließenden Schießerei mit der Polizei getötet wurden und die mediale Beachtung immens war, entschied er, sich offiziell zu dem Anschlag zu bekennen.
Er dachte größer, globaler.
»Allahu Akbar, meine Brüder.«
»Allahu Akbar«, erwiderten sie, den Zeigefinger Richtung Allah zeigend, unisono.
»Inshallah – Es hat begonnen. Die Zeit ist gekommen, der gottlosen, verdorbenen, imperialistischen, westlichen Welt die Allmacht Allahs zu offenbaren und die ungläubigen Schweine, sofern sie sich nicht zu Allah bekehren, zur Schlachtbank zu führen.
Ohne Gott vermag der Mensch nichts. Wir sind seine Diener und Werkzeuge seines Willens. Haltet euch bereit.«
Stockholm
Salim wartete aufgeregt in dem kleinen Zimmer, das er vor einigen Wochen unter falschem Namen angemietet und im Voraus bezahlt hatte. Der Vermieter, ein schmuddeliger, bärbeißiger Rentner, gab sich damit zufrieden, ohne einen Ausweis sehen zu wollen. Salim nahm auf einem wackligen Holzstuhl Platz und ging in Gedanken die folgenden Schritte durch. Er war sich sicher, dass alles so laufen würde, wie er es geplant hatte. Wichtig war die zeitliche Abfolge. Nur wenige Minuten Verzögerung könnten seine komplette Durchführung vereiteln. Er würde die Nachricht von unterwegs absenden müssen. Dieser zeitliche Vorsprung war wichtig. Er hörte das Knarzen der obersten Treppenstufe. Eine Person stieg die Treppe hinauf. Seine Hand wanderte unwillkürlich unter sein T-Shirt und griff nach der Pistole in seinem Hosenbund. Salim hielt den Atem an und lauschte. Jeder Muskel seines Körpers war gespannt. Es klopfte viermal an der Tür. Dreimal kurz, einmal lang – das vereinbarte Zeichen. Er erhob sich und spähte durch den Spion, bevor er die Schließkette zurückschob.
»Gut! Du bist pünktlich«, flüsterte Salim. Er schob die Tür auf und ließ die Person eintreten. Sie trug ein in eine Decke gewickeltes Bündel auf dem Arm. Blonde Haare schauten daraus hervor.
»Sie schläft.«
»Gut, was denkst du, wie lange das Mittel anhält?«
»Sicherlich die nächsten sechs bis acht Stunden, dann musst du ihr weitere zwei Tabletten verabreichen.«
Er überschlug kurz die Zeiten im Kopf und mutmaßte, dass die Zeit ausreichen würde.
»Hast du alles, was ich brauche?«, fragte Salim.
»Ist alles in dem Rucksack.«
Salim nickte kaum merklich. »Ich muss jetzt los.«