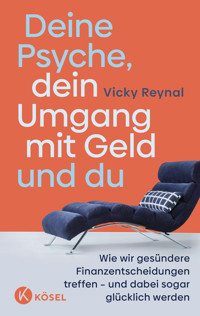
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch schließt eine Bildungslücke im Umgang mit unseren persönlichen Finanzen
»Die Verbindung von Kopf und Konto – anschaulich erklärt.«
Thomas Kehl, Finanzfluss
Offen über Geld zu sprechen, ist noch immer ein Tabu. Dabei könnte Reden helfen, denn die meisten unserer Beziehungskonflikte betreffen unseren Umgang mit Geld. Gleichzeitig erhöht dieser »finanzielle Stress« das Risiko für Magengeschwüre, Migräne, Angststörungen und Depression um ein Vielfaches.
Psychotherapeutin und Finanzexpertin Vicky Reynal entschlüsselt das komplexe Geflecht emotionaler Faktoren, das unsere Finanzentscheidungen lenkt, und hilft, ein gesundes »finanzielles emotionales Bewusstsein« zu schaffen: Denn ein Verhältnis zu Geld, mit dem wir uns wohlfühlen, ist unabhängig vom Einkommen möglich. Wenn wir verstehen, welche Rolle Geld in unseren Köpfen spielt, verbessert dies nicht nur unseren Kontostand, sondern auch unsere Beziehungen, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dieses augenöffnende Buch liefert die Werkzeuge dafür.
- Hilft psychologisch fundiert, den eigenen Umgang mit Geld zu verstehen und zu verbessern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch:
Offen über Geld zu sprechen, ist noch immer ein Tabu. Dabei könnte Reden helfen, denn die meisten unserer Beziehungskonflikte betreffen unseren Umgang mit Geld. Und gleichzeitig erhöht dieser »finanzielle
Stress« das Risiko für Magengeschwüre, Migräne, Angststörungen und Depression um ein Vielfaches.
Psychotherapeutin und Finanzexpertin Vicky Reynal entschlüsselt das komplexe Geflecht emotionaler Faktoren, das unsere Finanzentscheidungen lenkt, und hilft, ein gesundes »finanzielles emotionales Bewusstsein« zu schaffen: Denn ein Verhältnis zu Geld, mit dem wir uns wohlfühlen, ist unabhängig vom Einkommen möglich. Wenn wir verstehen, welche Rolle Geld in unseren Köpfen spielt, verbessert dies nicht nur unseren Kontostand, sondern auch unsere Beziehungen, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dieses augenöffnende Buch liefert die Werkzeuge dafür.
Über die Autorin:
Vicky Reynal ist approbierte Psychotherapeutin und Finanzexpertin mit einem MBA der London Business School. Als Expertin für Psyche und Finanzfragen eröffnete sie die erste auf »Financial Psychotherapy« spezialisierte Praxis in London. Mit ihrem erfolgreichen psychodynamischen Therapieansatz hilft sie ihren Klienten, die eigene emotionale Beziehung zu Geld zu verstehen und besser zu gestalten.
Vicky Reynal
Deine
Psyche,
dein
Umgang
mit Geld
und du
Wie wir gesündere Finanzentscheidungen treffen – und dabei sogar glücklich werden
Aus dem Englischen von Hans Freundl und Heike Schlatterer
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel MONEYONYOURMIND. The Psychology Behind Your Financial Habits bei Lagom, an Imprint of Bonnier Books UK, London.
© Vicky Reynal 2024
This translation of MONEYONYOURMIND is published by arrangement with Vicky Reynal.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Alle in diesem Buch veröffentlichten Aussagen und Ratschläge wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden, ebenso ist die Haftung der Autorin bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN978-3-641-32658-6V002
www.koesel.de
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1
Wie frühere Erfahrungen unser Verhältnis zu Geld beeinflussen
Kapitel 2
Übermäßige Ausgaben und ihre vielen Ursachen
Kapitel 3
Gier: Wenn wir nie genug kriegen
Kapitel 4
Zu wenig Geld ausgeben: Wenn wir Geld nicht genießen können
Kapitel 5
Selbstsabotage: Warum wir uns selbst im Weg stehen
Kapitel 6
Großzügigkeit: Von der Unzulänglichkeit zur Kontrolle oder warum wir geben
Kapitel 7
Stehlen: Wiedergutmachung, Auflehnung oder Befreiung?
Kapitel 8
Kontrolle: Streben nach Macht oder Suche nach Nähe?
Kapitel 9
Geldgeheimnisse
Kapitel 10
Paare und Geld
Kapitel 11
Geld und andere Beziehungen: Freundschaften, Familien und Berufsleben
Kapitel 12
Die eigene Einstellung zum Geld verstehen und verändern
Kapitel 13
Eine Botschaft zum Schluss
Dank
Quellen
Einleitung
Man könnte meinen, dass Psychotherapeuten gerne über alles reden. Über dunkle Geheimnisse, peinliche Erinnerungen, beschämende Gedanken, sexuelle Fantasien … all dies gehört zu den Themen, über die Klienten in der Therapie sprechen. In unserer Ausbildung als Therapeuten verbringen wir Jahre damit, uns mit der Neugier und der Belastbarkeit auszustatten, die wir brauchen, um unsere Klienten bei der Erkundung schwieriger Themen zu begleiten. Doch ein Bereich, der bis vor kurzem in der psychotherapeutischen Ausbildung kaum behandelt wurde, ist das Thema Geld.
Aus Gründen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, habe ich es mir zur persönlichen Aufgabe gemacht, meine eigene Beziehung zu Geld zu verstehen und zu vertiefen. Nicht weil Geld wichtig ist, sondern weil Geld ein Gegenstand ist, der unterschiedlichste Bedeutungsebenen umfasst, und diese zu erforschen hilft uns, besser zu verstehen, wer wir sind.
Zwischen einem Psychologiestudium und einem Aufbaustudium in Psychotherapie habe ich einen Master in Business Administration (MBA) gemacht. Ich war nicht überrascht, dass der MBA-Studiengang auch ein Seminar über Behavioural Finance beinhaltete, einen Wissenschaftszweig, der aus psychologischer Sicht erklärt, warum Menschen häufig irrationale Entscheidungen treffen, wenn es um Geld geht. Es war allerdings überraschend für mich, dass im Psychotherapiestudium, in dem man lernt, den Dingen auf den Grund zu gehen, das Thema Geld weitgehend gemieden wurde.
Ich war neugierig darauf, Fragen wie diese zu erforschen:
Warum können manche Menschen nie genug Geld bekommen? Andere dagegen scheinen schon mit wenig zufrieden zu sein.Warum werden manche Menschen von Schuldgefühlen geplagt, wenn sie Geld für sich selbst ausgeben? Andere hingegen verschleudern ihr Vermögen geradezu.Warum streiten sich manche Paare unaufhörlich über Geld? Andere wiederum scheinen sich in den meisten finanziellen Angelegenheiten einig zu sein.Wann wird Geld benutzt, um andere zu kontrollieren, um Liebe zu erbitten oder Liebe zu zeigen, um zu protzen, um etwas zu kompensieren, um gegen etwas aufzubegehren?Mein Interesse ist nicht nur beruflich motiviert. Es ist auch ein persönliches Anliegen. Mein Vater hat ein ganzes Buch über die finanzielle Tragödie geschrieben, die sein Vermögen, seine Hoffnungen, seine Träume und noch viel mehr zunichtegemacht hat. Es ist eine Geschichte von Betrug, Verrat und Verlust, die bei ihm ein tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit, der Wut und des Bedauerns hinterlassen hat. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass die Erfahrungen meiner Familie mit Geld meine Ansichten darüber geprägt haben, wofür Geld steht und wie wichtig es ist. Es ist nicht nur der Einfluss der Erfahrungen meines Vaters, sondern alles, was damit verbunden war. Geld als Maßstab für Leistung (aber auch für den Selbstwert). Geld als Instrument der Großzügigkeit und der Hilfe (aber auch des Stolzes). Geld als Mittel des sozialen Aufstiegs (aber mit Gefühlen der Unzulänglichkeit oder der Scham, die bisweilen damit einhergehen). Geld als etwas, das von einem Tag auf den anderen weg sein kann (und dadurch Chancen, Hoffnungen und Wünsche zunichtemacht). Ich werde in diesem Buch nicht über meine persönliche Geschichte sprechen, aber ich erwähne sie hier, um begreiflich zu machen, warum mich dieses Thema so brennend beschäftigt.
Geld ist immer noch ein Tabu
Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, auf den ich mich in diesem Buch des Öfteren beziehen werde, war der Erste, der den Tabuaspekt des Geldes bemerkte. Er schrieb: »Geldangelegenheiten [werden] von den Kulturmenschen in ganz ähnlicher Weise behandelt wie sexuelle Dinge, mit derselben Zwiespältigkeit, Prüderie und Heuchelei.«1 Auch mehr als ein Jahrhundert später ist diese Aussage noch aktuell. In einer 2019 in Großbritannien durchgeführten Umfrage2 (die sich auch in Erhebungen in den USA widerspiegelt)3 gaben die Menschen an, dass sie mit Freunden und der Familie lieber über Sex als über Geld sprechen würden. Die Hälfte der Briten erklärt, dass das Reden über persönliche Geldangelegenheiten in alltäglichen Gesprächen ein Tabu sei, noch vor Sex, Religion und Politik. Mehr als zwei Fünftel (44 Prozent) der Menschen vermeiden Gespräche über Geld. Selbst in der Therapie wird das Thema nur ungern angesprochen, wie der am C. G. Jung-Institut geschulte Psychoanalytiker James Hillman schrieb: »Patienten geben eher preis, was in ihrer Hose verborgen ist, als was in ihrer Hosentasche steckt.«4 Deshalb glaube ich, dass die Bezeichnung »Finanzpsychotherapeutin« vielen meiner Klienten gewissermaßen das Gefühl vermittelt hat, dass sie hier einen Raum betreten, in dem das Reden und Denken über Geld »erlaubt« ist und frei von Wertungen.
Geld ist nach wie vor ein heikles Thema und eine wichtige Ursache für Stress, Scham und Konflikte. Wenn Gespräche über Geld geführt werden, lösen sie eine Vielzahl von Emotionen aus. Fast ein Drittel (32 Prozent) der Befragten gibt an, dass sie es als stressig empfinden, mit Familie und Freunden über ihre Finanzen zu sprechen, und mehr als zwei Fünftel (43 Prozent) erklären, dass ihnen das Thema peinlich sei.5 Scham und Peinlichkeit scheinen bei jüngeren Menschen, die mit dem Thema Geld konfrontiert werden, besonders ausgeprägt zu sein.6 Hinzu kommt, dass vielen von uns beigebracht wurde, dass es nicht höflich oder angemessen sei, über Geld zu sprechen, so dass wir uns darüber hinaus auch noch Sorgen machen, dass wir als unhöflich erscheinen könnten, wenn wir das Thema im Freundeskreis anschneiden. Nimmt man zudem die Geheimhaltungsklauseln in Bezug auf Gehälter hinzu, die es Beschäftigten verwehren, ihr Gehalt gegenüber Kollegen offenzulegen, wird deutlich, dass es viele Botschaften gibt, die uns dazu bewegen, unsere Geldangelegenheiten für uns zu behalten. Auch wenn solche Forderungen nicht expressis verbis an uns herangetragen werden, sind Unternehmenskulturen, in denen Diskussionen über das Gehalt verpönt sind, keine Seltenheit und tragen dazu bei, dass Geld weiterhin als Tabu gilt.
Der Zusammenhang zwischen Geld und psychischer Gesundheit
Wir meiden das Thema Geld nicht, weil es unwichtig wäre, sondern weil es manchmal emotional »aufgeladen« erscheint. Manche von uns lassen es zu, dass das Geld unsere Beziehungen, unsere geistige und körperliche Gesundheit und unsere Leistung am Arbeitsplatz beeinflusst. Wenn Sie schon einmal nachts aufgewacht sind, weil Sie die Sorgen um Ihr Geld nicht schlafen ließen, sind Sie gewiss nicht allein. Studien aus aller Welt bestätigen, dass sich fast die Hälfte der Erwachsenen gelegentlich um ihre Finanzen sorgt, in Ländern wie Großbritannien und den USA sogar mehr als die Hälfte.7
Geldsorgen können jeden befallen, aber gerade für Menschen, die von einer Gehaltszahlung zur nächsten leben, wird es leicht zu einem täglichen Kampf. Das kann einem geistig und emotional stark zusetzen, weshalb es wichtig ist, das Geldtabu in Angriff zu nehmen. Scham, Angst und Traurigkeit im Zusammenhang mit den Finanzen können bei manchen Leuten ein tiefes Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Hilflosigkeit hervorrufen. Wenn man seine Gefühle unterdrückt, sie versteckt und sie nicht erforscht und bespricht, können sie übermächtig werden.
Finanzieller Stress, insbesondere im Zusammenhang mit Schulden, wird auch mit einer schlechten körperlichen Gesundheit in Verbindung gebracht. Eine 2010 durchgeführte Meta-Analyse von über 60 Untersuchungen bestätigte den Zusammenhang zwischen Schulden und schlechterer Gesundheit.8 Eine vorhergehende Studie9 ergab, dass Menschen, die mit hohen Schulden zu kämpfen haben, mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit an Magengeschwüren oder Verdauungsproblemen, Kopfschmerzen/Migräne und mit mehr als sechsmal höherer Wahrscheinlichkeit an Angstzuständen und Depressionen leiden. Die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, war doppelt so hoch, und mehr als die Hälfte klagte über Muskelverspannungen und Rückenschmerzen. Außerdem litten diese Menschen, wie bei chronischen Stresssymptomen üblich, unter Konzentrations- und Schlafproblemen und berichteten, dass sie sich ohne triftigen Grund aufregen.
Auch unsere Leistung am Arbeitsplatz wird durch finanziellen Stress beeinträchtigt. Fast sieben von zehn Arbeitgebern in Großbritannien sind der Meinung, dass die Leistung ihrer Mitarbeiter negativ beeinflusst wird, wenn sie unter finanziellem Druck stehen, und tatsächlich fehlen 10 Prozent der Arbeitnehmer deswegen mehrere Tage krankheitsbedingt bei der Arbeit (im Durchschnitt knapp fünf Tage pro Jahr), so ein Bericht des Centre for Economics and Business Research.10 Darüber hinaus stellte der Bericht fest, dass 18 Prozent der Arbeitnehmer aufgrund ihrer finanziellen Sorgen einen Rückgang ihrer Produktivität bemerkten.
Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um eine wechselseitige Beziehung handelt: Wir haben gesehen, wie finanzielle Schwierigkeiten zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit führen können, aber auch psychische Erkrankungen können die Fähigkeit von Menschen beeinträchtigen, rationale und selbstbewusste finanzielle Entscheidungen zu treffen. Sie beeinflussen zudem ihre Fähigkeit, ihren Arbeitsplatz halten zu können.
Geld kann auch die Harmonie unserer Beziehungen auf direkte oder indirekte Weise stören: Wir können feststellen, dass Konflikte um Geld einige unserer wichtigsten Beziehungen beeinträchtigen oder dass unsere Geldsorgen uns emotional so sehr belasten, dass wir angespannter und reizbarer werden und nicht mehr in der Lage sind, unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten und mit unseren Lieben zu kommunizieren. Zu verstehen, welche Rolle Geld in unseren Köpfen spielt, kann somit nicht nur unseren Kontostand verbessern, sondern auch unsere Beziehungen.
Reichtum ist keine Garantie für Glück
Auch wenn das Fehlen von Reichtum unser Wohlbefinden empfindlich beeinträchtigen kann, garantieren Reichtum und finanzieller Erfolg kein Glück. Zahlreiche Studien haben herauszuarbeiten versucht, ob das Glück mit dem Einkommen oder dem Vermögen zunimmt.
Die Ergebnisse sind uneinheitlich, und es gibt zahlreiche akademische Debatten darüber, ob man das »evaluative Wohlbefinden« (wie wir selbst unser Leben und unsere Lebenszufriedenheit bewerten) messen sollte oder das »erlebte Wohlbefinden« (wie wir uns im täglichen Leben fühlen). Es ist jedoch erwiesen, dass das »evaluative Wohlbefinden« stärker mit dem Wohlstand zusammenhängt als das »erlebte Wohlbefinden«, was darauf hindeutet, dass Wohlstand zwar Einfluss darauf hat, wie wir unser Leben im Allgemeinen bewerten, dass aber auch wohlhabende Menschen im Alltag nicht weniger um ihr Glück zu kämpfen haben als alle anderen.
Nun sind wir Menschen, wie ich gerne betone, komplexe Wesen, so dass der Versuch, Glück anhand eines Fragebogens zu bewerten, schnell an Grenzen stößt. Und so tröstlich und beruhigend es ist, die Schlussfolgerungen von Psychologen zu lesen, wonach die 100 reichsten Amerikaner nur geringfügig glücklicher sind als der Durchschnittsamerikaner,11 so gibt es doch auch Studien, die diesen Ergebnissen widersprechen.12
Meine Berufserfahrung und die vieler Kollegen bestätigt, dass sich viele wohlhabende Menschen schwertun, Freude und Erfüllung zu finden. Wenn überhaupt, dann tragen sie mehr Schuldgefühle und Scham über ihre Traurigkeit in sich, weil unsere Gesellschaft uns die irreführende Annahme eintrichtert, dass mehr Geld uns glücklicher machen würde. Geld kann durchaus, wenn wir es zulassen, unser Glück fördern, aber es ist nicht die entscheidende Triebkraft dafür.
Zuzulassen, dass Geld das Glück fördert, ist aber anscheinend schwieriger, als man es sich vorstellt. Wir können uns emotional, irrational, unrealistisch und manchmal sogar wahnhaft verhalten in Bezug darauf, was Geld uns bringen kann, und so lassen wir es manchmal zu einer Quelle von Konflikten oder auch zu einem Werkzeug werden, mit dem wir unsere Selbstzerstörung und Selbstkasteiung ausleben können, anstatt es als lebensfördernd zu betrachten.
Es ist nichts Neues, dass Menschen in Bezug auf Geld irrational handeln können
Während das Thema Geld in der psychoanalytischen Literatur bestenfalls am Rande behandelt wird (mit Ausnahme des Glücksspiels), untersucht die Behavioural Finance seit Jahren den Einfluss der Psychologie auf die Finanzmärkte und auf Finanzentscheidungen.
Die Forschung der Behavioural Finance hat gezeigt, dass Menschen im Umgang mit Geld in hohem Maße irrational sein können. So wurde beispielsweise bei der Untersuchung der menschlichen Entscheidungsfindung festgestellt, dass wir für bestimmte sogenannte »kognitive Verzerrungen« anfällig sind: Der »Effekt der versunkenen Kosten« (Sunk Cost Fallacy), der »Ankereffekt« (Anchoring Effect) und der »Rezenzeffekt« (Recency Bias) verzerren unsere Rationalität und verleiten uns dazu, schlechte finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Nehmen wir als Beispiel für die oben genannten Verzerrungen den »Effekt der versunkenen Kosten«. Stellen Sie sich vor, Sie haben Konzertkarten für 150 Euro und Theaterkarten für 75 Euro gekauft, ohne zu wissen, dass beide Veranstaltungen am selben Abend stattfinden sollen. Welche Veranstaltung sollen Sie besuchen? Vielleicht entscheiden Sie sich für das Konzert, weil Sie dafür einen höheren Preis bezahlt haben. Das Geld für die Karten ist jedoch so oder so verloren: Wer rationale Entscheidungen treffen will, würde nur den zukünftigen Wert betrachten. Welche Veranstaltung wird Ihnen mehr Freude und Zufriedenheit bereiten? Das ausgegebene Geld sollte bei dieser Entscheidung keine Rolle spielen.
In diesem Buch geht es jedoch nicht um die irrationalen Neigungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, sondern darum, Ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen Sie Ihre eigene, individuelle Einstellung zum Geld erforschen können, die auf der einzigartigen Kartierung Ihrer inneren Welt beruht.
Ein Psychotherapeut kann Ihnen zwar helfen, die Irrtümer in Ihrem Denken zu erkennen, aber er wird sich eher dafür interessieren, warum Sie überhaupt in eine solche Bredouille geraten sind (zwei Veranstaltungen am selben Abend zu buchen). Wenn dies häufig vorkommt, könnte es Gründe für diese »Fehler« geben. Vielleicht haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie Geld für sich selbst ausgeben, und um dieses Schuldgefühl zu vermeiden, treffen Sie Geldentscheidungen, ohne viel nachzudenken (oder Termine zu überprüfen). Vielleicht fürchten Sie, dass Sie am Samstagabend allein sein könnten (eine Unsicherheit, die in den Schwierigkeiten wurzelt, in der Schulzeit Kontakte zu knüpfen), was Sie dazu veranlasst, überstürzt und ohne viel nachzudenken Pläne zu machen. Oder vielleicht spiegelt dies eine chaotische Lebensweise wider, die Sie auch in anderen Bereichen Ihres Lebens an den Tag legen? Was mich interessiert, ist die einzigartige emotionale Prägung, die einen Menschen für bestimmte Denk- und Verhaltensweisen prädisponiert.
Indem ich Ihnen auch eine andere Denkweise vorstelle, hoffe ich, Ihnen eine neue Sicht zu vermitteln, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Beziehung zu Geld zu erkunden. Ich erinnere mich, wie ein Klient, der mit Geldsorgen zu kämpfen hatte, einmal tief Luft holte, nachdem er gerade ausführlich von der schmerzhaften Erinnerung an den Bankrott seiner Eltern erzählt hatte. Auf den tiefen Atemzug folgte längeres Schweigen, dann fragte er mich mit hoffnungsvollem Blick: »War es das?« Er meinte damit: »Haben wir das Geheimnis gelüftet? Haben wir jetzt die Antwort gefunden?« oder anders ausgedrückt: Könnte diese eine Erfahrung für alles verantwortlich sein? Bedauerlicherweise aber gibt es nie ein »es«. Es kann vielleicht enttäuschen, zu lesen, dass es so gut wie nie nur eine bestimmte Sache, eine bestimmte Erfahrung oder einen bestimmten Gedanken gibt, die unser Handeln im Hier und Jetzt erklären.
Das macht die Suche aber nicht weniger wertvoll, davon bin ich heute überzeugt. Wenn Sie sich öffnen für eine andere Herangehensweise an die Selbsterforschung und die Reflexion, werden Sie sich selbst in einer vielschichtigen und multidimensionalen Weise begreifen, die Ihr Verständnis von sich selbst (und nicht nur von Geld) bereichern wird. Ich werde Beispiele aus dem Leben, aus meiner eigenen klinischen Praxis, aus Berichten aus der klinischen Praxis von Kollegen sowie aus dem öffentlichen Leben und der Populärkultur verwenden. Wenn ich hin und wieder auf die Arbeit mit meinen eigenen Klienten zurückgreife, mache ich dies in verdeckter und anonymisierter Form, um ihre Privatsphäre zu schützen und meiner Schweigepflicht nachzukommen.
Finanzielles Wohlbefinden und finanzielles emotionales Bewusstsein
Finanzielles Wohlergehen wird im Allgemeinen damit beschrieben, dass man mit seiner finanziellen Situation zufrieden ist und sie im Griff hat. Es hat nichts mit der Menge des Geldes zu tun, das man besitzt, sondern vielmehr damit, dass man ein ausreichendes Maß an Kontrolle über die eigene finanzielle Situation besitzt und das Gefühl hat, dass die Entscheidungen, die man trifft, rational begründet sind (anstatt irrational oder gegen die eigenen Interessen gerichtet). So erklärt zum Beispiel der Money and Pensions Service (MaPS), eine unabhängige britische Finanzberatungsorganisation: »Finanzielles Wohlergehen bedeutet, dass man sich sicher fühlt und die Dinge unter Kontrolle hat. Es geht darum, jeden Tag das Beste aus seinem Geld zu machen, mit dem Unerwarteten umzugehen und auf dem richtigen Weg in eine gesunde finanzielle Zukunft zu sein. Kurz gesagt: finanziell widerstandsfähig, zuversichtlich und sich seiner selbst gewiss zu sein.«
Im Allgemeinen gibt es eine Reihe von Faktoren, die unser finanzielles Wohlergehen beeinflussen können. Dazu gehören:
Soziale und wirtschaftliche FaktorenFinanzielle AllgemeinbildungPsychologische FaktorenAlle diese Faktoren beeinflussen unser finanzielles Wohlergehen, weil sie sich darauf auswirken, wie sicher wir uns in Bezug auf unsere Finanzen fühlen und wie stark unsere Kontrollfähigkeit ist. Diese Faktoren beeinflussen sich auch gegenseitig: Wenn wir uns in Bezug auf unsere Finanzen eher unsicher fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir schlechte finanzielle Entscheidungen treffen, so dass wir in einen Kreislauf aus sich verschlechternden finanziellen Umständen und schlechter psychischer Verfassung geraten.
Auch wenn es bei finanziellem Wohlbefinden nicht in erster Linie um die Höhe des Geldbetrags auf unserem Bankkonto geht, spielt unsere »finanzielle Resilienz« eine große Rolle:
Haben wir eine Notfallreserve, um unvorhergesehene Ausgaben abdecken zu können?Können wir im Bedarfsfall darauf zugreifen, oder sind alle unsere Ersparnisse in illiquiden Vermögenswerten gebunden, so dass wir sie im Notfall nicht einfach in Bargeld umwandeln können?Können wir uns von finanziellen Herausforderungen erholen und eine stabile finanzielle Situation aufrechterhalten?Können wir die Auswirkungen zum Beispiel der Inflation oder eines finanziellen Rückschlags verkraften?Unser Verhalten wird sich auf unsere finanzielle Resilienz und damit auf unser finanzielles Wohlergehen auswirken. Wenn wir uns in einer prekären finanziellen Lage befinden, wird uns dies in irgendeiner Weise bewusst sein und wir werden das Gefühl bekommen, dass uns die Kontrolle über unser Geld zu entgleiten droht und dass wir mit unserer finanziellen Situation nicht zufrieden sein können.
Soziale und wirtschaftliche Faktoren
Es gibt eine Reihe von sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die sich direkt oder indirekt auf unser finanzielles Wohlergehen auswirken, weil sie bestimmen, inwieweit wir Zugang zu Chancen haben, und damit unsere Lebensqualität und unser Wohlbefinden insgesamt beeinflussen.
Aufwachsen in Armut sowie Schulden und Arbeitslosigkeit sind häufig mit einer schlechten psychischen und physischen Gesundheit verbunden. Finanzieller Stress und Ängste führen zu schlechten oder falschen finanziellen Entscheidungen: In den USA hat die Investor Education Foundation der US-Finanzaufsichtsbehörde herausgefunden, dass finanziell verunsicherte und gestresste Erwachsene mit größerer Wahrscheinlichkeit kostspielige finanzielle Verhaltensweisen an den Tag legen, wie zum Beispiel teure Kredite aufnehmen oder vorzeitig Geld von ihrem Rentenkonto abheben, und dass sie seltener für den Ruhestand planen.13 Diese sozioökonomischen Faktoren wirken sich also sowohl auf die Entscheidungen aus, die wir in Geldangelegenheiten treffen, als auch darauf, wie glücklich wir sind und wie gut wir unsere finanzielle Situation im Griff haben.
Aber auch hier geht es nicht um die Finanzen als Zahlenwerte, sondern um finanzielles Wohlbefinden, und das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Wenn man in armen oder prekären Verhältnissen aufwächst, ist man nicht zwangsläufig zu schlechtem finanziellem Wohlbefinden verurteilt, und man wird auch nicht zu einer bestimmten Einstellung zum Geld gezwungen. Ebenso ist das Aufwachsen im Reichtum keine Garantie für Freiheit von Geldsorgen. Es handelt sich lediglich um unterschiedliche und gleichermaßen komplexe emotionale Konstellationen.
Wer in bescheidenen Verhältnissen groß geworden ist und unter Geldsorgen zu leiden hatte, welche die Eltern nur schwer in den Griff bekamen, könnte als Erwachsener eher zu einem ängstlichen, vorsichtigen Umgang mit Geld neigen und nie das Gefühl bekommen, dass er nun »genug« hat, um sich zu entspannen und sich sicher und zuversichtlich zu fühlen in seiner finanziellen Situation. Vielleicht horten solche Menschen dann ihr Geld, anstatt es zu genießen, »nur für den Fall«, dass etwas passiert, und werden von Katastrophenphantasien heimgesucht, die es ihnen nicht erlauben, sich an ihrem Geld zu erfreuen. Wenn die Eltern dagegen mit ihren Ängsten umgehen konnten, haben vielleicht auch ihre Kinder Wege gefunden, insgesamt mit ihrer finanziellen Situation zufrieden zu sein, das Beste aus dem zu machen, was sie haben, sich realistische Ziele zu setzen und sich nicht zu sehr darum zu kümmern, was andere tun oder sich leisten können.
In ähnlicher Weise mögen die Wohlhabenden im Großen und Ganzen weniger Ängste haben, dass sie sich einmal in einer finanziell prekären Situation wiederfinden könnten, aber gleichwohl könnte ihr finanzielles Wohlergehen immer noch von einer Fülle negativer Emotionen beeinflusst werden: von Unsicherheit über ihre Fähigkeiten, mit dem Geld, das sie haben, umzugehen, wenn es geerbt und nicht verdient wurde; von Scham darüber, dass sie mehr haben als andere, wenn sie mehr verdienen als ihre Freunde und ihre Familie; von Angst davor, dass das Geld eines Tages weg ist, wenn sie in der Kindheit miterlebt haben, wie ihre Eltern einen Bankrott oder einen großen Verlust erlitten haben. Es ist also nicht so, dass Knappheit und Mangel automatisch schlechtes finanzielles Wohlergehen bedeuten und Reichtum gutes finanzielles Wohlergehen, sondern es ist die eigene Einstellung dieser Situation gegenüber, die finanziellem Wohlergehen im Wege stehen könnte.
Ein interessanter Aspekt ist auch die Schichtzugehörigkeit. Da der wirtschaftliche Status und das Bildungsniveau, die mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht einhergehen, (traditionell) ein gewisses Potenzial an Verdienstmöglichkeiten und Chancen eröffneten, finde ich es interessant, darüber nachzudenken, wie das Erleben unserer Schichtzugehörigkeit unsere Einstellung zu und unser Verhalten im Umgang mit Geld geprägt haben. Gab es Ressentiments gegenüber dem Geld oder der Macht, welche die Angehörigen einer höheren sozialen Schicht ausübten, und Scham über unseren »minderwertigen« Status, der uns das Gefühl gab, abgehängt und machtlos zu sein? In diesem Fall kann unser finanzielles Wohlergehen von der Vorstellung geprägt sein, dass »andere immer mehr haben werden«, und vielleicht auch von Resignation und dem Gefühl, dass wir nur wenig Einfluss auf unsere eigene Situation besitzen. Wenn wir in einer Familie aufgewachsen sind, in der Reichtum und »gierige Reiche« verachtet wurden, könnten wir in einen schweren inneren Konflikt geraten, wenn wir irgendwann später auf der sozialen Leiter aufgestiegen sind und statt unser Geld genießen zu können, von Schuld- und Schamgefühlen geplagt werden.
Weitere Faktoren, die unsere Gefühle und unser Verhalten in Bezug auf Geld beeinflussen können, sind der allgemeine Zustand der Wirtschaft und der Finanzmärkte: In einer prosperierenden Wirtschaft fühlen wir uns vielleicht zuversichtlicher und gehen mehr Risiken ein, während wir uns in einer Rezession ganz anders fühlen und verhalten.
Auch unser Alter, unsere Lebensphase und unser Beziehungsstatus können sich auf unsere Geldentscheidungen und unser Vertrauen in unsere finanzielle Belastbarkeit auswirken (in jungen Jahren sind wir vielleicht risikofreudiger und mit zunehmendem Alter risikoscheuer; in den ersten Jahren unserer Erwerbstätigkeit konzentrieren wir uns vielleicht mehr auf das Sparen und in der Lebensmitte auf das Ausgeben). Aber auch hier gilt, dass die individuellen Erfahrungen und Lebensumstände den größten Einfluss auf unser finanzielles Wohlergehen haben, und diese sozioökonomischen Faktoren können unser Verständnis für unsere Beziehung zu Geld zwar beeinflussen, aber letztlich nicht zur Gänze erklären.
Finanzielle Allgemeinbildung
Finanzielle Bildung ist wichtig, denn davon hängt es maßgeblich ab, wie sicher wir uns bei unseren finanziellen Entscheidungen fühlen. Außerdem ist sie die Grundlage für einen soliden Umgang mit Geld und Finanzen. Wenn wir Entscheidungen treffen, die unseren ureigensten finanziellen Interessen zuwiderlaufen, muss das nicht unbedingt auf tiefgreifende emotionale Probleme zurückzuführen sein, sondern kann auch schlicht auf finanziellem Nichtwissen beruhen.
Die Statistiken bezüglich finanzieller Allgemeinbildung sind ernüchternd:
In der Europäischen Union ist nur etwa die Hälfte der Erwachsenen finanziell gebildet.14In jedem Land gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Bei einer groß angelegten Untersuchung in 93 Ländern stellte die amerikanische Ratingagentur Standard and Poor (S&P Global Ratings) fest, dass die Kluft zwischen Männern und Frauen bei den richtigen Antworten mehr als fünf Prozentpunkte betrug.In den USA kennt einer von drei Teenagern nicht den Unterschied zwischen einer Kreditkarte und einer Debitkarte.15In einer OECD-Studie, die sich auf 33 Länder bezog, kann ein Viertel der Erwachsenen nicht ausrechnen, wie viel Wechselgeld sie in einem Geschäft erhalten sollten (in Ländern wie Spanien, England und Italien steigt dieser Anteil auf etwa ein Drittel der untersuchten Personen).1644 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien meinen, dass sie finanziell wesentlich besser dastehen würden, wenn ihnen grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Geld, wie zum Beispiel mit Haushaltsplanung, vermittelt worden wären.17Sowohl in den USA18 als auch in Großbritannien19 wünschen sich drei von vier Menschen im Teenager-Alter, sie hätten mehr Unterricht in Finanzmanagement erhalten.13 Prozent der Eltern in den USA gaben an, dass ihre eigenen Eltern überhaupt nicht mit ihnen über Geld gesprochen haben,20 und in Großbritannien reden selbst heute noch weniger als die Hälfte der Eltern offen mit ihren Kindern über Geld.21Weltweit (aber auch in den wohlhabenden Ländern) bilden die Menschen, die über solide finanzielle Kenntnisse verfügen und in der Lage sind, zu entscheiden, was wirklich in ihrem finanziellen Interesse liegt, eine Minderheit. Das sind erschütternde Zahlen, sie zeigen uns, dass wir dringend eine bessere Finanzbildung brauchen.
Die Folgen sind weitreichend. Finanzielle Allgemeinbildung hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und unsere eigenen finanziellen Ergebnisse. Sie beeinflusst unsere Fähigkeit, Wohlstand zu schaffen und sich von finanziellen Schocks zu erholen. Sie steht im Zusammenhang damit, größere Ersparnisse und mehr Vermögen aufzubauen, mit einer besseren Altersvorsorge, einem besseren Umgang mit Schulden und einer geringeren Neigung zu leichtfertigem Umgang mit Kreditkarten.22 Und natürlich wirkt sie sich auf unser finanzielles Wohlergehen und unsere psychische Gesundheit aus, weil fehlende Finanzkenntnisse zu Unsicherheiten, Zweifeln und Ängsten im Zusammenhang mit finanziellen Entscheidungen führen. Bei der Untersuchung über finanziellen Stress fanden Forscher heraus, dass die finanziellen Ängste umso geringer sind, je höher das Niveau der finanziellen Bildung ist.23 Wissen schafft Vertrauen und fördert ein Gefühl der Kontrolle und der Wahlfreiheit. In der Praxis führt dies letztlich auch zu besseren Entscheidungen.
Psychologische Faktoren: Aufbau eines emotionalen Finanzbewusstseins
Das Gefühl, dass man selbstbewusst sein darf und die eigenen Finanzen unter Kontrolle hat, wird von einer Vielzahl psychologischer Faktoren beeinflusst, von denen ich einige in diesem Buch ausführlich behandeln werde. Ein komplexes Geflecht emotionaler Faktoren (Sehnsüchte, Ängste, Abwehrmechanismen, innere Konflikte, Überzeugungen), vergangener Erfahrungen (Erkenntnisse darüber, wofür Geld steht, überkommene Überzeugungen und Erfahrungen wie finanzielle Traumata und soziale Mobilität) sowie unsere Persönlichkeit und unsere mentalen Prozesse (wie wir die Welt um uns herum erleben) bestimmen die Entscheidungen, die wir in Bezug auf Geld treffen, und wie wir uns dabei fühlen.
Ich möchte mit diesem Buch dazu beitragen, dass sich Ihr, wie ich es nenne, »finanzielles emotionales Bewusstsein« verbessert: Ihr Bewusstsein für die psychologischen Einflüsse, die Ihre Gefühle und Ihr Verhalten in Bezug auf Geld bestimmen und formen. Sie werden feststellen, dass viele dieser Faktoren auf frühere Erfahrungen zurückgehen, einige sogar auf Erlebnisse aus der Kindheit und in vielen Fällen auf Erfahrungen, die nichts mit Geld zu tun haben. Sie entdecken vielleicht, dass Ihre Schwierigkeiten, sich mit einem Geschäftspartner über die Vergütung zu einigen, in Wirklichkeit mit alten geschwisterlichen Dynamiken zu tun haben, die durch diese Beziehung wiederbelebt werden. Oder dass Ihr Wunsch, weiterhin die Ferien Ihrer Kinder zu finanzieren, in Ihrer Angst vor einer Trennung von ihnen begründet ist, die Sie bei Ihren eigenen Eltern nur schwer überwinden konnten. Oder dass Ihre Gewohnheit, die Ausgaben bis auf den letzten Cent zu erfassen, mit einer tief sitzenden Angst vor Ausbeutung oder Übervorteilung zu tun hat.
Es ist nicht meine Absicht, Emotionen aus finanziellen Entscheidungen zu eliminieren. Könnte man Hypothekenverträge unterschreiben, ohne eine gewisse Besorgnis oder Beklemmung zu verspüren? Könnten wir zum ersten Mal in ein unternehmerisches Projekt investieren, ohne zu bangen und aufgeregt zu sein? Könnten wir für unser Kind/unseren Partner zum fünften Mal eine Bürgschaft übernehmen, ohne einen gewissen Ärger zu verspüren? Die Antwort auf all diese Fragen lautet »Wahrscheinlich nicht«, denn viele Geldentscheidungen sind emotional. »Finanzielles emotionales Bewusstsein« bedeutet, dass Sie sich der Gefühle, die Ihre finanziellen Entscheidungen bestimmen, bewusster werden und sie besser wahrnehmen können, so dass Sie finanzielle Entscheidungen treffen können, die Ihnen mehr Sicherheit geben. Wenn Sie diese Art von Einsicht entwickeln, können Sie Ihre Entscheidungen von Ihrem Gefühl leiten lassen, anstatt sie blindlings zu treffen. Dies wird unweigerlich zu größerem finanziellen Wohlbefinden beitragen.
Manchmal sind negative Gefühle eine natürliche Reaktion auf eine schwierige finanzielle Entscheidung und nicht etwa ein Zeichen dafür, dass man eine schlechte Entscheidung trifft.
Wir könnten vielleicht folgende Empfindungen verspüren:
Scham, wenn wir uns entscheiden, weniger als die anderen zu einer Sammlung für ein Geschenk beizutragenSchuldgefühle, wenn wir uns eine Massage oder ein teureres Restaurant zu regelmäßig gönnenFrustration, wenn wir auf eine gewünschte Anschaffung verzichten, um für ein größeres finanzielles Ziel zu sparenAngst, wenn wir einen Kredit aufnehmen, um ein Unternehmen zu gründenEs sind nicht immer die negativen Emotionen, die zu solchen schlechten Entscheidungen führen. Nehmen wir die Sammlung für ein Geschenk: weniger zu geben als andere, könnte Scham hervorrufen, aber mehr zu geben, als wir uns leisten können, kann Bedauern oder sogar Groll auslösen. Es gibt also keine »richtige« Entscheidung, die uns von allen negativen Gefühlen befreit. Es geht darum, sich über die Gründe für unsere Entscheidung im Klaren zu sein (und nicht impulsiv und unter Druck zu handeln, ohne die Folgen abzuschätzen) und dann die Nachteile der Entscheidung, die wir letztendlich treffen, zu bewältigen. Probleme entstehen, wenn Emotionen uns daran hindern zu verstehen, was das Beste für uns ist, wenn sie unser Urteilsvermögen trüben.
Nehmen wir zum Beispiel Jonathan, der eine Beförderung erhält und seinen gesamten Bonus für einen Luxusurlaub ausgibt. Ist das eine schlechte Entscheidung? Nun, die Antwort lautet: »Es kommt darauf an.« Ausschlaggebend ist, ob Jonathan die Gründe für seine Entscheidung durchdacht hat und nicht impulsiv und aus einer emotionalen Aufwallung heraus gehandelt hat. In ersterem Fall ist er so begeistert, dass er endlich eine beträchtliche Bonuszahlung bekommen hat, dass er ohne zu überlegen einen Luxusurlaub bucht. Als er aus dem Urlaub zurückkehrt, plagen ihn jedoch Schuldgefühle. Hätte er den Bonus nicht für den Urlaub »verpulvert«, wäre er der Anzahlung für die Wohnung, die er im Auge hatte, einen Schritt näher gekommen.
Im zweiten Fall nimmt sich Jonathan Zeit, um die Vor- und Nachteile seiner Entscheidung abzuwägen: Ja, der Luxusurlaub wird ihn bei der Finanzierung der Wohnung zurückwerfen. Entweder muss er länger warten, bis er genug Geld dafür hat, oder er muss seine Familie um finanzielle Unterstützung bitten. Aber dieser Luxusurlaub ist etwas, das er schon seit seiner Jugend machen wollte. Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie, schaute Jonathan immer neidvoll auf die Kinder in seiner Schule, die ins Ausland reisen konnten. Er sehnte sich danach, sich dies auch eines Tages leisten zu können, und legte sich in seinem ersten Job mächtig ins Zeug, um endlich seinen Traumurlaub machen zu können. Dank seiner Bemühungen kann er sich dieses Ziel nun erfüllen. Da ihm bewusst ist, was er dafür aufgeben muss, kann er erkennen, dass er einen Kompromiss eingehen und sich dafür entscheiden muss, was ihm wichtiger ist. Er genießt den Urlaub ohne Schuldgefühle oder Reue.
Dieselbe Entscheidung, aber ganz unterschiedliche Entscheidungsprozesse. Und was noch wichtiger ist, auch die emotionalen Ergebnisse sind sehr unterschiedlich: Letztere Entscheidung steigert sein finanzielles Wohlbefinden, denn selbst wenn er am Ende in der gleichen finanziellen Lage ist, hat er sich erlaubt, mit dem Geld, das er hat, etwas anzustellen, was ihm Freude bereitet hat, und eine Entscheidung zu treffen, mit der er zufrieden sein kann.
Jede Entscheidung bedeutet, etwas aufzugeben, und sich dessen bewusst zu sein, hilft uns, es loszulassen, und zwar im Zusammenhang mit dem, was wir dadurch gewinnen. Wenn wir uns die Möglichkeit verschaffen, unsere Entscheidungen zu überdenken und die unvermeidlichen Verluste zu betrauern, sind wir besser in der Lage, das zu genießen, wofür wir uns entschieden haben. Es ist auch eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir die Nachteile unserer Entscheidung minimieren können – welche Alternativen zum Aufschub des Wohnungskaufs hat Jonathan? Im »impulsiven Szenario« hat Jonathan wahrscheinlich den Urlaub genossen, während er versuchte, Schuldgefühle zu vermeiden, die im Hintergrund lauerten, weil ihm unterschwellig bewusst war, dass er das Geld auch für die Wohnung verwenden hätte können. Als er aus dem Urlaub zurückkehrte, traf ihn die Realität seiner Entscheidung mit voller Wucht. Wenn wir unsere Entscheidungen mit finanziellem emotionalem Bewusstsein treffen, gewinnen wir Klarheit über die Faktoren, die sie beeinflussen, können die daraus resultierenden emotionalen Auswirkungen besser einschätzen (wir werden von unseren Gefühlen nach der Entscheidung weniger überrascht, wenn wir vorher darüber nachgedacht haben) und haben das Gefühl, dass wir sie in gewisser Weise im Griff haben.
Finanzielles Wohlergehen lässt sich nicht mit dem Meterstab messen. Es gibt keine Messgrößen, anhand deren sich feststellen lässt, wann unsere Ausgaben aus dem Ruder laufen, wann ein paar lustige Pokerabende mit Freunden zur Spielsucht ausarten oder wann »Vorsicht« im Umgang mit Geld in Knauserigkeit umschlägt.
Doch es gibt gewisse Anhaltspunkte dafür, und einige davon sind emotionaler Natur. Auf unsere Emotionen zu achten, kann uns darauf hinweisen, dass eine Grenze überschritten wurde: Ein aufsteigendes Schuldgefühl zum Beispiel sagt uns, dass etwas an unserem Verhalten nicht in Ordnung ist. Was zunächst wie eine Gewohnheit aussah, die wir im Griff hatten, scheint nun außer Kontrolle geraten zu sein. Aber auch das Gegenteil ist beileibe nicht immer der Fall: Wenn wir davon überzeugt sind, dass ein selbstzerstörerisches Verhalten in Ordnung sei, dann versuchen wir es vielleicht nur zu verleugnen.
Tatsachen sagen mehr als Worte, und hohe oder wiederholte Kreditkartenschulden oder Verluste im Spiel können uns darauf aufmerksam machen, dass wir uns um eine bestimmte Sache kümmern müssen. Auch bestimmte Verhaltensweisen können darauf hinweisen, dass vielleicht etwas nicht in Ordnung ist: Wenn wir Gespräche über Geld vollständig abblocken, wenn wir Geheimnisse vor unseren Lieben haben, und wenn wir ein auffällig widersprüchliches Verhalten an den Tag legen, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass wir mit unseren Finanzen nicht im Reinen sind.
Anzeichen dafür, dass es eine Schwierigkeit geben könnte, die es anzugehen gilt, sind oft leicht zu erkennen: Vielleicht hat man direkt oder indirekt von anderen ein Feedback erhalten (»Warum machst du dich so verrückt wegen ein paar Euro?« oder »Warum entziehst du dich jeder Diskussion über Geld?«). Sie wissen, welche Geheimnisse Sie haben (vielleicht schneiden Sie die Etiketten neuer Klamotten ab, damit Ihr Partner, Ihr Freund oder Ihre Eltern nicht merken, dass Sie einkaufen waren, oder Sie schieben es vor sich her, Ihrem Partner von der Erbschaft zu erzählen, die Sie erhalten haben). Sie wissen, was Sie beim letzten Mal, als in einer Unterhaltung das Thema Geld zur Sprache kam, am liebsten für sich behalten hätten (»Warum musste ich meinem Freund, der mir gerade erzählt hat, dass er keine Erfolgsprämie bekommen hat, verraten, wie viel ich gekriegt habe?«). Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Sie wesentlich vorsichtiger oder draufgängerischer oder risikoscheuer sind als die meisten anderen Menschen, die Sie kennen. Es geht hier nicht darum, Unterschiede als krankhaft einzustufen, sondern Ihnen zu helfen, sich Ihrer selbst bewusster zu werden und sich zu fragen: Woran liegt das?-1
*
Ohne finanzielles emotionales Bewusstsein kann uns das Gefühl überwältigen, dass wir in Verhaltensweisen und Emotionen gefangen sind, gegen die wir nicht ankommen. »Egal wie viel Geld ich in meinem Beruf verdiene, ich bin immer unzufrieden und wünsche mir mehr«; »Ich kann nicht aufhören, mit meinem Partner, meinen Geschwistern oder meinen Eltern über Geld zu streiten«; »Ich habe ständig Angst um mein Geld«. In all diesen Aussagen steckt einerseits der Wunsch, dass sich etwas ändert, andererseits aber auch eine Herausforderung in emotionaler Hinsicht: Es geht darum, etwas zu verstehen, einen Konflikt zu lösen oder einem bestimmten Gefühl Raum zu geben. Wir können diese emotionalen Hürden erkennen und überwinden, manchmal aber brauchen wir dabei Unterstützung.
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen helfen, darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Sehnsüchte, Ihre Ängste und inneren Konflikte bezüglich Geld ausdrücken können und wie Ihre früheren Erfahrungen, auch solche, die nichts mit Geld zu tun haben, Ihr Verhalten und Ihre Gefühle im Zusammenhang mit Geld beeinflusst haben könnten.
Ich werde in diesem Buch eine Vielzahl von Verhaltensweisen in Bezug auf Geld behandeln, wenngleich nicht alle. Auf Glücksspiele oder Zockereien mit hohen finanziellen Risiken zum Beispiel werde ich nicht näher eingehen, weil zu diesem Thema bereits zahlreiche Bücher (akademischer wie auch nichtakademischer Art) geschrieben wurden. Ich konzentriere mich vielmehr auf Aspekte unseres Verhältnisses zu Geld, die bislang weniger ausführlich untersucht wurden. Gleichwohl können viele der in diesem Buch behandelten Themen auch für unser Verständnis des Glücksspiels hilfreich sein (wie etwa der Masochismus, der Wunsch nach einer magischen Verwandlung, die Auflehnung oder die Suche nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung).
Kapitel 1
Wie frühere Erfahrungen unser Verhältnis zu Geld beeinflussen
Geld als Symbol
Geld ist ein starkes Symbol. Ein Symbol steht für etwas Konkretes und ist immer mit einer bestimmten Bedeutung verbunden. Wir verwenden andauernd Symbole – Eheringe für die Verbundenheit zwischen zwei Menschen, ein Herz für die Liebe, eine weiße Flagge für Kapitulation, ein Kreuz für das Christentum. Doch abgesehen von ihrer allgemein bekannten Aussage haben Symbole auch eine ganz individuelle emotionale Bedeutung. Aufgrund dieser ist es so ärgerlich oder verstörend, wenn man seinen Ehering verliert oder wenn eine Fahne verbrannt wird. Wir haben nicht nur einen Gegenstand verloren, sondern spüren diesen Verlust auch aufgrund des besonderen emotionalen Hintergrunds.
Die symbolische Bedeutung eines Gegenstands wird von vielen wahrgenommen, die emotionale ist jedoch meist sehr persönlich. Fragt man Passanten in den USA »Was bedeutet die amerikanische Flagge für Sie?«, erhält man eine Vielzahl von Antworten: Freiheit, Macht, Land der unbegrenzten Möglichkeiten; es gibt aber auch diejenigen, die sie (aufgrund der Geschichte des Landes oder ihrer eigenen Erfahrungen) mit Imperialismus oder Rassismus in Verbindung bringen.24 Bei einem Kriegsveteranen kann sie unangenehme Erinnerungen wecken, bei einem im Ausland lebenden Amerikaner nostalgische oder tröstliche Gefühle hervorrufen.
Praktisch alles kann zum Symbol werden, man muss nur eine Bedeutung darauf übertragen. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott stellte fest, dass eins der ersten von uns verwendeten Symbole das »Schmusetuch« (oder »Übergangsobjekt«, wie es in der Fachsprache heißt) ist, weil es ein Objekt in der realen Welt mit einer persönlichen Bedeutung verbindet.25 Die Decke/das Kuscheltier/der Schnuller steht für Trost und füllt den Raum, der zwischen Mutter und Kind entsteht, wenn sich das Kind in seiner Entwicklung nach und nach von der Mutter löst. Die Kuscheldecke erhält also die Bedeutung, die das Kind ihr zuschreibt, psychologisch wie emotional.
Geld strotzt geradezu vor Bedeutung. Während seine gemeinsame Bedeutung (als Tauschmittel) allgemein akzeptiert wird, ist seine psychologische und emotionale Bedeutung vielfältig und für jeden von uns einzigartig. Wofür Geld in unseren Köpfen steht (und zwangsläufig unseren Umgang damit beeinflusst), hängt von unseren eigenen Erfahrungen ab. Ich möchte hier nicht näher auf die Geschichte des Geldes und der Währungen eingehen, sondern Sie stattdessen dazu einladen, sich mit Ihrer eigenen Geschichte zu befassen, um Hinweise darauf zu finden, wofür Geld in Ihrem Bewusstsein steht. Was bedeutet Geld für Sie?
Die vielfältigen Bedeutungen von Geld spiegeln die Vielfalt unserer menschlichen Erfahrungen und unserer inneren Welten wider. Unsere Erziehung, unsere Erlebnisse und unser Selbstwertgefühl beeinflussen unseren Umgang mit Geld. Geld steht bei den verschiedenen Menschen für ganz unterschiedliche Dinge, und wir gebrauchen (oder missbrauchen) es, um unbewusst Gefühle über uns selbst oder andere auszudrücken. Geld steht beispielsweise für:
Sicherheit, die wir empfinden oder anstrebenMacht, die wir über andere haben oder die dazu benutzt wird, uns zu kontrollieren oder unsere Freiheit einzuschränkenFreiheit, Gelegenheiten zu nutzen, das Leben in vollen Zügen zu genießen oder eine missbräuchliche Beziehung zu beendenein besseres Selbstwertgefühl für diejenigen, die das Gefühl haben, nur mit Geld hätten sie die Aufmerksamkeit, den Respekt oder die Liebe »verdient«, die man ihnen entgegenbringtFairness, wenn wir in unserem Gehalt, einer Erbschaft oder der Aufteilung der Rechnungen mit unseren Mitbewohnern die Bestätigung sehen, dass wir nicht ausgebeutet werdenaber auch noch für vieles andere, etwa moralische Verkommenheit, Männlichkeit, Prestige, LiebeNehmen wir zum Beispiel Francesca und Isabel, die beide Probleme hatten, eine Gehaltserhöhung auszuhandeln, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Francesca hatte Karriere im Marketing gemacht. Sie kannte ihren Wert und war sogar ein bisschen stolz auf ihre Leistung. Sie wusste schon seit längerem, dass sie im Vergleich zu ihren Kollegen in der Firma unterbezahlt war, und auch im Vergleich zu dem, was sie in anderen Unternehmen für ihre Tätigkeit bekommen könnte. Trotzdem konnte sich Francesca nicht dazu durchringen, um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Der Gedanke, ihrem Chef gegenüberzutreten und ein Gespräch über ihr Gehalt zu führen, erfüllte sie mit Angst und Schrecken. Die Bücher mit Tipps und Strategien für Gehaltsverhandlungen, die sie gelesen hatte, hatten ihr auch nicht geholfen. Wir mussten also herausfinden, warum es Francesca so schwerfiel, etwas zu fordern, von dem sie wusste, dass es ihr zustand. Francesca war mit einer jähzornigen und kritischen Mutter aufgewachsen, die frustriert war, dass sie ihre Karriere aufgegeben hatte, um die Kinder großzuziehen. Der Vater war beruflich viel unterwegs und selten zu Hause gewesen. Infolgedessen konnte Francesca ihre Leistung zwar auf einer bestimmten Ebene anerkennen, doch ein Teil von ihr hatte immer das Gefühl, sie hätte »es nicht verdient«, sei »nicht gut genug« oder auch »zu bedürftig«.
In der Therapie mussten wir diese Seite besser verstehen und die Wut und Enttäuschung darüber aufarbeiten, dass ihre Eltern sie nicht stärker unterstützt hatten. So sollte sie in der Lage sein, die Realität mit neuen Augen zu sehen und ihr »Ich bin nicht gut genug«-Narrativ durch ein positiveres zu ersetzen. Der Blick auf das »kritisierte kleine Mädchen« half ihr, diesen Teil ihres Selbst zu verstehen und besser damit umzugehen, damit beim Gehaltsgespräch ihr erwachsener Teil die Oberhand hatte, dem bewusst war, dass sie eine qualifizierte und tüchtige Mitarbeiterin war, die eine bessere Bezahlung verdiente, und kein »bedürftiges kleines Mädchen«.
Auch Isabel fiel die Bitte um eine Gehaltserhöhung schwer und sie hatte Probleme, ein ihrer Meinung nach angemessenes Gehalt zu verlangen, doch bei ihr hatte das mit der in ihrer Familie verbreiteten Ansicht zu tun, dass »Gier schlecht« und »Geld schmutzig« sei. Da Isabels Familie stolz auf ihre Bescheidenheit und harte Arbeit war, hatte sie aus ihrer Kindheit die Botschaft mitgenommen, dass man zufrieden und dankbar für das sein sollte, was man hat, um nicht unzufrieden oder »zu gierig« zu wirken. Einerseits respektierte Isabel die Werte ihrer Familie und bemühte sich aufrichtig, danach zu leben. Andererseits brauchte sie als Erwachsene Hilfe, um ihre eigene Version dieser Werte zu formulieren und selbst zu entscheiden, was Ehrgeiz in Abgrenzung zu Gier ist, was fair und was undankbar ist.
Dieses Dilemma in Worte zu fassen und die verschiedenen Bedeutungsnuancen herauszuarbeiten, half ihr, das Gefühl der Angst und Schuld abzulegen und eine selbstbewusstere Haltung einzunehmen, dank der sie das Gefühl hatte, dass die von ihr erbetene Gehaltserhöhung vernünftig und verdient war.
Ein schlechtes Finanzmanagement oder Schwierigkeiten im Umgang mit Geld können wir besser verstehen, wenn wir die dahinter verborgenen emotionalen Probleme erschließen. Ein emotionales Bewusstsein für Finanzen bedeutet, die Wünsche, Sehnsüchte oder Ängste zu verstehen, die bei unserem Umgang mit Geld zum Ausdruck kommen, und sich der Gefühle bewusst zu sein, die hinter unseren finanziellen Entscheidungen stehen.
Wenn ich versuche, Ihr finanzielles emotionales Bewusstsein zu schärfen, indem ich die psychologischen Aspekte des Geldes erläutere, werden wir unweigerlich bei frühen Erfahrungen landen. Das liegt nicht etwa daran, dass unser Verlangen nach Geld bereits in der Kindheit einsetzt, sondern dass die Sehnsüchte, die wir mit seiner symbolischen Bedeutung verbinden, schon sehr früh auftreten. Die Psychoanalytikerin Lesley Murdin schreibt dazu: »Der Wunsch nach Geld ist nicht infantil. Ein Kind mag sich nach Macht, nach Kontrolle […], nach Liebe sehnen, aber es sehnt sich nicht nach Geld. Erst Erwachsene in all ihrer Komplexität verstehen, dass Geld vieles von dem symbolisiert, was sie wollen oder glauben zu wollen.«26 Unser aktueller Umgang mit Geld wurzelt in frühen Erfahrungen; wir hoffen, dass Geld Sehnsüchte stillt, die wir hatten, bevor wir überhaupt wussten, was Geld ist. Oft muss Geld als Ersatz für unsere emotionalen Bedürfnisse herhalten. Wenn wir verstehen, was uns Geld bedeutet, können wir auch informierte Entscheidungen treffen.
Aufgrund des emotionalen Ballasts, den Geld mit sich bringt, kann es auch unsere Beziehungen belasten. In Beziehungen ist Geld oft ein wahres Minenfeld, weil wir zugelassen haben, dass Geld zum Symbol (oder zum Kommunikationsmittel) für mehr als nur finanzielle Belange wurde. Oder anders ausgedrückt: Wir verwenden Geld, um unbewusste Gefühle über andere oder unsere Beziehung zu ihnen auszudrücken. Doch die Botschaft, die auf diese Weise übermittelt wird, ist unklar und kann dazu führen, dass wir uns in endlosen, unlösbaren Konflikten verfangen. Aber warum lassen wir überhaupt das Geld sprechen? Wäre es nicht besser, zu verstehen, was wir mit Geld ausdrücken wollen?
Die Vorstellungen, wofür Geld steht und wie es verwendet werden soll, gehen weit auseinander: Was den einen schon exzessiv vorkommt, ist für die anderen noch zu wenig; was fair und vernünftig erscheint, wirkt auf andere ungerecht und damit unvernünftig. Falls Sie kürzlich ein Date hatten, haben Sie wahrscheinlich schon im Vorfeld überlegt, was der oder die andere erwarten wird, wenn die Rechnung kommt. Ist er oder sie für Gleichberechtigung und will die Rechnung teilen? Oder würde er/sie es schätzen oder sogar erwarten, dass Sie ihn einladen? Das Angebot, die Rechnung zu übernehmen, kann als galant, großzügig, als »Machtspielchen«, kontrollierend oder schlicht nett wahrgenommen werden. Die Erwartung, eingeladen zu werden, kann unterwürfig oder berechnend wirken. Wir wissen es einfach nicht.
Zu erraten, wie jemand anderes über Geld denkt oder unser Verhalten interpretiert, kann verunsichern. Die Rechnung liegt auf dem Tisch: eine peinliche Situation. Man fühlt sich irgendwie bloßgestellt oder verwundbar; man weiß, dass man aus dieser Situation nicht so leicht rauskommt: Man muss etwas von sich oder zumindest von seinen Ansichten preisgeben.
Schon die einfache Frage »Sollen wir teilen?« verrät, dass wir nicht die Absicht haben, die komplette Rechnung zu übernehmen. Wartet man zu lange darauf, dass der andere zuerst etwas sagt, kann das als mangelnde Bereitschaft interpretiert werden, sich überhaupt zu beteiligen.
Die Begleichung der Rechnung ist, wie vieles bei einem ersten Date, Teil einer Dynamik, in der man nach und nach seine Werte und Ansichten preisgibt und gleichzeitig die des anderen entdeckt, und das alles in der Hoffnung, den anderen weder zu verletzen noch das Interesse an ihm zu verlieren, wenn man mehr über ihn weiß. Wird man die Unterschiede verstehen und akzeptieren können? Lassen sie sich überbrücken? Geld ist nur einer von vielen Bereichen, in denen sich ein Paar solchen Fragen stellen muss.
Paola (die wir in Kapitel 8 noch näher kennenlernen) wurde als Kind von ihren Eltern massiv kontrolliert. Diese Kontrolle zeigte sich auch beim Geld; Paola bekam im Gegensatz zu Gleichaltrigen nie ein Taschengeld, weshalb sie es sich nicht leisten konnte, auszugehen und etwas mit anderen Jugendlichen zu unternehmen. Jahre später, bei ihren ersten Verabredungen mit ihrem zukünftigen Ehemann, konnte sie nicht zulassen, dass er ihre Kinokarte bezahlte. »Wir gehen ins Kino, wenn ich es mir leisten kann«, sagte sie ihm. Für sie war das viel angenehmer, als ihn zahlen zu lassen. Und warum? Paola waren finanzielle Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ungemein wichtig, sie verband damit ein Gefühl der Freiheit. Wenn sie ihr Date zahlen ließ, hätte sie das beunruhigende Gefühl gehabt, dass jemand anderes über ihr Vergnügen bestimmte. Sie wollte nicht zulassen, dass Geld auch in ihrer zukünftigen Beziehung dazu genutzt wurde, sie zu kontrollieren.
Für die meisten Menschen ist die Dynamik in Verbindung mit Geld eher subtil und wird nur unbewusst wahrgenommen. Uns ist meist gar nicht klar, dass wir mit Geld eine zwischenmenschliche Dynamik der Abhängigkeit, Kooperation oder Gleichheit schaffen, vor allem, wenn es sich um eine gesunde Dynamik handelt, die keinen Stress verursacht und daher auch nicht unangenehm auffällt.
Nach meiner Erfahrung lässt sich jedoch nicht leugnen, dass unser Umgang mit Geld – wie wir es interpretieren, darüber reden, danach streben, es verleugnen, vermeiden oder verachten – nicht nur von unseren finanziellen, sondern ganz allgemein von vergangenen Erfahrungen beeinflusst wird. Was Geld für uns bedeutet, wird von vielen Faktoren beeinflusst.
Wir würden uns zu sehr einschränken, wenn wir bei unserem Verhältnis zum Geld nur überlegten, was wir von unseren Eltern über Geld gelernt haben, wie wir mit unserem Taschengeld umgegangen sind und ob wir im Überfluss oder in Armut aufwuchsen (also die emotionale Prägung durch unsere Erfahrungen). Ob einschneidende Erlebnisse wie Traumata und Verluste oder kleine Interaktionen, all unsere Erfahrungen von der Wiege bis zur Gegenwart haben einen Einfluss darauf, was wir von uns selbst und von anderen erwarten, wonach wir uns sehnen und wovor wir Angst haben.
Wir sind das Produkt unserer vergangenen Erfahrungen: Sie haben uns geprägt, vor allem, wenn sie emotional aufgeladen waren. Was wir mit unseren Gefühlen (damals) gemacht haben und wie die Menschen in unserem Umfeld uns halfen, damit umzugehen, prägt uns emotional bis heute und bestimmt, wie wir mit ähnlichen Problemen in der Gegenwart umgehen. Unsere frühen Beziehungen haben großen Einfluss darauf, wer wir sind, wie wir uns selbst fühlen, wie wir künftige Beziehungen aufbauen und wie wir die Welt um uns herum erleben.
Wenn ein Psychotherapeut Ihre Beziehung zu Geld betrachtet, beginnt er vielleicht mit einem Problem in der Gegenwart, versucht jedoch gleichzeitig, mit seinem »Werkzeugkoffer« die unbewussten Gefühle und Gedanken zu ergründen, die hinter diesem Verhalten stecken könnten, um herauszufinden, wonach man sich eigentlich sehnt oder wogegen man sich wehrt.
Das Problem, zu viel auszugeben, könnte in Wirklichkeit mit dem Wunsch zu tun haben, dazuzugehören.Das Problem, zu wenig Geld auszugeben, könnte mit unserem geringen Selbstwertgefühl zusammenhängen.Heimlichtuerei in finanziellen Dingen könnte mit einem Gefühl der Scham zu tun haben.Bei Spielsucht könnte es darum gehen, dass wir unsere Eltern dafür bestrafen wollen, dass sie uns vernachlässigt haben.Betrachten wir ein Beispiel aus einer Therapiesitzung:
Michael: »Ich plane ja nicht im Voraus, so viel Geld auszugeben, es passiert einfach, wenn ich mit Freunden unterwegs bin.«
Therapeutin: »Es passiert einfach …«
Michael: »Genau … wenn wir ausgetrunken haben, rufe ich plötzlich: ›Die nächste Runde geht auf mich!‹«
Therapeutin: »Und wie fühlen Sie sich dann?«
Michael: »Das ist so eine Mischung … zu 5 Prozent Bedauern, kaum dass ich es gesagt habe … aber hauptsächlich Begeisterung … und Erleichterung.«
Therapeutin: »Erleichterung?«
Michael: »Ja, als ob etwas in mir ruhiger werden würde.«
Therapeutin: »Wie wenn …?«
Michael: »Wie wenn ich mir, zumindest für den Moment, keine Gedanken machen müsste, dass die anderen mich mögen.«
Michael war das mittlere Kind von drei Geschwistern und musste, weil sein Vater Diplomat war, häufig umziehen und die Schule wechseln. In Beziehungen zu anderen fühlte er sich oft unsicher. Selbst innerhalb der Familie fürchtete er als mittleres Kind, ausgeschlossen zu werden, weil seine Schwester eine starke Bindung zum Vater hatte und sein Bruder zur Mutter. Er war sich nicht sicher, ob er um seiner selbst willen geliebt wurde. Ganz gleich, wie viele Ratschläge er von seiner frustrierten Frau zum Thema Finanzen erhielt, sein Umgang mit Geld war nicht rational, sondern emotional. In der Vergangenheit hatte er Erfahrungen gemacht, die ihn dazu brachten, Ausgrenzung und Ablehnung zu fürchten, und die er nun aufarbeiten musste. Im Hier und Jetzt musste er seine Befürchtungen einem Realitätscheck unterziehen (werden seine Freunde wirklich weniger von ihm halten, wenn er nicht ganz so großzügig ist?) und sich davon überzeugen, dass die Zukunft nicht so sein muss wie die Vergangenheit, und dass er in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ihm die kalte Schulter gezeigt wird, sobald seine Großzügigkeit nachlässt, kein Schuljunge mehr ist, der allein auf dem Spielplatz steht, sondern ein Erwachsener, der sich Freundschaften suchen kann, die auf Gegenseitigkeit beruhen.
Wie wir uns selbst sehen
Vergangene Beziehungen haben Einfluss darauf, wie wir uns als Persönlichkeit entwickeln und die Welt erleben, was sich wiederum darauf auswirkt, was wir uns als Erwachsene gönnen, was wir uns wünschen und wie wir uns verhalten. Viele der im Buch beschriebenen Probleme im Umgang mit Geld haben ihren Ursprung in der Frage, ob wir etwas verdient haben, ob wir Anspruch auf etwas haben oder ob wir Handlungsfähigkeit zeigen wollen.
Unsere Beziehung zu unseren ersten Bezugspersonen prägt unser Selbstverständnis: von der ersten Bindung zwischen Mutter* und Kind, den Erfahrungen, als Baby gehalten, gefüttert und gewickelt zu werden, bis hin zu allen späteren Interaktionen (wie reagieren unsere Bezugspersonen auf uns, wie ermutigen sie uns, wie drücken sie ihren Ärger über uns aus). All diese Erfahrungen wirken sich auf unser Gefühl aus, wie liebenswert/fähig wir sind. Ein Baby, das angelächelt und liebevoll in den Arm genommen wird, dessen Bedürfnisse von seinen Eltern angemessen interpretiert und erfüllt werden, wird das Gefühl entwickeln, dass es der Liebe würdig ist, dass es wertvolle Eigenschaften hat und dass die Welt ein sicherer Ort zum Leben ist. Ein vernachlässigtes Baby wird mit einem ganz anderen Selbstverständnis aufwachsen: Es hält sich vielleicht für nicht erwünscht, nicht liebenswert oder für unfähig. Die Welt betrachtet es womöglich als bedrohlichen, gefährlichen Ort und fühlt sich entsprechend verwundbar.
Winnicott erklärt, dass die Persönlichkeit eines Kindes von dem geprägt ist, was es im »Spiegel« des mütterlichen Gesichts sieht: eine desinteressierte, wütende oder deprimierte Mutter wirkt sich auf das Baby aus, das sich als weniger »gut«, liebenswert oder interessant wahrnimmt. Genauso wichtig ist das sogenannte »Attunement« (Feinabstimmung) zwischen Mutter und Kind, bei dem die Mutter die Bedürfnisse des Kindes interpretiert und versteht. Eine Mutter, die nicht auf ihr Kind eingeht, hinterlässt bei ihm ein Gefühl der Unzulänglichkeit und Scham. Dazu kommen Gefühle wie Verwirrung und Hilflosigkeit. Die Mutter (und damit die Welt, in der es lebt) erscheint ihm hart, kalt und abwertend.
In der Summe führen diese Erfahrungen dazu, dass sich dieser Eindruck in uns verfestigt. Haben wir das Gefühl, dass wir etwas Gutes (wie Liebe oder Geld) verdient haben? Steht uns ein Kompliment, ein leckerer Nachtisch, ein liebevoller Partner sowie die schönen Dinge, die man mit Geld kaufen kann, überhaupt zu und können wir sie genießen? Vielleicht fällt es uns schwer, Geld zu haben und auszugeben, weil unsere früheren Erfahrungen in uns das Gefühl hinterlassen haben, dass wir »nicht gut genug« sind und etwas Schönes nicht verdienen. Das führt dazu, dass wir uns Verhaltensweisen angewöhnen, die unseren finanziellen Erfolg beeinträchtigen, und unser Umgang mit Geld unausgewogen ist: Wir verschenken es, geben es schnell wieder aus oder horten es in der Hoffnung, unser Selbstwertgefühl zu stärken.
Vielen Menschen fällt es schwer, etwas Gutes zu genießen oder zu schätzen. Sie werden von Scham und dem Gefühl gequält, sie hätten es nicht verdient. Wenn sie sich doch etwas gönnen, können sie es nicht genießen oder gehen davon aus, es schnell wieder zu verlieren (»das ist zu schön, um wahr zu sein, es wird nicht halten«) oder sabotieren sich selbst. Manche haben Schuldgefühle beim Essen oder fühlen sich wie ein Hochstapler, wenn sie etwas erreicht haben. In den Kapiteln, in denen es darum geht, zu wenig auszugeben oder sich selbst zu sabotieren, werden wir über diese Veranlagung sprechen und Menschen begegnen, die unter »finanzieller Magersucht« leiden oder sich lieber selbst ruinieren, anstatt ihr Geld zu behalten und zu genießen.
Der Kreis der Bezugspersonen erweitert sich im Lauf der Zeit. Wir beginnen, neben der Mutter (die in den ersten Wochen so ziemlich alles ist, was ein Baby wahrnehmen kann) Interaktionen mit unserem Vater, unseren Geschwistern, Großeltern, Lehrern und der Gesellschaft zu registrieren. Auch diese Interaktionen haben Auswirkung auf unser Selbstbild. Innerhalb der Familie ist interessant, mit welchem Elternteil man sich besonders identifiziert. Wenn man nicht versteht, warum man bei beruflichen Entscheidungen an sich zweifelt und sich bei einem Erfolg wie ein Hochstapler fühlt, sollte man sich fragen, ob diese defätistische Haltung daher rührt, dass man sich mit einem Elternteil identifiziert, der kein Vertrauen in seine Fähigkeiten hatte oder nicht das »Zeug« zum Erfolg hatte.
Natürlich identifizieren wir uns nie ausschließlich mit einem Elternteil: In Bezug auf Arbeit und Geldverhalten identifizieren wir uns vielleicht mit dem Vater, in Hinblick auf Beziehungen mit der Mutter. Wir sprechen hier von komplexen, unbewussten, multifaktoriellen Phänomenen, die wir im Einzelfall nicht wissenschaftlich untersuchen können, die es uns aber trotzdem ermöglichen, unser Verständnis von uns selbst zu erweitern.
Wie wir uns selbst sehen, hat Einfluss auf unseren Umgang mit Geld. Genauso wichtig ist die Fähigkeit, unsere Gefühle zu erkennen, zu benennen und zu steuern. Auch diese Fähigkeit wird über das Attunement mit unserer primären Bezugsperson erlernt: Ihre Fähigkeit, unsere Emotionen und Bedürfnisse zu erkennen, überträgt sich bei ausreichend guten Erfahrungen auf uns. Untersuchungen haben gezeigt, dass es emotional beeinträchtigten Kindern an Selbstbewusstsein und der Fähigkeit mangelt, ihre Gefühle zu benennen und zu reflektieren (was der Psychoanalytiker Peter Fonagy als »Mentalisierung« bezeichnet), aber auch an der Fähigkeit, den mentalen Zustand anderer zu erkennen.27 Wir neigen viel eher dazu, unsere Gefühle destruktiv auszuleben, wenn wir sie nicht reflektieren, geschweige denn kontrollieren können.
Wie die Welt auf uns reagiert
Unsere frühen Erfahrungen formen auch unseren Sinn für Handlungsfähigkeit und unsere Erwartungen an die Art und Weise, wie andere uns begegnen und auf uns reagieren. Beides ist wichtig für unsere Fähigkeit, finanziell erfolgreich zu sein, aber auch für das Gefühl, dass wir bei der Verwaltung unserer Finanzen das Heft in der Hand halten.
Angefangen bei den frühen Mutter-Kind-Interaktionen prägen frühe Beziehungen unsere Erwartungen, wie die Welt auf uns reagiert. Wie die Jungianer Deborah C. Stewart, Lisa Marchiano und Joseph R. Lee in der Folge »The Money Complex« im Podcast This Jungian Life ausführen, wird ein Säugling, der sich der Brust zuwendet und feststellt, dass ihm die Brust im Gegenzug angeboten wird, mit dem Gefühl aufwachsen, dass die Welt positiv reagiert, wenn er nach etwas verlangt.28
Eine Mutter, die ihrem Kind die Erfahrung vermittelt, dass sie emotional präsent, aufmerksam und ansprechbar ist, hilft dem Kind nicht nur, sich wertgeschätzt, geborgen und umsorgt zu fühlen, sondern gibt ihm auch das Gefühl, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden können (sie sind sowohl akzeptabel als auch erfüllbar). Derartige Erfahrungen sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir ein Gefühl der Handlungsfähigkeit entwickeln. Um Karriere zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, brauchen wir ein gewisses Maß an Vertrauen, dass die Welt positiv auf uns reagiert.29 Für ein selbstbewusstes Auftreten (etwa wenn wir Kunden eine Idee präsentieren) ist eine bestimmte Menge an positiven Erfahrungen erforderlich, bei denen der Empfänger auf unsere Botschaft mit Interesse oder zumindest mit Respekt reagiert hat. Wenn das nicht der Fall war, werden wir diese Situationen entweder meiden (und in unserem Streben bescheiden bleiben) oder von Angst überwältigt werden, wenn wir mit ihnen konfrontiert sind.





























