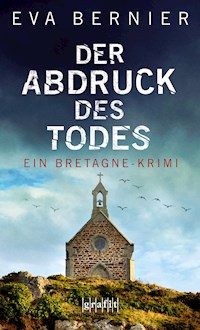
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Robert Le Clech
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Mord führt Adjudant-chef Robert Le Clech auf eine spannende Jagd in der malerischen Bretagne.
Zerklüftete Felsen, einsame Dörfer und mystische Legenden bilden die Kulisse für einen rätselhaften Fall in Eva Berniers fesselndem Kriminalroman Der Abdruck des Todes. Adjudant-chef Robert Le Clech freut sich auf einen romantischen Sommer mit seiner Bekannten Barbara, für die er heimliche Gefühle hegt. Doch aus der trauten Zweisamkeit wird nichts. Stattdessen wird er zu einem grausigen Leichenfund gerufen: Mitten auf einem Artischockenfeld wurde ein abgetrennter Frauenarm entdeckt. Verstreute Abdrucke des Arms und anderer Körperteile, die in einer traditionellen japanischen Kunsttechnik angefertigt wurden, geben den Ermittlern Rätsel auf. Dass Zeugen eine Unheil bringende Sagengestalt in einem Boot gesehen haben wollen, verkompliziert die Arbeit der Gendarmerie noch zusätzlich.
Als ein Au-pair-Mädchen verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Hat der Mörder sein nächstes Opfer bereits im Visier?
Der Abdruck des Todes besticht durch eine gelungene Mischung aus Spannung, atmosphärischem Lokalkolorit und der faszinierenden Welt der japanischen Kunst. Lassen Sie sich von Eva Berniers lebendigen Charakteren und wendungsreicher Handlung in den Bann ziehen und begleiten Sie Robert Le Clech bei seiner Jagd nach dem Mörder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Eva Bernier
Der Abdruck des Todes
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung von Adobestock/pogana22
Lektorat: Nadine Buranaseda, typo18, Bornheim
E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck
Eva Bernier
1
Es war Flut. Eine strahlende Sonne beherrschte den wolkenlosen Himmel über dem Ärmelkanal. Von Südwest kommend, kräuselte eine leichte Brise die von tiefblau bis silbrig changierende Oberfläche des Meeres rund um die Halbinsel. Unablässig trieb die Strömung das Wasser in die breite Mündung des Jaudy hinein. Der höchste Tidenstand war fast erreicht, überall an den Ufern trafen kurze, stetige Wellen auf die steinige Küste. Auch an den Granitquadern am Ende der alten Mole von Port Béni leckten sie in gleichmäßigem Rhythmus. Im offenen Hafenbecken wiegten sich an runden weißen Bojen festgemachte Barken und Boote.
Es war Mittag, Anfang Juli. Nach der allmorgendlichen Betriebsamkeit lag der kleine Küstenort wieder verlassen da. Touristen und Spaziergänger waren unterwegs zu ihrem Mittagstisch, die einheimischen Hummer- und Krabbenfischer würden erst mit der nächsten Flut spätabends zurückkehren. Selbst der Spielplatz auf dem Rasenstück hinter den Parkplätzen war verwaist. Die Kinderstimmen, die den halben Morgen die Luft zum Schwingen gebracht hatten, waren verstummt.
Ganz still war es allerdings nicht. Oberhalb des Hafens, auf einem von der Straße durch eine Reihe zerzauster Eiben getrennten Feld wurde geerntet. Im Schritttempo bewegte sich ein Traktor laut brummend durch die akkuraten Artischockenreihen, gefolgt von zwei Erntehelfern, einem Mann und einer Frau. Mit geübten Handgriffen schnitten sie die kinderkopfgroßen Artischockenknospen von den Stielen und warfen sie auf den Anhänger hinter dem Traktor. Die Arbeit ging nur langsam voran, sie hatten noch gut ein Drittel des Felds vor sich.
Am äußersten Ende der Mole, oberhalb der Steintreppe, die zum Wasser hinunterführte, saß eine Möwe und beobachtete die Fluten. Von der offenen See, weit hinter dem Leuchtfeuer, das nachts die Einfahrt in die Flussmündung anzeigte, näherte sich gemächlich eine höhere Welle, schwappte heran, klatschte im zweiten Anlauf hoch an die Kaimauer, bespritzte den Granit. Mit einem kurzen Schrei erhob sich die Möwe in die Luft und flog einen eleganten Bogen durch den blauseidenen Himmel Richtung Land. Flugs hatte sie Hafen und Mole überquert und kreiste dann in einer ruhigen Aufwärtsspirale einige Male über das Feld. Minutenlang ließ sie sich mit ausgebreiteten Flügeln von der Thermik höher tragen. Nichts schien die Leichtigkeit und Mühelosigkeit ihres Gleitflugs stören zu können.
Plötzlich unterbrach sie das Segeln, um steil zu sinken und nach ein paar wenigen abrupten Richtungswechseln in einer Furche zwischen zwei Artischockenpflanzen einzutauchen. Sie war nicht mehr zu sehen, als wäre sie von der Erde verschluckt worden.
Vom anderen Ende des Felds kroch der Traktor mit seinem Anhänger langsam näher. Der Fahrer, ein junger Mann mit Sturmfrisur und braun gebrannten, nur knapp von einem verschwitzten T-Shirt bedeckten Oberarmen, fuhr geradeaus weiter, ohne vom Kurs abzuweichen. Von seinem hohen Sitz aus überblickte er das regelmäßige Muster, das die Artischocken auf der dunklen Erde hinterließen. Während seine Hände das große Steuerrad fest umklammert hielten, achtete er darauf, die Maschine samt Anhänger genau zwischen den Pflanzenreihen zu lenken.
Mittlerweile hatte der Trecker die Stelle, wo die Möwe zwischen den Artischocken verschwunden war, beinahe erreicht. Kurz bevor es so weit war, erhob sich der Vogel mit einem jähen Flügelschlag vom Boden, streifte das linke Vorderrad und flog quer über das Feld zurück zum Wasser, in seinem Schnabel einen abgerissenen Fetzen von dem, was in der Furche lag. Unter den ausladenden stacheligen Blättern einer besonders großen Artischocke zeichnete sich der Rest seiner Beute undeutlich ab.
Der Fahrer hatte die Möwe beobachtet und blickte nun von oben direkt in die Erdfalte hinein. Er sah etwas Längliches, schmutzig Graues. Es ähnelte einem abgestorbenen Ast, dessen krallenartiges Ende wie eine freigelegte Wurzel aus dem Ackerboden herausragte. Das ließ ihn erschrocken auf die Bremse treten. Mit einem Ruck stoppten Traktor und Anhänger mitten auf dem Feld. Der junge Mann stierte nach unten. Er wollte seinen Augen nicht trauen, schaffte es aber auch nicht, sich abzuwenden. Sein Magen reagierte schneller als sein Verstand. Der Brechreiz ließ ihm keine Wahl, er musste sich sofort zur Seite drehen und übergeben.
Auf die wiederholten Zurufe seiner beiden Helfer, die verwundert hinter dem Anhänger stehen geblieben waren, konnte er zunächst nicht antworten. Erst als sie nach vorne kamen, deutete er auf die Stelle.
Im Schattenspiel der langen Artischockenblätter lag ein abgehackter menschlicher Arm. Die feingliedrige Hand mit den leicht gekrümmten Fingern zeigte nach oben, der Unterarm war noch intakt, während am Ende des Oberarms, da, wo er von der Schulter getrennt worden war, ein Fetzen menschlichen Fleischs vom Knochen hing, blassrosa. Der ganze Arm war von einer anthrazitgrauen Farbe bedeckt, die Haut darunter erschien wie marmoriert.
Die Frau stieß einen Schrei aus, drehte sich um und rannte davon. Beide Männer schauten fassungslos auf den Fund, unfähig, sich zu rühren. Nach einer Weile gelang es dem älteren, den Blick von der Furche loszureißen.
Mit atemloser Stimme wandte er sich an den jungen Mann, der immer noch wie erstarrt auf dem Fahrersitz des Traktors saß. »Ruf die Gendarmen an, schnell!«
***
Adjudant-chef Robert Le Clech parkte seine Harley-Davidson neben den Hortensienbüschen entlang der engen Einfahrt zum Haus von Barbara Leport. Die vor wenigen Jahren renovierte Bauernkate lag geschützt oberhalb einer flachen Bucht an der Mündung des Flusses Jaudy. Von dort hatte man einen weiten Blick, im Osten bis zum offenen Meer. Er war bereits ein paarmal da gewesen, um sich nach ihr zu erkundigen, das lag inzwischen mehrere Wochen, sogar Monate zurück. Es waren kurze Besuche gewesen, bei denen es lediglich eine Tasse Kaffee gegeben hatte. Die Unterhaltungen drehten sich hauptsächlich um ihre Genesung von einem Knöchelbruch und um den bevorstehenden Sven-Krug-Mordprozess, bei dem die Ehefrau des Ermordeten, ihre einstige Freundin, als Hauptangeklagte vor Gericht stehen würde.
Le Clech wäre es durchaus recht gewesen, wenn es außer dem Mordfall, der sie beide seit dessen Aufklärung trotz oder vielleicht wegen der belastenden Umstände miteinander verband, andere Gesprächsthemen gegeben hätte. Die Ereignisse, bei denen sie sich kennengelernt hatten, waren höchst unerfreulich gewesen und er merkte, dass es ihr noch nicht gelungen war, sich völlig davon zu erholen. Aber er hatte sich vorgenommen, ihren Schmerz zu respektieren, und versuchte nicht, ihre Zurückhaltung zu überwinden.
Obwohl er sie mit »Barbara« anredete – so waren sie einander zu Lebzeiten von ihrem verstorbenen Ehemann vorgestellt worden –, siezten sie sich immer noch. Dabei verhielt sie sich ihm gegenüber durchaus freundlich, jedoch leicht distanziert, als wären seine Besuche vor allem seiner Dienstpflicht geschuldet. Das frustrierte ihn ein wenig, denn er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass sie ihn als Freund und nicht als Amtsperson behandelte. Eigentlich wünschte er sich mehr – emotionale Nähe. Daran war allerdings vorerst nicht zu denken, er musste sich in Geduld üben.
Nachdem ihr Knöchel verheilt war, nutzte Barbara Leport ihre wiedergewonnene Bewegungsfreiheit dazu, nach Deutschland zu reisen, angeblich um dort Familienangelegenheiten zu regeln. Le Clech vermutete, dass sie Abstand von den schrecklichen Ereignissen nehmen wollte, in die sie hineingezogen worden war. Da sich ihre Abwesenheit über Monate hingezogen hatte, fürchtete er, dass sie nicht mehr in die Bretagne zurückkehren würde und dabei war, den Rückzug in ihr Heimatland vorzubereiten.
Schließlich hatte Barbara Leport in den letzten Jahren hautnah zwei tragische Todesfälle erleben müssen. Wenige Monate nach ihrer gemeinsamen Übersiedlung in die Bretagne kam Yann, ihr Mann, beim Fischen auf See um, dann, keine drei Jahre später, versuchte Elsa Krug, ihre bis dato beste Freundin aus Studientagen, auf deren Besuch sie sich gefreut hatte, nicht nur, ihren Ehemann Sven umzubringen, sondern verhielt sich anschließend auch kalt und skrupellos ihr gegenüber, ließ sie hilflos und verletzt zurück.
Nach solchen Erlebnissen wäre es nicht verwunderlich, wenn Barbara die Halbinsel von Lézardrieux, Le Clechs Revier, fortan nicht mehr als einen für sie geeigneten Wohnort empfinden würde und woanders einen Neubeginn versuchen wollte. Daher war ihre Einladung zum Mittagessen eine freudige Überraschung für ihn gewesen. Er hoffte nur, dass es kein Abschiedsbesuch sein würde.
Le Clech zog an der Schnur, die von einer Miniaturschiffsglocke an der Wand neben der Haustür hing.
»Kommen Sie herein, die Tür ist nicht abgeschlossen.«
Sie stand am Herd in der zum Wohnzimmer offenen Küche und schob gerade eine flache Auflaufform in den Ofen. Eilig streifte sie den Ofenfäustling ab und gab ihm zur Begrüßung die Hand. Ein Küsschen auf die Wange rechts und links, wie unter guten Freunden in Frankreich üblich, wäre ihm lieber gewesen, doch er schob den Gedanken beiseite.
»Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Und laut Wetterdienst soll es die nächsten Tage so bleiben.« Dabei schaute er aus dem Küchenfenster, das die Aussicht auf den nördlichen Teil der Bucht freigab.
Der lag im strahlenden Sonnenschein, nur die Neigung der Strandgräser und der erstarkte Wellengang zeigten, dass der Wind aufgefrischt war.
»Ja, ich habe schon überlegt, ob ich den Tisch nicht draußen auf der Terrasse decken soll, aber der Wind ist zu unangenehm, ich glaube, wir bleiben lieber drinnen.« Sie deutete auf den langen Tisch zwischen Küche und Wohnzimmer, auf dem bereits für zwei Personen gedeckt war. »Könnten Sie die für mich aufmachen?«
Le Clech nahm die Flasche Weißwein samt Korkenzieher entgegen. Nach der für seinen Geschmack allzu förmlichen Begrüßung fühlte er sich befangen und brauchte Ablenkung.
Ein paar Minuten später, nachdem Wein eingeschenkt und Krabben-Avocado-Salat mit frischem Baguette serviert worden war, hatte er sich von seiner kleinen Enttäuschung so weit erholt, dass er die Frage stellen konnte, die ihn seit seiner Ankunft beschäftigte.
»Sie waren so lange weg, ich dachte schon, Sie würden vielleicht nicht mehr zurückkehren. Haben Sie eigentlich vor, hierzubleiben?«
Sie lächelte knapp, als hätte sie mit der Frage gerechnet. »Nun ja, nach dem, was passiert ist, musste ich für eine Weile weg. Und ich hatte tatsächlich einiges in Deutschland zu erledigen. Nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass ich nicht dortbleiben möchte. Mir fehlte das hier!« Sie zeigte durch die halb offene Terrassentür auf den Garten.
Hinter der niedrigen Abgrenzungsmauer öffnete sich die Landschaft zu einem breiten Panorama. Zunächst das Ufer der Bucht, ein Kiesstrand, an dem sich die Wellen brachen, dann das tiefblaue Wasser der Flussmündung, ein breiter, glänzender Streifen mit kleinen Schären, hier und da von ein paar Schaumkronen übersäht, dahinter die felsige Küstenlinie der gegenüberliegenden Seite, der Beginn des als »Rosa Granitküste« bekannten Landstrichs. Obwohl zwischen beiden Ufern beinahe zwei Kilometer lagen, schien das grüne Hügelland mit den zerstreuten weißen Ferienhäusern in der klaren Luft zum Greifen nah. Oberhalb davon erhob sich wie ein zum strahlenden Himmel deutender Zeigefinger der spitze Kirchturm von Plougrescant, der den Seeleuten als Richtpunkt für die Einfahrt in den Hafen von Tréguier diente. Ein weißes Dreiecksegel bewegte sich langsam aus der glitzernden Mündung hinaus zum offenen Meer.
Le Clech war ihrem Blick gefolgt. Er sagte nichts, nickte nur. Für ein paar gemeinsame Sekunden versanken sie in die Betrachtung des für die Bretagne so typischen harmonischen Miteinanders von Land und Meer.
Es dauerte eine Weile, bis das Gespräch wieder in Gang kam, aber Le Clech empfand die Pause nicht als unangenehm. Obgleich Barbara ihre Entscheidung zu bleiben noch einmal beteuerte, fragte er, ob ihr das Leben in diesem abgeschiedenen Winkel auf Dauer nicht zu eintönig sei.
Wieder lächelte sie. »Hier kommt keine Langeweile auf. Allein das Wetter sorgt für Abwechslung. Wie heißt es so schön? In der Bretagne durchläuft das Wetter an einem Tag alle vier Jahreszeiten.«
Sie sprachen über die Vorzüge und Nachteile des Lebens auf der Halbinsel zwischen Goëlo und Trégor. Le Clechs Anspannung löste sich endgültig und er konnte ihre Gesellschaft ohne Hintergedanken genießen.
Mit Appetit vertilgten sie die Vorspeise, Le Clech schenkte Wein nach. Dann stand Barbara auf, um das Hauptgericht, Seebarsch mit Gemüse in Olivenöl, aus dem Ofen zu holen. Als sie die Auflaufform auf den Tisch stellte, stieg ein verführerisch aromatischer Duft in Le Clechs Nase, im selben Moment klingelte sein Handy.
Seine Stirn kräuselte sich vor Ärger. Er hatte vergessen, das Ding abzuschalten.
»Entschuldigung!«
Ein Blick auf das Display zeigte ihm die Mobilnummer von Lucien Marceau, seinem Stellvertreter in der Gendarmerie von Lézardrieux. Der Anruf kam also nicht aus der zentralen Dienststelle. Da er heute offiziell freihatte, musste es wichtig sein. Mit einem unterdrückten Seufzen stand er auf und ging durch die Terrassentür nach draußen.
Es war tatsächlich Marceau und der sonst so besonnene, stets vorschriftsmäßig handelnde Gendarm überraschte Le Clech mit einem ungebremsten Redeschwall. Marceau hatte Mühe, einen klaren Satz zu formulieren, und klang verwirrt, schien überfordert, was noch nie vorgekommen war. Erst als Le Clech ihn bat, in Ruhe noch einmal alles von vorne zu erzählen, verstand er den Grund für Marceaus Fassungslosigkeit.
»Es ist, wie ich Ihnen gesagt habe, Chef, ich konnte es nicht glauben, deshalb bin ich selbst hingefahren. Ein abgetrennter Arm, ein einzelner menschlicher Arm auf einem Feld in der Nähe des Hafens von Port Béni!«
»Verstanden. Haben Sie schon erste Maßnahmen eingeleitet?«
»Im Moment sind wir nur zur zweit, ich habe schon mal abgesperrt und Verstärkung angefordert. Aber Sie sollten kommen, Chef!«
Es klang wie ein Hilferuf. Le Clech wusste aus Erfahrung, dass es bei einem Einsatz wesentlich schlimmer war, auf einzelne Körperteile zu stoßen als auf eine ganze Leiche. Marceau war noch relativ jung und hatte im Gegensatz zu Le Clech seine bisherige Laufbahn in der beschaulichen bretonischen Provinz absolviert. Auf so etwas war er nicht vorbereitet. Le Clech blieb keine Wahl, er musste die Dinge selbst in die Hand nehmen. Er gab Marceau Anweisungen, die KTU und die Gerichtsmedizin in Saint-Brieuc anzurufen und einen Leichenhund aus Lannion kommen zu lassen, um die nähere Umgebung abzusuchen. Dann drehte er dem in seiner malerischen Vollkommenheit unveränderten Panorama widerwillig den Rücken zu und kehrte ins Haus zurück.
Barbara stand noch neben dem Tisch.
»Es tut mir wirklich leid«, bedauerte Le Clech. »Ich kann nicht bleiben, ich muss zu einem Einsatz.«
Seine Stimme klang nicht halb so zerknirscht, wie er in Wahrheit war. Dabei schaute er auf den verlockend aussehenden Seebarsch, den er nicht kosten würde, und sein Frust betraf keinesfalls nur das verpasste Essen, es war zu ärgerlich, jetzt gehen zu müssen.
Le Clechs einziger Trost war, dass er beim Abschiednehmen in Barbaras Gesicht lesen konnte, wie sehr sie über seinen plötzlichen Aufbruch enttäuscht war, obwohl sie nicht versuchte zu erfahren, was passiert war, weder eine Bemerkung machte noch eine höfliche Floskel benutzte, um die Situation zu kommentieren.
Sie nickte und sagte resigniert: »Natürlich, ich verstehe.«
Im Gehen drehte er sich noch einmal um. »Bei nächster Gelegenheit lade ich Sie ein, wir holen das nach, das verspreche ich.«
Als er die Haustür hinter sich schloss, kam ihm der Gedanke, dass sie so etwas nicht zum ersten Mal erlebte, sie war mit einem Offizier der Gendarmerie verheiratet gewesen, bestimmt war auch er oft unerwartet zum Einsatz abkommandiert worden. Das erklärte ihr einsichtiges Verhalten. Sein Freund Yann hatte es gut mit ihr gehabt, denn eine Ehefrau, die nicht protestierte, wenn das Zusammensein mal wieder von der Arbeit gestört wurde, war in seinem Beruf ein seltenes Glück.
***
Die Kapelle stand auf einer flachen Erhebung abseits der Landstraße, die zum Weiler von Brestan führte. Bis dorthin war es noch gut ein Kilometer, sodass die Kapelle nicht zum Ort gehörte, der aus einem halben Dutzend Häusern bestand. Der Grund für ihre Errichtung war einst eine Quelle gewesen, mitten auf einer Wiese, die inzwischen von niedrigen Büschen und Bäumen bewachsen war.
Nach wiederholten Umbauten im Laufe der Jahrhunderte war ein recht schlichtes Gotteshaus übrig geblieben, mit einem offenen Glockenturm auf dem Dach und einer Eingangstür, die sich unter einem Rundbogen öffnete. Oberhalb davon war 1651, das Entstehungsjahr, in den Granit eingemeißelt worden. Einzig bemerkenswert war unterhalb der Kapelle ein gut erhaltenes Brunnenhäuschen, in dem das Wasser der Quelle nach wie vor aus der Erde sprudelte und über einen engen gemauerten Kanal ein quadratisches Becken speiste. In früheren Zeiten war es vom Vieh als Tränke und von Waschfrauen als Spüle genutzt worden. Jetzt, im Hochsommer, floss die Quelle nur langsam, auf dem Wasserspiegel des Beckens hatten sich grünliche Schlieren gebildet. Das trübe seichte Wasser, von der Mittagssonne erwärmt, roch leicht faulig.
Von der Küste kommend, näherte sich auf der Straße eine Gruppe von Radfahrern der Einfriedung, die das Kapellengelände umfasste. Der Anführer, ein Mann mittleren Alters in eng anliegender schwarzer Trägerhose, hob schnell die Hand, hielt an und stieg ab.
»Kurze Pause!«, rief er, lehnte sein Fahrrad an die niedrige Mauer, setzte den Helm ab und ging zum Brunnenhäuschen. Über die Öffnung gebeugt, ließ er Wasser über Nacken und Handgelenke fließen.
Nachdem die Pause auf allgemeinen Wunsch auf zehn Minuten verlängert worden war, erfrischten sich die Männer einer nach dem anderen und legten sich zum Ausruhen auf die Böschung hinter der Einfassungsmauer. Allein der Anführer, von einem drängenden Bedürfnis sich zu erleichtern bewegt, verließ die Gruppe in Richtung der Bäume jenseits der Einfriedung. Er überquerte die Grasfläche vor der westlichen Mauer der Kapelle, blieb stehen, als er das Steinkreuz auf einem dreistufigen Sockel rechts davon sah, bevor seine Augen, von einer fast unmerklichen Bewegung angezogen, etwas anderes erfassten.
Ein paar Meter zu seiner Linken, aus drei groben Granitblöcken gebaut, befand sich ein Außenaltar. Darauf lag, von einem Stein beschwert, etwas Langes, Weißes, das sich wie eine Fahne im Wind bewegte. Neugierig näherte sich der Mann und berührte das flatternde Etwas. Es fühlte sich an wie dickes Papier, war aber leicht dehnbar und geschmeidig wie Stoff. Bei genauer Betrachtung zeichneten sich darauf Striche ab, die so etwas wie ein Muster oder eine Skizze bildeten.
Um es im Ganzen überblicken zu können, drückte er das wehende Stück mit beiden Händen auf die steinige Unterlage.
Tatsächlich, an einem Ende war ein anthrazitgrauer Abdruck zu erkennen. Eine Handfläche mit gespreizten Fingern, daran schlossen sich das dazugehörige Handgelenk und der Unterarm an, dann der Ellenbogen, undeutlich abgebildet, und zuletzt der Oberarm, ebenfalls schemenhaft. Kurz vor der Schulter brach die Zeichnung ab, da war auch der längliche Papierbogen zu Ende.
Was hatte das zu bedeuten? Wer hatte dieses Abbild einer menschlichen Gliedmaße auf den Altar gelegt und warum? Der Radfahrer schaute sich um. Vor dem Hintergrund sich wiegender Bäume bot die Kapelle mit dem Kreuz davor ein Bild ländlicher Ruhe und Einkehr. Abgesehen vom leisen Windhauch, der das Laub bewegte, war es still. Kein Anzeichen einer anderen Präsenz. Er drehte sich um. Auf der Straße hinter ihm rührte sich nichts, seine Radkumpane saßen und lagen noch alle auf der Böschung unterhalb des Quellenhäuschens, es war kein Laut zu hören. Er schaute noch einmal auf das lange weiße Blatt. Es war eindeutig ein Arm abgebildet, nicht muskulös, eher feingliedrig … Seltsam!
»Kommt her, schaut euch das an!«, rief er seinen Begleitern zu.
Vom lauten Zuruf in ihrer Ruhe gestört, reagierten die Radfahrer nur träge, rappelten sich widerwillig auf und näherten sich dem Altar.
2
Gegen halb sieben abends kehrte Le Clech aus Port Béni, wo er den gesamten Nachmittag auf dem Artischockenfeld hinter dem Hafen verbracht hatte, nach Pleubian zurück. Eigentlich hätte er sofort nach Lézardrieux zu seiner Dienststelle weiterfahren müssen, aber er hatte den ganzen Tag über nichts zu sich genommen, bis auf die kleine Vorspeise, die er bei Barbara Leport kurz vor Marceaus Anruf gegessen hatte. Zu trinken hatte es nur klares Wasser gegeben, aus der Wasserstelle für Camper beim Toilettenhäuschen am Hafen. Jetzt war es höchste Zeit für einen anständigen Espresso und vielleicht hatte Soizig Gourvil, die Wirtin des Poisson Rouge, seiner Lieblingskneipe, noch etwas Baguette übrig, um ihm einen jambon-beurre dazu zu servieren, bevor er aufbrechen musste.
Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die sich an diesem Nachmittag auf dem Artischockenfeld bei Port Béni aufgehalten hatten, war ihm keineswegs der Appetit vergangen, im Gegenteil, er hatte einen Bärenhunger, nicht nur sein Magen, sein Gehirn schrie geradezu nach Nahrung. Es war schon immer so gewesen, dass er bei besonders widerlichen, schockierenden Erfahrungen in seinem Beruf hinterher den starken Drang verspürte, sich zu stärken.
Er parkte sein Motorrad in der Ortsmitte auf dem Marktplatz und bog um die Ecke der Seitenstraße, in dem die Kneipe lag. Die beiden Tische auf dem Bürgersteig vor dem Eingang waren besetzt und auch im Inneren war es ziemlich voll. Es war die Stunde des Aperitifs, der Raum war erfüllt von den Stimmen der Stammgäste, die jeden Abend um diese Zeit ihr Glas tranken und dabei die Nachrichten des Tages austauschten.
Der Lärmpegel senkte sich merklich, als Le Clech durch die Tür trat, die meisten Köpfe ruckten in seine Richtung und dann wieder weg.
»Guten Abend«, sagte Le Clech.
Soizig stand hinter dem Tresen und strahlte ihn an, denn er war einer ihrer Lieblingsgäste. »Wie immer?«
Le Clech nickte, Soizig wandte sich zur Kaffeemaschine und fing an, einen doppelten Espresso vorzubereiten. Währenddessen kamen die Gespräche langsam wieder in Gang. Einer der Männer am anderen Ende der Theke, die bis dahin geschwiegen hatten, starrte allerdings beharrlich zu Le Clech.
»Haha, da ist ja unser oberster Ordnungshüter!«, rief er plötzlich laut.
Seine Stimme verriet, dass er ordentlich getankt hatte. Einige Köpfe drehten sich zu ihm. Als Le Clech nicht reagierte, nahm der Mann einen neuen Anlauf.
»Vielleicht geruht er uns zu erklären, was sich da in Port Béni abgespielt hat.«
Le Clechs Augen blieben bei der Betrachtung der großen Kaffeemaschine, an der Soizig immer noch hantierte.
»Hey, sag mal, was war da los, was habt ihr da ausgegraben? – Uff!« Ein Rippenstoß seines Nachbarn hinderte ihn daran, weiterzusprechen.
»Halt den Mund, Loik.« Es war ein älterer Mann in einer blauen Fischerkutte. Sein Gesichtsausdruck zeigte eine Mischung aus Verärgerung und Scham.
»Man wird ja wohl noch fragen dürfen, wir leben schließlich in einem freien Land«, maulte der andere und schüttelte sich.
Inzwischen war es im ganzen Lokal still geworden. Alle warteten ab. Endlich erwiderte Le Clech wortlos den sturen Blick des Trunkenbolds, ohne zu blinzeln. Sekunden vergingen.
»Komm, trink aus, wir gehen«, sagte der Mann in der blauen Fischerkutte und legte einen Geldschein auf den Tresen.
Daraufhin senkte der Säufer den Kopf, murmelte etwas Unverständliches, nahm einen letzten Schluck und ließ sich von seinem Nachbarn widerstandslos nach draußen bugsieren.
Le Clech wandte sich wieder der Wirtin zu. »Soizig, hast du noch ein Schinkensandwich für mich?«, fragte er in betont freundlichem Tonfall.
»Ich schau mal, was ich habe«, antwortete sie genauso unaufgeregt.
Sofort entspannte sich die Atmosphäre, die Gäste kehrten zu ihren Gesprächen zurück.
Während Soizig sein Sandwich bereitete, dachte Le Clech darüber nach, ob es am Ende gelingen würde, die Nachrichtensperre einzuhalten, die er allen Beteiligten am Tatort auferlegt hatte. Anscheinend war doch einiges durchgesickert. Der Säufer am Tresen hatte von »ausgegraben« gesprochen, was immerhin nah an der Wahrheit war, auch wenn der Arm eher auf der Erde als darin gelegen hatte.
Le Clech wollte den grausigen Fund vorerst nicht der Öffentlichkeit preisgeben, er hoffte, dass der Gerichtsmediziner und die KTU ihm in der Nacht noch wertvolle Informationen geben würden. Mit etwas Glück wäre er in der Lage, morgen bei der unvermeidlichen Pressekonferenz gezielte Angaben zu machen und die Bevölkerung so weit einzubeziehen, dass brauchbare Hinweise die Gendarmerie erreichen würden. Dann hätte diese lästige Pflichtveranstaltung wenigstens einen positiven Nebeneffekt.
Sollte der Fund heute bis zur Presse durchsickern, würde es spätestens morgen nach Erscheinen der Zeitung wilde Spekulationen geben, was wenig hilfreich wäre. Außerdem brauchte er Zeit, um mit seinem Vorgesetzten in Saint-Brieuc, Colonel Arnaud Delavigne, Kommandant der dortigen Kompanie, die nächsten Schritte abzustimmen. Und – auch wenn es ihm widerstrebte, denn sein Verhältnis zu einigen der dortigen Beamten war bekanntlich alles andere als kollegial – die Kripo von Saint-Brieuc musste ebenfalls informiert werden. Es würde wohl eine lange Nacht werden.
***
Barbara schaute hinaus auf die abendliche Landschaft, aber ihre Gedanken waren nicht bei der Aussicht. Der überstürzte Aufbruch von Le Clech hatte bei ihr ein Déjà-vu ausgelöst. Er erinnerte sie an frühere Zeiten, als sie noch mit einem Gendarmen verheiratet gewesen war, der für die Sicherheit des französischen Botschafters in Berlin zuständig gewesen war.
Damals kam es immer wieder vor, dass ihr Mann Yann aus wichtigem Anlass aus ihrem Privatleben, manchmal sogar mitten in der Nacht, herausgerissen und sofort zu einem Einsatz gerufen wurde. Daran müsse sie sich gewöhnen, so etwas gehöre zu seinem Beruf, erklärte er ihr. Ihr Alltag war oft nicht planbar, sie musste mit häufigen Abwesenheiten ihres Mannes rechnen, denn wann immer der Botschafter verreiste, war Yann dabei. Umso mehr freute sie sich auf ein ungestörtes Leben zu zweit in der Bretagne, nachdem er endlich in den Ruhestand versetzt worden war und sie zusammen in seine alte Heimat zogen.
Nur dass dieses Leben nach kaum einem Jahr jäh zu Ende war. Yann ertrank beim Fischen draußen auf dem Meer. Er hatte sich in den Leinen der Fangkörbe verheddert und war ins Wasser gefallen. Als man ihn nach stundenlanger Suche fand, war es zu spät, er war trotz Schwimmweste an Erschöpfung gestorben. Nach seinem Tod stand Barbara vor der Entscheidung, das Haus, das gerade fertig renoviert und eingerichtet war, wieder zu verkaufen und zurück nach Deutschland zu ziehen, wo ihre Wurzeln lagen. Doch sie hatte sich in der kurzen Zeit in die Bretagne verliebt und das war auch alles, was ihr von Yann geblieben war, seine geliebte Heimat, wo er mit ihr sein Leben hatte verbringen wollen. Wäre sie fortgezogen, wäre auch das für immer verloren gegangen.
Also war Barbara geblieben, obwohl sie dadurch an ihren schweren Verlust erinnert wurde, wie jetzt, als Robert Le Clech in ihrem Beisein zum Einsatz gerufen worden war. Sie hatte den Adjudant-chef eingeladen, um sich bei ihm zu bedanken, denn er hatte sie aus höchster Not gerettet.
Außerdem spürte sie, dass Le Clechs Interesse an ihr nicht rein professioneller Natur war, und dieses Gefühl tat ihr gut, das musste sie sich bei aller Trauer um ihren toten Mann eingestehen. Es war nicht zu leugnen, sie fühlte sich in seiner Gegenwart wohl, ja, er strahlte Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Trotzdem blieb die stete Erinnerung an Yann und dass Le Clech ebenfalls Gendarm war, war nicht gerade hilfreich, um eine unbefangene Beziehung zu ihm aufzubauen.
Sie seufzte. Um auf andere Gedanken zu kommen, beschloss sie, einen Spaziergang vor dem Abendessen zu machen. Zwar war es bereits spät, doch um diese Jahreszeit war es lange hell und es gab niemanden, auf den sie Rücksicht nehmen musste, niemanden, der auf sie wartete.
Weil sie nicht immer das Stück Küstenwanderweg vor ihrer Haustür gehen wollte, nahm sie mit ihrem weißen Citroën die Landstraße, die in kurzer Entfernung vom Ufer entlang der Mündung des Jaudy durch die Dörfer führte. Zunächst lenkte sie den Wagen nach Süden Richtung Bellevue, einem Weiler, von dem aus man einen Blick über die gesamte Mündung hatte, vom offenen Meer bis nach Tréguier, der alten Hauptstadt des Trégor. Die beiden Türme der Kathedrale waren als Silhouette im Gegenlicht gut zu erkennen, als sie über den Hügel von Bellevue fuhr und auf der Kuppe anhielt, um einen Schluck aus ihrer mitgebrachten Wasserflasche zu trinken.
Beim Versuch, der tiefen Sonne zu trotzen und das gegenüberliegende Ufer zu betrachten, blendete das Licht so sehr, dass sie beschloss, weiterzufahren. Das Sträßchen lief hinunter zum Bauernhof von Bilvéro, direkt am Ufer der Mündung. Von dessen Strand aus hatte man freie Sicht auf die Anlegestelle von La Roche Jaune auf der anderen Seite.
Sie erinnerte sich, mit Yann ein paarmal dort gewesen zu sein. In dem gemütlichen kleinen Restaurant, das in einem alten Bootshangar eingerichtet war, wurden frische Meeresfrüchte serviert. Fischerboote, die an der kurzen Mole zu Füßen des umgebauten Hangars anlegten, brachten täglich Hummer und Muscheln. Unweit davon, etwas tiefer in der Mündung, lagen die Austernbänke, von denen das Restaurant ebenfalls Ware bezog.
Barbara stieg in Bilvéro aus dem Auto. Die Flut hatte ihren Höchststand überschritten, das Wasser zog sich bereits langsam zurück. Einige Segelschiffe fuhren flussaufwärts, um noch vor der Ebbe ihren Ankerplatz in Tréguier zu erreichen. Das Licht strahlte nach wie vor stark, die Stelle war jedoch windgeschützt, sodass sie die volle Kraft der Sonne auf ihren Schultern spürte, als sie sich abwandte, um nach Süden zu laufen. Von Bilvéro aus wand sich der Rundwanderweg abseits des Ufers durch Buschwerk bis zur Kapelle Saint-Voltrom, einer von rund einem halben Dutzend auf der Halbinsel.
Zwar hatten die vor Jahrhunderten errichteten Gotteshäuser ihre Bestimmung als Andachtsort längst verloren, aber für Wanderer waren sie ein willkommenes Etappenziel. Deshalb achteten die meisten Gemeinden, deren Eigentum sie waren, auf die Erhaltung der schlichten Granitbauten. Auch die Umgebung wurde in Ordnung gehalten, die Vegetation am Wuchern gehindert und durch blühende Pflanzen ersetzt, damit die Touristen etwas zu fotografieren hatten.
Beim Spazierengehen hatte Barbara manch eine dieser Kapellen besucht, auch wenn zu ihrem Bedauern die Eingangstüren in der Regel abgesperrt waren. Die Schlüssel dazu verwahrte ein Nachbar oder jemand von der Gemeindeverwaltung, sodass man umständlich danach fragen musste. Deshalb hatte Barbara nur selten Gelegenheit, das Innere zu besichtigen. Trotzdem lohnte sich meist der Weg, denn die Kapellen befanden sich mitunter an besonders malerischen Stellen der Halbinsel.
Bevor sie die Wiese unterhalb der Kapelle erreichte, roch es schon nach frischem Gras. Offensichtlich war am Nachmittag gemäht worden. Oben lag die Westfassade der Kapelle im Licht der Abendsonne, an der südlichen Mauer wuchs ein mannshoher Hortensienbusch in voller Blüte. Die riesigen pinkfarbenen Blumen leuchteten vor dem grauen Granit, als wollten sie mit ihrer Pracht von den rauen Mauern ablenken. Rechts davon erhob sich auf einem hohen Sockel ein schlichtes Steinkreuz. Es war niemand zu sehen. Barbara schaute auf die Uhr, es war Abendessenszeit, die meisten Wanderer waren längst am Ziel, obwohl es noch lange hell sein würde. Sollte sie nach Hause oder bis Tréguier fahren, um dort in einem der Lokale unweit des Hafens zu essen?
Inzwischen hatte sie die Wiese überquert und stand vor der Kapellentür. Sie legte die Hand auf die Klinke und drückte. Abgeschlossen, wie zu erwarten um diese Uhrzeit. Unschlüssig drehte sie sich um und schaute zurück zur Mündung. Unterhalb der Kapelle, am Ende der abschüssigen Wiese, ragten ein paar kleinere Bäume auf, vom Küstenwind arg zerrupfte Zierpflaumen. Eines der Bäumchen war bereits kahl, von seinen abgestorbenen Ästen war nur eine dreigliedrige Gabel übrig geblieben, die ihre Zacken in den Himmel reckte. Um den dürren Stamm war etwas Weißes gebunden. Es sah aus wie ein langes Stück Stoff, vielleicht ein Halstuch oder eine Schärpe, vom Wind hierhergetragen, die sich um den Baum gewickelt hatte. Oder hatte jemand ein Kleidungsstück verloren, das ein anderer aufgehoben hatte, um es dort gut sichtbar aufzuhängen und einzurollen, damit es nicht fortgeweht wurde? Nicht selten fand sich am Wegesrand eine von einem Wanderer verlorene Kappe, ein Pullover oder sogar ein Schuh, der dann, an einem Ast aufgehängt, auf die hypothetische Rückkehr seines Eigentümers wartete.
Eine Weile betrachtete Barbara den seltsam anmutenden Baum und die Landschaft im Abendlicht, ließ die Ruhe und Einsamkeit auf sich wirken. Dann beschloss sie, nach Hause zu fahren.
Ehe sie die Wiese hinunterlief, machte sie einen Schlenker zum steinernen Kreuz. Fast alle Kapellen der Halbinsel hatten ein solches frei stehendes Kreuz an ihren Seiten, oft gepaart mit Altären aus Granit. Barbara wusste, dass die Bauwerke früher als geweihte Stationen bei Prozessionen gedient hatten und dass dort Gottesdienste unter freiem Himmel abgehalten worden waren.
Als sie näher kam, sah sie, dass ein trockener Buchsbaumzweig oben auf dem Sockel des Kreuzes lag, vielleicht ein Relikt aus der Fronleichnamsprozession. Der meterhohe Unterbau war ungewöhnlich. In jede der vier Seiten des Granitquaders war eine Nische eingemeißelt. Nur in der vorderen befand sich etwas. Es war eine Darstellung des gekreuzigten Christus, stark verwittert. Der offene Mund war das Einzige, das von den grob erodierten Gesichtszügen des Gemarterten erkennbar war. Außerdem fehlten der Steinfigur Arme und Beine, lediglich Torso und Kopf waren, von Flechten zerfressen, erhalten und hingen in schrägem Winkel in der Nische, in die sie offensichtlich nicht gehörten. Der Anblick der verstümmelten Figur berührte Barbara unangenehm. Er passte nicht in die Idylle um sie herum.
Um ihr Unbehagen zu verscheuchen, begab sie sich auf den Weg zurück nach Bilvéro. Der Pfad führte vorbei an den umwickelten Baum, der aussah, als hätte man ihm einen Verband angelegt. Sie wollte einen Blick darauf werfen.
3
»Morgen, Chef!«
Lucien Marceaus Stimme hallte scharf und laut in Le Clechs Kopf nach. Er reckte die Arme, drehte sich auf die Seite und erhob sich mühsam von der harten Pritsche, auf der er die wenigen Stunden bis zum Morgen verbracht hatte.
Marceau, der die Zelle gerade betreten hatte, hob die Brauen. »Chef, warum sind Sie nicht zu mir rübergekommen? Sie hätten bei mir zu Hause schlafen können!«
»Ihr Sofa in Ehren, Marceau, aber dann hätte ich Sie um drei Uhr nachts wecken müssen, das wollte ich nicht«, brummte Le Clech mit belegter Stimme.
Er hatte bis tief in die Nacht arbeiten müssen. Da sich der Heimweg nicht mehr lohnte und er mit der Morgenschicht weitermachen wollte, legte sich Le Clech auf die Pritsche in einer der beiden Arrestzellen der Gendarmerie, wo er sofort einschlief. Seinem Rücken hatte das nicht gutgetan, er fühlte sich wie gerädert, es war in dem Gebäude jedoch die einzige Möglichkeit, in die Horizontale zu kommen. Auf keinen Fall wäre er zu Marceaus Wohnung gegangen, obwohl sie sich kaum eine Minute entfernt auf dem Gelände der Gendarmerie befand.
Marceau war zwar sein Stellvertreter und engster Mitarbeiter, doch zu viel Nähe zwischen ihnen hielt er nicht für angebracht. Marceau war überdies fast fünfzehn Jahre jünger als Le Clech. Dass Marceau den am Vortag bei der Auffindung des abgetrennten Arms erlittenen Schock bereits überwunden, offensichtlich eine erholsame Nacht verbracht hatte und in diesem Moment geradezu vor Energie strotzte, hob keineswegs Le Clechs Stimmung. Außerdem glaubte er in der Stimme seines Stellvertreters einen ironischen Unterton herauszuhören, was ihm auch nicht gefiel.
»Soll ich die Mannschaft zur Krisensitzung einberufen?«, preschte Marceau weiter vor.
»Haben Sie schon Kaffee gekocht?«
»Ja, Chef, gleich …«
»Danach können Sie alle ins Konferenzzimmer bitten.«
»Mach ich, Chef.«
Zufrieden registrierte Le Clech, dass Marceaus Tonart merklich gedämpft klang.
Sein Stellvertreter mochte es nicht, an seine Pflichten als Kaffeeholer beziehungsweise Kaffeezubereiter erinnert zu werden. Obwohl er sonst Marceaus Arbeitseifer zu schätzen wusste, konnte Le Clech gerade jetzt keinen jungen, dynamischen Mann an seiner Seite ertragen, der ihm vor Augen führte, dass er in seinem reifen Alter wesentlich länger brauchte, um sich zu regenerieren. Was er dringend brauchte, war etwas Zeit und vor allem ein anständiger Kaffee, bevor er wieder auf der Höhe seiner Aufgaben war.
Marceau verließ die Zelle, um frischen Kaffee zu brühen, denn das, was aus dem Automaten im Flur der Gendarmerie kam, verschmähte Le Clech als ungenießbar. Dieser Umstand gab ihm die Gelegenheit, mit ein paar Streckübungen seinen müden Körper aufzurichten. Danach ging er zurück zu seinem Schreibtisch, um die Unterlagen zum Fall noch einmal durchzusehen. Dabei musste er an die gestrige Unterhaltung mit seinem Vorgesetzten Colonel Delavigne denken. Als Le Clech ihn über die jüngsten Ereignisse informiert und seine Absicht erklärt hatte, sofort die Kripo von Saint-Brieuc zu benachrichtigen, da es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine kriminelle Tat handele, hatte der überraschend reagiert.
»Ich denke, wir brauchen die Kollegen noch nicht um Unterstützung zu bitten. Versuchen Sie zunächst mehr herauszufinden, dann sehen wir weiter. Wenn sich der Fall als kompliziert erweisen sollte, können wir immer noch auf die Leute vom hiesigen Hauptkommissariat zurückgreifen. Ich lege die Sache in Ihre erfahrenen Hände, vielleicht lässt sich das einfacher und schneller aufklären, als wir es uns im Moment vorstellen können.«
Le Clech war absolut schleierhaft, wie Colonel Delavigne zu dieser Einschätzung gelangt war. Hatte sein Chef hellseherische Fähigkeiten entwickelt? Wusste er etwas, das er nicht mitteilen wollte? Oder war er von allen guten Geistern verlassen? Wie konnte er ernsthaft annehmen, dass es für einen abgetrennten Arm auf einem Artischockenfeld eine »einfache« Erklärung geben könnte, die zu einer »schnellen« Aufklärung führen würde? Hinter dem Auftrag musste etwas anderes stecken als Delavignes angebliches Vertrauen in seine »erfahrenen Hände«.
Allerdings hatte Le Clech keine Zeit, herauszufinden, was es war. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich sofort an die Arbeit zu machen. Immerhin hatte er seinem Vorgesetzten das Versprechen abgerungen, ihm alle mögliche Unterstützung zu geben, auch was das Personal betraf. Denn die Gendarmerie von Lézardrieux war unterbesetzt, die Schulferien hatten begonnen, die meisten Familienväter unter seinen Männern hatten gerade Urlaub. Es waren ihm nur die jüngeren, unerfahrenen geblieben, meist unverheiratet und ohne Anhang. Zum Glück war Marceau Single, auf ihn konnte er zählen.
Wenig später drängten sich die Kollegen der Morgenschicht um einen Tisch in der zum Besprechungsraum umfunktionierten ehemaligen Abstellkammer des Gendarmeriegebäudes.
»Wie ihr wisst, wurde gestern auf einem Feld bei Port Béni ein Leichenteil entdeckt. Der Fund wurde um dreizehn Uhr sechzehn per Handy gemeldet, von einem Landwirt, der dort seine Artischocken ernten wollte. Marceau und Lambert waren die Ersten vor Ort, ich kam zehn Minuten später dazu. Die KTU aus Saint-Brieuc traf etwa um halb drei ein, eine halbe Stunde später war auch der Hundeführer mit Leichenhund vor Ort.«
Während Le Clech weiterhin Informationen über den gestrigen Einsatz zusammenfasste, verbreitete die von Marceau vor ihm abgestellte Kaffeekanne einen aromatischen Duft. Die Gesichter in der Runde zeigten keinerlei Entspannung, die Luft in dem engen Raum schien durch die Fragen, die niemand stellte, aufgeladen zu sein. Alle Anwesenden ahnten, dass schwierige Ermittlungen sie erwarteten und der Fall für ihre kleine Einheit eine Herausforderung darstellte. Einige von ihnen waren bei Verkehrsunfällen mit dem Tod konfrontiert worden, doch ein in der Landschaft liegender menschlicher Körperteil, das war für die meisten eine völlig neue Erfahrung.





























