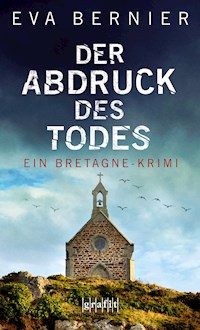Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Robert Le Clech
- Sprache: Deutsch
Im Zeichen der Triskele: Mysteriöse Morde, keltische Legenden und dunkle Geheimnisse in der Bretagne
Lézardrieux, eine kleine Gemeinde in der Bretagne: An einem stürmischen Morgen wird die Leiche eines deutschen Geschäftsmanns am Strand angespült – mit einer verstörenden Wunde auf der Stirn.
Gendarm Robert Le Clech, nach einigen Jahren im Ausland auf eigenen Wunsch in seine bretonische Heimat zurückversetzt, kommt bei den Ermittlungen nur mühsam voran. Weder seine Kollegen noch die Dorfbewohner sind ihm eine Hilfe. Zudem sagen mehrere Zeugen aus, "Ankou", den Todesboten der bretonischen Mythologie, gesehen zu haben. Aberglaube oder Sinnestäuschung?
Als an einem zweiten Tatort die Triskele, ein altes keltisches Zeichen, entdeckt wird, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Robert Le Clech muss tief in die Vergangenheit und die Legenden der Bretagne eintauchen, um die rätselhaften Morde aufzuklären.
Ein atmosphärischer Krimi voller Mystik und Spannung, der die Leser in die faszinierende Welt der Côtes-d'Armor entführt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Bernier
Im Zeichen der Triskele
Ein Bretagne-Krimi
© 2017 by GRAFIT Verlag GmbH
Chemnitzer Str.31, D-44139 Dortmund
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
Die Autorin
Eva Bernier ist gebürtige Französin. Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Japanologie. In Kooperation mit ihrem Mann, dem Autor und Fernsehregisseur Georg Bense, hat sie zahlreiche Dokumentationen für den Saarländischen Rundfunk, das ZDF und arte produziert. Ab 1992 war sie als Redakteurin in der Fernsehkulturabteilung des SR tätig. Heute lebt sie abwechselnd in Saarbrücken und Pleubian (Côtes d’Armor, Bretagne).
Im Zeichen der Triskele ist ihr erster Kriminalroman.
Kapitel 1
Kurz vor sieben schlich er hinaus, so leise wie möglich. Ringsum war noch tiefe Nacht und die Hecken und Mauern, die den Hof des kleinen Bauernhauses begrenzten, waren nur dunkle Schatten vor dem noch finsteren Himmel. Die Laterne über der Eingangstür schaltete er nicht ein. Schnell und mit gesenktem Kopf überquerte er den Hof, um in den schwarzen Geländewagen einzusteigen, der in der Einfahrt stand. Es regnete in Strömen. Damit ihm das Wasser nicht den Hals hinunterlief, musste er den Jackenkragen mit einer Hand festhalten. Im Inneren des Autos roch es intensiv nach feuchter Erde. Er startete, rollte langsam mit abgeblendeten Scheinwerfern durch das offene Tor, bog in den Feldweg Richtung Hauptstraße ein und versuchte, dabei den Motor nicht aufheulen zu lassen. Bald aber musste er kräftig aufs Gaspedal treten, um nicht in den vom Dauerregen aufgeweichten Spuren stecken zu bleiben. Er hoffte, das Wüten des Sturmes würde den Lärm übertönen. Die Scheibenwischer waren auf höchste Stufe geschaltet, aber sie schafften es nicht, die Regenmassen von der Windschutzscheibe zu entfernen. Vom Feldweg war kaum noch etwas zu erkennen. Nach mühsamen fünfzig Metern durch den Morast hatte er das Nachbargehöft erreicht. Als der Wagen an dessen großem geschlossenem Hoftor vorbeifuhr, ging plötzlich die Außenbeleuchtung an. Er wusste von dem Bewegungsmelder, der sie in Gang setzte, und auch, dass sie nach zehn Sekunden wieder erlosch. Unwahrscheinlich, dass um diese Uhrzeit bei dem Wetter jemand auf das Licht geachtet hatte. Noch dreißig Meter und eine scharfe Kurve, dann konnte er oberhalb der Hecken die einsame Straßenlaterne an der Kreuzung zur Hauptstraße erkennen. Die Räder drehten ein letztes Mal durch, als er mit einer plötzlichen Linksdrehung des Lenkrads den Wagen auf den Asphalt der Straße riss.
Im selben Moment hörte er ein dumpfes Poltern im hinteren Wagenteil, als wäre irgendetwas im Kofferraum lose. Er horchte einige Sekunden lang, aber außer dem Brummen des Motors war nichts mehr zu hören. Vermutlich war nur das Warndreieck oder eine leere Getränkekiste hin und her geschleudert worden. Es konnte jedenfalls nichts Wichtiges gewesen sein. Anhalten, um nachzuschauen, wollte er bei diesem Wetter nicht, stattdessen trat er aufs Gas. Auf der Landstraße nahm das schwere Auto sofort Geschwindigkeit auf, sodass der heftige Regen durch den Fahrtwind von der Windschutzscheibe gewischt wurde. Der Motor surrte nun beruhigend vor sich hin, während er mit überhöhtem Tempo Richtung Küste fuhr.
Jetzt konnte er sich entspannen und musste sogar ein wenig schmunzeln, denn eigentlich war der Sturm das passende Wetter für eine romantische Eskapade zu zweit. Bei der unangenehmen Witterung würde an ihrem vereinbarten Treffpunkt garantiert niemand sonst unterwegs sein: Es war mitten im Januar und selbst die Pendler nach Paimpol oder Lannion lagen noch in ihren Betten und schliefen. Wie gut, dass sie sich nicht im Freien verabredet hatten, sondern an einem vor Blicken geschützten Ort. Dort wäre sie hoffentlich auch vor dem Regen sicher, sollte sie zu ihrem Rendezvous bereits vor ihm ankommen. Er schaute auf seine Uhr: Nein, er würde in jedem Fall vor ihr eintreffen, er hatte trotz Sturm und Regen einen guten Vorsprung. Es wäre auch unfair gewesen und nicht gerade eines Kavaliers würdig, sie warten zu lassen. Denn er wusste, dass sie bis zu dem verabredeten Treffpunkt einen zehnminütigen Gang durch den Regen auf sich nehmen musste. Während er sich vorstellte, wie sie gerade aufstand, um in aller Frühe ihr Haus zu verlassen und allein in die stürmische Nacht hinauszugehen, nur um ihn zu sehen, fühlte er sich wieder richtig jung, ein Gefühl, das ihm in den letzten Jahren abhandengekommen war. Es war schön, wieder eine jüngere Frau zu begehren, vor allem eine, mit der er in eine erwartungsvolle Zukunft blicken konnte. Denn sie war in ihn verliebt, das war das Unerwartetste, das Beste, was ihm passieren konnte. Dadurch öffnete sich ihm eine Perspektive, sowohl privat als auch beruflich, für die er beinahe dankbar gewesen wäre – wenn Dankbarkeit zu seinen Charaktereigenschaften gehört hätte. Ihm war klar, dass er die Sache auf keinen Fall vermasseln durfte. Denn das hier war seine Chance, vielleicht die letzte, ein neues Leben anzufangen. Sicher, es galt, noch einige Hindernisse zu überwinden, nicht nur was sein bisheriges Leben betraf. Auch der Genehmigungsweg durch die französischen Behörden würde nicht einfach werden, das war ihm in den letzten Tagen ebenfalls klar geworden. Aber er hatte entscheidende Trümpfe in der Hand, er kannte die richtigen Leute und war entschlossen, alles zu tun, was notwendig sein würde, um sein Ziel zu erreichen. Er hatte es bei seinen Geschäften bisher fast immer geschafft, seinen Vorteil herauszuschlagen, wie schwierig die Umstände auch gewesen waren. Warum sollte es ausgerechnet diesmal anders sein, wo er vor einer entscheidenden Wende seines Lebens stand?
Nachdem das Auto die Hängebrücke über der Flussmündung des Trieux passiert hatte, bog er nach rechts ab Richtung Norden. Die enge Straße, die an den ersten Häusern von Lézardrieux vorbeiführte, war leer und die Granitfassaden waren dunkel, keines der Fenster war beleuchtet. Das einzige schwache Licht kam von einer Laterne vor der Kirche am Ende des lang gezogenen Vorplatzes. Jetzt waren es höchstens noch zehn Minuten auf kleinen kurvigen Landstraßen, Wind und Regen ließen schon etwas nach, er würde bald da sein.
Es war nicht besonders schwer gewesen, unauffällig das Haus zu verlassen. Mariannig kannte es seit ihrer Geburt, sie hatte den größten Teil ihrer Kindheit hier verbracht, jeder Winkel des alten zweistöckigen Steingebäudes war ihr vertraut. Lautlos war sie die Treppe hinabgestiegen und in die Küche gegangen, wo der große gusseiserne Holzherd, der im Winter nie ganz ausging, noch warm war von der Glut des letzten Scheits in seinem Inneren. Schnell war sie durch den kleinen Gang, der die Vorratskammer von dem ebenfalls verwaisten Gesinderaum trennte, geeilt. Sie dachte an die Zeit zurück, als sie noch ein Kind war. Damals war gerade in diesem Teil des Hauses am frühen Morgen immer viel Betrieb gewesen: Kurz vor sieben kamen die Köchin und das Dienstmädchen, um den Herd mit Holz aufzufüllen, die Fensterläden zu öffnen, das Frühstück für alle Haushaltsmitglieder vorzubereiten und die Hunde zu füttern. Wenig später trat dann der Gärtner durch die Außentür des Gesinderaums herein, um seinen Milchkaffee an dem großen Holztisch zu trinken, während die Frauen schon emsig bei der Arbeit waren. Für sie als kleines Mädchen war die Küche ein Hort der Geborgenheit, in dem sich jeder Tag gut beginnen ließ. Doch heutzutage war morgens alles still. Es gab keine Dienstmädchen mehr, nur noch eine Zugehfrau, die erst nach acht Uhr kam. Und die kleine Außentür, die direkt von dem ehemaligen Gesinderaum in den Park führte, wurde nur noch selten genutzt. Sie quietschte und klemmte, als Mariannig an ihr zog, und ließ sich erst nach mehrmaligen Versuchen öffnen.
Draußen war der Regen so heftig, dass sie sofort die Kapuze ihres Anoraks hochzog. Sie hätte Gummistiefel anziehen sollen, denn der kürzeste Weg zu dem verabredeten Treffpunkt führte durch den Park und danach querfeldein über eine Wiese. Aber sie wollte nicht an einem solchen Tag, dem ersten, den sie gemeinsam in der Stadt verbringen würden, in Gummistiefeln ausgehen. Sie planten, zum Mittagessen ein Feinschmeckerrestaurant zu besuchen. Es sollte ein richtig toller Ausflug werden, hatte er gesagt. Undenkbar mit Gummistiefeln. Also lief sie um das Haus herum, überquerte den Hof, ging durch das große Tor, das nie geschlossen wurde, und nahm die schmale asphaltierte Straße Richtung Süden. Sie führte nach einem guten Kilometer zu dem Parkplatz, der sich vor dem Denkmal für die gefallenen Widerstandskämpfer befand. Von dort aus waren es nur noch ein paar Schritte bis zu ihrem eigentlichen Treffpunkt, dem alten Bunker. Diese Strecke war ein Umweg, aber so würde sie wenigstens nicht bis zu den Knöcheln im Schlamm versinken.
Als sie den Bereich der Laterne vor dem Haus verließ, wurde die Welt um sie herum stockfinster. Die Straße vor ihren Füßen war zwar noch als dunkle glänzende Fläche zu erkennen, aber sonst waren Himmel und Erde kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Sie hörte, wie der Wind die Büsche links und rechts der Straße durchschüttelte, es rauschte und knackte und über allem lag das Heulen des Sturms. Als sie einmal aufsah, war ihr Gesicht im Nu genauso feucht wie ihre Füße. Sie versuchte, schneller zu gehen, aber mit gesenktem Blick drohte sie, die Orientierung zu verlieren. Mit jeder nassen Böe spürte sie, wie die Kälte mehr und mehr in sie hineinkroch, doch Umkehren kam nicht infrage. Nicht jetzt, wo sie dem Mann begegnet war, der ihrem Schicksal eine entscheidende Wendung geben, ihr endlich ein sorgloses und angenehmes Leben bieten würde, nach all den unerfreulichen Erlebnissen der letzten Zeit. Es wäre dumm, jetzt zurückzugehen. Womöglich würde er denken, sie sei zu schwach, um sich gegen den Sturm durchzusetzen, und somit auch zu schwach, um an seinen Projekten, an seinem Leben teilzuhaben. Ein solches Bild wollte sie nicht abgeben, nicht einem Mann gegenüber, dessen Kraft und Ausstrahlung sie so faszinierte, dass sie in seiner Anwesenheit alles andere um sich herum vergaß.
Mit beiden Händen hielt sie Kragen und Kapuze ihres Anoraks zusammen, stemmte sich gegen den Sturm und ging weiter. Minute für Minute bewegte sie sich in beinahe vollkommener Dunkelheit vorwärts. Die Welt bestand aus undurchdringlicher Nacht. Mariannig kam es vor, als würde sie sich nicht von der Stelle bewegen, obwohl sie immer wieder einen Fuß vor den anderen setzte. Endlich, ein schwacher Widerschein auf einer Pfütze, wenige Meter entfernt: Er musste von der Straßenlaterne kommen, die vor der Einfahrt zum Hof der Lemarchands stand – das Zeichen, dass etwa die Hälfte des Weges geschafft war. Noch ein paar Schritte und sie hätte den blassen Lichtkegel erreicht. Instinktiv suchte Mariannig die Umrisse des Bauernhauses auf der rechten Seite, aber es war nichts zu erkennen außer dem Regen, der im Dämmerlicht die Straße peitschte.
Plötzlich sah sie etwas, was sich von der Finsternis abhob, etwas, was nicht flüssig war und nicht vom Wind getrieben wurde, ein aufrechter Schatten in Menschengestalt, der die Straße rasch überquerte. Für den Bruchteil einer Sekunde erblickte sie einen langen dunklen Kapuzenmantel, der über dem Boden zu schweben schien. Dann wurde der Schatten wieder von der Nacht verschluckt.
Erschrocken war sie stehen geblieben, musste blinzeln, das Wasser rann ihr in die Augen. Wer oder was war das? Und was hatte die Gestalt in der Hand? Etwas Langes, einen Stab, einen Stock, oder … In diesem Augenblick packte sie die Angst, ihr Atem setzte aus, ihr Nacken versteifte sich, sie erstarrte: der Ankou!
Vergeblich versuchte sie, sich gegen die Stimme in ihrem Kopf zu wehren, die das Wort endlos wiederholte. Es war eine Stimme aus der Vergangenheit, die Stimme ihrer Großmutter, die zu ihr sprach und sie wieder zu einem erschrockenen Kind machte, trotz der Jahre, die seitdem vergangen waren. Der Ankou! Großmutter hatte ihr immer wieder von den Legenden und Geistern ihrer Heimat erzählt, besonders oft von dem Todesboten der Bretonen. Sie hatte ihr die in Stein gehauenen Darstellungen in der Kirche oder auf dem Friedhof gezeigt und sich jedes Mal bekreuzigt, wenn sie das Wort Ankou aussprach. Genau so hatte sie ihn damals beschrieben: als großen schattenhaften Mann in einem dunklen Kapuzenmantel, der die Todgeweihten abholte oder als Vorzeichen des nahen Todes eines Verwandten erschien. In der Hand hielt er einen langen Stab, manchmal auch eine Sense. Ihre Großmutter war schon vor vielen Jahren verstorben, sodass Mariannig den Ankou fast vergessen hatte. Außerdem ging sie nur noch selten in die Kirche. Er war ihr bisher nur in Stein gemeißelt begegnet. Nie hätte sie gedacht, dass er ihr einmal im wirklichen Leben so nahe kommen würde und schon gar nicht an diesem Morgen, auf einer stockfinsteren Straße, während sie mit nasskalten Füßen unterwegs zu ihrem Geliebten war.
Sie konnte den Blick von dem schwachen Lichtkegel der Laterne nicht abwenden, die Panik lähmte ihren Atem und ihre Muskeln, sie war nicht mehr in der Lage, auch nur einen Schritt weiterzugehen. Der Regen rann an ihren Waden hinunter und weichte endgültig ihre Schuhe auf, aber das spürte sie nicht. Sie blieb einfach stehen, während der Sturm vergeblich an ihrem Körper riss.
Als er merkte, dass er sich verfahren hatte, war es schon zu spät: Plötzlich war die Straße vor ihm zu Ende, er musste scharf bremsen, um den Wagen zu stoppen. Dabei drehten die Vorderräder durch und das Auto schlitterte nach vorn, bevor es endlich ganz zum Stehen kam. Im Licht der Scheinwerfer war kaum mehr zu erkennen als eine steile Böschung direkt vor der Kühlerhaube, auf die der Regen kaskadenartig herunterprasselte. Links und rechts des Fahrzeugs war nichts zu sehen. Offensichtlich war er falsch abgebogen. Statt der Zufahrt, die zu dem Parkplatz am Denkmal für die Widerstandskämpfer führte, hatte er irgendeine kleine Sackgasse erwischt, die im labyrinthischen Wirrwarr des Ortes in Richtung Küste führte. Jetzt war die Straße zu Ende und er wusste nicht einmal genau, wo er sich befand. Klar war nur, dass er wenden musste, doch er fragte sich, wie. Schon spürte er Ärger in sich aufsteigen. Wegen dieser Irrfahrt würde er wohl zu spät kommen und sein Versprechen, sie nicht an diesem einsamen Ort warten zu lassen, nicht einhalten können. Er hasste es, wenn die Dinge nicht so liefen, wie er geplant hatte. Es war doch keine gute Idee gewesen, auf ihren Vorschlag einzugehen und sich in dem alten Bunker zu verabreden. Es schien ihm von Anfang an eine für sie typische Laune gewesen zu sein: Sie wollte ihn höchstwahrscheinlich mit ihrer Kenntnis der ›geheimnisvollen‹ Orte auf der Halbinsel beeindrucken, denn der Bunker war eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Er hatte eingewilligt, weil der Platz vor dem Denkmal so früh am Morgen menschenleer sein würde und er kein Aufsehen erregen wollte. Wie dumm nur, dass er sich bei dem Wetter verfahren hatte und sie nun vermutlich doch vor ihm da sein würde. Hoffentlich würde sie die Nerven behalten, auf ihn warten und nicht denken, dass er sie versetzt hatte. Schließlich war sie sein Trumpf für die Zukunft.
Er legte den Rückwärtsgang ein, zog die Handbremse fest und machte die Zündung aus. Die Scheinwerfer ließ er an. Im selben Moment brauste der Sturm auf, als hätte der Wind nur gewartet, dass der Motor verstummte. Er knöpfte seine Jacke bis zum Kragen zu und stieg aus, um die Lage zu sondieren, bevor er den Wagen wendete. Jetzt stecken zu bleiben, wäre das Letzte, was er gebrauchen konnte. Kaum stand er im Freien, schlug ihm der Regen wie eine nasse Ohrfeige ins Gesicht. Zusätzlich zu dem Heulen des Sturmes war jetzt auch ein an- und abschwellendes Brüllen zu hören, wahrscheinlich das Meer, das irgendwo hinter der sandigen Böschung sein musste und mit gewaltigen Wellen immer wieder die Küste attackierte. Das, was er im Scheinwerferlicht sehen konnte, war wohl der untere Teil einer Düne, die dort anstieg, wo die Straße endete. Er war bis zur Küste gefahren, also mussten die Ruine des ehemaligen Semaphors von Creac’h Maout, das Denkmal für die 1944 ermordeten Widerstandskämpfer, und der darunterliegende Bunker ganz in der Nähe sein, aber wie weit entfernt und in welcher Richtung sie lagen, war in einer solchen Nacht unmöglich herauszufinden. Es half nichts, er musste umdrehen, denselben Weg zurückfahren und dann von der Ortsmitte aus versuchen, sich neu zu orientieren.
Bevor er wieder einstieg, lief er vor den Wagen, beugte sich hinab zu den Vorderrädern, um nachzuschauen, wie tief sie sich in den Sand gegraben hatten. In diesem Moment hörte er etwas, ein dumpfes Klicken. Es war kein natürlicher Ton, es hatte nichts mit dem Toben der wütenden Elemente um ihn herum zu tun. Überrascht richtete er sich auf, versuchte herauszufinden, aus welcher Richtung das Geräusch gekommen war. Doch seine Pupillen waren von dem blendenden Scheinwerferlicht so geweitet, dass er die Gestalt, die mit hoch erhobenem Arm auf ihn zukam, zu spät wahrnahm. Das Letzte, was er sah, war ein lang gezogener Schatten, der für einen kurzen Moment in sein Sichtfeld fiel, bevor der Schlag sein Bewusstsein mit einem jähen Schmerz erlöschte.
Regungslos lag Sven Krug am Boden. Lange blieb die Gestalt mit der eisernen Kurbel in der Hand unbeweglich neben dem Auto stehen, während Regen und Wind weiter ungebremst auf sie eindroschen. Dann löste sie sich aus der Erstarrung und stieg ein. Das Durchdrehen der Räder und das Aufheulen des Motors gingen im Sturm unter, bevor der Wagen es endlich mit einem Ruck aus dem Schlamm schaffte und zurückrollte.
Kapitel 2
Seit dem frühen Morgen tobte der Sturm und es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er bald nachlassen würde. Vom Küchenfenster aus konnte Barbara sehen, wie sich im Westen mächtige graue Wolken in riesigen Wellen immer neu am Horizont auftürmten und vom Wind gepeitscht Richtung Osten getrieben wurden. Der Regen prasselte in heftigen Güssen gegen die Fensterscheiben, im Kies der Einfahrt hatten sich inzwischen große Pfützen gebildet. Sie hatte das Haus, entgegen ihrer eigentlichen Absicht, einkaufen zu gehen, seit dem Morgen nicht verlassen und es stattdessen mit dem Erledigen liegen gebliebener Hausarbeit versucht. Inzwischen war es kurz vor zwölf und sie schaute, das Bügeleisen in der Hand, in den stürmischen Himmel. Den ganzen Morgen war es nicht richtig hell geworden, sie hatte das Licht im Haus brennen lassen müssen. An solchen Tagen kam der alte Schmerz wieder hoch und mit ihm die Zweifel, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, hierzubleiben und nach dem Tod ihres Mannes in diesem Haus allein zu leben. Vor drei Jahren war Yann verstorben, und immer wenn Stürme über die Bretagne zogen, erinnerte sie sich daran, wie sehr er dieses Wetter geliebt hatte. Während sie keinen Fuß vor die Tür setzen mochte, zeigte er sich vom Kampf der Elemente begeistert und versuchte sie zu überreden, mit ihm einen ›Sturmspaziergang‹ zu machen: am liebsten entlang des Zöllnerpfades, der unterhalb ihres Grundstückes verlief und am Ufer der Flussmündung bis hin zum offenen Meer führte. Wenn im Frühjahr oder im Herbst während der Tagundnachtgleiche die Stürme besonders heftig waren, war sie manchmal mit Yann im Auto zum Leuchtturm von Pléven gefahren, um die wütenden Angriffe des Meeres auf die Betonquadern vor der Mole zu beobachten. Die groben Wellenbrecher wirkten unter der Wucht der Wassermassen wie zerbrechliches Kinderspielzeug. Das Schauspiel mussten sie allerdings vom Auto aus genießen, um nicht von Gischt und Regen vollkommen durchnässt zu werden.
Bei den Gedanken an die Vergangenheit begann die Trauer, sich wie ein Ring aus Stahl um Barbaras Kehle zu schließen. Das Bügeleisen in ihrer Hand wurde immer schwerer, sodass sie es abstellen musste. In diesem Moment klingelte das Telefon. Sie atmete einmal kräftig durch und nahm den Hörer in die Hand.
»Was machst du gerade?«
Die vertraute Stimme ihrer Freundin Elsa brachte sie sofort ins Hier und Jetzt zurück.
»Ich bügele! Aus lauter Verzweiflung! Und du, was hast du heute Morgen gemacht?«
»Ich habe versucht, an einer Hafenansicht zu arbeiten, komme aber nicht so richtig voran. Das Licht ist zurzeit ganz anders als an dem Tag, als ich damit angefangen habe.«
Seit der Kindheit malte Elsa in Öl, Kreide und Aquarellfarben. Aber erst seit ihre Kinder erwachsen waren und ein eigenes Leben führten, war aus ihrem Hobby eine Leidenschaft geworden. Auf diese Art und Weise füllte sie die Tage in den verschiedensten Orten Europas, an die der Beruf ihres Mannes sie führte. Sven Krug war ein erfolgreicher Immobilienmanager, der sich nach einem Architekturstudium auf Planung, Entwicklung und Bau von exklusiven Ferienanlagen und Hotels spezialisiert hatte. Seine Arbeit hielt ihn oft von zu Hause fern, was, wie Barbara wusste, seiner Ehe beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Doch seitdem die Kinder aus dem Haus waren, konnte Elsa ihrem Mann folgen und ihre Beziehung schien eine Wende zum Positiven genommen zu haben. Die Bilder, die Elsa von ihren Aufenthalten an Europas Küsten oder aus den Bergen mitbrachte, wurden von Zeit zu Zeit in einer kleinen Galerie ihrer Heimatstadt ausgestellt und sie konnte für das eine oder andere Werk sogar einen Käufer finden.
»Bist du allein zu Hause?«, fragte Barbara, nachdem sie die üblichen Flosken über die Wetterlage ausgetauscht hatten.
»Ja, Sven musste heute Morgen in aller Frühe nach Rennes fahren. Er hat dort einen Termin und wird wohl nicht vor dem späten Abend wieder zurück sein.«
»Dann komm doch zu mir und wir machen uns einen gemütlichen Nachmittag zu zweit«, erwiderte Barbara.
»Danke, sehr gerne, allerdings kann ich nicht lange bleiben, ich habe mich heute Abend mit Anita zum Skypen verabredet.«
Anita, Elsas Tochter, lebte seit einem Jahr in Mexico City. Ursprünglich wollte sie dort nur ihren Bruder Martin besuchen, der einen gut bezahlten Job bei einer internationalen IT-Firma gefunden und sich in der Stadt niedergelassen hatte. Aber sie hatte sich in Mexiko so wohlgefühlt, dass sie nach ein paar Wochen durch Vermittlung ihres Bruders als Grafikdesignerin im selben Unternehmen Arbeit gefunden hatte, in dem er als Manager arbeitete. So waren die Monate vergangen. Barbara wusste, dass Elsa ihre Kinder vermisste, besonders Anita, ihre Jüngste. Über das Internet konnte sie allerdings regelmäßig Kontakt zu ihr halten, da Anita in ihrem Hightechbüro per Videoanruf zu erreichen war.
»Ich mache uns etwas zu essen, danach kannst du wieder nach Hause fahren, es ist ja nur eine Viertelstunde Fahrzeit«, sagte Barbara.
»Okay, bis gleich!«
Barbara legte auf und räumte das Bügeleisen weg. Sie freute sich auf den Besuch ihrer Freundin, der den Tag weniger einsam machen würde, und begann mit den Vorbereitungen für ein spätes Mittagessen. Draußen war der Himmel immer noch mit schweren Wolken verhangen und eine frühe Dämmerung legte einen grauen Schleier über eine Landschaft ohne Horizont. Aber der Regen hatte schon etwas nachgelassen, er fiel nur noch in unregelmäßigen Schauern. Der Sturm hatte jetzt seinen Höhepunkt überschritten und im Laufe des Abends würde der Wind nach und nach, so wie sich das Meer bei Ebbe langsam zurückzieht, das Land loslassen.
Adjudant-chef Robert Le Clech von der Gendarmerie in Lézardrieux war noch tief im Schlaf versunken, als sein Handy, das auf Kopfhöhe neben seinem Bett lag, zu brummen anfing. Fast gleichzeitig meldete sich mit einem lauten Krächzen das Funkgerät, das er gestern im Wohnzimmer abgestellt hatte. Es dauerte allerdings noch eine volle Minute, bis beide Lärmquellen das bewirkten, was sie sollten, und Le Clech, immer noch schlaftrunken, den Arm endlich nach seinem Mobiltelefon ausstreckte. Die Nacht war kurz gewesen. Seitdem er die fünfzig erreicht hatte, brauchte er eine längere Nachtruhe, wenn er, wie gestern, bis nach Mitternacht im Einsatz gewesen war, um die Verkehrssicherheit in seinem Bezirk aufrechtzuerhalten. Der Sturm hatte Bäume umgeworfen, Strommasten und Dächer beschädigt sowie Geröll auf die Fahrbahn gespült. Die Gendarmen waren bis zum Abend damit beschäftigt, Straßen zu sperren, Umleitungsschilder aufzubauen und der freiwilligen Feuerwehr beim Aufräumen zu helfen. Es mussten etliche Protokolle von Unfällen, die sich ereignet hatten trotz aller Warnungen und Ermahnungen in Rundfunk und Fernsehen, aufgenommen werden. Le Clech hatte den ganzen Tag sowohl vor Ort als auch von der Funkzentrale aus die Einsätze seiner Einheit koordiniert. Danach hatte er in seinem Büro in der Gendarmerie eine Abschlusssitzung einberufen, bei der eine Bilanz des Tages gezogen wurde und die notwendigen Schichten für die nächsten Tage verteilt wurden. Während seine Männer dann in ihren Dienstwohnungen, die lediglich ein paar Meter entfernt auf dem Gendarmeriegelände lagen, in ihre Betten fielen, musste Le Clech gegen Mitternacht noch den Abschlussbericht für die Präfektur in Saint-Brieuc verfassen. Erst danach konnte er sich auf sein Motorrad schwingen, um im allmählich abklingenden Sturm sieben Kilometer bis nach Hause zu fahren. Es war zwar seine Entscheidung gewesen, nicht, wie er sagte, »in der Kaserne« zu wohnen, aber dafür musste er längere Strecken in Kauf nehmen. Trotzdem hatte er diese Entscheidung nie bereut, auch jetzt nicht, als er mit Mühe versuchte, seine Augen auf das Display seines Handys zu fokussieren. Als er sah, dass der Anruf aus der Gendarmerie von Lézardrieux kam, drückte er die Anzeige weg, stand mit steifen Gliedern auf und ging zu seinem Funkgerät, das nebenan auf dem Sofatisch lag.
Kaum hatte er sich gemeldet, war die Stimme von Marceau zu hören, seines Stellvertreters in der Zentrale. Sie klang ungewöhnlich erregt: »Chef, wir haben einen Leichenfund am Strand von Pors Rand!«
Le Clech wurde augenblicklich wach. Es entsprach den Dienstvorschriften, wichtige Ereignisse per Funk zu melden, und Gendarm Marceau verhielt sich immer regelkonform. Deshalb hatte er Le Clech lediglich eine Nachricht geschickt, mit der Bitte, sofort per Funk die Gendarmerie zu kontaktieren. Le Clech fand diese Art der Kommunikation seit jeher mühsam und hätte sich lieber per Handy mit seinem Kollegen unterhalten, um mehr Details zu erfahren. Aber Marceau war ein junger, ehrgeiziger Gendarm, der immer alles richtig machen wollte und sich penibel an die Vorschriften hielt. Daher begnügte sich Le Clech mit einem kurzen Gespräch und ließ sich von Marceau den genauen Fundort der Leiche beschreiben. Anschließend gab er ihm die Anweisung, sich mit ein paar Kollegen als Verstärkung dorthin zu begeben, ohne auf ihn zu warten. Denn Le Clech zog es trotz des unbeständigen Wetters vor, sich wieder auf sein Motorrad zu schwingen und direkt an den Einsatzort zu fahren. Da sein Wohnort näher an Pors Rand lag als die Gendarmerie, wollte er vor seinen Männern am Fundort der Leiche anzukommen. Ein Blick aus dem Fenster zeigte ihm, dass sich im Osten über dem Meer die Morgendämmerung mit einem zarten blaugrauen Streifen am Horizont ankündigte.
Es hatte aufgehört zu regnen und die Sonne war gerade an einem klaren, blank gereinigten Himmel aufgegangen. Trotz der frühen Stunde hatte sich ein Dutzend Männer und Frauen am Strand von Pors Rand versammelt, als der typische Harley-Davidson-Sound von Le Clechs Motorrad die Luft schwingen ließ. Alle Blicke, die bis dahin auf die im Sand liegende Gestalt konzentriert waren, verfolgten nun, wie der Adjudant-chef seine Maschine ordentlich auf dem Touristenparkplatz oberhalb der kleinen Bucht abstellte und zu den Schaulustigen hinunterlief. Es war Ebbe, sodass der Strand gerade seine maximale Ausdehnung zwischen den Gezeiten erreicht hatte. Die Leiche lag im unteren Abschnitt, dort wo der Sand noch feucht und von den vielen kleinen Rinnsalen des ablaufenden Wassers gezeichnet war. Die Gruppe öffnete sich und die Menschen bildeten einen Gang, um Le Clech durchzulassen, einige nickten ihm zu, als er in ihre Nähe kam.
Bäuchlings auf dem Strand lag ein großer Mann. Sein Gesicht war fast komplett im Sand versunken, seine Gliedmaßen standen links und rechts in unnatürlichen Winkeln vom Körper ab. Der Tote war mit einer dicken dunklen Windjacke und einer grauen Hose bekleidet, die wohl zu einem Anzug gehörte. Seine Schuhe sahen teuer aus, es waren geschnürte Sportschuhe im englischen Stil. Alles an ihm war total durchnässt und mit Algenfetzen und Sand beschmutzt, auch der Hinterkopf mit dem kurzen hellen Haar.
Langsam und mit prüfendem Blick umrundete Le Clech die Leiche, bevor er die Anwesenden scharf musterte. »Hat ihn jemand angefasst?«
Ein Mann räusperte sich: »Ja, ich.«
Le Clech drehte sich um. Er erkannte Docteur Le Guennec, der in Pleubian eine Praxis für Allgemeinmedizin betrieb.
»Ich habe den Puls und die Halsschlagader gefühlt, obwohl ich sicher war, dass er tot ist.«
Le Clech nickte, ohne zu antworten. Der Arzt hatte seine Pflicht getan. Außerdem wusste er als Profi, dass man nach dem Auffinden einer Leiche bis zur Ankunft der Polizei so wenig wie möglich verändern sollte. Der Adjudant-chef bückte sich, packte den Toten am linken Ärmel und am linken Hosenbein und drehte ihn mit einem präzisen kraftvollen Ruck um.
Vor ihm lag ein Mann mittleren Alters. Seine Gesichtszüge waren noch nicht vom Salzwasser aufgedunsen. Oberhalb des Haaransatzes war die Haut aufgerissen, aber das Meer hatte das Blut weggespült und nur etwas Sand in den verklebten Haaren hinterlassen. Plötzlich stutzte Le Clech: Etwas weiter unten auf der Stirn befand sich noch eine Verletzung, eine kreuzförmige Wunde, die ebenfalls von einer Sand- und Algenkruste bedeckt war. Er unterdrückte den Impuls, diese Stelle mit dem Finger zu berühren, um sie zu säubern. Stattdessen inspizierte er noch eine Weile das Gesicht des Mannes, aber weitere Verletzungen waren nicht zu erkennen. Schließlich strich er mit der Hand über die halb offenen trüben Augen, um sie ganz zu schließen. »Kennt ihn jemand?«, fragte er, ohne den Blick zu heben.
Zunächst war Totenstille, dann erhob sich seitens der Schaulustigen ein undeutliches Gemurmel, das bald wieder verebbte.
Le Clech richtete sich auf und sah sich um. Einige der Frauen drehten sich weg, eine von ihnen hielt sich die Hand vor den Mund, als würde sie sich gleich übergeben müssen. Die meisten aber starrten gebannt auf das Gesicht des Mannes. Zum zweiten Mal beobachtete der Adjudant-chef die Runde genau und notierte sich innerlich die Namen derer, die er kannte. Neben Docteur Le Guennec und seiner hinter ihm stehenden Sprechstundenhilfe Gaelle Pornic hatten sich drei Austernzüchter in ihrer Arbeitskleidung am Strand eingefunden: André Lebon und sein Sohn Kevin sowie Maurice Le Dantec. Sie waren am frühen Morgen zu ihren flachen Barkassen unterwegs, um eventuelle Sturmschäden an ihren Bänken in der Bucht zu beheben. Lebon war es gewesen, der die Leiche als Erster gesehen und nach Rücksprache mit seinen Begleitern die Gendarmerie benachrichtigt hatte, so viel hatte Le Clech durch das kurze Funkgespräch mit Marceau bereits erfahren.
Außerdem standen da zwei Rentner, Monsieur und Madame Masetzky, Besitzer eines Hauses mit Seeblick oberhalb des Strandes von Pors Rand. Sie waren Le Clech bekannt, weil sie mehrmals in der Gendarmerie erschienen waren, um wichtigtuerisch Anzeige zu erstatten gegen ihrer Meinung nach illegale Camper, die mit dem Wohnmobil auf dem Strandparkplatz übernachtet hatten. Bei den übrigen Zuschauern handelte es sich wahrscheinlich um Bewohner von Pors Rand, die zum Strand gekommen waren, nachdem sie von dem Toten gehört hatten. In ihren Gesichtern der zeigte sich eine Mischung aus unverhohlener Neugierde und Betroffenheit.
In allen – mit einer Ausnahme.
In der zweiten Reihe erkannte Le Clech den alten Lemarchand, der vor einiger Zeit in die Gendarmerie vorgeladen worden war: ›Hausfriedensbruch und Wilderei‹ hatte die Anzeige gelautet, meinte er sich zu erinnern. Der Ausdruck in den Augen des betagten Mannes war seltsam, er schien keine Abscheu vor der Leiche zu haben. Vielmehr schien etwas Zorniges in seinem starren Blick zu liegen, seine nach unten verzogenen Mundwinkel zeigten mehr Verachtung als Betroffenheit oder gar Mitleid. Le Clech kam der Gedanke, dass man diese Mimik als eine Art Schadenfreude deuten könnte. Aber warum? Kannte Lemarchand den Toten? Was mochte ihn zu einer solchen Reaktion veranlassen?
In dem Moment hob Lemarchand den Blick von der Leiche und schaute für eine Sekunde direkt in die Augen des Adjudant-chef, der ihren kalten Glanz zu spüren bekam. Doch noch bevor Le Clech reagieren konnte, ertönte plötzlich in unmittelbarer Nähe eine Polizeisirene.
Alle Köpfe drehten sich in die Richtung der beiden Einsatzwagen der Gendarmerie, die soeben mit Blaulicht in hohem Tempo zum Strand hinunterfuhren. Marceau und seine Kollegen hatten ihr Ziel erreicht.
Nachdem sie ihre Wagen mitten auf der Straße stehen ließen, liefen die Gendarmen in großen Schritten hinunter auf ihren Vorgesetzten zu, vorneweg der eifrige Marceau, der atemlos vor Le Clech zum Stehen kam. »Gendarm Marceau mit drei Mann, Chef!«, sagte er mit gepresster Stimme, obwohl das jeder der Anwesenden sehen konnte.
»Haben Sie Saint-Brieuc benachrichtigt?«, fragte Le Clech, ohne auf die Meldung einzugehen.
»Jawohl, mon adjudant!«
»Dann räumen Sie den Strand und sperren Sie den Fundort, bis die Spurensicherung da ist«, befahl Le Clech. Als er sich wieder umdrehte, sah er, dass Lemarchand sich bereits von den übrigen Schaulustigen entfernt hatte und langsam Richtung Parkplatz hinauflief, wobei der alte Mann das rechte Bein nachzog.