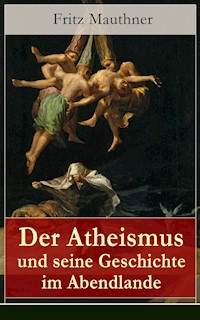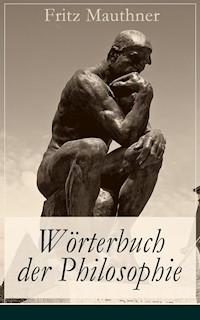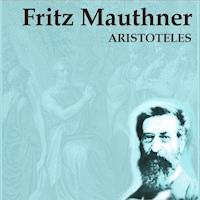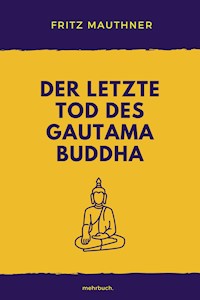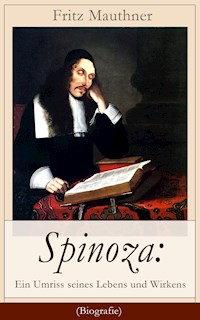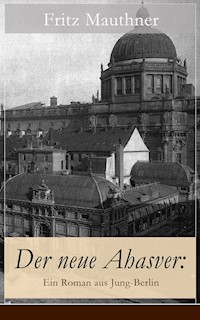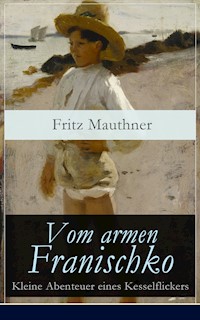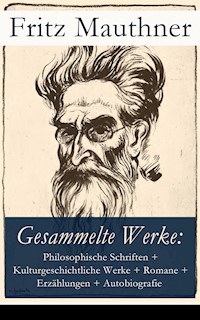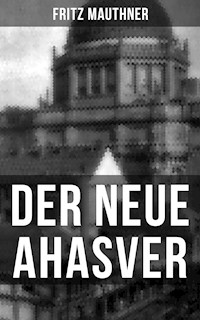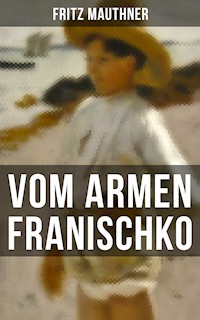Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In Fritz Mauthners Werk 'Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande' wird die Entwicklung des Atheismus im abendländischen Kulturraum detailliert untersucht. Mauthner präsentiert eine umfassende Analyse der historischen und philosophischen Hintergründe, die zur Entstehung und Verbreitung von atheistischen Strömungen geführt haben. Sein literarischer Stil zeichnet sich durch Präzision und Intellektualität aus, wobei er komplexe Konzepte auf verständliche Weise präsentiert. Das Buch ist ein bedeutendes Werk im Kontext der Religionskritik und gibt einen tiefen Einblick in die Vielfalt des Atheismus im abendländischen Denken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1317
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande
Books
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Vorwort
Damit der Leser nicht bis zum letzten Abschnitt des vierten Bandes zu warten brauche, um das letzte Ziel dieses Werkes kennen zu lernen, will ich gleich an dieser Stelle ein Glaubensbekenntnis ablegen; ich möchte diejenigen, die mir vertrauen, auf die helle und kalte Höhe führen, von welcher aus betrachtet alle Dogmen als geschichtlich gewordene und geschichtlich vergängliche Menschensatzungen erscheinen, die Dogmen aller positiven Religionen ebenso wie die Dogmen der materialistischen Wissenschaft, auf die Höhe, von welcher aus übersehen Glaube und Aberglaube gleichwertige Begriffe sind. Was ich zwischen den Zeilen des niederreißenden Buches aufbauend zu bieten suche, mein Kredo also, ist eine gottlose Mystik, die vielleicht für die Länge des Zweifelsweges entschädigen wird.
Die Überschrift verspricht ein Buch über den Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. Ich meine, hier etwas mehr, dort etwas weniger gegeben zu haben. Die Darstellung des Atheismus selbst mußte unvollständig ausfallen, weil ich nur die Befreiung vom Gottesbegriff behandelt habe, die Vorgeschichte Gottes jedoch, die siegreiche Entwicklung des Gottesbegriffs, einem nach mir kommenden Arbeiter überlassen wollte. Die Geschichte der Befreiung vom Gottesbegriff wäre aber kläglich lückenhaft, wenn ich mich auf die Reihe der dogmatischen Gottesleugner beschränkt hätte. Äußere und innere Gründe hinderten im sogenannten Mittelalter und noch lange nachher auch freie Geister, deutlich und entschieden ihre Absage an die Kirche auszusprechen; die äußeren Gründe sind in den Gefahren zu suchen, die jedem Gottesleugner drohten; der innere Grund bestand in der Abhängigkeit jedes Denkers von der Sprache der Zeit, von der gemeinsamen christlichen Sprache, worunter aber auch die gemeinsame Sitte und Wissenschaft zu verstehen ist. Es gehörte zu meinen schwierigsten Aufgaben, in jedem einzelnen Fall eine Entscheidung darüber zu wagen, ob die Halbheit der Freidenkerei mehr auf bewußte Vorsicht oder auf unbewußte Fesselung, durch den Zeitgeist, zurückzuführen sei. Sollte also die Geschichte des geistigen Befreiungskrieges nicht sehr bedeutende Persönlichkeiten und Strömungen übergehen, so mußte die Geschichte der Aufklärung in den Kreis der Betrachtung einbezogen werden, mußten neben den rein negierenden Atheisten auch die Lehrer der Vernunft- oder Naturreligion, die Deisten und die Pantheisten, endlich sogar einige Reformatoren und andere Ketzer dargestellt werden. Eine Kulturgeschichte des Abendlandes vom Standpunkt der religiösen Befreiung – nicht: einer Befreiung von der Religion – war zu schreiben. Anstatt »Abendland« hätte ich auch »Christenheit« sagen können, d. i. die Gesamtheit der westlichen Völker Europas, insofern sie nach Denk- und Lebensweise ein Ganzes ausmachen. Zu dieser Christenheit gehören wir alle, ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Durch Sitte und Sprache. Der Gegenstand des Kampfes, der Gottesbegriff, ist mir niemals der theologische Gott einer christlichen Konfession, sondern überall der ethnographische Gott der gemeinsamen »Christenheit«.
Diesen ungeheuern geschichtlichen Stoff aus eigener Forschung zu bewältigen, geht doch wohl über die Kraft eines einzelnen Menschen, auch wenn er gelehrter, fleißiger und jünger wäre als ich. Bei vielen Führern und Anregern im Unglauben und im Zweifel durfte ich mich also damit begnügen, fremden Untersuchungen zu vertrauen und so wieder ein wenig zu glauben. Mir lag nur das Ziehen der großen Linien ob; und bei den nachwirksamsten Gestalten und Gedanken sorgte schon meine Wahrheitsleidenschaft dafür, daß ich bis auf die Quellenschriften zurückging und mich auf keine Vorarbeit verließ.
Für die Zeit bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts war ich bemüht, die Menschen und die Ideen der religiösen Befreiung mit möglichster Vollständigkeit zu schildern, wenn »Vollständigkeit« in einem Geschichtswerk nicht ein vermessener Ausdruck ist. Für die letzten beiden Menschenalter wäre der bloße Versuch, Vollständigkeit anzustreben, eine Torheit gewesen. Die Literatur der Gegenwart ist überhaupt gottlos. Die Geisteswissenschaften möchten zwar eine Verbindung mit der Theologie heuchlerisch wieder anknüpfen, aber die Naturwissenschaften stehen längst außerhalb der Kirche und die Dichtung gar ist allgemein atheistisch, auch da, wo sie die toten Symbole des Theismus wiederzubeleben sucht. Ich mußte mich für die letzten siebzig Jahre auf Stichproben beschränken, wenn ich überhaupt ein Ende finden wollte.
Um Entschuldigung zu bitten habe ich natürlich für die Unbescheidenheit, mit der ich ein Geschichtswerk zu verfassen unternahm, der ich kein gelernter Historiker bin. Aber ich habe ja auch die »Kritik der Sprache« verfaßt und war kein gelernter Philosoph und kein gelernter Philolog.
Meersburg, im März 1920 Fritz Mauthner
Kapitel 2
Einleitung
I
Geschichte Gottes
Der große Pan ist tot oder liegt im Sterben; es ist Zeit, seine Geschichte zu schreiben. So lange noch Zeugen seiner lebendigen Herrschaft da sind. Die Geschichte des gewaltigsten Gedankenwesens, das in der Menschheit gewirkt hat. Die Geschichte der Gottesvorstellung oder des Gottes, je nachdem.
Es gibt ein gutes Buch über das Emporkommen und den Niedergang des Teufelswahns, und dieses Buch ist überschrieben »Geschichte des Teufels«; in gleicher Weise hätte ich meine Untersuchung eine »Geschichte des Gottes« nennen können, obgleich ich mich auf den zweiten Teil der Aufgabe beschränkt habe, auf den abendländischen Freiheitskampf gegen die Gottesfurcht, und den ersten Teil, die Darstellung des Emporkommens der Gottesbegriffe, gern der vergleichenden Religionswissenschaft überlasse. Der Titel »Geschichte des Gottes« wäre aber nicht nur zu weit gewesen, sondern auch für mein Sprachgefühl noch ungenauer als der stillschweigend geduldete Buchtitel »Geschichte des Teufels«. Auch da wäre es gewiß sorgfältiger gewesen, »Geschichte des Teufelswahns« zu sagen oder so ähnlich, denn ein Wahn kann als eine seelische Tatsache eine Geschichte haben, nicht aber der unwirkliche Gegenstand des Wahns. So kann man – genau genommen – auch nur eine Geschichte der Hexenprozesse oder des Hexenwahns schreiben, nicht aber eine Geschichte der Hexen, der niemals wirklichen Zauberweiber. Immerhin ist in den Kreisen der bücherlesenden Menschen der alte Teufelswahn so völlig abgestorben, daß der Titel »Geschichte des Teufels« allgemein richtig verstanden wird als eine nicht ganz genaue Bezeichnung für die Entwicklung und den Tod des Glaubens an ein Fabelwesen; als ob jemand mit behaglicher Ironie eine Geschichte des Zeus oder der Chimära ankündigen wollte.
Etwas anders steht es doch um die Gottesvorstellung. So stetig sich auch die Gebildeten in den Kulturvölkern Europas zuerst von den positiven Gottesdefinitionen und dann von den undeutlichen Vorstellungen der Vernunftreligion oder des Deismus losgelöst haben, ist doch eine gemeinsame Seelensituation für die Gottlosen eigentlich nicht vorhanden; die leise Ironie in der Überschrift »Geschichte des Gottes« würde kaum verstanden werden, und der Ausdruck »Geschichte des Gotteswahns« würde überflüssigen Anstoß erregen. Weil das gemeinsame Wort die gemeinsame Vorstellung überdauert hat.
Doch auch abgesehen von der Frage, ob der Kampf um den Gottesglauben für so abgeschlossen gelten darf wie der Kampf um den Teufelswahn, bringt es die ungeheure Ausdehnung des Stoffes mit sich, daß eine Geschichte des Atheismus oder der Gottlosigkeit sich selbst Grenzen ziehen muß, um die sich eine Geschichte des Teufels nicht zu kümmern brauchte. Aufbau und Abbau der Teufelsvorstellung läßt sich übersehen, Aufbau und Abbau der Gottesvorstellung ist unübersehbar.
Ketzer keine Atheisten
Will ich mich aber mit der Darstellung des Abbaus begnügen, mit Atheisten einer Geschichte der Befreiung vom Gottesbegriffe, so muß ich die unzähligen Erscheinungen der sogenannten Ketzer aus meinem Rahmen ausschließen; denn die Ketzer waren immer, wenn man sich nicht auf den Standpunkt einer einzigen Konfession stellen und das arme Wort zum Schimpfe für Andersgläubige machen will, am Aufbau der Religion beteiligt oder doch bemüht, eine bestimmte Religion von Verunreinigungen zu säubern. Die meisten christlichen Ketzer wenigstens strebten mit reicheren oder geringeren Kenntnissen danach, in tiefer Gläubigkeit ein unfaßbares Urchristentum wieder herzustellen. Wir werden aber auf unserem Wege freilich auch solche Ketzer antreffen, die im Forschen nach dem wahren Sinne der Offenbarung über die Gottseligkeit zur gottlosen Bibelkritik gelangten, oder wieder Freidenker, die ihren Zweifel oder ihre Gottlosigkeit hinter einer von ihrem Zeitgeiste schon geduldeten Ketzerei verbargen. Die Ketzer der ersten Art teilen mit den ganz frommen Ketzern die Überzeugung, daß sie im Besitze der reinen Lehre sind; es ist sicherlich nur ein Zufall, verdient aber dennoch Erwähnung, daß dieses Vertrauen auf die reine Wahrheit der eigenen Lehrmeinung bereits in der Bezeichnung »Ketzer« steckt; man nimmt wenigstens allgemein an, daß der Ausdruck von den Katharern herkommt, einer gnostischen Sekte, die sich selbst als Katharer oder als »rein« von der offiziellen Kirche unterschied. Beinahe lustig ist es, daß man die Herkunft des Namens, der im 12. Jahrhundert üblich wurde, vergaß, daß man – mit lateinischer und mit deutscher Volksetymologie – »Ketzer« von »Katze« herleitete, dem Teufelstier, und daß man diese Herleitung wiederum dazu benützte, die widernatürliche Unzucht zu erklären, die fast jede christliche Sekte der anderen vorwarf, jede Kirche ihren Ketzern; und merkwürdig genug hat die gleichbedeutende Bezeichnung Bulgaren – die Sekte der Katharer kam über Bulgarien nach dem Abendlande – im Französischen eine ähnliche Wandlung durchgemacht: bougrehieß ein Knabenschänder, weil ein Ketzer so ein Schuft sein mußte, und nahm erst spät den Sinn eines allgemeinen und gemeinen Schimpfwortes an, wie übrigens auch »Ketzer« in einigen Mundarten der Schweiz. Wir werden leider die gleiche Erfahrung nur zu oft machen: ein Name, den sich eine Gruppe von Menschen zur ehrenvollen Unterscheidung von der Menge beigelegt hat, wird von dieser Menge zuerst als Ketzername gedeutet und schließlich als ein entehrendes und gefährdendes Schimpfwort gebraucht. Immer handelt es sich bei einem solchen Bedeutungswandel um die Torheit oder um die Unverschämtheit, die den eigenen Glauben für den richtigen und guten, den fremden Glauben für den falschen und schlechten hält, für den Aberglauben.
Aberglaube
Das Wort Aberglaube wirft vielleicht einiges Licht auf das Wort Glaube zurück. Solange man nicht von seinem eigenen, besonders nicht von seinem eigenen leidenschaftlich ergriffenen religiösen Glauben spricht, ist Glaube die vorurteilslose und parteilose Bezeichnung für die Anerkennung oder Bejahung einer Sache, einer Idee oder eines Ereignisses; Aberglaube dagegen will immer ein abschätziges Urteil über den falschen Glauben anderer fällen. Ja selbst, wenn man einmal von seinem eigenen Aberglauben redet, will man mitverstanden wissen, daß man diesen seinen falschen Glauben zwar nicht loswerden könne, aber mit seinem Verstande verurteile. Aberglaube ist also allgemein der von anderen Menschen angenommene Glaube, den der Sprecher nicht teilt; in der Gemeinsprache eines Volkes oder eines Volksteils: der fremde Glaube, den dieses Volk oder dieser Volksteil nicht teilt. Der gute Lutheraner Walch führt in seinem »Philosophischen Lexikon« den römischen Gottesdienst ganz unbefangen an als ein Hauptbeispiel des Aberglaubens. Es ist, als würde daheim die Währung eines fremden Landes nicht für ein fremdes, sondern für ein falsches Geld angesehen, die Währung des eigenen Landes jedoch für gemünztes Gold.
Zu einem solchen Gegensatze zwischen Glaube und Aberglaube konnte es aber erst in der christlichen Zeit kommen, in welcher der »richtige« Glaube (in jeder Sekte anders) in sogenannten Glaubensartikeln festgelegt und vom falschen Glauben unterschieden wurde. Wir werden gleich sehen, in welcher Weise die Gemeinsprache unscharf zwischen theoretisch falschem Glauben oder Ketzerei und praktisch falschem Glauben oder Aberglauben unterschied. Die antike Welt nahm es mit der Rechtgläubigkeit nicht so genau. Die Griechen verstanden unter δεισιδαιμων und δεισιδαιμoνια etwa Gottesfurcht sowohl im guten als im übeln Sinne; richtiger: sie meinten Gottesfurcht, und es hing von der Freidenkerei oder auch nur von der Lokalreligion des Sprechenden ab, ob er diese Gottesfurcht freundlich oder unfreundlich bewerten wollte; der natürliche Gang der Entwicklung hatte zur Folge, daß δεισιδαιμoνια später fast nur noch für die tadelnswerte Gottes furcht, ἀδεισιδαιμoνια für Freiheit von Aberglauben gebraucht wurde. Das entsprechende Wort der Römer superstitio ist uns vielleicht nur darum mehr im Sinne des Aberglaubens bekannt, weil die römischen Klassiker um einige hundert Jahre jünger sind als die griechischen. Die lateinischen Kirchenväter gebrauchten zwar religio ausschließlich für den wahren, superstitio für den falschen Glauben; aber der gewöhnliche Sprachgebrauch lehrt, daß superstitio ursprünglich nicht so sehr den falschen als den ängstlichen Glauben bedeutete, die religiöse Scheu, ja sogar die Andacht, die eine Gottheit oder ihr Tempel einflößte; auch die religiöse Schwärmerei, dann aber besonders die mystische Verehrung fremder Kulte. Noch zwei Beispiele für die Vorurteilslosigkeit des römischen Sprachgebrauchs: das Adverb superstitiose heißt soviel wie genau, peinlich, skrupulös (ein Lieblingswort sehr gewissenhafter katholischer Geistlicher); und den Schulsatz bei Quintilianus (IV. 4, 5), Sokrates habe novas superstitiones eingeführt, dürften wir gar nicht anders übersetzen als »eine neue Gottesverehrung« oder »einen neuen Glauben«, weil der Schulmeister doch gar nicht hatte sagen wollen, die alten superstitiones seien Aberglaube gewesen. Am entscheidendsten scheint es mir jedoch, daß der Dichter Vergilius das Wort superstitio für einen Schwur bildlich gebrauchen durfte, für einen Eidschwur der Juno, und daß der berühmteste Kommentator des Vergilius den Ausdruck superstitio harmlos durch religio erklärt.
Von dieser Anwendung des lateinischen Wortes sind in dem französischen superstition noch sehr deutliche Spuren erhalten. Es bezeichnet ursprünglich nicht Bräuche, die von der Kirche verboten sind, sondern eine übertriebene Ängstlichkeit in der Gottesverehrung, die dann allerdings zu der Vorstellung falscher Pflichten und zum Vertrauen auf unmögliche Wirkungen führen kann; endlich eine übertriebene Sorgfalt jeder Art, auch außerhalb religiöser Dinge. Fontenelle wendet das Wort auf die Befestigungskunst von Vauban an; es gebe gewisse superstitions, die erst bei dem Auftreten eines Genies verschwinden. Derselbe klassische Schriftsteller spricht vom Gemeinwohl, das bis zur superstition geliebt werden sollte, von einer Gewissenhaftigkeit jusqu'au scrupule et jusqu'à la superstition. D'Alembert redet einmal von einer superstition littéraire und Mme. de Genlis gar von les superstitions de la toilette. Und auch das Adjektiv superstitieux wird (ebenfalls von Fontenelle) im Sinne einer pedantischen Genauigkeit gebraucht. Auch die englischen Worte superstition und superstitions haben mitunter die alte römische Bedeutung einer übertriebenen Peinlichkeit.
Der bewußte bibelkritische, erkenntniskritische und endlich sprachkritische Atheismus des christlichen Abendlandes ist nun aber eine ganz andere Sache als der Atheismus der antiken Welt, der zwar auch aufklärerisch war, aber an eine Kritik des Gottesworts (weil es keines gab) nicht denken konnte, an eine Kritik des Gottesbegriffs nicht dachte. Das wird besonders deutlich, wenn wir uns erinnern, mit wie kindlicher Harmlosigkeit ein so konservativer und religiöser Schriftsteller wie Plutarchos den Satz ausstellen konnte: der Aberglaube sei ein größeres Unglück als der Atheismus. Die Griechen und Römer hätten, wenn sie englisch gesprochen hätten, ein bekanntes Wort abändern und sagen können: » Superstition begins at home.« Den Römern war (und ähnlich stand es um die noch deutlichere δεισιδαιμoνια der Griechen) » superstitio« auch die Furcht vor falschen, ausländischen Göttern, aber jede Ängstlichkeit in der Religion, jede Schwärmerei, ja endlich der Kultus selber hieß » superstitio«; dem Christentum war es vorbehalten, die hochmütige Unterscheidung zu befehlen: was ich glaube, das ist Glaube, was die anderen glauben, das ist Aberglaube. Es braucht nicht wieder darauf hingewiesen zu werden, daß jede christliche Sekte die Meinung jeder anderen Sekte für Aberglauben erklärt, daß namentlich die Protestanten über den Aberglauben der Katholiken schreien. Die Römer redeten von einer superstitio muliebris, anilis beim eigenen Volke. Die Philosophen bekämpften eigentlich niemals den Gottesbegriff, sondern nur die Gottesfurcht; darum war ein Mann wie Epikuros nicht ein Atheist in unserem Sinne, sondern nur ἀδεισιδαιμων frei von Gottes furcht, frei von Aberglauben. Erst die lateinischen Kirchenväter änderten die Wortbedeutung und wollten » superstitio« unduldsam auf den Volksglauben, den Glauben an die antiken Götter angewandt wissen. Die Beschränktheit der neuen Religion ging so weit, daß sie den Wahnsinn gar nicht bemerkte, zu welchem die Umkehrung der Begriffe führte; als nämlich bald darauf die unglückselige Lehre aufkam, hinter Venus, Diana und den anderen Göttern stecke der Teufel, da wurde diese Lehre unter die Glaubensartikel aufgenommen und jeder Zweifel daran nach einer noch späteren Entwicklung mit dem Feuertode bestraft; der einfache Glaube der Römer aber an das Dasein ihrer Götter hieß auch dann noch Aberglaube, als die Kirche das Dasein des Teufels (in diesen Göttern) zu einem Glaubenssatze gemacht hatte. Und niemand scheint die Zudringlichkeit in dieser Dummheit beachtet zu haben.
Als nun Bayle den Satz wieder auf die Bahn brachte, der Atheismus sei nicht so schlimm wie der Aberglaube, da tat er zwar sehr unschuldig und stellte sich auch so an, gelegentlich, als verstünde er unter dem Aberglauben den Götzendienst der Heiden; sein Satz war aber wirklich vom Standpunkte der Kirche ungleich gefährlicher als der Satz des Plutarchos. Dieser, obgleich sonst ein Gegner des Epikuros, war doch Grieche genug, um ungefähr zu meinen: die Furcht vor göttlichen Strafen, die Angst vor überirdischen Einmischungen ist schlimmer als eine Philosophie, die eine allgemeine Geltung der Naturgesetze lehrt und den Gott einen guten Mann sein läßt. Was Bayle, oft mit überraschender Offenheit, öfter mit begreiflicher Vorsicht, lehrt, das ist, mehr als anderthalb Jahrtausende später, etwas ganz Neues: der Aberglaube, worunter man jedes unduldsame, fanatische Religionssystem verstehen mag, ist für die Ruhe der Bürger, für den Frieden im Staate und zwischen den Staaten gefährlicher als die Überzeugung, daß es einen Gott überhaupt nicht gebe. Plutarchos verstand unter Atheismus eine ruhige, persönliche, unangreifbare und friedliche Weltanschauung, Bayle verstand unter dem gleichen Worte eine »gefährliche«, rebellische, die öffentliche Meinung bekämpfende Überzeugung. In der Zeit zwischen Plutarchos und Bayle war »Atheist« zu einem Schimpfworte geworden; und blieb noch lange in solcher Geltung.
Gottlos
Streng genommen bedeutet »Atheismus« nur den Seelenzustand eines Menschen, der ohne Gott lebt, der z. B. vom Dasein eines Gottes niemals gehört hat oder der einfach an das Dasein von Göttern nicht glaubt. In diesem Sinne gab es im alten Indien, gab es in Griechenland Atheisten genug. Der Atheismus im neueren Abendlande, der christliche Atheismus, wenn ich so sagen darf, besaß nicht diesen ruhigen, einfach negierenden oder nichtwissenden Charakter. Inmitten der Christenheit, die tausend Jahre lang eine Theokratie war und die eine Priesterherrschaft heute noch in vielen Bestimmungen des Rechts und der Sitte duldet, mußte die einfache Gottesleugnung aktiv werden oder scheinen, wurde jeder Atheist zu einem Aufrührer, der seiner Überzeugung nur mit der äußersten Lebensgefahr Ausdruck geben konnte. Der drohende Feuertod hat sich zu der immerhin kleineren Gefahr gemildert, daß der Atheist nicht Briefträger werden kann, auch nicht Minister, auch am Stammtisch einer Kleinstadt nicht unbehelligt lebt, aber die Sachlage blieb: die gesamte Christenheit bekennt sich, ehrlich oder nicht, zum Glauben an einen Gott; auch der Gottesleugner ist in diesem Glauben und zu diesem Glauben erzogen worden und hat sich früher oder später von diesem Glauben losmachen, losketten, losdenken müssen. Er hat sich durch eigene Arbeit befreien müssen. In dem Wörtchen »los« liegt die Vorstellung einer Befreiung aus Gefangenschaft oder Knechtschaft. Diese Bedeutung hat »los« fast immer vor einem Verbum und hinter einem Nomen. Verbindungen wie »arglos, achtlos, bewußtlos« werden zwar nicht falsch verstanden, wenn man die Nachsilbe wie eine reine Negation auffaßt, sie etwa mit »ohne« gleichsetzt; aber im Falle der Zusammensetzung »gottlos« liegt die Sache doch etwas anders. Die Einigkeit, ja die Vereinigung mit Gott scheint dem tief christlichen Jahrtausend eine Selbstverständlichkeit; der Fromme – der Pietist ist darin womöglich noch sicherer als der Rechtgläubige – kann es sich gar nicht vorstellen, daß ein Volksgenosse einfach ohne Beziehung zu dem Gotte des allgemeinen Volksglaubens stehe, daß er das Band nicht gewaltsam (z. B. durch einen Bund mit dem Teufel, der dann in ganz besonderem Sinne »los« ist) zerrissen habe. Aber auch der Atheist, bis tief in unsere Zeit hinein, empfindet es als eine Tat (nicht als eine Unterlassung), Gott los geworden zu sein. So hätte auch im Sprachgebrauche der Atheisten das Wort »gottlos« einen aktiven, heroischen Charakter annehmen können. Doch die Minderheit schafft nicht den Sprachgebrauch; die Mehrheit, die gottgläubig war, gewöhnte sich daran, an eine (strafbare) Handlung zu denken, wenn sie ein Geschehen oder einen Menschen gottlos nannte. In Luthers Bibelübersetzung konnte mit »gottlos« noch der unbekehrte, der über Gott unbelehrte Mensch bezeichnet werden, der Heide; im Sprachgebrauche der Frommen aber wurde »gottlos« schließlich zu einem Scheltworte, mit welchem jeder Andersgläubige als nichtswürdig gebrandmarkt wurde. Der Ausdruck kam dadurch so herunter, daß er (moralisch melioriert, sprachlich pejoriert) auch einen viel leiseren Tadel mitumfaßte; man redete von gottlosen Knaben, gottlosen Streichen, wo man vielleicht nur scherzend einen Mutwillen nicht ganz am Platze fand; wie umgekehrt »göttlich« zur Bezeichnung lobenswerter Eigenschaften des Geistes oder des Körpers verwandt wurde, besonders von witzigen Schriftstellern, wie Adelung meint, und mißbräuchlich.
Kapitel 3
II
Philosophen
Eine Geschichte der Freidenkerei ist nicht eine Geschichte der Philosophie. Daß die Philosophen zu allen Zeiten Gottesleugner gewesen seien oder doch Förderer des Atheismus, ist ein Satz, der früher ebenso allgemein gegen die Philosophie ausgespielt wurde, wie er jetzt unbesehen zugunsten des Atheismus benützt wird. Eine ernsthafte, also sprachkritische Geschichtschreibung wird wieder einmal darauf hinweisen müssen, daß die Leugnung eines Glaubens verschieden ist je nach der Art des Glaubens, daß der heidnische Atheismus ein anderer war als der christliche, und daß die Meinung, alle Philosophen seien Gottesleugner gewesen, eigentlich falsch ist, weil die Scholastiker des wirklich ganz frommen 10. und 11. Jahrhunderts, weil also diese logischesten Theologen ganz wohl das Recht hatten, sich nach ihrer Disziplin und ihrer Methode etwa auch Philosophen zu nennen. Wir sind nur durch den Atheismusstreit der christlichen Geschichte zu befangen geworden, um das gern zuzugeben; man achte aber darauf, daß der Glaube oder Unglaube – an das Dasein der Götter nämlich – in den antiken Philosophenschulen eine sehr kleine Rolle spielte. Als dann die alte Philosophie durch die Renaissance wieder bekannt wurde, wurden freilich viele christliche Gelehrte zum Abfall verlockt; nicht aber gleich zum Zweifel am Dasein eines Gottes, sondern zunächst nur zum Zweifel an der Wahrheit des Christentums.
Noch früher ist die Renaissance des Aristoteles der jüdischen und der mohamedanischen Orthodoxie gefährlich geworden. Es ist beschämend für den Bekenntnismut auch dieser für fanatisch ausgegebenen Nationen, daß die Araber sogleich Freigeister wurden, da aufgeklärte Kalifen das Studium des Aristoteles begünstigten, daß viele Juden unter der Herrschaft aufgeklärter Kalifen die heidnische Philosophie annahmen und sogar das Gesetz Moses preisgaben. Das Denken war so frei, wie der Herrscher es erlaubte.
Bekanntlich hat schon Cicero den Leitsatz von dem Atheismus aller Philosophen vorgebracht, und zwar wie einen Gemeinplatz, wie ein Axiom, über dessen Wahrheit allgemeine Übereinstimmung herrscht. (Man erinnere sich, daß der consensus nationum als Argument für das Dasein Gottes ebenfalls seit Cicero bis zum heutigen Tage durch die Schulen wandert.) So selbstverständlich dünkt ihm dieser Satz, daß er die folgenden Beispiele daneben stellt: die Mutter liebt ihr Kind, der Geizhals hat keine Achtung vor dem Eide. Will man sich aber ganz deutlich zum Bewußtsein bringen, wie unübersetzbar solche Worte aus dem Altertum für uns im Grunde sind, so denke man daran, daß in dem Satze » Philosophen wissen nichts von Gott« eigentlich nur die Negation »nichts« und das armselige Vorwörtchen »von« ihre Bedeutung in diesen 2000 Jahren nicht geändert haben. Es wären drei starke Bücher zu schreiben, wollte man den Bedeutungswandel der drei Hauptbegriffe auch nur einigermaßen erschöpfend darstellen. Ich will hier, wie an anderen Stellen auf andere Entwicklungen, bei jedem der Worte nur auf den einen Punkt hindeuten, daß nämlich bei den Griechen und Römern nur wenige Begriffe (etwa die der Jurisprudenz) genau definiert waren, daß die allermeisten Worte, ganz gewiß die drei unseres Satzes, ahnungslos der Gemeinsprache entlehnt wurden.
Philosophie ist freilich heute noch ein vielumstrittener Begriff; es gäbe für geduldige Leser einen nicht unlustigen Folianten, wollte man zusammenstellen, was auch nur seit Bacon von Verulam unter Philosophie verstanden worden ist. Immerhin ist selbst die positivistische Philosophie, deren bester und diesseitigster Teil der Erkenntnissehnsucht der Griechen (natürlich nicht der griechischen Unbehilflichkeit des Ausdrucks und der griechischen Unwissenheit) am nächsten stehen dürfte, doch ein Versuch, über allen Wissenschaften einen höheren Standpunkt zu finden und von ihm aus das Sein der Welt (nicht den sogenannten Sinn des Lebens) zu erklären; dieser höchste Standpunkt verlangt die Anwendung der schärfsten Methoden der Logik oder der Psychologie, je nachdem, weil die moderne Philosophie Erkenntnistheorie geworden ist, auch bei denen, die es nicht zugeben wollen. Von alledem finden sich im Altertum nur erst leise Spuren. Zur Zeit des Cicero hieß freilich Philosophie längst nicht mehr, wie in den kindlichen Anfängen, der bloße Wunsch nach irgendeiner Weisheit; aber er definiert sein bißchen Philosophie doch noch so ungefähr: als die Übung in jeder Kenntnis von allerlei sehr guten und interessanten Dingen. Zu diesen Dingen gehörten für ihn auch die Götter des Volksglaubens; er war mit den weit besseren griechischen Denkern nicht zufrieden, die ihren Witz just an solchen Dingen übten.
Wissen ist der neueren Philosophie, eben weil sie Erkenntnistheorie ist, ein ernstlich relativer Begriff geworden. Nun war eine gewisse Relativität des Wissens den Griechen durchaus nicht fremd; die besten Sophisten und die Skeptiker lehrten das, aber, mit den Ergebnissen des Humeschen Zweifels und des französischen und englischen Agnostizismus verglichen, sind alle diese antiken Kühnheiten nur dogmatische Spielereien begabter und streitsüchtiger Jünglinge. Sokrates und Platon, die von allen späteren Philosophen zumeist verehrt wurden, ja auch Aristoteles, glaubten absolut zu wissen, was sie etwa wußten. Unkritisch, wortabergläubisch trugen darum die Griechen, die gläubigen wie die ungläubigen, auch das vor, was sie von den Begriffen zu wissen glaubten, die man damals um den Gottesbegriff herum sprechen hörte. Ja sogar die Negation »nichts«, die ich vorhin voreilig oder vorläufig unverändert genannt habe, ist es nur gewissermaßen in logischer Beziehung; in Verbindung mit dem Wissensbegriff hat auch diese Negation ihre Wandlung durchgemacht. Der moderne Agnostizismus ist freilich nicht positiv, wie Herbert Spencer gern glauben machen möchte; aber er ist (in sehr ungeschickter Form) doch ein verständlicher Ausdruck der neuen Erkenntnistheorie und dürfte sogar für Kants letzte Überzeugung angesprochen werden; die Agnosie des Sokrates, sein berühmtes »ich weiß, daß ich nichts weiß«, geht aber auf keine erkenntnistheoretische Methode zurück, sondern bezeichnet offenbar nur die ironische Weise seiner Gesprächführung; er stellte sich unwissend, damit der Gegner sich Blößen gäbe; nirgends findet sich in dem, was von ihm berichtet wird, der tiefe Gedanke der Unerkennbarkeit des Wesens. Und bei den anderen Griechen erst recht nicht.
Gott ist scheinbar kein so abstraktes Wort wie Philosophie und Wissen, und der Begriff ist auch darum in der Hauptsache für unverändert gehalten worden. Aber nicht einmal in der Zeit von Homeros bis zu den Neuplatonikern haben wir es mit dem gleichen Gottesbegriffe zu tun; und trotz der Abhängigkeit des christlichen Gottesbegriffs von diesen Neuplatonikern ist der Gott, der etwa in einer protestantischen Kirche verehrt wird, etwas ganz anderes als der Gott, der leibhaftig in einem griechischen Tempel wohnte. Was sich verhältnismäßig wenig verändert hat in den 3000 Jahren der irgendwie bekannten Geschichte des Abendlandes, das ist der Mensch, vor allem der ungelehrte Mensch. So mag es freilich gekommen sein, daß die Pöbelvorstellung von Gott heute noch ungefähr die gleiche ist, wie die Pöbelvorstellung der vorhomerischen Zeit: offener oder heimlicher Fetischismus. Ich werde es noch oft wiederholen: eine Theologie, d. h. ein schulgerechtes Wissen von Gott, kannte das gesamte Altertum zu seinem Glücke überhaupt nicht, und so hätte man unseren Satz dahin erweitern können, daß die antike Welt (eigentlich auch das Christentum bis zu seinem ersten Konzil) nichts von Gott »wußte«.
So wird man es nicht mehr für einen unziemlichen Scherz halten, sondern für eine wortgeschichtliche Parallele, wenn ich jetzt einen ganz fernabliegenden Satz neben den unseren stelle. »Die Sansculotten (Ohnehosen) waren immer Königsmörder.« Zum Erweise dieses Unsinns hätten deklamierende Prediger noch vor hundert Jahren sich vielleicht daraus berufen, daß im Orient, wo die Beinkleider zu Hause waren, kaum ein Königsmord vorkam, daß die griechischen und römischen Tyrannenmörder wirklich keine Hosen trugen und daß die Bergschotten, die die Hosen heute noch nicht kennen, vornehmlich an der englischen Revolution beteiligt waren. Man lache nicht zu überlegen; die Negation einer Tracht gibt keinen viel unklareren Begriff als die Negation eines unvorstellbaren Abstraktums.
Der Bedeutungswandel aller Begriffe, besonders der abstrakten Begriffe, warnt also vor der Aufstellung eines Satzes wie: die Philosophie hat kein Wissen von Gott. Es gibt keine ewige Philosophie, kein unveränderliches Wissen, keinen feststehenden Gottesbegriff, nicht in verschiedenen Ländern und nicht in verschiedenen Zeiten, genau genommen kaum bei zwei verschiedenen Menschen; der Mann, der nach altem Herkommen die religiösen Angelegenheiten eines Staates zu verwalten hat, auch den sogenannten Gottesdienst, sollte Götterkultusminister heißen.
Kapitel 4
III
Wahrheit
Ich habe (Wörtb. d. Phil., Art. »Wahrheit«) hoffentlich überzeugend nachgewiesen, daß »Wahrheit« ein relativer Begriff sei, daß zwischen Wahrheit und Glaube kein Unterschied bestehe, daß »glauben« nichts weiter bedeute als: geloben, ja-sagen, gut-heißen, für-wahr-halten. Aus subjektiven Gründen natürlich für wahr halten; denn Wissen unterscheidet sich von Glauben nur durch einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit. Man hat aus guten Gründen zwei Arten von Glauben unterschieden: den Eigenglauben und den (aus dem Glauben oder dem vermeintlichen Wissen eines andern beruhenden) historischen Glauben; man hat, von Schwierigkeiten des Begriffes gedrängt, ganz unlogisch wieder zwei Formen des Eigenglaubens angenommen: den Glauben des Individuums (eine alte Frau hält sich selbst für eine Hexe) und den Glauben der Menge (ein ganzes Volk glaubt an Hexen). Ich brauche nicht erst zu versichern, daß ein solcher Eigenglaube dadurch nicht wahrscheinlicher werde, daß er von Millionen geteilt wird.
Die ganze feine Distinktion wird dadurch hinfällig, daß auch der historische Glaube, also die Zuversicht auf das Wissen eines andern, fast immer oder immer erst dann wirksam wird, wenn der historische Glaube gemeinsamer Eigenglaube geworden ist. Jeder religiöse Glaube, auch der Glaube an Gott (was immer man zu seiner Begründung aus der Vernunft gesagt haben mag), beruht auf Tradition und zuletzt aus einem historischen Glauben, den man in diesem Falle Offenbarungsglauben nennt. Wer für andere historische Traditionen aus Mangel an Autoritätsglauben wenig Zuversicht hat, um so weniger, je weiter in die vorgeschichtliche Zeit die Meldung eines geschichtlichen Ereignisses zurückgeht, der wird natürlich um so weniger geneigt sein, die Kunde von der allerältesten Tatsache der Weltgeschichte zu glauben, daß Gott nämlich die Welt geschaffen habe. Schließlich ist die so viel jüngere und wahrscheinlichere Legende von der Gründung Roms für die Kritik lange nicht so herausfordernd.
Auf die Textkritik jenes uralten Satzes (die aber den ganzen Inhalt einer »Geschichte des Theismus« ausmachen müßte) kommt es mir hier viel weniger an, als eben auf den einfachen Hinweis darauf, daß der Glaube an Gott – ganz logisch betrachtet und ohne jede sogenannte Blasphemie – teils zu der Art des Massenglaubens gehört, wie der Glaube an den Teufel oder an die Hexen, teils zu der Art des historischen Glaubens, wie der Glaube an die Gründung Roms durch Romulus und der Glaube an die Gründung der schweizerischen Eidgenossenschaft durch Wilhelm Teil. Die Vergleichung mit solchen legendären Persönlichkeiten kann am besten erklären, warum die Welt es nicht dulden will, nicht von Gott geschaffen worden zu sein; so wahr das Festhalten an alten Überzeugungen mit Recht als ethisch geschätzt wird, so wahr waren ethische Mächte im Spiel, als das gelehrte Europa sich seinen Romulus (und seinen Homeros) nicht nehmen lassen wollte, als die Schweiz die Existenz des historischen Tell verteidigte. Ganz ähnliche ethische Mächte, nur in besonders individueller Färbung, bewirken eine Empörung, sobald ein Mensch die Nachricht für wahr halten soll, der Mann, den er bisher für seinen Vater hielt, sei nicht sein Vater gewesen; er, der bisher so sichere Mensch, sei unbekannter Herkunft, sei ein »natürliches« Kind.
Dieser Gedankengang kann und will nichts behaupten, als daß die Frage nach dem Dasein Gottes eine historische, eine Frage des historischen Glaubens ist. Es hat nach dem Auftreten des Christentums gut anderthalb Jahrtausende gedauert, bevor freie Menschen (immer noch mit Lebensgefahr) daran dachten, den Sinn der Evangelien und den leibhaftigen Erdenwandel Jesu Christi philologisch zu untersuchen, also historisch. Nur einen Schritt weiter auf diesem Wege scheint mir die Pflicht zu liegen, die Nachricht von dem Dasein der Götter überhaupt, insbesondere die Nachricht von der Weltschöpfung durch den alten Judengott, wie sie den ersten Satz der Bibel ausmacht, einfach als einen Gegenstand historischer Kritik zu behandeln, die Frage nach dem Dasein Gottes als eine historische Frage.
Kapitel 5
IV
Wir werden, um die innere und äußere Geschichte des Atheismus verstehen zu können, manche Anleihe machen müssen bei der Geschichte des Aberglaubens, der Ketzerei und der Philosophie; und wir werden die Erfahrung machen, daß die Meinungen des Aberglaubens und der Ketzerei einander ebenso oft berühren wie die Meinungen der Ketzerei und der Philosophie, daß darum auch die Kluft zwischen Aberglauben und Philosophie nicht unüberbrückbar ist; überall tönen uns nur arme Menschenworte entgegen, und vor der rücksichtslosen Wortkritik wandelt sich leicht auch Metaphysik wie Physik in Wortaberglauben.
Theologie
Die eigentliche Theologie als die vermeintliche Wissenschaft derer, die von dem Wesen und den Eigenschaften Gottes unglaublich viel auszusagen wissen, sollte nach dem ursprünglichen Plane von dieser Darstellung ausgeschlossen werden; wie es aber nicht angeht, eine Geschichte der Heilkunst zu schreiben, ohne sich mit den Verirrungen und den Betrügereien der Zauberer und Scharlatane zu beschäftigen, wie die Alchimie notwendig zu einer Geschichte der Chemie gehört, die Astrologie zu einer Geschichte der Sternenkunde – schon um der lebendigen Menschen willen, die auf diesen Wissensgebieten gearbeitet haben –, so ist für einen Geschichtschreiber des Atheismus der geistige Kampf nicht zu umgehen, der sich nicht unmittelbar gegen das Dasein Gottes richtete, sondern mittelbar gegen theologische Sätze, welche das Dasein des alten Gottes als unzweifelhaft annahmen und darüber hinaus über das Verhältnis zwischen Gott und Welt allerlei zu erzählen wußten: über die Art und Weise der göttlichen Weltregierung oder über die Vorsehung, über die Unabhängigkeit Gottes von den Naturgesetzen oder über die Wunder, über die Gerechtigkeit Gottes, die sich bei der Ungerechtigkeit des Weltlaufs nur in jenseitigen Belohnungen und Strafen äußern konnte, oder die Unsterblichkeit der Seele. Heutzutage noch gibt es Menschen genug, welche an die Vorsehung, an Wunder, an die Unsterblichkeit der Seele nicht glauben und dennoch in dem geheimsten Schreine ihres Herzens einen konfessionslosen, unbekannten Gottschöpfer irgendwie verehren; um so weniger darf es überraschen, wenn wir in den Zeiten der Aufklärung, der Renaissance und des mittelalterlichen Nominalismus (um nur die wichtigsten Perioden der älteren Freidenkerei zu nennen) Männer kennen lernen werden, die einen Zweifel am Dasein oder Wesen Gottes niemals aussprachen, die aber bereits Vorsehung oder Wunder oder Seelenunsterblichkeit leugneten und so das Aufkommen der Gottesleugnung selbst vorbereiteten; vom Wesen Gottes blieb wirklich nichts mehr übrig, wenn man dem Wesen seine Eigenschaften genommen hatte. Die schwierigste und wichtigste Aufgabe wird in jedem Falle der Versuch sein müssen, sich auf den Standpunkt so eines alten Freidenkers zu versetzen, der z. B. die Unsterblichkeit oder die Geister oder die Hexen nicht anerkannte, dennoch aber für einen Gottgläubigen gelten wollte. Wir werden ja von unserer Darstellung fast immer die frommen Ketzer auszuschließen haben, die die eine oder andere Meinung der Theologen nicht teilten, an dem Gotte der Offenbarung aber mit um so stärkerer Inbrunst hingen; wir werden bei den eigentlichen Aufklärern oder starken Geistern, die jedoch nur einzelne Eigenschaften Gottes bestritten, nicht aber sein Dasein, sehr genau zusehen müssen, ob sie in dieser schwankenden Haltung – die oft erst uns schwankend erscheint – mehr von der Macht des Zeitgeistes und der Sprache oder mehr von ihrem eingewurzelten Kinderglauben oder gar mehr von der Gefahr beeinflußt wurden, die durch ein Bekenntnis zum Atheismus ihnen drohte.
Es wird also nötig sein, den Begriff des Atheismus auch auf viele dogmenfeindliche Bestrebungen auszudehnen und die Aufmerksamkeit besonders aufs solche Schriftsteller zu lenken, die unter dem Scheine der Ketzerei die rechtgläubige Lehre über Vorsehung, Wunder, Unsterblichkeit und über ähnliche leere Worthülsen bekämpften. Die Aufgabe ist freilich, eine Geschichte der Leugnung Gottes zu entwerfen; der Gott, um den es sich da handelt, bleibt aber immer der Gott des christlichen Abendlandes, der zwar nicht einer und derselbe geblieben ist durch die Jahrhunderte, der aber bis zum Schatten verblassen muß, wenn man ihn seiner Tätigkeiten und seiner Eigenschaften beraubt. So wird in meiner Darstellung der Deismus und die Aufklärung einen breiten Raum einnehmen, obgleich die meisten Vertreter beider Richtungen ängstlich bemüht waren, sich zum Gotte einer Vernunftreligion zu bekennen. Eine Geschichte des Atheismus wäre unvollständig, wenn sie z. B. Voltaire, den Advokaten eines konfessionslosen Gottes, nicht ausführlich behandeln wollte. Unter den Tätigkeiten und Eigenschaften Gottes gibt es aber eine (Tätigkeit oder Eigenschaft? ich wüßte es nicht zu sagen), die bei dem bloßen Glauben an das Dasein Gottes im Abendland fast immer mitgedacht wird: die göttliche Weltregierung, die sogenannte Vorsehung.
Vorsehung
Zu den Atheisten wurde also auch gerechnet, vom Standpunkt der christlichen Gottesvorstellung mit vollem Recht, wer nur die Weltregierung durch die göttliche Vorsehung anzweifelte oder leugnete. Bei den Alten standen sich in dieser Frage die Epikureer und die Stoiker schroff gegenüber; aber selbst Epikuros leugnete die Götter nicht ausdrücklich, die freilich bei ihm müßig und überflüssig waren, das fünfte Rad am Weltwagen, und das »Schicksal« der Stoiker war doch etwas ganz anderes als etwa die Vorsehung beim heiligen Thomas. Wo die theistischen oder deistischen Theologen in Gott die erste Ursache und den Schöpfer und Regierer der Welt sahen, daneben aber doch das Bestehen der Naturgesetze, der sogenannten zweiten Ursachen anerkannten, da verwickelten sie sich in unlösbare Widersprüche, am meisten die lutherischen Theologen mit ihrem concursus, einer Mitwirkung von Schöpfer und Geschöpf; der fromme Volksglaube, besonders der der Katholiken, kennt solche Widersprüche nicht, weil er, wenn man ihn zu einer Besinnung darüber zwingen wollte, außer der ersten Ursache keine zweiten Ursachen, d. h. keine unabänderlichen Naturgesetze kennen würde. Nach diesem einfachen Glauben wird die Welt unaufhörlich, im größten wie im kleinsten, von dem wandelbaren oder unwandelbaren Willen Gottes regiert, ohne Rücksicht auf die naturgesetzliche Ursächlichkeit, in jedem Augenblicke durch unzählige Wunder; nicht die poetisch so genannten Wunder der Natur sind damit gemeint, sondern richtige Wunder im kirchlichen Sinne, unmittelbare Wirkungen der ersten Ursache. Die göttliche Vorsehung des abendländischen Volksglaubens, übrigens auch die des Judentums und des Islam, ist nicht die unzerreißbare Kausalkette des naturwissenschaftlichen Denkens, sondern eine unendliche unzusammenhängende Reihe von Wundern. Wer also die Vorsehung leugnet, der leugnet wirklich die Wunder und damit den Gott des gemeinen Volksglaubens. Wie eng die beiden Vorstellungen miteinander verwachsen sind, mag man daraus erkennen, daß der Fromme die Vorsehung personifizieren und anstatt Gott »die Vorsehung« sagen kann. In dichterischer Sprache heute noch »die Vorsicht«.
»Vorsicht« ist natürlich die ältere (schon althochdeutsche), »Vorsehung« die jüngere Lehnübersetzung von providentia; das griechische Modellwort πςουοια bedeutete mehr das Vorherbemerken, in der Gemeinsprache dann soviel wie menschliche Klugheit. Auch das Vorhersehen war in einem gewissen Umfange nicht der Gottheit vorbehalten; auch der kenntnisreiche Mensch, freilich besonders der von der Gottheit beratene, konnte mancherlei vorhersehen, vorherwissen, vorhersagen ( propheta). Im Deutschen wie im Lateinischen ist aber, sicherlich nicht unabhängig voneinander, zu unterscheiden zwischen praevidentia und providentia, zwischen Vorsehung und Fürsehung, wie man die beiden Worte noch vor hundert Jahren und auch noch einige Jahrzehnte später auseinanderhielt. Prae und pro, vor und für wurden im Sprachgebrauche oft miteinander verwechselt oder doch vermischt, wahrhaftig ebenso oft wie in der älteren Philosophie vorausgehende Ursachen und Endursachen. Worüber nachzudenken wäre. In den Begriff der Vorsehung wurde so, auch nachdem man nicht mehr »Fürsehung« schrieb, der Begriff der Fürsorge gemischt. Buddeus sagt also ungefähr die Wahrheit, wenn er sich vernehmen läßt: unter denjenigen Lehrsätzen, welche mit dem Atheismus eng verbunden seien, habe wohl den vornehmsten Platz die Verleugnung göttlicher Vorsehung inne. »Denn gleichwie ein Atheiste dieselbe nicht zuläßt, also ist ein solcher, der sie leugnet, nicht viel von einem Atheo unterschieden; wenigstens hebet er allen Grund der Religion und Gottesdienst auf.« Auch ist Buddeus dem Skeptiker Bayle gegenüber vollkommen im Rechte, wenn er die in den Artikeln über Origenes, über die Marcioniten, die Manichäer und die Paulicianer hervorgehobenen Schwierigkeiten so deutet, daß Bayles Absicht mehr die Vorsehung zu bekämpfen als den Manichäismus zu unterstützen war. Und Bayle wiederum ist im Rechte gegen Spinoza, der zwar alle Wunder und damit eine wunderbare Vorsehung Gottes entschiedener bestritt als irgend jemand vor ihm, die providentia also durchaus ablehnte, die praevidentia jedoch an einigen Stellen, die leider nicht gut spinozistisch sind, anzunehmen schien; freilich ist Bayles Artikel »Spinoza«, wie wir in anderem Zusammenhange sehen, ein wunderliches Gemisch von erstaunlicher Überlegenheit und ebenso erstaunlichen Vorurteilen.
Die rechtgläubigen Schriftsteller, die zu einem Atheisten machten, wer auch nur die göttliche Vorsehung leugnete, waren demnach in ihrem guten Rechte; wer die wesentlichen Eigenschaften eines Dinges nicht sieht, der kann das Ding nicht sehen, und die Vorsehung – mit dem was drum und dran hängt – gehört zu den wesentlichen Eigenschaften des abendländischen Gottes. Ich wiederhole auch, daß die rechtgläubigen Schriftsteller auch diejenigen zu Atheisten stempelten, die die Wunder nicht anerkannten; ich werde bald zu zeigen haben, daß der kirchliche und der volkstümliche Begriff der Vorsehung mit dem Wunderglauben stehen und fallen muß.
Was aber die Griechen unter einer Erhaltung der Welt, die sie allerdings auch den Göttern zuschrieben, verstanden, das hat wenig zu tun mit der Vorsehung, die die Haare auf dem Kopfe jedes Menschen gezählt hat. Die ältere griechische Philosophie, die Naturwissenschaft sein wollte, staunte über die Regelmäßigkeit der Himmelskörper und nahm einen menschenähnlichen Verstand an, der die Ordnung der Sterne hergestellt hätte; noch bei Aristoteles, bei welchem bereits eine Art Teleologie eine Rolle spielt, erstreckt sich die Aufsicht des ersten Bewegers – wenn er an so etwas wie eine Aufsicht gedacht hat – nicht auf die sublunare Welt; nur daß schon seit Sokrates die Vorstellung aufgekommen war, die Naturvorgänge hätten eine Beziehung zum Nutzen des Menschen. Die Stoiker bemühten den Begriff providentia allerdings sehr gern; aber auch bei ihnen hat das, was doch nur ihr Fatum (είμαϛμενη) ist, mit der christlichen Vorsehung nichts zu schaffen. Seneca hat eine besondere Abhandlung über die providentia geschrieben; und da sieht man deutlich, daß sich seine providentia, sein Fatum ganz gut mit dem vertrug, was heute die Gottlosen die eherne Kette der Notwendigkeit nennen. » Causa pendet ex causa. Cuncta veniunt, non incidunt.« Wie denn die Religion der Stoiker sich ebensogut in christlichen wie in atheistischen Worten ausdrücken ließe. Seneca sah sehr richtig, daß z. B. die Folge der Jahreszeiten nicht um der Menschen willen da ist; Lactantius aber schon legte in die stoische Philosophie die kleine Menschenvorstellung hinein, der Mensch sei die Zweckursache der Welt.
Diese Vorstellung, noch vergröbert durch den Glauben, der Lokalgott habe das kleine Volk Israel zum Zwecke seiner Schöpfung gemacht, lag der altjüdischen Lehre zugrunde. Irgendein naturwissenschaftliches Denken gab es nicht; der Gott regierte die Welt nach seinem Willen oder nach seiner Laune, wie er sie ebenso erschaffen hatte; Fruchtbarkeit und Mißwachs, Landplagen und Glück, Sieg und Niederlage kamen unmittelbar von Gott, der unaufhörlich zu arbeiten hatte, ein angestrengter Zauberer. Es gab gar keinen ordentlichen Zusammenhang der Dinge, also konnte ein außerordentliches Ereignis gar nicht als ein besonderes Wunder angesprochen werden. Eine Schwierigkeit entstand erst, als die Juden die ethische Forderung stellten, ihr Gott müßte die Gerechten belohnen, die Ungerechten bestrafen; dieser Forderung widersprach der Weltlauf. So regten sich bereits in einigen Büchern des Alten Testaments Zweifel an der Gerechtigkeit und an der Güte Gottes, pessimistische Zweifel an dem, was alle späteren Theodizeen unter der Vorsehung verstanden. Erst die Pharisäer scheinen die Gerechtigkeit der göttlichen Vorsehung durch die Annahme jenseitiger Belohnungen und Strafen haben retten zu wollen.
Unter dem Bilde des Vaters stellte sich Jesus seinen Gott vor, wieder einen unermüdlichen Zauberer, der die Blumen des Feldes kleidet, der beim Tode jedes Sperlings mitwirkt und der demnächst sichtbar werden wird, um sein Reich auf der Erde zu errichten. Dem Vater im Himmel ist kein Ding unmöglich; kein Naturgesetz steht der Erhörung des Gebetes entgegen. Daraus entwickelte sich gleich im apostolischen Zeitalter das Vertrauen auf eine Vorsehung, die mit unausdenkbarer Geschäftigkeit die alltäglichen Schritte jedes Menschen leitet, die bedeutungsvollen Schritte hervorragender Menschen erst recht; Paulus macht seinen Reiseplan von dem Willen Gottes abhängig, wie viel später die Pietisten (Spener) jedes Ereignis ihres kleinen Lebens als eine Leistung der allwirksamen Vorsehung zu betrachten lieben. Nur langsam dringen aus Alexandrien naturphilosophische Begriffe in das altchristliche Weltbild ein und bringen Unsicherheit in den Glauben an das behagliche Zauberwesen. Wer sich durch Anerkennung der Naturgesetze oder des Fatums an der naiven Zaubervorsehung irremachen ließ, der schien jetzt die christliche Glaubenslehre zu leugnen; wohl konnte selbst ein Kirchenvater (Hieronymus) die Konsequenz absurd finden, daß Gott sich um Geburt und Tod jeder Mücke kümmere, aber allgemein sah man nicht so genau hin, und ohne dogmatische Definition schien der Vorsehungsglaube eine selbstverständliche Voraussetzung der Lehre. Und eine optimistische Geschichtsauffassung (Augustinus) verließ sich darauf, Gott könnte und würde alles zu seinen guten Zielen lenken: die Weltgeschichte wurde zum Weltgericht. Mit seiner erstaunlichen Sophistik behandelte der heilige Thomas die Vorsehung als ein Element seines Systems. Die Kirche aber hütete sich, einen theologischen Streit über den schwierigen Begriff anzuregen; sie ließ es, auch in ihrem Katechismus, bei dem gemütlichen Volksglauben bewenden, bis die mechanistische Welterklärung der neuesten Zeit sie zwang, auch den Vorsehungsglauben dogmatisch festzulegen. Das geschah erst in einem Syllabus Pius IX. und dann noch strenger im Vaticanum. Verdammt war erst von jetzt ab, wer nicht glaubte, daß Gottes Vorsehung die Welt regierte und auch die künftigen Regungen des freien Menschenwillens voraus wüßte.
Gegenüber dieser einfachen und klugen Haltung Roms macht das Schwanken des Protestantismus einen kläglichen Eindruck. Luther zwar blieb dabei, den Vorsehungsglauben als eine Herzenssache des Christen zu betrachten und ihn nicht philosophisch zu erklären; so ungefähr dachten auch Zwingli und Calvin. Doch die späteren protestantischen Theologen wollten die Vorsehungsfragen (Willensfreiheit, Theodizee) in einem System unterbringen und gerieten bald auf die Abwege einer neuen Scholastik. Sie waren eben Theologen und wußten darum über Gottes Wissen und Wirken mehr, als unsereiner sich träumen läßt. Wie sie die psychologische Tätigkeit Gottes (Vorwissen, Vorsatz und Ausführung), wie sie seine regierende Tätigkeit einteilten, das ist heillose Begriffsspalterei; es gibt da im Walten der Vorsehung ein Ordinarium und ein Extraordinarium, was recht bedenklich an die oft auf Täuschung berechnete Einteilung des Budgets erinnert. Zum Glücke für den Glauben kümmerte sich das Volk nicht viel um solche Ungehörigkeiten; es blieb bei seinem zudringlichen Gottvertrauen und hielt sich an das Kirchenlied von Neumark »Wer nur den lieben Gott läßt walten«. Die Pietisten besonders machten – wie gesagt – den lieben Gott zu einem Mädchen für alles; als Francke mit der Stiftung seines Waisenhauses Erfolg hatte und dies unter ein speziellstes Extraordinarium der Vorsehung buchte, eigentlich doch ganz christlich, wurde das von den Orthodoxen gerügt, die eben mit Gott nicht auf so vertrautem Fuße standen. Und die Rationalisten, die den Pietisten nicht so entgegengesetzt waren, wie man gewöhnlich glaubt, machten den Vorsehungsglauben, wenn auch nicht den ganz plumpen, zu einem Teil ihrer Naturreligion. Nicht nur der in allen Sätteln gerechte Leibniz, auch der in Freiheit tapfere Lessing erblickten eine Annäherung an Gottes Ziele in der Weltgeschichte; Rousseau fühlte das Schicksal als den Willen einer Vorsehung, und selbst Voltaire ließ diese Vorstellung gelten, bis das Erdbeben von Lissabon ihn stark machte, seinen unheimlichen und unwiderstehlichen » Candide« gegen den optimistischen Glauben an eine sittliche Weltregierung zu schreiben.
Insofern der Protestantismus höhere Bibelkritik und die unmetaphysische Philosophie Erkenntniskritik wurde, hätten beide darauf verzichten müssen, den Vorsehungsbegriff zu behandeln, der der Lebenserfahrung widersprach und in logischer Beziehung noch widerspruchsvoller war. Die Aufgabe war jedoch von der Kirche und daher auch von den Staatsbehörden gestellt, und so versuchten sich Theologen und Philosophen eifrig oder schamlos an ihrer Lösung. Die Schultheologie und die Schulphilosophie hielten es nicht unter ihrer Würde, die alten Haarspaltereien wieder aufzunehmen und mit Schlußfiguren sophistisch beweisen zu wollen, was den frommen Christen von jeher schlichte Andacht und kindliche Sehnsucht gewesen war. Anstatt bescheiden zu beschreiben und zu berichten, als eine seelische Erscheinung, wie der gläubige Christ sich durch die Vorstellung einer allweisen und allgütigen Vorsehung in diesem Jammertal von Elend und Sünde zurechtfand, wie er so seine Sehnsucht innerlich erlebte und das Irdische überwand, wollten diese Sophisten ein Dogma, das für sie gar nicht da war, theoretisch demonstrieren, wollten Naturnotwendigkeit, Willensfreiheit und Vorsehung zusammenmischen und die Theodizee gegen den Augenschein aufrecht halten. Sie wollten nicht zugestehen, daß es für keine Wissenschaft eine Theodizee oder eine Vorsehung geben kann, nicht für die Geschichte und nicht einmal für eine logisch anständige Theologie. Auch die Schulphilosophie sank in diesem Wettbewerb auf eine sehr niedrige Stufe hinab. Was bei uns namhafte Philosophieprofessoren, in Frankreich Boutroux (auch Bergson dürfte noch auf diesen Weg gelangen) über die begriffliche Vereinigung von Naturgesetz und Vorsehung mit scheinbarer Freiheit vorgetragen haben, das würde in seiner ganzen Unwürdigkeit kenntlich werden, wollte man die Gedanken nach Gebühr in das scholastische Latein des Mittelalters zurückübersetzen, woher sie geholt sind.
Da war Schleiermacher, der frivole Offiziosus des »christlichen Glaubens«, beinahe noch moderner, da er die Religion als ein Gefühl definierte, als das Gefühl der »schlechthinigen Abhängigkeit«, und so eine Tür sich offen ließ, um vielleicht unter vier Augen erklären zu können, eine Tatsache wäre durch ihre Abhängigkeit von Gott nicht unabhängig vom Naturzusammenhang, d. h. doch wohl: er fände keinen Unterschied zwischen Gott und Natur.
Wunder
Die frommen Geschichtschreiber des Atheismus haben nun nicht nur die Leugner der Vorsehung, sondern auch die Leugner der Wunder zu Atheisten gemacht, wieder mit einigem Rechte; aber sie haben die Apologie des Wunderglaubens in einem besonderen Kapitel untergebracht und dabei übersehen, daß jede Äußerung der göttlichen Vorsehung ein Wunder ist, daß also ein besonderes Eingreifen der Vorsehung anzunehmen keine Ursache hat, wer vom Dasein der Wunder überzeugt ist; so oft der alte Zauberer einen Finger rührt, von selbst oder auf ein Gebet hin, tut er Wunder.
Gottfried Keller hat einmal (»Grüner Heinrich« III. S. 19) so ein Wunder den »theatralischen Fall« der allgemein angenommenen Hilfe Gottes genannt; wirklich besteht gar kein begrifflicher Unterschied zwischen dem alltäglichen Walten der Vorsehung, die einem frommen Manne oder einem gläubigen Volke das Leben erleichtert, und den außerordentlichen Fällen, in denen Tote erweckt und Lebensmittel in Rosen verwandelt werden. Und wie die Vorsehung, so entspricht auch das Wunder völlig dem verwissenschaftlichen Weltbilde der alten Juden und der ersten Christen; mit den gleichen Mitteln, mit denen der alte Zauberer die Welt aus Nichts hervorgebracht hat, erhält und regiert er sie auch; die Naturkräfte sind Gesetze seiner Willkür, sind Wunderkräfte. Es läuft fast nur auf einen bequemen Sprachgebrauch hinaus, wenn man die alltäglichen Gaben Gottes unter dem Ordinarium, die seltenen und auffallenden Gunstbezeugungen unter dem Extraordinarium des göttlichen Budgets verrechnet.
Wunderbare, d. h. aller Erfahrung entgegengesetzte und darum unglaubliche Erscheinungen finden sich in der verwissenschaftlichen Zeit überall, im Abendlande wie im Morgenlande, bei Geschichtschreibern, Naturbeobachtern und Theologen. Auf dem Gebiete der Religionen naturgemäß besonders häufig, weil doch die Götter nicht einmal an den mangelhaft genug beobachteten Naturlauf gebunden sind. Selbst die Heilswunder, die der inneren Erfahrung angehören, waren den griechischen Mysterien nicht fremd; und der Volksaberglaube der antiken Welt war voll von überaus tollen Wundergeschichten. Die fabelhaften Überraschungen, von denen die christlichen Heiligenlegenden wimmeln, in solchem Übermaß, daß nicht nur Modernisten eine Säuberung des heute noch üblichen Breviers für nötig halten, fallen uns nur darum so auf, weil die Quellen aus den ungebildeten Kreisen des Altertums nur sickern, die Quellen aber aus dem wissenschaftlich ebenso ungebildeten Mittelalter überreichlich fließen. Das Wunder ist auch des Volksglaubens liebstes Kind. Nun war die katholische Kirche wieder einmal ganz folgerichtig und eigentlich tapfer, da sie dem Volke diese Fabeltiere mit Haut und Haar zu verspeisen gestattete. Die geistigen Führer der Kirche waren um eine Begründung um so weniger verlegen, als ihnen damals noch naturgesetzliches Denken fremd war und es ihnen schon darum aus ein Mehr oder Weniger nicht ankommen konnte. Augustinus half sich mit dem vernünftigen Satze, daß ein Wunder nicht gegen die Natur geschehe, sondern nur gegen die uns bekannte Natur; also – wenn man von dem Unterschiede zwischen dem damaligen und dem heutigen Naturwissen absehen will – mit dem scheinbaren Agnostizismus, der in unseren Tagen die Okkultisten, Spiritisten, Theosophen rüstige Anstalten zu einer neuen Religionsgründung treffen läßt. Der heilige Thomas, der große Systematiker, half sich schon mit gelehrterer Schlauheit. Ein Wunder sei, was von Gott außerhalb der uns bekannten Ursachen, außerhalb der Naturgewohnheit geschieht; innerhalb der von Gott bestimmten Naturgesetze seien die Wunder so ungefähr Ausnahmegesetze. Einige scholastische Distinktionen kamen hinzu, und dabei ist die katholische Kirche bis zur Stunde stehengeblieben. Der einzig mögliche Standpunkt, wenn man den Wunderglauben nicht fallen lassen will.
Die Reformation war wieder einmal nicht folgerichtig und verstrickte sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, je mehr sie sich vor der Wissenschaft schämte, mehr und mehr in abenteuerliche Unmöglichkeiten. Da sie die Verehrung der Heiligen aufgab, brauchte sie sich mit der ganzen Masse der Heiligenwunder nicht zu schleppen; auch fügte sie sich in die Zeit, und selbst Luther gab zu, daß neuerdings keine rechten Wunder mehr geschehen; er hatte kein Bewußtsein davon, daß die Greuel von Teufeln und Hexen, an die er glaubte, den Heiligenlegenden an Wunderbarkeit nicht nachstanden. Um so fester hielt sich die Reformation zunächst an die alten Wunder, die durch Gottes Wort verbürgt wurden; und an das umfassende Wunder der Offenbarung selbst. In der Hauptsache war also die Reformation zunächst katholisch geblieben. Als aber die protestantische Scholastik nicht mehr aufrecht zu halten war, als die gebildeten Theologen Kompromisse mit der jeweiligen Naturwissenschaft schlossen, verriet sich die langsame Selbstzersetzung des Protestantismus besonders deutlich in der unehrlichen Behandlung des Wunderglaubens. Was heutzutage darüber von den Halben vorgetragen wird, um weder bei der Kirche noch bei der Wissenschaft anzustoßen, das muß ich doch recht unhöflich eine Affenschande nennen. Dem Worte Wunder wird Gewalt angetan; man redet sehr vornehm und geistig, als handle es sich gar nicht darum, ob Moses (vom neuen Testamente zu schweigen) einen Holzstab in eine lebendige Schlange verwandelt habe oder nicht, als handle es sich einzig und allein um eine innere Wundererfahrung. Der psychologische Vorgang des Glaubens oder des Gebets sei das wahre Wunder. Der Wunderbegriff wird in eine poetische Metapher aufgelöst. Aber das dicke Ende kommt nach. An die Wunder der Metamorphosen von Ovidius brauche ein gebildeter Mensch selbstverständlich nicht zu glauben; wohl aber habe er zu glauben oder glaube er – das Sollen wird verschleiert – an die Wunder, die Gottes Wort an die Stiftung der Religion knüpft, welche heute noch die herrschende ist. Kurz (was die Herren freilich nicht so eindeutig sagen): unser Glaube allein ist kein Aberglaube und alles Wirkliche ist vernünftig. Eine Kritik an der Wahrheit der biblischen Wundergeschichten wird nicht geradezu abgelehnt; aber die Kritik wird dadurch unwirksam gemacht, daß die Herren sagen: wer das Dasein der Wunder leugnet und Gründe für sein Leugnen beibringt, der ist an die Frage bereits mit einem Vorurteil herangetreten. Daß diese Wunder sich in der Vorzeit ereigneten und jetzt sich nicht mehr wiederholen, das spreche erst recht für die Wahrheit der Wunder. Die Herren kennen Gottes Absicht wieder genau: er habe einer wundersüchtigen Zeit mit Wundern kommen müssen, um sie zur wahren Gotteserkenntnis zu erziehen; Gott habe sich eben (diese Leute bemerken die Blasphemie gar nicht!) dem geschichtlich gewordenen Zustande der damaligen Menschheit angepaßt – wie ein heutiger Theologieprofessor der Wirklichkeit, die immer vernünftig ist. (Diese Anpassung der göttlichen Vorsehung an die Kulturstufen der Menschheit wird gern durch eine Berufung auf Lessing unterstützt; man vergißt dabei, daß Lessing in seiner »Erziehung des Menschengeschlechts« das Lehrbuch des Alten und das des Neuen Bundes nur in Kauf nahm, um das dritte Reich verkünden zu können.) Nun hätte ja die erzieherische Anpassung Gottes an das Jugendalter der Menschheit auch darin bestehen können, daß die Zeugen der biblischen Wunder sich das alles nur einbildeten; die psychologische Überredungskraft der geglaubten Tatsachen hätte darum nicht geringer zu sein brauchen; dann hätte man aber auch das Wunder der Offenbarung unter die Einbildungen oder Selbsttäuschungen rechnen müssen, dazu einige Wunder der Christologie, und das alles wollten die Halben doch festhalten. Sie lehrten also fröhlich weiter: die Naturgesetze gelten gegenwärtig, haben aber nicht immer gegolten. Und noch schlimmer, bald unehrlicher, bald törichter, sind die Sophismen, mit denen die Halben solche alte Wunder gegenüber der modernen Anschauung von der Unverbrüchlichkeit der Naturgesetze erklären wollen; es ist zum Schreien, wenn sie mit Psychologie und Erkenntnistheorie vorgehen und sich dann plötzlich wie auf der Kanzel eines Bibelverses als eines Beweises bedienen. Die Naturgesetze seien, was zu leugnen ich der letzte wäre, nur menschliche Formeln; der Mensch benütze diese Gesetze für seine Zwecke. Nun aber wird der Kopfsprung gemacht und behauptet: noch freier als der Mensch stehe Gott den Naturgesetzen gegenüber; er sei der Gesetzgeber, könne seine Gesetze wieder aufheben, könne aber vor allem die Gesetze, die er besser verstehe als irgendein Mensch, zu neuen und überraschenden Erscheinungen verwenden. Und zuletzt wird das Wort Gottes zu einem Zauberspruch, der je nach Umständen körperliche oder seelische Verwandlungen hervorruft.
Auch bezüglich der Wunder haben sich einzelne Philosophen der Zeit angepaßt, wie Gott den Kulturstufen der Menschheit. Lotze ist in dieser Nachgiebigkeit nicht am weitesten gegangen, soll aber hier als warnendes Beispiel stehen, gerade weil man ihm die Bemühung anmerkt, mit der Kirche einen Frieden zu schließen, ohne sich zu unterwerfen. Sein »Mikrokosmus« steht in hohem Ansehen und ist doch nur ein hübsches Lesebuch für hochgebildete Beschränktheit. Er hat sich da (II5 S. 44ff.) mit dem Begriffe des Wunders in der Weise auseinandergesetzt, daß er ihn der angenommenen Einheit der Natur entgegenstellt, ihn also eigentlich rund ablehnen müßte. Er sagt auch ausdrücklich, man würde die Kompensation der Störungen im Naturlauf gleich sehr mißverstehen, »sowohl wenn man sie nur für eine in dem Fortarbeiten jedes Mechanismus sich von selbst verstehende Erhaltung der Ordnung ansähe, als wenn man in ihr eine von oben her eingreifende, dem Mechanismus gänzlich fremde Wiederherstellung dieser Ordnung vermutete.« Lotze nimmt also, was für das geschlossene System eines Organismus sicherlich angeht, aber für die gesamte Natur sehr bedenklich ist, eine Naturheilkraft an, die von selber bessernd eingreift; er konstruiert sich das Vorkommen von Wundern, die mehr sein sollen als bloß ungewöhnliche Erscheinungen, doch auch weniger als eine völlige Durchbrechung der Naturgesetze. »Die wunderbar wirkende Macht, welche sie auch sein mag, richtet sich nicht unmittelbar gegen das Gesetz, um seine Gültigkeit aufzuheben, sondern indem sie die inneren Zustände der Dinge durch die Kraft ihres inneren Zusammenhanges mit ihnen (?) ändert, verändert sie mittelbar den gewohnten Erfolg des Gesetzes, dessen Gültigkeit sie bestehen läßt und fortdauernd benutzt.« Die Macht, »welche sie auch sein mag«, wirkt also mittelbar auf die innere Natur, die durch den »Sinn der Welt« bestimmbar ist. Ob dieser Konstruktion eine Wirklichkeit entspreche und welcher Kraft die »Berechtigung« zum Wundermachen zuzuschreiben sei, will Lotze nicht entscheiden. So ungefähr sagt das der Pfarrer auch, nur mit schlichteren Worten.
Die Aufklärung hat den Wundern von jeher ihre Anerkennung versagt; häufig nur in der Weise, daß sie die Berichte allegorisch oder sonst umzudeuten suchte. Selbstverständlich stellte sich Leibniz auf Seite des Wunderglaubens, und das zu einer Zeit, als Spinoza den Wunderbegriff schon kritisch vernichtet hatte. Nur den Begriff, mit Hilfe seiner begrifflichen Abstraktion. Gott und Natur seien dasselbe; Ereignisse gegen die Natur seien also Ereignisse gegen Gott; das Wunder sei also unmöglich. Diese Beweisführung genügte den Freidenkern, war aber zu metaphysisch und zu theologisch, um in einer Zeit vorhalten zu können, die der Metaphysik und der Theologie nicht mehr vertraute. Die Axt an die Wurzel des Wunderglaubens schien erst der starke Hume zu legen, da er an die Wunderberichte den gleichen Maßstab anlegte, wie an andere geschichtliche Nachrichten. Die Wunder seien so unwahrscheinlich, daß die Zeugnisse für ihre Wahrheit stärker sein müßten als die Zeugnisse von wahrscheinlicheren Begebenheiten.
Über diese Wahrscheinlichkeitsrechnung Humes hinausgehen kann nur eine sprachkritische Beleuchtung der aufdringlichen Begriffe »Wunder« und »Vorsehung«.