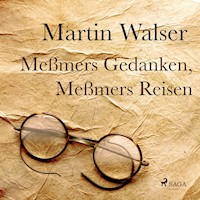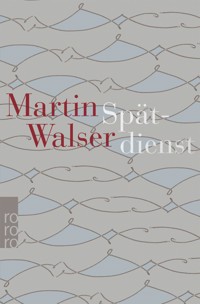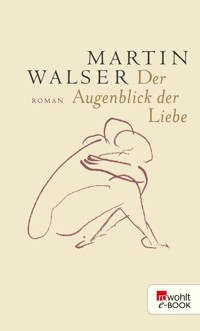
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
«Walsers schönster Roman.» (Martin Lüdke, SWR) Gottlieb Zürn, Exmakler und Privatgelehrter mit Domizil am Bodensee, erhält Besuch von einer Doktorandin. Sie interessiert sich für seine Aufsätze über den französischen Philosophen La Mettrie und überreicht ihm, er ist erstaunt und merkwürdig geschmeichelt, eine Sonnenblume. Sie könnte seine Enkelin sein. Und doch vernimmt er sofort das Klirren erotischer Möglichkeiten. Sie hingegen weiß: "Es gibt nichts, wofür man nicht gestraft werden kann." Trotzdem, und weil er mit seiner Frau Anna längst im gleichen Wortschatz untergeht, folgt er der Doktorandin kurz darauf nach Kalifornien zu einem Kongreß. Dort erfüllt sich ihre Prophezeiung – auf eine Weise, die gleich in mehrfacher Hinsicht zum Eklat führt. Eros, Ehe und Erlebnishunger sind die äußeren Markierungspunkte dieses Romans, das Verhältnis von Leben, Literatur und Todeslust ist sein geheimes Motiv. «Ein Buch, das mit literarischer Brillanz und insistierender Intelligenz der Wahrheit unserer Empfindungen nachgeht.» (Ulrich Greiner, Die Zeit) «Martin Walser hat einige beste Bücher geschrieben. Sein jüngstes Werk gehört dazu. […] ist ein schönes Buch - komisch, traurig, rabiat.» (Andrea Köhler, Neue Zürcher Zeitung) «Hochkomisch, sprachmächtig: Martin Walsers neuer Roman über Liebe im Alter ist ein Vergnügen. Wenn Walser je komisch war, wenn er je die Funken des Witzes aus Konstellationen des Unangemessenen, Unpassenden geschlagen hat, hier tut er's stärker.» (Tilman Krause, Literarische Welt) «Seite für Seite eröffnet Martin Walser uns ein Stilvergnügen, wie es nur wenige deutsche Autoren bieten können. Walser schreibt eben nicht nur die schönsten Sätze, er setzt sie auch in anregende Horizonte.» (Andreas Isenschmid, NZZ am Sonntag) Weitere Veröffentlichungen: Die Verwaltung des Nichts Angstblüte Leben und Schreiben 1. Tagebücher 1951 – 1962 Leben und Schreiben 2. Tagebücher 1963 – 1973 Ein liebender Mann Tod eines Kritikers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Ähnliche
Martin Walser
Der Augenblick der Liebe
Roman
Über dieses Buch
Gottlieb Zürn, Exmakler und Privatgelehrter mit Domizil am Bodensee, erhält Besuch von einer Doktorandin. Sie interessiert sich für seine Aufsätze über den französischen Philosophen La Mettrie und überreicht ihm, er ist erstaunt und merkwürdig geschmeichelt, eine Sonnenblume. Sie könnte seine Enkelin sein. Und doch vernimmt er sofort das Klirren erotischer Möglichkeiten. Sie hingegen weiß: "Es gibt nichts, wofür man nicht gestraft werden kann." Trotzdem, und weil er mit seiner Frau Anna längst im gleichen Wortschatz untergeht, folgt er der Doktorandin kurz darauf nach Kalifornien zu einem Kongreß. Dort erfüllt sich ihre Prophezeiung – auf eine Weise, die gleich in mehrfacher Hinsicht zum Eklat führt.
Eros, Ehe und Erlebnishunger sind die äußeren Markierungspunkte dieses Romans, das Verhältnis von Leben, Literatur und Todeslust ist sein geheimes Motiv.
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Weitere Veröffentlichungen:
Die Verwaltung des Nichts
Angstblüte
Leben und Schreiben 1. Tagebücher 1951 – 1962
Leben und Schreiben 2. Tagebücher 1963 – 1973
Ein liebender Mann
Tod eines Kritikers
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Alissa Walser
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00041-4
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
I.Kommen aber gehen
1.
Herr Zürn oder Herr Krall, wie hätten Sie’s gern? So fing sie an, so eröffnete sie.
Gottlieb sagte: In welche Sauce wir den Daumen, den wir lutschen müssen, vorher tunken, ist egal. Oder nicht? Und sie: Es gibt nichts, wofür man nicht gestraft werden kann. Und er: Aber die Möglichkeiten klirren. Und sie: Wenn Sie so wollen. Und er: Ich will. Gottlieb hatte das Gefühl, er sei begeistert. Wenn das Leben auf sich aufmerksam machte, fühlte er sich als Dichter, sogar als Komponist. Er war weder das eine noch das andere. Er war mit der Besucherin in ein Duett geraten. Sie hätten ihre Sätze gleichzeitig sagen können, das hätte die Wirkung nicht gemindert.
Anna blieb nichts anderes übrig, als zwischen der Besucherin und Gottlieb hin und her zu schauen wie beim Tennis. Also schaute sie, nach Gottliebs Ich will, die Besucherin an, weil die jetzt dran war. Aber die wollte oder konnte offenbar nicht weitermachen im Duett.
Dann starrten alle drei auf die Sonnenblume, die die Besucherin mitgebracht hatte, für die Gottlieb keine Vase gefunden hatte, die er dann in den größten Glaskrug gestellt und mitten auf dem Terrassentisch platziert hatte. Noch nie hatte jemand eine Sonnenblume mitgebracht. Anna hatte die gewaltige Blume entgegengenommen und hatte gesagt: Unglaublich. Und das stimmte ganz genau. So eine Prachtblume zu überreichen, die sofort die Szene beherrscht, und nichts dazu zu sagen, das war unglaublich. Das war eigentlich die Eröffnung des Duetts gewesen.
Anna schaute die Besucherin an, als müsse die ihr noch erklären, wie es überhaupt zu dieser Frage, ob Zürn oder Krall, komme. Gottlieb wußte, daß Anna, hätte sie sich äußern können, jetzt gleich noch einmal ihr Lieblingswort, ihr Passepartoutwort, gesagt hätte: Unglaublich. Das brauchte sie so oft, daß es auf Gottlieb überging. Und wenn es ihm unwillkürlich unterkam, merkte er, daß er wieder Annas Wort benutzte. Sollten Ehepaare einander im Lauf der Zeit ähnlicher werden – was er bei sich und Anna bestritt –, dann dürfen sie auch im selben Wortschatz untergehen. Hätte die Besucherin ihre Eröffnungsfrage eine Stunde später gestellt, nachdem Anna ihren Kaffee und die drei oder vier Gläschen Calvados schon getrunken gehabt hätte, dann hätte Anna höchstens noch ein wenig den Kopf geschüttelt, so langsam, daß es aussähe, als suche sie für ihren Kopf eine Lage, in der er bleiben könne. Jetzt aber, bei der ersten Tasse Kaffee und beim ersten Calvados, reagierte sie doch so neugierig, als sollte Gottlieb ihr in Gegenwart der Besucherin etwas erklären, was er ihr verschwiegen habe. Ach nein, doch nicht verschwiegen, einfach nicht gesagt hatte er ihr, daß vor Wochen ein Brief aus North Carolina eingetroffen war, geschrieben von einer Beate Gutbrod, die fragte, ob sie kommen dürfe, es handle sich um La Mettrie.
La Mettrie, das war einmal ein Thema gewesen. Eines der vielen Themen, mit denen Gottlieb sich die Zeit vertrieb, die er hatte, seit Anna das Geld verdiente. Er besorgte den Haushalt und das Schriftliche, Anna den Handel, den Immobilienhandel. Als er dieser Beate Gutbrod geschrieben hatte, sie könne, wenn sie nichts Besonderes von ihm erwarte, gern zu einem Kaffee auf der Terrasse kommen, hatte er es nicht für nötig gehalten, Anna zu sagen, da komme eine von einer Uni aus North Carolina, die in Langenargen eine Großtante besuche und ihn bei dieser Gelegenheit auch besuchen wolle, da sie eine Doktorarbeit darüber schreibe, wie La Mettrie in Deutschland aufgenommen worden sei. Wann aufgenommen, warum so spät und wie dann. Im Internet hatte diese Beate Gutbrod offenbar entdeckt, daß Gottlieb vor fünfzehn Jahren in einem Anfall von Begeisterung zwei Aufsätze über La Mettrie geschrieben hatte.
Hier heiße ich Zürn, sagte Gottlieb jetzt. Er tat, als bemerke er Annas kritische Neugier nicht. Die Besucherin sollte den Eindruck haben, seine Frau sei informiert darüber, daß er unter dem Namen Wendelin Krall über La Mettrie veröffentlicht hatte. Gewußt hatte sie es einmal. Vor fünfzehn oder sechzehn Jahren. Verwitterte Inschriften im Ehegestein. Vielleicht wußte Anna wirklich nicht mehr, daß ihr Mann jedes seiner wenigen Themen unter einem anderen Namen bearbeitet hatte. Und für La Mettrie war eben Wendelin Krall zuständig gewesen. Den Satz, daß er hier Zürn heiße, begleitete Gottlieb mit Gesten, die der Besucherin sagen mußten, hier am Tisch, hier beim Tee heiße ich Zürn. Warum sollte er dieser Besucherin die Innenansichten seiner Ehe präsentieren. Auch wenn Gottlieb nur sogenannte Tatsachen mitteilen würde, wüßte so eine Besucherin nichts über diese Ehe, sondern nur das, was er ihr über diese Ehe mitteilen wollte. Was verstünde denn eine Besucherin, wenn er jetzt Annas deutliches Informationsdefizit mit den Sprech- und Sprachgepflogenheiten dieser Ehe erklärte! Daß sie, wenn nicht gerade Kinder da sind, nach einander frühstücken, ist der Ausdruck einer Übereinstimmung, die eine Besucherin nicht begreifen kann. Überhaupt vollzieht sich das Gespräch zwischen ihm und Anna auf einer für eine Besucherin vor Höhe unhörbaren Frequenz. Die höchsten Töne sind die feinsten. Nur daß Sie’s wissen. Je weniger sie mit einander sprechen, desto besser verstehen sie einander. Das erklär mal einer Besucherin. Je länger sie nicht mit einander sprechen, desto näher kommen sie einander. Also wegen einer Besucherin, die zum Kaffee kommt, weil sich das mit dem Besuch der Großtante namens Mimi verbinden läßt, wegen einer solchen exemplarischen Unwichtigkeit das sich geradezu samtig anfühlende Einvernehmen des Schweigens dem Mißverständnis einer Touristin auszuliefern – nein, danke.
Andererseits hatte die so eröffnet, daß er hoch eingestiegen war. Das war ein Duett. Diesem Duett nachhörend saßen sie dann. Zu wissen, woran jetzt jeder an diesem Tisch denkt, brächte einen weiter. In der Menschenkenntnis. Die es nicht gibt. Weil keiner in den anderen hineinsieht. Wenn er der Besucherin sein und Annas einvernehmliches Nichtssagen erklären könnte, wüßte sie immer noch nicht, wie wichtig Anna für ihn wird, wenn sie dann einmal drauflosquatscht. Er sitzt, sie räumt auf, er kann nur sitzen, starren, sie aber redet, und das tut sie für ihn. Zustimmend schweigen, das kann er noch. Sie plappert bewußt, macht deutlich, daß sie jetzt nur plappert, damit demonstriert sie, man könne doch immer noch plappern, Quatsch reden. Es kann sein, sie versackt dann jäh. Dann wird es ziemlich still. Dann fängt er an. Er schafft nicht halb soviel Stimmung oder wenigstens Akustik wie sie. Und gibt auch gleich auf. Dann ist die Stille, die folgt, ein Ausdruck vollkommener Harmonie. Näher kann man einander nicht sein als in dieser wunderbaren Wüste gemeinsam erworbenen Schweigens.
Es war die Besucherin, die verfügte, daß er jetzt und wie er jetzt über Anna nachdachte. Wäre doch Anna ein wenig weniger lieb. Er merkte, daß er, wenn er, was vom Liebsein handelte, hochkommen ließ, schnell bei einem Generalverdacht landen würde. Wollte er etwas gegen Anna empfinden, intonierte er diesen Generalverdacht: Anna will nichts von dir, sie will nur, daß du etwas von ihr willst. Wurde aber in vorstellbarer Nähe ein Kind ermordet, durfte Geschlechtliches eine Schonzeit lang überhaupt nicht mehr vorkommen. Das war seine auf Klage oder Anklage getrimmte Vorwurfsroutine, gegen die Anna sich nicht verteidigen konnte, weil er ihr diese öfter in ihm ablaufende Vorwurfsplatte niemals vorgespielt hatte und wahrscheinlich niemals vorspielen würde. Die Platte lief. Und es war die Besucherin, die die Platte zum Laufen gebracht hatte.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß Anna es neben einem aushielte, ohne einen zu berühren. Und wenn sie’s dann tut, dann vielleicht nur, weil sie glaubt, der andere wolle es. Sie will einem etwas zuliebe tun. Sie will einem alles zuliebe tun. Sie ist unerschöpflich unermüdlich im Einemetwaszuliebetun. Manchmal zöge man es vor, sie dächte mehr an sich. Fuhr er achtlos in eine Parklücke hinein, sagte, sobald er ausgestiegen war, Anna: Wenn du deutlicher links einparkst, hat noch einer Platz. Sie war andauernd humaner als er. Sie fühlte sich ihm wahrscheinlich überlegen. Das kann in ihr die Stimmung erzeugt haben, er müsse ihr für das lebenslängliche Bei-ihm-Bleiben dankbar sein. Es tat sicher gut zu wissen, daß er ihr immer ein bißchen oder mehr als ein bißchen schuldig blieb und für das, was er ihr schuldig blieb, dankbar zu sein hatte.
Gottlieb hatte serviert: Kaffee und Calvados für Anna, für die Besucherin und für ihn Tee. Und Apfelkuchen für alle. Daß er den Apfelkuchen heute vormittag selber gebacken hatte, sagte er mit dem gespielten Stolz, mit dem Männer auf ihre Küchenverdienste hinzuweisen haben. Und da sie ja aus dem Apple-Pie-Country kam, also vielleicht nicht wußte, was sie auf dem Teller hatte, sagte er, ganz ohne Nachdruck, noch dazu, daß es sich um eine Tarte Tatin handle, er serviere die aber heute, ohne sie gestürzt zu haben. Und warum heute nicht gestürzt, fragte sie. Genau so mußte sie reagieren, fand er, spürte er. Er wies auf die wellige, ganz glatte, kahle, hellfahle Oberfläche in der weißen Form, sagte aber nichts. Sie sagte: Wie eine freundliche Mondlandschaft. Ja, sagte er und nickte bedeutungsvoll, gestürzt, sähen wir jetzt die nassen Apfelinnereien. Und fing an auszuteilen.
Daß Anna deine Decknamen nicht mehr weiß, muß dich nicht beleidigen. Die Namen, unter denen du versucht hast, auf dich aufmerksam zu machen, hast du Anna gegenüber nie wichtig werden lassen. Wenn du als Andreas Schwarzkopf ein bekannter Feuerbach-Experte oder als Jost Jordan ein anerkannter Rousseau-Kenner oder eben als Wendelin Krall ein renommierter La Mettrie-Forscher geworden wärst, hättest du dich Anna nur zu gern als Schwarzkopf-Jordan-Krall präsentiert. Da aber keinerlei Aufsehen geschah, konntest du froh sein, daß auch Anna gnädig vergaß, was du unter deinen Decknamen getrieben hast.
Als er mit der zweiten Kanne Tee zurückkam, sagte die Besucherin, wie Frau Zürn ihren Calvados trinke, sei ansteckend, also widerrufe sie ihre vorschnelle Ablehnung allen Alkohols, sie sei jetzt, falls das Angebot noch gelte, ganz scharf auf Calvados. Dafür sei sie da, sagte Anna und holte eine nächste Flasche. Und Sie, Herr Doktor, sagte die Besucherin. Zürn reicht, sagte Gottlieb. Mein Mann trinkt nicht mehr, sagte Anna. Gottlieb nickte so, als wolle er ein Schicksal andeuten, über das man ihn besser nicht befrage. Man muß ja in jedem Augenblick etwas zu vermuten geben, was einen interessanter wirken läßt, als man sich fühlt. In ihm klang nach, daß die Besucherin gesagt hatte, jetzt sei sie ganz scharf. Wie sie das gesagt hatte. Sie hatte ohnehin einen blühenden Mund. Auch durch genaues Schminken eigentlich nicht fassbar, dieser Mund. Unflätig eigentlich, dieser Mund. Ein Kinder- oder gar Babymund. Gerade von der Mutterbrust kommend. Und scharf hatte sie mit mehreren f gesprochen. Und Anna, ohne jeden Ausdruck: Mein Mann trinkt nicht mehr. Weder spöttisch noch bedauernd. Ihr war es gelungen, sachlich zu bleiben. Bewundernswert. Die Besucherin hob das Gläschen zu Gottlieb hin, Anna imitierte dieses Glasheben, beide tranken, Gottlieb sagte: Zum Wohl. Ja, sagte die Besucherin, wo soll ich anfangen! Das Philosophie-Department an der University of North Carolina in Chapel Hill erfreue sich eines guten Rufs. Untergebracht in einem der sechzehn Campusse. Caldwell Hall heiße ihr Quartier. Da werde umgebaut seit Monaten, und seit Monaten hänge eine rötliche Kunststoffröhre aus dem Haus heraus und die Röhre habe oben einen eigenartigen, aber doch ziemlich eindeutig gewölbten Abschluß, dem zuliebe man eigentlich wünscht, das Haus vis à vis mit der entsprechenden weiblichen Ausrüstung zu bestücken. Sie möchte, sobald sie ihre Doktorarbeit beendet hat, schreiben, frei schreiben, sich freischreiben. Zwei Kommilitoninnen wollen sich aus ihren jungen Ehen schon wieder lösen, aber nur, um sich wieder auf Bindungen einzulassen, die genau zu den Verhältnissen führen, aus denen sie sich gerade befreien wollen. Vor dergleichen will sie sich schreibend bewahren. An ihrem Leinenkleid – rostrot mit gelblichen Blumen – hatte sie die drei oberen Knöpfe offen gelassen. Man sah ihren Körper beginnen.
Anna stand auf. Sie habe noch eine Protokollierung, in Pfullendorf. Und gab der Besucherin die Hand. Falls Sie, wenn ich zurückkomme, nicht mehr da sind, sagte sie, und zu Gottlieb, lächelnd: Du wirst ja, denke ich, noch da sein. Die Besucherin produzierte, Anna nachschauend, im sarkastischen Echoton: Pfullendorf! Dann drehte sie sich entschlossen in Richtung See und sagte Wow, als bemerke sie erst jetzt, daß da zwischen etlichen Stämmen der See heraufgleißte. Und so nah, sagte sie. Bei der Großtante in Langenargen sehe man ihn nur vom oberen Stockwerk aus, zwischen Häusern durch. Und auch noch ein Boot, sagte sie.
NIOBE, sagte Gottlieb. Jetzt sag bloß nicht: Kommen Sie, besuchen wir NIOBE.
Sie sagte, damit könne sie im Augenblick nichts anfangen. Hoffentlich nie, sagte Gottlieb. Und weil sie fragend schaute und dabei ihr Mund förmlich schwoll, sagte er noch: Die ist versteinert, später. Vor Schmerz. Ach, sagte sie. Und das ch beatmete sie so lange, wie sie vorher bei scharf das f beatmet hatte. Ihr Mund blieb nach diesem Achchch halb offen hängen. Dann sah sie aber die zwei Schwäne, also rief sie: Und auch noch Schwäne! Was sollte er darauf sagen? Die Schwäne glitten durchs Bild, als seien sie dazu bestellt.
Erst als sie verschwunden waren, schaltete die Besucherin um. Diesmal zu La Mettrie. Wenn nicht dessen 250. Todestag bevorstünde und wenn nicht doch ein kleiner Erinnerungseifer sich auch in Deutschland bemerkbar machte, säße sie jetzt wohl nicht hier. Und hätte sie nicht diese Großtante in Langenargen, hätte vielleicht auch der 250. Todestag des Verehrungswürdigen nicht gereicht, sie hierherzubringen. Was sie, das sage sie jetzt schon, zu bedauern hätte. Es gebe doch wirklich nicht mehr als eine Hand voll Menschen in jedem Land, mit denen zusammen man La Mettrie feiern könne. Arzt und Philosoph, und beides so heftig, daß daraus notwendigerweise ein Drittes hervorgehen mußte, nämlich ein Mensch, der mit seinen Sinnen soviel erfuhr, daß er auch als Denkender niemals von seinen Erfahrungen verlassen wurde. Einverstanden? Gottlieb hob die Hände, ließ sie fallen, nickte, das hieß, bitte, machen Sie weiter, ich höre Ihnen gern zu.
Ihr Thema sei La Mettries aufhaltsames Bekanntwerden in Deutschland. Mit dem Satz, die Bewegung, die die Welt erhält, hat sie auch erschaffen können, habe La Mettrie sie kassiert, sagte sie. Sie soll, sie will in einer Doktorarbeit nachweisen, warum die sonst so geistesimportfreudigen Deutschen für La Mettrie nicht viel übrig hatten und haben. Glen O. Rosenne, ihr Professor, und der Gründer der amerikanischen La Mettrie-Gesellschaft, hat Vermutungen, die sie bestätigen soll. Tatsächlich werde La Mettrie in der deutschen Universitätsphilosophie am liebsten unter plattem Materialismus geführt, als oberflächlich, einseitig, Erfinder einer nur dem Genuß verschriebenen Unethik! Schon wie sein wichtigster Titel übersetzt wird: Der Mensch eine Maschine, oder neuestens: Der Mensch als Maschine. Für L’Homme Machine! Leicht zu übersetzen sei das nicht. Aber dann soll man’s doch lieber lassen. Es war Rosenne, der sie auf Wendelin Krall brachte, auf seine zwei Aufsätze. Als sie Vor Rousseau war La Mettrie gelesen hat, hat sie gewußt, daß sie diesen Wendelin Krall einmal sehen möchte. Und dann Alles eins. Da sind dem Wunsch Flügel gewachsen. Der Akzente-Redaktion hat sie abgerungen, wer dieser im Internet gefundene Wendelin Krall wirklich ist. Immerhin ist es fünfzehn Jahre her, seit die zwei Aufsätze erschienen sind. Beide im selben Jahr, und dann nichts mehr. Warum dann nichts mehr? Das fragt auch Glen O. Rosenne. Hat Wendelin Krall weiter geforscht über La Mettrie und in Deutschland niemanden mehr gefunden, der sich dafür interessierte? Ihre Arbeit wird wahrscheinlich drei Stadien beschreiben: erstens Hegel, zweitens Marx und der Materialismusstreit auf der Göttinger Naturforscherversammlung, 1854, Lichtblick Karl Vogt mit seinem Buch Köhlerglaube und Wissenschaft, dann die Verfinsterung durch den Neukantianismus. Drittens: die sogenannte Gegenwart, zu der dann auch Wendelin Krall zählt.
Er hätte der Besucherin gern gesagt, wie großartig er es finde, daß seine Frau einfach aufgestanden und gegangen sei. Eine Protokollierung. In Pfullendorf. Ihren Mann kann sie ruhig bei einer zirka vierzig Jahre jüngeren Besucherin aus North Carolina sitzen lassen. Schon an solche Zahlen zu denken, ist … ist … ist beleidigend.
Die aus dem zweiten Stock von Caldwell Hall hängende rötliche Kunststoffröhre mit der deutlichen Schlußwölbung hat Anna gar nicht mitgekriegt. Er hatte Anna im Blickfeld. Annas große Augen verrieten fast nie, was hinter diesen Augen vorging. Diese Augen sind zu groß, vielleicht auch zu tief. Annas Augen sind wie ein Meer, das zu groß ist für Stürme. Auf jeden Fall sind sie nicht zu bewegen durch grelle Nachrichten über eine Caldwell Hall in North Carolina. Wahrscheinlich entwarf Anna, während die Besucherin sprach, den Vorvertrag für eine Villa mit Seeblick in Nonnenhorn. Die Besucherin wollte mit ihrer Caldwell Hall-Anzüglichkeit wahrscheinlich nur Freimut beweisen. Zur Lockerung des beginnenden Gesprächs. Gottlieb konnte sich nicht hindern zu denken: Sie hat einen unanständigen Mund. Das wird man ja wohl noch denken dürfen. Er hörte ihr zu, sagte auch mal etwas Zustimmendes, dachte aber immer wieder an Gabriele, die vor ein paar Tagen angerufen hatte, und wie immer hatte sie gesagt: Moment, ich muß das Fenster schließen, du sprichst so leise. Dann hatten sie weitertelephoniert. Mehr als einmal im Jahr telephonierten sie inzwischen nicht mehr. Und jedes Mal war es Gabriele, die anrief. Und jedes Mal hatte sie einen sogenannten Grund. Diesmal war es ihr Entschluß gewesen, nicht mehr Gabriele zu heißen, sondern Gabriela. Sie könne, hatte sie gesagt, nicht mehr begreifen, daß sie es so lange ausgehalten habe, als Gabriele herumzulaufen. Und übermorgen sei, bitte, ihr und sein La Mettrie-Gedenktag.
Inzwischen sind es fünfzehn Jahre her, daß sie Gottliebs Aufsatz Vor Rousseau war La Mettrie gelesen hatte. Und nichts, was sie je gelesen hat, sagte sie jedes Mal, habe ihr Leben so verändert wie dieser Aufsatz. Weniger wegen Gottlieb als wegen La Mettrie. Sechzehnmal hatte sie ihn damals in acht Tagen angerufen. Die Theologiestudentin in Tübingen. Dann folgte Alles eins. Diesen Aufsatz hätte er vielleicht gar nicht geschrieben ohne das Zustimmungsvibrato der Theologiestudentin.
Nur durch die Natur begreifen wir den Sinn der Wörter des Evangeliums, dessen wahrer Interpret ganz allein die Erfahrung ist.
Das war der La Mettrie-Satz, der zu ihrem Tag- und Nachtgebet wurde, wenn sie neben einander oder auf einander lagen, er zwanzig Jahre älter, gerade noch in Frage kommend, vielleicht schon nicht mehr, aber vielleicht doch noch, weil sie diesen Leben spendenden Textstrom hatten. Daß man den Sinn des Evangeliumstextes nur durch die Natur entdecken kann, hatte die Tübinger Theologie noch nicht gemerkt.
Die Theologie wurde ihr fremd. Also zur Kirchenmusik. Das war dem Vater, Pastor auf der Ostalb, gerade noch recht. Aber nirgends ist die Konkurrenz so brutal wie in der Musik. Ihr Professor in Stuttgart mußte eine Psychotherapie durchlaufen, so verletzte es ihn, wenn er fabelhaft und fehlerfrei spielende Bewerber ablehnen mußte, weil kein Platz mehr frei war. Aber Gabriele schaffte alles. Nur die Praxis nicht. Erstens fand sie’s schon mal unmöglich, mit einer Begabung Geld zu verdienen. Da wirkte die Theologin nach. Dann der jeden Orgelton überflutende Nachhall in den Kirchen, den sie auch durch sorgsamste Belegung der Bänke mit Polstern von zwölf Sekunden nicht weiter als auf sieben schwächen konnte. Schließlich konnte sie Sterben mein Gewinn und dergleichen einfach nicht mehr spielen, ohne zu grinsen. Also in die Politik. Jetzt Landtagsabgeordnete. Verheiratet. Geschieden. Ganz bei den Grünen.
Anna hatte sich, als diese Erschütterung verebbt war, die Haare, die bis auf die Schultern reichenden, so abschneiden lassen, daß die Ohren ins Freie standen, hatte gesagt, das sei jetzt der Abschied gewesen von allen möglichen Einbildungen. Und hatte den Umsatz verfünffacht. Und hatte angefangen, jeden Abschluß zur theatralischen Zeremonie zu machen. Sie wurde bekannt für ihre Kostümansprüche. Viel weniger als ein Hochzeitsniveau durfte es, wenn’s zum Notar ging, nicht sein. Sie selber trug nur noch Anzüge. Dunkle. Am liebsten Nadelstreifen. Und die Feierlichkeit jeder Prozedur wurde mit Calvados eingesegnet. Sie glaubte inzwischen selber an die Mär, die sie verbreitete: Bei Calvados geschlossene Verträge halten. Ach, Anna, du liebe Lebenslängliche. Sie hatten ohne Calvados geheiratet. Und hatten doch die Zeit der Stürme überstanden.
Aber daß eine Besucherin an dem Tag auf ihn einredete, den Gabriele zum La Mettrie-Gottlieb-Gedenktag erhoben hatte, bewies wieder, was er längst wußte: Es gibt keine Zufälle. Was man für Zufall hält, ist immer eine noch nicht erkannte Gesetzmäßigkeit. Sollte er der Besucherin eigentlich sagen, welchen Tag sie sich ausgesucht hatte? Das würde allerdings ihr Duett mit einer Schicksalswucht aufladen, der sie, beide, nicht entsprechen konnten. In zwei Stunden würde sie gehen. Aufnichtmehrwiedersehen. Zurückbleiben würde die Sonnenblume. Er wußte plötzlich, was die Sonnenblume wollte. Herrschen. Nein, die wollte nicht herrschen, die herrschte. Duldete nichts neben sich. Gottlieb sagte: Diese Sonnenblume. Und die Besucherin: Ja? Und Gottlieb: Unglaublich. Die Besucherin lachte laut auf. Das sei offenbar das Lieblingswort in dieser Familie. Gottlieb dachte: Die ist ziemlich wach.
Warum haben Sie nicht weitergemacht, Herr Zürn? Mit La Mettrie? Das fragte sie vorwurfsvoll. Sie wollte sich offenbar hineinsteigern. Gottlieb kannte das. Dem anderen zuliebe so tun, als könne man sich nicht mehr fassen vor Angetansein. In diesem Fall von La Mettrie und einem von La Mettrie heftig belebten Gottlieb Zürn. Und dann auf einmal gar nichts mehr. Warumwarumwarum, Herr Zürn! Sie sah ihn an, als wisse sie, warum, wolle es aber von Herrn Zürn hören. Da sie einander im Namen La Mettries gegenübersaßen, konnte das damalige Nichtmehrweitermachen nur mit Herrn Zürns Gefühlswelt zu tun haben. Und das wollte sie wissen. Aus wissenschaftlicher Neugier. Sie machte es glaubhaft klar. La Mettrie fordert den ganzen Menschen. Wenn sie beschreiben will, warum La Mettrie in Deutschland so zögerlich aufgenommen wurde und wird, dann kann sie das, sagte sie, am genauesten an einzelnen Erfahrungsbeispielen darstellen. Sie vermute, Resignation sei das Motiv, das persönliche und das gesamtgesellschaftliche, also nationale. In der DDR noch eine kleinmütige, halbherzige Pflege, weil La Mettrie viel zu lebendig, viel zu naturtreu und, trotz aller materialistischen, antimetaphysischen Leidenschaft, eben überhaupt nicht klassenkämpferisch ausbeutbar gewesen sei. Und im Westen? Dann, exemplarisch, bei Wendelin Krall alias Zürn?
Gottlieb hätte ihr sagen müssen: Als es erlosch, das Gabriele-Gottlieb-Feuer, da erlosch auch – in Gottlieb – das La Mettrie-Feuer. Er hatte die Nase voll vom Leben beziehungsweise von der Natur. Er war überhaupt nicht mehr verständnissüchtig, wißbegierig.
Anna hatte nach dem Abschied von allen möglichen Einbildungen ihren Beruf zur Raserei entwickelt. Gottlieb war einfach versunken. Senkrecht hinab. Wenn es Scheintod gibt, muß es auch Scheinleben geben. So empfand er, dachte er. Aber die Besucherin sprudelte. Ihr Mund wogte, als habe er Wehen. Sie sah ihn an. Ein starker Blick, dachte Gottlieb. Dieses geradezu massive Blau. Dieser Blick meinte andauernd etwas. Annas Blick war die bedeutungsabweisende Meeresweite schlechthin. Die Augen der Besucherin lieferten andauernd das Gefühl zu dem, was ihr Mund gerade sagte. Der Mund, dieses sich auf Wörter reduzierende Lippengelände, hatte zu kämpfen, um das herauszubringen, was die Augen schon wußten und ausdrückten. Dieser um Sätze kämpfende Mund sah doch wirklich aus, als habe er Wehen.
Die Natur hat uns einzig und allein dazu geschaffen, glücklich zu sein; ja, uns alle – vom Wurm, der auf dem Boden dahinkriecht, bis zu dem Adler, der sich in den Wolken verliert.
Und wenn sie so ein Paradezitat ausgestoßen hat, wartet sie auf die Wirkung. Herr Zürn, Sie sind auf dem Prüfstand, stellvertretend für Ihre Landsleute, zeigen Sie Wirkung oder gestehen Sie, daß Sie keine mehr spüren. Daß einer kurz vor 1750 vollkommen Schluß gemacht hat mit dem Sprachschwindel hie Körper, da Seele, daß ihn seitdem keiner übertroffen hat in seiner Fähigkeit, sich, uns alle, den Menschen als eins, als ein Einziges zu erleben, und nicht nur den Menschen, Herr Zürn, alles ist eins, die Mücke, der Hund, der Mensch, die Sonnenblume, alles ist aus dem selben Stoff, und Bewußtsein ist überall! Das hat vor ihm und nach ihm keiner so mitreißend erlebt und erzählt. Herr Zürn! Herr Krall! Was ist los mit Ihnen?!
Gottlieb spürte, daß sie ihn heftig loben wollte. Er müßte ihr sagen, daß er ein Training hinter sich habe. Schluß mit dem Gelobtwerdenwollen. Das Gelobtwerdenwollen ist das unverwüstlich Kindheitliche in uns. Und je älter wir werden, desto komischer wirkt dieses Immernochgelobtwerdenwollen. Irgendwann müßte, was man tut, sich selber loben. Oder eben nicht. Bei dir eben nicht, Gottlieb Zürn. Deshalb bist du immer noch in Gefahr, abhängig zu werden von solchen, die dich loben. Oder die so tun, als wollten sie dich loben. Es lobt dich jeder nur um seinetwillen. Das ist erfahren. Keiner lobt dich um deinetwillen. Also schließ deine Ohren vor diesem freundlichen Schwall. Schenk ihr noch einen Calvados ein. Und noch einen. Ermuntere sie zum Trinken, daß sie dann selber merkt, wie wenig glaubwürdig sie ist. Gib ihr Gabrieles Telephonnummer. Soll sie die ausfragen über La Mettrie-Wirkungen in Deutschland. Das tat er dann. Die Besucherin war entzückt. Eine junge Politikerin, die durch La Mettrie zu sich selbst gefunden hat. Das ist Wirkungsgeschichte! Fabelhaft! Dann mußte sie tatsächlich gehen. Die Großtante braucht das Auto, weil sie heute ihren Bridge-Abend in Bad Schachen hat. Aber sie sei so froh, daß sie es gewagt habe, hier einzudringen und vorzudringen zu Wendelin Krall. Sie habe viel gelernt an diesem zu kurzen Nachmittag. Und so weiter.
Gottlieb hörte das wie aus weiter Ferne. Die konnte jetzt also einfach gehen. Und er, der Immerschonidiot, blieb verblutend zurück. Er ging mit ihr zum eisernen Gartentor, das man nur aufkriegte, wenn man es zuerst nach oben riß, dann erst konnte man es zu sich herziehen. Auch kreischten die Angeln, weil Gottlieb vor lauter Sitzenmüssen nie dazu kam, sie zu ölen. Sie blieb stehen, hob Kopf und Schultern, als stünde sie unter der Dusche, und sagte mit ihrem dabei sich ganz langsam öffnenden Mund: Toll. Gottlieb blieb nichts übrig als zu fragen: Was? Das Kreischen, sagte sie, so schön, so schrill. Und wie sie vorher scharf mit drei f’s gesprochen hatte, sprach sie jetzt schrill mit einem nicht aufhörenden l aus. Daß sie ihre Zunge während dieses unaufhörlichen l’s ziemlich entblößte, schien ihr nichts auszumachen. La Mettrie läßt grüßen, dachte Gottlieb und machte durch eine Kopfbewegung deutlich, daß er jetzt, solange sie das l trillerte, vor sich auf den Boden schauen werde. Da sah er, zum ersten Mal, ihre Schuhe. Wahrscheinlich waren die jetzt gerade modern. Viel länger als nötig, so weit kann kein Fuß nach vorne kommen, so schmal kein Fuß sein, und ganz vorne nicht mehr spitz, sondern wie abgesägt. Aber das wirklich Attackierende war das Schlangenleder oder Schlangenledermuster. Total tropisch beziehungsweise: die Schlange persönlich. Die Absätze manierierter als je. Geschwungen dünn und dann doch ziemlich massiv auf den Boden kommend.
Er schaute wieder nach oben.
Sie werden, fürchte ich, von mir hören, sagte sie. Der Animateur La Mettrie! Sie sei so unbescheiden zu vermuten, daß sie Zeugin einer Wiederbelebung geworden sei. Die sei La Mettries Werk. Wendelin Krall redivivus! Solche Beispiele suche sie. Vielleicht sei sie zu wenig Wissenschaftlerin. Auf jeden Fall zu wenig Historikerin. Noch glaube sie an das Leben, und wo es in der Geschichte verschwinde, interessiere es sie nicht mehr. Erst wenn die Geschichte im Leben verschwinde, erwache ihr Interesse. Es war mir eine Ehre, Herr Krall. Die Großtante wartet, zum Glück. Und sie gleißt vor Pedanterie. Sonst könnte ich doch gar nicht gehen. Gestehe ich. Freimütig. Im Namen La Mettries.
Sie standen noch immer in der geöffneten Tür, Gottlieb drückte ihre kleine Hand, drückte sie ein bißchen mehr, als er wollte, sie ging auf die andere Straßenseite, da stand das Auto der Großtante, ein mittlerer Mercedes, sie stieg ein, öffnete das Fenster, winkte herüber, fuhr ab, aber im Davonfahren streckte sie den Arm heraus und winkte noch einmal.
Gottlieb merkte, daß er ihren letzten Blick, ihren letzten Gesichtsausdruck, nicht loswurde. Ein vorwurfsvoll geschürzter Mund. Das hieß wahrscheinlich: So trübsinnig wie Sie steht man nicht in der Welt, wenn man La Mettrie intus hat. Dieser Vorwurfsmund wurde unterstützt durch das massive Augenblau. Er forschte geradezu, ob in den Augen nicht auch eine Leidensahnung mitwirke. Und entdeckte nichts. Nur Lebensfreude, Wissenschaftslaune, Übermut. Gottlieb fühlte sich wie ein Patient, bei dem die Betäubung nicht funktioniert. Man hat ihm doch versprochen, er werde von der Operation nichts spüren, und jetzt, die Operation in vollem Gang und er erwacht aus der Betäubung. Gerade daß er es noch schaffte, den Schrei zu unterdrücken. Er rannte ins Haus, rannte durch das Haus, hinaus auf die Terrasse, setzte sich auf den Platz, auf dem sie gesessen hatte, und schenkte sich einen Calvados ein. Was sind das für tönerne Begegnungen. Man spricht mit einander, um nichts zu sagen. Das Wichtigste wäre gewesen, dieser Besucherin zu sagen, was er in der vergangenen Nacht geträumt hatte. Geträumt hatte, weil er wußte, am nächsten Tag komme sie. Nein, bitte, das nicht. Das ist Traumdeutungsquatsch. Aber seinen Traum hätte er ihr servieren müssen. Ohne alle Anspielungstendenz. Nur daß sie gewußt hätte, mit wem sie am Tisch saß, diese übermütige Wissenschaftszicke. Aber so wie die Welt ist, war es undenkbar, daß er ihr diesen Traum servierte. Dafür Tarte Tatin, ungestürzt.
Und war doch, bis zu ihrer Ankunft, herumgewatet im Gewölk dieses Traums. Eine Rechtsanwältin hatte ihn verteidigt. Sie war nichts als jung. Brüste, die frech hinausstachen. Steile Spitzen sah er. Sie war überhaupt nicht angezogen wie eine Anwältin, sondern wie ein Mädchen. Anna war auch im Gerichtssaal. Es war im Saal nicht überall gleich hell. Er und das Anwaltsmädchen gaben einander Zeichen des Einverständnisses, aber so, daß es niemand bemerkte, weder Anna noch der Richter. Immer wieder mußte er versuchen, das Anwaltsmädchen zu berühren, sie weiter hinten im Saal in eine Bank zu ziehen. Es gelang auch diese und jene Berührung, aber beide wollten mehr beziehungsweise alles. Immer kam Anna dazu und zog etwas aus der Tasche, was im Augenblick für den Gang der Verhandlung wichtig war, Beweisstücke zu Gunsten ihres Mannes. Zum Beispiel einen blau und rot angemalten voluminösen Schinken, der durch diese Bemalung märchenhaft schön aussah. Das Anwaltsmädchen rief: Jawohl, das ist die Ehe! Während sie das rief, preßte er sich von hinten an sie. Es mußte doch möglich sein, diese höchste Bereitschaft zweier Menschen in eine Wirklichkeit zu überführen. Aber obwohl er immer kühnere Zugriffe probierte, auch solche, die Anna brüskierten, beleidigten, blamierten und sie sogar aus dem Gerichtssaal jagten, es gelang ihm nichts. Er rannte Anna nach, redete sich im Hinausrennen ein, daß er das Anwaltsmädchen überschätze. Aber wo war Anna? Ihn schüttelte eine furchtbare Angst. Er wachte auf. Und sah das Anwaltsmädchen vor sich. Als wäre sie da. Sie war aber nicht da. Aber er sah doch ihre lockere Oberlippe, die gekräuselten Haare bis zur Ohrmitte, dann den langen nackten Hals. Wie sollte er da weiterleben? Was für eine Fehlentwicklung ist der Mensch. Er würde das Leben boykottieren. Diesen Schmerz, nein danke, das läßt er sich nicht gefallen. Gäbe es ein Jenseits, könnte er sich umbringen. In der Hoffnung, das Anwaltsmädchen erwarte ihn dort. Aber es gibt nichts. Dort nichts. Hier nichts. Nirgends nichts. Er hatte Anna den ganzen Tag lang nicht sagen, nicht verzeihen können, woran sie ihn in dieser Nacht gehindert hatte. Und dann diese Besucherin. Mit der Sonnenblume. In deren gelbumflammte dunkle Unergründlichkeit konnte er jetzt starren.
2.
Anna kam, er saß immer noch auf der Terrasse. Guten Abend, sagte sie und ließ ihre Lippenpartie ein bißchen entgleisen. Herr Zürn oder Herr Krall, wie hätten Sie’s gern? Gottlieb sagte: Unglaublich.
Und Anna: Vor allem die Sonnenblume.
Gottlieb nickte so sachlich wie möglich. Anna legte auf den Tisch, was sie geleistet hat, den Pfullendorfer Abschluß, die Hälfte der Provision, per Scheck, EURO 6000. Gottlieb stand auf. Er würde das sofort buchhalterisch erledigen. Gratuliere, sagte er. Ich dir, sagte sie. Ja, sei doch tief rührend, kommt so eine jung-schön-gescheite Philosophin aus Amerika, um Wendelin Krall anzuschauen. Wie ich sehe, habt ihr das gebührend gefeiert. Zeigte auf die halbleere Calvados-Flasche. Und daß er mitgetrunken habe, zeige doch, wie nahe ihm dieser Besuch gegangen sei.
Gottlieb konnte jetzt nicht sagen, daß er erst getrunken habe, als die Besucherin wieder weg gewesen sei. Das war ja noch viel schlimmer, als mit ihr zusammen zu trinken. Jetzt nimm’s nicht so schwer, sagte Anna, vierzig Jahre, das kann man doch auf sich beruhen lassen. Gottlieb dachte: Woher weiß sie das, vierzig Jahre, es können genau so gut zweiunddreißig Jahre sein oder sechsunddreißig. Typisch Anna. Alles so negativ wie möglich. Immer schon. Immer ist alles zu Ende. Sie zieht dich hinab. Nicht absichtlich. Unwillkürlich. Ihre Spezialität, in allem das Ende herauszuspüren. Besonders an lichtlosen Tagen. Sie war immer lichtabhängig. Das Licht regelte alles bei ihr. Wenn sie Ende Juni spazieren gingen und alles noch blühte und grünstens prangte, konnte sie sagen: Der erste Herbsttag heute. Und das lag am Licht. Wenn er, durch sie aufmerksam geworden, dieses Licht mit seinen Sinnen prüfte, mußte er ihr recht geben, durch irgendwelche Druck- und Feuchtigkeitsumstände war trotz aller Grünherrschaft ein Hauch kühles Gold in der Luft, ein Herbstschimmer, unverkennbar. Er, vom oberflächlich herrschenden Grün eingenommen, hätte das nicht bemerkt.
Er ging an ihr vorbei, zeigte, daß er die Papiere versorge, den Scheck werde er morgen gutschreiben lassen. Bloß kein Gespräch jetzt. Er mußte ihr jetzt bestätigen, daß auch er der Ansicht sei, eine vierzig Jahre jüngere, das könne man auf sich beruhen lassen. Auf sich beruhen, oh Anna! Ist ja gut. Solange er nichts sagen muß, erträgt er alles. Wenn er ihr nur nicht ins Gesicht sagen muß: Stimmt, vierzig Jahre, da erlischt jedes Problem! Sie sagte, sie habe sich doch auch darüber gefreut, daß Wendelin Krall noch so schöne Wirkungen zeitige. Von seinen Pseudonymen sei ihr Wendelin Krall immer das liebste gewesen. Das sei doch einfach ein lieber Name. Wendelin Krall. Er nickte. Verbarg, daß er staunte. Berührte sie leicht an der Schulter. Dann hörte er sich sagen, er müsse noch wegfahren, heute. Wohin, fragte sie. Er komme ja gleich wieder, sagte er. Er holte seinen Autoschlüssel, gab sich eilig, fuhr ab. Nur nichts sagen müssen jetzt. Daß das erwartet, ja verlangt werden kann, immer alles sagen! Das ist doch Seelenmord. Er will doch selbst nicht wissen, wie es in ihm momentan aussieht. Und dann soll er es Anna so sagen, daß sie es nicht nur versteht, sondern auch noch billigt! Ohne zu lügen nicht zu machen. Und lügen in Gottliebs Alter – das war Seelenselbstmord. Er war sich im Augenblick nur erträglich, wenn er nichts sagen mußte. Einfach nur tun, was er mußte. Aber nichts sagen, nichts erklären. Jetzt fuhr er also offenbar nach Langenargen. Und durch Langenargen, bis zur Uferstraße. Eine Großtante, die im Mercedes zur Bridgepartie nach Bad Schachen fährt, haust nicht in einer Zweizimmerwohnung. In der Gegend der Villen hatte Gottlieb, als er noch den Handel besorgte, mehr als ein Haus von innen kennengelernt. Eine Familie Gutbrod hatte nie zu seinen Kunden gehört, weder als Käufer noch als Verkäufer. Aber vielleicht hieß die Großtante gar nicht Gutbrod. Beate Gutbrod. Er konnte sich nicht vorstellen, die Besucherin je Beate zu nennen. Sie hatte mit fortschreitendem Calvadoskonsum manchmal von amerikanischen Gewohnheiten Gebrauch gemacht und ihn Wendelin genannt. Immer eingebettet in Sätze. Nie am Anfang oder am Ende eines Satzes. Immer deutlich in amerikanischer Routine, also ohne privaten Anteil. Beate? Ob er diesen Namen erlernen könnte? Jetzt spielte er den, der die Uferstraße auf und ab schlendert. Der schwarze Mercedes mußte inzwischen in Bad Schachen stehen. Auf keinem Schild der Name Gutbrod. Er hätte im Telephonbuch nach dem Namen suchen sollen. Anrufen. Was dann sagen? Vielleicht war der Großonkel am Apparat. Die Welt war eine Verschwörung. Alles setzte sich durch gegen ihn. Er durfte nichts unternehmen, sich durchzusetzen. Was er wollte, war so wenig möglich, so wenig erlaubt, daß er nicht den geringsten Versuch machen durfte, seinen Willen durchzusetzen. Bitte, was wollte er denn? Schon das zu formulieren war unmöglich.