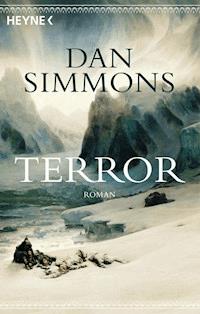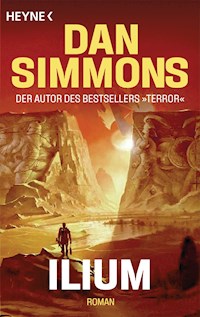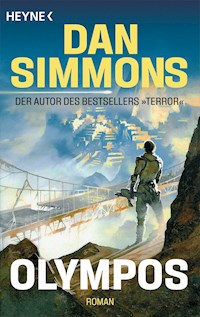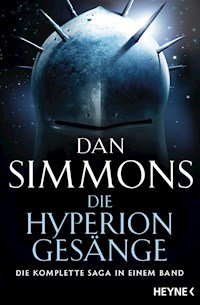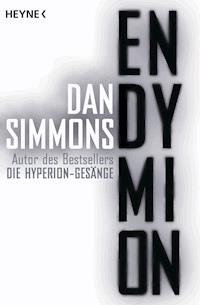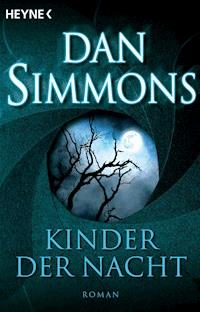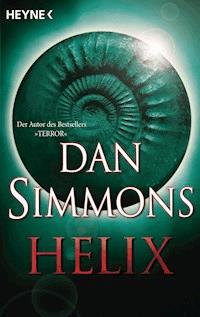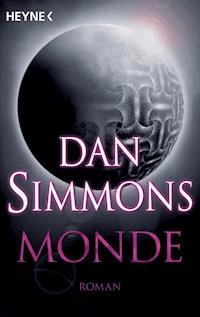5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1924. Auf der Nordostseite des Mount Everest machen sich die beiden englischen Bergsteiger George Mallory und Andrew Irvine auf den Weg zum Gipfel – und verschwinden für immer. Bis heute weiß man nicht, was ihnen geschehen ist. Waren es die Wetterbedingungen? Oder war etwas dort oben bei ihnen auf dem Berg, etwas Tödliches? Mit Der Berg erzählt Bestsellerautor Dan Simmons die packende Geschichte von der Erstbesteigung des Mount Everest.
Mythen und Legenden umranken George Mallorys und Andrew Irvines Versuch, 1924 erstmals den Mount Everest zu bezwingen. Waren die beiden vielleicht doch auf dem Gipfel? Und wenn ja, was ist ihnen beim Abstieg geschehen? Diese Fragen lassen den Bergsteiger Richard Deacon nicht los, und so organisiert er ein Jahr später eine weitere Expedition, um das Schicksal der beiden Verschwundenen aufzuklären – und um den höchsten Berg der Welt zu besteigen. Doch in den dunklen Schluchten und Höhlen des Mount Everest verbergen sich Dinge, die lieber unentdeckt bleiben sollten. Je höher Deacon und seine Kameraden steigen, desto lauter wird das dumpfe Heulen, das aus dem Schnee kommt . . . Mit Der Berg stellt Dan Simmons – wie in seinem Bestseller Terror – eindrucksvoll unter Beweis, dass in den großen Entdeckergeschichten der Menschheit noch unzählige Rätsel lauern. Simmons macht aus historischen Ereignissen ein faszinierendes Leseabenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1003
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DAN SIMMONS
DERBERG
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Friedrich Mader
Das Buch
Unzählige Mythen und Legenden umranken George Mallorys und Andrew Irvines gescheiterten Versuch, 1924 erstmals auf den Mount Everest zu steigen. Was ist den beiden auf dem Berg zugestoßen? Haben sie es zum Gipfel geschafft? Wenn ja, was ist ihnen dort begegnet? Und warum sind sie verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen? Diese Fragen lassen den Bergsteiger Richard Deacon nicht los, und so organisiert er ein Jahr später eine Expedition, um das Schicksal der beiden Verschollenen aufzuklären – und um den höchsten Berg der Welt endlich zu bezwingen. Doch in den dunklen Schluchten und Höhlen des Mount Everest verbergen sich Dinge, die lieber unentdeckt bleiben sollten. Je höher Deacon und seine Kameraden steigen, desto lauter wird das dumpfe Heulen, das aus dem dichten Schnee kommt …
Wie schon in seinem Bestseller Terror stellt Dan Simmons auch in Der Berg eindrucksvoll unter Beweis, dass in den großen Entdeckergeschichten der Menschheit noch viele faszinierende Rätsel lauern. Ein packendes Leseabenteuer, wie es nur Dan Simmons erzählen kann.
Der Autor
Dan Simmons wurde 1948 in Illinois geboren. Nach dem Studium arbeitete er einige Jahre als Englischlehrer, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Simmons ist heute einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Seine Romane Terror, Die Hyperion-Gesänge und Endymion wurden zu internationalen Bestsellern. Der Autor lebt mit seiner Familie in Colorado, am Rande der Rocky Mountains.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel
The Abominable bei Little Brown and Company, New York
Copyright © 2013 by Dan Simmons
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in derVerlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung: Eisele Grafikdesign, München
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-12586-8
Dieses Buch ist voller Respekt
gewidmet dem Andenken von
Jacob »Jake« William Perry
(2. April 1902 – 28. Mai 1992)
»Wenn Menschen und Berge sich begegnen,
ereignen sich große Dinge.«
William Blake
Einleitung
Ich lernte Jake Perry im Sommer 1991 kennen. Wieder einmal war es so weit, dass ich meinem Verlag ein Paket mit drei neuen Büchern vorschlagen sollte. Schon seit geraumer Zeit interessierte ich mich für Antarktisexpeditionen – eigentlich bereits seit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957/58, als die USA mit der Einrichtung permanenter Stützpunkte dort meine Fantasie als Zehnjähriger beflügelten. Ungefähr ab 1990 trug ich mich mit der vagen Vorstellung eines in der Antarktis spielenden Romans. Weitere fünfzehn Jahre sollten vergehen, bis ich tatsächlich ein Buch über eine gescheiterte Polarexpedition schrieb – das 2007 erschienene Terror, das allerdings in der Arktis spielt. Meine große Begeisterung für den Südpol war entstanden durch die jahrelange Lektüre der Abenteuer von Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott, Apsley Cherry-Garrard und anderen Helden und Märtyrern der Antarktis.
Dann erwähnte eine Bekannte gegenüber meiner Frau Karen im Sommer 1991, dass sie einen echten Südpolforscher kannte. Dieser alte Herr – der in einer Senioreneinrichtung in der Kleinstadt Delta im Westen Colorados lebte – hatte schon in den Dreißigerjahren Konteradmiral Richard Byrd bei einer amerikanischen Antarktisexpedition begleitet.
So zumindest laut Marys Erzählung im Gespräch mit Karen. Ich persönlich tippte eher auf Alzheimer, Lügen, einen unverbesserlichen Aufschneider oder alles drei.
Doch nach Marys Bericht hatte dieser neunundachtzigjährige Gentleman namens Jacob Perry tatsächlich an der US-Expedition zum Südpol 1934 teilgenommen. Dieser verheerenden Forschungsreise, bei der der stets auf seinen Ruhm bedachte Admiral Byrd fünf Monate allein in einer weit vorgerückten meteorologischen Station im Eis hauste und wegen der schlechten Ofenlüftung fast an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben wäre. (Später schrieb er über dieses Erlebnis einen Bestseller, der den naheliegenden Titel Allein! Auf einsamer Wacht trug.)
Laut Mary war dieser betagte Herr namens Jacob Perry einer von vier Männern gewesen, die im Winter 1934 bei totaler Finsternis und heulenden Stürmen mehr als hundert Kilometer Eis durchquerten, um Admiral Byrd zu retten. Danach musste die gesamte Gruppe bis zum Beginn des antarktischen Sommers im Oktober ausharren, um ihrerseits gerettet zu werden.
»Von dem könntest du bestimmt einmalige Informationen über den Südpol bekommen«, sagte Karen. »Vielleicht kannst du sogar ein Buch über diesen Mr. Perry schreiben. Möglicherweise ist das sogar der Admiral Perry, der als Erster den Nordpol erreicht hat!«
»Unser Antarktisforscher heißt Perry«, antwortete ich. »Nicht zu verwechseln mit dem Konteradmiral Robert Peary, der behauptete, 1909 der erste Mensch am Nordpol gewesen zu sein.«
»Vielleicht sind sie ein und derselbe. Wäre doch möglich.«
»Also, erstens ist da die Namensschreibung.« Ich war leicht gereizt, entweder weil ich mich bedrängt fühlte, oder weil ich es generell nicht ausstehen kann, wenn mir jemand vorschlägt, worüber ich als Nächstes schreiben soll. Ich wies sie auf den Unterschied zwischen Admiral Peary und Mr. Perry hin, Marys altem Herrn in Delta. »Zweitens«, fügte ich hinzu, »wäre Konteradmiral Peary inzwischen schon über hundertdreißig Jahre alt …«
»Schon gut, schon gut.« Karen hob die Hände zu einem in jahrzehntelanger Ehe erprobten Signal, das uns davon abhält, einander an die Gurgel zu gehen. »Ich nehme alles zurück. Trotzdem hat dieser Mr. Perry vielleicht eine wunderbare Geschichte zu erzählen …«
»Außerdem«, unterbrach ich sie rechthaberisch, »ist Admiral Robert Peary schon 1920 gestorben.«
»Aber dieser Jacob Perry in Delta lebt«, erwiderte Karen. »Gerade noch.«
»Gerade noch? Du meinst, wegen seines Alters?« Heute fallen für mich alle Leute mit neunundachtzig oder neunzig in die Kategorie gerade noch am Leben. 1991 stand für mich sogar schon jeder über sechzig kurz davor, den Löffel abzugeben. (Um die Karten auf den Tisch zu legen: Bei der Niederschrift dieses Vorworts im Jahr 2012 bin ich dreiundsechzig.)
»Nein, es ist nicht bloß das Alter«, sagte Karen. »In ihrer E-Mail hat Mary erwähnt, dass er Krebs hat. Anscheinend geht es ihm bis jetzt noch ganz gut, aber …«
Ich hatte gerade mit Ideen zu Büchern herumgespielt und mögliche Titel in den Computer eingetippt. Nun schaltete ich ihn aus. »Mary hat wirklich erzählt, dass er mit Byrd 1934 in der Antarktis war?«
»Ja, wirklich. Ich wusste gleich, dass dich das interessiert.« Irgendwie gelingt es meiner Frau, nicht eingebildet zu klingen, auch wenn sie recht behält. »Es würde dir guttun, ein paar Tage aus dem Büro rauszukommen. Du brauchst fünf oder sechs Stunden, auch wenn du bis Grand Junction auf der Interstate bleibst. Du kannst bei Guy und Mary in Delta übernachten.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich nehme den Miata. Und fahre von der I-70 runter, durch Carbondale und dann weiter über den McClure-Pass.«
»Schafft es der Miata denn über den McClure?«
»Und wie.« Ich überlegte bereits, welche Kleider ich einpacken sollte, falls ich Mr. Perry am Morgen des zweiten Tags aufsuchte und anschließend wieder nach Hause fuhr. Ich besaß eine kleine North-Face-Reisetasche, die perfekt in den winzigen Kofferraum des Miata passte. Die Nikon durfte ich auch nicht vergessen. (Zumindest was Fotografie anging, war ich damals noch nicht im digitalen Zeitalter angelangt.)
So kam es, dass ich Mr. Jacob Perry kennenlernte, weil ich so darauf versessen war, mit meinem neuen Mazda MX-5 durch die Berge zu fahren.
Delta hatte ungefähr sechstausend Einwohner. Als ich mich dem Ort näherte – meine Route hatte mich auf dem schmalen, zweispurigen Highway 65 über Hochpässe und vorbei an den entlegenen Außenposten Marble und Paonia geführt –, bekam ich ein Gespür dafür, wie eng von Bergen umgeben diese Kleinstadt ist. Delta liegt in einem breiten Flussbecken südlich der Grand Mesa, einer der größten Hochebenen der Welt.
Das Haus, wo Jake Perry lebte, sah nicht nach einem Altenheim aus und schon gar nicht nach einem, das rund um die Uhr Pflege bot. Mithilfe staatlicher Zuschüsse hatte Mary ein ehemals prachtvolles, doch heruntergekommenes Hotel renoviert und es mit einem leeren Ladengeschäft daneben verbunden. Das Ergebnis waren Räumlichkeiten, die eher an ein Viersternehotel von 1900 erinnerten als an eine Einrichtung für betreutes Wohnen.
Ich stellte fest, dass Jacob Perry ein eigenes Zimmer im zweiten Stock hatte. (Im Zuge der Renovierung waren Fahrstühle eingebaut worden.) Nachdem Mary mich vorgestellt und erklärt hatte, dass ich Schriftsteller bin und Recherchen zu einem am Südpol angesiedelten Roman betrieb, bat mich Mr. Perry hinein.
Das Zimmer und der Mann schienen sich gegenseitig zu ergänzen. Ich staunte über den großen Raum: ein ordentlich gemachtes Doppelbett nahe dem einen von drei Fenstern, die einen weiten Blick über die Geschäfte im Ortszentrum zu den Bergen und der Grand Mesa im Norden boten. Vom Boden bis zur Decke Regale voller gebundener Bücher – viele davon über Bergketten aus aller Welt – und Erinnerungsstücke: altmodische Seilrollen, Brillen aus Crookesglas, wie sie früher von Arktisforschern getragen worden waren, ein verschlissener Motorradhelm aus Leder, eine antike Kodak-Kamera, ein alter Eispickel mit einem Holzgriff, der viel länger war als bei modernen Geräten dieser Art.
Was Jacob Perry selbst betraf, so konnte ich einfach nicht glauben, dass der Mann neunundachtzig war.
Sicher hatten Alter und Schwerkraft ihren Tribut gefordert und seiner Wirbelsäule durch Krümmung und Stauchung ein paar Zentimeter geraubt, trotzdem war er immer noch deutlich über eins achtzig. Er trug ein kurzärmeliges Denimhemd, und ich konnte erkennen, dass sein Bizeps ein wenig geschrumpft war, doch die Muskeln vor allem an den Unterarmen waren immer noch beeindruckend. Nicht einmal die Zeit hatte seinem kräftigen, von einem Leben voller physischer Anstrengungen geformten Oberkörper viel anhaben können.
Erst nach einigen Minuten fiel mir auf, dass an seiner linken Hand der kleine und der Ringfinger fehlten. Offenbar eine sehr alte Verletzung, denn die Haut an den Stummeln nahe den Knöcheln war genauso braun und verwittert wie die an den Händen und Unterarmen. Dabei schienen ihn die fehlenden Finger nicht im Geringsten in seiner Geschicklichkeit zu behindern. Im Lauf unserer Unterhaltung spielte Mr. Perry mit zwei dünnen Lederschnürsenkeln herum, beide ungefähr fünfundvierzig Zentimeter lang, und ich beobachtete verwundert, wie er mit beiden Händen unabhängig voneinander komplizierte Knoten schlang. Vermutlich handelte es sich um Seemanns- oder Kletterknoten – ich hätte sie auch mithilfe beider Hände und einer ganzen Pfadfinderschar nicht zustande gebracht. Mr. Perry hingegen flocht und entflocht sie ganz nebenher, obwohl die linke Hand nur noch über zwei Finger und den Daumen verfügte. Anscheinend war das eine alte Gewohnheit, die der Beruhigung diente, und er schenkte dem ganzen Vorgang und den fertigen Knoten kaum Beachtung.
Als wir uns die Hand reichten, verschwanden meine Finger fast völlig in seinem mächtigen Griff. Er drückte nicht zu, um mir zu imponieren, die Kraft war einfach da. Mr. Perrys Gesicht verriet, dass er sich zu oft in der Sonne bewegt hatte – in großen Höhen, wo das UV-Licht der Epidermis richtig zusetzen konnte –, und zwischen den braunen Flecken waren Narben von kleinen Operationen zur Abklärung möglicher Melanome zu erkennen.
Die wenigen Haare trug er ganz kurz geschnitten. Durch das schüttere Grau konnte ich die braune Kopfhaut sehen. Wenn er lächelte, zeigte er seine eigenen Zähne, von denen ihm nur unten und hinten zwei oder drei fehlten.
Besonders eingeprägt haben sich mir Mr. Perrys Augen. Sie waren durchdringend blau und, wie mir schien, ohne Alter. Nicht die triefenden, zerstreuten Augen eines Mannes Ende achtzig. Perrys strahlend blauer Blick war neugierig, aufmerksam, mutig, fast … kindlich.
Wenn ich mit beginnenden Schriftstellern zusammenarbeite, warne ich sie stets vor einem Vergleich ihrer Figuren mit Kinostars oder berühmten Menschen. So etwas ist allzu bequem, obendrein zeitgebunden und klischeehaft. Trotzdem – als ich fünfzehn Jahre später mit Karen Casino Royale sah, den ersten neuen James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, flüsterte ich aufgeregt: »Das ist genau die Augenfarbe, die Mr. Perry hatte – blauer als blau. Überhaupt hat Daniel Craig viel Ähnlichkeit mit ihm.«
Karen wandte sich mir in dem dunklen Kinosaal kurz zu und machte »Schsch«.
1991 in der betreuten Wohneinrichtung in Delta fehlten mir zunächst die Worte, und in meiner Verlegenheit bewunderte ich erst einmal die Andenken in Perrys Regalen und auf seinem Schreibtisch: den großen, in einer Ecke aufgepflanzten Eispickel, mehrere Steine, die von verschiedenen Berggipfeln stammten, wie er mir später verriet, und etliche vom Alter gebräunte Schwarz-Weiß-Fotos. Die kleine Kamera – eine Kodak, die man zum Aufnehmen aufklappen musste – war trotz ihres Alters rostfrei und gut erhalten.
»Da ist noch ein Film drin von … schon einige Jahre her«, erklärte Mr. Perry. »Nie entwickelt.«
Ich berührte den Fotoapparat und wandte mich zu meinem Gastgeber um. »Sind Sie nicht neugierig, wie Ihre Schnappschüsse geworden sind?«
Mr. Perry schüttelte den Kopf. »Ich habe die Bilder nicht geschossen. Auch die Kamera gehört mir eigentlich nicht. In der Drogerie hier in Delta hat man mir gesagt, dass man den Film wahrscheinlich noch entwickeln kann. Vielleicht lasse ich es irgendwann doch machen.« Er winkte mich zu einem Sessel bei einem Einbau-Schreibtisch. Darauf verstreut lagen sorgfältige Zeichnungen von Pflanzen, Felsen und Bäumen.
»Mein letztes Interview ist schon sehr, sehr lange her.« Mr. Perry begleitete seine Worte mit der Andeutung eines ironischen Lächelns. »Und schon damals, vor vielen Jahrzehnten, hatte ich der Presse praktisch nichts zu erzählen.«
Ich ging davon aus, dass er von der Byrd-Expedition 1934 redete. Damit lag ich völlig falsch, und ich war zu dumm, um diesen Irrtum sofort aufzuklären. Mein Leben und auch dieses Buch hätten sich ganz anders entwickelt, wenn ich den nötigen Funken journalistischen Instinkt besessen hätte, um bei so einer Bemerkung sofort nachzufassen.
Stattdessen brachte ich das Gespräch in meiner für einen Egoisten bescheidenen Art wieder auf mich: »Ich habe nur selten jemanden interviewt. Den größten Teil meiner Recherchen erledige ich in Bibliotheken. Stört es Sie, wenn ich mir Notizen mache?«
»Überhaupt nicht«, antwortete Mr. Perry. »Sie interessieren sich also nur für meine Beteiligung an der Byrd-Expedition von 1934?«
»Ich denke schon. Was mir vorschwebt, ist ein spannender Thriller in der Antarktis. Mir wäre mit allem gedient, was Sie mir über Südpolexpeditionen erzählen können. Vor allem, wenn es unheimlich ist.«
»Unheimlich?« Perry lächelte erneut. »Ein Thriller? Soll da neben Kälte, Finsternis und Einsamkeit etwa auch noch irgendeine böse Kreatur im Spiel sein, die Ihren Figuren ans Leder will?«
Ein wenig verlegen erwiderte ich sein Lächeln. Romanhandlungen klingen häufig albern, wenn man sie aus ihrem stilistischen Zusammenhang reißt. Manchmal sind sie auch in ihrem Zusammenhang albern, da müssen wir uns nichts vormachen. Und ich hatte tatsächlich an eine Art Riesenmonster gedacht, das meine Figuren verfolgt, tötet und auffrisst. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich allerdings noch keine klare Vorstellung, worum es sich dabei handeln könnte.
»So ungefähr«, bekannte ich. »Ein wirklich großes und bedrohliches Wesen, das sich in der Dunkelheit und Kälte herumtreibt und unseren Helden nachstellt. Das mit Zähnen und Klauen versucht, in ihre Antarktisstation oder in ihr eingefrorenes Schiff einzudringen. Nicht menschlich und sehr hungrig.«
»Ein Killerpinguin?«, schlug Mr. Perry vor.
Ich stimmte in sein Lachen ein, obwohl mir meine Frau, mein Agent und mein Lektor genau dieselbe Frage gestellt hatten, sobald ich die Idee zu einem Antarktisthriller erwähnt hatte: Wie jetzt, Dan? Soll dieses Monster eine Art mutierter, riesiger Killerpinguin sein? Dieser Sarkasmus beschämte mich, da ich tatsächlich einen mutierten, riesigen Killerpinguin als meine antarktische Bestie in Betracht gezogen hatte.
Anscheinend war Perry mein leichtes Erröten nicht entgangen. »Eigentlich reicht schon der Guanogestank einer Pinguinkolonie, um einen Menschen zu töten.«
»Sie haben solche Kolonien also besucht?« Ich ließ den Stift über dem schmalen Büchlein schweben, in das ich meine Recherchenotizen eintrug. Ich fühlte mich wie Supermans Freund Jimmy Olsen.
Mr. Perry nickte, und sein strahlend blauer Blick schien sich nach innen auf eine Erinnerung zu richten. »Ich habe meinen dritten und letzten Winter dort in der Hütte am Kap Royds verbracht … mit dem Auftrag, das Verhalten der Pinguine in der nahe gelegenen Brutkolonie zu studieren.«
»Hütte am Kap Royds …« Verwundert zögerte ich. »Shackletons Hütte?«
»Ja.«
»Ich dachte, Ernest Shackletons Hütte ist eine Art Gedenkstätte, die von Besuchern nicht betreten werden darf.« Vor Überraschung vergaß ich ganz mitzuschreiben.
»Stimmt«, antwortete Mr. Perry. »Inzwischen ist das so.«
Ich kam mir vor wie ein Idiot und neigte den Kopf zum Notizbuch hinunter, um mein erneutes Erröten zu verbergen.
Jacob Perry sprach schnell weiter, wie um die peinliche Situation zu entschärfen. »Shackleton war für die Engländer so ein Nationalheld, dass die Hütte schon eine Art Museum war, als mich Admiral Byrd im antarktischen Winter 1935 hingeschickt hat. Die Hütte wurde ab und zu von britischen Ornithologen benutzt, um die dortige Pinguinkolonie zu beobachten. Es waren immer Vorräte eingelagert, sodass Amerikaner vom nahe gelegenen Stützpunkt und auch andere im Notfall auf die Hütte zurückgreifen konnten. Allerdings hatte vor meinem Aufenthalt schon viele Jahre niemand mehr in der Hütte überwintert.«
»Es überrascht mich, dass die Briten einem Amerikaner gestattet haben, mehrere Monate in Shackletons Hütte zu verbringen«, erklärte ich.
Mr. Perry grinste. »Sie haben es nicht gestattet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätten sie so eine Genehmigung auch nie erteilt. Admiral Byrd hat nicht um Erlaubnis gefragt. Er hat mich einfach mit Vorräten für sieben Monate losgeschickt – auf zwei Schlitten mit Hunden, die von den anderen gleich wieder zu Byrds Station mitgenommen wurden, nachdem sie mich hingebracht hatten. Ach, nicht zu vergessen das Brecheisen, um die verrammelte Tür aufzustemmen. Ein paar von den Hunden hätte ich in dem Winter wirklich als Gesellschaft gebrauchen können. In Wahrheit wollte mich der Admiral nur aus den Augen haben. Also hat er mich so weit wie möglich weggeschickt, an einen Ort, wo zumindest eine gewisse Chance für mich bestand, den Winter zu überleben. Byrd spielte gern den Wissenschaftler, doch in Wirklichkeit hat ihn die Beobachtung des Pinguinverhaltens nicht die Bohne interessiert.«
Obwohl ich eigentlich nichts begriff, schrieb ich alles auf in dem Gefühl, dass es aus irgendeinem Grund wichtig sein könnte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich Shackletons Hütte für meinen vage konzipierten Spannungsroman ohne Titel verwenden sollte.
»Shackleton und seine Leute haben die Hütte 1906 gebaut.« Mr. Perrys leise Stimme klang leicht belegt, was auf den teilweisen Verlust seines linken Lungenflügels zurückzuführen war, wie ich im weiteren Verlauf unseres Gesprächs erfuhr. Selbst mit diesem Krächzen hatte er noch einen angenehmen Tenor. Vermutlich hatte er vor der Operation eine perfekte Erzählerstimme besessen.
»Shackletons Leute haben sie 1908 aufgegeben. Als ich hinkam, fand ich auch die Überreste eines Automobils, das sie zurückgelassen hatten. Wahrscheinlich steht es noch immer dort, weil dort ja alles so langsam verrostet und kaputtgeht. Kann mir nicht vorstellen, dass das Ding auch nur drei Meter weit gefahren ist in dem tiefen Schnee, mit dem Shackleton ständig zu kämpfen hatte. Die Briten hatten eben eine Schwäche für ihre Spielsachen. Genau wie Admiral Byrd übrigens. Jedenfalls wurde ich früh im antarktischen Herbst dort abgesetzt. Im März 1935. Abgeholt wurde ich Anfang Oktober desselben Jahrs. Ich hatte den Auftrag, über die Adeliepinguine in der großen Kolonie am Kap Royds zu berichten.«
»Aber das ist doch der antarktische Winter.« Ich zögerte, weil ich befürchtete, etwas unglaublich Dummes zu sagen. »Ich dachte, dass die Adeliepinguine … nicht überwintern. Dass sie irgendwann im Oktober ankommen und mit den Jungen, die überlebt haben, Anfang März weiterziehen. Täusche ich mich? Bestimmt täusche ich mich.«
Erneut kräuselten sich Jacob Perrys Lippen. »O nein, Sie haben vollkommen recht, Mr. Simmons. Bei meiner Ankunft am Kap Royds Anfang März konnte ich gerade noch beobachten, wie die letzten zwei oder drei Pinguine raus ans Meer gewatschelt sind – es stand kurz davor, wieder zuzufrieren, und schon wenig später war das offene Wasser Dutzende Kilometer von der Hütte entfernt. Und abgeholt wurde ich wie gesagt im Oktober, also im Frühling, bevor die ersten Adeliepinguine zurückkehrten, um sich zu paaren und ihre Jungen in der Kolonie aufzuziehen. Viel habe ich nicht mitbekommen von den Pinguinen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das versteh ich nicht. Sie wurden für … meine Güte … sieben, fast acht Monate dort hinbeordert, um die Brutkolonie am Kap zu beobachten, obwohl gar keine Pinguine dort waren. Und die meiste Zeit auch kein Sonnenlicht. Sind Sie Biologe oder eine Art Naturwissenschaftler, Mr. Perry?«
»Nein.« Wieder dieses schiefe Lächeln. »Ich habe in Harvard Anglistik studiert – Schwerpunkt amerikanische und englische Literatur des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Abschluss 1923, da war gerade Henry James in Mode. 1922 war Ulysses von James Joyce erschienen und sechs Jahre davor sein Porträt des Künstlers als junger Mann. Nach einem Jahr in Europa zum Skifahren und Bergsteigen – das ich mir leisten konnte, weil mir an meinem einundzwanzigsten Geburtstag eine kleine Erbschaft zufiel – habe ich in der Transatlantic Review von Ford Madox Ford eine Erzählung gelesen und bin kurz entschlossen aus der Schweiz nach Paris gereist, um den Verfasser dieser Erzählung – einen jungen Mann namens Hemingway – kennenzulernen und ihm etwas von meinen geschriebenen Sachen zu zeigen.«
»Und? Haben Sie ihn kennengelernt?«
»Ja«, antwortete Mr. Perry. »Hemingway arbeitete damals von Zeit zu Zeit als Frankreichkorrespondent für den Toronto Star, und er hatte diese besondere Masche, um Nervensägen wie mich loszuwerden. Wie viele andere, die ihn in seinem schäbigen, kleinen Büro aufgesucht haben, hat er mich sofort nach unten in ein Café geführt. Nach ein paar Minuten sah er dann auf die Uhr und sagte, er müsste wieder an die Arbeit – und der angehende Schriftsteller blieb allein im Café zurück.«
»Haben Sie ihm Ihre Sachen gezeigt?«
»Klar. Er hat einen Blick auf die erste Seite von drei Erzählungen geworfen und mir geraten, bei meinem Beruf zu bleiben. Aber das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Wir Alten geraten gern vom Hundertsten ins Tausendste.«
»Wirklich interessant.« Im Stillen dachte ich: Meine Güte, wie fühlt es sich wohl an, Ernest Hemingway zu treffen und von ihm gesagt zu bekommen, dass man kein Schriftsteller ist? Oder will mich Perry bloß verkohlen?
»Also zurück zu dem Thema, das Sie interessiert, Mr. Simmons – die Antarktis von 1933 bis 1935. Angeworben wurde ich von Admiral Byrd als Helfer und wegen meiner Erfahrung als Bergsteiger. Die Wissenschaftler der Gruppe wollten nämlich im Lauf der Expedition mehrere Gipfel erforschen. Damals hatte ich keinen blassen Schimmer von Naturwissenschaften oder Pinguinen, und daran hat sich trotz der vielen Dokumentarsendungen im Fernsehen bis heute nicht viel geändert. 1935 spielte das allerdings keine Rolle, weil mich Admiral Byrd bloß bis zur Heimkehr der gesamten Expedition im antarktischen Frühjahr loshaben wollte.«
»Sie waren also sieben Monate allein dort in der Dunkelheit und Kälte«, sagte ich bestürzt. »Gab es einen Grund für seine Abneigung gegen Sie?«
Mr. Perry schnitt mit einem kurzen, scharfen Taschenmesser einen Apfel auf und bot mir ein Stück an. Dankend griff ich zu.
»Ich habe ihn gerettet.« Die leisen Worte waren kaum zu verstehen, weil er auf einer Apfelscheibe kaute.
»Stimmt, Mary hat erwähnt, dass Sie zu der kleinen Gruppe gehörten, die Admiral Byrd 1934 in seiner vorgerückten Station entdeckt hat.«
»Richtig.«
»Es war ihm peinlich, einen seiner Retter um sich zu haben, daher hat er Sie in Shackletons Hütte auf Kap Royds verbannt, damit Sie die gleiche Einsamkeit erleben wie er?« Mir erschien das alles ziemlich abwegig.
»So ungefähr. Bloß dass ich mich im Gegensatz zu Byrd nicht mit Kohlenmonoxid vergiftet habe und auch nicht gerettet werden musste. Außerdem hatte er jeden Tag Funkkontakt zu unserem Stützpunkt Little America. Ich hatte weder ein Funkgerät noch Kontakt zum Stützpunkt.«
Ich warf einen Blick in mein Büchlein, wo ich mir Notizen zu dem Gespräch mit Mary und den Daten aus Nachschlagewerken gemacht hatte (1991 gab es Google noch nicht). »Sie sind damals mit drei anderen Männern hundertfünfzig Kilometer weit durch den Polarwinter gefahren, obwohl die Signalfahnen an den Eisspalten weggeweht oder vom Schnee bedeckt waren. Durch absolute Finsternis auf einem Schneetraktor, der kaum mehr war als ein umgebauter Ford Modell T mit Metalldach. Nur Sie und drei andere vom Stützpunkt Little America.«
Mr. Perry nickte. »Dr. Poulter, Mr. Waite und mein direkter Vorgesetzter E. J. Demas, der für die Schneetraktoren zuständig war. Demas wollte unbedingt, dass ich mitkomme und den Traktor fahre.«
»Das war Ihre Aufgabe bei der Expedition? Oh, danke.«
Perry hatte mir noch ein Stück von dem köstlichen Apfel gereicht. »Als Helfer habe ich ständig an diesen verdammten Traktoren rumgebastelt und sie schließlich im Sommer für die verschiedenen Wissenschaftler gefahren, die etwas außerhalb der Station zu erledigen hatten. Wahrscheinlich dachte Mr. Demas, dass ich es am ehesten schaffe, uns nicht alle im Dunkeln in eine Eisspalte zu lenken. Einmal mussten wir umkehren, als wir feststellten, dass die meisten Warnflaggen verschwunden waren. Doch wir haben es gleich noch mal probiert, obwohl das Wetter immer schlechter wurde.«
»Trotzdem hört sich das für mich so an, als wollte Admiral Byrd Sie bestrafen.« Der Apfel schmeckte erfrischend. »Mit sieben Monaten Einsamkeit.«
Jake Perry zuckte die Achseln. »Die Rettung war dem Admiral peinlich, und er hasste es, wenn jemand das Wort in diesem Zusammenhang verwendet hat. Gegen Dr. Poulter und Mr. Waite konnte er nichts unternehmen – sie waren Schwergewichte der Expedition. Demas hingegen wurde zu Arbeiten vergattert, bei denen er dem Admiral nur selten unter die Augen kam, und mich hat er eben zu den Sommerexpeditionen und später für den gesamten antarktischen Winter nach Kap Royds geschickt. Letztlich hat Admiral Byrd mich in dem Bericht über seine … Rettung nicht mal erwähnt. In den meisten Geschichtsbüchern über die Antarktis ist mein Name nicht zu finden.«
Das Schäbige von Admiral Byrds Handlungsweise frappierte mich. »Dass Sie den Winter allein auf Kap Royds verbringen mussten, war doch gleichbedeutend mit Isolationshaft.« Ich konnte meinen Ärger nicht verhehlen. »Und kein Funkgerät? Admiral Byrd ist nach drei Monaten Einsamkeit durchgedreht – dabei hatte er täglich Sprechkontakt mit Little America.«
Mr. Perry grinste. »Kein Funkgerät.«
Das überstieg mein Vorstellungsvermögen. »Gab es denn einen Grund – einen Auftrag vielleicht –, weshalb Sie sieben Monate völlig allein und fünf Monate davon in absoluter Finsternis in Shackletons Hütte verbringen mussten?«
Mr. Perry schüttelte den Kopf. Weder sein Gesicht noch seine Stimme verrieten Groll. »Wie gesagt, ich wurde für die Expedition angeworben, um auf Berge zu klettern. Im Anschluss an Byrds Rettung mussten wir zu viert mit ihm in seiner kleinen Station im Eis ausharren – vom 11. August bis zum 12. Oktober, dem Tag, an dem Byrd und Dr. Poulter mit der Pilgrim ausgeflogen wurden. Erst danach konnte ich endlich an Sommerexpeditionen teilnehmen und den Wissenschaftlern mit meinen Kletterfähigkeiten helfen.«
»Die Pilgrim war ein Flugzeug?«
Mr. Perry hätte ohne Weiteres entgegnen können: Was denn sonst, wenn sie damit ausgeflogen wurden? Ein überdimensionaler Albatros vielleicht? Doch er beschränkte sich auf ein höfliches Nicken. »So ist es, Mr. Simmons. Anfangs hatten sie bei der Expedition drei Flieger: die große Fokker …« Er unterbrach sich lächelnd und buchstabierte den Namen für mich.
Ich grinste. »Schon notiert. Aber nennen Sie mich bitte Dan.«
»Wenn Sie mich mit Jake ansprechen.«
Das fiel mir erstaunlich schwer. Menschen, die berühmt sind, einen Titel tragen oder sonst irgendeine Autorität darstellen, können mir nur selten imponieren, doch von Mr. Jacob Perry war ich zutiefst beeindruckt. Egal wie oft ich »Jake« zu ihm sagte, er blieb für mich doch immer »Mr. Perry«.
»Jedenfalls«, fuhr er fort, »sie hatten die große Fokker mit dem Namen Blue Blade, die schon beim ersten Startversuch in der Antarktis abgestürzt ist. Dann ein noch größeres Wasserflugzeug, die William Horlick, die aber ständig am Boden war und gewartet werden musste. Also flog der kleine Eindecker Pilgrim los, um Admiral Byrd und Dr. Poulter zu bergen, sobald sich im Oktober das Wetter stabilisiert hatte. Davor hatten wir natürlich in seinem kleinen Eisunterschlupf die Ofenlüftung repariert. Ich weiß noch, dass Dr. Poulter in den Wochen des Wartens häufig Sterne und Meteore beobachtet und barometrische Arbeiten durchgeführt hat, für die Byrd zu krank und zu verwirrt war. Die Ansammlung von Kohlenmonoxid hatte die Gehirnzellen des Admirals nicht unbedingt belebt. Dann, nachdem Byrd und Dr. Poulter im August mit der Pilgrim ausgeflogen worden waren, sind Waite, Demas und ich mit dem Traktor zum Stützpunkt zurückgekehrt … gerade rechtzeitig vor dem Aufbruch mehrerer Expeditionen zu den Haines Mountains.«
»Haben Sie sich der Expedition angeschlossen, um in der Antarktis auf Berge zu klettern?« Als ich meine Frage stellte, trat Mary mit Limonade für uns beide ein und verschwand gleich wieder. Die Limonade war selbst gemacht und ausgezeichnet.
Mr. Perry nickte. »Das war meine einzige echte Fähigkeit. Klettern. Sicher, ich verstand was von Motoren und technischen Geräten … deswegen habe ich mich ja letztlich im Winter, wenn es nichts zu klettern gab, für Demas um die Traktoren gekümmert. Aber was mich an der Antarktis gereizt hat, waren die Berge.«
»Sind Sie auf vielen gewesen?«
Wieder trat ein versonnener Ausdruck in Perrys blaue Augen. »McKinley Peak im Sommer 34 … natürlich nicht der Mount McKinley in Alaska, sondern der gleichnamige Berg in der Nähe des Südpols. Mehrere namenlose Hügel in der Haines-Kette – die Wissenschaftler haben sich dort für Moos und Flechten interessiert, und ich habe sie sicher auf einem Sims abgesetzt und bin schnell rauf zum Gipfel gestürmt, ehe ich ihnen wieder mit ihrer Ausrüstung helfen musste. Im gleichen Sommer habe ich den Mount Woodward in den Ford Ranges erklommen, dann Mount Rea, Mount Cooper und zuletzt Mount Saunders. Aus technischer Sicht keiner von ihnen besonders interessant. Viel Schnee- und Eisklettern. Jede Menge Gletscherspalten, Eisklippen und Lawinen. Jean-Claude hätte seine Freude daran gehabt.«
»Wer ist Jean-Claude?«, erkundigte ich mich. »Ein anderer Teilnehmer der Byrd-Expedition?«
Mr. Perrys ferner Blick wurde wieder scharf und richtete sich auf mich. »Nein, nein. Nur ein Kletterfreund von früher, ist schon sehr lange her. Hat jede Aufgabe geliebt, bei der es um Schnee, Eis, Gletscher oder Spalten ging. Ach ja, ich war auch auf dem Erebus und dem Terror.«
»Das sind ehemalige Vulkane.« Mit meiner Bemerkung wollte ich beweisen, dass ich in Sachen Südpol nicht völlig unwissend war. »Nach britischen Schiffen benannt, nicht wahr?«
Mr. Perry nickte. »James Clark Ross hat ihnen 1841 die Namen gegeben – er gilt als der Entdecker der Antarktis, obwohl er nie einen Fuß auf den Kontinent gesetzt hat. Die HMSErebus war sein Flaggschiff, während den Befehl über die HMS Terror sein Stellvertreter hatte, ein gewisser Francis Crozier.«
Ich schrieb alles mit, ohne zu wissen, ob mir das bei meinem potenziellen Buch über riesige, mutierte Killerpinguine, die Shackletons Hütte überfielen, weiterhelfen würde.
»Crozier war ein paar Jahre darauf ebenfalls stellvertretender Kommandant bei Sir John Franklins Expedition. Die Erebus und Terror sind nicht aus dem nördlichen Eis zurückgekehrt.« Abwesend setzte Mr. Perry hinzu: »Die britischen Eisbrecher natürlich, nicht die Vulkane. Die sind noch da.«
Ich blickte auf. »Sie sind gesunken? Die beiden Schiffe, nach denen die Vulkane benannt wurden, Erebus und Terror, sind einige Jahre später gesunken?«
»Schlimmer noch, Dan. Sie sind einfach verschwunden. Sir John Franklin, Francis Moira Crozier und ganze einhundertsiebenundzwanzig Mann, die die Nordwestpassage entdecken wollten. Irgendwo nördlich von Kanada haben sich die Schiffe und die Besatzung scheinbar in Luft aufgelöst. Inzwischen hat man hier und da auf öden Inseln einige Gräber und Knochen von den Seeleuten gefunden, aber die Schiffe und die Mehrheit der Mannschaft sind bis auf den heutigen Tag verschollen.«
Ich kritzelte wie besessen. Eigentlich hatte ich kein Interesse, über den Nordpol und die Expeditionen dorthin zu schreiben. Trotzdem, über hundert Menschen und zwei Schiffe, die einfach spurlos verschwunden waren? Ich fragte nach dem vollen Namen von Captain Crozier, und Mr. Perry buchstabierte ihn mir geduldig wie einem Kind.
»Jedenfalls«, schloss er dann, »da Admiral Byrd nicht besonders glücklich über meine Anwesenheit war – vermutlich habe ich ihn an die fast schon kriminelle Fahrlässigkeit erinnert, mit der er sich in seiner ach so gefeierten Eisstation um ein Haar vergiftet hätte und die andere Männer gezwungen hat, ihm unter Einsatz ihres Lebens den Allerwertesten zu retten –, beorderte er mich in meinem letzten Winter dort auf Kap Royds, um Pinguine zu beobachten. Von März bis Oktober 1935.«
»Pinguine, die bereits verschwunden waren.«
»Genau.« Lachend verschränkte Mr. Perry die Arme, und mir fielen neben der kräftigen Muskulatur mehrere bleiche Narben daran auf. Alte Narben. »Bevor es so richtig gottlos kalt wurde, konnte ich im Herbst immerhin jeden Tag den penetranten Guanogestank von den Brutkolonien genießen. Aber man gewöhnt sich sogar an schlechte Gerüche.«
»Das hat sich bestimmt wie eine schlimme Strafe angefühlt.« Mein Zorn über Admiral Byrds Gehässigkeit war noch nicht verraucht. »Also, nicht der Guano. Die Einsamkeit und die Gefangenschaft.«
Perry lächelte mich bloß an. »Ehrlich gesagt, war ich begeistert. Die Wintermonate auf Kap Royds gehören zu den wunderbarsten Zeiten, die ich erlebt habe. Dunkel und kalt, sicher … manchmal sogar sehr kalt, da Shackletons Hütte für einen Menschen allein nicht geheizt werden konnte. Durch tausend Ritzen kroch der Wind herein. Mit Leinwand und Shackletons alten Kisten habe ich mir eine kleine Kammer bei der Tür gebaut, wo ich mich ein bisschen wärmen konnte, auch wenn das Marderfell an der Öffnung meines Schlafsacks an manchen Morgen mit Frost bedeckt war. Trotzdem war es insgesamt eine wunderbare Erfahrung. Wirklich wunderbar.«
»Haben Sie in diesem Winter Berge bestiegen?« Sofort wurde mir klar, was für eine dumme Frage ich da gestellt hatte. Wer sollte denn im Dunkeln bei minus fünfzig Grad auf Bergen herumklettern?
Zu meiner Überraschung nickte er erneut. »Shackletons Männer sind 1908 auf den Mount Erebus gestiegen – zumindest bis zum Vulkanrand. Ich bin dreimal allein hochgegangen, auf verschiedenen Routen. Und die erste Winterbesteigung des Erebus hat nicht der Engländer Roger Mear 1985 geschafft, sondern ich war schon im Winter 35 zweimal auf diesem Gipfel. Steht natürlich in keinem Rekordbuch. Ich hab’s einfach nie jemandem erzählt, der es aufgeschrieben hätte.« Er verstummte.
Während sich das Schweigen in die Länge zog, beschlich mich erneut der Verdacht, dass mich dieser nette alte Herr nach Strich und Faden verkohlte.
Dann stand er auf und griff nach seinem alten Eispickel mit dem Holzschaft. »Erst vor ein paar Monaten, im Januar, hat ein Eisenarbeiter der McMurdo-Station, ein gewisser Charles Blackmer, in siebzehn Stunden eine Solobesteigung des Erebus geschafft und die alte Rekordmarke damit um viele Stunden unterboten.«
»Haben Sie bei Ihrer Besteigung des Bergs sechsundfünfzig Jahre davor auf die Zeit geachtet?«
Mr. Perry entblößte die Zähne. »Dreizehn Stunden und zehn Minuten. Aber für mich war es auch nicht das erste Mal.« Lachend schüttelte er den Kopf. »Das hilft Ihnen alles nicht bei Ihren Recherchen weiter, Dan. Was möchten Sie denn über die Erforschung des Südpols erfahren?«
Seufzend machte ich mir klar, wie schlecht vorbereitet ich als Interviewer war. (Und in mancher Hinsicht auch als Mensch.) »Was können Sie mir erzählen? Ich meine Dinge, die nicht in Büchern zu finden sind.«
Perry schabte über die weißen Stoppeln an seinem Kinn. »Also, wenn man auf die Sterne knapp über dem Horizont blickt … besonders wenn es wirklich kalt ist … dann flackern sie. Hüpfen nach links, nach rechts … und gleichzeitig nach oben und unten. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die eisigen Luftmassen über dem Land und dem gefrorenen Meer wie eine riesige Linse wirken, die sich bewegt …«
Eifrig notierte ich mit.
Mr. Perry gluckste. »Nützen Ihnen solche trivialen Details was für Ihren Roman?«
»Das weiß man nie.« Ich kritzelte noch immer.
Sechzehn Jahre danach sollten die über dem Horizont flackernden Sterne auf der zweiten Seite meines Romans Terror erscheinen, der sich nicht um die Antarktis drehte, sondern um das Debakel der Franklin-Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage.
Mr. Perry war schon lange vor der Veröffentlichung von Terror seinem Krebsleiden erlegen.
Später fand ich heraus, dass Mr. Perry neben seiner Zeit mit Admiral Byrd auch an mehreren berühmten Bergexpeditionen und verschiedenen Forschungsreisen nach Alaska und Südamerika teilgenommen hatte. Unser »Interview« an jenem Sommertag des Jahres 1991, das über weite Strecken ein bewegendes Gespräch über Reisen, Mut, Freundschaft, Leben, Tod und Schicksal war, dauerte ungefähr vier Stunden. Vier Stunden, in denen ich kein einziges Mal die richtige Frage stellte – eine Frage, durch die ich von seinen außergewöhnlichen Erlebnissen im Himalaja 1925 erfahren hätte.
Gegen Ende unserer langen Unterhaltung wurde Mr. Perry allmählich müde. Außerdem sprach er mit einem hörbaren Schnaufen. Als er merkte, dass mir das aufgefallen war, sagte er: »Letzten Winter haben sie mir ein Stück von einem Lungenflügel rausgeschnitten. Krebs.Auch der andere macht es wahrscheinlich nicht mehr lange, außerdem hat der Krebs sowieso schon überall gestreut, also wird es am Ende wahrscheinlich nicht die Lunge sein, die mir den Rest gibt.«
»Das tut mir leid.« Die Unzulänglichkeit meiner Worte war mir schmerzlich bewusst.
Mr. Perry zuckte die Schultern. »Wenn ich neunzig werde, kann ich doch von Glück sagen, Dan. Wie sehr, können Sie gar nicht ermessen.« Er lachte leise. »Das Gemeine ist, ich habe Lungenkrebs, obwohl ich nicht geraucht habe. Nie. Kein einziges Mal.«
Darauf fiel mir keine passende Erwiderung ein.
»Und eine weitere Ironie des Schicksals ist, dass ich nach Delta gezogen bin, um die Berge ganz in der Nähe zu haben«, fuhr Mr. Perry fort. »Und jetzt fange ich schon bei einem niedrigen Hügel an zu keuchen. Wenn ich bloß über eine Wiese am Ortsrand marschiere, fühle ich mich, als würde ich irgendwo über achttausendfünfhundert Meter herumkraxeln.«
Noch immer suchte ich vergeblich nach Worten – der Verlust eines Lungenflügels war sicher schrecklich. Und ich stand zu sehr auf der Leitung, um zu fragen, wann und wo er bis auf achttausendfünfhundert Meter geklettert war. Die Region über achttausend Meter heißt nicht ohne Grund Todeszone: jede Minute, die sich ein Bergsteiger in dieser Höhe aufhält, schwächt ihn, er hustet, keucht, ringt ständig nach Luft und kann sich nicht einmal mehr mit Schlafen erholen (was dort oben ohnehin fast unmöglich ist). Später überlegte ich mir, dass er diese Zahl vielleicht nur genannt hatte, um zu veranschaulichen, wie schwer ihm das Atmen inzwischen fiel. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er je in solche Sphären vorgedrungen war. Immerhin ist der Mount Vinson, der größte Berg der Antarktis, nur knapp fünftausend Meter hoch.
Ehe ich dazu kam, eine intelligente Frage zu stellen, hatte sich Mr. Perry vorgebeugt und klopfte mir auf die Schulter. »Ich beklage mich nicht. Mir gefällt einfach das Ironische daran. Wenn es in diesem erbärmlichen Universum einen Gott gibt, dann hat er einen ziemlich schrägen Humor.« Er legte eine Pause ein. »Sagen Sie, Sie sind doch ein Autor, der Bücher veröffentlicht hat.«
»Ja.« Möglicherweise klang ich ein wenig vorsichtig. Immerhin ist es gang und gäbe, dass Autoren von neuen Bekanntschaften darum gebeten werden, ihnen bei der Suche nach einem Agenten oder Verlag behilflich zu sein.
»Sie haben einen Literaturagenten und all das?«
»Ja?« Ich wurde noch reservierter. Nach den wenigen Stunden unseres Gesprächs empfand ich größte Bewunderung für diesen Mann, aber ein Amateurschriftsteller bleibt nun mal ein Amateurschriftsteller.
»Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, selbst etwas zu schreiben.«
Da hatten wir’s. Einerseits fand ich es bedauerlich, denn auf diese Worte liefen viel zu viele Unterhaltungen mit neuen Bekannten hinaus. Andererseits war ich auch erleichtert. Wenn er sein Buch noch gar nicht geschrieben hatte, war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass er es – neunzigjährig und sterbenskrank – noch beenden würde.
Mr. Perry las in meinem Gesicht und lachte laut heraus. »Keine Sorge, Dan. Ich werde Sie nicht bitten, mir bei der Veröffentlichung eines Buchs zu helfen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich es veröffentlichen will.«
»Was dann?«
Wieder strich er sich über Wange und Kinn. »Ich möchte etwas schreiben, und ich möchte, dass es jemand liest. Klingt das sinnvoll?«
»Ich denke schon. Das ist der Grund, warum ich schreibe.«
Fast ein wenig ungeduldig schüttelte er den Kopf. »Nein, Sie schreiben für ein riesiges Publikum, das Ihre Gedanken liest. Mir geht es nur um einen Leser. Einen Menschen, der es hoffentlich versteht. Und der es hoffentlich glaubt.«
»Jemand aus der Verwandtschaft vielleicht?«
Es fiel ihm sichtlich schwer, seine Bitte vorzutragen. »Die einzige mir bekannte Verwandte ist eine Urgroßnichte oder so irgendwo in der Gegend von Baltimore. Ich bin ihr nie begegnet. Das Heim hat ihre Adresse, damit sie meine Sachen hinschicken können, nachdem ich abgetreten bin. Nein, Dan, wenn ich es schaffe, das aufzuschreiben, brauche ich jemanden, der es auch versteht.«
»Ist es ein Roman?«
Er grinste. »Nein, auch wenn es sich so lesen wird. Allerdings vermutlich wie ein schlechter Roman.«
»Haben Sie schon damit angefangen?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe jahrzehntelang darauf gewartet … keine Ahnung, worauf eigentlich. Wahrscheinlich darauf, dass der Tod an meine Tür klopft, um mir einen Ansporn zu geben. Und jetzt hat er geklopft.«
»Wenn Sie mir etwas anvertrauen möchten, wäre es mir eine Ehre, es zu lesen, Mr. Perry.« Ich war selbst überrascht, dass mir diese Worte so von Herzen kamen. Normalerweise war ich gegenüber Amateurmanuskripten so misstrauisch, als wären sie mit Pestbakterien verseucht. Nicht aber in diesem Fall. Ich war einfach gespannt darauf, etwas von diesem Mann zu lesen, wobei ich annahm, dass sich der Text um Byrds Südpolexpedition in den Dreißigerjahren drehen würde.
Lange saß Jacob Perry reglos da und starrte mich an. Die blauen Augen schienen mich irgendwie zu berühren, als ob seine acht nervigen, narbigen Finger gegen meine Stirn drückten. Nicht unbedingt ein angenehmes Gefühl, doch auf jeden Fall nah.
»In Ordnung.« Sein Blick löste sich von mir. »Wenn ich es je aufschreibe, lass ich es Ihnen zukommen.«
Meine Visitenkarte mit der Adresse und anderen Informationen hatte ich ihm schon gegeben.
»Allerdings gibt es ein Problem«, sagte er.
»Ja?«
Er hob die beiden Hände, die so geschickt waren, obwohl der linken die letzten beiden Finger fehlten. »Im Tippen bin ich eine Null.«
Ich lachte. »Wenn Sie einem Verlag ein Manuskript vorlegen, findet sich bestimmt jemand, der das für Sie abtippt. Oder ich mache es selbst. Und fürs Erste …« Aus meiner abgenutzten Aktentasche zog ich ein Moleskine-Notizbuch, dessen zweihundertvierzig cremeweiße Seiten noch unberührt waren. Es hatte einen weichen Ledereinband mit einer Doppelschlaufe, in der ein gespitzter Bleistift steckte.
Mr. Perry fasste das Leder an. »Das ist viel zu kostbar …« Er traf Anstalten, es mir zurückzugeben.
Seine Bescheidenheit berührte mich, und ich drückte ihm das in Leder geschlagene Notizbuch wieder in die Hand. »Das ist ein kleines Dankeschön für die Zeit, die Sie sich genommen haben.« Noch immer brachte ich es nicht fertig, ihn Jake zu nennen. »Wirklich, ich möchte es Ihnen schenken. Und wenn Sie etwas schreiben, das Sie mir anvertrauen wollen, freue ich mich darauf, es zu lesen. Ich verspreche Ihnen ein ehrliches Urteil.«
Während er das Buch in seinen knorrigen Händen hin- und herdrehte, huschte ein Lächeln über Mr. Perrys Lippen. »Wahrscheinlich bin ich schon tot, wenn Sie das Buch … oder die Bücher … kriegen, Dan. Dann müssen Sie bei Ihrer Kritik kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie wird mich bestimmt nicht mehr kränken.«
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte.
Das Gespräch mit Jacob Perry fand im Juli 1991 statt und liegt nun, da ich dieses Vorwort schreibe, genau zwanzig Jahre zurück.
Ende Mai 1992 teilte uns Mary telefonisch mit, dass Mr. Perry im Krankenhaus von Delta verstorben war. Der Krebs hatte ihn besiegt.
Auf meine Frage, ob mir Mr. Perry etwas hinterlassen hatte, zeigte sich Mary überrascht. All seine Habseligkeiten – Bücher, Erinnerungsstücke – waren verpackt und an seine Urgroßnichte in Baltimore gesandt worden. Mary war zur fraglichen Zeit nicht in Delta gewesen und hatte ihre Assistentin beauftragt, diese Angelegenheit zu regeln.
Vor neun Wochen nun, im späten Frühjahr 2011, erhielt ich ein UPS-Paket von einem gewissen Richard A. Durbage Jr. aus Lutherville-Timonium in Maryland. In der Annahme, dass es sich um ein Konvolut mit alten Büchern von mir handelte, die mir jemand zum Signieren geschickt hatte – eine Verhaltensweise, die ich wirklich ärgerlich finde, wenn der betreffende Leser vorher nicht angefragt hat –, war ich einen Augenblick versucht, das Paket ungeöffnet an den Absender zurückgehen zu lassen. Dann griff ich nach einem Kartonmesser, um es mit mehr als der nötigen Energie aufzuschlitzen. Nach einem Blick auf die Adresse brachte mich Karen mit der Anmerkung zum Lachen, dass wir aus Lutherville-Timonium noch nie Bücher zum Signieren bekommen hatten, und sah sofort im Internet nach, wo das lag. (Karen hat eine Leidenschaft für Geografie.)
Doch es waren keine alten Bücher zum Signieren.
In dem Paket lagen zwölf Notizbücher. Ich blätterte sie kurz durch und stellte fest, dass jede Seite mit einer präzisen, kleinen Handschrift gefüllt war, deren energische schräge Linien offenbar von einem Mann stammten.
Erst als ich auf das letzte Buch ganz unten stieß, fiel mir Mr. Perry ein.
Es war in den Ledereinband geschlagen, in dessen Schlaufe noch der Stummel eines Bleistifts steckte. Das Leder war inzwischen abgewetzt und fleckig von der häufigen Berührung durch Mr. Perrys Hände. Offenbar hatte er den Ledereinband für jedes Notizbuch verwendet, in dem er einen Teil seiner langen Geschichte festhielt.
Bei den Bänden lag eine getippte Mitteilung:
Sehr geehrter Mr. Simmons,
vor einigen Tagen ist meine Mutter, Lydia Durbage, im Alter von 71 Jahren verstorben. Beim Durchsehen ihrer Sachen fand ich diesen Karton. Sie hatte ihn 1992 von einem Pflegeheim in Delta erhalten, wo Mr. Jacob Perry, ein entfernter Verwandter von ihr, die letzten Jahre bis zu seinem Tod verbrachte. Da sie ihren Urgroßonkel nicht persönlich kannte, warf meine Mutter offenbar nur einen flüchtigen Blick auf den Inhalt der Schachtel, nahm das eine oder andere heraus, um es bei ihrem wöchentlichen Garagenflohmarkt zu verkaufen, und ließ alles andere unberührt. Ich glaube nicht, dass sie die Bücher in dem Karton jemals aufgeschlagen hat.
Auf der ersten Seite des obersten Bandes befand sich ein Zettel mit der Bitte an eine gewisse Mary, die Leiterin der betreuten Wohneinrichtung, die Notizbücher und eine sogenannte »Vest Pocket Kodak« an Sie zu schicken. Dort wurde auch die Adresse genannt, an die ich dieses Paket nun schicke.
Falls Sie vor zwanzig Jahren mit dem Empfang dieser Dinge gerechnet hatten, entschuldige ich mich für die große Verspätung. Meine Mutter war schon in mittleren Jahren sehr zerstreut.
Da die Notizbücher für Sie bestimmt sind, habe ich sie selbstverständlich nicht gelesen. Beim schnellen Durchblättern ist mir allerdings aufgefallen, dass der Verwandte meiner Mutter ein vollendeter Künstler war. Die Karten, Bergzeichnungen und anderen Skizzen sind offenkundig von professioneller Qualität.
Noch einmal möchte ich mich für die Nachlässigkeit meiner Mutter entschuldigen, die dazu geführt hat, dass Sie dieses Paket viel später erhalten, als es sich Mr. Jacob Perry wohl erhofft hat.
Mit besten Grüßen
Richard A. Durbage Jr.
In meinem Arbeitszimmer nahm ich den Stapel Notizbücher aus der Schachtel und machte mich daran, sie zu lesen. Ich las vom Nachmittag an die ganze Nacht durch ohne Unterbrechung und wurde am nächsten Tag um neun Uhr früh fertig.
Nach wochenlangem Grübeln habe ich beschlossen, Jacob Perrys Manuskript in zwei Ausgaben zu veröffentlichen. Ich gehe davon aus, dass das letztlich seinen Wünschen entspricht, nachdem er zehn Monate lang an der Niederschrift gearbeitet hat. Vermutlich ist das auch der Grund, weshalb er mich als seinen ersten Leser ausgesucht hat. Ich sollte beurteilen, ob es sich lohnt, das Manuskript in Buchform erscheinen zu lassen. Und tatsächlich ist es meine ehrliche Auffassung, dass Jacob Perrys Aufzeichnungen eine Veröffentlichung verdienen.
Eine streng limitierte Ausgabe wird Mr. Perrys Handschrift zeigen und sämtliche Skizzen, Porträtzeichnungen, sorgfältig gestaltete Karten, Berglandschaften und alte Fotografien enthalten, die der Autor beigelegt hat. Die andere Ausgabe wird nur den Text umfassen. Dieser erzählt die Geschichte, die Jacob Perry (1902–1992) am Herzen lag. Die Geschichte, die ich hören sollte – und die wir hören sollten. Als sein Herausgeber habe ich lediglich einige Rechtschreibkorrekturen vorgenommen und ganz selten Erklärungen eingefügt. Als sein erster Leser und Herausgeber vertraue ich darauf, dass Mr. Perry verstanden hat, wie sehr es mich drängen wird, anderen die Möglichkeit zu geben, sein sonderbares, ergreifendes Testament kennenzulernen.
Ich bin überzeugt davon, dass das seinen Wünschen entspricht.
Zumindest hoffe ich es.
Erster Teil – DIE KLETTERER
Der Gipfel des Matterhorns bietet eine klare Wahl: ein falscher Schritt nach links, und man stirbt in Italien; ein falscher Schritt nach rechts, und man stirbt in der Schweiz.
Wir erfahren von Mallorys und Irvines Verschwinden am Mount Everest, während wir auf dem Gipfel des Matterhorns zu Mittag essen.
Es ist ein herrlicher Tag Ende Juni 1924, und die Neuigkeit steht in einer drei Tage alten englischen Zeitung, in die jemand aus der Küche des kleinen Gasthofs im italienischen Breuil unsere dicken, frischen Brotscheiben mit kaltem Rinderbraten und Meerrettich gewickelt hat. Ahnungslos habe ich diese Nachricht – die nun wie ein schwerer Stein auf unseren Herzen lastet – in meinem Rucksack hinauf zum Matterhorn getragen, neben dem Weinschlauch aus Ziegenleder, zwei Wasserflaschen, drei Orangen, dreißig Metern Kletterseil und einer dicken Salami. Es dauert einige Zeit, ehe wir die Zeitung bemerken und die Meldung lesen, die uns den Tag verderben wird. Zu sehr sind wir erfüllt vom Erreichen des Gipfels und dem Ausblick, der sich uns darbietet.
Sechs Tage lang sind wir auf dem Matterhorn herumgeklettert, ohne den Gipfel anzusteuern. Warum, weiß nur der Diakon.
Am ersten Tag nach dem Aufstieg von Zermatt erforschten wir den Hörnligrat – Whympers Route im Jahr 1865 –, vermieden dabei jedoch die Fixseile, die sich wie Narben über die Bergflanke ziehen. Am nächsten Tag gelangten wir über eine Traverse auf den Zmuttgrat. Der dritte Tag wurde uns sehr lang. Von der Schweizer Seite über den Hörnligrat kommend, querten wir die bröckelige Nordwand knapp unter dem Gipfel, den uns der Diakon verboten hatte, und stiegen dann auf dem italienischen Kamm ab, ehe wir – bereits im Dämmerlicht – unsere Zelte auf den hohen grünen Almen erreichten, die nach Süden Richtung Breuil blicken.
Nach dem fünften Tag wurde mir klar, dass wir den Spuren unserer berühmten Vorgänger am Matterhorn folgten – der Gruppe um den entschlossenen fünfundzwanzigjährigen Bergsteiger und Künstler Edward Whymper, zu der außer ihm noch drei weitere Briten zählten: Reverend Charles Hudson (»der Geistliche von der Krim«), Reverend Hudsons neunzehnjähriger Schützling und Kletteranfänger Douglas Hadow und der selbstbewusste achtzehnjährige Lord Francis Douglas (der gerade bei der Musterung der britischen Armee den nächstbesten seiner hundertachtzehn Konkurrenten um fünfhundert Punkte übertroffen hatte), Sohn des achten Marquess von Queensberry und seit zwei Jahren eifriger Alpenkletterer. Zu Whympers bunter Schar von jungen Bergsteigern, deren Erfahrung und Können nicht unterschiedlicher hätte sein können, gehörten darüber hinaus drei von Whymper angeworbene Führer: Der »alte« Peter Taugwalder (trotz seines Spitznamens erst fünfundvierzig), der »junge« Peter Taugwalder (einundzwanzig) und der höchst kompetente, fünfunddreißigjährige Michel Croz aus Chamonix. Eigentlich hätte Letzterer als Führer genügt, doch Whymper hatte den Taugwalders schon früher Arbeit versprochen und stand zu seinem Wort, obwohl seine Klettergruppe damit unnötig groß und schwerfällig wurde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!