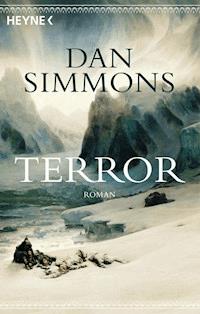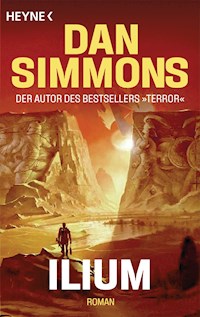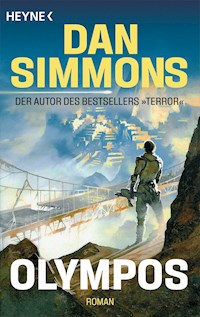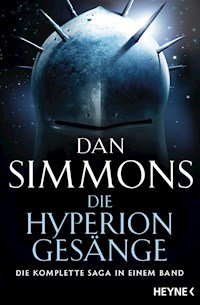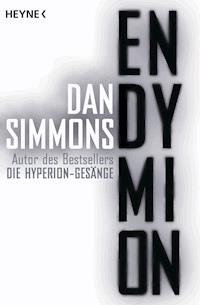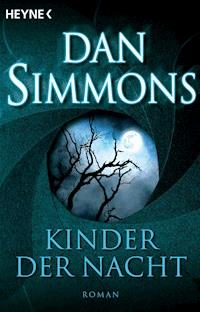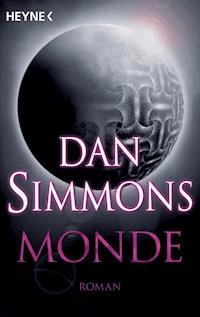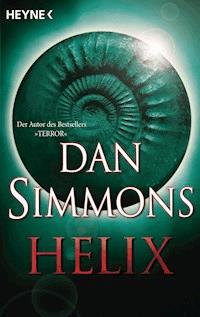
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dan Simmons erschafft die fantastischen Mythen unserer Zeit
Mit „Helix“ legt Dan Simmons, der Autor des Bestsellers „Terror“, fünf preisgekrönte Erzählungen vor, die zum Besten gehören, was die SF in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Darunter eine Rückkehr in das Universum von „Die Hyperion-Gesänge“ und jene Geschichte, die den Grundstein für sein Zukunftsepos „Ilium“ legte. Diese Geschichten werden Sie nicht mehr loslassen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DAN SIMMONS
HELIX
Erzählungen
DAS BUCH
Mit seinen internationalen Bestsellern »Terror« und »Die Hyperion-Gesänge« hat Dan Simmons eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es ihm wie kaum einem anderen Schriftsteller gelingt, historische und phantastische Stoffe zu gewaltigen Epen zu formen. Auch in den in diesem Band gesammelten Erzählungen wird diese Kunst deutlich: Die Geschichte eines Mannes, der wortwörtlich in die bizarre Phantasiewelt eines jungen Mädchens gerät; die Geschichte einer Raumschiffbesatzung, die in den Tiefen des Alls auf Schmetterlinge stößt; die Geschichte der Menschen des Jahres 3001, die auf ihre letzte Reise warten; die Geschichte dreier irdischer und eines außerirdischen Bergsteigers, die gemeinsam den K2 erklimmen; die Geschichte des Astronauten, der die Wahrheit über das russische Raumfahrtprogramm erfährt …
Fünf preisgekrönte Erzählungen von einem der bedeutendsten Autoren der Gegenwart – in denen Dan Simmons unter anderem in das Universum von »Die Hyperion-Gesänge« zurückkehrt und die Grundlage für seine Zukunftssaga »Ilium« legt.
DER AUTOR
Dan Simmons wurde 1948 in Illinois geboren. Er schrieb bereits als Kind Erzählungen, die er seinen Mitschülern vorlas. Nach einigen Jahren als Englischlehrer machte er sich 1987 als freier Schriftsteller selbstständig. Sein zuletzt erschienener Roman »Terror« über die legendäre Polarexpedition John Franklins stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Simmons lebt mit seiner Familie in Colorado, am Rande der Rocky Mountains.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe
WORLDS ENOUGH & TIME
Deutsche Übersetzung von Jürgen Langowski
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe 6/08 Copyright © 2002 by Dan Simmons Copyright © 2008 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-19230-3 V003
www.heyne.de
www.penguinrandomhouse.de
EINLEITUNG
»Ganzheit; alles andere ist Öde und Trostlosigkeit.«
Mit diesem Satz beginnt und endet »Daniel Martin« von John Fowles. Es ist einer meiner Lieblingsromane, den ich freilich vier- oder fünfmal lesen musste, ehe ich die volle Bedeutung dieses Satzes erfassen konnte – nicht nur in Bezug auf den Roman selbst, sondern auch als cri de cœur, der als Mahnung an alle Schriftsteller und Künstler aus dem Herzen der Kunst selbst zu kommen schien. In der vorletzten Szene von »Daniel Martin« wird der Titelheld mit diesem Befehl konfrontiert, als er den Blick des alten Rembrandt sieht. Kompromisslos brennt auf einem der letzten Selbstporträts des Meisters die Kraft in den betagten Augen. Auch mich hat der Anblick eines Selbstbildnisses von Rembrandt wie ein Hammerschlag getroffen, und auch ich bin der Ansicht, dass hier sowohl die letzte Frage als auch die letzte Antwort zur schöpferischen Suche des Künstlers festgehalten sind.
Eigentlich schätze ich es nicht, wenn man mich durch Einführungen darauf vorbereiten will, ein besseres Verständnis für ein fiktives Werk zu bekommen. Ich lese Einleitungen zwar ganz gern, bin aber gleichzeitig auf der Hut. Für viel zu viele gilt das, was John Keats über schlechte Dichtung sagte: »Man spürt die Absicht uns gegenüber – und wenn wir dem Verfasser nicht beipflichten, schiebt er die Hände in die Hosentaschen.« Als Autor bin ich der Ansicht, dass eine Erzählung – wie die Kunst ganz allgemein – für sich stehen und nur für sich selbst genommen beurteilt werden sollte. Man sollte sie nicht mit hohlem Wortgeklingel retuschieren oder rechtfertigen müssen.
Und doch …
Da ich Leser und Autor zugleich bin, gefällt es mir, wenn die Geschichten meiner Lieblingsautoren durch Einleitungen in einen Kontext gestellt werden. Mein Freund Harlan Ellison sagte einmal: »Alle raten mir, eine Autobiografie zu schreiben. Ich antworte ihnen: ›Ich habe sie in jeder Geschichte, die ich veröffentliche, in Stückchen und Bröckchen in den Einleitungen, längst geschrieben.‹« Ich verspüre zwar nicht den Drang, eine Autobiografie zu schreiben, aber ich muss gestehen, dass ich Harlans mitreißende, aufschlussreiche Einführungen liebe, ja dass ich mich an einige dieser Texte sogar noch erinnern konnte, als ich die Einzelheiten der Geschichten, zu denen sie gehörten, längst vergessen hatte.
Im Gegensatz zu Performance-Künstlern, die ihr Publikum überall finden – etwa in den Benutzern eines Aufzugs oder den Gästen eines Restaurants –, trete ich in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung und habe auch nicht die Absicht, daran etwas zu ändern. In einer Zeit, in der die Privatsphäre missachtet wird und alle an rückhaltlosen Enthüllungen interessiert sind, wirke ich mit meinem Beharren auf Zurückgezogenheit altmodisch. Nein, ich bin damit altmodisch. »Sagen Sie nichts, ich werde auch nicht fragen« – das könnte meine Haltung zu einem großen Teil der Welt beschreiben, die vieles viel zu schnell offenbart.
Doch als Romanautor, der ab und an auch Kurzgeschichten veröffentlicht, habe ich die Mauern meiner Privatsphäre längst bewusst niedergerissen. »Schriftsteller treiben ihre Dämonen selbst aus«, sagte Mario Vargas Llosa einmal, und das Gegenstück zu dieser Maxime ist Henry James’ Bemerkung, die Gegenwart des Autors sei wahrnehmbar »auf allen Seiten all seiner Bücher, aus denen er sich so eifrig zu tilgen suchte«.
So ist vielleicht das Herstellen eines Kontextes die einzige Rechtfertigung für Einführungen, wie sie in dieser Sammlung erscheinen. Womöglich sind Einleitungen aber auch einfach nur ein Ausdruck guter Manieren, so wie man »Hallo« zu anderen Wanderern sagt, denen man hier in den Rocky Mountains, wo ich lebe, begegnet. Wenn man es richtig macht, beeinträchtigt der Gruß nicht die Landschaft und die Einsamkeit, welche die wahren Gründe sind, um hier zu wandern – und wenn man es richtig macht, stört eine Einführung den Leser auch nicht beim Lesen der Geschichte.
Die fünf Erzählungen in diesem Band sind in einer Zeit entstanden, in der der Autor deutliche, aber nicht unbedingt äußerlich sichtbare Veränderungen durchgemacht hat. Man möchte an Dante denken, der in der »Göttlichen Komödie« den Abschnitt über die Hölle folgendermaßen beginnen lässt:
Auf halbem Weg des Menschenlebens fand
Ich mich in einen finstern Wald verschlagen,
Weil ich vom rechten Weg mich abgewandt.
Wie schwer ist’s doch, von diesem Wald zu sagen,
Wie wild, rau, dicht er war, voll Angst und Not;
Schon der Gedank erneuert noch mein Zagen.
Nur wenig bitterer ist selbst der Tod;
Doch um vom Heil, das ich drin fand, zu künden,
Sag ich, was sonst sich dort den Blicken bot.
Man könnte das für melodramatisch halten und die Ansicht vertreten, dass nicht sehr vielen Menschen eine Führung in und durch den neunten Kreis der Hölle angeboten wird – aber genau dort landen natürlich die meisten früher oder später. Viele – wenn auch nicht alle – haben das Glück, an Satans behaarten Schienbeinen hinunterklettern zu können (oder hinauf, weil er im eisigen neunten Kreis kopfüber begraben liegt), um wieder herauszukommen, und wenn sie auf dem Weg nach oben schon nicht durchs Fegefeuer ins Paradies gelangen, so doch wenigstens ins Licht eines gewöhnlichen Arbeitstages.
Ich hätte da einen Vorschlag. Falls Sie sich einmal in dichtem Gehölz wiederfinden, an einem Ort, an dem die einfachsten Dinge schiefgehen (was heißt, Ihr ganzes Leben gerät aus den Fugen), dann empfehle ich Ihnen, genügend Geld für ein paar Monate Therapie zusammenzukratzen. Wenn Sie das Geld dann haben, pfeifen Sie auf die Therapie und fliegen stattdessen zur Insel Maui. Fahren Sie zur fast unbewohnten Nordostküste und mieten Sie in der Nähe des Dorfes Hana (800 Einwohner) ein kleines hale. Wenn Sie dort sind, essen Sie hauptsächlich Reis und Gemüse, schlafen mit dem Rauschen der Brandung ein und erwachen vor der Morgendämmerung davon, dass der »weiße Regen von Hana« aufs Blechdach trommelt. Sie wandern viel, zeichnen ein bisschen, schreiben ein wenig (falls Ihnen das liegt) und hören Musik, soweit es Ihre Stimmung erlaubt. Der Waianapanapa State Park in der Nähe von Hana ist ein großartiger Ausgangspunkt für Wanderungen an der Küste – entweder nach Süden in Richtung Hana Town oder, noch interessanter, einige Meilen nach Norden bis zum kleinen Flugplatz von Hana. Wenn Sie sich vom Dorf entfernen, sollten Sie aber vorsichtig sein, denn der alte hawaiische »befestigte Wanderweg«, der am kahlen, vulkanischen Strand verläuft, ist keineswegs befestigt und stellenweise nicht einmal mehr als Weg zu erkennen. Der Wanderer muss über Blaslöcher springen und sich unter hohen Klippen an der donnernden Brandung im Geröll seinen Weg suchen. Ich übertreibe nicht, es ist wirklich eine bezaubernde Gegend – wunderschön mit dem milden Regen und den darauf folgenden Regenbogen, die sich über die grünen Hänge von Haleakala spannen. Sie werden garantiert auf andere Gedanken kommen.
Fünf Tage sollten reichen, eine Woche wäre noch besser.
Die längeren Geschichten, die Sie in dieser Sammlung finden, müsste man wahrscheinlich als Novellen bezeichnen, aber mir war nie so recht klar, von welchem Umfang an diese Bezeichnung gilt, deshalb nenne ich sie einfach »längere Geschichten«. Es gibt keine übergreifende Architektur, wohl aber einige gemeinsame Themen, die immer wieder auftauchen.
Wenn Autoren über ihre Themen reden, werden sie oft anmaßend. Ich will mich also lieber jetzt schon entschuldigen, falls die folgenden Kommentare diesen Eindruck erwecken sollten. Früher oder später muss freilich jeder mal über sein Handwerk reden – und wenigstens seinen Ehrgeiz beschreiben, ohne deshalb unbedingt über vollbrachte Leistungen zu schwadronieren.
Im Idealfall sollten die hier versammelten Geschichten (genau wie meine Romane) den Gedanken des niwa verwirklichen, was die Elemente des fukinsei, kanso, koko, datsuzoku, seijaku und shibui einschließt. All diese Elemente müssten durch die Resonanz von wabi und sabi verstärkt werden. Das scheint nicht immer der Fall zu sein, aber ich betrachte es zumindest als mein Ziel.
Vor einigen Jahren bin ich mit einem Freund nach Japan und in andere Regionen Asiens gereist. Angeblich, um für einen Roman zu recherchieren (die Recherchen ergaben schließlich, dass ich den Roman besser nicht schreiben sollte), in Wahrheit aber, um Zen-Gärten zu besuchen.
Das japanische Wort für Garten lautet niwa, doch es bedeutet auch »reiner Ort«. Wie beim Betrachten von Kunstwerken ist ein gewisses Maß an Vorbildung notwendig, wenn man einen Zen-Garten oder einen Moosgarten oder irgendeinen anderen japanischen Garten in sich aufnehmen möchte. Etwas sehr Einfaches kann viel mehr bedeuten, als man auf den ersten Blick zu erkennen vermag: Geharkter Kies könnte das Meer symbolisieren, ein Stein eine Insel mit Millionen Einwohnern, ein einfacher Strauch alle Wälder.
In diesen Gärten und, wie ich glaube, in zunehmendem Maße auch in meinen fiktiven Werken wirkt als steuerndes Element das fukinsei – die Ansicht, dass jenes Prinzip, welches das Gleichgewicht einer Komposition bestimmt, stets asymmetrisch sein sollte. Ein wenig bekannter Aspekt der Ästhetik scheint der zu sein, dass alle Menschen, ob sie es nun wissen oder nicht, bei Blumengebinden, bei der Zusammenstellung von Fliesen für eine Wohnung, in der Architektur, in der Kunst und in der Fiktion entweder Symmetrie oder Asymmetrie bevorzugen. Menschen aus westlichen Kulturen neigen zur Symmetrie, die manchmal sogar sehr rigide sein kann; die Elemente eines japanischen Gartens sind, der fernöstlichen Ästhetik entsprechend, eher asymmetrisch angeordnet. Auch ich glaube, dass das Leben nicht ganz so symmetrisch ist, wie wir es gerne hätten.
Nachdem ich fast zwei Jahrzehnte lang in diesem Beruf tätig bin, stelle ich fest, dass meine Arbeiten nun wieder Themen wie Liebe und Verlust aufgreifen, während die handwerkliche Seite mehr und mehr zu einer Suche nach kanso (Einfachheit) gerät. Der Bruder koko, der freilich kein Zwillingsbruder ist, lässt mich nach Strenge und Reife streben. So kehre ich zum Wesentlichen zurück und ehre, was ehrenswert ist. Was den Stil angeht, lese ich zwar gern Michael Oondatje oder lyrische Prosa nach Art von Nabokov, doch würde ich für mich, wie der Gärtner in Nara, eher shizen wählen – die Natürlichkeit, die durch bewussten Verzicht auf jede Verstellung entsteht. Manchmal kann man diese Schlichtheit erreichen, wenn man seijaku findet – man entscheidet sich für das Schweigen statt für den Lärm, für die Ruhe anstelle von Aufregung.
Manchmal aber auch nicht.
Shibui, wabi und sabi sind komplexe Ideen, die ich als Ziele weder in mein Leben noch in meine Erzählungen zu übertragen vermochte. Andererseits kann ich mich ihnen aber auch nicht völlig verschließen, und so tauchen sie häufig als eine Art von Besessenheit in meinen Werken auf. Wabi dreht sich um die dem Zen gemäße Einsicht, dass zusammen mit der Blüte auch das Vergessen einsetzt. Der Zen-Garten Ryoanzi wird dreimal täglich geharkt, um die von den Bäumen fallenden Blütenblätter vom Boden zu entfernen, doch die Vollkommenheit des mit Stein und Kies gestalteten Gartens findet sich gerade in jenen lästigen Blättern, gerade in jenen willkürlichen, aber unausweichlichen Begegnungen mit der sterbenden Schönheit, die mit der Harke beseitigt wird. Es erinnert uns daran, dass uns etwas Unersetzliches geraubt wird, noch während wir das Leben und die Schönheit preisen. Sabi ist die Entdeckung der Schönheit in der Patina der Zeit, in den Flechten auf dem Stein, im verwitterten umgestürzten Baum, und gemahnt uns daran, dass die Zeit milde mit den Dingen, aber unermesslich grausam mit uns Menschen umgeht. In unserer Lebensspanne mögen wir viele Welten sehen, doch wir haben nicht genügend Raum, um sie auch alle zu erleben. Zeit ist das einzige Geschenk, das uns alles nimmt – uns jeden Menschen raubt, den wir lieben –, wenn wir es im Übermaß bekommen. Die Erkenntnis, ja vielleicht sogar die Würdigung des sabi – jenes ersten Anflugs von Vergessen, der schon kommt, wenn wir noch die Menschen und Dinge festhalten, die wir lieben – ist ein wichtiger Aspekt in mehreren Geschichten dieser Sammlung.
Manch einer von uns ist womöglich auch auf das Wort shibui gestoßen, auf diesen fast unübersetzbaren Begriff, der einerseits den guten Geschmack meint, andererseits und im wörtlichen Sinne aber auch die bittere Schärfe bezeichnet, die man schmeckt, wenn man in eine unreife Dattelpflaume beißt. Dies entspricht meiner eigenen Erfahrung mit der Natur – ich preise ihre Schönheit und Vielfalt und versuche, dem Drang zu widerstehen, allzu sentimental zu werden. Meiner Ansicht nach leben wir in einem Zeitalter, das nicht nur von überzogener Sentimentalität, sondern auch von einer infantilen Unreife geprägt ist. Wir wollen nicht anerkennen, dass es Dinge gibt, die ihrem Wesen nach weder süß noch wohltuend sind, oder dass es hier und da auch mal einen sauren Geschmack geben darf, der die Reinheit des Kerns umso süßer erscheinen lässt. Meine mädchenhafte Prophetin Kelly Dahl versucht, ihrem früheren Lehrer diese Schärfe zu vermitteln, und es ist vielleicht auch ein Teil der nicht ausformulierten Botschaft, die von Kanakaredes und seinen Krippenbrüdern zur Erde gebracht wird. Ich weiß, dass es die zentrale Botschaft Aeneas ist, der widerwilligen Erlöserin, die in »Die verlorenen Kinder der Helix« das Universum der Menschen prägt.
Yugen erfordert großes Einfühlungsvermögen und baut eher auf Andeutung als auf Offensichtlichkeit. Wenn man das mit dem Prinzip des datsuzoku verknüpft – einer Weltfremdheit, die nichts mit Exzentrizität zu tun hat, sondern mit einer Transzendierung des Konventionellen auf eine Weise, die über den Horizont jedes konformistischen Rebellen weit hinausgeht –, dann entsteht in einem fiktiven Text ein Element von Fremdartigkeit, das nach Ansicht des Kritikers Harold Bloom ein Wesensmerkmal aller die Zeiten überdauernden Literatur ist, sei es nun Shakespeare, Jane Austen oder John Fowles.
Begleiten Sie mich also in den Zen-Garten. Wir werden das Feuer in Gestalt eines Steins oder einer eisernen Laterne sehen. Die Erde in Gestalt eines Steins. Wasser, Luft, Pflanzen und Tiere in ihrer wahren Gestalt. Wasser wird stets vorhanden sein, sei es nur angedeutet oder in einer eleganten Kaskade von Regentropfen, die eine Kette von Wasserfällen herunterstürzen.
Der Weg durch den Garten, der roji, ist eher Philosophie als Stein. Jeder Schritt soll den Besucher vom Spiegel der vergänglichen Welt losreißen und deren Gegenteil näher bringen. Die Steine des roji sind absichtlich in ungleichen Abständen gelegt, wie es dem Prinzip des fukinsei entspricht – damit der Blick auf den Boden gerichtet bleibt und nichts für gegeben genommen wird. Es gibt größere Steine, auf die man sich stellen kann, um einen Überblick zu gewinnen. Dort kann der Besucher auch innehalten und über das meditieren, was er gesehen oder übersehen hat.
Wenn wir einen Zen-Garten in seiner Ganzheit erfassen wollen, brauchen wir auch ein Gefühl für yugen – das ist die Vorliebe des Zen-Gärtners für halb verborgene Dinge, für Bereiche, die absichtlich unklar angelegt sind, für die Regionen, wo es Schatten gibt. Und wir brauchen auch ein Auge für die Ganzheit, die in gebrochenen Reflexionen im Wasser aufscheint, ein Gespür für die Schönheit der nur verschwommen enthüllten Formen und Bedeutungsebenen. Eine ähnliche Freude findet man in den Schatten des Mondes, der sich in einem Teich spiegelt, im Stein, in Mustern im Sand, in Symbolen, in den zarten Schatten des Bambus, der dicht im Mondlicht steht.
»Ganzheit; alles andere ist Öde und Trostlosigkeit.«
AUF DER SUCHE NACH KELLY DAHL
Dies ist eine Geschichte über Liebe, Verlust, Betrug, Besessenheit und die Ängste im mittleren Lebensabschnitt – es ist, mit anderen Worten, eine ganz normale romantische Komödie.
»Auf der Suche nach Kelly Dahl« erschien zuerst bei OMNI-Online und wurde dann in High Fantastic abgedruckt, einer von Steve Rasnic Tem herausgegebenen Hardcover-Anthologie, in der alle in Colorado lebenden Autoren phantastischer Literatur Berücksichtigung fanden. Allerdings wurde die Geschichte für keinen dieser Märkte geschrieben; sie ist ohne konkreten Auftrag entstanden.
Eine eigenartige Reaktion auf diese Geschichte, der ich immer wieder begegnet bin, ist: »Gibt es wirklich eine Kelly Dahl?«
Nun, in gewisser Weise schon. Kelly Dahl ist der Name eines Campingplatzes am Peak to Peak Highway in Colorado, südlich von Nederland und nördlich der alten Bergbaustädte Blackhawk und Central City, die heute vom Glücksspiel leben.
Vor einigen Jahren habe ich mich im Wald in der Nähe von Kelly Dahl verlaufen. Ich bin ziemlich sicher, dass es das einzige Mal war, dass ich mich im Wald oder in den Bergen verirrt habe. Es war dumm, weil ich mich nur etwa eine Viertelmeile vom Campingplatz entfernt hatte, um von einem Höhenzug aus den Sonnenuntergang zu betrachten. Normalerweise kampiere ich weit entfernt von solchen Orten, weiche mit meinem Rucksack den Menschenansammlungen aus. Als ich auf dem Rückweg eine Abkürzung zum Campingplatz nehmen wollte, lief ich mehrere Stunden in einem stockdunklen Kiefernwald herum. Ich hasse diese Kiefernwälder. Die Bäume werfen die unteren Äste ab, bis nur noch die Baumwipfel lebende Nadeln haben und das Sonnenlicht einfangen. Das Ergebnis ist ein Wald aus Telegrafenmasten, die so dicht zusammenstehen, dass man kaum einen Weg hindurch findet – während das Dach droben den Himmel verdeckt. Sogar jemand mit einem einigermaßen guten Orientierungssinn wie ich kann sich verirren, wenn er sich durch die mit Kiefern bewachsenen Hügel einen Weg sucht.
Jedenfalls sage ich mir das.
Wie auch immer, nachdem ich mich etwa neunzig Minuten lang durch Unterholz und Drehkiefern gearbeitet hatte, fand ich eine Straße. Es war allerdings nicht der Peak to Peak Highway, die einzige Straße, die auf der Kontinentalscheide von Nord nach Süd verläuft. Es war stockdunkel, aber ich konnte mich nun wieder orientieren: Wenn ich dieser Zufahrtsstraße bergauf folgte, musste ich theoretisch irgendwann den Peak to Peak Highway erreichen. Ich beschloss, bei einem Bauernhaus anzuklopfen – dem einzigen Haus an dieser Straße – und zu fragen, ob der Kelly-Dahl-Campingplatz nördlich oder südlich der vermuteten Kreuzung mit dem Highway zu finden sei.
Es war ein Bumpus-Haus (wenn Sie Jean Shepherd gelesen oder die Filme gesehen haben, die auf seinen Büchern beruhen, dann wissen Sie, was ich meine). Verwittert, keine Farbe, kaputte Autos im Hof, mindestens zwei Außentoiletten, eine seitliche Veranda, die abgerissen worden war – vermutlich während eines Wutanfalls von einem der Hausbewohner –, das Unkraut wucherte sechs Fuß hoch, und man konnte einen flüchtigen Blick auf graue Tiere erhaschen, die wie Opossums aussahen, nur dass sie größere Zähne hatten und zwischen den Schrottautos im Unkraut herumstrolchten … Ein waschechtes Bumpus-Haus.
Hinter der geschlossenen Haustür und durch die zerfetzten Rollläden war ein Lichtschimmer zu sehen, und so beschloss ich, nach dem Weg zu fragen. Als ich erkannte, dass das Licht grün war, hätte ich es mir beinahe anders überlegt. Es war nicht das allgegenwärtige blaue Flackern eines Fernsehers in einem dunklen Raum, sondern ein widerliches, schmieriges Grün, das pulsierte und flimmerte. Da lief kein moderner Fernseher, sondern es war ein Changieren wie aus einem Horrorfilm von Universal aus den Dreißigerjahren. Trotzdem ging ich weiter, stieg über die Betonblöcke, die früher mal die Veranda gestützt hatten, hob die Hand, um anzuklopfen … In diesem Augenblick brach explosionsartig das wildeste und unwirklichste Knurren los, das ich je gehört hatte. Es kam nicht etwa aus dem Innern des Hauses, sondern von draußen – von hinten, von der Seite oder aus dem finsteren Kiefernwald. Vielleicht … ja, vielleicht züchteten die Bewohner des Hauses Wolfshunde (was im ländlichen Colorado gar nicht so ungewöhnlich ist), und vielleicht hatten sie zehn davon im Haus und zwanzig im Hinterhof und noch einmal zwanzig im Garten und fünfzig weitere draußen im Wald. Damit hätte man das Knurren halbwegs erklären können.
Vielleicht.
Jedenfalls beschloss ich, auf die Wegbeschreibung zu verzichten und einfach weiterzugehen. Nein, eigentlich trabte ich sogar ein ganzes Stück, bis ich im Sternenlicht wieder auf der dunklen Straße stand. Nachdem ich vierzig weitere Minuten gelaufen war und an der Kreuzung mit dem Peak to Peak Highway richtig geraten hatte, dass ich nach Süden abbiegen musste, sah ich den Kelly-Dahl-Campingplatz mit den verstreuten Kuppelzelten, den Lagerfeuern und den Gästen vor mir liegen. Ich weiß nicht, ob mir schon einmal irgendein Anblick willkommener war als dieser.
All das hat natürlich herzlich wenig mit dieser Story zu tun.
Eine der Liebesgeschichten, die in »Auf der Suche nach Kelly Dahl« eingebettet sind, dreht sich um die Liebe zum Lehren. Eine andere behandelt die Liebe zum Hochland von Colorado.
Nachdem ich 1974 nach Colorado umgezogen war, konnte ich ein Dutzend Jahre lang diese beiden Lieben in unserer alljährlichen »Eco-Week Experience« miteinander verbinden. Wir waren Lehrer, unterrichteten im sechsten Schuljahr und konnten für drei Tage und zwei Nächte die Kinder in die Berge mitnehmen. Die anderen beiden Tage dieser »Öko-Woche« wurden von Ausflügen zum Wasserreservoir der Stadt, zu einer Wasseraufbereitungsanlage und zum Klärwerk ausgefüllt – zu einem Ort mit dem Geruch des Unnahbaren.
Der Kern der Öko-Woche waren aber jene drei Tage und zwei Nächte im Camp St. Malo, einem altehrwürdigen katholischen Sommercamp etwa dreißig Meilen nördlich vom Kelly-Dahl-Campingplatz am schon erwähnten Peak to Peak Highway. Die meisten Schulen fuhren im Herbst dorthin, wenn die Blätter der Espen die schönsten Farben hatten. Einige weniger glückliche Schulen des Bezirks mussten im Mai fahren, wenn im Camp manchmal noch drei Fuß Schnee lagen. Das war den Sechstklässlern aber mehr oder weniger egal – so wie einige Lehrer freuten sie sich das ganze Jahr lang auf die Öko-Woche. Wir haben die Kinder nicht einfach ins Camp gesetzt und gehofft, sie hätten eine schöne Zeit. Unsere wissenschaftliche Vorbereitung begann schon Monate vorher, und während unseres Aufenthalts führten wir Experimente durch – prüften den pH-Wert von Wasser und Boden, entnahmen Proben aus Baumstämmen, identifizierten Bäume auf Spaziergängen mit Augenbinden durch Geruch und Tastsinn, übten mit dem Kompass und lernten, uns zu orientieren, studierten die durch Gletscher gebildete Landschaft, suchten Eichhörnchenkobel, beobachteten Insekten mit Vergrößerungsgläsern, zeichneten die Erosion vom Granit des Pikes Peak über Kieselsteine bis hin zu Erdreich und Humus nach, beobachteten das Verhalten von höheren Tieren und Vögeln … so in etwa müssen Sie sich das vorstellen.
Gott, wie ich die Öko- Woche geliebt habe! (Ein Jahr, nachdem ich den Lehrerberuf aufgegeben hatte, stellte der neue Bezirkspräsident, ein kurzatmiger Typ aus irgendeinem Kaff in Wyoming, die Öko-Woche ein, die sechzehn Jahre lang für die Sechstklässler der Höhepunkt der Schulzeit gewesen war – angeblich, weil sie zu teuer war. Dann musste der Mann wegen eines Sexskandals aus dem Verkehr gezogen werden, und der Bezirk war gezwungen, ihn mit mehr als 200.000 Dollar abzufinden, nur um ihn loszuwerden. Aber die Öko-Woche wurde nicht wieder eingeführt.)
Sie werden meine Liebe zum Lehrerberuf in »Auf der Suche nach Kelly Dahl« wiederfinden, auch meine Liebe für das Lehren ökologischer Zusammenhänge – aber noch wichtiger als meine Liebe für das Lehren ist meine Liebe für das Lernen: das Erlernen wissenschaftlichen Denkens. Die Szene, in der Kelly Dahl die Klasse dazu bringt, den Mund zu halten und der Natur zu lauschen, hat sich auf die eine oder andere Weise tatsächlich bei allen unseren Öko-Wochen zugetragen.
Ich habe mich damals über die Befürchtungen von Beamten, Eltern, Schülern und vielen Lehrern hinweggesetzt und Nachtwanderungen veranstaltet. (Am Vorabend habe ich den hundert Kindern am Lagerfeuer immer die »Gronker-Story« erzählt und ihnen damit eine Heidenangst eingejagt – nach der »Gronker-Story« wollte niemand mehr allein nach draußen gehen.) Auf diesen Nachtwanderungen sind wir im Mondlicht oder bei Sternenlicht durch die Wälder gelaufen und haben sichere Orte gefunden, an denen wir allein sein und dreißig Minuten schweigen konnten. Für die meisten der Kinder, die in einer Stadt mit rund 60.000 Einwohnern aufgewachsen sind, war das vermutlich die erste Gelegenheit, einmal allein im Wald zu sitzen und dem Rascheln der kleinen Tiere, dem Flattern der Eulenflügel und dem Rauschen des Windes in den Zweigen der Ponderosakiefern zu lauschen. Es hat ihnen gefallen.
Ich bin nicht sicher, ob es ein Zufall ist, dass die 46 Hektar Bergland mit Hütte – das Gelände heißt »Windwalker« –, die ich schließlich kaufte, nicht weit vom Camp St. Malo entfernt liegen (dort befindet sich heute allerdings ein katholisches »Executive Conference Center«, in dem einmal Johannes Paul II. logierte – er ist tatsächlich mit seinen weißen Goldschnürchenlatschen im Gronker-Land wandern gegangen). Es war auch nicht unbedingt ein Zufall, dass sich nicht wenige der Sechstklässler, die an der Öko-Woche teilgenommen haben, später für wissenschaftliche Berufe entschieden, einige davon sogar im Bereich des Umweltschutzes. Eine dieser Schülerinnen schreibt in diesem Jahr eine Doktorarbeit über die Fortpflanzungsstrategien alpiner Pflanzen. Sie wandert jeden Tag in das Untersuchungsgebiet, wo, kalte 4000 Meter hoch über der Baumgrenze gelegen, ihre Sumpfdotterblumen stehen. Das Gelände liegt auf dem Niwot Ridge an der Kontinentalscheide, ungefähr auf halbem Weg zwischen Camp St. Malo und dem Kelly-Dahl-Campingplatz. Mir ist klar, dass weder die Öko-Woche noch ich diese Liebe für die Wissenschaft und das Leben im Freien in ihr geweckt haben – ihre Eltern hatten diese Neigung bereits ausgebildet, bevor sie ins sechste Schuljahr kam –, aber ich durfte sie begleiten, als sie ihre ersten ökologischen Feldforschungen betrieben hat.
Vielleicht meine liebste Szene in »Auf der Suche nach Kelly Dahl« spielt in einer solchen Tundra über der Baumgrenze, wo Kelly Dahl – falls es eine Kelly Dahl gibt – den Erzähler gleichsam anvisiert und telepathisch mit ihm kommuniziert. Sie beschreibt ihm ihre Liebe für die Poesie der Tundra mit Worten wie »Fjell, Wiesenmaus, Steinbrech, Solifluktionsterrassen, Nelkenwurz und Riedgräser, Gelbbäuchiges Murmeltier, Permafrost, Nivationsnischen, Geißfuß, Chiming Bells und die Seggenart, die Menschen hasst …«
Es ist durchaus möglich, dass dieser Seggenart eine gewisse symbolische Bedeutung zukommt.
Ich sollte noch betonen, dass die Prinzipien von wabi und sabi in der Natur nirgendwo deutlicher zum Ausdruck kommen als im Krummholz oder »Eibenholz«, in den knorrigen und verdrehten kleinen Bäumen an der Baumgrenze, die gut tausend Jahre alt sein können; ebenso in den eiszeitlichen Moränen, den umgestürzten Bäumen, den mit Moos bewachsenen Felsen und im subglazialen Sand.
Abschließend noch die Definitionen einiger Begriffe, die nützlich sein könnten:
Chiaroscuro – die Benutzung und Verteilung von Licht und Schatten in einem Gemälde.
Pentimento – das Auftauchen eines übermalten Motivs in einem Gemälde.
Palimpsest – ein Pergament, von dem die Schrift ganz oder teilweise entfernt wurde, um Platz für einen anderen Text zu schaffen.
Palinodie – ein Gedicht, in dem der Dichter etwas zurücknimmt, das er in einem früheren Gedicht gesagt hat.
1
CHIAROSCURO
Als ich am Morgen im Camp aufwachte, musste ich feststellen, dass der Highway nach Boulder verschwunden war. Keine Kondensstreifen mehr am Himmel, die Blätter der Espen hatten sich, obwohl es angeblich ein Tag im Hochsommer war, golden verfärbt, und nachdem ich mit dem Jeep vier Meilen weit durch den Wald und über den felsigen Höhenzug bis zurück zu den Flatirons geholpert war, ließ mich der Anblick des Binnenmeeres auf der Stelle anhalten.
»Verdammt«, murmelte ich. Ich stieg aus und lief zur Klippe.
Wo die Vorberge und die Ebene hätten sein sollen, erstreckte sich jetzt bis zum Horizont und wohl noch darüber hinaus ein großes Meer. Träge Wellen leckten unten am Uferschlamm. Wo die eckigen Bauten des NCAR, des National Center for Atmospheric Research, unterhalb der Sandsteinflächen der Flatirons gestanden hatten, gab es jetzt nur noch mit Büschen besetzte Sümpfe und verschlammte Buchten. Von Boulder war nichts zu sehen. Weder die Bäume der Stadt noch deren niedrige Gebäude konnte man ausmachen. Der Highway 36 verlief nicht mehr wie früher schnurgerade über die Hügel nach Südosten in Richtung Denver. Weit und breit war keine Straße zu sehen. Die Hochhäuser von Denver waren verschwunden, ganz Denver war verschwunden. Nur das Binnenmeer erstreckte sich nach Osten, Norden und Süden, so weit mein Blick reichte. Die Farbe entsprach dem Graublau, das ich aus meiner Jugend vom Lake Michigan kannte. Die Wellen schwappten lustlos, es war die halbherzige Bewegung eines großen Sees, nicht die rauschende Brandung eines echten Ozeans.
»Verdammt«, sagte ich noch einmal und zog die Remington heraus, die hinter dem Fahrersitz des Jeeps in einer Hülle steckte. Mit der zwanzigfachen Vergrößerung des Zielfernrohrs suchte ich die Rinnen ab, die zwischen den Flatirons zu den Sümpfen und zum Strand hinunterliefen. Es gab keine Straßen, keine Wege, nicht einmal Fährten von Tieren. Ich setzte den Fuß auf einen flachen Stein, stemmte den Arm aufs Knie und versuchte, den Bildausschnitt möglichst ruhig zu halten, während ich links und rechts den langen Streifen des dunklen Strandes absuchte.
Fußabdrücke im Schlamm – die Spur eines Menschen führte von der Rinne direkt unter meinem Standort, der eines Tages Flagstaff Mountain heißen sollte, zu einem kleinen Ruderboot, das außer Reichweite der plätschernden Wellen auf den Sand gezogen worden war. Im Boot saß niemand, und vom Boot führten auch keine Spuren weg.
Ein Farbfleck und eine Bewegung, ein paar hundert Meter vom Ufer entfernt, erregten meine Aufmerksamkeit. Ich hob das Gewehr und versuchte, das Zielfernrohr auf den hüpfenden gelben Tupfer auszurichten. Da draußen, knapp außerhalb des Flachwassers, trieb ein Floß.
Ich ließ die Remington sinken und trat einen Schritt näher an den Steilabfall. Mit dem Jeep wollte ich auf keinen Fall dort hinunter. Es hätte Stunden, ja Tage gedauert, einen Weg durch das dichte Unterholz und die Ponderosa- und Lodgepolekiefern zu hacken, die in der Rinne wuchsen. Und selbst dann musste ich noch die Winde benutzen, um den Jeep über Felsblöcke und beinahe senkrecht abfallende Stellen zu hieven. Es war die Mühe nicht wert, den Wagen mitzunehmen. Zu Fuß würde ich etwa eine Stunde brauchen, um nach unten zu gelangen.
Aber wozu?, dachte ich. Das Ruderboot und die Boje waren doch sicher nur eine weitere falsche Fährte, ein weiterer Kelly-Dahl-Witz. Oder sie versucht, mich hinunter aufs Wasser zu locken, damit sie den Fangschuss anbringen kann.
»Verdammt«, sagte ich zum dritten und letzten Mal. Dann schob ich das Gewehr ins Futteral zurück, zog den blauen Rucksack hervor und überprüfte Rationen, Wasserflaschen und die 38er. Ich nahm den Rucksack auf den Rücken, steckte das Kabar-Messer griffbereit in die Scheide am Gürtel, sodass ich es mit einer Bewegung ziehen konnte, klemmte die Hülle mit dem Gewehr in die Armbeuge und begann nach einem letzten Blick zum Jeep und seiner Ladung den langen Abstieg.
Kelly, du wirst nachlässig, dachte ich, während ich den schlammigen Abhang hinunterrutschte und die Zweige der Espen als Haltegriffe benutzte. Hier passt nichts mehr zusammen. Du hast das hier genauso verpfuscht wie das Trias gestern.
Dieses Binnenmeer konnte theoretisch zu mehreren Zeitaltern gehören – etwa in die späte Kreidezeit oder ins späte Jura. Doch in Ersterer, vor etwa fünfundsiebzig Millionen Jahren, war das große Binnenmeer viel weiter nach Westen vorgedrungen als hier, bis Utah oder sogar noch weiter, und die Rocky Mountains, die ich zwanzig Meilen weit im Westen erkennen konnte, wurden aus den Überresten von Pazifikinseln in jenem Ozean geboren, der das spätere Kalifornien bedeckte. Die Flatirons, die sich vor mir erhoben, wären kaum mehr als eine weiche Schicht im Erdreich.
Wenn es aber das mittlere Jura sein sollte, fast einhundert Millionen Jahre früher als die Kreidezeit, dann müsste die ganze Gegend von einem warmen, flachen Meer bedeckt sein, das sich von Kanada bis hierher erstreckte und dessen südlicher Strand irgendwo im Norden Mexikos verlief. Noch weiter südlich müsste es einen riesigen Salzsee geben, und die schlammigen Ebenen des südlichen Colorado und des nördlichen New Mexico müssten sich als Landenge fast zweihundert Meilen weit zwischen den Gewässern erstrecken. Diese Gegend im zentralen Colorado müsste dann eine Insel sein – auf der es jedoch weder Berge noch Flatirons gab.
Du hast das alles falsch gemacht, Kelly. Ich gebe dir dafür eine Vier minus. Ich bekam keine Antwort. Verdammt, es ist sogar noch schlechter: eine Fünf. Immer noch blieb es still.
Auch die Flora und Fauna stimmten nicht. Statt der Espen und Kiefern, durch die ich jetzt nach unten kletterte, hatte es im Jura schlanke und hohe, palmenähnliche Bäume mit großen Blättern und Zapfen gegeben. Das Unterholz hätte nicht aus den Wacholdersträuchern bestanden, die ich hier umgehen musste, sondern aus exotischem Schachtelhalm mit Blättern wie Bananenstauden. Die Flora in der späten Kreidezeit wäre dem menschlichen Auge etwas vertrauter vorgekommen – niedrige Bäume mit breiten Blättern, riesige Koniferen –, wenngleich die Blüten üppig und tropisch gewesen wären. Der Duft riesiger Blüten, die an Magnolien erinnerten, hätte die feuchte Luft gewürzt.
Hier war die Luft weder warm noch feucht. Es war ein normaler Herbsttag in Colorado. Die einzigen Farbtupfer, die ich erkennen konnte, waren die verdorrten Blüten der kleinen Kakteen vor meinen Füßen.
Die Fauna war falsch. Und langweilig. Dinosaurier gab es sowohl in der Kreidezeit als auch im Jura, aber die einzigen Tiere, die ich an diesem schönen Morgen gesehen hatte, waren ein paar Raben, drei Rehe mit weißen Spiegeln, die eine Meile, bevor ich die Klippe erreichte, weggerannt waren, und kurz vor dem höchsten Punkt der Flatirons einige Erdhörnchen mit goldenem Pelz. Falls nicht noch ein Plesiosaurus den Schlangenhals aus dem Wasser reckte, konnte ich getrost annehmen, dass das Binnenmeer in unsere Epoche versetzt worden war. Als die Jagd mich die letzten Male durch frühere Zeitalter geführt hatte, war ich einigermaßen enttäuscht gewesen. Ich hätte wirklich gerne einmal einen Dinosaurier gesehen, und sei es nur, um zu überprüfen, ob Spielberg mit seinen Computeranimationen hinsichtlich der Bewegungen dieser Geschöpfe richtig lag.
Kelly, du wirst nachlässig. Faul. Oder du triffst deine Entscheidungen eher aufgrund von Gefühlen und Ästhetik und ohne jeden Sinn für Genauigkeit. Ich war nicht überrascht, dass ich keine Antwort bekam.
Kelly war schon immer sehr eigenwillig gewesen, und aus der Zeit, als ich noch ihr Lehrer war, konnte ich mich nicht gerade an übermäßige Sentimentalität erinnern.
Sie hat nicht geweint, als ich die sechste Klasse aufgab und den Job an der Highschool angenommen habe. Die meisten anderen Mädchen haben geweint. Kelly Dahl war damals elf. Sie hat auch kaum Emotionen gezeigt, als sie später im Englischunterricht doch noch einmal in meine Klasse kam. Wie alt war sie da? Siebzehn.
Und jetzt versuchte sie, mich zu töten. Auch da war nicht viel Platz für sentimentale Gefühle.
Am Rand der Rinne verließ ich den Wald und folgte den menschlichen Fußabdrücken, die auf den von der Ebbe freigelegten Sandbänken im Schlamm zu sehen waren. Ob das Binnenmeer nun aus dem Jura oder der Kreidezeit stammte – der Mensch, der vor mir über die Sandbänke gelaufen war, hatte Sportschuhe getragen. Laufschuhe, nach den Sohlen zu urteilen. Von den Gezeiten abhängige Sandbänke? Doch, das war möglich – das Meer von Kansas war groß genug, um Gezeiten zu haben.
Das Ruderboot war bis auf zwei ordentlich verstaute Riemen leer. Ich sah mich um, nahm das Gewehr heraus, um die Hügel abzusuchen, warf dann den Rucksack ins Boot, legte mir das Gewehr über den Schoß, stieß mich durch die niedrigen Wellen ab und ruderte zur gelben Boje hinaus.
Ich rechnete mit einem Gewehrschuss, nahm aber an, dass ich ihn nicht hören würde. Trotz der gescheiterten Anschläge vor einigen Tagen war Kelly Dahl offensichtlich eine gute Schützin. Wenn sie entschlossen war, mich zu töten, und ein gutes Schussfeld hatte wie hier – sie konnte von jeder Stelle der Flatirons aus schießen –, dann war ich schon beim ersten Versuch mit ziemlicher Sicherheit tot. Meine einzige Chance bestand darin, dass es kein tödlicher Schuss werden und ich noch fähig sein würde, die Remington zu bedienen.
Trotz der kühlen Herbstluft war mein Hemd von der Anstrengung durchweicht. Das Gewehr lag hinter mir auf der Ruderbank, und ich musste daran denken, wie verwundbar ich hier auf diesem kreidezeitlichen Meer war und wie dumm ich mich verhielt. Mein Lachen klang eher nach einem Grunzen.
Tu, was du nicht lassen kannst, Mädchen. Hinter den Felsen auf dem Flagstaff Mountain blitzte in der Sonne irgendetwas auf. Ein Fernglas? Die Windschutzscheibe meines Jeeps? Ich ruderte gleichmäßig weiter. Tu, was du nicht lassen kannst. Schlimmer als das, was ich mir selbst antun wollte, kann es nicht sein.
Die gelbe »Boje« war ein Plastikkanister, der Bleichmittel enthalten hatte. Eine Schnur war daran gebunden. Ich zog sie hoch. Die Weinflasche am anderen Ende war mit Steinen beschwert und mit einem Korken verschlossen. Drinnen fand ich einen Zettel.
PENG, stand dort. ERWISCHT.
Noch am gleichen Tag, als ich beschlossen hatte, mich umzubringen, plante ich mein Vorhaben, traf die notwendigen Vorbereitungen und führte es auch aus. Warum noch länger warten?
Die Ironie war, dass ich Selbstmord und Selbstmörder immer verabscheut habe. Papa Hemingway und seine Bundesgenossen, also die Leute, die sich eine Boss-Schrotflinte in den Mund stecken und abdrücken, sodass die Überreste am Fuß der Treppe liegen bleiben, wo die Ehefrau sie dann findet, und die Wände mit Schädelsplittern verklebt sind, die von einer Putzkolonne entfernt werden müssen … nun ja, ich finde das widerlich. Ich glaube, diese Leute lassen sich gehen. Ich war ein Versager, ein Trinker, eine Niete – aber ich habe es nie jemand anderem überlassen, meinen Dreck wegzuräumen. Nicht einmal in den schlimmsten Tagen meiner Zeit als Trinker.
Natürlich ist es schwer, sich eine Art der Selbsttötung auszudenken, die kein Chaos hinterlässt. Es wäre nett gewesen, wie James Mason 1954 am Ende von Ein neuer Stern am Himmel einfach ins Meer zu marschieren, vorausgesetzt, eine starke Strömung hätte mich nach draußen gezogen oder die Haie hätten meine im Wasser verbliebenen Überreste vertilgt. Doch ich lebe in Colorado. In einem der kleinen Speicherseen hier in der Nähe zu ertrinken, ist bestenfalls erbärmlich.
Alle häuslichen Mittel – Gas, Gift, Aufhängen, eine Überdosis Schlaftabletten, die Schrotflinte im Schrank – bürden jemandem das Hemingway-Problem auf. Außerdem hasse ich melodramatische Inszenierungen. Meiner Ansicht nach geht es, von mir selbst abgesehen, niemanden etwas an, wie oder warum ich abtrete. Meiner Exfrau wäre es natürlich völlig gleichgültig, und mein einziges Kind ist tot und kann sich nicht mehr schämen, aber es gibt immer noch ein paar Freunde aus der guten alten Zeit, die sich hintergangen fühlen könnten, wenn sie erfahren, dass ich Selbstmord begangen habe. So denke ich es mir jedenfalls.
Ich brauchte knapp drei Bier im Bennigan’s am Canyon Boulevard, um die Lösung zu finden. Die Vorbereitungen zu treffen und den Plan umzusetzen, erforderte sogar noch weniger Zeit.
Zu den wenigen Dingen, die mir nach der Einigung mit Maria geblieben waren, zählten der Jeep und die Campingausrüstung. Noch während ich trank, fuhr ich gelegentlich ohne Vorankündigung einfach in die Berge und kampierte irgendwo am Peak to Peak Highway oder im Staatsforst im Left Hand Canyon. Ich bin eigentlich kein richtiger Offroad-Typ. Ich hasse die Arschlöcher mit Allradantrieb, die auch noch stolz darauf sind, wenn sie die Landschaft verschandeln, und die Typen mit Schneeschlitten und die Idioten mit Motorrädern, die mit Lärm und Gestank die Wildnis zerstören. Natürlich reize ich den Jeep manchmal aus, um weit draußen einen Lagerplatz zu finden, an dem ich keine Radios und keinen Verkehrslärm mehr höre und wo ich nicht das Hinterteil eines fetten Winnebago anstarren muss.
Da oben gibt es Minenschächte. Die meisten wurden horizontal in die Berge getrieben und enden schon nach ein paar hundert Fuß, weil die Decke eingebrochen ist oder weil sie überflutet sind. Es gibt aber auch Senken und Löcher, wo die Erde über einem alten Schacht eingebrochen ist – einige der schon lange aufgegebenen Minen sind senkrechte Abgründe, die zwei- oder dreihundert Fuß tief in den Fels zum Grundwasser führen oder zu den schleimigen Geschöpfen, die in solchen dunklen Löchern hausen mögen.
Ich wusste, wo sich einer dieser senkrechten Schächte befand – ein tiefes Loch mit einer Öffnung, die groß genug war, den Jeep und mich aufzunehmen. Der Schacht war weit oben im Canyon hinter dem Sugarloaf Mountain, weitab vom Weg und mit Warnschildern an den Bäumen gekennzeichnet. Nur jemand, der versuchte, einen Jeep in der Dämmerung oder im Dunkeln zu wenden, konnte versehentlich dort hineinfallen. Falls er ausgesprochen dumm war. Oder ein ausgemachter Säufer.
Es war ein Juliabend, etwa um sieben Uhr, als ich das Bennigan’s verließ, die Campingsachen aus meiner Wohnung in der 30th Street holte und auf dem Highway 36 nach Norden fuhr. Drei Meilen ging es an den Ausläufern des Gebirges entlang, dann nach Westen den Left Hand Canyon hinauf. Obwohl ich zwei oder drei Meilen auf einer unebenen Straße vor mir hatte, rechnete ich damit, vor acht Uhr abends am Schacht einzutreffen. Damit blieb mir noch genug Zeit, zu tun, was ich tun musste.
Trotz der drei Bier war ich nüchtern. Ich hatte seit fast zwei Monaten keinen Drink mehr gehabt. Als Alkoholiker wusste ich, dass ich nicht genesen konnte, wenn ich gerade eben noch nüchtern blieb. Ich verlängerte nur mein Leiden.
An diesem Abend wollte ich allerdings mehr oder weniger nüchtern sein. Auch damals war ich mehr oder weniger nüchtern gewesen – ich hatte nur zwei Bier getrunken, vielleicht auch drei –, als der Pick-up auf dem Highway 287 die Spur wechselte und gegen unseren Honda prallte. Allan war sofort tot, ich musste drei Wochen im Krankenhaus bleiben. Der Fahrer des Pick-up überlebte natürlich. Man entnahm ihm eine Blutprobe und stellte fest, dass er betrunken war. Er bekam eine Bewährungsstrafe und musste für ein Jahr auf den Führerschein verzichten. Ich war so schwer verletzt und es war so offensichtlich, dass der Pick-up schuld war, dass man bei mir auf die Blutprobe verzichtete. Ich werde nie erfahren, ob es mir gelungen wäre, schneller zu reagieren, wenn die zwei oder drei Bier nicht gewesen wären.
Dieses Mal wollte ich allerdings genau sehen, was ich tat, wenn ich den Jeep bis an den Rand des zwanzig Fuß breiten Lochs fuhr, den Wagen im niedrigen Gang mit dem Allradantrieb in Bewegung setzte und über den Wall, der das Loch umgab, in die dunkle Grube rollen ließ.
Genau so machte ich es. Ich zögerte nicht. Ich verlor nicht in letzter Sekunde meinen Stolz und schrieb einen verdammten Abschiedsbrief an irgendjemanden. Ich dachte nicht weiter darüber nach. Ich nahm die Baseballkappe ab, wischte mir den dünnen Schweißfilm von der Stirn, setzte die Kappe wieder fest auf, legte einen niedrigen Gang ein und donnerte über den Erdwall wie ein Pitbull, der den Arsch des Briefträgers im Visier hat.
Es fühlte sich beinahe an wie die zweite Erhebung auf der Wildcat-Achterbahn in den Elitch Gardens. Ich verspürte den Drang, beide Arme zu heben und zu kreischen. Doch ich ließ die Arme, wo sie waren, meine Hände packten weiter das Lenkrad, als die Nase des Jeeps in die Dunkelheit tauchte. Es war wie die Einfahrt in einen Tunnel. Ich hatte die Scheinwerfer nicht eingeschaltet. Schemenhaft sah ich Felsen, verfaulte Balken und Granitschichten vorüberfliegen. Ich schrie nicht.
In den letzten Tagen habe ich versucht, mich an alles zu erinnern, was ich noch über Kelly Dahl aus der Zeit wusste, als sie im sechsten Schuljahr war, doch das meiste ist nicht mehr sehr klar. Ich habe fast sechsundzwanzig Jahre lang unterrichtet, sechzehn davon in der Grundschule und noch einmal zehn an der Highschool. Namen und Gesichter verschwimmen. Das lag aber nicht daran, dass ich damals ein starker Trinker war. Kelly war in meiner letzten sechsten Klasse, und damals hatte ich kein Problem mit dem Alkohol. Probleme hatte ich – aber keins mit dem Alkohol.
Ich weiß noch, wie ich Kelly Dahl am ersten Tag wahrgenommen habe. Jeder Lehrer, der das Salz in der Suppe wert ist, bemerkt die Unruhestifter, die Außenseiter, die Streber, die Klassenclowns und all die anderen Typen, die es in Schulklassen gibt, auf den ersten Blick. Kelly Dahl passte in keine dieser Kategorien, aber eine Außenseiterin war sie ganz sicher. Körperlich war nichts Ungewöhnliches an ihr – mit elf Jahren verlor sie gerade den Babyspeck, der aus ihrer Kindheit noch übrig war, ihr Knochenbau setzte sich allmählich im Gesicht durch, ihr Haar war etwa schulterlang und braun, ein wenig strähniger als bei ihren sorgfältig geföhnten oder mit Zöpfen geschmückten Mitschülerinnen. Genau genommen wirkte Kelly Dahl sogar ein wenig verwahrlost und ärmlich. Ein Anblick, den wir Lehrer Mitte der Achtzigerjahre auch im reichen Boulder County nur allzu oft zu sehen bekamen. Die Kleidung des Mädchens war oft zu klein, selten sauber und wies häufig die vielsagenden Falten auf, die ein Kleidungsstück bekommt, wenn es am Morgen hastig aus dem Wäschekorb oder dem Schrank gezerrt wird. Wie gesagt, war ihr Haar selten gewaschen und wurde normalerweise von billigen Plastikspangen gehalten, die sie vermutlich schon seit dem zweiten Schuljahr trug. Ihre Haut hatte den fahlen Ton eines Kindes, das zu viele Stunden drinnen vor dem Fernseher verbringt. Später sollte ich allerdings erfahren, dass das auf Kelly Dahl nicht zutraf. Sie war in dieser Hinsicht einzigartig – ein Kind, das nie ferngesehen hatte.
Nur wenige meiner Annahmen über Kelly Dahl trafen zu.
Am ersten Tag meines letzten sechsten Schuljahrs fielen mir vor allem ihre Augen auf – verblüffend grün, erschreckend intelligent und überraschend wach, wenn sie sich gerade nicht hinter gespielter Langeweile verbarg oder den Blick abwandte, sobald sie aufgerufen wurde. Ich erinnere mich noch genau an ihre Augen und an den leicht überheblichen Tonfall, an die leise Stimme des elfjährigen Mädchens, als ich sie an diesem ersten Schultag einige Male aufrief.
Ich weiß auch noch, dass ich am Abend ihre Akte gelesen habe. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, die Akten der Schüler niemals zu lesen, bevor ich nicht die Kinder selbst gesehen hatte. In ihre Akte schaute ich vor allem, weil Kellys präzise Diktion und der leicht ironische Tonfall so gar nicht zu ihrem Äußeren passen wollten. Den Unterlagen zufolge wohnte Kelly Dahl in einem Wohnwagenpark westlich der Eisenbahnstrecke. Diesem Trailer Park hatte unsere Schule den Löwenanteil aller Probleme zu verdanken. Sie lebte dort mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Ein gelber Warnzettel aus dem zweiten Schuljahr wies die Lehrer darauf hin, dass Kellys leiblicher Vater zunächst noch das Sorgerecht gehabt hatte. Doch dann wurde es ihm gerichtlich entzogen, weil es Gerüchte über Missbrauch gegeben hatte. Ich sah auf dem Blatt nach, das ein Sozialarbeiter des County ausgefüllt hatte, und wenn ich zwischen den Zeilen der bürokratischen Formulierungen richtig las, musste ich davon ausgehen, dass die Mutter das Kind nicht haben wollte, sich jedoch der Entscheidung des Gerichts gefügt hatte. Der leibliche Vater war gern bereit gewesen, das Mädchen abzugeben. Offenbar hatte es eine Auseinandersetzung gegeben, weil keiner das Sorgerecht wollte. »Nimm du sie, ich muss mich um mein eigenes Leben kümmern« – viele meiner Schüler hatten so etwas erlebt. Die Mutter hatte also verloren und blieb auf Kelly sitzen. Der gelbe Warnzettel enthielt den üblichen Hinweis, dass das Mädchen das Schulgelände nicht mit dem leiblichen Vater verlassen dürfe. Sie durfte auch nicht ans Telefon gerufen werden, wenn er anrief, und falls er dabei erwischt wurde, dass er sich auf dem Schulgelände herumtrieb, sollte ihr Lehrer oder die entsprechende Aufsichtsperson den Schulleiter verständigen und/oder die Polizei rufen. Viel zu viele unserer Schüler hatten solche gelben Warnhinweise in den Akten.
Eine offenbar von Kellys Lehrer aus der vierten Klasse hinzugefügte Notiz wies darauf hin, dass ihr »richtiger Vater« im vergangenen Sommer bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei, man könne den gelben Zettel daher ignorieren. Und unten auf der getippten Stellungnahme des Sozialarbeiters fand ich noch eine gekritzelte Ergänzung, wonach Kelly Dahls »Stiefvater« in Wahrheit unverheiratet mit der Mutter zusammenlebe. Er sei auf Bewährung draußen, nachdem er in Arvada einen Supermarkt ausgeraubt habe.
Also eine ziemlich normale Akte.
Doch an der kleinen Kelly Dahl war nichts Normales. In den letzten Tagen, als ich mich an unser Verhältnis während des nur sieben Monate dauernden Schuljahres und an die acht Monate auf der Highschool zu erinnern versuchte, wunderte ich mich, wie eigenartig diese gemeinsame Zeit gewesen war. Manchmal kann ich mich kaum an die Namen der Sechstklässler erinnern, an die bedrückten Gesichter und die krummen Rücken der Schüler, aber Kelly Dahls schmales Gesicht, die ausdrucksvollen grünen Augen und ihre leise Stimme blieben hängen – ironisch mit elf, sarkastisch und herausfordernd mit sechzehn. Vielleicht war Kelly Dahl, nachdem ich sechsundzwanzig Jahre lang Hunderte von Elfjährigen, Sechzehnjährigen, Siebzehnjährigen und Achtzehnjährigen unterrichtet – eigentlich eher ertragen – hatte, meine einzige wirkliche Schülerin gewesen.
Jetzt lauerte sie mir also auf. Und ich ihr.
2
PENTIMENTO
Die Wärme der Flammen weckte mich. Ich zuckte zusammen und spürte noch das Gefühl des Fallens – ich erinnerte mich an den letzten bewussten Moment, als ich mit dem Jeep in die Grube gefahren war und in die Schwärze stürzte. Ich wollte die Arme heben und wieder das Lenkrad packen, doch meine Arme waren hinter mir festgebunden. Ich saß auf etwas Hartem, nicht auf dem Sitz im Jeep. Auf dem Boden. Bis auf die flackernden Flammen direkt vor mir war alles dunkel. Die Hölle?, dachte ich, doch ich mochte dieser Hypothese keinen Glauben schenken, nicht einmal für den Fall, dass ich tot war. Außerdem gehörten die Flammen, die ich sehen konnte, zu einem großen Lagerfeuer. Der Steinring war deutlich zu erkennen.
Ich hatte Kopfschmerzen, und mein ganzer Körper zitterte und schmerzte nach dem Schwindel erregenden Absturz, als säße ich immer noch in dem stürzenden Jeep. Ich versuchte, die Lage einzuschätzen. Ich war im Freien, saß auf dem Boden und trug noch die Sachen, die ich bei meinem Selbstmordversuch getragen hatte. Es war dunkel, ein großes Lagerfeuer knisterte sechs Fuß entfernt direkt vor mir.
»Scheiße«, sagte ich laut. Mein Kopf und mein Körper schmerzten, als hätte ich einen Kater. Da habe ich es wohl schon wieder vermasselt. Hab mich volllaufen lassen und alles vermasselt. Ich habe mir nur eingebildet, ich sei in die Grube gefahren. Verdammt!
»Nein, Sie haben es nicht vermasselt«, sagte eine leise, helle Stimme hinter mir in der Dunkelheit. »Sie sind wirklich in den Schacht gefahren.«
Ich erschrak und wollte mich zu der Sprecherin umdrehen, aber ich bekam den Kopf nicht weit genug herum. Jetzt erst bemerkte ich die Seile, die sich auf meiner Brust spannten. Man hatte mich irgendwo festgebunden, vielleicht an einem Baumstumpf oder einem Felsblock. Ich versuchte, mich zu erinnern, ob ich diese letzten Gedanken über das Trinken und meinen vermasselten Selbstmordversuch laut ausgesprochen hatte. Ich hatte unerträgliche Kopfschmerzen.
»Das war eine interessante Art, sich umzubringen«, sagte die Frau. Ich war sicher, dass es eine Frau war. Außerdem kam mir die Stimme unangenehm bekannt vor.
»Wo sind Sie?«, fragte ich. Meine Stimme schwankte. Ich drehte den Kopf so weit wie möglich, konnte aber in der Dunkelheit hinter mir nicht mehr als eine rasche Bewegung erkennen. Ich saß vor einem niedrigen Felsblock. Fünf Seilschlingen waren um meine Brust und um den Fels gelegt. Ein weiteres Seil hielt meine Handgelenke hinter dem Stein fest.
»Wollen Sie nicht lieber fragen, wer ich bin?«, erwiderte die seltsam vertraute Stimme. »Und zunächst einmal diesen Punkt klären?«
Ich schwieg einen Moment. Die Stimme und der leicht spöttische Tonfall, der darin mitschwang, erschienen mir so bekannt, dass ich sicher war, die Besitzerin auch ohne weitere Hinweise zu erkennen, wenn mir noch etwas Zeit blieb. Jemand hatte mich also betrunken im Wald gefunden und festgebunden. Aber warum hatte sie mich gefesselt? Maria war so etwas zuzutrauen, doch sie befand sich mit ihrem neuen Ehemann in Guatemala. Es gab ehemalige Geliebte, die mich hassten und fähig waren, mich zu fesseln und im Wald auszusetzen – oder Schlimmeres –, aber zu keiner passte diese Stimme. Andererseits war ich in den letzten ein, zwei Jahren neben so vielen eigenartigen Frauen aufgewacht … Und wer sagte eigentlich, dass ich diese Person tatsächlich kannte? Es sprach einiges dafür, dass mich irgendeine verrückte Frau im Wald aufgelesen hatte. Sie hatte festgestellt, dass ich betrunken und möglicherweise gewalttätig war – wenn ich sturzbesoffen bin, schreie ich laut und sage Gedichte auf –, und hatte mich gefesselt. Bis dahin klang es noch nach einer vernünftigen Erklärung – abgesehen davon, dass ich mich nicht erinnern konnte, so viel getrunken zu haben, und dass sich mein schmerzender Kopf und mein Körper nicht nach einem Kater anfühlten. Warum also sollte mich eine Frau fesseln wollen, selbst wenn sie verrückt war? Im Übrigen konnte ich mich ja daran erinnern, dass ich tatsächlich mit dem Jeep in diesen verdammten Schacht gefahren war.
»Geben Sie auf, Mr. Jakes?«, sagte die Stimme.
Mr. Jakes. Dieser vertraute Tonfall. Eine ehemalige Schülerin … Ich schüttelte den Kopf. Das Nachdenken tat weh. Es war schlimmer als die Kopfschmerzen bei einem Kater, anders, viel intensiver.
»Sie dürfen mich Roland nennen«, erwiderte ich mit belegter Stimme. Ich starrte in die Flammen und versuchte, zu mir zu kommen, nachzudenken.
»Nein, das geht nicht, Mr. Jakes«, sagte Kelly Dahl. Sie kam ins Licht und hockte sich zwischen mir und dem Feuer auf den Boden. »Sie sind Mr. Jakes. Ich darf Sie nicht anders nennen. Außerdem ist Roland ein blöder Name.«