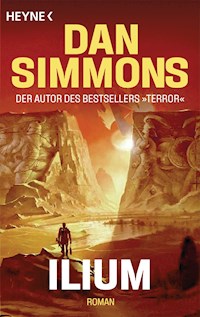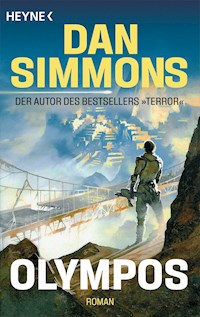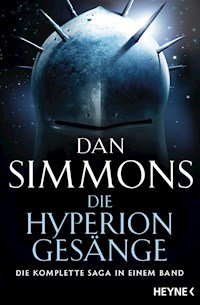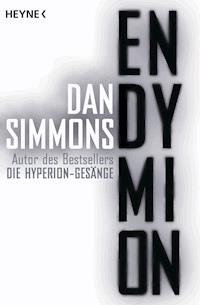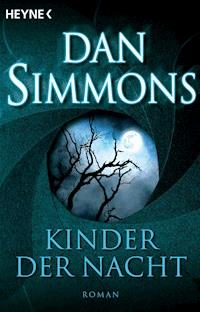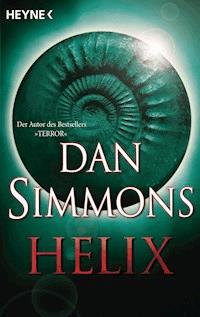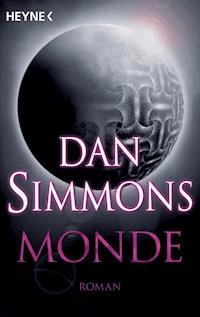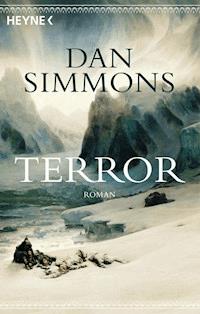
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das große historische Epos – ein einzigartiger Roman
England im Jahr 1845: Unter dem Kommando von Sir John Franklin brechen die modernsten Schiffe ihrer Zeit – die „Terror“ und die „Erebus“ – auf, um die legendäre Nord-West-Passage zu finden: den Weg durch das ewige Eis der Arktis in den Pazifik. 130 Männer nehmen an der Expedition teil. Keiner von ihnen wird je zurückkehren. Dies ist ihre Geschichte.
Mit „Terror“ lässt Bestsellerautor Dan Simmons eine der geheimnisumwobensten Entdeckerfahrten der Menschheitsgeschichte lebendig werden: John Franklins Suche nach der Nord-West-Passage. Warum ist diese Expedition gescheitert? Wie konnten 130 Männer und zwei Schiffe verschwinden, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen? Welchem Schrecken, welchem Terror sind sie im ewigen Eis begegnet? Aus diesen bis heute ungeklärten Fragen formt Dan Simmons eine atemberaubend spannende Geschichte, einen Roman, der Sie auf eines der größten Abenteuer mitnimmt, das es je gegeben hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1329
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
England, 19. Mai 1845. Zwei stolze Schiffe der Royal Navy segeln aus der Themsemündung und nehmen Kurs Richtung Norden: die Terror und ihr Schwesterschiff Erebus. Es sind die modernsten Schiffe ihrer Zeit – gepanzert mit dicken Eisenplatten, ausgestattet mit Heißwasserheizungen, angetrieben wenn nötig von Dampfmaschinen. Mit diesen beiden Schiffen soll es endlich gelingen, die legendäre Nordwestpassage zu finden, den freien Seeweg durch das bisher unüberwindliche Eis der Arktis in den Pazifischen Ozean. Die Expedition steht unter dem Kommando des hochdekorierten Sir John Franklin. Nach etlichen gescheiterten Versuchen will er dieses Mal den Erfolg mit aller Macht erzwingen. Er treibt die beiden Schiffe und ihre einhundertdreißig Mann Besatzung immer weiter in die arktische Inselwelt hinein – bis sie schließlich hoffnungslos im Packeis festsitzen. Gefangen in einer alptraumhaften Eiswüste versuchen die Männer, sich gegen die Kälte, den Hunger und die Attacken der Polarbären zu behaupten. Doch nach und nach werden die Schiffe von den gewaltigen Eismassen zerdrückt. Und der Terror beginnt …
In seinem großen historischen Roman erzählt Dan Simmons die Geschichte einer der geheimnisumwobensten Entdeckungsfahrten aller Zeiten. Es ist die Geschichte einer Reise in das weiße Herz der Finsternis.
Der Autor
Dan Simmons wurde 1948 in Illinois geboren. Nach dem Studium arbeitete er einige Jahre als Englischlehrer, bevor er sich 1987 als freier Schriftsteller selbstständig machte. Zahlreiche seiner Romane wurden zu internationalen Bestsellern. Simmons lebt mit seiner Familie in Colorado, am Rande der Rocky Mountains.
Inhaltsverzeichnis
In Freundschaft und voller Dank für unvergessliche arktische Erinnerungen widme ich dieses Buch Kenneth Tobey, Margaret Sheridan, Robert Cornthwaite, Douglas Spencer, Dewey Martin, William Self, George Fenneman, Dmitri Tiomkin, Charles Lederer, Christian Nyby, Howard Hawks und James Arness.
Diese unergründliche Eigenart ist’s, welche den Gedanken der Weiße, sobald von freundlicheren Assoziationen geschieden und mit irgendeinem in sich fürchterlichen Gegenstande verbunden, dazu veranlaßt, jene Schrecknis bis zu den äußersten Grenzen zu steigern. Zum Beweis seht den weißen Eisbär der Pole und den weißen Hai der Tropen; was anderes als ihre glatte, flockige Weiße macht sie zu den übernatürlichen Greuelwesen, so sie sind? Jene grausige Weiße ist’s, welche dem sprachlosen Glotzen ihres Anblicks eine solche widerwärtige Milde, mehr abscheulich noch als fürchterlich, einpflanzt. So daß nicht einmal der kriegskrallige Tiger in seinem heraldischen Rock so sehr den Mut wanken machen kann wie der weißgewandete Bär oder Hai.
– HERMAN MELVILLE Moby Dick (1851)
1
Crozier
70°05′ NÖRDLICHE BREITE | 98°23′ WESTLICHE LÄNGE OKTOBER 1847
Die Himmelsgeister greifen an, gerade als Kapitän Crozier an Deck seines Schiffes kommt. Schimmernde Lichtbögen zucken nach unten auf die Terror und weichen rasch zurück wie die schillernden Arme zorniger, aber unentschlossener Dämonen. Durchsichtige Knochenfinger strecken sich nach dem Schiff – und werden wieder eingezogen.
Die Temperatur beträgt minus fünfundvierzig Grad und fällt noch immer. Vor einer Weile ist Nebel aufgekommen, und in der einen Stunde schwachen Zwielichts, die ihnen noch als Tag geblieben ist, ragen die gekürzten Masten wie grob gestutzte, wipfellose Bäume empor und spiegeln das Polarlicht wider, das von einem kaum erkennbaren Horizont zum anderen tanzt. Marsstengen, Bramstengen, oberes Tauwerk und die höchsten Spieren haben sie gestrichen und eingelagert, um der Gefahr herabstürzender Eisbrocken vorzubeugen und zu verhindern, dass oben festfrierendes Eis das Schiff durch sein Gewicht zum Kentern bringt. Crozier beobachtet, wie die zerklüfteten Eisfelder um ihn herum blau aufleuchten, dann blutrot zerlaufen und schließlich grün erglühen, wie die Berge seiner Kindheit in Nordirland. Fast eine Meile vom Steuerbordbug entfernt, scheint der riesige schwimmende Eisberg, der die Erebus – das Schwesterschiff der Terror – den Blicken entzieht, aus einem frostigen inneren Feuer Farbe abzustrahlen.
Als er sich den Kragen hochzieht und in einer vierzig Jahre alten Gewohnheit den Kopf zurücklegt, um Masten und Tauwerk zu prüfen, bemerkt Crozier, wie kalt und starr die Sterne über ihm brennen, während diejenigen in der Nähe des Horizonts unstet flackern und sich verschieben, wenn man sie fixiert. In kurzen Sätzen rucken sie hin und her, auf und ab. Crozier hat dieses Schauspiel schon öfter erlebt – sowohl im fernen Süden zusammen mit Ross als auch bei früheren Expeditionen in arktischen Gewässern. Ein Wissenschaftler, der seinen ersten Winter im Eis mit dem Schleifen und Polieren der Linsen für sein Sehrohr zubrachte, erzählte Crozier damals auf der Reise zum Südpol, dass die Perturbation der Sterne wahrscheinlich auf die stark schwankende Brechungskraft der kalten Luft zurückzuführen sei, die schwer und unruhig über dem eisbedeckten Meer und den unsichtbaren gefrorenen Landmassen liegt. Mit anderen Worten: über neuen Kontinenten, die noch kein Mensch erblickt hat. Oder was die Arktis angeht, verbessert sich Crozier, zumindest noch kein Weißer.
Knapp fünf Jahre zuvor haben Crozier und sein Freund James Ross, der damalige Expeditionskommandant, solch einen unentdeckten Kontinent gefunden: die Antarktis. Meer, Eis und Land wurden nach Ross benannt. Berge wurden nach ihren Geldgebern und Freunden benannt. Den zwei Vulkanen, die sie am Horizont erkennen konnten, gaben sie die Namen ihrer zwei Schiffe – derselben zwei Schiffe –, und seitdem heißen die rauchenden Berge Erebus und Terror. Im Nachhinein wundert es Crozier, dass nicht noch irgendein Prachtstück der dortigen Geographie nach der Schiffskatze heißt.
Nach ihm selbst wurde nichts benannt. An diesem winterlich düsteren Oktobertag des Jahres 1847 gibt es auf Gottes weiter Flur keinen arktischen oder antarktischen Kontinent, keine Insel, Bucht oder Bergkette, keinen Meeresarm, Vulkan oder Eisschelf und noch nicht einmal eine gottverlassene Eisscholle, die Francis Rawdon Moira Croziers Namen trägt.
Doch das ist Crozier völlig schnurz. Tatsächlich fällt ihm erst beim Formulieren dieses Gedankens auf, dass er ein wenig betrunken ist. Na und, sagt er sich, als er ganz selbstverständlich sein Gewicht verlagert, um auf dem eisigen, zwölf Grad nach steuerbord und acht Grad zum Bug hin krängenden Deck Halt zu finden, schließlich bin ich schon seit über drei Jahren die meiste Zeit betrunken. Seit Sophia. Trotzdem bin ich selbst in besoffenem Zustand noch ein besserer Seemann und Kapitän, als es dieser armselige Unglücksrabe Franklin je war. Oder sein rosenwangiges, lispelndes Schoßhündchen Fitzjames.
Crozier schüttelt den Kopf und steuert über das vereiste Deck auf den Bug und den einzigen Wachposten zu, den er im Flackerschein des Polarlichts erkennen kann.
Es ist der kleine Kalfaterersmaat Cornelius Hickey mit dem verschlagenen Rattengesicht. Hier draußen auf Wache und ausnahmslos in die gleichen Kaltwetterplünnen gekleidet, ähneln sich die Männer alle: mehrere Schichten Flanell und Wolle, bedeckt mit einem schweren wasserdichten Überrock, bauschige, aus weiten Ärmeln ragende Fäustlinge, die dicke Welsh Wig mit Ohrenklappen tief ins Gesicht gezogen, und dazu oft noch ein langer, mehrfach um den Kopf gewickelter Wollschal, so dass nur noch die Spitze der frostgeplagten Nase zu sehen ist. Allerdings trägt jeder Mann seine Wetterplünnen ein wenig anders – etwa mit einem zusätzlichen Halstuch von zu Hause, einer zweiten, über die erste gestülpten Mütze oder vielleicht einem Paar bunter, von der besorgten Mutter, Frau oder Liebsten gestrickter Handschuhe, die unter den Marinefäustlingen herauslugen. Crozier hat gelernt, jeden einzelnen seiner sechsundfünfzig überlebenden Offiziere und Matrosen selbst aus der Ferne und im Dunkeln zu erkennen.
Hickey starrt wie gebannt über den von Eiszapfen bedeckten Bugspriet hinaus, dessen Spitze zehn Fuß tief in einem Kamm aus gefrorenem Seewasser steckt, da der Druck des Eises das Heck der Terror nach oben und den Bug nach unten geschoben hat. Der Kalfaterersmaat ist so in Gedanken oder in die Kälte versunken, dass er seinen Kapitän erst bemerkt, als der sich neben ihn an das Schanzkleid stellt, das sich längst in einen Altar aus Eis und Schnee verwandelt hat. An diesem Altar lehnt die Flinte des Wachpostens. Hier draußen bei dieser Kälte will niemand etwas aus Metall anfassen, auch nicht mit dicken Fäustlingen.
Hickey fährt leicht zusammen, als sich Crozier zu ihm beugt. Der Kapitän der Terror kann das Gesicht des sechsundzwanzigjährigen Unteroffiziers nicht erkennen. Er sieht nur den dampfenden Atem, der durch die vielen Wollschichten um den Kopf des kleinen Mannes dringt und sich sofort in eine Wolke aus Eiskristallen verwandelt, in denen sich das Polarlicht spiegelt.
Im Winter wird auf dem Eis nicht salutiert, es gibt nicht einmal das beiläufige Tippen mit den Fingerknöcheln an die Stirn, mit dem ein Offizier auf See gegrüßt wird. Stattdessen bezeigt Hickey seinem Kapitän den schuldigen Respekt wie alle anderen mit einem schlurfenden Seitenschritt und einem Senken des Kopfs. Wegen der Kälte sind die Wachen von vier auf zwei Stunden verkürzt worden – und weiß Gott, denkt Crozier, auf diesem überfüllten Schiff haben wir dafür wirklich genügend Leute, selbst bei verdoppelten Posten –, doch Hickeys zögerliche Bewegungen machen klar, dass er halb erfroren ist. Wie oft hat Crozier den Wachposten schon eingeschärft, dass sie in Bewegung bleiben müssen – herumgehen, auf der Stelle treten, auf und ab hüpfen, wenn nötig, natürlich stets, ohne den Blick vom Eis zu nehmen. Und trotzdem lungern sie die meiste Zeit so reglos herum, als würden sie in der Südsee leichtbekleidet nach Meerjungfrauen Ausschau halten.
»Sir.«
»Mr. Hickey. Irgendwas zu melden?«
»Nichts seit diesen Schüssen … diesem einen Schuss … vor fast zwei Stunden, Sir. Und vorher, ist noch nicht lange her, da hab ich was gehört, glaub ich zumindest … vielleicht einen Schrei, irgendwas … von hinterhalb des Eisbergs. Ich hab’s Leutnant Irving gemeldet, aber er war der Meinung, dass es wahrscheinlich bloß wieder im Eis rumort hat.«
Crozier hat vor zwei Stunden von dem schussartigen Knall aus der Richtung der Erebus erfahren und ist schnell an Deck gekommen. Doch da sich das Geräusch nicht wiederholte, hat er niemand zu dem anderen Schiff oder überhaupt aufs Eis geschickt, um der Sache nachzugehen. Sich auf die gefrorene See hinauszuwagen, wo in dem Gewirr von Pressrücken und Rinnen dieses … Wesen … lauert, ist der sichere Tod. Botschaften tauschen die Schiffe nur noch in den immer kürzer werdenden Zeiten des trüben mittäglichen Lichts aus. In wenigen Tagen schon wird es überhaupt kein echtes Tageslicht mehr geben, nur noch arktische Nacht. Ununterbrochene Nacht. Hundert Tage lang.
»Vielleicht war es wirklich nur das Eis.« Crozier wundert sich, dass ihm Irving nichts von dem möglichen Schrei berichtet hat. »Auch der Schuss. Nur das Eis.«
»Ja, Sir. Bestimmt war’s das Eis.«
Tatsächlich gibt sich natürlich keiner von beiden mit dieser Erklärung zufrieden, selbst wenn es zutrifft, dass das immer stärker gegen die Terror drängende Packeis ständig poltert, stöhnt, kracht, reißt, dröhnt und kreischt. Ein Schuss aus einer Büchse oder Flinte hat auch aus einer Meile Entfernung einen unverkennbaren Klang, und hier im hohen Norden pflanzt sich der Schall über schier unermessliche Strecken klar und deutlich fort.
Vor allem das Kreischen macht Crozier zu schaffen und reißt ihn manchmal aus dem tiefen Schlaf, von dem er ohnehin jede Nacht höchstens eine Stunde bekommt. Es klingt so sehr nach den Schreien seiner Mutter in ihren letzten Tagen … und es erinnert ihn an die Geschichten seiner alten Großmutter über die Banshees, die mit ihrem heulenden Wehklagen den Tod eines Menschen im Haus ankündigen. Beides hat ihm schon als Junge den Schlaf geraubt.
Langsam dreht sich Crozier um. Seine Wimpern sind bereits mit Eis bedeckt, und seine Oberlippe ist verkrustet von gefrorenem Atem und Rotz. Die Männer haben gelernt, den Bart unter den Schal und den Pullover zu stecken. Dennoch bleibt ihnen oft nichts anderes übrig, als an der Kleidung festgefrorene Haare abzuschneiden. Wie die meisten Offiziere hat Crozier daran festgehalten, sich jeden Morgen zu rasieren. Da jedoch mit der Kohle gespart werden muss, ist das »heiße Wasser«, das ihm der Steward bringt, meistens kaum mehr als getautes Eis, und die Rasur wird leicht zu einer ziemlich schmerzhaften Angelegenheit.
»Ist Lady Silence noch an Deck?«, erkundigt sich Crozier.
»O ja, Sir, sie ist fast immer hier oben.« Hickey flüstert, als dürfte er das nicht laut sagen. Doch selbst wenn Silence sie hören könnte, würde sie ihre Sprache nicht verstehen. Die Männer glauben – und dieser Glaube wird immer stärker, je länger sie von dem Wesen auf dem Eis verfolgt werden –, dass die junge Eskimofrau eine Hexe mit geheimen Kräften ist.
»Sie ist drüben am Backbordposten bei Leutnant Irving«, ergänzt Hickey.
»Leutnant Irving? Seine Wache ist doch schon seit über einer Stunde vorbei.«
»Stimmt, Sir. Aber wo Lady Silence ist, da ist in letzter Zeit meist auch der Leutnant, wenn ich das so sagen darf, Sir. Geht sie nicht unter Deck, geht er auch nicht unter Deck. Das heißt, bis er dann doch muss … Keiner von uns hält es so lange hier draußen aus wie diese He… diese Frau.«
»Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und behalten Sie das Eis im Auge, Mr. Hickey.«
Croziers scharfer Ton lässt den Kalfaterersmaat erneut zusammenfahren. Mit einem kurzen Schlurfen deutet er den üblichen Gruß an und kehrt die weiße Nase wieder der Dunkelheit jenseits des Bugs zu.
Crozier stapft über das Deck in Richtung Backbordausguck. Nach drei Wochen trügerischer Hoffnung auf ein Entrinnen im August hat er im vergangenen Monat das Schiff winterfest machen lassen. Wieder hat er Befehl gegeben, die unteren Rahen zur Längsachse des Schiffs zu brassen, um sie als Firstbalken zu verwenden. Dann wurde mit den Spieren, die während der zuversichtlichen Wochen unter Deck verstaut worden waren, erneut das pyramidenartige Zelt über den größten Teil des Hauptdecks gespannt. Doch obwohl die Männer jeden Tag stundenlang damit beschäftigt sind, Wege durch den knietiefen, als Wärmeschutz auf dem Deck belassenen Schnee zu schaufeln, das Eis mit Picken und Meißeln wegzuhacken, den unter dem Segeltuch entstandenen Nebel zu vertreiben und Sandstrecken für besseren Halt auszustreuen, bleibt immer eine dünne Eisschicht liegen. So geraten Croziers Bewegungen auf dem krängenden Deck manchmal eher zu einem anmutigen Gleiten.
Für diese Wache ist der Schiffsjunge Tommy Evans als Posten eingeteilt. Crozier erkennt den jüngsten Mann an Bord an der lächerlichen grünen Pudelmütze, die ihm offenbar seine Mutter gestrickt hat und die er sich immer über seine unförmige Welsh Wig stülpt. Evans hat sich zehn Schritt nach achtern begeben, offenbar damit der Dritte Leutnant Irving und Silence ein wenig für sich sein können.
Bei diesem Anblick würde Kapitän Crozier am liebsten irgendjemandem – oder auch gleich allen – einen kräftigen Tritt in den Hintern versetzen.
In ihrem Kapuzenanorak und ihren Pelzstiefeln wirkt die Eskimofrau wie ein kleiner rundlicher Bär. Dem großgewachsenen Leutnant hat sie halb den Rücken zugekehrt. Irving steht sehr dicht neben ihr am Schanzkleid – zwar ohne sie zu berühren, aber doch näher, als ein Offizier und Gentleman einer Dame bei einem Gartenfest oder auf einem Vergnügungsschiff kommen sollte.
»Leutnant Irving.« Eigentlich wollte Crozier den Gruß nicht so herausbellen, aber er ist auch nicht unglücklich darüber, dass der junge Mann hochfährt, als hätte man ihn mit der Spitze eines scharfen Degens angestoßen, und fast das Gleichgewicht verliert. Mit der linken Hand hält er sich am Schanzkleid fest und salutiert mit der rechten, wie es seine Gepflogenheit ist, obwohl er inzwischen weiß, dass das auf einem Schiff im Eis nicht üblich ist.
Es ist eine jämmerliche Ehrenbezeigung, wie Crozier findet. Nicht nur, weil die unförmigen Fäustlinge, die Welsh Wig und die vielen Schichten Kaltwetterplünnen den jungen Irving aussehen lassen wie ein salutierendes Walross, sondern obendrein, weil der Bursche den Schal von seinem glattrasierten Gesicht hat gleiten lassen – vielleicht um Silence mit seinen hübschen Zügen zu beeindrucken – und ihm inzwischen zwei derart lange Eiszapfen von den Nasenlöchern baumeln, dass die Ähnlichkeit mit einem Walross sich fast ins Groteske steigert.
»Rühren«, blafft Crozier. Gottverdammter Narr, fügt er stumm hinzu.
Irvings stocksteife Haltung ändert sich nicht. Der Blick, den er Silence zuwirft, streift nur die Rückseite ihrer haarigen Kapuze. Er öffnet den Mund zum Reden, doch da ihm anscheinend nichts einfällt, schließt er ihn wieder. Seine Lippen sind so weiß wie seine durchfrorene Haut.
»Das ist nicht Ihre Wache, Leutnant Irving.« Noch immer ist Croziers Stimme scharf wie ein Peitschenknall.
»Aye aye, Sir. Ich meine, nein, Sir. Ich meine, Sie haben recht, Kapitän Crozier. Ich meine …« Irving macht den Mund zu, doch das Klappern seiner Zähne raubt dieser Geste ein wenig die Wirkung. Nach drei oder vier Stunden in dieser Kälte können Zähne auseinanderbrechen und zwischen den zusammengepressten Kiefern regelrecht in Splitter aus Schmelz und Knochen zerspringen. Crozier weiß aus Erfahrung, dass man manchmal kurz vor dem Zerbersten der Zähne hören kann, wie der Schmelz zerreißt.
»Warum sind Sie noch hier draußen, John?«
Irving möchte blinzeln, aber seine Augenlider sind buchstäblich festgefroren. »Sie haben mir befohlen, auf unseren Gast aufzupassen, Sir … Sie haben doch gesagt, ich soll ein Auge auf Silence haben … mich um sie kümmern.«
Croziers Seufzer bricht in Form von Eiskristallen aus ihm hervor, die kurz in der Luft schweben und dann wie winzige Diamanten aufs Deck rieseln. »Damit habe ich nicht jede Minute gemeint, Leutnant Irving. Ich habe Ihnen Befehl erteilt, sie zu beobachten und mir zu melden, was sie treibt, um dafür zu sorgen, dass sie nichts anstellt, nicht zu Schaden kommt und von keinem der Männer … kompromittiert wird. Glauben Sie etwa, dass sie hier an Deck in Gefahr ist, kompromittiert zu werden, Leutnant Irving?«
»Nein, Sir.« Irvings Äußerung klingt mehr nach einer Frage als nach einer Antwort.
»Haben Sie eine Ahnung, wie lange es dauert, bis unbedeckte Körperteile hier draußen erfrieren?«
»Nein, Sir. Ich meine, ja. Wahrscheinlich ziemlich kurz.«
»Allmählich sollten Sie es wissen, Leutnant Irving. Sie hatten schon sechs Erfrierungen, und dabei hat der Winter noch gar nicht richtig angefangen.«
Leutnant Irving nickt trübsinnig.
»Es dauert weniger als eine Minute, bis ein unbedeckter Finger oder Daumen – oder ein ähnliches Körperanhängsel – durch und durch gefroren ist.« Crozier ist sich sehr wohl darüber im Klaren, dass das der reinste Humbug ist. Bei lediglich fünfundvierzig Grad minus dauert es wesentlich länger, aber er hofft einfach, dass Irving das nicht weiß. »Danach bricht das ungeschützte Körperteil ab wie ein Eiszapfen.«
»Jawohl, Sir.«
»Sind Sie also wirklich der Meinung, dass unser Gast hier an Deck Gefahr läuft … kompromittiert zu werden, Mr. Irving?«
Irving scheint sich seine Antwort genau zu überlegen. Es ist durchaus möglich, erkennt Crozier plötzlich, dass sich der Dritte Leutnant schon viel zu viele Gedanken über diese Frage gemacht hat.
»Gehen Sie unter Deck, John«, fährt Crozier fort, »und lassen Sie von Dr. MacDonald Gesicht und Finger inspizieren. Ich schwöre bei Gott, wenn Sie sich schon wieder ernste Erfrierungen geholt haben, dann kürze ich Ihren Sold um einen vollen Monatsbetrag und schreibe obendrein noch an Ihre Mutter.«
»Jawohl, Sir. Danke, Sir.« Irving macht erneut Anstalten zum Salutieren, überlegt es sich gerade noch anders und verschwindet, eine Hand noch immer halb erhoben und Silence keines Blickes mehr würdigend, unter der Zeltplane in Richtung Niedergang.
Wieder seufzt Crozier. Er mag John Irving. Der Junge hat sich freiwillig gemeldet – zusammen mit zwei Kameraden von der HMS Excellent, dem jetzigen Zweiten Leutnant Hodgson und dem Ersten Unterleutnant Hornby –, aber die Excellent ist ein verdammter Dreidecker, der schon alt war, bevor Noah Flaum auf der Oberlippe hatte. Das Schiff hatte bereits seit fünfzehn Jahren ohne Masten vor Anker gelegen und diente als Schulschiff für die aussichtsreichsten Geschützoffiziere. »So leid es mir tut, meine Herren«, erklärte Crozier den Jungen an ihrem ersten Tag an Bord – der Kapitän hatte an diesem Tag mehr als das übliche Quantum getrunken –, »wenn Sie sich umsehen, wird Ihnen auffallen, dass die Terror und die Erebus zwar als Mörserschiffe gebaut wurden, aber zusammen nicht über ein einziges Geschütz verfügen. Ich kann Ihnen versichern, meine jungen Herren Freiwilligen von der Excellent, dass wir abgesehen von den Büchsen der Seesoldaten und den in der Spirituslast eingeschlossenen Schrotflinten so waffenlos wie ein neugeborener Säugling sind. So waffenlos wie der verdammte Adam in seinem verdammten Geburtstagskleid. Mit anderen Worten, meine Herren, als Waffenkundige sind Sie für diese Forschungsreise ungefähr so nützlich wie Zitzen an einem männlichen Bären.«
Croziers Sarkasmus konnte die Begeisterung der jungen Geschützoffiziere jedoch nicht dämpfen; wenn überhaupt, waren Irving und die beiden anderen danach sogar noch mehr darauf erpicht, für mehrere Winter im Eis festzusitzen. Allerdings hatte sich das Ganze an einem warmen Maitag des Jahres 1845 in England abgespielt.
»Und jetzt hat sich dieser bedauernswerte Milchbart in eine Eskimofrau verschossen«, schimpft Crozier leise vor sich hin.
Als hätte sie seine Worte verstanden, dreht sich Silence langsam zu ihm um.
Meist ist ihr Gesicht tief in der großen Kapuze vergraben, oder ihre Züge werden von der weiten Halskrause aus Wolfspelz verdeckt, aber heute sind ihre winzige Nase, die großen Augen und der volle Mund zu sehen. Das funkelnde Polarlicht spiegelt sich in ihrer schwarzen Iris.
Kapitän Francis Rawdon Moira Crozier findet diese Person in keinster Weise reizvoll; sie hat so viel von einer Wilden an sich, dass er sie nicht als vollwertigen Menschen und schon gar nicht als körperlich anziehend wahrnehmen kann. Zudem sind sein Geist und seine unteren Körperregionen noch immer erfüllt von deutlichen Erinnerungen an Sophia Cracroft. Dennoch kann Crozier verstehen, warum sich Irving, weit entfernt von der Heimat, der Familie und irgendeiner Liebsten, in diese Heidin verliebt hat. Neben den tragischen Umständen ihrer Ankunft, die zum Tod ihres männlichen Begleiters geführt haben und so sonderbar verwoben sind mit den ersten Angriffen der monströsen Wesenheit dort draußen in der Finsternis, muss auch ihre Fremdartigkeit auf den hoffnungslosen jungen Romantiker John Irving eine magische Anziehung ausüben wie eine Flamme auf eine Motte.
Crozier dagegen hat 1843 in Van Diemen’s Land und noch ein letztes Mal in England, wenige Monate vor dem Aufbruch der Expedition, festgestellt, dass er für Romantik zu alt ist. Und zu irisch. Und zu gewöhnlich.
Im Augenblick wünscht er sich nur, dass diese junge Frau einen Spaziergang hinaus aufs dunkle Eis macht und nie mehr zurückkommt.
Als wäre es gestern gewesen, erinnert sich Crozier an den Tag vor vier Monaten, da Dr. MacDonald sie untersucht und danach Franklin und ihm Bericht erstattet hat. Am selben Nachmittag noch war der Eskimomann in ihrer Begleitung seinen Verletzungen erlegen.
Nach MacDonalds fachlicher Meinung war das Eskimomädchen zwischen fünfzehn und zwanzig Jahre alt – bei Ureinwohnern war das schwer zu beurteilen – und, obwohl die Menarche schon eingetreten war, allem Anschein nach Virgo intacta. Außerdem nannte Dr. MacDonald auch den Grund, weshalb sie, selbst nachdem ihr Vater oder Mann niedergeschossen worden war, keinen Laut von sich gab: Sie hatte keine Zunge. Nach Dr. MacDonalds Dafürhalten war ihre Zunge allerdings nicht abgeschnitten, sondern nahe der Wurzel abgebissen worden – entweder von ihr selbst oder von jemand anderem.
Crozier war erstaunt, weniger über die fehlende Zunge als darüber, dass dieses Eskimoweib noch Jungfrau war. Als er damals mit Parrys Expedition in der Nähe eines Eskimodorfes überwinterte, verbrachte er genug Zeit in der Arktis, um zu begreifen, dass Geschlechtsverkehr für die Einheimischen etwas ganz Belangloses war. Geschlechtliche Begegnungen nahmen sie so leicht, dass die Männer Walfängern und Forschern im Austausch gegen billigen Ramsch ihre Frauen und Töchter anboten. Manchmal gaben sich die Frauen auch einfach aus eigenem Antrieb hin und schwatzten kichernd mit anderen Frauen oder Kindern, während sich irgendwelche Seeleute stöhnend und schnaufend zwischen ihren Beinen abmühten.
Sie waren wie Tiere. Für Francis Crozier hätten die Pelze und haarigen Felle, die sie trugen, genauso gut Bestandteil ihres eigenen Körpers sein können.
Der Kapitän hebt die eingepackte Hand an den Schirm seiner Mütze, die in zwei schwere Schalschichten eingewickelt ist und daher unmöglich gelüftet werden kann. »Meine Verehrung, Madame. Darf ich vorschlagen, dass Sie sich möglichst bald in Ihr Quartier unter Deck verfügen? Es wird allmählich doch etwas frisch.«
Silence starrt ihn an. Sie blinzelt nicht, wenngleich ihre langen Wimpern seltsamerweise frei von Eis sind. Und natürlich spricht sie nicht. Sie beobachtet ihn.
Wieder tippt sich Crozier symbolisch an die Mütze und setzt seinen Rundgang um das Deck fort. Er steigt hinauf zum erhöhten Heck, dann auf der Steuerbordseite wieder hinunter und bleibt auf ein kurzes Wort bei den anderen zwei Wachen stehen, damit Irving Zeit hat, unter Deck seine Plünnen abzulegen. Der Kapitän will dem Leutnant nicht das Gefühl geben, ihm im Nacken zu sitzen.
Er beendet gerade sein Gespräch mit dem letzten schlotternden Posten, dem Vollmatrosen Shanks, als der Gefreite Wilkes, der jüngste der Seesoldaten an Bord, unter der Zeltplane hervorstürzt. Wilkes hat lediglich zwei lose Schichten über seine Uniform geworfen, und seine Zähne beginnen schon zu klappern, noch bevor er seine Nachricht überbracht hat.
»Einen schönen Gruß von Mr. Thompson, Sir. Der Maschinist lässt ausrichten, Sie möchten so schnell wie möglich hinunter zur Last kommen.«
»Warum?« Crozier weiß, wenn der Dampfkessel endgültig entzweigegangen ist, dann sind sie erledigt.
»Bitte vielmals um Verzeihung, Sir, aber Mr. Thompson sagt, Sie werden gebraucht, weil der Matrose Manson kurz vor der Meuterei steht, Sir.«
Crozier fährt auf. »Meuterei?«
»Kurz davor, hat Mr. Thompson gesagt, Sir.«
»Drück dich deutlicher aus, Gefreiter Wilkes.«
»Manson will keine Kohlensäcke mehr an der Totenkammer vorbeitragen, Sir. Und auch nicht mehr runter in die Last steigen. Bei allem Respekt, sagt er, aber er weigert sich. Er kommt auch nicht rauf, sondern hockt unten mit dem Arsch auf der Treppe und rührt sich nicht von der Stelle.«
»Was soll dieser Unfug?« Crozier spürt die ersten Regungen vertrauten irischen Zorns in sich hochsteigen.
»Es sind die Geister, Kapitän Crozier.« Die Zähne des Gefreiten Wilkes klappern noch stärker. »Wir alle hören sie, wenn wir Kohle schleppen oder Vorräte von ganz unten holen. Darum gehen doch die Männer nicht mehr unter das Orlopdeck, außer die Offiziere befehlen es ihnen, Sir. Dort in der Last ist was, da drunten im Dunkeln. Irgendwas kratzt und klopft da im Schiff, Sir. Und das ist nicht nur das Eis, das von draußen drückt. Es kommt von innen. Manson ist sich sicher, dass es sein alter Maat Walker ist … er und die anderen Leichen in der Totenkammer, die an den Planken scharren, weil sie rauswollen.«
Crozier unterdrückt den Impuls, den Gefreiten mit den tatsächlichen Gegebenheiten zu beruhigen. Der junge Wilkes würde das vielleicht nicht als sonderlich beruhigend empfinden.
Die erste schlichte Tatsache ist, dass das schabende Geräusch aus der Totenkammer mit größter Wahrscheinlichkeit von den Hunderten oder Tausenden großen schwarzen Ratten stammt, die sich an Wilkes’ gefrorenen Maaten gütlich tun. Crozier weiß viel mehr über diese Wanderratten als der junge Seesoldat. Zum Beispiel dass sie Nachttiere sind. Das bedeutet, dass sie im langen arktischen Winter ununterbrochen ihr Unwesen treiben. Außerdem haben diese Geschöpfe Zähne, die ständig nachwachsen. Und das wiederum bedeutet, dass das gottverfluchte Geschmeiß dauernd an irgendetwas nagen muss. Er hat schon erlebt, dass sie Eichenfässer der Royal Navy, zolldicke Büchsen und sogar Bleiplatten durchgenagt haben. Die Ratten dort unten haben mit den gefrorenen Überresten des Matrosen Walker und seiner vier unglückseligen Kameraden – darunter Croziers Zweiter Steuermann – bestimmt weniger Schwierigkeiten als ein Seemann mit einem starren Streifen Salzfleisch.
Unglücklicherweise glaubt Crozier nicht, dass Manson und die anderen nur die Ratten hören.
Aus der traurigen Erfahrung seiner zwölf Winter im Eis weiß Crozier, dass Ratten beim Verspeisen toter Seeleute zwar gründlich, aber auch ziemlich still vorgehen – bis auf das gierige Quieken, mit dem die ausgehungerten Nager übereinander herfallen, wenn sie erst einmal Blut geleckt haben.
Nein, das Kratzen und Klopfen unten in der Last hat eine andere Ursache.
Crozier verzichtet darauf, den Gefreiten Wilkes an eine weitere schlichte Tatsache zu erinnern: Im Laderaum unter der Wasserlinie aus gefrorenem Seeeis wäre es normalerweise völlig sicher, wenn auch furchtbar kalt. Aber der Druck des Eises hat das Heck der Terror mehr als ein Dutzend Fuß höher geschoben, als es liegen müsste. Der Rumpf ist zwar noch eingeschlossen, doch nur von mehreren Hundert übereinandergetürmten Tonnen zerklüftetem Eis und zusätzlichen Tonnen Schnee, die die Männer an den Längsseiten des Schiffs bis wenige Fuß vor dem Schanzkleid aufgeschichtet haben, um im Winter besser vor der Kälte geschützt zu sein.
Irgendetwas, so argwöhnt Francis Crozier, hat sich durch die Tonnen von Schnee gegraben und durch die steinharten Eisplatten gebohrt, um zum Rumpf des Schiffs zu gelangen. Irgendwie hat dieses Wesen geahnt, welche Teile des Rumpfinneren aus Eisen bestehen, wie zum Beispiel die Wassertanks, und hat einen der wenigen hohlen äußeren Staubereiche gefunden – die Totenkammer –, die direkt in das Schiff führen. Und jetzt scharrt und hämmert es gegen die Wände, um ins Innere zu gelangen.
Crozier weiß, dass es auf der ganzen Welt nur ein Wesen von solch übernatürlicher Kraft, tödlicher Beharrlichkeit und heimtückischer Intelligenz gibt. Das Ungeheuer aus dem Eis versucht, von unten ins Schiff einzudringen.
Ohne ein weiteres Wort an den Gefreiten Wilkes begibt sich Kapitän Crozier unter Deck, um nach dem Rechten zu sehen.
2
Franklin
51°29′ NÖRDLICHE BREITE | 0°0′ WESTLICHE LÄNGE LONDON, MAI 1845
Er war und blieb für immer der Mann, der seine Stiefel gegessen hatte.
Vier Tage vor der Abreise erkrankte Sir John Franklin an der Grippe, die schon seit einiger Zeit umging. Er war sicher, dass er sich nicht bei einem der einfachen Seemänner und Stauer angesteckt hatte, die am Londoner Hafen die Schiffe beluden, und auch nicht bei einem der hundertdreiunddreißig Matrosen und Offiziere seiner Mannschaft – die waren alle gesund wie Ackergäule. Nein, er hatte sie sich von einem dieser schwächlichen Stutzer aus Lady Janes Gesellschaftssalons geholt.
Der Mann, der seine Stiefel gegessen hatte.
Bei den Gattinnen arktischer Helden war es Brauch, eine Fahne zu nähen, die am nördlichsten Punkt der Reise oder in diesem Fall nach Vollendung der Nordwestpassage gehisst werden sollte. Franklins Frau Jane saß gerade über ihren letzten Stichen an dem seidenen Union Jack, als er nach Hause kam. Sir John trat in die Wohnstube und sank zusammen, kaum dass er neben ihr auf dem Rosshaarsofa Platz genommen hatte. Später konnte er sich nicht erinnern, die Stiefel ausgezogen zu haben. Jemand musste es für ihn getan haben – entweder Jane oder eine Dienstmagd. Bald lag er halb dösend und mit schmerzendem Kopf da, sein Magen krampfte sich stärker zusammen als je auf See, und seine Haut brannte vom Fieber. Ununterbrochen plappernd erzählte ihm Lady Jane von ihren vielen Verpflichtungen des heutigen Tages. Sir John bemühte sich zuzuhören, während ihn Fieberwellen davontrugen.
Er war der Mann, der seine Stiefel gegessen hatte, und zwar schon seit dreiundzwanzig Jahren, seit seiner Rückkehr von der ersten, gescheiterten Überlandexpedition durch Nordkanada mit dem Ziel, die Nordwestpassage zu finden. Er erinnerte sich noch gut an das abschätzige Lachen und die Witze, als er 1822 wieder in England eintraf. Franklin hatte auf dieser Reise tatsächlich seine Stiefel gegessen – und noch weit Schlimmeres: zum Beispiel Tripe de Roche, einen widerlichen Brei aus kuttelartigen Flechten, die man von Felsen kratzen musste. Vom Hunger geschwächt und verwirrt, hatte Franklin nach zwei Jahren seine Leute in drei Gruppen aufgeteilt, die sich getrennt durchschlagen und um ihr Überleben kämpfen sollten. In ihrer Not hatten er und die bei ihm verbliebenen Männer das Obermaterial ihrer Schuhe und Stiefel gekocht und verspeist. Ganze Tage hatte Sir John – damals einfach noch John, zum Ritter wurde er erst für sein Versagen bei einer späteren, völlig missratenen Expedition über Land und See geschlagen – im Jahr 1821 nichts anderes gekaut als Fetzen ungegerbtes Leder. Seine Männer hatten ihre Schlafdecken aus Büffelfell gegessen. Und einige waren noch weitergegangen.
Er selbst hatte nie Menschenfleisch angerührt.
Bis auf den heutigen Tag plagten Franklin Zweifel, ob es den anderen Expeditionsteilnehmern, einschließlich seines engen Freundes und stellvertretenden Kommandanten Dr. John Richardson, gelungen war, dieser Versuchung zu widerstehen. Zu viel war geschehen, als die Gruppen getrennt voneinander durch die arktischen Eiswüsten und Wälder stolperten und mit letzter Kraft versuchten, zu Franklins kleinem behelfsmäßigen Fort Enterprise und den echten Forts Providence und Resolution zurückzugelangen.
Neun Weiße und ein Eskimo starben. Neun von einundzwanzig Männern, mit denen der dreiunddreißigjährige Leutnant John Franklin, schon damals pummelig und mit schütterem Haupthaar, 1819 von Fort Resolution aus aufgebrochen war. Dazu ein indianischer Führer, den sie unterwegs aufgelesen hatten und dem Franklin untersagt hatte, die Truppe zu verlassen und sich auf eigene Faust durchzuschlagen. Zwei Männer waren kaltblütig ermordet worden. Und mindestens einer von ihnen wurde von den anderen aufgegessen. Aber nur ein Engländer fand den Tod. Nur ein einziger echter Weißer. Die anderen waren lediglich französische Voyageurs oder Indianer. Das war immerhin ein kleiner Erfolg – nur ein weißer Engländer tot, auch wenn alle anderen am Ende nur noch stammelnde Skelette mit Bart waren.
Auch wenn alle anderen bloß überlebten, weil George Back, dieser verteufelte, lüsterne Seekadett, eintausendzweihundert Meilen auf Schneeschuhen zurückgelegt hatte, um Vorräte und – noch wichtiger – weitere Indianer mitzubringen, die Franklin und seine verhungernden Männer ernähren und versorgen konnten.
Dieser verfluchte Back. Alles andere als ein guter Christ. Arrogant. Kein wahrer Gentleman, obgleich er später für eine Arktisexpedition zum Ritter geschlagen wurde, eine Reise mit ebenderselben Terror, die Sir John jetzt befehligte.
Auf dieser Expedition Backs war die Terror von einem hochschießenden Turm aus Eis fünfzig Fuß in die Luft geschleudert worden und dann mit solcher Gewalt wieder aufgeschlagen, dass sämtliche Eichenplanken des Rumpfs beschädigt wurden. Doch George Back brachte das leckende Schiff den ganzen weiten Weg zurück zur irischen Küste und landete nur wenige Stunden, bevor es gesunken wäre. Die Mannschaft hatte Ketten um den Rumpf gespannt, die die Planken so lange zusammenhielten, bis das Schiff die Heimat erreicht hatte. Alle Männer litten unter Skorbut – schwarz verfärbtes Zahnfleisch, blutende Augen, wackelnde Zähne – und unter den damit einhergehenden Sinnestäuschungen und Wahnvorstellungen.
Natürlich wurde Back danach in den Ritterstand erhoben. So verfuhren eben England und die Admiralität nach einer kläglich gescheiterten Polarexpedition mit schweren Verlusten an Menschenleben. Hatte man überlebt, bekam man einen Titel und eine Parade. Nach der Heimkehr von seiner zweiten Landvermessungsexpedition in den hohen Norden Amerikas im Jahr 1827 war Franklin von König George IV. höchstpersönlich zum Ritter geschlagen worden. Die Geographische Gesellschaft von Paris verlieh ihm eine Goldmedaille. Man übertrug ihm das Kapitänsamt für die schöne kleine, mit sechsundzwanzig Geschützen bestückte Fregatte HMS Rainbow und beorderte ihn ins Mittelmeer, eine Verlegung, die jeder Kapitän der Royal Navy täglich mit Stoßgebeten herbeiflehte. So kam es, dass er um die Hand einer engen Freundin seiner verstorbenen ersten Frau Eleanor anhalten konnte: der schönen, tatkräftigen, freimütigen Jane Griffin.
»Also habe ich Sir James beim Tee erklärt«, bemerkte Jane soeben, »dass mir das Ansehen und die Ehre meines geliebten Sir John unendlich viel teurer sind als der selbstsüchtige Genuss seiner Gesellschaft, selbst wenn er vier Jahre in der Fremde weilt … oder fünf.«
Wie hieß gleich wieder die fünfzehnjährige Ahtna-Indianerin, wegen der sich Back im Winterquartier in Fort Enterprise hatte duellieren wollen?
Greenstockings. Das war der Name. Greenstockings.
Dieses Mädchen war durch und durch schlecht. Schön, ja, aber schlecht. Sie besaß keinerlei Schamgefühl. Obgleich er sich nach Kräften bemühte, nie in ihre Richtung zu schauen, war Franklin in einer hellen Mondnacht einmal Zeuge geworden, wie sie aus ihren heidnischen Gewändern schlüpfte und splitternackt durch die halbe Kajüte schlich.
Er war damals bereits vierunddreißig Jahre alt, doch sie war die erste unbekleidete Frau, die er zu Gesicht bekam, und bis heute hatte er keine schönere erblickt. Die dunkle Haut. Die Brüste schon schwer wie runde Früchte, aber trotzdem die einer Halbwüchsigen, die Brustwarzen noch nicht erhoben, die Vorhöfe seltsam glatte, dunkelbraune Kreise. So sehr er auch darum gebetet hatte, Sir John hatte dieses Bild in dem Vierteljahrhundert, das seither vergangen war, nicht aus seinem Gedächtnis tilgen können. Das Schamhaar des Mädchens zeigte nicht das klassische V, das er später bei seiner ersten Frau Eleanor erspäht hatte – ein einziges, flüchtiges Mal, als sie sich fürs Bad vorbereitete, da Eleanor während ihrer seltenen Liebesbegegnungen nie auch nur den geringsten Lichtschimmer duldete –, und hatte auch keine Ähnlichkeit mit dem spärlicheren, aber zugleich wilderen, weizenfarbenen Busch seiner jetzigen Frau Jane. Nein, das Indianermädchen Greenstockings hatte einfach ein schmales, aber tiefdunkles senkrechtes Vlies über dem Geschlecht. So zart wie eine Rabenfeder. Und so pechschwarz wie die Sünde.
Der schottische Seekadett Robert Hood hatte bereits während des ersten, schier endlosen Winters in der Blockhütte, der Franklin den Namen Fort Enterprise gegeben hatte, mit einer anderen Indianerin einen Bankert gezeugt und verliebte sich nun prompt in die junge Ahtna-Squaw Greenstockings. Das Mädchen hatte davor schon bei dem anderen Seekadetten George Back gelegen, doch als Back zu einem Jagdausflug aufbrach, wechselte sie den Gegenstand ihrer geschlechtlichen Ergebenheit mit einer Leichtigkeit, wie man sie nur bei Heiden und Wilden fand.
Franklin erinnerte sich noch gut an das Ächzen der Leidenschaft in der langen Nacht – keine Leidenschaft von wenigen Minuten, wie er sie mit Eleanor erlebt hatte (selbstverständlich ohne je ein Stöhnen oder sonst ein Geräusch von sich zu geben, weil sich das für einen Gentleman nicht gehörte), oder zwei kurze Aufwallungen der Ekstase wie in jener denkwürdigen Nacht in den Flitterwochen mit Jane. Nein, Hood und Greenstockings trieben es ein halbes Dutzend Mal. Kaum war es in dem benachbarten Anbau still geworden, da ging es wieder von vorn los: Lachen, schwaches Kichern, dann das leise Stöhnen, das sich erneut zu Schreien steigerte, mit denen die schamlose Kindfrau Hood anfeuerte.
Jane Griffin war sechsunddreißig Jahre alt, als sie am 5. Dezember 1828 den jüngst in den Ritterstand erhobenen Sir John Franklin ehelichte. Die Flitterwochen verbrachten sie in Paris. Franklin hatte nicht viel übrig für die Stadt und auch nicht für die Franzosen, aber den Luxus des Hotels und die erlesenen Speisen wusste er durchaus zu schätzen.
Seine geheime Furcht damals war, dass sie bei ihren Reisen auf dem Kontinent diesem Roget über den Weg laufen könnten – Peter Mark Roget, der für ein gewisses literarisches Aufsehen gesorgt hatte mit der geplanten Veröffentlichung seines albernen Wörterbuchs, oder was es auch immer war. Dieser Mann hatte einmal um Jane Griffins Hand angehalten, war jedoch genauso abgewiesen worden wie alle anderen Freier in ihren jüngeren Jahren. Später warf Franklin einen Blick in Janes Tagebücher aus dieser Zeit. Vor sich selbst rechtfertigte er sein Vergehen mit dem Gedanken, dass sie die in Kalbsleder gebundenen Bände absichtlich so offen hingestellt hatte, damit er sie finden und lesen konnte. Dort erblickte er in der strengen, makellosen Schrift seiner geliebten Gemahlin jenen Satz, den sie an dem Tag geschrieben hatte, als Roget schließlich eine andere geheiratet hatte: »Die Liebe meines Lebens ist dahin.«
Sechs nicht enden wollende arktische Nächte lang hatte sich Robert Hood mit Greenstockings seinem lautstarken Vergnügen hingegeben, als schließlich sein Kamerad George Back von dem Jagdausflug mit den Indianern zurückkehrte. Die beiden Männer vereinbarten für den nächsten Tag bei Sonnenaufgang – ungefähr zehn Uhr morgens – ein Duell auf Leben und Tod.
Franklin war ratlos. Nicht einmal bei den mürrischen Voyageurs und den verachtungsvollen Indianern hatte sein Wort Gewicht. Wie hätte er da den eigensinnigen Hood und den aufbrausenden Back bändigen sollen?
Beide Seekadetten waren Künstler und Kartographen. Seitdem traute Franklin keinem Künstler mehr über den Weg. In Paris, während ein Bildhauer Lady Janes Hände modellierte, und auch hier in London, als einen Monat lang dieser parfümierte Geck erschien, um ihr offizielles Porträt in Öl zu malen, hatte er sie keine Sekunde mit diesen Männern allein gelassen.
Back und Hood wollten sich also im Morgengrauen duellieren, und John Franklin konnte nichts anderes tun, als sich in der Hütte zu verkriechen und zu beten, dass der Ausgang des Zweikampfs – ob Tod oder Verwundung – seiner ohnehin schon gefährdeten Expedition nicht den letzten Hauch von Vernunft rauben würde. In seinen Befehlen war nirgends davon die Rede gewesen, dass er für die eintausendzweihundert Meilen lange Reise über Land, auf Flüssen und durch Küstengewässer Lebensmittel mitbringen sollte. Aus seiner eigenen Tasche hatte er genügend Vorräte beschafft, um die sechzehn Männer einen Tag lang zu verpflegen. Franklin hatte angenommen, dass danach die Indianer für sie jagen und sie mit ausreichend Nahrung versorgen würden – schließlich trugen die Führer auch seine Taschen und trieben sein Birkenrindenkanu mit ihren Paddeln an.
Die Birkenrindenkanus waren im Übrigen ein Fehler gewesen. Dreiundzwanzig Jahre später war er bereit, das zuzugeben – zumindest sich selbst gegenüber. Nach nur wenigen Tagen im eisdurchsetzten Wasser der Nordküste, die sie über eineinhalb Jahre nach dem Aufbruch von Fort Resolution erreicht hatten, begannen die zerbrechlichen Boote auseinanderzufallen.
Mit geschlossenen Augen, brennender Stirn und dröhnendem Kopf lauschte Franklin halb auf den ununterbrochenen Strom von Janes Geplapper und dachte an den Morgen zurück, als er in seinem schweren Schlafsack gekauert und die Augen zugedrückt hatte, während Back und Hood draußen vor der Hütte ihre fünfzehn Schritte zurücklegten und sich zum Schießen umwandten.
Die vermaledeiten Indianer und die vermaledeiten Voyageurs, die in vieler Hinsicht kaum zivilisierter waren, behandelten das Duell auf Leben und Tod wie ein unterhaltsames Schauspiel. Und Greenstockings, das wusste er noch, glühte an diesem Morgen schier vor erotischer Ausstrahlung.
Obwohl er die Hände auf die Ohren presste, konnte Franklin alles deutlich hören: die Aufforderung zum Gehen, Wenden und Zielen und schließlich den Befehl zum Schießen.
Dann knackte es zweimal. Lautes Lachen aus der Menge.
In der Nacht hatte der alte schottische Seemann, der die Schritte abzählte, dieser raue, ungehobelte John Hepburn, Pulver und Kugeln aus den sorgfältig vorbereiteten Pistolen entfernt.
Beschämt durch das beharrliche Gelächter oberschenkelklopfender Voyageurs und Indianer, staksten Hood und Back in entgegengesetzter Richtung davon. Bald danach erteilte Franklin George Back den Befehl, zu den Forts zurückzukehren und bei der Hudson’s Bay Company zusätzlichen Proviant einzukaufen. Back blieb fast den ganzen Winter fort.
Franklin hatte seine Stiefel gegessen und Flechten von Felsen gekratzt, um sich davon zu ernähren – ein schleimiger Brei, den jeder englische Köter wieder von sich gegeben hätte. Doch Menschenfleisch hatte er nie zu sich genommen.
Ein langes Jahr nach dem verhinderten Duell jagte der halb wahnsinnige Irokese Michel Teroahaute aus Richardsons Gruppe, von der sich Franklin mit seinen Leuten inzwischen getrennt hatte, dem Seekadetten, Künstler und Kartographen Robert Hood eine Kugel mitten in die Stirn.
Eine Woche vor dem Mord hatte der Indianer der Gruppe ein streng riechendes Stück Fleisch gebracht und behauptet, es stamme von einem Wolf, der entweder von einem Rentier aufgespießt oder von Teroahaute selbst mit einem Horn erlegt worden war – die Geschichte des Indianers veränderte sich ständig. Die völlig Ausgehungerten kochten und aßen das Fleisch, doch bevor es ganz verspeist war, bemerkte Dr. Richardson die Ahnung einer Tätowierung auf der Haut. Der Doktor war sich sicher, wie er Franklin später anvertraute, dass Teroahaute zur Leiche eines in der gleichen Woche gestorbenen Voyageurs zurückgekehrt war.
Wenige Tage später waren der Indianer und der schon im Sterben liegende Hood allein im Lager, als Richardson, der weggegangen war, um Flechten von den Felsen zu schaben, einen Schuss hörte. Selbstmord, beteuerte Teroahaute, doch Dr. Richardson, der als Arzt schon einige Selbstmordwunden gesehen hatte, erkannte sofort, dass die Position der Kugel in Robert Hoods Gehirn einen selbst abgefeuerten Büchsenschuss ausschloss.
Nun bewaffnete sich der Indianer mit einem britischen Bajonett, einer Büchse, zwei geladenen und halb gespannten Pistolen und einem Messer, so lang wie sein Unterarm. Den zwei Weißen – Hepburn und Richardson – blieben miteinander nur eine kleine Pistole und eine unzuverlässige Büchse.
Richardson, inzwischen einer der angesehensten Wissenschaftler und Wundärzte Englands und Freund des Dichters Robert Burns, war damals nur ein vielversprechender Expeditionsarzt und Naturforscher. Er wartete ab, bis Teroahaute eines Tages, die Arme beladen mit Feuerholz, von einem Streifzug zurückkehrte, zückte die Pistole und schoss dem Indianer kaltblütig eine Kugel durch den Kopf.
Später räumte Dr. Richardson ein, die Büffeldecke des toten Hood gegessen zu haben, doch weder er noch Hepburn – die einzigen Überlebenden ihrer Gruppe – erwähnten je mit einem Wort, wovon sie sich in der folgenden Woche auf dem mühsamen Marsch zurück nach Fort Enterprise ernährt hatten.
Franklin und seine Leute, die dort gestrandet waren, konnten vor Schwäche nicht einmal mehr aufstehen. Richardson und Hepburn schienen dagegen in vergleichsweise guter Verfassung.
Er mochte zwar der Mann sein, der seine Stiefel gegessen hatte, aber dafür hatte John Franklin nie …
»Die Köchin macht heute Abend Rinderbraten, mein Schatz. Dein Leibgericht. Da sie neu ist – die irische Frau musste ich entlassen, weil sie bei der Buchführung geschwindelt hat, da bin ich mir sicher; Stehlen ist ja für die Iren so normal wie Trinken –, habe ich sie noch einmal daran erinnert, das Fleisch unbedingt so zuzubereiten, wie du es am liebsten hast: dass es schon bei der Berührung mit dem Messer blutet.«
Franklin, der gerade auf einer nachlassenden Fieberwelle dahinschwebte, wollte eine Antwort formulieren, doch das Brausen der Kopfschmerzen, der Übelkeit und der Hitze war zu stark. Sein Unterhemd und der immer noch starr am Hals sitzende Kragen waren schweißgetränkt.
»Admiral Thomas Martins Frau hat uns heute eine ganz entzückende Karte und einen wunderbaren Blumenstrauß geschickt. Sie hat als Letzte etwas von sich hören lassen, aber die Rosen draußen im Vorzimmer sind wirklich schön, das muss ich zugeben. Hast du sie gesehen? Andererseits ist er nicht so wichtig, oder? Auch wenn er Revisor der Navy ist. Gewiss nicht so bedeutend wie der Erste Lord oder die Ersten Kommissare oder gar deine Freunde vom Arktischen Rat.«
Sir John Franklin hatte zahlreiche Freunde; denn alle mochten Sir John Franklin. Nur respektierte ihn niemand. Seit Jahrzehnten nahm Franklin Ersteres zur Kenntnis, ohne sich Letzterem zu stellen. Trotzdem war es auf irgendeine Weise zu ihm durchgedrungen. Alle mochten ihn. Niemand respektierte ihn.
Zumindest nicht mehr seit Tasmanien. Seit seiner Verbannung auf die Insel und dem Pfusch, den er dort angerichtet hatte.
Als er zu seiner zweiten großen Expedition aufbrach, war seine erste Frau Eleanor dem Tode nah.
Er wusste, dass sie nur noch kurz zu leben hatte. Und sie wusste es auch. Ihre Schwindsucht und die Erkenntnis, dass sie daran sterben musste, lange bevor ihr Gemahl in der Schlacht oder auf einer Expedition sein Leben lassen würde, hatten die Trauungszeremonie wie ein stummer Gast begleitet. In den zweiundzwanzig Monaten ihrer Ehe hatte sie ihm eine Tochter geschenkt, die junge Eleanor – sein einziges Kind.
Sie selbst – eine kleine, körperlich zarte Frau, die jedoch geistig über eine beinah furchterregende Kraft verfügte – hatte ihn aufgefordert, zu seiner zweiten Suchexpedition nach der Nordwestpassage aufzubrechen, eine Reise, die zu Wasser und zu Lande der nordamerikanischen Küste folgen sollte. Zu dieser Zeit hustete sie bereits Blut und spürte das nahende Ende. Sie meinte, es sei besser für sie, wenn er anderswo war. Und er glaubte ihr. Oder zumindest glaubte er, dass es besser für ihn war.
Der tiefreligiöse John Franklin hatte darum gebetet, dass Eleanor vor seinem Aufbruch sterben möge. Doch so kam es nicht. Er verließ sie am 16. Februar 1825, schrieb ihr während der Überfahrt zum Großen Sklavensee viele Briefe, die er in New York und Albany abschickte, und erfuhr erst am 24. April auf dem britischen Flottenstützpunkt Penetanguishene von ihrem Dahinscheiden. Sie war kurz nach seiner Abreise aus England gestorben.
Als er 1827 von dieser Expedition zurückkehrte, wartete Eleanors Freundin Jane Griffin auf ihn.
Der Admiralitätsempfang hatte vor weniger als einer Woche stattgefunden – nein, genau vor einer Woche, vor dieser vermaledeiten Grippe. Selbstverständlich waren Kapitän John Franklin und all seine Offiziere erschienen. Desgleichen die Expeditionsteilnehmer, die keinen Marinerang bekleideten: James Reid, der Eislotse der Erebus, Thomas Blanky, der Eislotse der Terror, sowie die Ärzte, der Zahl- und der Proviantmeister.
Sir John kam hervorragend zur Geltung in seinem neuen blauen Frack, den blauen Hosen mit den goldenen Streifen, den Epauletten mit goldenen Fransen, dem Zeremonienschwert und dem Dreispitz aus der Nelson-Ära. Der Commander seines Flaggschiffs Erebus, James Fitzjames, der oft als der stattlichste Mann der Royal Navy bezeichnet wurde, sah so blendend und zugleich bescheiden aus, wie es sich für einen Kriegshelden gehörte, und nahm an diesem Abend alle Gäste für sich ein. Francis Crozier hingegen wirkte wie immer steif, unbeholfen, melancholisch und leicht betrunken.
Aber Jane hatte unrecht: die Mitglieder des »Arktischen Rats« waren nicht Sir Johns Freunde. Offiziell existierte der Arktische Rat gar nicht. Er war mehr eine Ehrengesellschaft als eine reale Institution, dafür jedoch der elitärste Club von ganz England.
Bei dem Empfang mischten sich Franklin und seine Offiziere unter die finster dreinblickenden, grauhaarigen Mitglieder des sagenumwobenen Arktischen Rats.
Um in diese ehrenwerte Gesellschaft Aufnahme zu finden, musste man eine Expedition in den fernsten arktischen Norden befehligen … und überleben.
Viscount Melville – der erste Würdenträger in einer langen Reihe von Gastgebern, die Franklin auf eine für ihn völlig ungewohnte Art ins Schwitzen brachten und ihm die Sprache raubten – war der Erste Lord der Admiralität und, wenn auch selbst kein alter Arktisfuchs, so doch der Förderer des großen Expeditionsförderers John Barrow.
Die wirklich legendären, zumeist schon über siebzigjährigen Gestalten des Arktischen Rats hatten für den nervösen Franklin an diesem Abend mehr Ähnlichkeit mit dem Hexenzirkel aus »Macbeth« oder einem Schwarm grauer Geister als mit realen Menschen. Jeder einzelne dieser Männer war, was die Suche nach der Nordwestpassage betraf, ein Vorgänger Franklins, und jeder war lebend, wenn auch nicht ganz lebendig zurückgekehrt.
Konnte man, so fragte sich Franklin, nach dem Überwintern in arktischen Regionen denn wirklich lebend zurückkehren?
Sir John Ross, dessen schottisch geprägte Züge mehr scharfe Schliffflächen aufwiesen als ein Eisberg, hatte Augenbrauen, die vorsprangen wie die Halsfedern jener Pinguine, die sein Neffe Sir James Clark Ross nach seiner Reise in die Antarktis beschrieben hatte. Ross’ Stimme glich einem Scheuerstein, der über ein splitteriges Deck schabt.
Sir John Barrow, älter als Gott und doppelt so mächtig. Der Urvater jeder ernsthaften britischen Arktisforschung. Alle anderen Anwesenden an diesem Abend, selbst die weißhaarigen Siebzigjährigen, waren nur Jungen … Barrows Jungen.
Sir William Parry, der selbst unter Mitgliedern des Königshauses zu den Vornehmsten der Vornehmen zählte, hatte sich viermal an der Erzwingung der Passage versucht und erleben müssen, wie seine Männer starben und seine Fury vom Eis zermalmt wurde und sank.
Sir James Clark Ross, erst seit kurzem Ritter und verheiratet mit einer Frau, die ihm das Versprechen abgenommen hatte, keine Expeditionen mehr zu unternehmen. Wenn er gewollt hätte, hätte er Franklins Stelle als Befehlshaber dieser Expedition beanspruchen können, und beide wussten das. Ross und Crozier standen ein wenig abseits von den anderen, an ihren Gläsern nippend und in ein leises Gespräch vertieft wie Verschwörer.
Der verteufelte Sir John Back; Franklin musste seinen Titel doch tatsächlich mit einem Mann teilen, der einst als Seekadett unter ihm gedient hatte und noch dazu ein Schürzenjäger war. An diesem Galaabend wünschte sich Sir John Franklin fast, Hepburn hätte vor fünfundzwanzig Jahren Pulver und Kugeln in den Duellpistolen belassen. Back war das jüngste Mitglied des Arktischen Rats. Und obwohl bei seiner letzten Expedition die HMS Terror arg gelitten hatte und um ein Haar gesunken wäre, wirkte er zufriedener und eingebildeter als alle anderen.
Kapitän John Franklin war Abstinenzler, doch die anderen Männer wurden nach drei Stunden Sekt, Wein, Weinbrand, Sherry und Whiskey allmählich immer ungezwungener. Das Lachen um ihn herum klang lauter und die Unterhaltung in dem großen Saal insgesamt weniger förmlich. Selbst Franklin entspannte sich schließlich, als ihm klar wurde, dass dieser ganze Empfang, all die goldenen Knöpfe, Seidenkrawatten, glänzenden Epauletten, all die feinen Speisen, Zigarren und lächelnden Lippen ihm galten. Diesmal ging es nur um ihn.
Umso größer war sein Schreck, als ihn der ältere Ross mit einem Mal schroff zur Seite zog und durch den Zigarrenrauch und das flackernde Kerzenlicht in den Kristallleuchtern einen Pfeilhagel von Fragen auf ihn abschoss.
»Franklin, warum zum Teufel segeln Sie mit einhundertvierunddreißig Mann?«, schnarrte er, ein Scheuerstein auf rauem Holz. Kapitän John Franklin blinzelte erstaunt. »Es ist eine große Expedition, Sir John.«
»Eine Nummer zu groß, für meinen Geschmack. Wenn etwas schiefgeht, dann ist es schon schwer, dreißig Leute übers Eis und in Booten zurück in die Zivilisation zu führen. Einhundertvierunddreißig Mann …« Der alte Arktisforscher räusperte sich so vernehmlich, als wollte er gleich ausspucken.
Franklin nickte lächelnd in der Hoffnung, den Alten bald wieder los zu sein.
»Und Ihr Alter«, fuhr Ross fort. »Um Gottes willen, Mann, Sie sind doch schon sechzig.«
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel THE TERROR bei Little, Brown and Company, New York
Taschenbuchausgabe 1/09
Copyright © 2007 by Dan Simmons
Copyright © 2007 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Tamara Rapp Karte: Andreas Hancock Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 9783641113612V002
www.randomhouse.de