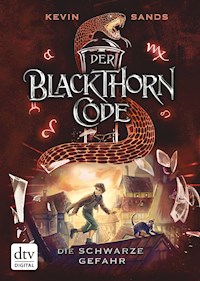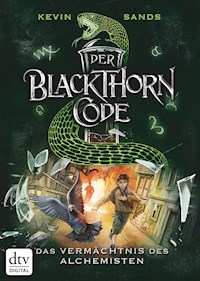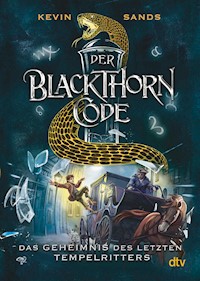
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Blackthorn Code-Reihe
- Sprache: Deutsch
Noch mehr Rätsel, noch mehr Spannung, noch mehr Lesevergnügen: Band 3 der Bestsellerreihe! Christopher und Tom sind auf Einladung des Königs in Oxford. Doch wo Christopher auftaucht, sind Abenteuer – und manchmal auch Mordanschläge – nicht weit: Das Treffen mit dem englischen König endet im Zusammenstoß mit einem Auftragsmörder! Der Anschlag missglückt, der Täter entkommt, hinterlässt jedoch eine verschlüsselte Nachricht, die Christopher decodieren kann. Ihm wird klar: 1. Der König war nicht das Ziel des Anschlags 2. Es wird nicht bei diesem einen Versuch bleiben Die Jagd nach dem Attentäter führt Christopher, Tom und Sally nach Paris an den Hof des Sonnenkönigs ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kevin Sands
Das Geheimnis des letzten Tempelritters
Aus dem amerikanischen Englischvon Alexandra Ernst
Montag,2. November 1665
Matutin
Glaubt ihr an Schicksal?
Einmal, kurz nachdem ich sein Lehrling geworden war, hatte ich Meister Benedict danach gefragt. Er hatte seine Suppe umgerührt und mit dem Löffel gegen den Teller geklappert. »Eine interessante Frage. Wie kommst du darauf?«
»Na ja«, sagte ich, »in dem Buch über Astronomie, das Ihr mir gegeben habt, steht, dass das Universum wie ein Uhrwerk funktioniert. Dass alles einem großen Plan folgt.
»Das stimmt.«
»Aber trotzdem haben wir doch einen freien Willen, nicht wahr? Ich meine, wir sind doch verantwortlich für die Dinge, die wir tun.«
»Natürlich«, sagte er.
»Aber … wie kann denn beides zutreffen?«, fragte ich. »Wie kann es einen großen Plan geben, wenn wir über freien Willen verfügen? Man könnte doch etwas tun, was den Plan des Universums durcheinanderbringt. Und wenn das Universum tatsächlich eine große Uhr ist und wir die Zahnrädchen, die eine bestimmte Funktion erfüllen, wie können wir dann für unsere Taten verantwortlich gemacht werden? Dann steht unsere Bestimmung doch schon von Geburt an fest.«
Mein Meister warf mir einen strengen Blick zu. »Hat das etwas mit der zerbrochenen Fensterscheibe bei den Baileys zu tun?«
»Ähm … nein.« Obwohl Tom und ich im Haus seiner Eltern wohl nicht mehr so schnell eine Burgbelagerung nachspielen würden.
»Dann warte einen Moment.«
Er ging nach oben, wo ich ihn in der kleinen Kammer poltern hörte, in der er seine Bücher aufbewahrte. Als er zurückkam, trug er einen Stapel vor sich her, der so hoch war, dass er daran vorbeischauen musste, um zu sehen, wohin er ging. Er ließ ihn auf den Tisch fallen und ich streckte hastig die Arme aus, um zu verhindern, dass der Turm in meine Suppe krachte.
»Fang damit an«, sagte mein Meister. »Dann reden wir weiter.«
Ich las die Bücher zusätzlich zu meinen anderen Pflichten und brauchte deshalb mehrere Tage dafür. Als ich damit fertig war, ging ich zu Meister Benedict, der in der Werkstatt an einem neuen Rezept gegen die Gicht arbeitete.
»Nun?«, sagte er. »Was glaubst du? Wird der Mensch vom Schicksal beherrscht oder von seinem freien Willen?«
Peinlich berührt kratzte ich mich am Kopf. »Ich habe keine Ahnung.«
Er seufzte. »Ich auch nicht. Ich hatte gehofft, du würdest etwas finden, was uns der Antwort näher bringt.«
Was bewies, dass dies eine fürchterlich schwierige Frage war. Während Tom und ich in der Kutsche saßen, die über die vom Regen aufgeweichte Straße nach Oxford schaukelte, versuchte ich ihm zu erklären, dass die größten Philosophen der Weltgeschichte sich darüber schon den Kopf zerbrochen hatten – darüber, wie schwierig die Frage war, wer die Verantwortung trug.
Für Tom dagegen war die Antwort ganz einfach: Das war alles meine Schuld.
Kapitel 1
»Das ist alles deine Schuld«, sagte Tom.
Er verschränkte die Arme vor der Brust und schaute unglücklich durch das Fenster. Durch die Vorhänge schimmerten die Lichter von vereinzelten, weit entfernten Bauernhöfen.
»Aber ich habe doch gar nichts gemacht!«, protestierte ich.
»Glaubst du vielleicht, wir sind wegen mir hier?«
»Nein, ich …«
»Ich stecke nämlich keine Pfirsichbäume in Brand«, sagte Tom.
»Das war ein Unfall.«
»Ich bin auch nicht derjenige, der sagte: ›He, jagen wir doch ein paar Kürbisse in die Luft!‹«
»Das war ein Experiment«, erklärte ich. »Und es war nur ein Kürbis. Das andere waren Rüben. Aber was hat das denn damit zu tun?«
»Vielleicht war es ein wichtiger Kürbis.«
»Wie kann denn ein Kürbis wichtig sein?«
»Vielleicht war es ein preisgekrönter Kürbis«, sagte Tom. »Vielleicht war es der Kürbis, der England im Internationalen Kürbiswettbewerb vertreten sollte. In Schottland.«
»Also, jetzt redest du wirklich kompletten Unfug.«
»Ach ja? Dann erklär mir doch mal das hier.« Er schnappte sich die … man würde es wohl Einladung nennen, die zu Boden gefallen war, und knallte sie mir vor die Brust. »Erklär’s mir!«
Das war ja das Problem. Ich konnte es nicht erklären. Diese ganze Sache war für mich genauso mysteriös wie für ihn.
Gestern hatten Tom und ich beim Mittagessen in meiner Apotheke gesessen, als jemand mit der Faust gegen die Ladentür hämmerte. Ich öffnete und sah mich einem Soldaten gegenüber, auf dessen Rock das Wappen des Königs prangte. Hinter ihm stand eine Kutsche, neben der ein weiterer Soldat wartete.
»Christopher Rowe?«, fragte der Mann. Als ich nickte, händigte er mir einen Brief aus. Den ich verständnislos anstarrte. Als ich ihn las, war ich genauso schlau wie vorher.
Christopher,
steig mit Thomas Bailey in die Kutsche.
Ashcombe
Baron Richard Ashcombe, der Beschützer des Königs Charles II., war der Lordprotektor Englands. Unsicher schaute ich den Soldaten an. »Stecken wir in Schwierigkeiten?«
Er zuckte mit den Schultern. »Mir wurde nur befohlen, euch nach Oxford zu bringen.«
Oxford? Dort befand sich der König mit seinem Hofstaat. »Stehen wir unter Arrest?«
Der Mann klopfte ungeduldig mit der Fußspitze auf den Boden. »Noch nicht.«
Und so landeten Tom und ich in dieser Kutsche, die durch das Land holperte. Die Nacht hatten wir in einem Gasthaus verbracht, wo die Soldaten sich als Wachen vor unserer Tür postierten. Seitdem war Tom felsenfest davon überzeugt, dass wir dem Untergang geweiht waren.
»Man wird uns in den Kerker werfen«, stöhnte er.
»Quatsch«, sagte ich, aber so ganz überzeugt war ich auch nicht.
»Weißt du, wie es im Kerker ist? Da gibt es kein Essen. Die lassen dich hungern!«
»Wir wurden doch nicht mal gefesselt!«
Toms Unterlippe zitterte. »Eine einzige Scheibe Brot, einmal am Tag. Und nicht mal gutes Brot mit Mohnsamen und vielleicht einem Hauch Zimt. Nein. Hartes Schwarzbrot. Hartes Brot für ein hartes Los.«
Das sieht dem Sohn eines Bäckers ähnlich, sich über die Qualität des Brots im Gefängnis Gedanken zu machen. Trotzdem wünschte ich mir, er würde damit aufhören. Je mehr er jammerte, desto mehr setzte sich die Aussicht, hinter Gittern zu landen, in meinem Kopf fest. Ich versuchte, nicht auf seine Worte zu achten, und fragte mich, warum Lord Ashcombe uns zu sich befohlen haben könnte.
Seit wir den Betrug mit der angeblichen Pestheilung auf dem Höhepunkt der Seuche aufgedeckt hatten, hatte ich nur zweimal vom Lordprotektor gehört. Einmal, nachdem Magistrat Aldebourne Lord Ashcombe darüber informiert hatte, welchem Unglück London dank meiner Hilfe entgangen war. Lord Ashcombe hatte daraufhin auch von mir einen Bericht verlangt. Und das zweite Mal, als er – wie versprochen – für Sally eine Anstellung fand.
Seine Nachricht war wie immer kurz und bündig gewesen. Er erklärte, er hätte sie als Kammerzofe bei Lady Pemberton untergebracht und würde eine Kutsche für sie schicken. Die Baroness befand sich bei Hof, der London wegen der Pest verlassen hatte, und so mussten wir uns im September schweren Herzens von Sally verabschieden. Seitdem hatte ich ihr jede Woche einen Brief geschrieben, hatte aber nichts von ihr gehört. Das wunderte mich nicht weiter, denn ihr Gehalt würde ganz bestimmt nicht ausreichen, um das Porto zu bezahlen. Lord Ashcombes Nachricht, mit der er Tom und mich nach Oxford zitiert hatte, ließ mich nun allerdings befürchten, sie könnte in irgendwelchen Schwierigkeiten stecken.
Die Kutsche wurde langsamer. Tom und ich schauten durchs Fenster und sahen, dass wir die Straße nach Oxford verließen und nach Norden abbogen. Offensichtlich lag unser Ziel also nicht in der Stadt. Wir umfuhren die Stadtmauer und wurden von zahlreichen Schlaglöchern tüchtig durchgeschüttelt, ehe der Kutscher durch das Tor eines großen Anwesens fuhr.
Eichen säumten die Einfahrt und das Herbstlaub wurde von den Fackeln, die am Wegrand aufgestellt waren, erleuchtet. Unsere Pferde, denen dank der kühlen Novemberluft der Atem in dicken Wolken vor den Nüstern stand, steuerten auf ein Herrenhaus auf einem Hügel zu. In den Fenstern strahlten helle Lichter und warfen einen warmen Schimmer in die neblige Luft.
Das hier war ganz bestimmt kein Gefängnis. Und aus welchem Grund auch immer man uns hergebracht hatte, wir waren jedenfalls nicht allein. Dutzende Kutschen standen auf dem Rasen und drückten das Gras unter ihren schlammbespritzten Rädern platt, während die Kutscher sich gelangweilt an die Kabinen lehnten.
Unser eigenes Gefährt hielt vor dem Haus an, wo uns ein Mann in Livree den Schlag öffnete und uns aus der Kutsche bat. Die Soldaten des Königs trieben uns die Treppe hoch zu einer mächtigen, doppelflügeligen Tür. Über der Tür prangte ein Wappen: zwei gekreuzte Hellebarden über einem Schild mit einem Hirschgeweih.
Ich hatte keine Ahnung, wo wir waren. Aber dieses Haus war umwerfend. Allein die Eingangshalle war so groß wie mein ganzes Haus. Eine marmorne Treppe zog sich von der Mitte des Foyers hinauf in die oberen Stockwerke. Am Fuß der Treppe standen zwei Diener, und weitere, in identische Livreen gekleidete Dienstboten befanden sich an den unzähligen Durchgängen zu den verschiedenen Flügeln des Anwesens. Von irgendwoher hörte ich Gesprächsfetzen und Gelächter und einige Takte Musik.
»Ihr kommt spät.«
Lord Ashcombe trat mit langen Schritten in die Eingangshalle. Er war in feinste schwarze Seide gekleidet, mit einer Klappe über dem linken Auge und einem Handschuh über seiner rechten Hand, die nur noch drei Finger hatte: beides Wunden aus einem Kampf mit den Männern, die meinen Meister ermordet hatten. Er hatte kein Schwert dabei, aber in seinem Gürtel steckte eine Pistole mit Perlmuttgriff.
»Tut mir leid, Kommandant«, sagte der Soldat, der uns ins Haus begleitet hatte, »aber der Regen hat die Straßen in Bäche verwandelt.«
Lord Ashcombe grunzte und betrachtete uns. »Wir müssen euch präsentabel machen.« Er gab den Dienstboten an der Treppe ein Zeichen.
»Mylord?« Ich schaute zu Tom, der mittlerweile einer Ohnmacht nahe war. »Stecken wir in Schwierigkeiten?«
Lord Ashcombe zog eine Augenbraue hoch. »Gäbe es dafür denn einen Grund?«
»Ähm … nein?«
»Dann hängt die Antwort auf deine Frage wohl davon ab, wie dieser Abend verläuft.«
»Dieser Abend?«
»Ja. Der König möchte mit euch sprechen.«
Kapitel 2
Ich verschluckte mich. »Der König?«
»Der König«, sagte Lord Ashcombe.
»Was für ein König?«, platzte Tom heraus.
»Euer König.«
»Unser König? Ihr meint, der auf den Münzen?«
Lord Ashcombe schloss kurz die Augen und seufzte. »Bringt sie nach oben«, sagte er zu den Lakaien.
In diesem Moment trat unser Kutscher mit einem kleinen Metallkäfig in der Hand in die Eingangshalle. Ein pummeliger Vogel marschierte in dem Käfig auf und ab und plusterte das schwarz-weiß gesprenkelte Gefieder auf.
Lord Ashcombe musterte den Käfig verwirrt. »Was ist das?«
Der Soldat warf ebenfalls einen Blick auf den Käfig. »Eine Taube, wenn mich nicht alles täuscht.«
Lord Ashcombe verzog den Mund zu einem schmalen Strich. »Ich weiß, dass das eine Taube ist. Ich will wissen, was sie hier zu suchen hat.«
»Die … die gehört mir, Mylord«, sagte ich, immer noch wie benebelt. Der König? »Das ist Bridget.«
Bridget schob den Kopf durch die Gitterstäbe und gurrte Lord Ashcombe an.
»Aber warum bringst du eine … ach, egal. Ich will es gar nicht wissen. Macht schon, nach oben mit ihnen«, sagte er an die Dienstboten gewandt und kehrte dann in den Saal zurück, aus dem die Musik erklang.
Einer der Lakaien nahm Bridgets Käfig. »Bitte hier entlang, meine Herren.«
Ich folgte ihm die Treppe hinauf, während sich mir der Magen umdrehte. Wir werden dem König vorgestellt.
Tom packte mich am Ärmel, seine Augen ganz starr vor Panik. »Bring mich hier raus«, verlangte er.
»Wie soll ich das denn bitte schön anstellen?«
»Keine Ahnung. Mach einfach. Ich kann nicht dem König gegenübertreten, Christopher. Das geht nicht.« Toms Stimme brach. »Ich bin ein Bäcker. Was soll ich denn zu ihm sagen? Vielleicht ›Guten Abend, Eure Majestät. Esst Ihr gerne Brötchen?‹«
Da wurde mir klar, dass ich ebenfalls keine Ahnung hatte, was ich zu ihm sagen sollte. Warum musste Lord Ashcombe auch jedes Mal so ein Geheimnis aus allem machen? Warum konnte er uns nicht einfach sagen, was genau wir hier sollten?
Im zweiten Stock wurden wir getrennt und in unterschiedliche Zimmer geführt. Tom, der einem Lakaien den Gang entlang folgte, warf mir über die Schulter einen anklagenden Blick zu. »Das ist alles deine Schuld.«
Der Diener, der auf den Namen Bodwin hörte, führte mich in ein elegant eingerichtetes Schlafzimmer, das im gegenüberliegenden Flügel lag. Er hielt Bridgets Käfig hoch. »Hat der Vogel einen bestimmten Zweck, Sir?«
Seine Frage riss mich aus meinen Grübeleien. »Was? Oh … nein. Sie ist … nur bei mir. Lord Ashcombe sagte nichts darüber, wie lange ich von zu Hause weg sein würde, und ich habe niemanden, der sich um sie kümmert.«
»Natürlich, Sir. Ich sehe zu, dass sie versorgt wird. In der Zwischenzeit werde ich Euch beim Waschen helfen.«
Eigentlich brauchte ich dabei keine Hilfe. Bislang hatte ich diese Aufgabe stets aus eigener Kraft und zur allgemeinen Zufriedenheit ausgeführt. Aber da mein Kopf immer noch wie in Watte gepackt war, leistete ich keinen Widerstand. Ich folgte ihm in den angrenzenden Raum, wo gerade ein Mädchen einen Eimer mit heißem Wasser in eine Wanne goss, aus der Dampf aufstieg. Bodwin wartete, bis ich mich ausgezogen hatte, und machte sich dann daran, mir den Staub der Straße von der Haut zu schrubben.
Als wir ins Schlafzimmer zurückkehrten, waren meine eigenen Kleider verschwunden. Stattdessen lagen neue Sachen auf dem Bett. Die Strümpfe, Beinkleider und das Hemd waren von viel besserer Qualität, als ich es gewohnt war. Die Vorderseite der saphirblauen Weste bestand aus Brokat, der Rücken aus Seide und das Wams aus weicher Wolle. Die Lederschuhe waren so blank poliert, dass sich mein Gesicht darin spiegelte. Es waren Kleidungsstücke für einen König. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Als ich angekleidet war, brachte mich Bodwin wieder in die Eingangshalle. Immer noch in Gedanken versunken, bog ich um eine Ecke und stieß mit einem Mann zusammen, der mit trüben Augen die Bronzebüste eines Gentlemans mit einer Perücke betrachtete. In der Hand hielt er eine Flasche Wein.
»Bitte um Verzeihung«, sagte er mit leicht schleppendem Tonfall.
Bodwin räusperte sich. »Mr Glover.«
»Einen Moment noch«, sagte Glover. »Ich versuche gerade herauszufinden, wer das ist.«
Bodwin räusperte sich noch einmal, diesmal energischer. »Mr Glover. Man verlangt unten nach Euch.«
»Die nächste Runde Wein is schon in den Karaffen«, sagte er und hickste. »Wer issen das? Neuer Dienstbursche?«
Beinahe hätte Bodwin die Fassung verloren. »Das ist ein Gast Seiner Majestät!«
»Oh. ’tschuldigung, junger Herr. John Glover, Kellermeister des Hauses, zu Euren Diensten.« Er verbeugte sich, wobei Wein aus der Flasche auf seine Schuhe spritzte.
»Mr Glover! Mr Skipwith hat Euch gewarnt.«
»Es is doch meine Aufgabe, den Wein zu probieren, Sir. Was, wenn er vergiftet is?« Er rülpste. »Bitte um Verzeihung.«
»Mr …«
Glover hob die Hand. »Kein Wort mehr. Ich gehe.«
Leicht schwankend verschwand er um die Ecke. Bodwin machte ein bedauerndes Gesicht. »Ich bitte um Verzeihung, Sir. Mr Glover ist wirklich ein anständiger Mann. Sehr freundlich zu aller Welt. Er hat nur manchmal … ein kleines Problem mit dem Alkohol.«
Das erschien mir keine besonders passende Eigenschaft für einen Kellermeister zu sein. »Schon gut«, sagte ich.
»Ich werde ihn natürlich melden.«
Ich hatte den Eindruck, dass er es nicht gerne tat. Mir lag auch nicht unbedingt etwas daran. Wenn er Glover meldete, dann würde der seinen Job verlieren, und ich wollte nicht der Grund sein, warum irgendjemand in Schwierigkeiten geriet.
»Mir wäre es lieber, Ihr würdet das nicht tun«, sagte ich.
Bodwin schaute mich überrascht an und senkte dann mit einem dankbaren Blick den Kopf. »Wie Ihr wünscht.«
Er ging mir voraus die Treppe hinunter, wo Tom bereits auf mich wartete. Er zupfte an seiner Hose. »Die passt nicht richtig«, klagte er.
Lord Ashcombe tauchte wieder aus der Richtung auf, aus der die Musik erklang. »Na endlich«, sagte er. »Kommt mit. Ich werde euch Seiner Majestät vorstellen.«
Kapitel 3
Wir waren mitten auf einer Party gelandet.
Der Ballsaal war voll mit vornehmen Leuten in Samt und Seide, die Wein aus Kristallgläsern tranken. Hoch über uns, im dritten Stock, ragten vier Balkone in den Saal hinein. Auf einem davon saßen sechs Musiker, ein Consort aus Blockflöten, und unten im Saal tanzten mehrere Paare. Andere standen am Rand und klatschten im Takt.
Von den ansonsten leeren Balkonen hingen gelbe und violette Banner, deren Spitzen beinahe die Perücken der Herrschaften unten im Saal berührten. In der Mitte funkelte ein riesiger Kronleuchter mit Hunderten von Kerzen und übergoss den Saal mit Licht und Wärme.
»Mund zu«, ermahnte mich Lord Ashcombe.
Ich klappte meine Kiefer zu, was mich aber nicht davon abhielt zu gaffen, während er uns durch die versammelten Gäste führte. Schaut, wo ich gelandet bin, Meister, sagte ich in Gedanken.
Ich blieb kurz stehen, als wir an einer Frau vorbeikamen, die seltsamerweise maskiert war. Die mit Federn verzierte Maske bedeckte die obere Hälfte ihres Gesichts. Sie war von einer Gruppe Männer umringt, die alle um sie herumscharwenzelten. Sie lachte melodiös, lächelte strahlend und sagte dann mit einem schweren Akzent: »Isch bin leidär vergeben.«
Fragend schaute ich zu Lord Ashcombe. »Eine Französin«, sagte er, als ob das alles erklären würde. »Jetzt hört gut zu. Wenn ihr dem König vorgestellt werdet, müsst ihr nichts weiter tun, als höflich zu sein. Sprecht ihn beim ersten Mal mit ›Eure Majestät‹ an und danach mit ›Sire‹. Und um der Liebe Gottes willen, fasst euch kurz. Es wird bei Hofe sowieso viel zu viel geschwafelt. Und wie leicht macht man sich dabei selbst zum Narren.«
Toms Gesicht war so weiß wie Schnee. Mein Magen schlug Purzelbäume. »Was will er denn von uns?«, fragte ich.
»Euch kennenlernen. Er hat schon nach der Sache mit dem Erzengel-Kult sein Interesse an euch zum Ausdruck gebracht, und als ich ihm erzählte, dass ihr die Bande habt auffliegen lassen, die den Stadtrat von London beinahe um sein ganzes Geld gebracht hätte, da bestand er darauf, dass ich euch an den Hof hole. Eigentlich wollte ich damit warten, bis wir wieder in London sind, aber angesichts der Tatsache, dass die Seuche noch nicht überstanden ist und wir in absehbarer Zeit nicht zurückkehren werden, dachte ich mir, der heutige Abend sei die perfekte Gelegenheit.« Er bedachte mich mit einem prüfenden Blick. »Du fällst doch nicht etwa in Ohnmacht, oder doch?«
Die Möglichkeit bestand durchaus. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir ruhig warten konnten, bis der Hof wieder in London war, als Lord Ashcombe uns durch einen Kreis aus Menschen schob, die ihre Aufmerksamkeit auf einen einzelnen Mann gerichtet hatten.
Er war unglaublich groß und dünn, mit einer vorspringenden Nase und einer Perücke mit langen schwarzen Locken. Während er sich unterhielt, bediente er sich von einem Teller mit Trauben, der zwischen ihm und der Dame neben ihm stand, und ließ eine nach der anderen in seinen Mund fallen.
Tom packte meinen Arm so fest, dass ich dachte, er würde mir die Knochen brechen. Denn wir standen tatsächlich vor Charles II., von Gottes Gnaden König von England, Schottland, Frankreich und Irland, Verteidiger des wahren Glaubens.
Seine Augen funkelten fröhlich. Dank meiner flatternden Nerven brauchte ich einen Moment, um zu begreifen, dass er einen Witz erzählte. »Und der Schäfer sagte zu ihr: ›Ich bitte um Verzeihung, Mylady, aber das ist nicht mein Hut.‹«
Die Männer brachen in Gelächter aus. Die Damen, die rechts und links des Königs standen, schnalzten vor schockiertem Entzücken mit den Zungen. Eine von ihnen schlug dem König spielerisch mit ihrem Elfenbeinfächer auf den Arm. »Oh, Ihr seid ein böser Junge«, sagte sie.
Er grinste. »Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass Ihr recht habt. Hallo, wer ist denn das?«
Er hatte mich entdeckt, wie ich zitternd am Rand des Kreises stand. Lord Ashcombe schob mich nach vorn. »Eure Majestät, darf ich Euch zwei Eurer Untertanen vorstellen? Das ist Christopher Rowe aus London, der frühere Lehrjunge des verstorbenen Benedict Blackthorn.«
Die Miene des Königs hellte sich auf. »Oh! Ja! Willkommen!«
Ich verbeugte mich fassungslos. In meinem Hinterkopf hörte ich wieder die Mahnung von Lord Ashcombe. Um der Liebe Gottes willen, fasst euch kurz. »Es … es ist mir eine Ehre, Eure Majestät«, stammelte ich.
Er drehte sich zu einer der Damen um. »Dieser Junge löst die verzwicktesten Mordfälle, ob Ihr’s glaubt oder nicht! Christopher, du musst morgen mit mir frühstücken. Dann kannst du mir all deine Tricks verraten.«
Eine Wärme breitete sich in meiner Brust aus. »Sehr … sehr gerne, Sire.«
»Richard, Ihr sorgt mir dafür, dass … Bei allen Göttern, wer ist denn der Riese? Er ist ja größer als ich!«
König Charles starrte Tom neugierig an, der schreckensstarr vor ihm stand. Lord Ashcombe musste ihn buchstäblich nach vorne ziehen. »Thomas Bailey, Sire«, sagte der Beschützer des Königs. »Sohn eines Bäckers und Christophers Freund.«
»Aha! Der Kämpfer mit dem Nudelholz!« Toms bleiche Wangen färbten sich rosa, als der König grinsend in die Hände klatschte. »Du musst bei meiner Leibwache in den Dienst treten, Thomas. Unsere Feinde werden allein bei deinem Anblick schon die Flucht ergreifen. Dann müssen wir nie mehr Schlachten schlagen und du hast genug Zeit, um für uns alle Kekse zu backen.«
Die Umstehenden lachten und Toms Gesicht wurde so rot wie eine Sauerkirsche.
»Oh nein, seht doch«, sagte der König. »Mein dummer Witz hat den Jungen verlegen gemacht. Komm her, Thomas, komm her.«
Tom blieb der Mund offen stehen, als der König seine Hand nahm. »Richard hat mir erzählt, was du im Mortimer-Haus getan hast. Du hast an diesem Tag nicht nur deinem Freund das Leben gerettet, sondern auch mir. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Du bist ein wahrer Sohn Englands.«
Tom sagte kein Wort. Aber ich hatte ihn noch nie so strahlen gesehen.
»Danke, Sire«, sagte Lord Ashcombe und zog uns wieder aus dem Kreis. Während die Damen um des Königs Aufmerksamkeit buhlten, brachte er uns ins Nebenzimmer.
»So, das wäre erledigt«, sagte er. »Wenn Seine Majestät euch noch einmal sprechen will, dann lasse ich euch rufen. Ansonsten: Genießt das Fest. Hier gibt es genug zu essen und zu trinken. Und getanzt wird auch, falls euch derartige Vergnügungen zusagen.«
Damit ließ er uns stehen. Immer noch mit einem warmen Glücksgefühl in der Brust drehte ich mich langsam im Kreis. »Das ist der beste Tag meines Lebens«, sagte ich.
Ich hatte Angst, dass Tom vor lauter Glück abheben würde. Als ein Mann an uns vorbeigehen wollte, griff er nach ihm und hielt ihn fest. »Ich bin ein wahrer Sohn Englands«, sagte Tom zu ihm.
Der Mann warf mir einen belustigten Blick zu. »Ist er«, versicherte ich ihm und wir lachten und gingen weiter.
Einem anderen Gentleman schüttelte Tom ungefragt die Hand. »Guten Abend. Ich bin Thomas Bailey aus London. Ich bin ein wahrer Sohn Englands.«
Der Mann sah genauso ratlos aus wie der erste. »Tatsächlich?«
Ich bekam das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. »Wir haben den König kennengelernt«, sagte ich.
»Ach so.« Er nickte verstehend. »Dann gratuliere ich euch. Genießt das … Argh!«
Tom hatte seine Arme um den Mann geschlungen und drückte ihn fest an sich. Ein Wachtposten, der an der Wand stand, hob seine Hellebarde und schob sich durch die Gäste auf uns zu.
»Tom«, sagte ich hastig. »Ich denke, du solltest besser nicht irgendwelche wildfremden Leute umarmen.«
»Na gut.« Er ließ los und wanderte mit einem seligen Lächeln auf dem Gesicht weiter. »Ich bin ein wahrer Sohn Englands.«
Ich half dem Mann, seine Perücke zurechtzurücken. »Es tut mir sehr leid, Mylord. Es ist nur so … Tom liebt den König.«
»Die Liebe zu Seiner Majestät bedarf keiner Rechtfertigung«, sagte der Mann und bedeutete dem Soldaten, auf seinen Posten zurückzukehren. »Richte deinem Freund die Grüße des Herzogs von York aus.«
Ich erstarrte. »Der Herzog von …«
Er zwinkerte mir zu und ging weiter.
Die Sache geriet allmählich außer Kontrolle. Tom hatte gerade den Lord High Admiral umarmt – der zufällig auch der Bruder des Königs war. Ich musste ihn zur Räson bringen, ehe ihm am Ende noch die Königin über den Weg lief.
In dem Moment kam Tom auf mich zugestürmt. »Christopher!« Er packte mich am Arm und zerrte mich quer durch den Saal. »Guck mal!«
Ich guckte. Und traute meinen Augen kaum.
»Ist das wirklich echt? Oder habe ich gerade eine Halluzination?«, wollte Tom wissen.
Da war ich mir selbst nicht ganz sicher. Rechts und links von uns standen zwei Tische, von denen jeder fünfzig Fuß lang war. Und darauf standen Teller und Platten mit allen möglichen Sorten Fleisch: Roastbeef, glasierter Braten, dampfendes Geflügel. Auf dem anderen Tisch waren Brote und Süßigkeiten aufgestapelt: Pasteten, Kuchen und Obst.
Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Meine Augen zuckten von den Desserts zum Fleisch und wieder zurück. Tom drückte meinen Arm.
»Sind das Koteletts?«, quietschte er. »In Soße? Christopher … in Soße!«
Er schüttelte mich so heftig, dass mir der Schädel rappelte. Als er mich losließ, wäre ich beinahe umgefallen. »Sag mal, weinst du etwa?«
Er schniefte. »Es ist einfach wunderschön!«
Er hatte ja recht. Wegen der Pest hatten wir beide seit Monaten kein Fleisch mehr auf dem Teller gehabt. Tom rannte geradewegs zu den Leckereien, während ich stehen blieb und wieder an meinen Meister dachte. Ich wünschte, Ihr wärt jetzt bei mir.
Plötzlich sah ich ihn vor mir, wie er mich mit hochgezogenen Augenbrauen ungläubig betrachtete. Ich musste lachen. Meister Benedict hätte an dieser Veranstaltung keine Freude gehabt. Er konnte Feierlichkeiten nicht leiden.
Ich aber schon. Ich drehte mich wieder zu den Tischen um und überlegte, welchen davon ich zuerst belagern sollte. Und in dem Moment stupste mich jemand von der Seite an.
Kapitel 4
Ich drehte mich um und sah ein Mädchen, ungefähr einen Kopf kleiner als ich, mit zarten Sommersprossen, wie Goldstaub, auf der Nase. Sie trug ein tannengrünes Kleid, das ihre kastanienbraunen Locken ganz wunderbar zur Geltung brachte. Mit einem breiten Grinsen schaute sie zu mir hoch.
»Hallo«, sagte sie.
»Sally!« Ohne nachzudenken, schlang ich meine Arme um sie und hob sie hoch. Sie kreischte vor Entzücken auf, als ich sie herumwirbelte. Ihre Arme umfassten meinen Nacken und hielten sich an mir fest und ihr Haar streichelte sanft meine Wange. Sie duftete nach Lavendel.
Mit einem Mal war ich unsicher und verwirrt. Ich setzte sie ab und ihre Hände glitten weich über mein Wams und fielen dann von mir ab. Sie warf mir unter ihren langen Wimpern einen Blick zu und errötete leicht. »Also«, sagte sie.
Mein Gesicht glühte ebenfalls. Einen Augenblick lang standen wir ziemlich unbehaglich da, bis eine ältere Dienstmagd vorbeikam, sich vorbeugte und verschwörerisch flüsterte: »Du hast etwas verloren, Liebes.«
Sie reichte Sally einen Schuh mit einer grünen Satinschleife über der Schnalle. Sally wandte sich ab und schlüpfte wieder hinein. Als sie sich wieder zu mir umdrehte, waren ihre Wangen tiefrot geworden.
»Hast du … ähm … hast du meine Briefe bekommen?«, fragte ich.
»Ja«, sagte sie. »Und ich habe jeden beantwortet. Ich kann sie dir nach der Party geben. Wenn du möchtest.«
»Natürlich möchte ich!«
»Wo ist Tom?«
»Dreimal darfst du raten«, sagte ich.
Ihre Augen wanderten ohne zu zögern zu dem Tisch mit den Fleischgerichten. Und da stand Tom breitbeinig vor der Platte mit den Koteletts. Er hatte eins im Mund und zwei weitere in der Hand. Als er Sally entdeckte, hob er sie hoch, als hätte er Goldnuggets entdeckt. »Ibn n baher Hohn Nghans«, rief er.
Sally lachte. »Was?«
»Ich erzähl’s dir später«, sagte ich. Dann betrachtete ich sie von oben bis unten. Als ich sie zuletzt gesehen hatte, hatte sie noch ihre Verbände von dem schrecklichen Kampf vor zwei Monaten tragen müssen. Jetzt waren nur noch zwei kleine rosa Narben übrig, eine auf ihrer Wange und eine auf ihrem Nasenrücken. »Hat Lord Ashcombe dich auch hergerufen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin im Dienst. Lady Pemberton ist unter den Gästen.«
»Wie ergeht es dir dort?« Als sie zögerte, schaute ich sie erschrocken an. »So schlimm?«
»Nein, nein«, sagte sie. »Die Baroness ist eigentlich ganz nett. Nur ein bisschen …«
»Sally!«, kreischte eine Frauenstimme.
»… überdreht«, seufzte Sally.
Eine junge Dame kam herbeigeeilt. Sie trug ein kanariengelbes, mit Brokat verziertes Seidenkleid. Tränen rannen über ihre Wangen. »Mein Kleid!«, jammerte sie. »Paul hat Wein darübergeschüttet. Es ist völlig ruiniert!«
Ich sah einen winzigen burgunderfarbenen Fleck auf einem Ärmel. Er wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn sie nicht darauf deuten und so tun würde, als hätte man ihr der Arm abgehackt.
»Mylady …«, setzte Sally an.
»Alle starren mich an«, behauptete die Baroness mit zitternder Stimme, was natürlich stimmte, aber nur wegen der Szene, die sie machte. »Ich muss mich umziehen, und zwar sofort.«
Sie packte Sally am Arm und zog sie mit sich. Sally warf mir noch einen entschuldigenden Blick zu und formte mit den Lippen: Bis später.
Ich hob den Arm, um ihr zuzuwinken, da ertönte von der Seite ein Ruf: »He, Junge!«
Ich drehte mich um und sah einen älteren Herrn mit einer schlecht sitzenden Krawatte, der mich mit einer Handbewegung zu sich rief. Als ich hinging, reichte er mir sein Glas. »Der ist nicht besonders gut. Euer Kellermeister hat doch gewiss einen besseren Tropfen.«
Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, was geschehen war. Er hatte gesehen, wie ich mich mit Sally unterhalten hatte, und hielt mich nun für einen Bediensteten. »Tut mir leid, Mylord«, sagte ich, »aber ich bin kein Kellner.«
»Wunderbar, den nehme ich.«
Offensichtlich war der Mann ein bisschen schwerhörig. »Ich bin kein Kellner«, wiederholte ich etwas lauter.
»Ausgezeichnet«, sagte er. »Das freut mich wirklich.«
Ich musste mir auf die Lippe beißen, um nicht zu lachen. Und weil ich so gut gelaunt war, dachte ich: Warum nicht? Ich konnte dem alten Burschen helfen und hatte gleichzeitig die Gelegenheit, mehr von diesem außerordentlichen Haus zu sehen. »Ich werde ihn Euch sofort bringen.«
»Und noch mehr Pickles.«
»Aber gewiss doch. Wie konnten uns nur die Pickles ausgehen?« Ich nahm mir ein Mandelstückchen vom Dessert-Tisch und winkte Tom zu. Ich hole noch mehr Wein, erklärte ich ihm stumm.
»Wnh?«, nuschelte er mit einem mächtigen Knochen zwischen den Zähnen.
Ich deutete auf die Tür, durch die die Kellner hereinkamen und wieder verschwanden. »Bin gleich wieder da.«
Tom breitete die Arme aus, als wollte er sagen: Wie kannst du nur das ganze gute Essen im Stich lassen? Normalerweise hätte ich ihn mitgenommen, aber ich brachte es nicht übers Herz, ihn seiner Lieblingsbeschäftigung zu entreißen, nicht solange es noch Koteletts mit Soße gab. Ich stopfte mir das Gebäck in den Mund, nahm ein zweites und hielt dann einen Mann an, der ein Tablett mit leeren Gläsern trug. »Habt Ihr Mr Glover gesehen? Einer der Gäste möchte einen anderen Wein haben.«
»Unten, Sir«, sagte der Mann. »Er bereitet die nächste Runde Wein vor. Durch die Küche, wenn’s beliebt.« Ich folgte seinen Anweisungen und trat ein in das Reich der Dienstboten.
Es war in gewisser Weise erschreckend, dem Chaos hinter der goldenen Fassade gegenüberzutreten. In der Küche, die sich beinahe durch den ganzen Ostflügel erstreckte, brüllten Köche ihre Küchenjungen an, fielen Töpfe klappernd zu Boden, sausten Kellner hin und her wie fleißige Bienen, und obwohl dieses Tohuwabohu nicht zu vergleichen war mit der stillen Werkstatt in Meister Benedicts Apotheke, fühlte ich mich hier doch viel mehr zu Hause als in der Welt, die ich gerade hinter mir gelassen hatte. Das Fest war ganz großartig, ein atemberaubender Blick in ein Leben, von dem ich immer geträumt hatte – ich, der ich im Cripplegate-Waisenhaus aufgewachsen war. Aber obwohl mein Herz immer noch von der Begegnung mit dem König glühte, wurde mir klar, dass ich in dem Ballsaal völlig fehl am Platz war. Man war mir dort mit Freundlichkeit begegnet, aber ich gehörte dort nicht hin.
Der andere Grund, warum ich die Küche so faszinierend fand, war ein ganz einfacher: Ich hatte noch nie so viel Essen auf einmal gesehen. Und dabei ächzten die Tische im Ballsaal doch schon unter dem Gewicht der Speisen. Wer sollte das alles essen?
Tom zum Beispiel, dachte ich schmunzelnd und mopste mir ein Kotelett mit Soße von einem Teller. Auf das hier würde er verzichten müssen. Ein paar Diener warfen mir neugierige Blicke zu, sagten aber nichts. Ich wollte schon nach dem Weinkeller fragen, als ich die Treppe nach unten entdeckte. Ich wich einem halben Dutzend Küchenmädchen aus, die mit silbernen Tabletts beladen waren, auf denen Gläser mit einer dunkelroten Flüssigkeit standen – die hoffentlich den Geschmack des schwerhörigen Gentlemans treffen würden. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich zur Party zurückkehren sollte, aber meine Neugier war geweckt. Wenn ich schon einmal hier war, konnte ich genauso gut einen Blick in den Keller werfen.
Ich ging die Treppe hinunter und mit jedem Schritt wurde es klammer. Die Kälte des Herbstes sickerte durch Stein und Erde. Flackernde Lampen erhellten den Weg und warfen Schatten, die im Rhythmus der Flammen tanzten. An einer Wand lagerten riesige Fässer. Aus einem lecken Zapfhahn tropfte Ale. Und in der Mitte des höhlenartigen Kellerraums zogen sich Regale mit unzähligen Weinflaschen bis zur hinteren Wand. Es mussten Hunderte sein – ein flüssiges Vermögen. Auf einem Tisch standen etliche leere Flaschen.
»Mr Glover?«
Er war nicht hier, aber er war auch nicht nach oben gekommen. Ich fragte mich, ob er seiner Leidenschaft nachgegeben hatte und betrunken zwischen den Fässern lag. Dann entdeckte ich ein schwaches Licht an der gegenüberliegenden Seite des Kellers.
Ich ging ein bisschen näher heran und sah eine Tür aus Stein, die sich fast nahtlos in die Wand einfügte. Sie stand nur einen kleinen Spalt offen und durch diesen Spalt drang das Licht. Ich zog an der Tür und steckte den Kopf durch den Spalt. Dahinter führte eine enge Wendeltreppe nach oben. An der Mittelsäule hing eine Öllampe.
Ein Geheimgang, dachte ich. Auf diesem Weg war Glover also verschwunden. Ich hatte von so etwas schon gehört: schmale Gänge für die Dienstboten, die auf diese Weise ungesehen hinter den Kulissen agieren konnten, ohne die vornehmen Herrschaften zu stören. Interessant war, dass es einen Geheimgang zum Keller gab. Wer immer dieses Haus erbaut hatte, war – genauso wie der Kellermeister – dem Wein anscheinend sehr zugetan gewesen.
Ich schlüpfte durch den Spalt, wobei mich eine Stimme in meinem Kopf ermahnte, ich solle nicht herumschnüffeln. Die Stimme hörte sich genauso an wie die von Tom. Ich ignorierte sie. Wie konnte irgendjemand einen Geheimgang sehen und nicht wissen wollen, wohin er führt?
Ich will nur einen kurzen Blick riskieren, beruhigte ich die Stimme in meinem Kopf und stieg vorsichtig die Stufen nach oben. Im zweiten Stock befand sich wieder eine Tür, die diesmal geschlossen war, und davor – merkwürdigerweise – ein einzelner Stiefel, der auf der Seite lag. Ich hob ihn auf und entdeckte einen Weinfleck auf der Spitze. Der Stiefel gehörte Glover. Ich hatte vorhin selbst miterlebt, wie er Wein über den Stiefel verschüttet hatte.
Warum lag dieser Stiefel hier?
Das Licht von oben wurde heller. Ich ging weiter und sah, dass die Wendeltreppe an einer weiteren Tür endete. Diese Tür stand offen. Ich lugte um die Ecke, um zu sehen, was sich dahinter befand.
Es war ein Schlafzimmer, viel prächtiger als meins. Ich hielt es für das Zimmer des Hausherrn, nicht nur wegen seiner luxuriösen Ausstattung, sondern auch aufgrund des Wandteppichs über dem Bett: gekreuzte Hellebarden über einem Hirschgeweih, genau wie über dem Eingang des Hauses.
Und dort, halb auf dem Bett, halb auf dem Boden, lag ein Mann.
Ich erstarrte. Es war Glover, der nur noch einen Stiefel trug. Vorsichtig ging ich weiter und hörte Glas klirren. Mit den Füßen war ich gegen zwei Flaschen gestoßen. Die eine war verkorkt, die andere offen, und aus dieser Flasche gluckerte Flüssigkeit über den Boden, als die beiden Flaschen zur Seite rollten.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte Glover nicht so liegen lassen. Er brauchte Hilfe. Aber wenn ich jemandem Bescheid sagte, musste ich erklären, was ich hier oben gewollt hatte – wo weder er noch ich etwas zu suchen hatten.
Also musste ich mich selbst um die Sache kümmern. Ich ging zum Bett und drehte den Kellermeister um. Der Gestank nach Wein und Erbrochenem stieg mir in die Nase, zusammen mit dem schweren Aroma nach Knoblauch. Er hatte sich übergeben, aber nicht hier, denn es war nichts zu sehen. Ich musste würgen, als ich ihn umdrehte, denn zu dem üblen Magengeruch gesellte sich noch ein anderer: Er hatte in die Hose gemacht.
»Mr Glover.« Ich schüttelte ihn, aber er wachte nicht auf. »Mr Glover!«
Sein Kopf fiel zur Seite und seine Augen öffneten sich einen Spalt. Einen Moment lang dachte ich, er würde aufwachen. Aber sein Blick war merkwürdig leer. Und dann erkannte ich, dass er nicht atmete.
Er war tot.
Ich stolperte rückwärts und fiel mit einem dumpfen Schlag auf den Teppich neben dem Bett. Die Pest, dachte ich unwillkürlich und kroch vor Panik nach hinten. Doch im nächsten Moment schalt ich mich wegen meiner Torheit.
Es war nicht die Pest. Der Mann hatte keinerlei Symptome gezeigt und die Krankheit hatte Oxford bisher verschont.
Aber was hatte ihn dann getötet?
War er gestürzt und hatte sich den Kopf am Bettpfosten angeschlagen? Ich untersuchte ihn, konnte aber keine Wunde entdecken.
Ein Herzanfall? Nein, auch dazu passte der Zustand nicht, in dem er sich befand. Er hatte sich erbrochen, sich unkontrolliert erleichtert, war mitten in der Bewegung tot umgefallen.
Also doch die Pest, kreischten meine Nerven, aber ich schüttelte den Kopf. Es gab überhaupt keine Zeichen. Basierend auf dem, was ich vor mir sah, war es viel wahrscheinlicher, dass er …
Mir wurde kalt bis auf die Knochen, als ich mich an die Worte des Kellermeisters erinnerte.
Es is doch meine Aufgabe, den Wein zu probieren, Sir. Was, wenn er vergiftet is?
Das war als Scherz gemeint gewesen. Doch ich erkannte mit Grauen, dass alles zusammenpasste. Nicht nur die Art der Symptome, sondern auch die rasende Geschwindigkeit, mit der der Tod eingetreten war.
Glover war vergiftet worden. Er hatte den Wein getrunken und eine der Flaschen war vergiftet gewesen. Und gerade war eine neue Runde Wein geöffnet worden. Ich selbst hatte gesehen, wie die Mädchen die Tabletts hineintrugen …
Zum Fest.
Zum König.
Meine Brust verkrampfte sich. Ich rappelte mich auf und wollte wieder nach unten rennen.
Genau in diesem Moment legte sich eine Schnur um meinen Hals.
Kapitel 5
Die Schlinge zog sich enger und mein Hals brannte vor Schmerz, als ich in die Höhe gerissen wurde.
Ich trat um mich und versuchte, meine Füße wieder auf den Boden zu bekommen. Der Körper eines Mannes drückte sich in meinen Rücken und sein Atem fuhr mir heiß ins Ohr.
Ich krallte nach der Schnur, versuchte, mit den Fingern darunterzukommen. Sie drückte mir die Luft ab und schnitt in mein Fleisch. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich konnte nicht mehr denken. Ich griff nach hinten und tastete nach dem Mann, der mich zu erwürgen versuchte. Ich fühlte seine großen Hände, die gespannte Haut seiner Finger, die sich um die Schlinge krampften. Meine Arme zuckten wild durch die Luft, aber meine Schläge waren zu schwach und landeten wirkungslos auf der Kapuze, die seinen Kopf bedeckte.
Er schüttelte mich, wie ein Hund eine Ratte schüttelt, und zog noch enger zu. Mein Gesicht schwoll an und ich hörte auf, um mich zu schlagen, und versuchte stattdessen wieder, die Finger unter die Schlinge zu zwängen. Vergeblich. Blitze und Kometen zuckten durch die Luft, dann wurde mir schwarz vor Augen. Meine Arme wurden schwer, und obwohl mein Gehirn sie anbrüllte, sie sollten sich gefälligst bewegen, fielen sie schlaff herab.
Tom, dachte ich noch.
Tom
nein
nein
Tom
Meister
Hilfe
fallen
Ich fiel
der Boden
Der Boden. Geräusche. Wärme. Jemand schrie.
Ein Kampf.
Ein … Schatten? Ein Gespenst? Ein Bär?
Mein Hals. Mein Hals tat so furchtbar weh.
Ich hörte Glas zersplittern. Ich fühlte eine kühle Brise. Sah einen Funken Kerzenlicht.
Hände hoben mich hoch. Große, starke Hände. Die mich aufs Bett legten.
Die Schnur. Jemand zog die Schnur von meinem Hals weg. Meine Haut brannte wie Feuer.
Luft. Ich schnappte nach Luft – und da war sie. In tiefen Atemzügen saugte ich sie in meine Lungen.
Tom türmte sich über mir auf. Er wirkte panisch. Er blinzelte. Sein eines Auge war rot und tränte und darunter auf der Wange wuchs eine rote Beule. Er drückte auf meine Brust, als ob er mir helfen wollte, die Luft in meinen Körper zu pumpen. Ich hustete und keuchte und kämpfte gegen seine Arme an.
»Es ist gut«, sagte Tom. »Der Mann … er ist weg. Er ist gefallen.«
Benebelt schaute ich zum Fenster, von dem nur noch Scherben übrig waren. Auf dem Boden lag ein Mantel. Tom musste den Attentäter von mir weggezogen und durch die Scheibe gestoßen haben. Pech für ihn, dass wir im zweiten Stock waren.
Der Herbstwind fegte herein und es wurde kalt im Zimmer. Ich atmete, hektisch, tief und rasselnd. Ich war am Leben. Ich ließ mich nach hinten sinken und wollte mich ausruhen, aber da meldete sich eine Stimme in meinem Kopf.
Hast du nicht etwas vergessen?
Ruckartig setzte ich mich auf. Mr Glovers Leiche lag immer noch neben mir auf dem Bett.
Gift, sagte ich. Oder versuchte es wenigstens.
Kein Wort kam aus meinem Mund.
Ich versuchte es noch einmal. Halt sie auf. Aber meine Kehle zog sich zusammen und widersetzte sich meinem Befehl. Die Schnur hatte mir die Stimme abgeschnitten. Ich konnte nicht mehr sprechen.
Ich konnte nicht sprechen.
Ich packte Tom an den Armen. »Leg dich hin«, sagte er. »Dann geht es dir gleich wieder besser. Leg dich hin.«
Ich schüttelte den Kopf. Keine Zeit. Du musst verhindern, dass sie den Wein trinken. Aber meine Stimme gehorchte mir nicht.
Meine stummen Worte ängstigten ihn. »Was ist denn los? Was brauchst du?«
Ich deutete auf die Flaschen auf dem Boden. Wein, sagte ich lautlos.
»Oh, ja – natürlich.« Tom hob die offene Flasche auf und setzte sie an meine Lippen. »Hier, trink.«
Erschrocken schlug ich seine Hand weg. Die Flasche entglitt seinen Fingern und zerbrach auf den Bodendielen. Der Rest des vergifteten Weins floss in kleinen Bächen unter den Schrank.
Am liebsten hätte ich vor lauter Frust gebrüllt, und zwar so laut ich konnte. Irgendeinen Ton. Irgendeinen. Aber ich hatte keine Stimme. Und keine Zeit.
Ich sprang auf. Tom schaute verwirrt zu, wie ich die ungeöffnete Flasche griff und auf den Geheimgang zutaumelte.
Oh nein. Böse Stufen. Erst nach unten, bis in den Keller, und dann wieder nach oben. Meine Beine waren wie Pudding. Das würde zu lang dauern. Stattdessen stakste ich zur Zimmertür hinaus und durch den Gang.
Tom folgte mir, immer noch mit ängstlichem Gesicht. »Was ist denn los? Christopher?«
Ich hätte alles darum gegeben, wenn ich ihm hätte antworten können. Doch so ging ich einfach weiter in Richtung der Festlichkeiten. Mir zitterten die Beine und Tom musste zweimal zupacken, als ich beinahe zu Boden gegangen wäre.
Ich muss die Treppe runter, dachte ich. Aber ich werde mir den Hals brechen.
Dann erinnerte ich mich an die Balkone im Ballsaal.
Die Balkone. Das war die Lösung. Ich bewegte mich jetzt schneller, sicherer, mit mehr Entschlossenheit. Ich fand den Gang, der zu dem nächstgelegenen Balkon führte, stolperte zum Geländer und schaute nach unten.
Außer den Musikanten auf dem Balkon mir gegenüber befanden sich alle anderen unten im Saal. Die Lakaien spazierten durch die Menge und verteilten die Weingläser.
Mein Blick zuckte durch die Gäste, auf der Suche nach dem König. Da er größer war als jeder andere Mann im Saal, war er nicht zu übersehen. Er hielt schon ein Glas in der Hand, genau wie die Herrschaften, die ihn umringten. Wie Lord Ashcombe, der auf der anderen Seite des Ballsaals stand. Die anderen Gäste bedienten sich von den Tabletts, die die Lakaien ihnen darboten. Gerade wurde der französischen Dame mit der Federmaske ein Glas gereicht.
»Halt.«
Endlich war meine Stimme wieder da. Aber ich konnte nur krächzen. Niemand hörte mich über den angeregten Gesprächen, dem Gelächter und der Musik.
Der König hob sein Glas und sprach einen Trinkspruch.
Ich versuchte es noch einmal.
»Halt.«
Aber sie hörten mich nicht. Sie konnten mich einfach nicht hören.
Der König beendete seine kurze Rede. Er hob das Glas an die Lippen.
Ich hatte immer noch die ungeöffnete Flasche von Mr Glover bei mir. Und ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen.
Ich warf die Flasche auf den König.
Die Flasche drehte sich im Flug und beschrieb einen langsamen, schwankenden Bogen. Dann landete sie mitten in dem Kreis um den König.
Sie zerbrach nicht einfach – sie explodierte. Glassplitter rasten wie Pfeile durch die Luft und blieben in den Stiefeln der Gentlemen stecken. Der Wein spritzte in alle Richtungen und befleckte Seidenstrümpfe und Satinröcke.
Ein paar Leute kreischten auf. Dann senkte sich eine verblüffte, entgeisterte Stille über den Saal. Die Gespräche verstummten, die Musik hörte auf und alle schauten nach oben.
»Was um Gottes willen …?«, hörte ich König Charles sagen.
Und dann setzten sich die Wachen unten im Ballsaal in Bewegung. Zwei schoben sich durch die Gäste, die Hellebarden im Anschlag, schubsten die Damen aus dem Weg und bildeten einen dichten Ring um den König. Andere versperrten mit ihren Hellebarden die Ausgänge. Der Rest rannte aus dem Saal. Um mich gefangen zu nehmen, wie ich befürchtete.
Lord Ashcombes Hand war instinktiv zu seiner Seite gezuckt, wo sich normalerweise sein Schwert befand, das er aber zu diesem Anlass nicht bei sich hatte. Dann packte er den Perlmuttgriff der Pistole und suchte mit den Augen die Balkone nach der Gefahr ab.
Als er mich erblickte, erstarrte er und runzelte die Stirn.
Tom, der nicht minder verdattert war, wich entgeistert über meinen Flaschenwurf vor mir zurück. Ich hatte keine Zeit, ihm meine Handlungsweise zu erklären. »Nicht den Wein trinken!«, rief ich nach unten. Aber meine Stimme war immer noch zu schwach und die Gäste unterhielten sich mittlerweile wieder lautstark über den Wahnsinn, dessen Zeuge sie soeben geworden waren. Eine Dame neben Seiner Majestät, deren Kleid den meisten Wein abbekommen hatte, verfluchte mich voller Zorn. Alle anderen schauten zum König hin.
Charles versuchte, die Spannung durch einen Scherz zu vertreiben. »Da habt Ihr uns vielleicht einen Burschen mitgebracht, Richard.« Er schüttelte rubinfarbene Tropfen von seinen Fingern. »Jemand sollte dem Jungen klarmachen, dass Wein zum Trinken da ist, nicht zum Werfen.«
Die Menge lachte, aber in meinen Ohren donnerten die Stiefel der Wachen, die die Treppe hochgestapft kamen. Und alles, was ich sehen konnte, war das Glas.
Der König hatte immer noch sein Glas in der Hand.
Panisch blickte ich zu Lord Ashcombe hin, der ratlos den Kopf schüttelte. Warum?
Die Wachen hatten mich gleich. Ich streckte die Hand aus und tat so, als würde ich ein Glas halten. Dann deutete ich hektisch auf dieses unsichtbare Glas.
Lord Ashcombe beobachtete mich.
Langsam und überdeutlich zog ich meinen Zeigefinger über meine Kehle.
Lord Ashcombe runzelte die Stirn.
Dann deutete ich direkt auf den König. Mir blieb kaum mehr Zeit für diese Geste, da hatten mich raue Hände schon gepackt und zu Boden gedrückt. Die Soldaten des Königs stürzten sich auch auf Tom. Er wich nur furchtsam zurück und machte keine Anstalten, sich zu wehren. Er landete auf dem Boden neben mir.
Aber Lord Ashcombe hatte meine Geste gesehen. Er drehte sich um.
Charles hatte wieder das Glas erhoben. »Auf die Jugend«, lachte er und alle, die nicht vor Schreck ihre Gläser fallen gelassen hatten, erhoben sie und prosteten dem König zu.
»Auf die Jugend!«
Lord Ashcombes Augen wurden groß.
Charles setzte das Glas an die Lippen.
Er würde zu spät kommen. Er hatte keine Zeit, um quer durch den Saal zu rennen. Stattdessen hob Lord Ashcombe mit einer fließenden Bewegung die Pistole, die er noch in der Hand hielt. Er zielte auf den König und drückte ab.
Der Knall hallte ohrenbetäubend in dem Ballsaal wider. Die Bleikugel wurde mit einer kleinen Rauchexplosion aus dem Lauf geschleudert und traf das Glas in dem Moment, in dem der Wein des Königs Lippen berührte. Das Kristall zersprang in tausend Stücke und der Wein ergoss sich blutrot über den Rock des Königs. Die Kugel flog weiter und riss einem Mann die gelockte Perücke vom Kopf, ehe sie in der Holztäfelung der Wand stecken blieb und dabei noch einige Splitter heraushebelte.
Die Menge keuchte auf. Die Soldaten neben dem König erstarrten, als ob sie nicht glauben konnten, was sie soeben erlebt hatten. Dann schoben sie die Gäste beiseite und packten ihren eigenen Kommandanten an den Armen. Doch immer noch wechselten sie ratlose und verwirrte Blicke.
Charles war ebenso fassungslos wie seine Männer. Er starrte seinen alten Freund an, und als er sprach, klang seine Stimme nicht wütend. Sie klang verletzt. »Richard«, sagte er. »Was für ein schlimmer Streich ist das?«
Lord Ashcombe neigte den Kopf. »Bitte vergebt mir, Sire«, sagte er. »Aber ich glaube, der Wein ist vergiftet.«
Kapitel 6
Alle Ein- und Ausgänge wurden geschlossen. Ein Dutzend Wachen brachten den König aus dem Ballsaal, während Lord Ashcombe seine Männer in jeden Winkel des Anwesens befahl, um zu verhindern, dass sich irgendjemand aus dem Staub machte. Dann schickte er einen Kurier nach Oxford, der Verstärkung anfordern sollte, und innerhalb einer Stunde war das Haus von so vielen Soldaten umstellt, dass es einem Belagerungszustand glich.
Trotz meiner – zugegebenermaßen ungeschickten – Bemühungen, das Attentat zu vereiteln, hatten einige Gäste das Gift bereits zu sich genommen. Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät: zwei Lords hatten ihren Wein ausgetrunken, sobald sie die Gläser in der Hand gehalten hatten, und ein Dienstmädchen hatte sich heimlich ein Glas genommen, bevor sie die restlichen auf dem Tablett nach draußen brachte. Eine Handvoll weiterer Personen hatte zumindest etwas davon getrunken, und da ich nicht wusste, um welches Gift es sich handelte, und entsprechend auch nicht das passende Gegenmittel kannte, hielt ich es für das Beste, sie alle erbrechen zu lassen.
Mit Lord Ashcombes Erlaubnis holte ich die Apothekerschärpe aus meinem Schlafzimmer. Sie hatte meinem Meister gehört und war mit zahlreichen Taschen besetzt, in denen sich alle möglichen Pulver, Kräuter und Salben befanden, außerdem eine Anzahl nützlicher Werkzeuge. Meister Benedict hatte sie stets dabeigehabt, wenn er Hausbesuche machte. Nachdem er ermordet worden war, hatte ich sie an mich genommen und trug sie meistens unter meinem Hemd.
Das beste Mittel, das ich bei mir hatte, war Brechwurzsirup, hergestellt aus einer Pflanze, die nur in der Neuen Welt wuchs. Das Fläschchen enthielt allerdings nur zwei Portionen, die ich den Gästen verabreichte, die den meisten Wein getrunken hatten. Den anderen gab ich Senfpulver. Auch davon hatte ich nur zwei Portionen, aber in der Küche gab es jede Menge Senfsamen, die ich zerkleinerte. Das Erbrechen war kein schöner Anblick – von dem Gestank ganz zu schweigen –, aber glücklicherweise erholten sich die Betroffenen im Großen und Ganzen recht gut, bis auf eine Dame, die weiterhin in Lebensgefahr schwebte.
Nachdem ich mich um die Vergifteten gekümmert hatte, humpelte ich in die Bibliothek, um mich selbst zu verarzten. Die Prellungen und Schrammen, die ich durch die Soldaten des Königs erlitten hatte, als diese mich zu Boden rissen, waren nicht der Rede wert, aber mein Hals tat immer noch entsetzlich weh und die Haut auf meinem Nacken brannte wie Feuer.
Tom wickelte das Tuch ab, das ich darumgeschlungen hatte, und schaute sich die Verletzung an. »Das sieht ziemlich schlimm aus«, sagte er.
Mithilfe des Spiegels aus meiner Schärpe betrachtete ich meinen Hals. Ringsum verlief ein knallroter Streifen und das Blut, das aus der Rille ausgetreten war, hatte den Kragen meines geborgten Hemds ruiniert. Seufzend ließ ich mich auf einen Stuhl fallen und hielt still, während Tom mir Spinnweben auf die Wunde legte.
Die Tür ging auf und die Wachen, die Lord Ashcombe zu meinem Schutz abgestellt hatte, rückten mit nach vorn gestreckten Hellebarden vor, bis ich sie zurückrief.
»Schon gut«, sagte ich. »Sie ist eine Freundin von mir.«
Sally warf den Wachen einen misstrauischen Blick zu, als sie ins Zimmer schlüpfte. Schnell kam sie zu mir und ihr Gesicht war genauso besorgt wie das von Tom. Dazu machte sie noch einen ziemlich erschöpften Eindruck.
»Du ziehst den Ärger wirklich magisch an, egal wo du bist«, sagte sie.
Tom grunzte. »Genau das hab ich auch gesagt.«
»Seid nett zu mir«, verlangte ich. »Ich bin verletzt.« Und damit deutete ich auf meinen Hals. »Seht ihr? Au.«
Tom schüttelte den Kopf, während Sally das Töpfchen mit Honig aus meiner Schärpe zog und ein wenig davon über die Spinnweben tupfte. Es brannte, aber die Kühle tat gut.
»Was geht da draußen vor?«, fragte Sally.
»Lord Ashcombe verhört die Gäste. Er versucht herauszufinden, wer der Attentäter war.«
Sally warf einen Blick auf die Soldaten und senkte die Stimme. »Er macht mir Angst.«
Dieses Gefühl kannte ich. »Mir macht eher Angst, dass ein Attentäter hier herumlaufen kann, ohne dass es jemand merkt.«
»Ach, das ist kein Problem.« Sally tupfte noch etwas Honig auf den roten Striemen und wickelte dann vorsichtig einen Streifen Baumwollstoff um die Wunde. »Es sind hundert Gäste da, von denen jeder einen Groll gegen den König hegen könnte. Und alle haben ihr eigenes Personal dabei. Allein die französische Dame hat zehn Bedienstete. Und niemand achtet auf Dienstboten. Wer immer es war, Gast oder Diener, hätte einfach an dir vorbeimarschieren können, ohne dass es jemanden gekümmert hätte.«
Das hatte ich auch bemerkt. Ich erzählte Tom und Sally, wie ich in die Küche und von da aus in den Weinkeller gegangen war. »Niemand hat mich aufgehalten. Niemand hat mir auch nur eine Frage gestellt.«
Sally band die Enden des Tuchs zusammen, damit es nicht verrutschte. »Ich sollte übrigens auch nicht hier sein. Lady Pemberton ist völlig hysterisch. Ich habe ihr gesagt, ich würde versuchen, ihr ein Beruhigungsmittel zu besorgen. In Wahrheit wollte ich nur sehen, ob es dir gut geht.«
Ich zog ein Fläschchen mit einer bräunlichen Flüssigkeit aus meiner Schärpe. »Das ist Brandy. Eins der besten Beruhigungsmittel, die es gibt. Und garantiert nicht vergiftet.«
»Allerdings könnte es explodieren«, warf Tom ein.
Sally wusste offenbar nicht, ob sie lachen oder uns ausschimpfen sollte. »Ihr Kindsköpfe«, sagte sie.
Wieder ging die Tür auf und Lord Ashcombe trat ein. Sally senkte den Blick, knickste und huschte dann an ihm vorbei aus dem Zimmer.
Er drückte die Tür hinter ihr zu. »Alles in Ordnung?«, fragte er mich.
»Alles klar«, sagte ich.
»Das hast du gut gemacht. Und das gilt für euch beide.« Lord Ashcombe verschränkte die Arme vor der Brust. »Jetzt müssen wir einen Verräter aufspüren. Erzählt mir alles, was ihr wisst.«
Ich berichtete ihm von den Ereignissen, wobei ich keine noch so kleine Kleinigkeit ausließ. Er lauschte aufmerksam, und als ich fertig war, wandte er sich Tom zu.
»Ich sah, wie Christopher das Fest verließ«, sagte Tom und duckte sich unwillkürlich unter Lord Ashcombes Blick. »Also folgte ich ihm. Als ich in die Küche kam, hat mir eins der Serviermädchen gesagt, er sei in den Weinkeller gegangen, und als ich da hinkam, sah ich die Treppe nach oben. Ich wusste genau, dass Christopher einem Geheimgang nicht widerstehen kann, also bin ich auch hochgegangen. Und da habe ich gesehen, wie jemand ihn erwürgen wollte.«
»Wie hat der Mann ausgesehen?«
»Er war stämmig. Kräftig wie ein Bulle. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so stark war.«
»Und sein Gesicht?«
»Das … das habe ich nicht sehen können«, sagte Tom entschuldigend. »Er hatte einen Umhang mit einer Kapuze, die sein Gesicht verdeckte.« Als Lord Ashcombe grunzte und Tom bedeutete, er solle fortfahren, holte der tief Luft. »Na ja, ich habe den Mann gepackt, um ihn von Christopher wegzuziehen. Er ließ ihn los und wir haben miteinander gerungen. Dann hat er mir ins Auge gestochen. Als ich sah, dass er mit seiner Hand nach seinem Gürtel griff, habe ich Panik bekommen und nach ihm getreten. Sein Umhang wurde weggerissen und er fiel durchs Fenster. Ich glaube … Ich glaube, ich habe ihn umgebracht.«
Lord Ashcombe schüttelte den Kopf. »Hast du nicht. Das Fenster befindet sich oberhalb des Gartens. Der Attentäter ist ins Gebüsch gefallen.«
Meine Kehle schmerzte, als ich schluckte. »Er ist noch am Leben?«
Lord Ashcombe nickte. »Was hast du mit dem Umhang des Mannes gemacht?«
»Nichts«, sagte Tom. »Ich habe ihn da liegen gelassen.«
Ashcombe befahl einem seiner Männer, den Umhang aus dem Gemach zu holen. Während wir warteten, betrachtete er uns. Sein Schweigen machte mich nervös. »Geht es dem König gut?«, fragte ich, nur um die Stille zu durchbrechen.
»Ja«, sagte er knapp.
Wieder eine Pause. »Sally hat gerade die Französin erwähnt, die an dem Fest teilgenommen hat, und …«
»Sie war es nicht.«
Danach gab ich es auf, ihn in ein Gespräch verwickeln zu wollen. Der Soldat kehrte mit dem Umhang und mit einem Fetzen zurück, der vom Hemd des Attentäters abgerissen worden war. Lord Ashcombe legte beides auf den Tisch.
Tom war niedergeschlagen. Er war der Einzige, der den Attentäter gesehen hatte, aber er war nicht in der Lage, irgendwelche nützlichen Hinweise beizusteuern. Ich entschloss mich, den Beschützer des Königs, der die Gegenstände auf dem Tisch wortlos anstarrte, ein weiteres Mal anzusprechen, teilweise um Toms willen, teilweise aber auch, weil mir meine Neugier keine Ruhe ließ. »Bitte verzeiht, Mylord, aber … sucht Ihr etwas Bestimmtes?«
Er schaute mich an und sein Blick war unergründlich. Dann sagte er: »Komm her.«
Ich ging zu ihm und er deutete auf Mantel und Fetzen. »Was siehst du?«
Ich war mir nicht sicher, wonach ich suchen sollte, genauso wenig wie Tom.
»Das ist kein Trick«, sagte Lord Ashcombe. »Sagt mir einfach, was ihr seht. Alles, egal wie unbedeutend es euch auch erscheinen mag.«
Tom würde garantiert nicht als Erster das Wort ergreifen, also tat ich es. Mein Magen flatterte, als ob ich wieder im Gildehaus der Apotheker stehen und meine Prüfung ablegen würde. »Der Umhang ist aus Wolle. Er ist braun. Er sieht warm aus. Das Hemd ist aus Leinen. Es ist weiß. Die Webart lässt auf eine leidliche Qualität schließen.«
»Und was sagt dir das?«
Ich fühlte, wie sich Schweißtropfen auf meiner Oberlippe sammelten. »Ähm …«
»Denk nach. Wer würde so etwas tragen?«
Ich schaute erst ihn und dann Tom an. Ashcombes Hemd bestand aus Seide, Toms aus Leinen, genau wie meins. Genau wie der Fetzen, der von dem Hemd des Attentäters abgerissen worden war. Und obwohl unsere Hemden von besserer Qualität waren als dieser Fetzen, konnte …
Und plötzlich verstand ich.
Kapitel 7
»Ein Dienstbote«, sagte ich. »Das ist die Kleidung eines Dienstboten.«