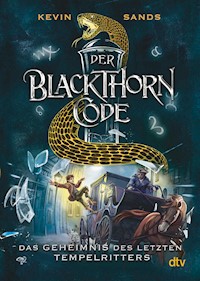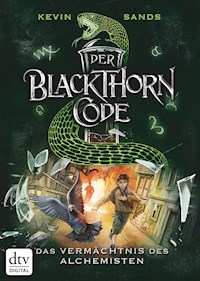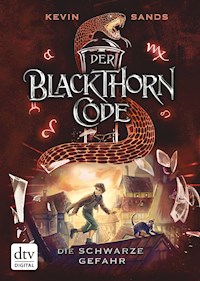
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Blackthorn Code-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Was für ein Lesewahnsinn zwischen zwei Buchdeckeln!« literaturmarkt.info »Christopher, ich habe einen Schatz für dich versteckt. Lies dies sorgfältig. Erkenne das Geheimnis.« Das ist die letzte Botschaft, die Benedict Blackthorn hinterlassen hat. Doch Christopher weiß nicht, wie er dieses Geheimnis lösen soll. Obwohl ihm ein Schatz sehr gelegen käme, denn er hat kaum noch Geld. Und es droht eine neue Gefahr: Die Pest hat ihren Weg nach London gefunden. Die panische Stimmung wird noch weiter angeheizt durch einen geheimnisvollen Propheten, der genau vorhersagen kann, wo der schwarze Tod als Nächstes zuschlägt. Auf der Jagd nach der Wahrheit geraten Christopher und sein bester Freund Tom mitten in das Herz einer dunklen Verschwörung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kevin Sands
Die schwarze Gefahr
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexandra Ernst
Montag,31. August 1665Zahl der Pesttoten des gestrigen Tages: 1.143Todesfälle insgesamt: 30.551
Ob ihr’s glaubt oder nicht: Igelstacheln können wirklich brennen!
Und obwohl die Feststellung dieser erstaunlichen Tatsache nicht Ziel meines jüngsten Experiments gewesen war, hatte mich Meister Benedict gelehrt, dass der wahre Fortschritt selbst in der kuriosesten Entdeckung liegen kann. Wenn ich mir allerdings Tom betrachtete, der entsetzt die Augen aufriss, als sich die Flammen über den Rücken des ausgestopften Igels fraßen, war mein Experiment wohl nicht wirklich ein Fortschritt, sondern eher ein Rückschlag.
Zu meiner Verteidigung muss gesagt werden, dass ich gar nicht vorhatte, Harry, den Igel, in Brand zu stecken. Doch dieses Argument ließ Tom nicht gelten. Du hast nie vor, irgendwas in Brand zu stecken, würde er sagen, seine mächtigen Arme verschränken und mich böse angucken. Und trotzdem tust du’s.
Es fing an wie immer: mit einer Idee. Und damit, dass ich die Stimme ignorierte, die mir sagte: Das ist eine blöde Idee.
Kapitel 1
»Das ist eine blöde Idee«, sagte Tom.
Aus den Augenwinkeln musterte er den Apparat am anderen Ende des Arbeitstischs, als ob er Angst hatte, das Ding würde ihm ins Gesicht springen, wenn er es direkt anschaute.
»Du weißt doch noch gar nicht, was man damit machen kann«, sagte ich.
Er biss sich auf die Lippen. »Ich will’s auch nicht wissen.«
Zugegeben, der Apparat sah merkwürdig aus. Er war etwa dreizehn Zentimeter hoch und hatte eine gewölbte Kappe über einer schmalen, hochkant stehenden Röhre, die mit Papier umwickelt war. Der obere Teil des Apparats balancierte auf drei hölzernen Stecken, die nach unten ragten. Am Ende baumelte eine Zündschnur.
»Es sieht aus wie ein Pilz«, sagte Tom. »Ein Pilz mit einem Schwanz.« Er wich von dem Arbeitstisch zurück. »Mit einem entflammbaren Schwanz.«
Ich fühlte mich gekränkt. Egal, wie seltsam das Ding auch aussehen mochte, es war das Wichtigste, was ich je hergestellt hatte. Die anderen Gerätschaften der Apotheke – die Porzellankrüge, die Glasbehälter, die Löffel und Becher und Töpfe und Kessel – lagen unberührt und unbenutzt auf den Bänken und Tischen an der Wand. Nur ein schwacher Duft nach Kräutern und Salben lag in der Luft. Selbst der riesige, zwiebelförmige Ofen in der Ecke war kalt. Denn es war dieser Apparat, der meinen Laden retten würde.
Stolz hob ich ihn hoch. »Blackthorns Hausrauchmaschine! Wirkt garantiert und … ähm … räuchert jedes Haus. Na ja, der Werbespruch braucht noch ein bisschen Feinschliff.«
»Dein Gehirn braucht Feinschliff«, brummte Tom.
Das ging zu weit! »Meine Erfindungen tun immer genau das, was sie tun sollen.«
»Ich weiß«, sagte Tom. »Das ist ja das Problem.«
»Aber … guck doch!« Ich stellte die Hausrauchmaschine vorsichtig wieder ab und zeigte ihm meinen Entwurf, den ich auf einem Stück Pergament aufgemalt hatte.
»Es funktioniert wie ein Feuerwerkskörper«, sagte ich, was vielleicht nicht der beste Einstieg in eine Erklärung war, mit der ich Tom für mich gewinnen wollte.
»Man muss die erste Zündschnur anstecken. Das Schießpulver im unteren Bereich der Maschine treibt den oberen Teil in die Luft. Dadurch wird die zweite Zündschnur entfacht und der Deckel explodiert.« Ich machte eine ausholende Armbewegung, als würde ich in der Royal Exchange von London einen Ballen Seide auswerfen. »Der Rauch verteilt sich im ganzen Haus und gewährleistet die Sicherheit und Gesundheit der Familie! Eine Maschine, mit der man die Pest aus dem Haus vertreiben kann!«
»Aha«, war Toms Kommentar. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ihn meine Ausführungen sonderlich beeindruckten. »Warum ist da Mehl drin?«
»Das ist der beste Teil. Schau her!«
Ich ging um den Arbeitstisch herum, wo ich seitlich zwei Säcke mit Mehl abgestellt hatte, schaufelte eine Handvoll heraus und nahm dann einen Wachsstock, der auf dem Tisch stand. Als ich das Mehl in die Flamme pustete, entzündete es sich mit einem hellen Schein.
»Siehst du?«, sagte ich. »Es explodiert. Das ist der Grund, warum Campdens Mühle letztes Jahr hochgegangen ist. Es war zu viel Mehl in der Luft.«
Tom legte seine Finger an die Stirn. »Eine explodierte Mühle hat dich auf die Idee zu deiner Erfindung gebracht?«
»Na ja … Mehl ist nicht so gefährlich wie Schießpulver, richtig?« Tom schien nicht überzeugt zu sein. »Also, wenn das Mehl explodiert, entzündet es die Sägespäne und die Kräuter und der ganze Raum wird mit Rauch gefüllt. Und soweit wir wissen, verhindert Rauch, dass man die Pest bekommt. Wir können jede Menge dieser Apparate herstellen und Sägespäne von unterschiedlichen Hölzern nehmen, je nach Kundenwunsch.«
»Warum kann man nicht einfach ein Feuer machen?«, fragte Tom.
»Man kann doch nicht einfach im Haus ein offenes Feuer anzünden«, sagte ich.
»Und das da soll sicherer sein?«
»Ist es«, beharrte ich. »Man darf es bloß nicht in der Nähe von Vorhängen aufstellen. Und Öllampen. Und Haustieren. Und … ach was, ich zeig’s dir einfach.«
Tom ging rückwärts. »Warte mal. Du willst das Ding doch nicht wirklich anzünden, oder?«
»Was sollte ich denn sonst damit machen?«
»Ich dachte, du nimmst mich bloß auf den Arm.«
Eine schwarz-weiß gesprenkelte Taube kam von einem Regal, auf dem Apothekerzutaten standen, zu mir heruntergeflogen. Sie gurrte.
»So ist’s recht, Bridget«, sagte Tom. »Bring du ihn zur Vernunft.«
Bridget pickte an der Zündschnur. Prustend trippelte sie rückwärts, flatterte auf und flog zur Treppe.
»Siehst du?«, sagte Tom, der sich hinter den Arbeitstisch duckte. »Auch der Vogel hält dich für verrückt.«
»Dir wird das Unken schon noch vergehen, wenn ich bis zu den Knien in Gold stehe«, sagte ich.
Toms Stimme kam hinter dem Arbeitstisch hervor. »Darauf lasse ich es ankommen.«
Ich entfachte die Zündschnur, schaute einen Moment zu, wie sie knisterte und Funken sprühte. Dann gesellte ich mich zu Tom. Hinter den Arbeitstisch. Nicht, weil ich Angst hatte, weit gefehlt! Es war nur … eine Vorsichtsmaßnahme.
Die Funken an der Zündschnur fraßen sich bis zum unteren Teil des Apparats. Einen Moment lang geschah nichts.
Dann flog das Schießpulver in die Luft. Es zischte und kleine Flammen züngelten aus dem Boden. Die Röhre schoss nach oben.
Ich zerrte an Toms Ärmel. »Es funktioniert! Es funktioniert!«
Dann setzte sich die zweite Zündschnur in Brand. Eine schmale, rauchige Flamme schlug aus der Röhre, die sich langsam zur Seite neigte. Und dann wie eine Rakete durch die Tür ins Ladengeschäft raste.
»War das so geplant?«, fragte Tom.
»Also …«, stammelte ich, aber die korrekte Antwort lautete: Nein.
Durch den Türrahmen schoss ein Blitz. Dann ein BUM! Das BUM war zu erwarten gewesen. Die Stimme, die folgte, nicht.
»AAHHHHH!«
Kapitel 2
Wir rannten in den Laden. Dort angekommen, schwankte ich zwischen Freude und Entsetzen.
Einerseits hatte meine Erfindung funktioniert! Meine Hausrauchmaschine hatte tatsächlich dafür gesorgt, dass sich im ganzen Laden ein dicker, süß duftender Rauch ausbreitete. Andererseits befand sich zwischen der Eingangstür und dem Fenster ein riesiger Rußfleck an der Wand. Und Harry, der ausgestopfte Igel auf dem Fensterbrett, stand in Flammen.
Hustend und wild mit den Armen wedelnd, rannte Tom zur Eingangstür und stieß sie auf. Dann packte er den Igel am Schwanz – das einzige Körperteil, das noch nicht Feuer gefangen hatte – und schleuderte ihn hinaus auf die Straße. Harry flog in einem hohen, glühenden Bogen durch die Luft und prallte zweimal auf dem Pflaster auf. Er rollte noch ein Stückchen und blieb dann in einer Kuhle liegen, wo er friedlich vor sich hin kokelte.
Tom drehte sich um und warf mir einen bitterbösen Blick zu. Ich wurde rot. »Also, jetzt warte mal …«, setzte ich an. Dann fiel mir etwas auf: Der Laden war leer. »Hat da nicht eben jemand geschrien?«
Tom riss die Augen auf. »Du hast einen Kunden in die Luft gesprengt!«
»Nur fast«, ertönte eine zitternde Stimme.
Die obere Wölbung eines Kopfs lugte über den Ausstellungstisch neben dem Kamin. Ich sah fedriges weißes Haar, das mir vertraut vorkam, und dann leicht verschleierte Augen. Mein Herz machte einen Satz.
»Meister Isaac!«, rief ich.
»Ich bin froh, dass ihr beiden euch zu beschäftigen wisst.« Isaac krabbelte unter dem Tisch hervor und erhob sich mit knackenden Knochen, die sein Alter verrieten.
Ich rannte zu ihm und hätte ihn am liebsten umarmt. »Geht es Euch gut?«
»Jedenfalls besser als dem Igel.« Isaac klopfte sich die Hosen ab. »Darf ich fragen, was das alles zu bedeuten hat? Hat dir das arme Tier irgendwas getan?«
»Das war meine Erfindung. Damit will ich die Pest bekämpfen.«
Er nickte. »Ja, das leuchtet ein. Wenn du jemanden zu Asche verbrennst, kannst du in der Tat verhindern, dass er an der Pest erkrankt.«
Mein Gesicht glühte vor Scham. »Tut mir wirklich leid.«
»Es ist ja nichts passiert.« Sein Blick fiel auf eine Schmauchstelle an der Schulter seines Wamses. »Jedenfalls nicht viel. Ach, mach dir keine Sorgen deswegen.«
So peinlich mir die Sache war, so sehr freute ich mich, ihn wiederzusehen. Isaac Chandler war Buchhändler und einer der besten Freunde von Meister Benedict gewesen. Und jetzt war er einer meiner besten Freunde. Er hatte mir und Tom geholfen, die Missetaten des Erzengel-Kults aufzudecken, dessen Mitglieder im vergangenen Frühjahr Dutzende Menschen ermordet hatten, einschließlich meines Meisters. Isaac hatte einen bescheiden wirkenden Buchladen zwischen einer Reihe von Lagerhäusern nördlich der Themse. Und was nur ganz wenige Menschen wussten: In einem Gewölbe unter diesem Laden befand sich eine geheime alchemistische Bibliothek mit uralten Werken, in denen das Wissen von Jahrhunderten versammelt war. Ich war bisher nur zweimal dort gewesen: das erste Mal, als ich einen Schlüssel gesucht hatte, der mir helfen sollte, Meister Benedicts Geheimnis zu lüften, und das zweite Mal vor vier Wochen, um jenes Geheimnis dort zu verstecken: das Rezept für eine schreckliche, explosive Waffe, die man »das Feuer des Erzengels« nannte.
Ich wünschte, ich hätte Isaac öfter besucht. Sein warmer, heimeliger Laden war schnell zu einem meiner Lieblingsorte geworden. Aber im Augenblick war ich einfach froh, Isaac wiederzusehen. Er war zwei Monate nicht in der Stadt gewesen.
»Bleibt Ihr jetzt in London?«
»Ja. Und nein.« Isaac zog einen großen Lederbeutel unter dem Tisch hervor. »Darf ich mich setzen? Die Reise hat mich sehr ermüdet.«
»Aber natürlich.« Ich nahm den Beutel und wollte Isaac zu dem bequemen Sessel neben dem Kamin führen.
Er aber nickte zum Arbeitsraum. »Ein bisschen Privatsphäre könnte nicht schaden.«
Überrascht geleitete ich ihn nach hinten. Tom blieb im Laden, nahm eine Bürste zur Hand und begann, nachdem er mir einen langen, vorwurfsvollen Blick zugeworfen hatte, den Rußfleck an der Wand damit zu bearbeiten. Isaac humpelte zu einem Schemel an einem Arbeitstisch und winkte mich zu sich.
Ich trat zu ihm und legte den Beutel zwischen uns. Jetzt, da wir die rauchgeschwängerte Luft des Ladens hinter uns gelassen hatten, konnte ich Isaac besser sehen. Ich musterte ihn; er sah nicht gut aus.
Mein Magen verkrampfte sich. »Stimmt etwas nicht?«
»Ich habe nicht die Pest, wenn du das meinst«, sagte er. »Aber irgendwie bin ich in letzter Zeit ziemlich alt geworden.«
Er sackte auf dem Schemel in sich zusammen, die Augen tief in den Höhlen liegend, das Gesicht schmutzig vom Staub der Straße. Ich schenkte ihm einen Becher mit schalem Bier aus dem einzigen Fass in der Vorratskammer ein und brachte ihm das letzte Frühstücksbrötchen, das Tom heute Morgen gebacken hatte. Isaac trank den Becher in vier großen Schlucken aus.
»Danke. Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt auf einem Pferd gesessen habe.« Er rutschte auf dem Schemel hin und her. »Und mein Hintern wünscht sich, dass es bis zum nächsten Mal wieder viele Jahre dauern wird.«
»Seid Ihr eben erst zurückgekehrt?«, fragte ich.
Er nickte. »Vor einer Stunde. Ich bin zusammen mit einem alten Freund von dir eingetroffen.«
Ich runzelte die Stirn. Ich hatte doch gar keine alten Freunde.
»Lord Ashcombe«, sagte Isaac.
Lord Ashcombe war der General Seiner Majestät, Beschützer von König Charles II. Zusammen mit Isaac hatte mir Lord Ashcombe im Kampf gegen den Kult des Erzengels zur Seite gestanden.
»Ich dachte, er sei mit dem König in Wiltshire«, sagte ich.
»Er ist auch nur heute in London. Aber ich musste ihn sehen. Er hat etwas für mich besorgt.«
Isaac öffnete den Beutel und zog zwei eingewickelte Pakete heraus. Das erste war in ein Leinentuch eingeschlagen. Das zweite befand sich in einer Hülle aus geöltem Leder, das mit einer Schnur fest zusammengebunden war. Die Knoten waren mit Wachssiegeln versehen.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Ein Buch«, sagte er und tätschelte das Paket. »Ein ganz besonderes Buch. Eines, das ich seit dreißig Jahren suche.«
Ich starrte das Paket an, als ob ich mit meinem Blick das Leder durchdringen könnte, wenn ich nur lange genug hinschaute. »Was für ein Buch?«
Isaac fuhr mit den Fingerspitzen über die Schnur. »Das ist im Moment nebensächlich. Vielleicht zeige ich es dir eines Tages. Aber nicht heute.«
Meister Benedict war genauso gewesen. Das hatte mich fast in den Wahnsinn getrieben. Da mir klar war, dass ich nichts aus Isaac herausbekommen würde, schluckte ich meine Enttäuschung herunter und fragte stattdessen: »Was ist in dem anderen Paket?«
»Etwas nicht halb so Wertvolles, mir aber dennoch lieb und teuer.« Er schlug das Leinentuch auf. Darin lag ein frisch gebackener Honigkuchen mit Zuckerguss.
»Mein Leibgericht«, sagte er. »Nimm dir ruhig etwas davon.«
Mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich mir ein Stück abschnitt. Gleichzeitig ließ ich das geheimnisvolle Päckchen auf dem Tisch nicht aus den Augen. »Woher habt Ihr das?«
»Aus der Bäckerei in der Fleet Street.«
»Ich meinte das Buch.«
»Ach ja?«
»Meister Isaac«, sagte ich genervt.
»Ägypten. Es kommt aus Ägypten. Und das ist alles, was ich dir darüber verraten werde«, sagte er fröhlich. Er steckte das Buch wieder in den Beutel. »Aber ich bin froh, dass die Pest deine Neugier nicht gedämpft hat. Und auch nicht deinen Appetit.«
Ich hatte das erste Stück Kuchen bereits verschlungen. Vermutlich hatte er meinen sehnsüchtigen Blick bemerkt. »Entschuldigung.«
Er schnitt mir noch ein Stück ab. »Ich teile ihn gern mit dir. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Nachrichten, die mich aus London erreicht haben, waren fürchterlich.«
Was immer er auch gehört hatte, konnte nicht einmal annähernd die Düsternis beschreiben, die sich über die Stadt gelegt hatte. Als der Kult des Erzengels meinen Meister ermordet hatte, hatte ich geglaubt, dass meiner Stadt nichts Schlimmeres widerfahren konnte. Ich hatte mich geirrt.
Die Pest, die London fast dreißig Jahre in Frieden gelassen hatte, war mit ganzer Macht zurückgekehrt. Es begann mit ein paar vereinzelten Fällen außerhalb der Stadtmauern, dann breitete sich die Seuche schnell aus und explodierte förmlich in der Sommerhitze. Die Bill of Mortality, die Totenliste, die jeden Donnerstag veröffentlicht wurde, führte Buch über die grausige Wahrheit: 6102 Opfer in der vergangenen Woche, und das waren bloß die offiziellen Zahlen. Jeder wusste, dass es in Wahrheit vermutlich doppelt so viele waren. Bis jetzt waren schon dreißigtausend Menschen gestorben und jeden Tag kamen ungefähr tausend dazu.
In unserer Straße traf es zuerst ein Kind: Jonathan Hartwell, Sohn des Silberschmieds, zehn Jahre alt. Anfangs hatten die Eltern noch die Hoffnung, dass ihr Sohn an einer anderen Krankheit litt, denn die ersten Symptome sind nicht spezifisch: Schüttelfrost, Krämpfe, Schweißausbrüche. Doch dann trat eine Veränderung ein: Er fing an, sich unkontrolliert zu erbrechen, und sein Leib wurde von Anfällen geschüttelt. Dann setzte das Delirium ein, sein Geist wurde mal von Engeln gewiegt, dann wieder von Dämonen gewürgt. Trotzdem weigerten sich die Hartwells zu glauben, dass es sich um die Seuche handelte, bis sich auf der Haut des Jungen der unwiderrufliche Beweis zeigte.
Sie waren einzigartig und es gab sie nur bei der Pest: die Male. Schreckliche schwarze Schwellungen am Hals, unter den Armen, in den Leisten. Oder sie kamen – in selteneren Fällen – in Form eines Ausschlags und geröteter, fleckiger Haut. Wie die meisten hatte der kleine Jon die Schwellungen. Er schrie so laut, dass ich ihn noch vier Häuser weiter hören konnte, durch geschlossene Türen, verriegelte Fenster und mit den Händen auf die Ohren gepresst.
Ich konnte ihm nicht helfen. Zwar ließ ich ihm von seinem Vater etwas Mohnsaft gegen die Schmerzen verabreichen, aber das bekämpfte nicht die Krankheit. Trotzdem verlor seine Mutter nicht die Hoffnung, denn einige erholten sich tatsächlich von der Seuche. Aber schließlich war er jener letzten, schrecklichen Stille anheimgefallen, die nur durchbrochen wurde vom Heulen und Klagen seiner Mutter, und ich hatte nichts mehr für ihn tun können. Ich war hilflos. Nutzlos. Die ganze Zeit.
»Es wird immer schlimmer«, sagte ich zu Isaac. »Ich habe Angst.«
»Die Pest macht uns alle gleich«, sagte er. »Hast du dir diesen Propheten schon angehört?«
»Wen?«
»Nach dem, was mir zugetragen wurde«, sagte Isaac, »ist ein Prophet in der Stadt eingetroffen, der den Weg der Pest vorhersagen kann. Hast du ihn gesehen?«
Ich hatte noch nie von ihm gehört. »Tom und ich bleiben die meiste Zeit im Laden. Wir erfahren nur wenig von dem, was in der Stadt vor sich geht. Außer natürlich durch die Totenlisten.«
Und die wollte sich keiner näher anschauen. Wie alle anderen auch versuchten Tom und ich uns dadurch zu schützen, dass wir nicht auf die Straße gingen. Niemand wusste, wodurch sich die Krankheit ausbreitete. Alle glaubten, dass Rauch helfen würde – daher meine mehr oder weniger erfolgreiche Erfindung –, aber man wusste immer erst dann, wenn sich die Male zeigten, ob jemand tatsächlich an der Pest erkrankt war.
Es gab sowieso kaum einen Grund, vor die Tür zu gehen. Die Pest hielt London im Würgegriff. Die meisten Läden hatten geschlossen und es war kaum noch Arbeit zu bekommen. Jeder, der es sich leisten konnte, hatte die Stadt verlassen. Den ganzen Sommer lang hatten Kutschen und Wagen die Straßen Londons verstopft. Die Reichen waren panikerfüllt auf ihre Landsitze geflüchtet, wo sie sich in Sicherheit wähnten. Jetzt waren nur noch die Totengräber mit ihren Karren unterwegs, die mit Pestopfern beladen waren. Jede Nacht zogen sie durch die Stadt, begleitet vom Schlagen einer Glocke und dem entsetzlichen Ruf: Bringt eure Toten heraus.
Isaac schüttelte den Kopf. »Ich habe dreimal die Pest in London erlebt: 1603, 1625 und 1636. Und ich sage dir, Christopher, dieser Ausbruch ist schlimmer als alle drei vorherigen zusammen. Wenn tatsächlich ein Prophet in der Stadt ist, dann ist dies ein beängstigendes Zeichen dafür, dass die Welt jenseits der unseren wieder einmal ein Auge auf uns geworfen hat. Und ich muss dir ja nicht erklären, wie gefährlich das ist.«
Ich erschauerte und dachte an das Feuer des Erzengels. »Als die Zahl der Opfer stieg, dachte ich, Ihr würdet überhaupt nicht zurückkommen.«
»Das hatte ich auch nicht vor. Aber als mich die Nachricht von diesem Propheten erreichte – und Berichte von Plünderungen –, habe ich mich besonnen. Deshalb bin ich hierhergekommen. Ich wollte dir sagen, dass ich meinen Laden schließe.«
Mir war, als hätte man mir in den Bauch geboxt. Isaac und Meister Benedict hatten sich sehr nahegestanden. Obwohl ich nur zweimal in seinem Laden gewesen war, hatte ich das Gefühl, mein zweites Zuhause und mit ihm auch meine letzte Verbindung zu Meister Benedict zu verlieren. »Aber … warum? Und was geschieht mit der geheimen Bibliothek?«
»Nichts. Die Bibliothek ist der Grund, warum ich den Laden zumache.« Isaac seufzte. »Ich liebe mein Geschäft, beinahe so, wie dein Meister diese Apotheke geliebt hat. Aber die Bibliothek ist meine wirkliche Aufgabe. Alles, was ich je getan habe, diente einzig dazu, sie wachsen zu lassen, sie zu beschützen. Doch ich war ein Narr.« Er deutete zu dem Buch in dem Lederbeutel. »Ich habe Bücher erworben für zukünftige Zeiten. Stattdessen hätte ich mich lieber auf diese Zeiten vorbereiten sollen.« Er seufzte noch einmal. »Ich habe keinen Lehrling«, fuhr er fort. »Wenn ich sterbe, wird niemand meinen Platz einnehmen. Und diese Bibliothek muss überleben. Also muss ich überleben. Wenigstens noch eine kleine Weile.«
Isaac starrte in seinen Becher. »Ich wäre am liebsten nicht wiedergekommen. Aber wenn mein Laden geplündert wird und Diebe den Geheimgang zur Bibliothek finden … das darf nicht passieren. Wenn ich schon in London sein muss, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie ich die Krankheit vermeiden kann: Ich muss mich von allen und jedem fernhalten. Bis es vorbei ist. Und das werde ich auch tun«, sagte er. »Ich werde den Laden verrammeln und mich im Gewölbe einschließen. Die Pest wird noch einige Monate wüten. Ich habe genügend Vorräte besorgt, um diese Zeit durchzustehen.«
Ich versuchte mir vorzustellen, wie es sein musste, monatelang unter der Erde eingesperrt zu sein. Niemals frische Luft zu atmen. Niemals die Sonne zu sehen. Schrecklich. »Wird es Euch nicht einsam werden?«
»Meine Bücher werden mir Gesellschaft leisten. Es sei denn, du möchtest mitkommen.«
Ich blinzelte. »Ich?«
Er nickte. »Das ist auch ein Grund, warum ich vorbeigekommen bin. Jetzt, wo dein Meister nicht mehr da ist, wollte ich dir die Chance bieten, mich in die Bibliothek zu begleiten. Es gibt genügend Platz für uns beide, und obwohl ich meine Bücher sehr schätze, wird es doch deutlich angenehmer sein, jemanden zum Reden zu haben. Es würde mich außerdem beruhigen, weißt du? Ich müsste mir dann keine Sorgen um dich machen.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte nicht unter der Erde leben. Andererseits wollte ich auch nicht diese Pestwelle erleben. Wenn ich mit ihm ging, bekam ich die Möglichkeit, Isaac besser kennenzulernen und Geschichten über Meister Benedict zu hören. Und die Bibliothek! All diese Bücher! Und ich würde viel Zeit haben, um sie zu lesen!
»Was ist mit Tom?«, fragte ich. »Könnte er auch mitkommen?«
Isaac schürzte die Lippen. »Toms Eltern und seine Schwestern, sind sie noch am Leben?«
»Ja.«
»Und würden sie nicht wissen wollen, wohin er geht?«
Jetzt verstand ich, warum Isaac unter vier Augen mit mir hatte sprechen wollen. »Doch«, sagte ich niedergeschlagen.
»Tom wäre mir willkommen«, sagte Isaac. »Ich habe ihm schon früher vertraut und er hat sich dieses Vertrauens würdig erwiesen. Aber das Wissen um die Bibliothek wäre in den falschen Händen äußerst gefährlich. Seine Familie darf nichts davon erfahren. Und deshalb fürchte ich, dass die Antwort nein lautet.«
Ich war enttäuscht, machte Isaac jedoch keine Vorwürfe. Toms Mutter war eine anständige Frau, aber eine fürchterliche Klatschtante. Toms Schwestern waren brave Mädchen, aber viel zu jung, um ihnen ein solch schwerwiegendes Geheimnis anzuvertrauen. Und was Toms Vater betraf, je weniger man über ihn sprach, desto besser. Tom konnte nicht mitkommen, das war mir klar.
Und deshalb war mir auch klar, wie meine Entscheidung lauten musste. Was, wenn Tom krank wurde, während ich in Isaacs Bibliothek hockte? Ich konnte ihn nicht im Stich lassen. Und auch nicht das, was mir mein Meister hinterlassen hatte.
»Ich würde wirklich gerne mitkommen«, sagte ich zu Isaac. »Aber vielleicht braucht mich Tom . Und … ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich einen Weg finden könnte, der Stadt und den Menschen zu helfen.«
Es kam mir dumm vor, das zu sagen. Aber Isaac lächelte und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Ich habe Benedict damals, 1636, genau das gleiche Angebot gemacht«, sagte er. »Und er gab mir die gleiche Antwort wie du. Also schön. Bevor ich mich selbst einschließe: Gibt es irgendetwas, das du brauchst?«
Es war mir schrecklich peinlich. »Nun … jetzt, da Ihr es erwähnt … Ich habe mich gefragt, ob … ob Ihr vielleicht … ich meine, ob Ihr etwas …«
Isaac hob eine Augenbraue. »Ich würde gerne nach Hause kommen, bevor mich die Pest in deiner Apotheke hinwegrafft, Christopher.«
»Ja. Natürlich. Also … ähm, könnte ich mir vielleicht … ähm, etwas … Geld borgen?«
»Geld?«
»Ich zahle es Euch zurück, das verspreche ich«, sagte ich schnell. »Es ist nur so, dass … ich bin pleite.«
Isaac bedachte mich mit einem strengen Blick. »Die Apothekergilde hat dir nach Benedicts Tod zehn Pfund überlassen. Du hast doch nicht etwa die ganze Summe aus dem Fenster geworfen, oder?«
»Ich habe nichts aus dem Fenster geworfen«, widersprach ich, »weil ich nie etwas bekommen habe.«
Die Erkenntnis machte sich auf seinem Gesicht breit. »Lass mich raten«, sagte Isaac. »Du bist jede Woche hingegangen, um das Geld zu holen, und sie hatten immer Ausreden, warum es gerade nicht verfügbar sei. Und jetzt ist das Gildehaus wegen der Pest geschlossen.«
»Sie waren immer sehr höflich.«
»Aber gewiss. Wovon hast du die ganze Zeit gelebt?«
»Ich habe einige von Meister Benedicts Vorräten an andere Apotheken verkauft«, sagte ich, »aber jetzt will niemand mehr etwas haben.«
»Weil sie Angst haben, dass die Sachen mit Krankheit behaftet sind?«, vermutete Isaac.
Ich nickte unglücklich. Der Mord an meinem Meister hatte nicht nur ein Loch in meinem Herzen hinterlassen. Ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit mehr, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nach der Sache mit dem Kult des Erzengels hätte mir die Apothekergilde eigentlich einen neuen Meister zuweisen sollen. Aber als die Pest ausbrach, hatten die Ratsmitglieder das Gildehaus geschlossen und waren geflohen, genau wie alle anderen reichen Londoner. Und mit ihnen verschwand meine Chance auf einen neuen Meister. Und natürlich auch die versprochenen zehn Pfund.
Als Lehrling durfte ich keine Arzneien verkaufen, daher hatte ich mir die Hausrauchmaschine ausgedacht. Rauch heilte nicht, sondern verhinderte nur, dass man sich mit der Pest ansteckte. Also war Rauch keine Arznei und der Verkauf der Maschine nicht illegal. Aber der große schwarze Rußfleck neben der Tür – und der verkohlte Igel draußen auf der Straße – bewiesen mir, dass meine Erfindung noch nicht reif für den Markt war. Und da die wenigen verbliebenen Apotheker sich weigerten, irgendetwas von mir zu kaufen, war meine Kasse vollkommen leer.
»Ach Christopher«, sagte Isaac. »Ich hätte dich nicht alleinlassen sollen. Hier.« Er holte fünf Silberschillinge aus seinem Wams und legte sie auf den Tisch. »Ich würde dir gern mehr geben, aber ich habe all meine Ersparnisse für die Vorräte ausgegeben. Ich sag dir was: Nimm auch den Honigkuchen. Nein, nein, ich will nichts hören.« Er klopfte sich auf den Bauch. »Ich liebe ihn zwar, aber er erwidert diese Liebe nicht.«
Wenn die Pest nicht gewesen wäre, hätte ich ihn fest umarmt. »Das ist eine große Hilfe für mich.«
»Es wird nicht lange reichen«, murmelte Isaac.
Natürlich würde es nicht reichen, bis die Pestwelle über die Stadt hinweggerollt war. Aber es würde mich ein paar Wochen lang ernähren. Besonders Tom würde sich freuen, und nicht nur wegen des Honigkuchens. Die Bäckerei seines Vaters war geschlossen, weil alle Kunden fort waren und das Mehl mittlerweile so billig, dass die meisten Leute ihr Brot jetzt selbst backten.
Sein Vater, ein echter Geizhals, hatte genug zur Seite gelegt, dass die Familie eine ganze Weile zurechtkommen würde. Weder Tom noch seine fünf Schwestern würden Hunger leiden müssen. Aber für mich würde sein Vater keinen Penny ausgeben. Er hatte Tom sogar ausdrücklich dazu ermutigt, Zeit mit mir zu verbringen, damit Tom sich statt von seinen nun von meinen Vorräten ernährte. Allerdings wusste er nicht, dass Tom von zu Hause Essen stibitzte und es mir brachte. Viel war es nicht, nur das eine oder andere Brötchen, das er unter seinem Hemd versteckte. Daher war Isaacs Geld ein willkommener Segen, der mich eine Weile über Wasser halten würde.
Ich sprang von meinem Schemel und wollte Tom die gute Nachricht erzählen.
»Warte noch«, sagte Isaac.
Ich blieb im Türrahmen stehen. Vorne im Laden hatte Tom den Rußfleck von der Wand geschrubbt und stellte gerade die Kuriositäten wieder an ihren Platz. Durch das Fenster sah ich zwei Männer auf die Apotheke zukommen.
»Ich habe Benedict mein Wort gegeben, dass ich nichts sagen würde«, meinte Isaac, »aber unter diesen Umständen hätte er wohl nichts dagegen, dass ich mein Versprechen breche.«
Er richtete sich auf. »Gehe ich recht in der Annahme, dass du den Schatz deines Meisters noch nicht gefunden hast?«
Kapitel 3
Ich blinzelte.
»Schatz?«, wiederholte ich. »Was für ein Schatz?«
Die Ladentür ging auf und die zwei Männer, die eben die Straße überquert hatten, kamen herein. Isaac legte den Kopf schräg und lauschte. Dann hob er einen Finger an die Lippen.
Tom schaute fragend zu mir hin. Ich bedeutete ihm, sich um die Kunden zu kümmern, schloss die Tür zum Arbeitsraum und eilte zu Isaac. »Schatz?«
Er nickte. »Als Benedict erkannte, dass der Kult des Erzengels ihn früher oder später erwischen würde, setzte er einen Letzten Willen auf, in dem er dir alles hinterließ. Trotzdem machte er sich immer noch Sorgen, was mit dir passieren würde, wenn er nicht mehr da war. Und es gibt etwas, das er nur dir anvertrauen wollte, etwas, das er nicht benennen konnte, für den Fall, dass das Testament in falsche Hände geriet.«
»Schatz?« Offensichtlich hatte ich mich in einen Papagei verwandelt. »Was für ein Schatz? Was ist es?«
Isaac runzelte die Stirn. »Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass er Geld hatte – viel Geld –, aber Benedict deutete an, dass er dir etwas Besonderes hinterlassen hätte. Etwas, das nur für deine Augen bestimmt ist. Er wollte mir nicht sagen, was es ist. Er wollte, dass du es selbst findest. Und gleichzeitig hatte er Angst, dass du es nicht finden würdest. Und deshalb hat er mir etwas übergeben, für alle Fälle.« Isaac deutete zu dem Beutel, der auf dem Arbeitstisch lag. »Da drin ist ein Bündel mit Briefen. Einer ist für dich. Mach schon, hol ihn heraus.«
Es waren sieben Briefe, die mit einer Kordel zusammengebunden waren. Die ersten fünf Adressaten kannte ich nicht, den sechsten schon: Lord Richard Ashcombe.
Ich fragte mich kurz, was Isaac, der Buchhändler, mit dem Beschützer des Königs zu schaffen hatte. Aber es war der letzte Brief, geschrieben in der schwungvollen Handschrift meines Meisters, der mich wirklich interessierte. Ich fuhr mit den Fingern die Buchstaben nach.
Christopher Rowe
Blackthorn-Apotheke, London
»Ich musste Benedict versprechen, dass ich dir diesen Brief erst nach einem Jahr geben würde«, sagte Isaac. »Er wollte wirklich, dass du den Schatz alleine findest. Aber jetzt, da die Pest ausgebrochen ist …«
Ich drehte den Brief um. Auf das Siegel hatte mein Meister ein Zeichen gemalt: einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte.
Ich erkannte das Symbol. Mein Meister war insgeheim ein Alchemist gewesen, der nach der Wahrheit des Universums jenseits der sterblichen Welt gesucht hatte. Um ihre Forschungen zu verschlüsseln, benutzten Alchemisten besondere Symbole für bestimmte Materialien, für Himmelskörper, Rezepte und andere Dinge. Der Kreis mit dem Punkt in der Mitte stand für die Sonne: für Licht, Wärme, Leben. Wie alle Himmelskörper repräsentierte auch die Sonne ein irdisches Metall. Mars war mit Eisen verbunden, Merkur mit Quecksilber. Und die Sonne?
Die Sonne war das Gold.
Durch die Tür drangen Stimmen aus dem Laden zu mir. Ich achtete nicht darauf. Ich brach das Siegel und las den Brief meines Meisters.
Christopher,
ich habe einen Schatz für dich versteckt, den du – so wie ich dich kenne – aufgrund deiner liebenswerten Torheit noch nicht gefunden hast und womöglich nie finden wirst. Unter unserem Dach. In unserem eigenen Elysium, unserem eigenen Reich.
Es ist wohl einem gewissen Unverständnis zu verdanken, dass dir die wahre Natur dieser Sache noch nicht klar geworden ist.
Es ist jetzt dein Reich, dein Elysium. Verhalte dich dementsprechend, in allem, was du tust. Oder aber du wirst nie finden, was zu finden ich dir bestimmt habe.
lies dies sorgfältig. Erkenne das Geheimnis. Es liegt in meiner Liebe zu dir verborgen.
Meine Augen brannten. Mein Herz schmerzte so sehr, als wäre er mir gerade eben erst genommen worden. Aber trotzdem musste ich lächeln. Denn natürlich war dieser Brief wieder einmal ein Rätsel, das ich lösen musste.
Mein Meister hatte eine Leidenschaft für Geheimnisse verborgen in Geheimnissen und Codes innerhalb von Codes gehabt. Zusammen mit vielen anderen Dingen hatte er diese Liebe an mich weitergegeben. Aber jetzt war keine Zeit, um zu trauern. Ich wischte mir über die Augen und suchte in dem Brief nach Hinweisen.
Isaac räusperte sich. »Ich merke schon, dass du mir ab jetzt keine Aufmerksamkeit mehr schenken wirst.«
Ich sah hoch. »Tut mir leid.«
Er wischte meine Entschuldigung mit einer Handbewegung beiseite. »Benedict war genauso.« Er stand auf. »Ich wünschte, ich könnte dir mit dieser verschlüsselten Botschaft helfen, aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu suchen. Du möchtest jetzt bestimmt lieber allein sein, um zu tüfteln. Und ich muss nach Hause.« Er runzelte die Stirn. »Außerdem glaube ich, dass du im Laden gebraucht wirst.«
Ich hatte mich so auf den Brief meines Meisters konzentriert, dass ich nicht bemerkt hatte, was vorne in der Apotheke los war. Jetzt hörte ich es: scharfe, laute Stimmen. Ein Streit war entbrannt.
Ich öffnete die Tür zum Laden. Tom stand hinter dem Tresen und mühte sich gerade mit drei Kunden ab. Zwei aufgebrachte Männer hatten sich direkt vor der Tür zum Arbeitsraum aufgebaut, es waren die beiden, die ich vorhin schon gesehen hatte. Ein dritter Mann war hinzugekommen und stand, leicht gebückt, auf der anderen Seite des Tresens, Tom gegenüber.
Die Kleider des Mannes waren dreckig und zerschlissen und überall geflickt. Er selbst war ebenfalls alles andere als sauber und auf seinem fettigen Haar saß keine Perücke. Seine Hände waren schorfig und auf der Spitze seiner Nase prangte eine große Warze. Am schlimmsten aber war, dass er so roch, als ob er gerade in einen Kothaufen getreten wäre. Die beiden anderen Männer ereiferten sich sowohl über seine Anwesenheit als auch über den Grund seines Hierseins: Er bettelte.
»Bitte, mein Herr«, sagte er zu Tom. »Nur eine Kleinigkeit.«
»Es tut mir leid«, sagte Tom, »aber wie ich schon sagte, es ist nicht mein Laden …«
»Wir waren zuerst hier«, beschwerte sich einer der beiden Männer.
Tom wirkte erleichtert, dass ich mich endlich blicken ließ. Der Bettler sah Isaac hinter mir und humpelte gebückt auf ihn zu. »Werter Herr …«
Ehe er fortfahren konnte, deutete Isaac auf mich. Der Bettler wirkte leicht überrascht, wandte sich aber unverzüglich mit seinem Flehen an mich. »Bitte, junger Herr. Mein Name ist Miles Gaspar. Ich war Gerber unten an den Docks, ehe die Pest kam. Jetzt ist die Gerberei geschlossen und ich habe seit zwei Monaten keine Arbeit mehr. Habt Ihr nicht etwas für mich? Ich kann alles tun, was Ihr wollt. Alles.«
»Es tut mir leid«, sagte ich, »aber ich habe keine …«
»Oh, bitte, mein Herr. Ich bin mir für nichts zu schade. Irgendetwas, egal was. Ich kann meine Familie nicht mehr ernähren.« Der Mann rang die Hände. »Meine Frau und ich, wir haben zwei kleine Kinder. Wir haben unsere Wohnung verloren, weil wir die Miete nicht mehr zahlen konnten. Wir geben den Kindern, was wir finden können. Ich selbst habe seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Bitte. Irgendetwas.«
Ich fühlte mich schrecklich. Beim Anblick dieses Ladens musste er glauben, dass ich im Gold schwimme. Wie konnte ich ihm klarmachen, dass ich selbst Isaac um Geld hatte bitten müssen?
»Es … Es tut mir so leid, aber ich kann mir nicht leisten, irgendetwas herzugeben«, sagte ich. »Es tut mir wirklich leid.«
Er senkte den Kopf. »Ich verstehe. Bitte verzeiht, dass ich Euch belästigt habe.« Er wandte sich ab.
Wie er da aus dem Laden humpelte, erinnerte er mich an mein eigenes Schicksal, an mein Leben, wie es vor wenigen Monaten gewesen war. Auch ich hatte auf der Straße gelebt. Und trotz Isaacs milder Gabe würde ich bald wieder dort hocken, wenn es mir nicht gelang, Meister Benedicts Schatz zu finden.
Viel konnte ich nicht für den Mann tun, ich hatte ja wirklich selbst kaum etwas. Aber ich erinnerte mich, wie damals, im Juni, jemand, der ebenfalls so gut wie nichts besaß, mir geholfen und mich aufgenommen hatte, und das, obwohl eine hohe Belohnung auf meinen Kopf ausgesetzt war.
»Wartet«, sagte ich.
Schon halb zur Tür heraus, drehte sich Miles mit einem hoffnungsvollen Blick um. Ich ging durch den Arbeitsraum in die Vorratskammer. Außer einem Sack Hafer, einem Fass mit schalem Bier und einem Kanten salzigem Käse war nichts mehr da. Ich nahm den Käse, wickelte ihn in das Tuch, in dem Isaacs Honigkuchen gewesen war, und ging wieder in den Laden.
Ich hielt ihm das Päckchen hin. »Für Eure Kinder.«
Miles nahm den Käse mit zitternden Händen. Er blinzelte die Tränen aus seinen Augen. »Möge der Vater im Himmel Euch beschützen, lieber Herr. Gottes Segen auf Euch und Eurem Haus.«
»Mehr habe ich nicht.«
»Das verstehe ich, mein Herr, wirklich, das tue ich. Ich werde Euch nicht wieder belästigen, das verspreche ich. Gott schütze Euch.«
Gott schütze uns alle, dachte ich, als Miles den Laden verließ. Tom wirkte glücklich, weil ich dem Mann eine Freude bereiten konnte. Die anderen beiden Herrschaften schienen sich ebenfalls zu freuen – weil der Bettler mit seinem Gestank nicht länger die Luft verpestete.
»Habt Ihr jetzt vielleicht Zeit für zahlende Kundschaft?«, fragte der Mann, der eben schon gesprochen hatte.
Zeit war nun wahrlich nicht mein Problem. »Es tut mir leid, aber ich darf nichts …«
»Unser Meister schickt uns, um Venezianischen Theriak zu kaufen.« Dieser Wunsch war derzeit nichts Ungewöhnliches. Viele glaubten, dass Venezianischer Theriak, ein Gegenmittel für einige Gifte, auch gegen die Pest half. »Wir nehmen alles, was Ihr habt, und alles, was Ihr noch herstellen könnt.«
Ich hatte vor zwei Monaten ein Schild ins Fenster gehängt: Vorübergehend geschlossen, demnächst wieder geöffnet! Das half aber nicht immer, weil viele Menschen nicht lesen konnten. »Es tut mir leid, meine Herren«, sagte ich, »aber der Laden ist im Augenblick nicht geöffnet. Ich warte auf einen neuen Meister.«
»Wird er im Laufe des Vormittags eintreffen?«
»Ähm … nein.« Ich wollte ihm nicht sagen, dass Blackthorn bis auf Weiteres geschlossen war. Wenn sich das herumsprach, bevor ich einen neuen Meister zugeteilt bekommen hatte, würden wir all unsere Kundschaft verlieren. »Es … wird noch eine Weile dauern.«
Der Mann hielt mir eine offene Geldbörse hin. »Nun, so viel Zeit haben wir nicht. Gebt uns alles, was wir hierfür bekommen können.«
Ich starrte in die Geldbörse. Sie war voller Goldmünzen. Es waren Guineen, jede davon ein Pfund und einen Schilling wert. Ich konnte mindestens acht Stück sehen.
Meine Kehle wurde eng. »Ich … ich kann Euch nichts verkaufen.«
»Habt Ihr nichts vorrätig?«
Ich hatte jede Menge davon, auf dem Regal hinter dem Tresen. »Ich … ich darf ohne einen Meister keine Arzneien verkaufen.« Ich schluckte. »Die Straße hinunter gibt es noch eine Apotheke, wo …«
»Wir wollen nirgendwo anders kaufen«, sagte der Mann. »Unser Meister befahl uns, hierher zu kommen. Er meinte, Blackthorns Theriak sei der beste.«
Mit jedem Wort des Mannes fühlte ich mich elender. Unser Theriak war der beste. Und mit so viel Geld konnte ich jahrelang auskommen.
Tom begaffte die Münzen. Nimm sie, drängte eine Stimme in meinem Kopf.
Ich betrachtete die Männer. Sie hatten von einem Meister gesprochen, aber ich hatte keine Ahnung, wer das war. Auch die Männer selbst kannte ich nicht. Sie trugen beide einfache Kleidung aus Wolle und Leinen. Dienstboten dem Anschein nach. Aber nur dem Anschein nach.
Zwei Dinge fielen mir ins Auge: Erstens waren beide bewaffnet. Einer hatte einen Knüppel mit einer Eisenspitze über der Schulter hängen, der andere trug ein Kurzschwert in seinem Gürtel. Und zweitens hatten beide ein Bronzemedaillon auf ihre Wämser genäht, direkt über dem Herzen. Auf beiden prangte das gleiche Muster: ein Kreis mit einem Dreieck in der Mitte und darin etwas, das aussah wie ein Kreuz. Ringsum waren Buchstaben eingraviert, die ich aber nicht entziffern konnte.
Der Mann hielt mir die Geldbörse hin. Die Münzen klingelten. Wenn ich sie annahm, dann konnte ich die Pestzeit ohne Probleme überstehen.
Und wenn ihr Meister irgendjemandem erzählte, wo er den Theriak herhatte?
Ich fühlte Toms Blick auf mir, während ich um eine Entscheidung rang. Aber ich hatte keine Wahl. »Ich … ich kann nicht. Es tut mir leid.«
Der Mann schob mir die Geldbörse noch näher unter die Nase. Dann zog er seine Hand zurück. »Unser Meister wird nicht erfreut sein.«
Das klang wie eine Drohung. Aber es spielte keine Rolle: Wenn man mich dabei erwischte, wie ich Arzneien verkaufte, verlor ich alles: meinen Laden, meine Zukunft, alles, was Meister Benedict mir hinterlassen hatte. Das würde ich niemals riskieren. Nicht für alles Gold auf der Welt.
»Es tut mir wirklich leid«, sagte ich.
Der Mann machte den Mund auf, um noch etwas zu sagen, aber Isaac trat vor. »Der Junge hat sich entschieden.«
Der Mann funkelte uns alle böse an. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und ging. Sein Begleiter folgte ihm dichtauf. Ich brauchte meine ganze Willenskraft, um sie nicht zurückzurufen.
Isaac legte mir die Hand auf die Schulter. »Du hast die richtige Wahl getroffen. Wenn du erst mal auf dem Markt warst und etwas zu essen gekauft hast, wird es dir schon besser gehen. Und noch besser natürlich, wenn du Benedicts Schatz gefunden hast.«
Mir war elend. Tom dagegen war bloß verwirrt.
»Schatz?«, fragte er. »Und … Essen?«
Tom hätte vor Glück fast geweint, als er den Honigkuchen sah. Während er ein Stück verspeiste, zeigte ich ihm den Brief meines Meisters.
»Erstaunlich«, sagte er und spuckte dabei Krümel in alle Richtungen. Tom schaute sich im Arbeitsraum um, als ob er überlegte, in welchem der unzähligen Gefäße auf den Regalen Meister Benedicts Schatz versteckt sein könnte.
Ich glaubte nicht, dass ich dort suchen musste. »Er wollte, dass ich dieses Rätsel löse, um den Schatz zu finden. Er würde ihn nicht irgendwo verstecken, wo ich aus purem Zufall darauf stoßen muss.«
Tom nahm sich noch ein Stück Kuchen. »Warum glaubte Meister Benedict, dass du ihn allein nicht finden würdest?«
Das war in der Tat das größte Rätsel. Diesen Umstand hatte er in seinem Brief besonders hervorgehoben.
… ich habe einen Schatz für dich versteckt, den du – so wie ich dich kenne – aufgrund deiner liebenswerten Torheit noch nicht gefunden hast und womöglich nie finden wirst … Oder aber du wirst nie finden, was zu finden ich dir bestimmt habe …
Und doch war es ihm offensichtlich sehr wichtig. Ihm – und mir. Nicht wegen des Geldes. … was zu finden ich dir bestimmt habe. … Errate das Geheimnis. Es liegt in meiner Liebe zu dir verborgen.
Isaac hatte sich ähnlich ausgedrückt. Benedict deutete an, dass er dir etwas Besonderes hinterlassen hätte. Etwas, das nur für deine Augen bestimmt ist.
Was war meinem Meister so wichtig gewesen, von dem er befürchtete, dass ich nicht von selbst darauf kommen würde? Ich verstand einfach nicht, worauf er hinauswollte. Allerdings hatte ich dennoch etwas in seiner Botschaft gefunden.
Tom war es ebenfalls aufgefallen. Er deutete auf den letzten Absatz. »Das ›L‹ ist kleingeschrieben«, sagte er.
»Ja«, sagte ich. »So ein Fehler wäre Meister Benedict ganz bestimmt nicht unterlaufen. Es muss ein Hinweis sein.«
»Ein Hinweis für was?«
Ich hatte keine Ahnung. Meister Benedict hatte mir in den vergangenen drei Jahren so viele verschiedene Codes beigebracht, dass ich mich gar nicht an alle erinnern konnte. Und dann gab es natürlich noch unglaublich viele, die er mich nicht gelehrt hatte – die er mich nicht mehr lehren konnte. Oder die er nicht für mich enträtseln wollte, weil ich selbst hinter die Lösung kommen sollte.
Vielleicht sollte ich in seinen Notizen nach dem Schlüssel suchen. Aber die Notizen meines Meisters waren, gelinde gesagt, ein einziges Chaos. Im Laden und im Arbeitsraum hatte stets tadellose Ordnung geherrscht, aber in den Stockwerken darüber sah es ganz anders aus. Die meisten Räume, einschließlich des Schlafzimmers meines Meisters, waren so mit Büchern und Dokumenten vollgestopft, dass man damit eine eigene Bibliothek hätte füllen können. Und mein Meister hatte seine Notizen nie sortiert. Jedenfalls nicht so, dass ein anderer als er selbst durchgeblickt hätte.
Oft hatte er mich nach oben geschickt, um ein Buch zu holen. »Ich brauche Culpeppers Herbarium«, sagte er manchmal. »Es ist in der Kammer im dritten Stock.«
In einem gewöhnlichen Haus wäre dieser Raum ein Schlafzimmer gewesen, aber bei uns war es ein Archiv mit Stapeln aus Büchern und Papieren. Der einzige Raum ohne Bücher war der Kriechkeller unter dem Haus, wo die Eiskammer war. Er hatte immer einen richtigen Keller daraus machen wollen, war aber nie dazu gekommen. Und der einzige Grund, warum dort unten weder Bücher noch Dokumente verwahrt wurden, war die Feuchtigkeit, die sie nicht vertragen hätten.
Jedes Mal, wenn er mich nach einem Buch schickte, ging ich nach oben und stand erst einmal ratlos in der Gegend herum. »Meister …«
»Zwölfter Stapel von der nordwestlichen Ecke aus gezählt, gegen den Uhrzeigersinn«, rief er dann die Treppe hoch. »Viertes Buch von unten. Der Einband besteht aus genarbtem Leder.« Dank seiner Anweisungen fand ich genau das Buch, das er haben wollte. Kopfschüttelnd ging ich wieder nach unten.
Aber mein Meister war nicht mehr da und konnte mir nicht mehr sagen, wo ich suchen sollte. Und so saßen Tom und ich da, aßen Honigkuchen und starrten ratlos auf das kleine ›L‹.
Es dauerte eine Weile, bis ich darauf kam.
Wir wollten erst nach dem Mittagessen auf den Markt gehen und mit Isaacs Geld neue Vorräte einkaufen, weil ich vorher noch über Meister Benedicts Brief nachgrübeln musste. Bridget leistete uns Gesellschaft. Sie marschierte um den Arbeitstisch herum und pickte an allem, was sie finden konnte; Tom hatte heute Brötchen gebacken. Er holte gerade die warmen Laibe mit einem Holzschieber aus dem Ofen, als ich mit einem Jubelschrei vom Schemel aufsprang und Bridget vor lauter Schreck unter den Tisch hopste. »Das ist es!«, schrie ich.
»Aaahh!«, kreischte Tom auf und heißes Brot flog durch die Luft.
»Tut mir leid«, sagte ich.
Bridget kam unter dem Tisch hervor und schlug entrüstet mit den Flügeln. Tom schaute trostlos in den Kessel, in dem zwei goldbraune Brötchen langsam im Wasser versanken. »Jetzt sind sie verdorben.«
»Völlig egal. Komm her und sieh dir das an.« Ich legte den Brief meines Meisters auf den Arbeitstisch. »Ich habe die Lösung gefunden. Das ›L‹ ist nicht kleingeschrieben, weil es wichtig ist. Es ist kleingeschrieben, weil es nicht wichtig ist.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Tom.
»Ich dachte erst, dass es Teil der versteckten Botschaft sei, weil es kleingeschrieben ist. Aber Meister Benedict hat es kleingeschrieben, weil es eben nicht Teil davon ist. Verstehst du? Er hat die Botschaft in den Großbuchstaben versteckt.«
Ich holte ein Tintenfass und kreiste mit einer Schreibfeder alle Großbuchstaben im Brief meines Meisters ein.
Und schon hatten wir die Botschaft entschlüsselt. Hintereinander geschrieben ergaben die Buchstaben folgende Anweisung:
Tom war beeindruckt. »Clever«, sagte er. Dann bemerkte er das Entsetzen auf meinem Gesicht. »Was ist los?«
»Tom«, sagte ich. »Unsere Vögel sind weg.«
Kapitel 4
Wir blickten zu Bridget hinüber, die jetzt wieder die Mehlkrümel auf dem Arbeitstisch aufpickte. Sie merkte, dass wir sie anstarrten, und schaute fragend zu uns hoch.
Vor dem Mord an meinem Meister hatten wir auf dem flachen Dach unseres Hauses ein paar Dutzend Tauben in einem Verschlag aus Holz und Drahtgeflecht gehalten. Als der Kult das Haus auf den Kopf stellte, waren die Vögel vor Angst davongeflogen. Nur Bridget war geblieben.
Meister Benedict hatte seine Botschaft Monate bevor er starb geschrieben, als unsere Tauben alle noch da gewesen waren. Er hatte ja nicht wissen können, dass sie verschwinden würden. »Wie soll ich unsere Vögel studieren, wenn sie nicht mehr da sind?«
»Vielleicht deutest du die Botschaft falsch«, sagte Tom.
»Wie soll ich sie denn sonst deuten?«
»Weiß ich nicht. Ich begreife bloß nicht, wie dir die Vögel helfen sollten, den Schatz deines Meisters zu finden. Wo soll er denn sein? Etwa unter ihrem Gefieder?«
»Vielleicht sollten sie mich dorthin führen. Tauben sind wirklich klug.« Bridget war mir auf meiner Flucht vor dem Kult durch ganz London gefolgt.
»Aber Meister Benedict sagte doch, dass das, was du suchst, im Haus ist.«
Da hatte Tom recht. Und als mein Meister noch am Leben war, hatte er die Tauben nur selten aus dem Käfig gelassen. Es war unwahrscheinlich, dass sie mich irgendwo hinführen sollten. Oder?
Bridget pickte das Mehl auf. Ich schaute ihr zu. … ich habe einen Schatz für dich versteckt. … Unter unserem Dach. In unserem eigenen Elysium, unserem eigenen Reich.
Unter unserem Dach?
»Denkst du, dass unter unserem Dach auch auf dem Dach bedeuten könnte?«, fragte ich.
Wir starrten einander an. Dann schnappte ich mir die verblüffte Bridget und raste die Stufen hoch, durch die Luke auf das Dach hinaus.
Die Taubenkästen waren zerstört worden, als man das Haus durchwühlte. Damals war ich über den Verlust unserer Tauben sehr traurig gewesen, aber nachdem die Pest ausgebrochen war, hatte ich meine Meinung geändert. Denn die Pestverordnung der Stadt sah vor, dass alle Haustiere getötet werden mussten, in der Hoffnung, so die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Das betraf auch Bridget – als ob ich es auch nur einen Augenblick in Erwägung ziehen würde, ihr ein Leid anzutun!
Aber ich musste sie ständig im Haus behalten, damit niemand sie sehen oder ihr Gurren hören konnte. Aus diesem Grund hatte ich den Taubenschlag nie repariert. Ich hatte nur die Tür offen gelassen, falls einige Tauben überlebt hatten und nach Hause zurückkehren wollten. Heute war ein einzelner Vogel darin, ein Rotkehlchen, das in dem verlassenen Käfig nach Futter suchte. Es flatterte davon, als ich eintrat.
Ich setzte Bridget auf den Boden. »So, dann mal los.«
»Was machst du da?«, fragte Tom.
»Ich studiere unsere Vögel.« Bridget stupste mit dem Schnabel gegen meine Stiefelspitze. Ich schob sie weg. »Komm schon, Bridget. Such Meister Benedicts Schatz.«
Tom schaute mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Bridget dagegen tat, was Tauben meistens tun: nichts.
Tom scharrte mit den Füßen, während meine Wangen anfingen zu brennen. Das hier fiel wohl nicht unter die Kategorie »gute Ideen«.
»Vielleicht sollten wir einfach selbst danach suchen?«, schlug Tom vor.
Und das taten wir. Wir suchten den verlassenen Taubenschlag von oben bis unten ab. Wir drehten die Nester in den zerbrochenen Taubenkästen um, zogen lose Bretter ab und spähten hinter die Kiefernplanken, aus denen der Verschlag gebaut war.
»Hier ist nichts«, sagte ich enttäuscht.
»Nun wissen wir wenigstens, dass der Schatz irgendwo im Haus ist«, sagte Tom. »Wir sollten jetzt auf den Markt gehen und später weitersuchen. Vielleicht fällt dir in der Zwischenzeit was Neues ein.«
Ich war mir ziemlich sicher, dass er nur auf das Essen scharf war. Aber er hatte recht. Wenn ich bloß hier herumstand, brachte uns das auch nicht weiter. Tom freute sich, als ich ihm zustimmte.
Ich dagegen freute mich gar nicht auf die Aufgabe, die vor uns lag.
Ein Besuch in der Royal Exchange war eine deprimierende Angelegenheit.
Früher war der große Markt einer meiner liebsten Orte in der Stadt gewesen. Wenn ich mit meinem Meister herkam, begaffte ich die Waren, die zum Verkauf standen: glänzende Seide aus China in allen Farben des Regenbogens, blumige Essenzen aus Arabien, süß duftende, geröstete Kaffeebohnen aus der Neuen Welt. Die Rufe der Kaufleute, mit denen sie ihre Waren anpriesen, hallten in den Galerien wider, während die Kunden durch die Gänge schlenderten, mit den Händlern feilschten und sich an Wein und frisch gebackenen Kuchen ergötzten oder mit Bekannten schwatzten, denen sie zufällig begegneten.
Das war einmal. Die meisten Stände hatten geschlossen. Die Händler waren aus der Stadt geflohen. Kaum jemand kaufte noch etwas. Die verbliebenen Kunden konnte man zählen, die Stimmung war gedrückt und trostlos. Schweigend schlichen die Leute von einem Stand zum nächsten, erworben nur das Allernötigste und bezahlten, indem sie die Münzen in Schalen mit Essig warfen, von dem man sich erhoffte, dass er die Krankheit wegätzte.
Tom und ich gingen langsam zwischen den Ständen hindurch und versuchten, den Kontakt mit den anderen Kunden soweit es ging zu vermeiden. Wir kauften nur die billigsten Nahrungsmittel und stapelten sie in dem Handkarren, den ich aus der Apotheke mitgebracht hatte. Gleichzeitig atmeten wir so flach wie möglich – und nicht nur wegen der fauligen Pestluft.
Der Gestank der Menschen war atemberaubend, und das lag nicht ausschließlich an ihrem normalen Körpergeruch. Da man glaubte, dass Gerüche die Krankheit fernhielten, trugen, kauten oder badeten die Leute in allem, was übel roch. Ein Mann war von oben bis unten mit Essig beschmiert, weil er offensichtlich glaubte, was gut war für Münzen, war auch gut für ihn. Ein anderer trug eine Kette aus verfaulten Zwiebeln um den Hals. Neben ihm ging eine Frau, die sich die Wangen so mit Knoblauch und Raute vollgestopft hatte, dass sie aussah wie ein Hamster.
Tom legte den Arm vor die Nase. »Ich muss mich gleich übergeben.« Dann deutete er auf einen Mann, der ein Tuch um den Kopf gewickelt hatte. »Schau dir das mal an.« In einem Nest obenauf saß eine Schale, in der Holzkohle glühte und ihn mit Rauch umgab. »Das wäre ein Kunde für deine Hausrauchmaschine.«
Ich verkniff mir eine Gegenbemerkung, während wir uns einem weniger stinkenden Teil des Markts näherten, wo ein warmer Sommerwind durch die offenen Gänge wehte. Und da rochen wir etwas, was in gewisser Weise schlimmer war als jeder andere Geruch.
Eine Frau in einer Metzgerschürze stand vor ihrer Ware. »Schweinefleisch!«, rief sie. »Gebratenes Schweinefleisch, frisch vom Land!«
Tom packte mich am Arm und stöhnte. »Fleisch! Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wann ich zum letzten Mal Fleisch gesehen habe!«
Mein Magen knurrte wie ein wütender Löwe, und ich umklammerte das, was uns von Isaacs Geld noch geblieben war. Am besten gar nicht hinschauen. Wir konnten es uns nicht leisten, auch nur eine Münze für eine Leckerei zu verschwenden.
Aber dieser Duft … Tom starrte trübsinnig auf die Auslagen der Metzgerin, während wir unseren Karren an ihrem Stand vorbeischoben. »Oh … allein die Vorstellung, Christopher: frische, knusprige, marinierte Rippchen … mit einer Bratensoße …«
Ich hielt bei einem Müller an und kaufte noch mehr Mehl. Tom sprach weiter, bis ihm die Köstlichkeiten ausgingen, die man aus Schweinefleisch machen konnte. Dann ging er zu anderen Tieren über: »Roastbeef … glasierter Fasan … Lammeintopf mit diesen kleinen Karotten in …«
»Das reicht, Tom«, sagte ich.
»Würstchen … gesottenes Hammelfleisch … Rippchen mit Soße …«
»Das hattest du schon.«
Toms Unterlippe bebte. »Ich wette, der König isst Rippchen mit Soße, so oft er will.«
Ich legte die Fingerspitzen an meine Schläfen. »Ich will das nicht mehr hören.«
Toms jammervolle Aufzählung dieser Leibgerichte drückte auf meine Stimmung. Wir hatten nur das Nötigste gekauft: Mehl, jede Menge und sehr billig, ein bisschen Hafer, harten, gesalzenen Käse, Eier und Butter, ein kleines Fässchen Dünnbier, einen Block Eis für unsere Eiskammer und sechs Dutzend Karotten, die ich für einen Penny das Bund ergattert hatte. Das war alles, was zwischen mir und dem Hungertod stand.
Und während ich meinen Karren über den Markt schob, hatte ich mit einem Mal das Gefühl, dass wir beobachtet wurden.
Aus dem Augenwinkel bemerkte ich eine Bewegung. Da, hinter dem Stand des Getreidebauern. Ich wirbelte herum.
Die Gestalt duckte sich weg. Ich erhaschte den Blick auf ein grünes Kleid und kastanienbraune Locken.
»Hast du das gesehen?«, fragte ich.
»Was gesehen?«, fragte Tom.
»Ich glaube, wir werden von einem Mädchen verfolgt.«
Tom schaute sich um. »Eine Taschendiebin vielleicht?«
Ich war mir nicht sicher. Aber ich sah sie nicht zum ersten Mal. »Sie hat uns schon auf dem Weg hierher beschattet.«
Tom legte eine Hand auf den Wagen und hielt nach kleinen Taschendiebinnen Ausschau, während ich den Karren weiterschob. Aber es gab noch andere zwielichtige Gestalten auf dem Markt: Angst und Panik hatten die Stadt erfasst und eine neue Art von Händlern hervorgelockt, die sich nun auf den doppelstöckigen Galerien der Royal Exchange breitgemacht hatten. Und jeder dieser Händler verkaufte sein eigenes, einzigartiges Produkt: ein todsicheres Heilmittel für die Pest.
Der Markt war mittlerweile berüchtigt für diese Quacksalber. Die Tatsache, dass keins dieser Heilmittel je gewirkt hatte, tat ihrem marktschreierischen Gehabe keinen Abbruch. Und sie hielt auch die Käufer in ihrer Verzweiflung nicht davon ab, fast jeden Preis dafür zu bezahlen.
Einer dieser Wunderheiler hatte mehr Menschen um sich versammelt als seine Konkurrenten. Er stand auf einer Kiste, in der Hand eine Kupferdose. »Hier drin«, schrie er, »liegt das Geheimnis! Das Geheimnis, dass euch retten wird, euch und eure Familie, eure Kinder. Ja, Sir, sehr schlau von Euch, Eure Familie wird es Euch danken.«
Der Quacksalber hielt einem korpulenten Mann in der ersten Reihe einen Krug mit Essig hin, in den dieser eine Münze fallen ließ. Er wickelte ein paar Kräuter aus der Kupferdose in ein Stück Papier und reichte sie nach unten, ehe er sich wieder den anderen Kunden zuwandte.
»Das ist Stephanus-Atem, jawohl. Enthält eine besondere Kräutermischung, ohne irgendeines dieser heidnischen Gifte aus fernen Ländern, mit denen die Apotheker herumpanschen. Die Kraft von Stephanus-Atem kommt einzig aus den sanften Hügeln Englands, gesegnet von Gott dem Herrn.«
»Lügner.«
»Was …?« Der Quacksalber hielt überrascht inne, als sich ein Mann durch die Menge schob. Er war groß und breitschultrig, mit langen blonden Haaren – es war keine Perücke, sondern sein eigenes Haar, das in Wellen über seine Schultern fiel. Er trug eine Jacke und Hosen aus Seide, beides übersät mit verschiedenfarbigen Flecken.
Ich kannte solche Flecken. Über die Jahre hatte ich sie oft genug an meiner eigenen Kleidung und der meines Meisters gesehen: schwarze Kohleschlieren am Kragen, getrocknetes Blut an den Ärmelsäumen, klebriger, honigfarbener Theriak an den Hosen.
Dieser Mann war Apotheker. Und er warf dem Quacksalber einen Blick voller Abscheu zu.
Der dagegen lächelte. »Lügner, sagt Ihr? Aber Sir, ich habe Beweise. Erblickt die Zauberkraft von Stephanus-Atem!«
Er streckte die Hand aus. Ein kleiner Junge stieg hinter ihm auf die Kiste.
»Noch vor drei Tagen«, sagte der Wunderheiler, »war dieser Junge todkrank und stand vor Petrus’ Himmelspforte. Dann verabreichte ich ihm den Stephanus-Atem. Und schaut ihn Euch nun an! Nicht das winzigste Anzeichen von Pest!«
Der Apotheker schnaubte. »Unfug!«
»Habt Ihr keine Augen im Kopf, Sir? Hier steht er vor Euch, vollständig geheilt …«
Der Apotheker wandte sich der Menge zu. »Hat jemand den Jungen mit Pestbeulen gesehen? Oder mit einem Ausschlag? Hat irgendjemand gesehen, dass er krank war?«
Der Quacksalber errötete. In der Menge rumorte es. Andere wiederum sprangen dem Mann bei. »Ihr habt wohl Euer eigenes Heilmittel, was?«, sagte der korpulente Mann, der das Päckchen mit der »Arznei« des Quacksalbers gekauft hatte, zu dem Apotheker.
»In der Tat.«
Der Quacksalber grinste. »Aha! Nun kommen wir der Sache schon näher. Er will seine eigene Arznei verkaufen – und wie alle Apotheker wird er euch zweifellos einen Wucherpreis nennen! Gute Leute, für eine einzige Krone lasse ich euch den Stephanus-Atem …«
»Ihr liegt falsch.«
Die Zuschauer wandten sich wieder dem Apotheker zu.
»Meine Arznei kostet nichts«, sagte er.
Das Gesicht des Wunderheilers rötete sich. »Ihr gebt sie umsonst her?«, sagte er ungläubig. »Was spielt Ihr für ein Spiel?«