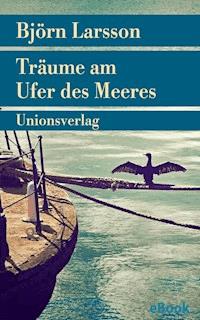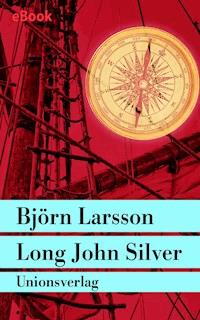Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Sprengstoffexperte Rachid erhält von seinem Imam den Auftrag, eine im Bau befindliche Pariser Metrostation und das darüber liegende Viertel der "Ungläubigen" in die Luft zu sprengen. Als er keine freivilligen Helfer findet, versucht er seinen Kollegen Ahmed zu erpressen - denn Ahmen hat eine kleine Tochter, die er über alles liebt.REZENSION"Zweifellos Björn Larssons bestes Buch bisher. Mit einer hochkarätigen Thrillerspannung und einem packenden Finale." - Göteborg-PostenAUTORBjörn Larsson wurde 1953 geboren. Er lehrt französische Literatur an der Universität Lund. Neben wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht er Erzählungen und Romane. Der Autor lebt im Sommer auf seinem Segelboot in Dänemark.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Björn Larsson
Der böse Blick
Roman
Aus dem Schwedischenvon Knut Krüger
Lindhardt und Ringhof
Am Tag der Auferstehung sollen sie gefragt werden nach dem, was sie erdichteten.
Koran, Sure 29/12
FatimaEine von Mohammeds Töchtern aus der Ehe mit Chadidscha. Verheiratet mit Ali und Mutter von Hasan und Husayn. Von Sunniten und Schiiten gleichermaßen verehrt. Zum Schutz vor Dämonen oder dem »bösen Blick« wird ihre Hand oft an Türen, auf Amuletten oder Halsschmuck abgebildet. Fatima ist in der gesamten islamischen Welt ein geläufiger Name.
Jørgen Bæk Simonsen, Lexikon des Islam
1
Rachid schaute auf die Uhr. Genau zwölf Minuten vor sechs, so wie an jedem Morgen der letzten drei Monate, betrat er den Fahrstuhl, der ihn zur Sohle des Victoriaschachts brachte.
Bevor er die Fahrstuhltüren zuzog, ließ er seinen Blick über den Bauplatz schweifen, um sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe war. Er sah die Baracken der Arbeiter, die man in sieben Etagen übereinander geschichtet hatte, um Platz zu sparen; den vierzig Meter hohen Kran, der eine Kapazität von sechzig Tonnen besaß, um Bagger und Betonelemente hinabzusenken; die vier Zementsilos, deren Inhalt unter Hochdruck durch meterdicke Schläuche gepresst wurde; die Belüftungsrohre, deren Ventilatoren unablässig surrten; die Berge von Armierungseisen und Baugerüsten, die auf ihren Einsatz warteten, und viele andere Dinge, deren Verwendungszweck Rachid nicht kannte.
Wie an jedem anderen Morgen der letzten Monate war er allein. Um den Nachtschlaf Tausender von Menschen nicht zu stören, ruhte der lärmende Vortrieb zwischen acht Uhr abends und sieben Uhr morgens. Nachtwächter, Techniker und Ingenieure arbeiteten währenddessen in zwei Schichten, waren entweder schon gegangen oder noch nicht da, als Rachid kam. Eine knappe Stunde, zumindest eine gute halbe Stunde würde er mit großer Wahrscheinlichkeit ungestört sein.
Aber Wahrscheinlichkeit war etwas anderes als Gewissheit. Als Ingenieur wusste er, wie gefährlich es war, aus einer begrenzten Anzahl von Beobachtungen auf eine Gesetzmäßigkeit zu schließen. Deshalb blieb er für einen Moment ruhig stehen, blickte in den Abgrund und lauschte, bevor er auf den Fahrstuhlknopf drückte. Durch das Stahlgitter des Aufzugskäfigs hindurch konnte er den Boden in dreißig Metern Tiefe erahnen und die Sprossen der Leiter, die an die Oberfläche führten, deutlich erkennen. Niemand war zu sehen. Völlige Stille.
Als sich der Fahrstuhl ratternd in Bewegung setzte, zog er seinen Notizblock hervor und kontrollierte ein weiteres Mal, ob alle Angaben stimmten. Er prüfte, wie lange er brauchte, um die Sohle zu erreichen und danach zu Schacht Nummer elf zu gelangen, wo von den Hauptkabeln aus der Strom auf mehrere kleinere Leitungen verteilt wurde. Genau hier, am Verteilerkasten, fünf Meter unter der Oberfläche, sollte eine kleine Sprengladung platziert werden, um die Stromversorgung außer Kraft zu setzen. Da er bereits wusste, wie viel Zeit er für diesen Vorgang veranschlagen musste, begab er sich von Schacht elf unverzüglich durch die südliche Tunnelröhre in den zukünftigen Zentralbereich der Station namens »Condorcet«. Mit raschen Schritten lief er zum anderen Ende, das über zweihundert Meter entfernt war. An einigen Stellen musste er Umwege in Kauf nehmen, weil ihm Bohrmaschinen, Baugerüste oder andere Gegenstände den Weg versperrten.
Am anderen Ende des Zentralbereichs nahm er den Aufzug bis zu einer Tiefe von zehn Metern unter der Oberfläche, dem Grundwasserspiegel. Er stieg aus dem Käfig und bog unmittelbar nach links in eine der kleineren Tunnelröhren ab, die ausschließlich Belüftungs- und Sicherheitszwecken dienten. Weil diese Röhren nach Fertigstellung der Arbeiten ohnehin zugeschüttet werden sollten, hatte man sich nicht die Mühe gemacht, den Boden von Lehm und Gesteinsbrocken zu befreien. Entsprechend lange dauerte es, um die ungefähr achtzig Meter zurückzulegen.
Am Ende bog er ein weiteres Mal nach links ab und erreichte einen Hohlraum, in dem sich dicke Schläuche befanden, die in ein Betonrohr von zwei Metern Durchmesser mündeten. Durch dieses Rohr leiteten fünfzig Pumpen das Grundwasser ab, das unablässig in den Untergrund sickerte. Abgesehen von einigen Verbindungstunneln zur Metro, entstand die gesamte Station im Bereich des Pariser Grundwassers.
Er kletterte über einige kleinere Schläuche hinweg und ging hinter dem Betonrohr in die Hocke. Er hob eine Sperrholzplatte an und vergewisserte sich, ob der trockene Hohlraum, den er vor einigen Wochen gegraben hatte, immer noch vorhanden war. Er schaute auf die Uhr und danach in sein Notizbuch. Die Zeitangaben stimmten auf die Minute. Danach ging er denselben Weg zurück, den er gekommen war. Mitten im Haupttunnel blieb er unterhalb der Rohrkonstruktion stehen, die sein eigener Arbeitsplatz war: Hunderte von Stahlrohren waren zu einem zehn Meter hohen Gerüst zusammengefügt, das die Decke abstützte, während man mittels einer Technik, die »lining« genannt wird, die Betonarbeiten durchführte. Hatte man sich drei Meter weiter in das Gestein vorgearbeitet, wurde die Fläche mit massivem Kunststoff verschalt, damit das Grundwasser nicht durchsickern konnte, wenn der Beton eingespritzt wurde. Über dem Stahlrohrgerüst befand sich eine zwanzig Meter breite, gewölbte Schalungsform aus Stahl, die hydraulisch gegen die Decke und den Kunststoff gepresst wurde. Dann wurde der Beton unter Hochdruck hineingespritzt und füllte den Hohlraum zwischen der Form und dem Gestein, während das austretende Grundwasser die Tunnelwände hinunterlief und abgepumpt wurde. Bevor das Unternehmen sich für die Lining-Technik entschied, hatte es verschiedene Injektionsmittel getestet, eines giftiger als das andere. Doch bei dem gleichmäßig strömenden Grundwasser hatte keines richtig aushärten können.
Rachid wusste das technische Know-how zu schätzen, das dem Bau der Station zu Grunde lag. Doch für sein Vorhaben spielte dies keine Rolle. Entscheidend war vielmehr, dass der Ort, an dem er jetzt stand, die Achillesferse des Projekts war. Genau hier, an der Nahtstelle zwischen dem freigelegten Gestein und dem noch nicht ausgehärteten Beton, konnte sich die Station von einem Meisterstück der Ingenieurkunst in ein Mahnmal für die Hybris der westlichen Welt verwandeln. An diesem Ort musste die größte Sprengladung platziert werden.
Die Vorbereitungen würden noch weitere Monate in Anspruch nehmen. Um die praktischen und technischen Fragen machte er sich keine Gedanken mehr. Die Ladung zu präparieren, erforderte genaue Planung und Fingerfertigkeit – und auf diesen Gebieten war er Experte. Das einzige unkalkulierbare Problem war der Faktor Mensch. Seine Lehrmeister hatten stets hervorgehoben, wie wichtig es war, auch mit dem Unerwarteten zu rechnen, wenn man es mit Menschen zu tun hatte. Obwohl Rachid die Arbeitspläne und Bewegungsströme genauestens analysiert hatte, reichte es aus, dass jemand zurückkehrte, um ein vergessenes Werkzeug zu holen, und der ausgetüftelte Plan war hinfällig. Er brauchte also jemanden, der Wache hielt. Zum Schacht elf und dem Pumpenraum kam selten jemand, das wusste er. Doch im Zentralbereich, besonders unter der Schalungsform, konnte man stets Leuten begegnen, selbst außerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Hilfe von außen gab es nicht. Weil die Unternehmensleitung Terroranschläge befürchtete, wurden alle neuen Mitarbeiter einer gründlichen Personenkontrolle unterzogen.
Trotz mehrerer Versuche war er selbst der Einzige, den die Bewaffnete Islamische Gruppe, genannt GIA, hatte einschleusen können.
Natürlich hatte er keine Angst vor dem Sterben. Alles lag in Allahs Hand. Ob er heute oder morgen starb, war gleichgültig. Er hätte die Aktion auch ganz allein durchführen können, doch ihm war strikt untersagt, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Es gab andere in der GIA, die keine besonderen Fähigkeiten besaßen und sich daher besser zum Märtyrer eigneten. Sich gemeinsam mit einem Dutzend Christen oder Juden in die Luft zu sprengen, war nicht der einzige Weg zu einem Platz an Allahs Seite. Genauso wertvoll war es, der wichtigste Bombenexperte der Bewaffneten Islamischen Gruppe zu sein. Für Allah zu sterben war keine Kunst. Die Kunst bestand darin, zu überleben.
Deshalb hatte man ihn ausgewählt. Er war der Einzige, der beweisen konnte, dass der Heilige Krieg nicht beendet war, bevor der Islam triumphiert hatte. Das Regime in Algerien und die Regierungen in Europa, die es unterstützten, glaubten, der Krieg sei gewonnen und die Lage unter Kontrolle. Die Industriestaaten pumpten Milliarden ins Land, um die Regierung sowie die Ausrottungsfront innerhalb der Streitkräfte zu stützen. Vor dem Terror und der Korruption der Armee verschlossen sie die Augen, weil sie Feinde des Islam waren. Viele der heiligen Krieger der GIA hatten ihr Leben im Kampf für Allah und den Islam gelassen. Rachid sollte zeigen, dass es nicht vergeblich gewesen war. Außerdem würde ihm die Aktion ewigen Ruhm einbringen. Der edle Schreiber an Allahs Seite, der alle guten Taten eines Menschen notierte, sollte mit Freude zur Feder greifen. Und niemand auf der Welt würde jemals vergessen, dass es Rachid war, der hinter der Auslöschung stand; ein ganzes Wohnviertel mit Tausenden von Menschen sollte auseinander gesprengt und in den Abgrund gerissen werden, um schließlich in der Sintflut des Grundwassers zu ertrinken – ein unvergleichliches Symbol für die Niederlage der westlichen Welt. Nachdem er alle Details überprüft hatte, ging er zum Victoriaschacht zurück. Dort hielt er inne und blickte durch den langen Trichter, der sich weit über seinem Kopf befand, zum schwarzen Morgenhimmel empor. Er hatte seinen kommenden Triumph vor Augen. Das Paradies war nah, so nah, dass er fast meinte, es berühren zu können: Für den aber, der seines Herrn Rang gefürchtet, sind der Gärten zwei. Beide mit Zweigen. In ihnen sind zwei eilende Quellen. In ihnen sind von jeder Frucht zwei Arten. Sie sollen sich lehnen auf Betten, mit Futter aus Brokat, und die Früchte der beiden Gärten sind nahe. In ihnen sind keusch blickende Mädchen, die weder Mensch noch Dschānn zuvor berührte. Als wären sie Hyazinthe und Korallen. In ihnen sind gute und schöne Mädchen. Hūris, verschlossen in Zelten. Die weder Mensch noch Dschānn zuvor berührte.
Sein Herz pochte so heftig, dass er sich in der unterirdischen Stille einbildete zu hören, wie das Echo zwischen den Tunnelwänden hin und her sprang. Er sah, wie der Imam ihn empfing und Hunderte jubelnder Mudschaheddin ihm zu Ehren Gewehrsalven in die Luft schossen. Er sah, wie die schönen Jungfrauen im Paradies ihn erwarteten.
Inmitten der Euphorie zuckte er zusammen. Hatte er ein Geräusch gehört? Er rieb sich die Augen und schlug sich ins Gesicht. Was fiel ihm nur ein! Er hatte sich von seiner Fantasie mitreißen lassen. Das war eine unverzeihliche Sünde. Seine Lehrmeister hatten ihn gewarnt: Nichts dürfe sich zwischen Allah und die Wirklichkeit drängen, keine Fantasie, keine Träume, keine Geschichten. Denn diese waren Trugbilder, die von der einzig wahren Erzählung ablenkten: Wer ist sündiger, als wer wider Allah eine Lüge ersinnt oder Seine Zeichen der Lüge zeiht? Der Wahn nützt nichts gegen die Wahrheit.
Ein beträchtlicher Teil seiner Ausbildung zielte darauf ab, sich niemals in das Leben eines Menschen hineinzuversetzen, auch nicht in sein eigenes und vor allem nicht in das eines Ungläubigen. Helft mir mit Kräften, und ich will zwischen euch und zwischen sie einen Grenzwall ziehen. Einfühlung war Verständnis, und Verständnis bedeutete zu akzeptieren, dass Menschen das Recht hatten, ein gottloses Leben zu führen. Doch es gab nur eine Wahrheit, die Wahrheit Allahs, so wie sie sich im Koran und in der Sunna, den Sprüchen des Propheten, offenbarte. Alles andere war Lüge.
Er durfte sich nicht vorstellen, wie es sein würde, in wenigen Monaten Rachid der Held zu sein. Unter keinen Umständen durfte er an die Menschen denken, deren Leben geopfert werden musste. Allah hatte ihn beauftragt, die Gottlosen zu töten. Also war es auch an Allah, zu urteilen und Mitleid zu zeigen. Nicht an ihm. Er diente ausschließlich dem Dschihad und der Wahrheit. Er durfte nicht vom Weg abweichen. Dass viele Mitglieder der GIA Naturwissenschaftler und Ingenieure waren wie er, war kein Zufall. Die wussten, dass man stets mit der notwendigen Präzision arbeiten musste. Die waren sich im Klaren, dass man alle Variablen, inklusive des Menschen, in Betracht ziehen musste, um das Ziel zu erreichen. Doch er begriff, dass diese Eigenschaften es ihm schwer machten, das Vertrauen seiner Kollegen zu gewinnen und jemanden zu finden, der ihm helfen konnte. Dass die meisten von ihnen zu den Einwanderern der ersten Generation gehörten und den Bürgerkrieg noch in frischer Erinnerung hatten, spielte keine Rolle. Das Geld und die westliche Dekadenz hatte sie bereits verdorben. Vor allem waren es Facharbeiter, die besser bezahlt wurden als die meisten anderen Ausländer. Die meisten von ihnen würden ihn bedenkenlos anzeigen.
Nur einer war anders: Ahmed. Wer war er? Er hatte nie von sich selbst gesprochen. Ahmed war nicht so wie die anderen. Er verbarg etwas. Rachid hatte versucht, etwas über seinen persönlichen Hintergrund in Erfahrung zu bringen, doch ohne Erfolg. Als existierte Ahmed nicht. Oder wäre ein anderer, ein Rätsel, das es zu lösen galt, ein nicht entzifferbarer Code. Wenn er Ahmed sah, musste Rachid an eine große Raubkatze denken, einen verwundeten Tiger, der nachts herumstrich und angriff, wenn man am wenigsten damit rechnete. Rachid wünschte sich, Ahmeds Geheimnis zu kennen. Er brauchte jemanden, der so war wie dieser: wachsam, verschwiegen und stark. Mit Ahmed wäre das menschliche Problem gelöst. Doch bisher hatte Ahmed alle Versuche Rachids, mit ihm in Kontakt zu treten, abgewehrt und selbst auf Fragen kaum etwas geantwortet.
Es brauchte Geduld und Vertrauen. Früher oder später würde sich mit Allahs Hilfe eine Tür öffnen. Irgendjemand würde eines Tages Rachids Hilfe in Anspruch nehmen, was diesen in die Lage versetzte, eine Gegenleistung zu fordern. Man musste nur auf die richtige Gelegenheit warten. Bis dahin ging es nur um eines: die Aktion minutiös vorzubereiten, um jederzeit zuschlagen zu können.
2
»Dreckiger Araber!«
Ahmed schaute aus den Augenwinkeln zu Fatima, die ungerührt vor sich hin sah. »Kanake!«
Jetzt blickte Fatima rasch zu ihm auf. Er erwiderte ihren Blick und lachte. Das waren hässliche Wörter, aber sie töteten nicht. Zumindest nicht auf der Stelle.
Doch dann kam der Stein. Er traf Fatima am Hinterkopf. Sie wankte und stieß einen Schrei aus. Sie wusste, dass man keine Angst zeigen durfte. Genau wie bei bissigen Hunden. Ahmed sah, wie das Blut zwischen ihren pechschwarzen Haaren hervorsickerte, es rot färbte und langsam den Nacken hinunterlief. Sie drehte sich um. Zwei Männer mit Glatzen und Lederjacken zeigten ihr den Mittelfinger. Ihre Gesichter fraßen sich in ihr Gedächtnis und die Wunden fanden Eingang in die Schreckenskammer, die einen immer größeren Teil ihres Kopfes einnahm.
»Kannst du gehen?«, fragte er.
Fatima nickte. Ihr Gesicht war angespannt. Sie hatte Schmerzen, weinte jedoch nicht.
Plötzlich hatte Ahmed seine Schwester vor Augen. Auch sie war stark gewesen. Allzu stark. Als sie starb, war sie in Fatimas Alter gewesen. Sie war keine fünfzehn, als sie von der DOP, der Sondereinheit der französischen Armee für operativen Schutz, zu Tode gefoltert wurde.
Als Fatima und er nach Hause kamen, war Mireille bereits da. Ahmed erzählte, was geschehen war. Gemeinsam reinigten sie Fatimas Wunde und legten einen Verband an. Danach setzten sich alle drei auf das Sofa und umarmten sich still. Nachdem Fatima aufgehört hatte zu zittern, stand Ahmed auf.
»Ich habe vergessen, Zigaretten zu kaufen. Ich bin gleich wieder da.«
Mireille schaute ihn an, sagte jedoch nichts.
»Soll ich dir etwas mitbringen?«, fragte Ahmed mit Blick auf Fatima.
»Ein Buch.«
Ahmed nickte. Neben dem Café, in dem er seine Zigaretten kaufte, befand sich eine Buchhandlung. Dort gab Fatima beinahe ihr gesamtes Taschengeld aus.
Ahmed lief die zehn Treppen hinunter und zum Park zurück. Schon aus großer Distanz erkannte er die beiden Männer. Sie standen immer noch an derselben Stelle wie vorhin, als er und Fatima an ihnen vorbeigegangen waren. Sie hatten wohl nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass irgendein dunkelhäutiger Vater mit Tochter bei ihnen vorbeikam. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, ging er auf sie zu. Überrascht schauten sie zuerst ihn und dann einander an, bevor sich ein Lächeln auf ihren Lippen abzeichnete. Darauf hatten sie wohl von Anfang an gehofft. Gemeinsam dürften sie keine Schwierigkeiten haben, einen Ausländer mittleren Alters zusammenzuschlagen.
Ahmed trat einem von ihnen zwischen die Beine, so dass er mit einem Aufschrei zusammensank, dem anderen brach er mit einem Faustschlag das Nasenbein. Danach trat er erst dem einen, dann dem anderen auf die Kniescheibe, womit er sie für mehrere Wochen zu Invaliden machte. Schließlich nahm er einen Stein und schlug damit auf ihre Köpfe ein, bis das Blut über ihre kahlen Schädel lief. Alles war so rasch vorüber, dass sie kaum Zeit gefunden hatten, ihre Angst und ihren Schmerz herauszuschreien, bevor sie das Bewusstsein verloren. Auf dem Rückweg suchte Ahmed die Buchhandlung auf. Er kaufte eine Taschenbuchausgabe von Tausendundeine Nacht. Scheherezade hatte ihr eigenes Leben gerettet, indem sie Geschichten erzählte. Er machte sich keine Illusionen: Geschichten konnten nicht verhindern, dass Fatima einen Stein an den Kopf bekam. Doch wenn sie dazu führten, dass sie abgelenkt wurde, war dies auch etwas wert.
Manchmal hatte er sie schon fragen wollen, warum sie sich nicht lieber mit ihren Freundinnen verabredete, anstatt ständig zu lesen, doch wenn er gründlich nachdachte, war er sich keinesfalls sicher, ob die Realität der Fantasie vorzuziehen war. Außerdem hatte er Angst, Fatima würde seine Frage als Vorwurf empfinden. Und vielleicht sogar den Verdacht hegen, er sei im Grunde immer noch der Überzeugung, das Leben einer Frau sei weniger wert als das eines Mannes. Doch er hatte sich vom Islam losgesagt. Sich ein für alle Mal und ausnahmslos von allen Religionen distanziert. Gott, ob man ihn nun Jehova, Allah oder sonst wie nannte, war einfach von Übel.
Und die Imame wussten ganz genau, was sie taten. Sie verboten den Mädchen und Frauen das Lesen von Romanen, weil dies die Freiheit einschloss, sich vorzustellen, dass nicht alles zwangsläufig so sein musste, wie es war. Mit ein wenig Fantasie war es durchaus vorstellbar, dass eine Welt ohne den Koran, ohne die Sunna des Propheten, gar ohne den Propheten selbst existierte, zumindest eine Welt, in der die Männer kein Recht hatten, ihre Frauen mit Allahs Segen zu unterdrücken. Nein, Fatima sollte nicht auf den Gedanken kommen, er habe etwas dagegen, dass sie ihre Nase immerzu in Bücher steckte. Wenn es etwas gab, das Fatima brauchte, dann war es Hoffnung. Doch woraus sollte sie diese schöpfen? Jedenfalls nicht aus der Realität, die sie umgab.
Er beeilte sich, nach Hause zurückzukehren. Er bereute nichts, obwohl er wusste, dass ein Umzug nun unvermeidlich war. Nicht, weil die beiden Männer ihn identifizieren konnten. Rassisten betrachteten Araber niemals als Menschen, sondern immer als graue und formlose Masse. Doch Fatimas Aussehen war zu auffallend, um in der Menge zu verblassen. Manchmal hatte er sich gewünscht, sie wäre nicht so hübsch.
Mireille erzählte er nichts davon, was er getan hatte. Es gab keinen Grund, sie zu beunruhigen, bis alles geregelt war. Sie hatte schon genügend Anlass zur Sorge. Nachdem Mireille zu Bett gegangen war, setzte er sich mit einer Zigarette und einer Tasse Kaffee in die Küche. Er versuchte, an den morgigen Tag zu denken. In wenigen Stunden würde er mit Georges einen Rundgang machen und die Pumpen kontrollieren. Ahmed würde Georges nicht im Stich lassen. Er versuchte, sich mit dem Hohlraum unter der Erde zu beschäftigen, der seit beinahe fünf Jahren sein Arbeitsplatz und sein Versteck war, und den Gedanken zu verdrängen, dass es vor allem darauf ankam, Fatima und Mireille ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Das hatte er vergessen, als er die beiden Glatzköpfe zusammenschlug.
3
Der Wecker klingelte um Viertel vor sechs. Georges war bereits wach. Er hatte schlecht geschlafen. Nach dreißig Jahren in derselben Firma, fünfzehn davon als Abteilungsleiter, sollte er sich an solche Situationen gewöhnt haben. Er wusste, was er konnte. Seine Vorgesetzten ebenso. Jedenfalls hatten sie ihm im Laufe der Jahre eine zunehmend größere Verantwortung und schwierigere Aufgaben übertragen, auch wenn sich das beim Gehalt kaum bemerkbar machte. Aber das Vertrauen der Vorgesetzten und seine eigene Erfahrung konnten seine Nervosität nicht mindern. Die stellte sich immer ein, wenn ihm die Bewältigung einer großen und wichtigen Aufgabe bevorstand. Das Adrenalin wurde unter Hochdruck ausgeschüttet.
Er versuchte, sich klar zu machen, dass es genau diese Anspannung war, die ihm seine Stelle – im Gegensatz zu vielen Kollegen – bislang gesichert hatte. Sie sorgte dafür, dass er sich auf alle Eventualitäten einstellte. Die Nervosität war der Preis für die relative Sicherheit seines Arbeitsplatzes.
Er stand auf und stellte den Wecker für Marie, bevor er sich innerhalb von fünf Minuten wusch und anzog. Während er die Nachrichten im Radio hörte, trank er eine Tasse Kaffee. Zwanzig Minuten später saß er zusammen mit ungefähr dreißig übermüdeten Pendlern im Bus, die alle an derselben Station ausstiegen wie er, um fünf Minuten später den Zug nach Paris zu nehmen.
Georges setzte sich auf denselben Platz wie immer. Normalerweise hatte er keine Schwierigkeiten, die Dreiviertelstunde bis zum Gare Montparnasse vor sich hin zu dösen. Zehn Minuten mit dem Bus, fünfundvierzig mit dem Nahverkehrszug, dreißig mit der Metro zuzüglich der Fußstrecken ergaben eine Fahrzeit von einer Stunde und fünfundvierzig Minuten. Dreieinhalb Stunden hin und zurück. Fünf Tage in der Woche. Er ging um Viertel nach sechs aus dem Haus und kehrte um halb acht zurück. Während der Fahrt zu schlafen war die einzige Gelegenheit, ein wenig Zeit für sich selbst zu finden.
Doch an diesem Morgen versuchte er gar nicht erst, die Augen zu schließen. Stattdessen dachte er an die heute bevorstehende Inspektion der Pumpen und den Probelauf der Generatoren. Er vergegenwärtigte sich die möglichen Fehlerquellen und eventuellen Gegenmaßnahmen. Zumindest in einer Hinsicht, dachte er, war ihm seine Zeit auf der Klosterschule von Nutzen gewesen. Sie hatte seine Fantasie angeregt. Um die sechs Jahre durchzustehen, hatte er sich oft ausgemalt, dass ein besseres Leben außerhalb der Mauern des Internats existierte.
Nun diente seine Vorstellungskraft vor allem der Arbeit und nicht dazu, sich ein anderes Leben zu erträumen. Gedankenspiele, die sich um das reibungslose Funktionieren von Menschen und Maschinen drehten, waren seine Spezialität geworden. Konnte es beispielsweise Probleme mit den Generatoren geben, wenn nachts die Elektrizität unterbrochen wurde, um einen Stromausfall zu simulieren? Nein, die Generatoren wurden routinemäßig einmal in der Woche hochgefahren. Außerdem waren sie parallel geschaltet. Wenn der eine ausfiel, übernahm automatisch der andere die Arbeit. Das Risiko, dass beide gleichzeitig ausfielen, ging gegen null. Um die Maschinen brauchte er sich also keine Gedanken zu machen. Blieben das Stromnetz, die Sicherungen und Kabel. Was geschah bei einem Kurzschluss? Was passierte, wenn ein Bagger aus Versehen das Hauptkabel durchtrennte? Dann würde das Grundwasser mit derselben Geschwindigkeit eindringen, mit der die Pumpen es normalerweise hinausbeförderten, was Hunderttausenden von Kubikmetern pro Stunde entsprach.
Er versuchte zu überschlagen, wie viel Zeit ihnen zu Gegenmaßnahmen blieb, bis es nur noch darum ging, sein Leben zu retten. Der Hohlraum, den sie geschaffen hatten, war so groß wie zwei Fußballfelder. Das Grundwasser befand sich in einer Tiefe zwischen zehn und zwanzig Metern. Die Aufzüge und Sprossen des Schachts waren der einzige Weg an die Oberfläche. Die Kathedrale von Notre-Dame hätte bequem unter der Erde Platz gefunden. Es handelte sich, mit Ausnahme des Eurotunnels, um die größte unterirdische Baustelle aller Zeiten, beträchtlich größer als die, auf der man »Les Halles« errichtet hatte, was zudem unter freiem Himmel geschehen war. Das so genannte Eole-Projekt hatte gigantische Ausmaße: zwei unterirdische Bahnstationen in dreißig Metern Tiefe, »Condorcet« am Gare St Lazare und »Magenta« am Gare du Nord, eine doppelte Tunnelröhre, die das gesamte nördliche Paris durchquerte, ungefähr dreißig Schächte, die sich über die Strecke verteilten, kilometerlange Schläuche, die das Grundwasser abpumpten, meterdicke Rohre, um den angemischten Beton in die Tiefe zu leiten, Extratunnel für die Ventilatoren und den Abtransport der weggesprengten Gesteinsmassen. Dennoch gab es nur wenige Menschen, die genau wussten, was sich unter der Erde abspielte. Passierte man die Baustelle an der Rue de Caumartin oder der Rue Joubert, machte sie keinen Aufsehen erregenden Eindruck. Das Konsortium hatte natürlich nicht ein ganzes Viertel abreißen oder Tausende von Menschen und Büros umsiedeln können, nur um eine oberirdische Arbeit zu ermöglichen. Stattdessen waren zunächst vertikale, dreißig Meter tiefe Schächte geschaffen worden, die, abhängig von ihrer Funktion, einen Durchmesser von zehn bis zwanzig Metern hatten. Der weitere Abbau in horizontaler Richtung wurde von der Sohle der Schächte aus durchgeführt. Die benötigte Ausrüstung beförderte ein Kran, der über der Erde stand, in die Tiefe.
Tatsächlich war oberhalb des gigantischen Hohlraums ein ganzes Geschäfts- und Wohnviertel für ungefähr zehntausend Menschen neu entstanden, das durch nichts anderes als Beton, Stahl und Zement abgestützt wurde. Damit die bestehenden Häuser nicht einstürzten, waren deren Fundamente erneuert und verstärkt worden. Wenn die Bewohner der Appartements gewusst hätten, was mit ihren Häusern geschah, wären viele sicher nicht dort wohnen geblieben.
Jeden Tag wurde gemessen, ob die Häuser sich nicht absenkten. Toleriert wurden maximal zehn Millimeter. Bislang befand man sich innerhalb dieses Spielraums, wenngleich in mehreren Wohnungen Risse entstanden waren, die behoben werden mussten. Die Arbeiten waren zumindest besser verlaufen als die an der künftigen Station »Magenta« beim Gare du Nord. Dort hatte man die Arbeiten monatelang unterbrechen müssen, weil einige Häuser sich plötzlich um vierzig Zentimeter abgesenkt hatten. Bei der Station »Condorcet« hatte es allenfalls Probleme mit einem benachbarten Gymnasium gegeben, nachdem ein Teil der Decke eingestürzt war und die Schüler aus Protest gestreikt hatten. Ein Bistrobesitzer hatte sich beschwert, dass die Gläser in den Regalen klirrten und herunterfielen, wenn direkt unterhalb des Bistros gebohrt und gegraben wurde. Außerdem hatten einige Friseure den Schock ihres Lebens bekommen, als sich der Fußboden ihres Salons plötzlich um zwei Zentimeter anhob, weil man zur Verstärkung des Fundaments zu viel Beton eingespritzt hatte. Aber das waren im Grunde Bagatellen, die man später den Enkeln erzählen konnte, und nichts im Vergleich zu den Schreckensszenarien, die von der Bauleitung hin und wieder den Vorarbeitern vor Augen geführt wurden, damit diese penibel auf Qualität und Gründlichkeit achteten, die notwendig waren, um ernste Unglücksfälle oder gar Katastrophen zu vermeiden.
Am Anfang hatte es immer wieder Momente gegeben, in denen ihm alles so unüberschaubar vorgekommen war, dass er Magenschmerzen und hämmerndes Kopfweh verspürt hatte. Er sollte die Stabilität von zehn siebenstöckigen Häusern gewährleisten. Er war es, der die Tragfähigkeit der Stahlrohrgerüste berechnet hatte, die sowohl die Decke als auch die Schalungsform abstützen sollten, während der Beton eingespritzt wurde. Er war es, der für die Sicherheit sämtlicher Arbeitsvorgänge verantwortlich war.
Eine halbe Stunde! Eine halbe Stunde war ungefähr die Zeitspanne, die ihnen blieb, um eventuelle Fehler zu beheben. Fielen alle Pumpen gleichzeitig aus, würde sich der Hohlraum innerhalb eines Tages mit Wasser füllen. Doch eine Evakuierung aller dreihundertfünfzig Menschen, die unter der Erde arbeiteten, brauchte seine Zeit. Die Aufzüge konnten maximal zehn Personen zur selben Zeit befördern, und der Weg über die Sprossen, die sich an den Schachtwänden befanden, nahm mindestens zwanzig Minuten in Anspruch. Eine halbe Stunde. Wer würde in Anbetracht solch einer Galgenfrist ruhig schlafen können?
Als er am Gare St Lazare die Oberfläche erreichte, begegnete er Dumas.
»Wie geht’s, Georges? Läuft alles nach Plan?« Diese Frage stellte Dumas jedes Mal, wenn sie sich begegneten.
»Alles in Ordnung. Heute werden die Pumpen kontrolliert und die Generatoren getestet. Morgen werden wir einen ganzen Abschnitt ausschalen und uns drei Meter weiter in das Gestein vorarbeiten. Im Großen und Ganzen läuft alles wie geplant.«
»Im Großen und Ganzen?«
Obwohl Dumas ihm vertraute, war er doch Vorgesetzter genug, um nichts dem Zufall zu überlassen. »Ich habe ein paar Probleme mit Alain gehabt. Er ist nicht gerade ein idealer Vorarbeiter, schon gar nicht, wenn eine Arbeitsgruppe nur aus Algeriern besteht.«
»Ich kann im Moment nicht viel tun.«
»Er hasst die Araber.«
»Das ist seine Privatsache. Solange sie seine Arbeit nicht beeinträchtigt. Ich werde mit ihm sprechen.« Georges konnte sich einen besseren Beginn des Tages vorstellen, als ihn in der Gesellschaft Alains zu verbringen.
4
Jean-Louis Dumas begrüßte seine Sekretärin. Er erkundigte sich nach ihrem Befinden und sagte etwas Freundliches über ihre Arbeit.
Zumindest ein Grund zur Freude, dachte er beim Betreten des Büros. Dominique war nicht nur kompetent. Sie war auch außergewöhnlich attraktiv. Sie besaß einen Körper, der die Männer zum Träumen brachte. Es schadete nicht, dass sie eine Mulattin war. Das machte sie nur noch anziehender.
Schon bald wollte er sie in eines der schicksten und teuersten Pariser Restaurants einladen. Doch es lag unter seiner Würde, sie mit billigen Tricks oder simpler Bestechung rumzukriegen. Die Initiative sollte von ihr ausgehen. Sie selbst sollte begreifen, was er von ihr erwartete. Dass es nicht ausreichte, ihre Arbeit tadellos zu erledigen, war ihr sicherlich klar. Für einen Mann in seiner Position war Zerstreuung außerordentlich wichtig; das musste sie doch verstehen, wenn er ihr das auf nette Weise zu verstehen gab.
Im Übrigen war es an der Zeit, dass etwas passierte. Seine Geliebte langweilte ihn. Es fehlte ihr einfach an Fantasie. Außerdem hatte sie begonnen, ihn selbst, doch vor allem seine Brieftasche als ihr Eigentum zu betrachten. Die Arbeit in seiner Abteilung lief wie am Schnürchen, was vor allem Georges’ Verdienst war. Georges aus dem Ausland zurückzuholen und zum Abteilungsleiter zu machen, war ein Geniestreich gewesen, der nicht zuletzt seine eigenen Führungsqualitäten unter Beweis stellte. Der Vorstandsvorsitzende sowie die gesamte Konzernleitung hatten die Augenbrauen gehoben. Sie waren davon überzeugt gewesen, dass Georges’ Entwicklungspotenzial an seine Grenzen gestoßen und es nur eine Frage der Zeit sei, wann er gegen einen jüngeren und dynamischeren Mitarbeiter ausgetauscht werden musste. Niemand bezweifelte, dass Georges seinen Auftrag erfüllt hatte, doch es mangelte ihm an Respekt gegenüber seinen Vorgesetzten. Die Konzernleitung schien sich allerdings nicht darüber im Klaren zu sein, dass ein Haus von Menschen und nicht von Maschinen gebaut wurde.
Darum hatte Georges auch das Problem mit Alain zur Sprache gebracht. Georges hatte Recht, obwohl er mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf dachte.
Manchmal fragte sich Dumas, warum er sich eigentlich erbarmt hatte, Alain einzustellen. Die Antwort war leicht. Es konnte Dumas eines Tages von Nutzen sein, zu beweisen, dass er seine alten Freunde aus Algerien nicht im Stich gelassen hatte. Es war der Front National zu verdanken, dass so viele rachedürstende und verbitterte Verlierer jetzt aus ihren Löchern krochen und einem Mann wie ihm ernste Probleme bereiten konnten. Die Station »Condorcet« musste in jedem Fall rechtzeitig fertig gestellt werden, um eventuelle Schadensersatzansprüche der Staatlichen Bahngesellschaft SNCF zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, war ihm jedes Mittel recht.
Das Konsortium wusste seit geraumer Zeit, dass das Projekt mit nominellen Verlusten abgeschlossen werden würde, die ihm jedoch nicht zur Last gelegt werden konnten. Das millionenschwere Defizit sollte auf die sechs Unternehmen des Konsortiums verteilt werden. Dumas sollte ausschließlich dafür Sorge tragen, dass der Eigenanteil am Verlust die 30-Millionen-Grenze nicht überschritt. Dreißig Millionen waren keine Kleinigkeit. Wenn er klug agierte, sollte er die Kosten noch um einige Millionen drücken können, von denen ein Teil direkt in seine Tasche wanderte. Eine gewisse Entschädigung für seinen undankbaren und harten Job in der am wenigsten glamourösen aller Branchen sollte ihm wirklich zustehen. Wen kümmerte es schon, dass er eines der spektakulärsten Pariser Bauprojekte leitete? In den Etagen der Macht hörte man auf die Bosse der Ölindustrie, der Fluggesellschaften und des Militärs, vom Banken- und Versicherungssektor ganz zu schweigen. Selbst simple Autohändler von Renault oder Citroën besaßen mehr Macht und Einfluss als er, der aus einer Branche kam, die keine Gewinnspannen kannte. Und da wunderte man sich noch über die verbreitete Korruption in der Bauindustrie! Eine andere Möglichkeit gab es doch gar nicht, wollte man überhaupt etwas zu Stande bringen. Wie sollte man überhaupt kompetente Führungspersönlichkeiten wie ihn gewinnen, wenn man ihnen nicht ermöglichte, ein paar Groschen dazuzuverdienen? Die Journalisten, die voller Empörung über Schmiergeldaffären berichteten, vergaßen die Hauptsache: die Dinge mussten funktionieren. Wenn dieses Projekt scheiterte, würde das ganze Pariser Verkehrssystem eines schönen Tages kollabieren. Dann konnten diese Moralapostel mit gekonnten Formulierungen über die Regierung und die Bauunternehmer herziehen. Das war die Realität. Schöne Worte hatten noch nie etwas von bleibendem Wert oder praktischem Nutzen für die Menschen geschaffen. Die Frage war, ob sie die Menschen überhaupt ein wenig glücklicher gemacht hatten. Mit einer schönen Frau zu schlafen, war in jedem Fall befriedigender, als mit ihr zu sprechen, wie intelligent und redegewandt sie auch sein mochte.
Und eines stand für ihn fest: Wenn das Projekt in zwei Jahren abgeschlossen war, würde er die Branche wechseln. Er hatte es satt, bautechnische Wunderwerke zu errichten, in deren Glanz sich andere sonnten, vor allem die Vorsitzenden der übrigen fünf Gesellschaften, die an dem Konsortium beteiligt waren. Mit einigen Millionen extra in der Tasche sollte es ein Leichtes sein, sich zu gegebener Zeit Einfluss zu verschaffen.
Es waren die finanziellen Möglichkeiten, nicht die Fähigkeiten, die Vertrauen schafften. Und Vertrauen hieß Macht, und Macht hieß noch mehr Geld. So war die Welt nun mal.
5
Alain wurde um sechs Uhr morgens durch das Läuten des Telefons geweckt. Wer zum Teufel rief denn um diese Zeit an? Zuerst wollte er gar nicht rangehen. Aber dann dachte er daran, dass sein letztes Telefongespräch schon Wochen zurücklag. Ein Meinungsforschungsinstitut hatte angerufen und ihn zu Vorurteilen gegenüber Farbigen befragt. Da waren sie an den Richtigen geraten. Er hatte losgelegt: Alles, was in den Zeitungen stehe, sei frei erfunden und Teil der Verschwörung, die sich gegen unbescholtene französische Staatsbürger wie ihn richte. Die Journalisten seien nur darauf aus, Leute wie ihn als Nazis und Kommunisten zu diffamieren. Er wolle nichts anderes, als in seinem eigenen Land in Frieden leben.
Das Telefon läutete immer noch. Wenn es nun doch etwas Wichtiges war? Vielleicht jemand aus der Bruderschaft, der Hilfe brauchte. Er nahm den Hörer ab.
»Alain Dubois?«, fragte eine weibliche Stimme.
»Ja, das bin ich. Wer sind Sie?«
»Ich bin eine Krankenschwester vom St Louis Hospital.«
»Hospital?«
»Ihr Sohn hat einen Unfall gehabt. Aber Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen, die Verletzungen sind nicht allzu schwer: eine lädierte Kniescheibe, eine gebrochene Nase, eine Platzwunde am Kopf und eine leichte Gehirnerschütterung. In ein paar Wochen wird er wieder auf den Beinen sein.«
»Wie ist das passiert?«
»Es, äh, ... war kein Autounfall oder so was. Dem Bericht zufolge wurde er von vier Männern verprügelt.«
»Von vier Männern? Warum? Von wem?«
»Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Alles, was hier steht, ist, dass es sich um vier Nordafrikaner handelte.«
»Nordafrikaner? Ich muss mit ihm sprechen.«
»Tut mir Leid, er hat ein Beruhigungsmittel bekommen und schläft jetzt. Sie können ihn am Nachmittag besuchen. Dann sollte er aufgewacht sein. Aber Sie brauchen sich, wie gesagt, keine Sorgen zu machen. Hier ist er in den besten Händen.«
»Keine Sorgen zu machen? Wenn er von vier Niggern misshandelt wurde. Auf welcher Abteilung liegt er?«
»18 C.«
Alain knallte den Hörer auf die Gabel. Jetzt hatte er endgültig die Schnauze voll. Die Ausländer mussten raus. Sie hatten es gewagt, seinen Sohn zu überfallen. Sollte das denn nie ein Ende nehmen? Sein Großvater war einer der Ersten gewesen, die nach Algerien ausgewandert waren. Als er dorthin kam, gab es nichts anderes als unkultivierte Erde, Wüste und Krankheiten. Die ersten Kolonisten starben wie die Fliegen an Malaria, Cholera und Tuberkulose. Viele bezahlten ihren Versuch, der kargen Erde etwas abzuringen, mit dem Leben. Doch solche Menschen waren es auch, die das Land aufgebaut und ein Schienennetz, Häuser, Städte, Wege, Landwirtschaft und Weingüter geschaffen hatten. Innerhalb von dreißig Jahren war Franzosen gelungen, was die Araber in Jahrtausenden nicht zu Wege gebracht hatten. Mit fünfzig Jahren war sein Großvater ausgebrannt gewesen und gestorben, worauf sein Sohn, Alains Vater, sich abrackerte, während die Araber untätig zuschauten. Zumindest rührten sie keinen Finger, um ihm zu helfen. Alains Vater erwarb ein bescheidenes Weingut, das sich gut entwickelte. Seine Eltern schufteten rund um die Uhr, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, sich ein Haus und einige Annehmlichkeiten der Moderne leisten zu können. Unmittelbar vor Ausbruch des Krieges hatten sie es endlich geschafft: Sie brauchten nicht mehr eigenhändig die Feldarbeit zu verrichten und hatten es sogar zu bescheidenen Ersparnissen gebracht. Wem hatten sie das zu verdanken? Ausschließlich sich selbst. Doch dann kam der Krieg. Die Araber, die nie zuvor einen Finger gekrümmt hatten, wollten jetzt alles an sich reißen, was sein Großvater und Vater mit ihrer Hände Arbeit und im Schweiße ihres Angesichts aufgebaut hatten. Die Araber sprachen von Selbstständigkeit, Unterdrückung und Identität. Unsinn. Sie waren nur hinter dem Geld her und schon damals genauso verlogen und unberechenbar wie heute. Dem Verräter de Gaulle hatten sie es zu verdanken, dass sie ihren Willen bekamen. Alains Vater verlor sein gesamtes Hab und Gut, als er im Zuge der Unabhängigkeit Algeriens das Land verließ. Und Alain selbst, der vom ersten bis zum letzten Tag am Krieg teilgenommen hatte, was bekam er? Nichts. Niemand wollte etwas mit einem ehemaligen Verhörspezialisten zu tun haben. Als die Familie nach Frankreich zurückkehrte, wurden sie als Ausländer betrachtet, die nicht mehr galten als die Araber. Vielleicht sogar weniger, weil viele von ihnen, die bis zuletzt für ein französisches Algerien gekämpft und am Militärputsch teilgenommen hatten, nun verdächtigt wurden, der fünften Kolonne anzugehören und die Macht in Frankreich an sich reißen zu wollen. Sie wurden wie Aussätzige behandelt, die gekommen waren, um den Franzosen die Arbeit wegzunehmen. Was glaubten sie nur? Dass eine Million pieds-noirs Algerien freiwillig verlassen hätte? Sein Vater bekam schwere Depressionen und starb ein Jahr später in völliger Armut. Seine Mutter lebte noch ein paar Jahre, bis auch sie keine Kraft mehr hatte.
Und jetzt begann wieder alles von vorne. Die Araber strömten in Horden über die Grenze. Sie wollten in Frankreich das Ruder übernehmen und eine islamische Diktatur errichten. Sie sprachen von ihren Rechten. Ihre Kinder sollten eigene Schulen besuchen und einen Schleier tragen. Jedes Viertel sollte eine eigene Moschee bekommen. Ein Teil dieses Pöbels forderte die französischen Ärzte sogar auf, ihren Frauen die Klitoris wegzuschneiden, damit diese nicht untreu wurden. Es war wirklich zum Kotzen. Die Menschenrechte galten doch wohl auch für Franzosen, nicht nur für Araber, Juden und Neger. Es war doch ein Menschenrecht, als Franzose in seinem eigenen Land auch wie ein Franzose leben zu können, oder etwa nicht? Es war doch ein Menschenrecht, auf die Straße gehen zu können, ohne zusammengeschlagen zu werden. Es war doch ein Menschenrecht, dass sein Sohn nicht mit kaputter Kniescheibe und gebrochenem Nasenbein im Krankenhaus zu liegen brauchte. Oder etwa nicht?
Als Alain eine Stunde später bei der Arbeit erschien, setzte er sich in der Baracke auf seinen gewohnten Platz, ganz in der Ecke, mit dem Rücken zur Wand. Der Platz neben ihm blieb frei. Das war auch gut so. Heute sollten sie sich vorsehen. Es spielte keine Rolle, wer Thierry misshandelt hatte. Die waren einer wie der andere, das ganze Pack.
6
Ahmed erblickte Alain sofort, als er die Baracke betrat. Etwas in Alains Blick signalisierte ihm, dass er auf der Hut sein sollte. Es war zwar nichts Ungewöhnliches, dass Alain die Araber geringschätzig anschaute, doch normalerweise brauchte man sich darum nicht zu kümmern. Alain war zu feige, um es auf eine Konfrontation ankommen zu lassen. Nicht zuletzt, weil er wusste, dass ein unterirdischer Schacht der ideale Ort war, um einem verhassten Vorarbeiter eine Lektion zu erteilen, die dieser nicht so schnell vergessen würde. Doch es hatte sich etwas Neues in Alains Blick gemischt: Hass, derselbe blinde Hass, den Ahmed so oft während des Krieges gesehen hatte, auf beiden Seiten.
»Wie geht’s?«, fragte Ahmed.
Alain schien ihn weder zu sehen noch zu hören.
Ahmed setzte sich ruhig neben ihn, so wie sonst auch. Schon vor langer Zeit hatte er beschlossen, Rassisten niemals zu ignorieren. Zu schweigen und ihnen auszuweichen war das Verkehrteste, was Ausländer tun konnten.
»Was ist los mit dir? Bist du mit dem linken Bein zuerst aufgestanden?«
»Halt’s Maul!«
»Warum bist du denn so gereizt?«
»Ach, fahr zur Hölle!«
»Gut gesagt. Heute werden wir nämlich die Pumpen kontrollieren. Näher an die Hölle kommt man in diesem Loch nicht ran. Du, Rachid, Georges und ich werden uns heute durch den Schlamm kämpfen, die Filter kontrollieren und sie reinigen. Wird nicht gerade ein Vergnügen werden.«
»Die Pumpen sind mir scheißegal. Hol euch Araberschweine doch alle der Teufel.«
»Vielleicht solltest du besser auf deine Worte Acht geben. Du kennst doch Georges’ Einstellung.«
»Georges hat von der Realität keine Ahnung. War höchste Zeit, dass mal jemand mit ihm geredet hat.«
»Was ist passiert?«
»Thierry ist gestern von vier Arabern zusammengeschlagen worden. Kniescheibe kaputt, Nasenbein gebrochen, schwere Kopfverletzungen. Er hatte keine Chance. Wurde von hinten angegriffen. Vier gegen einen.«
Ahmed starrte Alain unverwandt an. Alain wich seinem Blick aus.
»Thierry?«, fragte Ahmed.
»Wenn ich diese Schweine erwische, mache ich sie fertig, hast du gehört?«
»Ich bin ja nicht taub. Wer ist Thierry?«
»Thierry ist mein Sohn.«
Zehn Millionen, dachte Ahmed. Es wohnen zehn Millionen Menschen in Paris. Fünfzigtausend allein in Saint Denis. Die Chancen standen also eins zu fünfzigtausend, dass es Alains Sohn gewesen war, der Fatima den Stein an den Kopf geworfen hatte. Aber wie viele Rassisten gab es in Saint Denis? Ein paar Tausend? Dass es Alains Sohn war, der im Park gestanden hatte, wäre Pech, doch unwahrscheinlich war es nicht.
»Bist du ganz sicher, dass es sich so zugetragen hat?«
»Was soll die Frage?«
»Warum sollten vier Araber von hinten auf deinen Sohn losgehen? Sie werden doch wohl einen Grund gehabt haben.« Alain kniff die Augen zusammen. Für einen Moment hatte Ahmed das Gefühl, Alain wisse mehr, als er zugab, begriff dann aber, dass es blanke Wut war, die sein Gesicht verzerrte.
»Wenn du glaubst, dass mein Sohn lügt, dann ...«
»Woher weiß Thierry, dass es vier waren, die ihn von hinten attackiert haben?«
»Weil er sie gesehen hat, du Schwachkopf.«
»Dann kann er der Polizei ja sicher eine gute Täterbeschreibung geben.«
»Die Bullen stehen auf Seiten der Araber. Aber glaub ja nicht, dass sie davonkommen werden. Darum werden sich Thierry und seine Freunde schon persönlich kümmern, sobald er wieder auf den Beinen ist.«
Das war typisch. Alains Sohn hatte nicht zugeben wollen, dass er von einem einzigen Araber mittleren Alters verprügelt worden war. Genauso wenig wie sein Vater traute er sich, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Ihre Angst und ihr Hass auf das Fremde waren an die Stelle der Realität getreten. Sie sahen nur, was sie sehen wollten, schwarz und weiß. Aber ihre Missachtung der Realität verleitete sie auch zu Fehlern. Deswegen würden die Fanatiker am Ende stets die Verlierer sein. So war es immer gewesen und so würde es bleiben. Es gab keine rassistische Biologie, keine islamische Wissenschaft, keine kommunistische Logik. Richtiges Handeln setzte einen präzisen Blick für die Wirklichkeit voraus. »Welche Freunde?«, fragte Ahmed.
Alain antwortete nicht. Eigentlich hatte er herausschreien wollen, Thierry sei Sergeant der DPS, der Sicherheitstruppe der Front National, und direkt deren Führer unterstellt. Er hätte bis ins kleinste Detail schildern können, wie unliebsame Araber bestraft wurden. Er hätte Ahmed gern in Panik versetzt. Doch in letzter Sekunde besann er sich. Sein Wissen preiszugeben, noch dazu gegenüber einem Araber, wäre ein Verrat gewesen. Und er wusste, wie man mit Verrätern umging. Genauso wie mit Arabern.
Als Rachid in die Baracke kam, um eine Tasse Kaffee zu trinken, spürte er sofort die unterschwellige Spannung, die zwischen Ahmed und Alain herrschte.
Er stellte sich hinter Ahmed.
»Kann ich dir helfen?«, fragte er, während er Alain ansah.
»Du kannst auch zur Hölle fahren!«
Ahmed drehte sich um. Rachid versuchte, ihm in die Augen zu schauen, musste aber schließlich den Blick abwenden.
»Vier Araber haben Alains Sohn zusammengeschlagen«, erklärte Ahmed. »Und Alain scheint zu glauben, dass wir beide unter den Schlägern waren.«
»Ich?«
»Nimm’s lieber nicht persönlich«, sagte Ahmed. Rachid erkannte sofort die Gefahr. Wollte er seine Aktion nicht gefährden, musste er unbemerkt bleiben, beinahe unsichtbar, einer, den niemand zur Kenntnis nahm. »Alain meint, dass die Araber an allem Unglück der Welt die Schuld tragen. Er glaubt, es sitzt in unseren Genen.«
»Hör zu: Ich habe deinen Sohn nicht verprügelt.« Alain starrte vor sich hin.
Rachid hob den Arm und wollte Alain eine Ohrfeige geben, damit dieser zur Besinnung kam.
»Das ist keine gute Idee«, sagte Ahmed. »Und Worte gehen bei ihm zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus.«
»Ich akzeptiere einfach nicht, für etwas beschuldigt zu werden, das ich nicht getan habe. Andere glauben vielleicht, dass er Recht hat.«
»Schon möglich.«
Rachid blickte verstohlen zu Ahmed. Wie konnte er nur so ruhig bleiben? Alain hatte schließlich auch ihn verdächtigt. Ahmed war ihm ein Rätsel. Er war eine Führungspersönlichkeit, kein Handlanger, so wie er. Woher stammte Ahmed? Warum hatte der Imam, der über vielfältige Kontakte verfügte, nichts über ihn herausbekommen können?
»Damit Alain seine Meinung ändert, braucht er schon eine Gehirntransplantation«, sagte Ahmed.