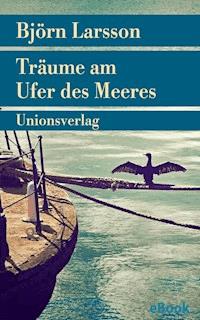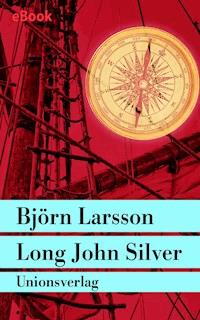11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine steife Brise fegt über die dänische Stadt Dragör hinweg, als ein finnischer Katamaran im Hafen anläuft. Der leidenschaftliche Segler Ulf hilft dem erschöpften Skipper Pekka beim Anlegen. Dieser übergibt ihm sein Logbuch, welches von einem mysteriösen Bund handelt: dem »Keltischen Ring«. Ulf beschließt, dieses Geheimnis zu ergründen und die Route des Skippers nachzufahren. Er und sein Freund Torben brechen auf, Pekka wird indes ermordet und der waghalsige Törn entlang der schottischen Küste wird bald zu einer lebensbedrohlichen Gefahr für die beiden Segler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
An einem stürmischen Abend hilft Segler Ulf dem Finnen Pekka beim Anlegen im Hafen. Daraufhin übergibt er ihm sein Logbuch, welches von einem mysteriösen Bund handelt: dem »Keltischen Ring«. Ulf beschließt, die Route des Skippers nachzusegeln. Der waghalsige Törn entlang der schottischen Küste wird bald zur Lebensgefahr.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Björn Larsson (*1953) ist Professor für Französisch in Schweden, seine Leidenschaft ist aber das Segeln, das er mit der Schriftstellerei verbindet. Im Sommer lebt er auf einem Segelboot. Björn Larsson wurde u. a. 2004 mit dem schwedischen Literaturpreis Östrabopriset ausgezeichnet.
Zur Webseite von Björn Larsson.
Jörg Scherzer ist als Übersetzer aus dem Dänischen, Norwegischen und vor allem aus dem Schwedischen tätig.
Zur Webseite von Jörg Scherzer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Björn Larsson
Der Keltische Ring
Ein nautischer Thriller
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen von Jörg Scherzer
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel Den keltiska ringen im Verlag Norstedts, Stockholm.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 im Berlin Verlag.
Originaltitel: Den Keltiska ringen (1992)
© by Björn Larsson 1992
Rechte vermittelt durch Nordin Agency AB, Sweden.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: thomasufer/photocase.com
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30954-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 23:25h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER KELTISCHE RING
1 – Es war der 18. Januar 1990. Eine steife …2 – Die Stadt lag noch immer in tiefer …3 – Als ich wieder auf der Rustica war …4 – Die ersten Eintragungen waren nicht sonderlich aufschlussreich …5 – Das Erwachen um die Mittagszeit des folgenden Tages …6 – Am 19. Januar 1990 um 21.00 Uhr legten …7 – Das ist Torben, meine Mannschaft«, erklärte ich Carsten …8 – Am nächsten Morgen wurde mir wieder einmal klar …9 – Ist dir nicht gut?«, fragte Torben, als er …10 – Ich mochte es mir einbilden, aber ich hatte …11 – Wir erwachten an einem klaren, windstillen Morgen …12 – Am nächsten Morgen schliefen wir lange, aber beim …13 – Was für eine Überraschung«, fuhr MacDuff mit barscher …14 – Als wir auf die Rustica zurückkamen, war es …15 – Genau das war die Frage. Es war recht …16 – Ich hatte gerade den Fuß auf den Boden …17 – Im Pub von Corpach saßen Torben und Junior …18 – Zwei Tage später verabschiedeten wir uns von Junior …19 – Wann war das?«, fragte O’Connell nach einer Weile …20 – Vorsichtig tastete ich mich auf dem Weg zurück …21 – Wir setzten die Sturmfock und legten zwei Reffs …22 – Ich starrte auf die Pistole, die neben ihm …23 – Die beiden Stunden vor dem Essen widmete ich …24 – Der Wind flaut ab«, sagte MacDuff nach einer …25 – In der Backbordkoje schlief ich unruhig oder überhaupt …26 – Setz mich an Land«, sagte Torben27 – Am nächsten Vormittag wachte ich mit drückenden Kopfschmerzen …28 – Als ich am Schiff ankam, holte Mary bereits …EPILOGMehr über dieses Buch
Über Björn Larsson
Über Jörg Scherzer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Björn Larsson
Zum Thema Dänemark
Zum Thema Schottland
Zum Thema Meer
Zum Thema Abenteuer
1
Es war der 18. Januar 1990. Eine steife Brise, die bisweilen Sturmstärke erreichte, fegte mit schweren Regenschauern von Südwesten heran.
Die Järnvägsgatan, eine Straße am Hafen von Limhamn auf der schwedischen Seite des Sunds, lag verlassen da, nur ab und zu spiegelte sich das Scheinwerferlicht eines Autos in Schaufensterscheiben und lag glänzend auf dem nassen Asphalt.
Mit dem Wind im Rücken ging es sich leicht. Die schwersten Böen schoben mich förmlich auf mein Ziel, den Fähranleger, zu. Nicht, dass ich es eilig gehabt hätte. An einem Donnerstagabend im ersten Monat des Jahres gab es keine Warteschlange, die Fähren legten halb leer ab. Und der Wartesaal war alles andere als einladend.
Obwohl mir Warten im Grunde nichts ausmachte. Ich hatte es allmählich gelernt, und manchmal gelang es mir zu vergessen, dass mir die Zeit ziemlich sinnlos durch die Finger rann. Ich war viel in Bewegung, aber das änderte nichts an dem Gefühl vergeudeter Zeit. Immer gab es etwas zu tun, etwas, was beendet werden musste und keinen Aufschub duldete. Und stets waren es andere, die mir Fristen setzten.
Meine Übersiedlung nach Dänemark war ein erster Versuch gewesen, dieser Tretmühle zu entkommen. Ich arbeitete aber weiter in Schweden, und nach wie vor war die Stechuhr das Maß meines Lebens. Ich pendelte nur immer hin und her, ich kam niemals irgendwo an.
Jahraus, jahrein war ich dreimal in der Woche über den Sund gefahren. Die einzige Abwechslung bestand in den unterschiedlichen Fährverbindungen, die ich benutzen musste, je nachdem, wo sich mein »Zuhause« gerade befand. Denn ich wohnte auf einem Segelboot, das in Häfen zwischen Helsingör im Norden und Dragör im Süden lag.
Den Winter über, wie jetzt, machte ich in Dragör fest, einem der wenigen Häfen, in denen das ganze Jahr über Leben herrschte. Lotsen, Fischer und Fähren, die zu jeder Jahreszeit fuhren, vertrieben mir die Einsamkeit. Im Sommer dagegen wechselten mein Schiff und ich ständig den Liegeplatz. Die Rustica, so hieß es, hatte keinen festen Heimathafen.
Für die Behörden hatte mein unstetes Leben mich zum »Grenzgänger« gemacht, zu einem, der in einem Land wohnt und in einem anderen arbeitet. Ich selbst hielt mich eher für einen Zugvogel, den man zu lange gefüttert hatte. Andere als Staatsgrenzen überschritt ich jedenfalls nicht. Dennoch hatten die tägliche Überfahrt und das Gefühl, ausgewandert zu sein, einen gewissen Reiz für mich, und gelegentlich ließ ich mich zu der Hoffnung verleiten, dass alles sich ein wenig verändert haben könnte, wenn ich die Fähre verließ und an Land ging. Natürlich wurde ich immer enttäuscht.
Immerhin war an diesem Abend eine kleine Neuigkeit zu erwarten. Die Fähre Ofelia war vollständig überholt und als Königin des Öresunds wieder in Dienst gestellt worden. Es war meine erste Fahrt auf dem umgebauten und in den Adelsstand erhobenen Schiff, und ich war neugierig darauf, wie es mir gefallen würde. Da ich vier dunkle Monate im Winterhafen von Dragör vor mir hatte, war das bei meinen ständigen Fahrten durchaus eine Frage von echtem Interesse. Wenn sich Eis bildete, konnte ich die Rustica nicht mehr in einen anderen Hafen mit einer anderen Fährverbindung über den Öresund verlegen.
Bis dahin hatten wir einen milden Winter gehabt. Im Dezember hatte es einige Tage geschneit, aber der Schnee war nicht liegen geblieben. Nur in einer Nacht war das Thermometer unter zehn Grad minus gefallen, sonst hatte es sich um null Grad bewegt. Grau war es gewesen, graue Luft mit viel Regen und Wind, und zweimal hatten wir Wind in Orkanstärke gehabt, der Flughafen Kastrup hatte 37 Sekundenmeter gemeldet. Am nächsten Tag waren die Anlegebrücken im Hafen überflutet gewesen, und ich konnte nicht an Land gehen. Kurz, wir erlebten einen typischen südschwedischen und dänischen Winter: feucht, rau, düster und trist.
Was sich rasch ändern konnte. Glaubte man den Fischern, konnte man erst nach dem 15. Februar sicher sagen, dass dies ein eisfreier Winter sein würde, und bis dahin war es noch ein guter Monat. In den letzten Tagen war das Wetter außerdem sehr wechselhaft gewesen, am Vortag schneidender Nordwind, nun eine feuchte Brise aus Südwest. Den ganzen Tag über hatte es geregnet, was darauf hindeutete, dass die Wetterfront uns bald passiert haben müsste und dass der Wind umschlagen würde nach West- oder Nordwest. Es lag eine Unbeständigkeit in der Luft, die mich nicht unberührt ließ. Nichts schien mir mehr sicher oder gewiss.
Ich war darum auch nicht sonderlich erstaunt, als ich zum Fähranleger kam und feststellte, dass der Warteraum völlig menschenleer war. Es war noch nie vorgekommen, dass ich der einzige Passagier war, aber bei meinen ungewöhnlichen Fahrzeiten hatte ich mir schon häufiger vorgestellt, dass der Fall eines Tages eintreten könnte. Ich fragte am Fahrkartenschalter, ob die zur Majestät gewordene Ofelia wirklich fahren würde.
»Wieso nicht?«, lautete die Antwort.
»Ich dachte nur. Wo sind denn die anderen?«
»Welche anderen?«
»Die Passagiere.«
»Wahrscheinlich kommen keine mehr«, sagte der Fahrkartenverkäufer. Seinethalben konnten die Fähren immer leer fahren.
Aber er hatte sich geirrt. Als der Zweite Steuermann meine Fahrkarte lochte, hörten wir rasche Schritte. Wir drehten uns beide gleichzeitig um, um uns den Nachzügler anzusehen. Ein großer Mann in mittleren Jahren, mit roten Haaren, in dunkler Seemannsjacke, Pullover und Gummistiefeln.
»Wartet ihr auf mich?«, fragte er auf Englisch. Dem Akzent nach stammte er aus Schottland oder Irland, dachte ich.
Ich sah den Steuermann an, der keine Miene verzog.
»Ich hab schon gedacht, ich hätte die ganze Fähre für mich allein«, antwortete ich.
»Wir sind die Einzigen?«, fragte der Mann.
Er griff in sein zottliges Haar und kratzte sich.
»Das Wetter ist schlecht«, sagte der Steuermann. »Da bleiben die Leute zu Hause. Sie und ein paar Fernfahrer sind die Einzigen.«
Der Fremde lächelte.
»Eine ganze Fähre für uns allein.«
Er ließ seine Fahrkarte lochen. Wie ich zufällig bemerkte, war es eine einfache Fahrt.
Hinter uns schlug die Tür zu.
»Kann ich dir Gesellschaft leisten?«, schlug er vor, und seine Worte hallten zwischen den Stahlwänden. »Wenn du nichts Besseres vorhast?«
»Nicht das Geringste«, sagte ich sofort.
Er sah aus wie ein Seemann oder ein Fischer. Aber etwas an seiner Haltung, an seiner selbstsicheren Art sagte mir, dass sein Platz eher auf der Brücke war als an Deck oder im Maschinenraum.
»MacDuff«, sagte der Fremde und hielt mir die Hand hin, während wir über den Steg gingen.
»Ulf«, murmelte ich.
»Schön, dich kennenzulernen, Ulf«, sagte er. »Wie wärs mit einem Bier?«
Mir fiel auf, dass er meinen Namen sofort benutzte. Mit Schweden und Dänen kann man Stunden verbringen, ohne zu sagen, wie man heißt. Und wenn man dann doch seinen Namen nennt, ist es keineswegs sicher, dass ihn irgendjemand behält.
Später habe ich begriffen, dass Namen in Schottland und Irland bedeutsamer sind als bei uns, was vielleicht auf eine tausend Jahre alte keltische Tradition zurückgeht. Die Anonymität war für die Kelten gleichbedeutend mit dem Tod, und einen Namen zu vergessen hieß, den zu töten, der ihn trug.
Ich schlug MacDuff vor, in den »Öresundskrug« auf dem Oberdeck zu gehen. Glaubte man den Zeitungen, so war er nicht umgebaut worden, sondern sah mit seiner Einrichtung aus rotbraunem Mahagoni und glänzendem Messing aus wie früher. Ein einsamer, einsilbiger Kellner war für die Bedienung zuständig. Er servierte uns je ein Sorte Guld, bekam sein Geld und ließ sich nicht mehr blicken.
MacDuff und ich sahen einander an.
»Wo kommst du her?«, fragte ich. »Aus Schottland?«
»Warum?«
Es war, als hielte er die Frage für nicht ganz harmlos. Mein erster Eindruck war, dass ich es hier mit einem Menschen zu tun hatte, der sehr auf der Hut war. Aber ich konnte mir das natürlich auch nur einbilden. Eine meiner vielen Schwächen war, dass ich oft zu früh zu viel zu wissen glaubte.
»Kommen nicht alle Macs aus Schottland?«, sagte ich. »Heutzutage nicht mehr«, sagte MacDuff, und es klang fast verächtlich.
»Dein Akzent ist jedenfalls weder amerikanisch noch englisch«, stellte ich fest.
»Nein, Gott bewahre. Ich bin Schotte. Geboren und aufgewachsen auf der Isle of Lewis. Falls du weißt, wo das ist.«
Ich nickte. Ich wusste es wirklich. Ich erzählte ihm, dass ich schon seit Jahren einmal nach Schottland segeln wollte und dass ich viele Stunden mit dem Studium von Seekarten und Lotsenbüchern von Schottland, den Hebriden und Irland zugebracht hatte.
Begeistert und mit aufrichtigem Stolz sprach MacDuff von den Hebriden. Nach seinen Worten musste dort das Paradies auf Erden sein. Sie waren seine Heimat, und es war unverkennbar, dass er wusste, wohin er gehörte und warum. Und ich, der niemals über irgendwelche Wurzeln verfügt hatte, weder geografische noch familiäre, beneidete ihn umso mehr, je länger er erzählte. Für mich waren mein Land und mein Volk, falls die Schweden ein Volk genannt werden können, nicht mehr als eine ferne Kulisse. Seit ich erwachsen war, hatte ich nur einige wenige Jahre in Schweden zugebracht. In meinem Leben gab es kein Heimweh, aber vielleicht doch das Gefühl, dass mir etwas fehlte. Und es mag sein, dass MacDuff mich mit seinen Schilderungen eben deshalb so fesselte.
Das war aber nicht der einzige Grund. Er war ein sehr intensiver Mann, und seine Ernsthaftigkeit faszinierte mich. Als ich ihn nach den Gewässern um die Hebriden fragte, stieß ich auf ein Wissen, das nur aus der Erfahrung stammen konnte. Er musste dort viel gesegelt sein. Aber als ich ihn fragte, ob er Segler sei, war es mit seiner Redseligkeit vorbei. Das alte Misstrauen schien plötzlich wieder aufgetaucht zu sein.
Ich setzte schnell hinzu, dass ich nicht aufdringlich sein wolle, aber da ich segelte und auf einem Segelboot wohnte, interessiere mich das natürlich. Als ich ihm dann von meinem Törn in die Bretagne erzählte und sagte, mein nächstes Ziel sei Irland oder Schottland, war meine Frage rasch vergessen. Halb im Scherz sagte ich sogar, in meinen Adern fließe wahrscheinlich keltisches Blut. Ich machte Andeutungen über meine Wurzellosigkeit und fügte hinzu, das einzige Land, in dem ich mich jemals heimisch gefühlt hätte, sei die Bretagne. Es mochte am Licht und an der Atmosphäre liegen, an der Mischung aus französischer Gefälligkeit und bretonischer Kargheit, an den Felsenküsten, dem Meer und meinem Gefühl, dass die Menschen dort eine Geschichte hatten. MacDuff lächelte nicht darüber. Er nahm mich ernster als ich mich selbst.
Von nun an blieb unsere Unterhaltung offen und mühelos, sie war über weite Strecken sogar vertraulich. Aber trotzdem gab es um MacDuff eine Sphäre, in die man nicht einzudringen wagte. Es glich einem Balanceakt, ihm einerseits nicht zu nahezukommen, aber doch die Vertraulichkeit zu wahren, die sich zwischen uns als den einzigen Gästen auf dieser Fähre eingestellt hatte. Immerhin fragte ich ihn, was ein Schotte mitten im Winter in Schweden zu suchen habe.
»Ich suche Unterstützung«, antwortete er und fragte, ob ich von dem geplanten Atomkraftwerk in Nordschottland gehört hatte. Das hatte ich nicht.
Die Engländer, sagte er, standen kurz davor, eines der schönsten Naturgebiete Schottlands mit vielen historischen Stätten zu zerstören. Aber das sei ja nichts Neues, fügte er hinzu.
»Und was hat das mit Schweden zu tun?«, fragte ich.
»Es geht um Formen des Widerstands«, sagte MacDuff steif. »Und damit habt ihr in Schweden Erfahrung. Schweden ist eines der wenigen Länder, die auf Kernenergie ganz verzichtet haben. Wir können von euch lernen.«
Da ich mich in dieser Frage auf bescheidene Weise selbst engagiert hatte, fragte ich, mit wem er denn in Schweden gesprochen hatte. Er nannte Namen, die ich noch nie gehört hatte. Und er schien die »Volkskampagne gegen die Kernenergie« überhaupt nicht zu kennen! Wenn ich ihn richtig verstand, hatte er nur wenige Orte besucht, und mir fiel auf, dass es sich ausnahmslos um Hafenstädte handelte. Seine Geschichte konnte natürlich trotzdem wahr sein – aber besonders glaubwürdig erschien sie mir nicht.
Er gab mir im Übrigen bald zu verstehen, dass wir über ihn und seine Angelegenheiten nun genug gesprochen hätten. Jetzt begann er mich auszufragen, wollte wissen, warum ich auf meinem Boot wohnte, in welchen Häfen ich in der letzten Zeit gelegen hätte und ob es in Skandinavien viele Leute gab, die lebten wie ich. Oder die mitten im Winter segelten. Viel zu erzählen hatte ich nicht. In den letzten drei Monaten hatte ich in Dragör gelegen, und die einzigen Wintersegler, denen ich begegnet war, waren ein paar Freunde gewesen, denen der Schiffsausrüster in Limhamn gehörte. Vorher war ich natürlich in den Häfen am Öresund herumgekommen und hatte viele Segler kennengelernt. MacDuff jedoch schien sich nur für Menschen zu interessieren, die im Winter segelten.
In dem Augenblick, in dem die Königin die scharfe Wende zur Einfahrt in den Hafen von Dragör machte, stellte sich denn auch heraus, dass MacDuffs Interesse im Grunde nur einer einzigen Person galt.
»Du bist nicht zufällig einem Finnen begegnet, der Pekka heißt?«, fragte er mit gespielter Beiläufigkeit.
»Schon möglich«, antwortete ich, vor allem um festzustellen, wie MacDuff darauf reagierte.
Mir war völlig gleichgültig, wer Pekka war und was MacDuff von ihm wollte. Aber sein auffälliges Interesse für den Finnen und seine verdeckte Art des Fragens zerstörte etwas von dem Vertrauen zwischen uns. Wie erwartet, erregte meine Antwort dieses Interesse mehr, als sich mit seinem gleichgültigen Tonfall vereinbaren ließ. Hastig teilte er mir mit, er sei Pekka vor nicht ganz einem Monat in Schottland begegnet, als dieser mit einem Katamaran in den Gewässern um die Hebriden gesegelt sei.
»Im November!«, rief MacDuff in einem Ton, der verriet, was er von solchen Wagnissen hielt. Zuletzt hätten sie sich in Oban gesehen, einer Stadt an der Westküste Schottlands. Pekka hatte gesagt, er sei auf dem Rückweg nach Finnland, durch den Kaledonischen Kanal, über die Nordsee und den Öresund. Er, MacDuff, habe alles getan, um Pekka dazu zu bewegen, bis zum Frühjahr zu warten, und es hätte nicht viel gefehlt und er hätte ihn mit Gewalt am Aufbruch gehindert. Vor allem, weil Pekka eine Frau an Bord hatte, eine Schottin, die er auf einer der Inseln aufgelesen hatte. Wenn Pekka nur sein eigenes Leben riskiert hätte, wäre das seine Sache gewesen, aber das Leben der Frau für nichts aufs Spiel zu setzen, das sei unverzeihlich.
In MacDuffs Stimme lag ein grollender Unterton. Pekka hatte versprochen, ein paar Tage zu warten, aber am nächsten Morgen war das Boot verschwunden. MacDuff hatte den Schleusenwärter in Corpach angerufen, mit dem er gut bekannt war. Aber dort war kein finnischer Katamaran durchgekommen. Einige Tage später war MacDuff ein Fischer aus Kirkwall auf den Orkneys über den Weg gelaufen. Pekka und die Frau waren um die Nordspitze Schottlands herum und durch den Pentland Firth gesegelt, den berüchtigten Sund zwischen Schottland und den Orkneyinseln, und sie hatten überlebt.
»Unverschämtes Glück«, war MacDuffs Kommentar. Dann hatten sie Kurs auf Skagen und die Einfahrt ins Kattegat genommen, allen Warnungen der Fischer zum Trotz. Wo sie sich jetzt befanden, wussten die Götter, vermutlich auf dem Grund der Nordsee oder auf irgendeiner jütländischen Sandbank. Bestenfalls.
»Hast du ihn in letzter Zeit getroffen?«, fragte MacDuff.
»Nein, hab ich nicht. Ich würde mich sicher erinnern. Einer wie der hätte einiges zu erzählen.«
»Allerdings«, sagte MacDuff scharf. »Dinge, die man lieber nicht erzählen sollte. Sonst versuchen andere so was auch und setzen ihr Leben aufs Spiel. Für nichts.«
Die Stimme des Kapitäns aus den Lautsprechern unterbrach ihn.
»Eine Mitteilung an unsere beiden Passagiere. Ich muss Sie bitten, über das Autodeck an Land zu gehen. Wir haben einen Stromausfall in Dragör. Wenn Sie hinaussehen, werden Sie feststellen, dass die Stadt völlig im Dunkeln liegt. Ohne Elektrizität können wir die Landungsbrücke nicht ausfahren. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Überfahrt, und ich würde mich freuen, Sie bald wieder auf der Königin des Öresunds begrüßen zu dürfen.«
Ich übersetzte für MacDuff, aber er begann schon zu lächeln, bevor ich damit fertig war, er hatte erraten, was der Kapitän gesagt hatte.
»Das nenn ich Service«, sagte er. »Wunderbar!«
Wir gingen über das Autodeck an Land. Man hatte für MacDuff und mich eine Planke ausgelegt. Der Erste Steuermann kam mit uns und achtete darauf, dass wir festen Boden unter die Füße bekamen. MacDuff ging ohne Zögern voraus; er war an schmale, wacklige Landungsstege offensichtlich gewöhnt. Auch ich hatte durch den schmalen Bug der Rustica eine gewisse Erfahrung und musste mir keine Gedanken darüber machen, wohin ich die Füße setzte.
»Seien Sie vorsichtig«, sagte der Steuermann, als wir an Land waren. »Es ist stockdunkel.«
So war es.
Man musste wissen, dass es hier einen Hafen gab, um die Konturen von Häusern und Schiffen ausmachen zu können. Für mich war es ungewohnt, mich im Dunkeln zu bewegen. MacDuff aber machte es offensichtlich nichts aus.
Ich fragte ihn, wohin er wollte. Einen Augenblick schien er zu zögern, dann sagte er, er wolle nach Kopenhagen.
»Komm doch auf ein Glas auf die Rustica«, lud ich ihn ein, und ich meinte es ernst.
Es wird viel von der »Liebe auf den ersten Blick« geredet, viel weniger dagegen von der »Freundschaft auf den ersten Blick«, von jener unmittelbaren Gewissheit, dass manche Menschen Freunde werden können, wenn Zeit und Umstände es erlauben. So ging es mir mit MacDuff an jenem Abend, als wir im Hafen von Dragör auf dem Kai standen – trotz seines übertriebenen Misstrauens.
MacDuff nahm die Einladung an.
»Aber vorher musst du mir den Hafen zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich arbeite als Lotse. Häfen interessieren mich einfach.«
»Wir können doch kaum was sehen«, wandte ich ein.
»Warte ein paar Minuten. Das Dunkel ist niemals völlig undurchdringlich. Irgendein Licht gibt es immer.«
Natürlich hatte er recht. Nach einiger Zeit konnte man die Umrisse der Boote, Fischereigeräte, der Kais mit ihren Gebäuden erkennen, und man ahnte das Wasser. Trotzdem bewegte ich mich vorsichtig. Der Kai war schlüpfrig, und die Wassertemperatur lag um null.
Ich deutete auf die wenigen Segelboote, die noch im Wasser lagen, äußerte meine aufrichtige Bewunderung für die Lotsen und berichtete im Übrigen alles, was mir über diesen Hafen bekannt war. Im Gegensatz zu dem, was er gesagt hatte, schien MacDuff nur mäßig interessiert, sah sich aber genau um.
»Ist das hier das einzige Hafenbecken?«, fragte er, als wir vor der Rustica standen. »Ich dachte, da wäre noch eins.«
»Es gibt noch einen kleinen Jachthafen.«
»Und wo ist der?«
»Wollen wir nicht lieber auf der Rustica einen Whisky trinken?«
»Erst der Jachthafen, dann der Whisky«, sagte MacDuff. Und schon war er unterwegs.
Ich wusste, dass es da nichts zu sehen gab. Nur ein paar Boote, keines davon bewohnt. Als wir jedoch am Kopf des Anlegers standen und das kleine Becken überblickten, deutete MacDuff auf die Konturen eines Bootes, das an einer Boje schwoite. Ein Katamaran.
»Was ist das für ein Boot?«, fragte er.
Ich begriff, warum er unbedingt auch den kleinen Jachthafen hatte sehen wollen. Er suchte natürlich Pekkas Boot. Mir kam der Gedanke, dass Pekka mit MacDuffs Frau durchgebrannt sein könnte. Vielleicht wurde ich zum Zeugen eines Eifersuchtsdramas.
Der Katamaran wurde nur für Regatten benutzt, erklärte ich, und lag schon seit drei Jahren in Dragör. In der Dunkelheit konnte ich nicht feststellen, ob MacDuff enttäuscht war. Jedenfalls kehrte er mit mir auf die Rustica zurück, auf einen Whisky, einen zehn Jahre alten Macallan, der ihn überraschte. Was immer er erwartet hatte, sicher nicht einen so guten Whisky auf einem schwedischen Boot.
Ich vergab ihm alles, als er begann, Gutes über die Rustica zu sagen. Zum Herzen jedes Menschen führt ein Weg. Meiner verlief über die Rustica, aber ich glaube nicht, dass MacDuff das bemerkte oder ausnutzte. Er meinte, was er sagte. Und das verlieh seinen Worten umso größeres Gewicht. Unter anderem nannte er die Rustica – ich entsinne mich deutlich – »ein Boot, auf dem man sich sicher fühlt«. Wenn ich heute daran denke, nach allem, was geschehen ist und vielleicht noch geschieht, dann erscheint es mir unvorstellbar, dass man sich jemals auf der Rustica sicher gefühlt haben soll.
Irgendwann gegen elf Uhr ging MacDuff. Ich begleitete ihn zur Bushaltestelle. Aber dort angekommen, beschloss er, zu Fuß nach Kopenhagen zu gehen. Ich riet ihm davon ab. Immerhin waren es gut sechzehn Kilometer bis zur Innenstadt. Bevor wir uns trennten, gab er mir seine Adresse und seine Telefonnummer in Inverness, und ich musste versprechen, ihn zu besuchen, wenn ich nach Schottland kam. Aber als ich ihn in der Dunkelheit verschwinden sah, war ich überzeugt, dass wir uns zum letzten Mal gesehen hatten.
2
Die Stadt lag noch immer in tiefer, stummer Dunkelheit, als ich durch Dragör zurück zum Hafen hinunterging. Meine Stiefel hallten trostlos auf dem Kopfsteinpflaster. Die schmalen Gassen mit den niedrigen gelben Häusern unter Reetdächern hatten normalerweise einen idyllischen Charme. Aber in dieser Nacht waren die Fenster nicht erleuchtet, und man konnte nicht in das gemütliche Innere der Stuben blicken wie sonst. Es war wie eine Geisterstadt. Nur hier und da kämpfte eine Kerze gegen die Dunkelheit. Ein ungleicher Kampf.
Ich ging an der Rustica vorbei bis an den Kopf des Piers. Der Wind war immer noch stark genug, um Fetzen aus den Schaumkronen der Wogen zu reißen und sie wie zerrissene Silberstreifen durch die Luft zu schleudern. Aber die Böen schienen mir in der Spitze Kraft zu verlieren. Draußen im Sund flimmerten und blitzten die Seezeichen, die Leuchtfeuer, Tonnen und Bojen – Drogden, Nordre Rose, Flinten und Oskarsgrundet. Ein Flugzeug setzte zur Landung in Kastrup an. Die Scheinwerfer warfen Lichtkegel auf den Pier, auf dem ich stand, trafen dann einen Frachter mit Kurs nach Norden. Ein hereinkommendes Flugzeug, ein hinauslaufendes Schiff – einer der Gründe, warum ich mich für Dragör als Winterhafen entschieden hatte, war, dass ich hier so oft an die Welt jenseits des Horizonts erinnert wurde.
In der Kajüte der Rustica war es warm und behaglich. Bevor ich die Petroleumlampe anzündete, stand ich einen Augenblick im Dunkeln. An der Kajütendecke spiegelten sich die Lichtreflexe aus dem kleinen Guckloch in der Ofenplatte. Das Loch war dazu da, um festzustellen, ob der Ofen brannte. Ich benutzte es nie. Die Lichtreflexe an der Decke genügten mir, um zu erkennen, ob er entrußt werden musste.
Der Ofen machte nie Probleme. Dies war ein alter, erprobter mechanischer Dieselofen von der Art, wie ihn die Fischer seit über fünfzig Jahren verwendeten. Er benötigte keine Elektrizität und hatte nicht einmal einen Docht, der ab und zu ausgewechselt werden musste. Er hatte zwei eiserne Ringbrenner, und die Ölzufuhr wurde mit einem einfachen Ventil geregelt, eine bewährte Konstruktion, die noch nie versagt hatte. Vier Winter hintereinander hatte der Ofen die Rustica wohlig warm gehalten, und ich hatte nicht mehr mit ihm zu tun, als ihn alle zwei Monate zu entrußen.
Ähnlich dankbare Gefühle hegte ich gegenüber meiner Paraffinlampe, einer dänischen Stelton, die über dem Tisch an der Decke hing. Sie war so zuverlässig, schön und funktional wie der Ofen. Ihre Form war modern, ihr Brenner legendär, und wenn man den Docht hoch herausschraubte, spendete die Lampe ebenso viel Licht wie eine Vierzig-Watt-Glühbirne, gratis dazu bekam man noch siebenhundert Watt Wärme.
Backbord hing mein zweiflammiger Kocher aus weißem Emaille, ebenfalls ein älteres Modell, das nicht mehr im Handel war. Er wurde mit Spiritus geheizt, weshalb sich der Brenner selten mit Ruß zusetzte. Neuere Modelle benötigen Petroleum, sie lassen sich schwerer anzünden und müssen umsorgt werden wie Kleinkinder.
Meine ganze Ausrüstung war so: einfach, funktional, schön. Auch mit meinem Schiff hatte ich Glück gehabt, sie war eine Rustler 31, die ich aus zweiter Hand gekauft hatte. Sie maß einunddreißig Fuß, war neun Fuß breit, hatte einen langen Kiel und war sehr widerstandsfähig. Gebaut worden war sie von Anstey Yachts in England. Die Rustica besaß die guten Segeleigenschaften aller solide gebauten, langkieligen Boote, das heißt alle außer Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit auf engem Raum. Ihre Einrichtung war konventionell. An Backbord die Pantry, an Steuerbord der Arbeitstisch. Zwei Kojen, Schrank und Toilette, die einander gegenüberlagen, und die Vorpiek, mein Schlafplatz. Die Einrichtung war in Esche statt wie sonst üblich in dunklem Teakholz gehalten. Bevor ich dauerhaft an Bord zog, wusste ich nicht, wie viel Licht das bedeutete. Im Sommer mag Teak eine warme, einladende Holzart sein. An regnerischen Novembernachmittagen aber lernt man weiß gestrichene Schotts und helle Holzflächen schätzen.
Mit der Zeit hatte ich mir feste Gewohnheiten zugelegt. Kam ich an Bord, sah ich zunächst nach dem Ofen und füllte wenn nötig Dieselöl nach. Dann nahm ich das Glas von der Paraffinlampe und trimmte vor dem Anzünden den Docht. Es dauerte eine Weile, bis die erste bläuliche Flamme ihren weichen Schein über die Kajüte der Rustica warf und dem hellen Holz einen goldenen Schimmer verlieh. Dann setzte ich Wasser auf und holte die Thermoskanne für den Kaffee hervor. Ich warf meine Aktentasche in die Ecke und machte mir was zu essen.
War der Kaffee fertig, legte ich mich, ein Kissen im Nacken, auf die Steuerbordkoje und las. An Werktagen machte ich abends selten was am Boot, außer vielleicht an warmen, hellen Frühjahrs- und Sommerabenden. Ich liebe die Einsamkeit, und mir macht es nichts aus, wenn sich außer mir nichts im Hafen regt. Deshalb war der Sommer nicht immer einfach, denn in der warmen Jahreszeit schien die Segler eine unbezähmbare Sehnsucht nach dem Mitmenschen zu überfallen. Schon im Frühjahr, wenn um die Rustica mehr und mehr Boote auftauchten, vermisste ich oft die Einsamkeit des Winters und den freien Horizont. Ich bin ein seltsamer Mensch, und nichts schenkt mir solchen Frieden wie ein Abend allein an Bord, im tiefen Winter und in der ausschließlichen Gesellschaft von Möwen, Wind und Wellen.
An diesem Abend aber wollte sich der Frieden nicht einstellen. Wer auf einem Boot unruhig ist, ist es doppelt. Im Sommer gibt es ein erprobtes Mittel dagegen – man legt ab und segelt hinaus. Aber im Winter, wenn einen jeden Tag das Eis einschließen kann? Wie ein Tier im Käfig geht man hin und her, der Weg beträgt nicht mehr als drei Meter in die eine wie die andere Richtung, und obendrein muss man noch den Kopf einziehen, weil die Stehhöhe zu gering ist. Unruhe an Bord ist ein schweres Leiden, weshalb fast alle Segler eine Flaute noch weit mehr als einen Sturm fürchten. Wenn die Unruhe bei Flaute auf See in einen kriecht, kann man nichts machen. Dafür gibt es kein Rezept.
An diesem Abend versuchte ich, mir mit den Handbüchern der Britischen Admiralität und mit Seekarten eine gewisse Erleichterung zu verschaffen. Im Lauf der Jahre hatte ich einen stattlichen Bestand gesammelt und konnte von Segeltörns auf fast allen Meeren dieser Welt träumen. In den Handbüchern konnte man sich über Wind und Gezeiten informieren, über Häfen und Ankerplätze, Routen und Riffe, alles im Licht von immerhin jahrhundertelanger seemännischer Erfahrung niedergeschrieben.
Ich griff zu NP 52, dem Küstenhandbuch für Nordschottland, und informierte mich über die Strömungsverhältnisse im Pentland Firth. Wie Pekka das überlebt hatte, überstieg mein Fassungsvermögen. Mitten im Sund, dort, wo die Strömung am stärksten ist, liegt eine Insel, Stroma. Sie besitzt keinen natürlichen Hafen und nicht einmal eine Bucht, in der man ankern könnte. Mit bis zu zehn Knoten schießt der Gezeitenstrom an den Klippen dieser Insel vorbei, schneller als die meisten Segelboote. Ich hatte keine Schwierigkeit, mir das kochende Wasser vorzustellen, die Brecher an den Felsen der Küste, steile, meterhohe Wogen, die aus dem Nichts kamen und sich ebenso schnell irgendwo wieder verloren, aber in ihrer kurzen Lebenszeit mit Leichtigkeit ein Schiff zum Kentern bringen konnten.
Es muss gegen ein Uhr nachts gewesen sein, als ich das Pochen eines Außenbordmotors hörte. Der Wind hatte nachgelassen, und zwischen Wolkenfetzen tauchte ab und zu ein Stern auf, manchmal auch der Mond, der einen zitternden Silberschimmer über das bewegte Wasser schickte. Dragör lag noch immer im Dunkeln.
Der Motor kam näher, wurde lauter. Ich stand auf und sah durch das Bullauge an Backbord. Einige der Freizeitfischer von Dragör hatten Außenbordmotoren, aber noch nie hatte ich sie so spät draußen gesehen, schon gar nicht bei solchem Wetter. Ich sah keine Positionslampen. Also kein Segelboot und kein Fischkutter, dachte ich.
Vor dem Kopf des Piers lief der nächtliche Besucher in das plötzlich aus einer Wolke heraustretende Mondlicht, das eine helle Spur aufs Wasser zauberte, als wollte es dem Schiff den Weg in den Hafen weisen. In dem Moment sah ich, was es war. Ein Katamaran.
Mein erster Gedanke war, die Lampe auszublasen, um besser sehen zu können oder um mich unsichtbar zu machen – beide Impulse waren gleich stark. Falls es Pekka war, würde ich mich verpflichtet fühlen, ihm von MacDuff zu erzählen. Zugleich hatte ich das hartnäckige Gefühl, dass ich das gerade nicht tun sollte.
Auf der anderen Seite war Pekka bei rauem Wetter draußen gewesen und wäre für ein wenig Hilfe beim Festmachen und eine Tasse Kaffee in der warmen Kajüte der Rustica sicher dankbar. Durchgefroren und erschöpft musste er sein nach der Fahrt durch den Öresund, bei starkem Südwind mit Böen in Sturmstärke. Um dann in einen Hafen zu laufen, der in tiefer Dunkelheit lag.
Deshalb hielt er auch Kurs auf die Rustica, wie mir jetzt klar wurde; das Licht, das durch ihre Bullaugen fiel, war das Einzige, was klar sichtbar war, wenn der Mond hinter den treibenden Wolkenmassen verschwand.
Er nahm unmittelbar hinter der Rustica, die an zwei Holzpollern lag, Fahrt weg und schaltete in Leerlauf. Eine seitliche Bö warf den Katamaran auf die Poller, er krachte in sie hinein, ohne dass dies den Skipper zu rühren schien. Steif und breitbeinig stand er im Cockpit, eine Hand am Ruder, und starrte zur Rustica hinüber. Ich sah, dass sich seine Lippen bewegten, aber seine Stimme drang nicht durch den Motorlärm und den in der Takelage heulenden Wind. Er trug eine Fliegermütze aus Pelz auf dem Kopf, die sein Gesicht beschattete, sodass Mund und Augen wie zwei schwarze Löcher in seinem bleichen Gesicht standen.
Der kalte Wind rüttelte an mir, als ich den Kopf aus der Luke steckte. Pekka, denn inzwischen war ich überzeugt, dass er es war, hob andeutungsweise einen Arm zum Gruß. Ich antwortete mit einer Geste.
»Ich brauch Strom«, rief er in unverkennbar finnischem Schwedisch. »Weißt du, wo ich Strom bekommen kann? Ich brauch unbedingt Strom«, seine Stimme war müde, gebrochen vor Erschöpfung.
Ich wies auf die gegenüberliegende Hafenseite. Seit der Sturm die Piers unter Wasser gesetzt hatte, war ich auch ohne Elektrizität, aber wenn er Glück hatte, funktionierte auf der gegenüberliegenden Brücke noch ein Anschluss, sobald die Stadt wieder Strom hatte. Dankend hob er die Hand. Als er sich bückte, um den Gang einzulegen, wäre er fast gestürzt. Er versuchte auch nicht, sein Boot von den Pollern abzustoßen, er gab einfach Gas. Ein knirschendes Geräusch war zu hören, als der Rumpf an Holz und Metall entlangrieb, dann zog er herum ins Hafenbecken.
Pekka brauchte Hilfe, das war offensichtlich. Als ich sah, dass er meine Handbewegung missverstanden hatte und am Lotsenkai festmachte, zog ich Ölzeug an und verließ das Schiff, um zu ihm hinüberzugehen. Auf dem Parkplatz des Strandhotels stand ein Auto mit eingeschalteten Parkleuchten. Ein Mann saß am Steuer, ein anderer stand neben der Beifahrertür und sprach in ein Sprechfunkgerät.
Ich ging auf den Pier hinaus. Pekka irrte dort herum und suchte nach einer Steckdose.
Ich trat zu ihm und erklärte ihm, dass er den Liegeplatz des Lotsenschiffes erwischt hatte. Das Schiff würde noch in der Nacht zurückkommen. Er starrte mich an, als spräche ich eine fremde Sprache. Ich wies auf den sich anschließenden Pier. Langsam wurde sein Blick klarer. Er packte mich am Arm. »Kannst du mir helfen?«, fragte er.
Er drückte noch fester zu, als wollte er seine Bitte unterstreichen.
Er zog mich mit sich, und ich folgte ihm an Bord. Ich sah, dass er sich an einer Wante festhalten musste, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Er glich einem Boxer, der sich nach einem schweren Treffer mühsam wieder hochrappelt.
»Woher kommst du?«, fragte ich.
»Anholt«, antwortete er knapp.
»Heute Nacht?«
»Ja.«
»Wars hart?«
Zunächst antwortete er nicht, dann sagte er: »Nein. Nicht so schlimm. Kein Eis zumindest.«
Er stand schwankend da, schien nachzudenken, dann brachte er mühsam hervor: »Ich hab eine Frau an Bord.«
Es klang, als spräche er von einem Anker oder anderen beweglichen Ausrüstungsteilen. Was er mir damit sagen wollte, weiß ich nicht. Vielleicht, dass es für sie hart gewesen war.
Er beugte sich über den Motor. Das war also wirklich Pekka. Und die Frau an Bord musste die Schottin sein, die er auf der Insel gefunden und in Lebensgefahr gebracht hatte. Die Frau, die er MacDuff vielleicht weggenommen hatte.
Ich stieß den Katamaran am Bug von der Kaimauer weg, und wir steuerten auf das benachbarte Hafenbecken zu.
»Willst du ein Bier?«, schrie er, um den Motor zu übertönen, der auf vollen Touren lief.
Ich nickte, obwohl ich eigentlich kein Bier wollte. Pekka rief etwas in die Kajüte hinunter. Einen Moment später tauchte in der Tür ein Frauengesicht auf. Sie blickte mit Augen zu mir auf, aus denen jedes Leben gewichen zu sein schien. Ich wusste nicht, ob ich etwas sagen sollte, aber der Blick erschreckte mich so, dass ich schwieg. Das Gesicht verschwand wieder, und dann kam die Frau mit zwei Bierdosen zurück, die sie wortlos auf den Niedergang stellte. Dann verschwand sie wieder.
»Mary«, sagte Pekka.
Wir liefen in das nächste Hafenbecken hinein. Ich deutete auf den Liegeplatz, den er ansteuern sollte, und er nahm das Gas zurück. Wir glitten langsam auf die dunkle Kaimauer zu, an der eine Schute lag. Er streckte die Hand aus. »Pekka«, sagte er. »Ich heiße Pekka.«
»Ich weiß.«
Er zuckte zusammen.
»Ich habe MacDuff getroffen.«
Pekka trat einen Schritt zurück. Die Müdigkeit war aus seinen Augen verschwunden.
»Wo?«, fragte er.
Ich sagte rasch, dass ich keine Ahnung hatte, wo MacDuff sich in diesem Augenblick befand, dass ich ihn nicht näher kannte, sondern nur zufällig kennengelernt hatte, aber dass er offenbar unterwegs sei in Richtung Norden, jedenfalls habe er das gesagt.
»Ich glaub nicht, dass er heute Abend noch hierher zurückkommt.«
Das schien Pekka ein wenig zu beruhigen. Er packte mich wieder am Oberarm und sah mich lange von der Seite an. Als wollte er seinen Blick in mein Gedächtnis eingraben.
»Es ist wichtig«, sagte er dann. »Willst du mir helfen?«
Ich nickte mechanisch. Was hätte ich auch sonst tun können.
Anschließend ging alles so schnell, dass ich mich nicht mehr genau daran erinnere. Im letzten Augenblick hatte Pekka wieder die Hand auf der Pinne und zog den Katamaran herum, ehe wir auf die Schute aufliefen, bei der wir längsseits gehen wollten. Trotzdem rammte Sula – so hieß der Katamaran – die Schute mit einem dumpfen Krachen. Ich war schon auf dem Weg nach vorne, kam ins Stolpern, konnte aber eine Leine packen, machte fest, ging nach achtern und schaltete den Motor aus. Was Pekka in dieser Zeit tat, weiß ich nicht, aber als ich mich aufrichtete, stand die Kajütentür offen. Zur gleichen Zeit sah ich, wie zwei Autos in langsamer Fahrt auf den Kai glitten, eine Polizeistreife und der Wagen, den ich auf dem Parkplatz gesehen hatte. Im nächsten Augenblick standen vier Uniformierte auf der anderen Seite der Schute.
Ich steckte den Kopf in den Kajüteneingang.
»Der Zoll ist hier«, sagte ich, »und die Polizei.«
Er fuhr hoch und kam auf mich zu, aber ich hatte gerade noch gesehen, dass er den Arm um die Frau gelegt hatte, die mit gebeugtem Kopf am Tisch saß.
Pekka sah auf die Frau zurück, dann blickte er mich noch einmal prüfend an. Im nächsten Augenblick drehte er sich um, öffnete die Luke zu einem Verschlag, dessen Vorhandensein man nicht erahnt hätte, und entnahm ihm einen in braunes Packpapier eingeschlagenen Gegenstand.
»Nimm das!«, sagte er. »Und geh!«
Ich zögerte.
»Du musst. Ich kann nicht mehr. Geh da raus und sag ihnen, dass du nichts mit uns zu tun hast und nur helfen wolltest.«
Ohne nachzudenken, stopfte ich das Päckchen in meine Öljacke und wandte mich zum Gehen. Noch einmal packte er meinen Oberarm und drückte so fest zu, dass es wehtat.
»Der Keltische Ring«, sagte er. »Ich trau dir. Irgendjemandem muss ich trauen.«
Das alles kann nicht länger als eine Minute gedauert haben. Ich kletterte auf die Schute und wurde von einem der Polizisten angehalten, während die anderen an Bord der Sula gingen. Gefragt, wer ich sei, gab ich an, dass ich nur beim Festmachen des Katamarans geholfen hätte und auf der Rustica wohnte, »da drüben«, wenn er mir nicht glaube, könne er den Hafenkapitän fragen. Gleichzeitig hörte ich, wie einer der Zöllner in sein Sprechfunkgerät sprach.
»Wir haben Kontakt«, sagte er. »Es handelt sich um einen Finnen und einen Schweden.«
Ich spürte das Misstrauen im Blick des Polizisten. Das war in meiner Situation nur natürlich. Schon tat es mir leid, dass ich gesagt hatte, ich »wohnte« auf einem Boot im Hafen. Das machte mich kaum glaubwürdiger. Es gab genug Leute, die das gar nicht für möglich hielten. Aber vielleicht verbesserte es meine Lage, wenn ich ihm meine frühere dänische Adresse gab: Oehlenschlaegersgade 77, zweite Tür rechts. Kein Schwede konnte eine solche Adresse einfach erfinden.
Als ich schließlich gehen durfte, erklärte mir der Polizist, man habe sie gerufen, weil das Boot ohne Positionslampen fuhr.
»Das ist nicht erlaubt«, sagte er und ließ mich gehen.
Was ich auch tat. Aber zuvor drehte ich mich noch einmal um und sah, wie Pekka zwischen drei Uniformierten im Cockpit seines großen Katamarans stand. Wieder hob er den Arm, zum dritten Mal in dieser Nacht. Diesmal hob er ihn höher, als wiege er nicht mehr ganz so viel.
Ich sollte Pekka nie wiedersehen.
3
Als ich wieder auf der Rustica war, machte ich kein Licht, sondern begnügte mich mit dem schwachen Feuerschein vom Ofen, der an der Kajütendecke tanzte. Das Boot schaukelte leicht, und es gab jedes Mal einen Ruck an den Leinen, wenn eine stärkere Bö übers Wasser kam. An der Art, wie die Rustica reagierte, erkannte ich, dass der Wind auf Westnordwest umgesprungen war. Ich versuchte, mich an den Wortlaut des Wetterberichts zu erinnern, bis mir einfiel, dass ich vergessen haben musste, ihn anzuhören. Das war ungewöhnlich. Der Wetterbericht war mein Lieblingsprogramm. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, den dänischen Bericht um zehn Minuten vor elf zu hören. Auf den schwedischen, eine Stunde früher, verzichtete ich meistens, weil ihm eine Abendandacht vorausging, die weder den Unterhaltungswert noch die Zuverlässigkeit des Wetterberichts besaß.
Ich stand eine Weile in der Kajüte der Rustica und lauschte. Ich versuchte, Geräusche von der anderen Hafenseite wahrzunehmen, ein anfahrendes Auto vielleicht oder Schritte, die sich auf der Brücke näherten. Ich war überzeugt, dass die Polizei sich nicht mit dem Gespräch auf der Schute begnügen und mir noch einen Besuch abstatten würde. Warum sollten sie mir meine Geschichte abnehmen, wenn sie Pekka für einen Schmuggler hielten?
Ich betrachtete das braune Päckchen, und plötzlich fiel mir ein, dass es Rauschgift enthalten könnte. Je länger ich dieses Päckchen anstarrte, umso zwingender wurde der Gedanke. Was, wenn die Polizei die Rustica durchsuchte und Rauschgift fand? Das würde allen Träumen von einem freien, unabhängigen Leben ein jähes Ende setzen. Ich hatte den Impuls, das Ding über Bord gehen zu lassen, aber dann besann ich mich. Hätte Pekka Schmuggelware an Bord gehabt, wäre er wohl kaum mit einem Motor herumgekreuzt, den man meilenweit hören konnte. Und nie wäre er in einen Lotsen- und Fährhafen wie Dragör eingelaufen, in dem es vor Beamten wimmelte.
Andererseits musste dieses Päckchen etwas enthalten, was er den Behörden verheimlichen wollte. Er hatte es mir fast in Panik in die Hände gedrückt, als Zoll und Polizei auf dem Pier auftauchten. Und er hatte eindeutig Angst vor MacDuff gehabt. Seine Entscheidung, mir zu vertrauen, hatte sicher mehr mit der Lage zu tun, in der er sich befand, als mit mir.
Ich nahm das Päckchen und verstaute es in meinem Geheimfach, wo ich die Originale meiner Schiffspapiere, einen zweiten Pass und eine kleine Schiffskasse in verschiedenen Währungen aufbewahrte. Als das erledigt war, wurde ich ruhiger und wartete auf das, was nun geschehen würde.
Eine ganze Stunde verging, ohne dass ich etwas hörte, von der Schiffsuhr abgesehen, die die Glasen schlug. Der Wind hatte sich weiter abgeschwächt, und alles war still. Darum war ich mir völlig sicher, dass das, was ich dann hörte, der Schrei einer Frau war. Unmittelbar darauf wurden Motoren angelassen, und zwei Wagen fuhren am Fährterminal vorbei und verließen den Hafen. Dann war wieder alles still.
Hätte es etwas geändert, wenn ich noch einmal zur Sula hinübergegangen wäre, um nachzusehen? Kaum. Ich habe sowieso immer geglaubt, dass es keinen Sinn hat, zurückzublicken. Wenn ich jetzt trotzdem zu Papier bringe, was damals geschah, dann nur deshalb, weil es noch immer geschieht. Was man getrost als Warnung verstehen kann. Ich entsinne mich der Worte MacDuffs, dass gewisse Geschichten besser nicht erzählt werden sollten. Er könnte recht gehabt haben. Aber wenn man Gewissheit will, muss man die Geschichte erzählen. Es gibt keinen anderen Weg.
Ich gestehe, dass ich nicht den Mut hatte, zur Sula zurückzugehen. Damit meine ich nicht die übliche Feigheit. Ich glaube sogar sagen zu können, dass ich ein ziemlich unerschrockener Mann bin, ich besitze eine gewisse Distanziertheit und Gelassenheit in Situationen, in denen andere leicht in Panik geraten. Vor allem auf See. Wenn es um Menschen geht, wird es schon schwieriger – vor allem, wenn sie Hilfe brauchen.
Ich wartete noch eine Viertelstunde, aber es war nichts mehr zu hören. Die Stille lastete wie eine Glocke auf dem dunklen Dragör. Schließlich zog ich die Vorhänge zu und zündete zwei Kerzen an, deren Schein die Kajüte nun, da ich so lange angestrengt in die Dunkelheit gestarrt hatte, unwirklich hell erscheinen ließ. Dann machte ich mir einen Kaffee, goss mir ein Glas Macallan ein und holte das Päckchen aus seinem Versteck.
Ich riss das Papier auf und hielt ein abgegriffenes, dickes blaues Logbuch in der Hand. Ich schlug die erste Seite auf: »S/Y Sula, Helsinki, Finnland«, stand in schwarzer Tinte auf dem weißen Papier. Ich befeuchtete einen Finger und fuhr damit über die Buchstaben. Die Tinte war wasserfest. Nur wer nicht weiß, welche Folgen es haben kann, wenn die letzte Logbucheintragung von den ersten Regentropfen eines Südwesters gelöscht wird, benutzt gewöhnliche Tinte auf See. MacDuff hatte angedeutet, dass Pekka ein leichtsinniger Verrückter war, der das Meer nicht fürchtete, weil er es nicht kannte. Aber Pekka hatte sein Logbuch mit wasserfester Tinte geführt, er hatte die Nordsee im Winter überquert, er hatte den Pentland Firth überlebt. Hatte MacDuff versucht, mich irrezuführen, wie er ja auch den wahren Grund seiner Anwesenheit in Skandinavien verborgen hatte? Gab es andere Gründe als Ignoranz und Draufgängertum, die Pekka dazu gebracht hatten, durch den Pentland Firth zu segeln? Was hatte ihn getrieben?
Ich begann zu lesen.
4
Die ersten Eintragungen waren nicht sonderlich aufschlussreich. Pekka war am 16. September in Helsinki aufgebrochen und hatte die Ostsee offenbar ohne besondere Ereignisse überquert. Er war nach Visby auf Gotland gesegelt und von dort bereits am nächsten Tag nach Hanö, einer kleinen Insel vor der Südostküste von Schweden. Auch auf Hanö war er nur über Nacht geblieben, dann war er nach Käseberga, weiter südlich auf schwedischem Festland, gesegelt. Dort hatte er einen Aufenthalt eingelegt, um sich Ales Stenar anzusehen, den bekannten steinzeitlichen Tumulus.
Auf der gegenüberliegenden Seite hatte er einen Zeitungsausschnitt mit einem Artikel über die englische Entsprechung von Ales Stenar, Stonehenge, eingeklebt. Der Artikel beschäftigte sich mit »Druiden« unserer Zeit, die jedes Jahr in Stonehenge die Sonnenwende feierten. Verschiedene »Druidenorden«, stritten offenbar um das Privileg, dort ihre jährlichen Zeremonien abhalten zu dürfen. Andererseits hätten sich einige Gruppen wegen der vielen Touristen in Stonehenge an abgelegenere heilige Orte zurückgezogen. Unter anderen, so hieß es, auf eine alte keltische Erdfestung in der Nähe von Northampton. Der Autor dieses Artikels behandelte die Druiden und ihre Rituale mit unverhohlener Ironie: Sie deklamierten Verse, trugen Fahnen mit sonderbaren Symbolen durch die Gegend, entzündeten ein Feuer in einem runden Kupferkessel.
Ein Foto zeigte ungefähr zwanzig Männer in weißen Umhängen, die um einen solchen Kupferkessel herumstanden, in ihrer Mitte ein zelebrierender Oberdruide. Auf mich wirkten sie lächerlich. Konnte das wirklich etwas mit diesem sogenannten »Keltischen Ring« zu tun haben? Ich dachte an Pekkas Angst, die alles andere als lächerlich gewesen war.
Von Käseberga führte seine Fahrt nach Gilleleje in Nordseeland. Pekka musste eine besondere Vorliebe für das Segeln bei Nacht haben. Jeder andere hätte es vermieden, mitten in der Nacht allein quer über den Öresund zu segeln, eine der meistbefahrenen Wasserstraßen dieser Welt. Tatsächlich enthielt das Logbuch verschiedene Eintragungen über Begegnungen mit Schiffen, die in einer nachlässigen, fahrigen Handschrift festgehalten waren – ein sicheres Zeichen für Müdigkeit.
Um 7.00 Uhr am folgenden Tag hatte Pekka in Gilleleje abgelegt, mit Kurs 275 Grad in Richtung des Mariager Fjords auf Jütland. Im Morgendunst war Hässelö in Sicht gekommen, und Pekka hatte notiert, die Insel sehe aus wie »in ein Geheimnis gehüllt«.
Ab Hässelö hatte die Sula einen guten südlichen Wind gefunden und war schnell vorangekommen. Den Mariager Fjord lief sie in der Abenddämmerung an, und Pekka hatte über die Einfahrt in den Fjord einige lyrische Worte gefunden, über den Sonnenuntergang und Kühe, die auf beiden Seiten der gewundenen Fahrrinne im abendlichen Zwielicht standen. Um 22.30 Uhr hatte er im Fischereihafen Hadsund festgemacht.
Er blieb einige Tage in Hadsund und machte Ausflüge zu verschiedenen Orten auf Jütland. Weitere Ausschnitte, diesmal aus Touristikbroschüren, waren im Logbuch eingeklebt. Einer handelte von einem Grabstein in der Kirche von Tommerby, der keltischen Ursprungs sein sollte. Ein anderer beschrieb den sogenannten Tollund-Mann, eine fast zweitausendjährige, erstaunlich gut erhaltene Moorleiche, die man 1946 im Moor von Borremose gefunden hatte. Der Mann war Opfer einer rituellen Erdrosselung gewesen, das Hanfseil lag noch immer um seinen Hals. Seine gepflegten Fingernägel ließen auf eine vornehme Herkunft schließen. Ich hatte vom Tollund-Mann schon früher gehört, nach dem Zeitungsausschnitt in Pekkas Logbuch aber besagten neuere Theorien, dass er wohl ein Druide gewesen sei. In dem Artikel hieß es, man habe in England eine Leiche gefunden, die einen ähnlichen Opfertod gestorben war.
Es war ganz offensichtlich, dass Pekka sich für Kelten und Druiden schon vor seiner Ankunft in Schottland interessiert hatte. Konnte dieses Interesse vielleicht sogar der eigentliche Grund für seine Fahrt gewesen sein? Kommentare zu den Ausschnitten fanden sich nicht.
Von Hadsund war Pekka nach Skagen gesegelt, und am darauffolgenden Morgen befand er sich auf der Nordsee. »Endlich auf dem Weg«, schrieb er, »auf See ohne Land am Horizont.« Die Sula hielt einen Kurs von 271 Grad, geradewegs auf Rattray Head zu, der Wind war günstig, Ost bis Südost. Die Aufzeichnungen im Logbuch wurden knapper. Erst als die Sula wieder unter Land kam, wurde Pekka mitteilsamer. Er beobachtete Vögel und fragte sich, wie weit sie wohl aufs Meer hinausflogen und ob es eine absolute Grenze gab, die sie nicht überschritten. Und wenn es die gäbe, woher sie wüssten, wann sie sie erreicht hätten. Dem schloss sich eine Überlegung zu unserem Bild der Grenze an. Der Gedanke einer absoluten Grenzlinie sei falsch, meinte er, man könne sie immer überschreiten, nichts sei wirklich begrenzt. »Das gilt auch für die Geschichte«, stand etwas weiter unten auf derselben Seite. »Alles lebt weiter und kann wieder auferstehen.«
Nach drei Tagen und 340 Seemeilen legte er im Fischereihafen von Fraserburgh an. »Nebel und Nieselregen«, schrieb er. »Die Sula und ich sind in Schottland.« Offenbar war aber damit das Ziel noch nicht erreicht. Bereits am nächsten Tag nahm er Kurs auf Inverness. Bei Mary Head geriet er in Sturmböen und legte zwei Reffs ins Großsegel. Nach seinen Aufzeichnungen der Segelwechsel ging es ihm darum, so bald wie möglich anzukommen. Am Rand der Seite fanden sich Berechnungen darüber, wie schnell er den Kaledonischen Kanal erreichte, wenn er verschiedene Durchschnittsgeschwindigkeiten zugrunde legte. Aber warum diese Eile? Alles deutete darauf hin, dass er zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein wollte. Das wurde auf der nächsten Seite bestätigt, wo es hieß:
»15 Meilen bis Urquhart Castle am Loch Ness, wo die Spur vielleicht beginnt. Es gibt einen neuen Goldenen Weg, davon bin ich überzeugt. Ich muss vor Samain ankommen. Dann werde ich es erfahren.«
Ich legte das Logbuch aufgeschlagen auf den Tisch. Zuerst Druiden, dann rituelle Opfer aus vorgeschichtlicher Zeit, und nun eine Goldene Straße und etwas, was er Samain nannte. Das passte alles nicht zu dem Eindruck, den ich von Pekka gewonnen hatte. Wann kam MacDuff ins Bild? Und Mary, die Frau? Ich goss mir Kaffee ein und las weiter.
Die Sula ging im Loch Ness, in einer Bucht nördlich von Urquhart Castle, vor Anker. Zum ersten Mal, seit er Hadsund auf Jütland verlassen hatte, hielt sich Pekka an einem Ort länger auf. Zwei Tage später jedoch lichtete er ohne erkennbaren Grund Anker und legte die zehn Seemeilen bis Fort Augustus am anderen Ende von Loch Ness zurück. Pekkas einziger Kommentar zu dem sagenumwobenen See lautete, sein Wasser sei schwarz. In Fort Augustus fuhr er durch die Schleuse und lief dann unter Motor weiter. Er passierte zwei weitere Schleusen und erreichte am selben Nachmittag Loch Lochy, den mittleren der drei Seen, die der Kaledonische Kanal miteinander verbindet.
Hier musste irgendetwas vorgefallen sein. Pekka hatte am Fuß eines Schlosses namens Invergarry Castle festgemacht. Es war die Rede von einer »Öffnung in der Erde« und von »der Gegenwart, die sich eingräbt, um ihre Wurzeln und ihre Zukunft zu verbergen«, und von heimlichen Vorbereitungen für »eine neue Ära in alter Gestalt«. Weiter unten auf der Seite las ich: »In König Artus’ Zeit waren es die einfachen Leute, die Heiden und Mystiker, die im Verborgenen lebten. Heute sind die Führer, die Könige, in den Untergrund gegangen und leben wie einfache Leute unter uns. Bald aber werden sie sich zeigen, wie es vorhergesagt wurde. Der König lebt in der Unterwelt. Der Goldene Weg ist wiederhergestellt.«
Ungläubig starrte ich auf die Logbuchseite. Ich litt selbst nicht gerade an einem Mangel an Fantasie. Ich konnte jederzeit eine gute Geschichte erzählen und auch noch selbst an sie glauben. Aber meine Geschichten blieben im Rahmen des Möglichen. Bei Pekka verhielt sich das offenbar anders.
Nach Invergarry Castle legte er erst wieder in Oban, der größten Stadt an der schottischen Westküste, einen Aufenthalt ein. Oban machte er dann offenbar zu seiner Basis. Von hier aus segelte er zu den umliegenden Inseln, meist nur für einen Tag, manchmal aber auch mit einer oder mehreren Übernachtungen.
Ich holte die Karte heraus und versuchte, die Orte zu finden, die er von Oban aus erkundet hatte. Einige fand ich ohne größere Schwierigkeiten. Kerrera genau gegenüber von Oban, die Garvellachs südlich von Mull, Duart Bay auf der Ostseite von Mull, Inch Kenneth westlich von Mull und Loch Breachacha auf der Insel Coll. Andere konnte ich nicht finden. Ich war mir jedoch gar nicht sicher, ob die Namen, die er nannte, überhaupt Ortsnamen waren, die sich auf Karten finden ließen. Einige Seiten weiter bestätigte sich meine Ahnung. Pekka hatte eine primitive Karte von Schottland und Irland gezeichnet, auf der er Burgen und historische Ruinen eingetragen hatte. Zwischen ihnen liefen gestrichelte oder gepunktete Linien, die diese Orte zu einem sonderbaren Muster verbanden. Ich folgte den Linien mit dem Finger, und mir fiel auf, dass sie ohne Unterbrechung durch ganz Schottland und bis nach Irland liefen.
Die Logbuchseiten wimmelten von kurzen historischen Kommentaren. Das meiste sagte mir nichts. Geschichte hat mich nie sonderlich interessiert, und von keltischer Geschichte wusste ich trotz meiner Besuche in der Bretagne sehr wenig. Selbst wenn ich mit meinem Freund Torben zusammen war, der sich – unter anderem – ausgiebig mit europäischer Geschichte beschäftigt hatte, war mein Interesse gering geblieben. Wie gesagt, ich neigte nicht dazu, zurückzublicken. Torben hätte vielleicht verstanden, was Pekka mit seinen Andeutungen hatte sagen wollen. Auf mich wirkte der Text des Logbuchs wie unbegreifliche, aus dem Zusammenhang gerissene Bruchstücke einer schlecht konstruierten Erzählung.