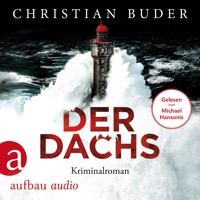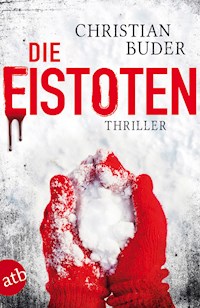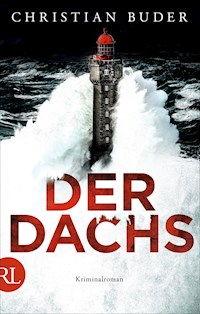
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Rau und mörderisch – die Bretagne.
Zwei Tote werden an die nordbretonische Küste geschwemmt: Flüchtlinge aus dem berüchtigten Lager in Calais »La Jungle«. Was zunächst nach Routine für Ronan Prad von der Gendarmerie Maritime aussieht, wird zu einem brisanten Fall, als ein verschollenes Segelschiff geortet wird. Obwohl man ihn warnt, beschließt Ronan, zu dem Schiff zu tauchen. Nachdem er bei dem Tauchgang knapp einem Anschlag entgangen ist, findet er im Rumpf des Bootes weitere Leichen. Seine Ermittlungen reichen weit in politische Sphären. Auf der Suche nach der Wahrheit muss Ronan nicht nur um sein Überleben kämpfen, sondern er stößt auch auf ein Rätsel seiner eigenen Geschichte: seine Frau, die vor Jahren beim Segeln auf dem Meer verschollen ist.
Ein Spannungsroman in der rauen Landschaft der Bretagne, ein packender Thriller und ein Gesellschaftsroman in Zeiten, in denen das organisierte Verbrechen auf der offenen Bühne der Politik spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Seit seine Frau Camille vor dreizehn Jahren spurlos auf dem Meer verschwand, ist Ronan Prad zum Einzelgänger geworden. Als ein Fischer spurlos verschwindet und die Marine ein verschollenes Boot am Grund des Meeres ortet, wird Ronan von der Gendarmerie in eine gefährliche Ermittlung hineingezogen. Nachdem er auf dem Tauchgang zu dem versunkenen Boot Tote im Rumpf des Schiffes entdeckt hat, entgeht er nur knapp einem Mordanschlag. Ihm wird klar, dass er es mit mächtigen Feinden zu tun hat. Der Bürgermeister einer Stadt, der sich von einer Handvoll früherer Fremdenlegionäre schützen lässt, setzt alles daran, um Ronan an der Aufklärung der rätselhaften Fälle zu hindern. Eine junge und ehrgeizige Polizistin wird in seine Einheit versetzt, was kein Zufall ist, denn auch sie hat offenbar etwas zu verbergen.
Im Flüchtlingslager Calais wird Ronan Zeuge eines brutalen Mordanschlags und findet heraus, wie eng das organisierte Verbrechen mit der Politik verstrickt ist. Seine Ermittlung wird zum Überlebenskampf, und seine Suche nach der Wahrheit führt ihn zurück in seine Vergangenheit und zum rätselhaften Verschwinden seiner Frau Camille.
Packend erzählt, mit authentischen Charakteren – so ist noch nie über die Bretagne geschrieben worden!
Über Christian Buder
Christian Buder wurde 1968 in Memmingen geboren. Er studierte zuerst Betriebswirtschaft und dann Philosophie in Marburg, Paris und Chicago. Als freier Autor und Journalist schrieb Christian Buder Artikel für DIE ZEIT und überregionale Zeitungen. Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern abwechselnd in Deutschland und in der Bretagne.
Im Aufbau Taschenbuch liegen seine Kriminalromane »Die Eistoten« und »Der Tote im Moor« vor. Außerdem erschien von ihm: »Schwimmen, ohne nass zu werden. Wie man mit Philosophie glücklich wird«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christian Buder
Der Dachs
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Motto
Widmung
Teil I
Wie die Dinge beginnen
Ronan
Ein Tag beginnt in Penec
AIS
Kazav
Teil II
Nord
Tiefe
Der Auftrag
Der Verteidiger
Teil III
Der Dachs
Point Nemo
Legion
La Jungle
Teil IV
Das Weiß der Wahrheit
Morvins Rückkehr
Eine Stadt verschließt sich
Herr und Knecht
Wie die Dinge enden
Danksagung
Glossar
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
On est toujours libre au dépens de quelqu’un.
(Albert Camus)
Man ist immer auf Kosten eines anderen frei.
Wir müssen überzeugt sein, dass das Wahre die Natur hat, durchzudringen, wenn seine Zeit gekommen, und dass es nur erscheint, wenn diese gekommen, und deswegen nie zu früh erscheint noch ein unreifes Publikum findet.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
Der Roman beruht auf wahren Begebenheiten.
Für meinen Vater
Teil I
Wie die Dinge beginnen
Die Ereignisse, die sich Anfang des Jahres 2014 in dem kleinen beschaulichen Ort Penec in der Bretagne zutrugen, hatten ihren Ursprung bereits Monate vorher, genau genommen begannen sie kurz vor Weihnachten 2013, an einem kühlen Montag, als alle Bewohner Penecs, die nichts Besseres zu tun hatten, zu Carrefour strömten, um sich für die Feiertage mit Pastis, tiefgefrorenem Truthahn, Escargots de Bourgogne, Krabben, Hummer und natürlich Rotwein einzudecken. Charlotte Morvan hatte ihre gesamten Rabattmarken eingelöst. Sie hatte zwei gefütterte Regenjacken gekauft, die ihr zwar zu klein waren, aber sie fasste die fünfzig Prozent Preissenkung als Vorsatz auf, vier oder fünf Kilo abzunehmen. Für Liz hatte sie ein Barbiehaus gekauft und für Tangi ein Schiffsmodell der Titanic, das schwimmfähig sein sollte. Gael gönnte sich eine Flasche Lagavulin, siebzig Prozent reduziert. Er hätte sich am liebsten zwei Flaschen gekauft, aber Charlotte ermahnte ihn, dass er dann vielleicht zu viel trinken könnte. Ihre Handys waren ebenfalls nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Technik schreitet voran, und der Verkäufer zeigte auf ein Schild: Zwanzig Prozent Nachlass beim Kauf eines iPhones und dreißig Prozent beim Kauf von zwei. Ihr Einkaufswagen war voll mit Kinderspielzeug, Ersatzscheibenwischern, Kriechöl im Sechserpack, einer kabellosen Brotschneidemaschine, einem Bewegungsmelder für den Garten, zwei iPhones im Original Apple-XMas-Karton und einem 195-Zoll-Flatbildschirm mit Kinosound, der so viel kostete wie ein Neuwagen. Das haben wir uns verdient, sagte sie zu Gael. Sie hatten ihre Einkäufe im Wagen verstaut, als Charlotte zu Gael sagte, sie wolle zum Mercedeshändler, obwohl sie eigentlich nicht vorhatte, ein Auto zu kaufen. Sie hatten Gaels Lieferwagen und den alten Volvo, dessen Federung in jeder Kurve ächzte, der sie aber überallhin brachte.
Wir könnten uns so ein Cabriolet leisten, sagte sie zu Gael und zeigte auf ein knallrotes Modell. Ein Verkäufer bemerkte Charlotte, wie sie mit ihrem Finger über den Rahmen strich. Fast als spräche der Wagen zu ihr, spulte der Verkäufer herunter, dass dieses Auto nicht nur ein Gegenstand war, sondern pures Lebensgefühl. Roadster GT S, 522 PS, Automatikgetriebe, Ledersitze … Gael schüttelte erst den Kopf. Doch diese Woche war Mercedes-Rabatt-Woche, auf alle Cabrios. Ratenzahlung möglich.
Also kauften Charlotte und Gael ihren Traumwagen, zwar gebraucht, den sie die nächsten fünf Jahre abzahlen konnten. Es lief ja gut. Gael hatte unglaubliche Fangquoten, die Preise für Hummer waren hoch, und die Nachfrage stieg. Wir können uns das leisten, sagte Charlotte wieder und küsste ihren Mann. Wozu lebt man eigentlich, wenn man sich nicht ab und zu etwas gönnte? An diesem Tag haben noch viele Menschen Autos gekauft, Waschmaschinen, Fernseher und Dinge, die sie nicht unbedingt brauchten. Nur hatte Charlotte Morvan an diesem Tag keine Ahnung, dass sie mit ihrer Unterschrift eine Kette von Ereignissen in Gang setzte, die sie nicht mehr aufhalten konnte.
Der Wagen stand seit einem Monat in ihrer Garage, als die Hummer ausblieben. Sie waren aus der Bucht verschwunden, so als wären sie einem fernen Ruf gefolgt. Barsch und Makrele ließen sich kaum mehr sehen. Dann verschwanden nicht nur der Hummer und die Seespinne, sondern auch die Fische.
Ronan
Der Defender holperte über Wurzeln und Felsen. Die alte Karre schluckte mehr Diesel als zwei Geländewagen aus der neuen Serie. Dafür hatte der Wagen keine Elektronik, keine elektrischen Fensterheber, keinen Schnickschnack, den die salzige Luft zersetzen konnte. Nichts ging über zuverlässige Mechanik. Ronan kuppelte kurz aus und schaltete an einem kleinen Hebel den Vierrad hinzu. Äste knackten, und der Wagen geriet in Schräglage. Der Waldboden federte nach. Es hatte geregnet, und die torfige Erde hatte sich mit Wasser vollgesogen. Die Antriebsräder schaufelten sich mit Mühe über den schlammigen Weg. Zehn Meter weiter und er würde im Schlamm feststecken. Ronan stellte den Motor ab. Den Rest musste er laufen. Vom Wegrand stellte sich ihm ein rotes Schild entgegen: Vorsicht Jagd.
Hunderte Wipfel stießen in den Kronen aneinander, ein melancholisches Geflüster düsterer Riesen. Die alten Eichen blickten seit zwölf Jahrhunderten über die Bucht, und einige Bäume waren schon Greise, als Karl der Große im Jahre 800 das bretonische Königreich zerschlagen hatte.
Ein Schuss hallte durch das Gehölz, danach zwei weitere. Großkaliber, wahrscheinlich Schrot. Dann, als Ronan Prad seine Flossen aus dem Wagen holte, noch ein Schuss, diesmal viel näher. Er sah sich um. Kein Jäger zu sehen. Eine leuchtendrote Neoprenweste zu tragen war noch kein Grund, nicht von einem neunzigjährigen Jäger aus Versehen erschossen zu werden. Ohne Leuchtweste hoffte er, erst gar nicht von einem der Hobbyjäger gesehen zu werden. Tradition nannten es die konservativen Nationalisten, Mord an Tieren die Tierschutzaktivisten, und für Ronan waren die Jäger einfach nur Dummköpfe mit Gewehren. Seine Gummistiefel sanken bis zu den Knöcheln in den Morastboden ein. Ein schmatzendes Schluuaap entstand, als er ein Bein aus dem Boden zog. Entfernte Schüsse verhallten, kamen wieder als Echo, Hundegebell, dann splitterte der Ast einer Kiefer, gefolgt von einem lauten Knall. Instinktiv duckte er sich und warf sich flach auf den Boden. Verdammtes Arschloch! Eine weitere Ladung zerfetzte die Rinde eines Baumes. Wenn er diesen Idioten in die Finger bekäme, dann würde er ihm seine Flinte in den Hintern schieben, aber nicht mit dem Lauf zuerst. Stimmen, unterbrochen von Hundegebell. Ronan blieb geduckt. Aus seiner Deckung konnte er nicht erkennen, ob es sich um schießwütige Jäger handelte, die das Unterholz mit Schrot durchsiebten, oder um jemanden, der es gezielt auf ihn abgesehen hatte. In beiden Fällen wäre er tot, wenn er nicht in Deckung blieb. Für einen Auftragsmörder, der sich als Jäger getarnt hatte, bewegte sich die erste Gestalt viel zu plump durch das Gestrüpp.
Ronan erkannte zwei Jagdhunde. Ein Jäger mit Leuchtweste tauchte hinter einem Stamm auf, und Ronan wäre auf ihn losgestürzt, um ihm das Gewehr aus der Hand zu reißen, wenn in diesem Augenblick nicht etwas Flaches gegen seine Beine geprallt wäre. Er verlor kurz das Gleichgewicht. Der Dachs hatte seinen Kopf zur Seite gedreht. Die schwarzen Augen blieben für zwei Sekunden auf ihn gerichtet, so als hätte das Tier entschieden, dass Ronan keine Gefahr für es darstellte. Die Hunde preschten heran. Sie waren kaum mehr als zwanzig Meter entfernt. Der Dachs wich nach links aus, drehte um und rannte auf Ronans Wagen zu. Die Heckklappe stand noch offen, und kaum hatte Ronan gedacht, was in den nächsten Augenblicken geschehen würde, war der Dachs schon auf den Sack seiner Schwimmausrüstung gekrabbelt und von dort im Kofferraum verschwunden. Einer der Jäger folgte der Fährte der Hunde, die nun auf Ronans Wagen zurannten. Die Hunde würden die Fährte des Dachses wittern, ihn aus seinem letzten Versteck zerren und zerfleischen. Ronan schlug die Heckklappe des Geländewagens zu.
Noch vor einigen Minuten war er lediglich auf dem Weg zum Schwimmen gewesen. Und jetzt plötzlich hatte ihn eine Gewehrkugel nur knapp verfehlt, stand da ein Jäger mit Leuchtweste, rannten zwei Jagdhunde auf ihn zu und saß ein Dachs in seinem Kofferraum.
»Einen Dachs gesehen?«, rief ihm der Jäger zu, während er sich nach allen Seiten umblickte und dann nach seinen Hunden pfiff, die vor der geschlossenen Heckklappe von Ronans Wagen hockten und bellten.
»Nur ein paar Wildwest-Clowns, die blind um sich ballern.«
»Jagdsaison«, erwiderte der Jäger.
»Ich habe wohl Glück, dass ihr nur auf Bäume schießt.«
Der Jäger hielt seine doppelläufige Schrotflinte leicht gesenkt, aber in Ronans Richtung und machte zwei Schritte auf ihn zu. Die Hunde kläfften gegen die Heckklappe und sprangen auf der Stelle.
»Mach den Kofferraum auf.«
Ronan verkürzte die Distanz zu dem Jäger.
»Nehmen Sie Ihre Hunde und verschwinden Sie.«
»Gewildert«, sagte der Jäger, »die Hunde riechen es … Aufmachen, sofort!« Er hob die Waffe. »Die Polizei kümmert sich um dich.«
»Sie kümmert sich gerade um einen Fall, in dem ein alkoholisierter und kurzsichtiger Jäger einen Beamten der Gendarmerie Nationale mit einer Waffe bedroht hat.« Ronan zog aus seiner Tasche seinen Dienstausweis.
Doch der Ausweis schien den Jäger nicht zu beeindrucken. Er fuchtelte vor Ronans Brust mit dem Doppellauf des Jagdgewehrs.
»Ich glaube, was wir suchen, ist in Ihrem Wagen.«
»Wenn es in meinem Wagen ist, dann sucht ihr es nicht.«
Abgelenkt von seinen Hunden vergaß der Jäger, dass Ronan nur noch eine Armlänge entfernt war. Mit einer schnellen Handbewegung drückte Ronan den Lauf zur Seite, packte das Gewehr und trat dem Jäger mit dem Fuß gegen die Brust. Ronan spürte, wie sein Fuß im Fettgewebe des Jägers versank. Die Leuchtweste flatterte, als der Mann nach hinten ins Moos fiel. Aus dem Gebüsch kam eine weitere Leuchtweste. Ronan richtete die Schrotflinte auf ihn.
Der Mann hob entwaffnend die Hände. Das Gewehr hatte er über die Schulter gehängt. Der ungesund rote Kopf des anderen Jägers war unverkennbar. Kazav, der Bürgermeister.
»… Daaaachs …«, hustete der Mann am Boden und deutete auf Ronans Wagen.
»Hooooo, nicht schießen«, rief Kazav und hob die Hände.
Der Mann am Boden rappelte sich auf, immer noch um Atem ringend.
»Wenn Ihr Jagdfreund noch einmal seine Waffe auf mich richtet, dann werde ich ihn jagen«, sagte Ronan in ruhigem Ton.
»Niemand wollte Sie bedrohen«, beschwichtigte Kazav, »es ist alles nur ein Missverständnis gewesen.« Kazav war Politiker, redete wie ein Politiker, dachte wie ein Politiker und war auch genauso verlogen wie ein Politiker. Von einem Missverständnis konnte überhaupt nicht die Rede sein. Ronan hätte den Jagdgenossen festnehmen können, nachdem er die Waffe auf ihn gerichtet hatte. Kazav pfiff nach den Hunden, die jedoch unbeirrt weiter die Heckklappe von Ronans Wagen ankläfften.
»Er hat den Dachs …«, rief der erste Jäger.
»Halt den Mund und verschwinde«, zischte Kazav seinen Jagdgenossen an, der seine Leuchtweste zurechtzupfte, als gäbe es dafür Kleidervorschriften. Der Mann zeigte auf seine Schrotflinte, die Ronan noch immer in der Hand hielt.
Ronan kippte den Lauf des Jagdgewehrs und nahm die verbliebene Patrone aus dem Doppellauf. Der Mann runzelte die Stirn, als er sah, dass Ronan die Patrone einsteckte. Glaubte er im Ernst, dass er ihm eine geladene Waffe zurückgab?
»Es ist gefährlich, während der Jagdsaison im Wald herumzuspazieren, dazu noch ohne Leuchtweste«, sagte Kazav und pfiff wieder nach den Hunden.
»Die Jagd sollte den Förstern überlassen werden«, meinte Ronan.
»Wir haben eine französische Tradition. Ich als Bürgermeister dieser Stadt pflege natürlich die französischen Werte und Traditionen …«
»Da bin ich froh, dass die Sklaverei nicht mehr zur französischen Tradition gehört.« Ronan ging zu seinem Wagen. Die Hunde knurrten ihn an, als er seine Sporttasche nahm.
Kazav pfiff wieder. Diesmal folgten die Hunde und trotteten davon.
»Der Dachs ist ein Schädling«, sagte Kazav, »wenn wir ihn nicht eindämmen, unterhöhlt er das Ufer, die Äcker …« Zufrieden, das letzte Wort gehabt zu haben, verschwand der Bürgermeister mit den Hunden im Gestrüpp. Sein Jagdgeselle hatte sich bereits verzogen, und Ronan war wieder allein im Wald, mit einem verängstigten Dachs im Wagen.
—
Ronan Prad über sich selbst:
Ich kann Menschen nicht ausstehen. Ich ertrage sie nicht. Daran ändert auch nichts, dass ich selbst zu ihnen gehöre. Ich bin nicht besser oder schlechter als die meisten von ihnen. Vielleicht liegt es an meinem Beruf, dass ich mir kein schöneres Bild von meiner Spezies machen konnte. Mein Vater sagte mir, ich hätte niemals zur Armee und erst recht nicht zur Polizei gehen dürfen. Das sei kein Beruf. Mein Vater hat mir nie verziehen, dass ich mich auf die andere Seite geschlagen hatte. Er war Strafverteidiger. Seine Klienten kleine Taschendiebe, Vergewaltiger, Trickbetrüger, kleine und große Mafiosi und solche, die noch welche werden wollten, korrupte Politiker und Polizisten. Manchmal frage ich mich, wer den Menschen besser kennt: derjenige, der das Schlechte in ihm verachtet, oder derjenige, der ihn verehrt. Mein Vater empfand sicher für einige seiner kriminellen Klienten so etwas wie Bewunderung. Im Staatsapparat gibt es nur Marionetten, sagte er. Niemand lebt dort, und wenn du einige Jahre für sie arbeitest, dann hast du an allen Enden deines Körpers Fäden, an denen Unbekannte ständig ziehen, und du merkst es nicht einmal.
Aber als ich mich entschied, zur Armee und nicht auf die juristische Fakultät zu gehen, war ich noch jung. Ich wusste nicht, ob es gut war und wie sich eine Entscheidung, die ich innerhalb weniger Minuten getroffen habe, später auf mein Leben auswirken würde, ich tat es einfach, weil es sich damals irgendwie gut anfühlte und ich vielleicht nur auf der Seite stehen wollte, auf der mein Vater nicht war. Vielleicht waren wir nur Spieler in ein und demselben Spiel. Während ich den Abschaum von der Straße holte und sie einsperrte, strengte mein Vater sich an, um sie wieder freizubekommen. Alle wesentlichen Gegensätze auf dieser Welt finden sich innerhalb einer Familie wieder.
—
16 h, steigende Tide. Höchststand 17.18 h. Koeffizient 93
Trieux. 48° 49‘ 20.9“ N 3° 041‘ 06.2“ W
Ronan wartete, bis das Gebell der Hunde verschwunden war, dann öffnete er die Heckklappe des Defenders. Der Dachs war über die umgeklappten Hintersitze in den Fußraum des Beifahrers geflüchtet. Er regte sich nicht, auch nicht, als sich Ronan einige Schritte entfernte. Erst als er die Beifahrertür öffnete, hob das Tier den Kopf, machte jedoch keine Anstalten, seinen Unterschlupf zu verlassen.
Dann eben nicht, dachte sich Ronan, ließ die Beifahrertür einen Spalt offen, nahm seine Flossen mit der Sporttasche und kletterte den steilen Weg durch die Granitfelsen zu einem Steinblock, der im Nebel nur seine Umrisse verriet. Die Uferlinie lag bei Flut noch zwei Meter unter ihm. Bei Ebbe klaffte dort ein Abgrund von neun Metern. Sanfte Wellen brachen sich an dem harschen Granit. Er stopfte seine Kleider in die Tasche, setzte sich auf die äußerste Felskante, zog seine Flossen an und stieß sich vom Ufer ab.
Der Nebel über dem Wasser bewegte sich zäh zwischen den schwarzen Felsen des Trieux. Die scharfkantigen Felsspitzen hätten genauso gut nur harte Bleistiftstriche auf feinkörnigem Papier sein können, wäre da nicht die Kälte des Wassers, die Ronan am ganzen Körper spürte. Die Muskeln in seinen Händen hatten sich verkrampft, sodass es seine Finger beim Kraulen auseinanderdrückte. Er schwamm bis zu dem Felsen, auf dessen anderer Seite die rote Fahrwassertonne stand. Ein Sockel aus Beton, darauf eine rote Eisenstange mit einem roten Viereck. Die Flut presste das Wasser in die Flussmündung. An den senkrechten Uferfelsen schäumten Wellenkämme. Verwirbelungen peitschten das Wasser auf. Wie zwei feindliche Armeen, die aufeinanderprallten, traf das Flusswasser auf das hereinströmende Meerwasser. Die Strömung war stärker, als Ronan gedacht hatte. Die Gezeitenkräfte des Mondes und der Sonne zogen das Wasser noch stärker als sonst gegen das Wasser des Flusses. Ronan stieß sich von einem Felsen ab, der knapp unter der Wasseroberfläche war. Die Strömung erfasste ihn sofort. Mit ein paar kräftigen Flossenschlägen korrigierte er die Richtung, um nicht zu weit in die Fahrtrinne gezogen zu werden. Mit einer kurzen Rolle nach vorn tauchte er ab. Lichtstrahlen verloren sich in der Tiefe des grünen Wassers. Er sah nicht weiter als vier oder fünf Meter. Die Strömung wirbelte den Boden auf. Algenfetzen und Reste von Plastiktüten trieben an ihm vorbei. Er trieb neben den meterlangen Pflanzen im Wasser. Der Trieux war an dieser Stelle mehr als zwanzig Meter tief. Ronan atmete ein wenig Luft aus und ließ sich weiter in die steile Felsenschlucht sinken. Die Strömung drückte ihn mit den Algenteppichen in die Flussmündung hinein. Der Wasserdruck schmerzte in seinen Ohren. Zweimal machte er einen Druckausgleich, hielt sich die Nase zu und presste Luft aus seiner Lunge in seine Ohren. Die Sicht verringerte sich. Er war ungefähr zehn Meter tief, als ein Felsen vor ihm auftauchte. Ronan griff nach der Spitze und hielt sich an ihr fest. Er spürte noch heftiger, wie die Strömung an ihm zerrte. Er konzentrierte sich auf seinen Herzschlag. Die Kälte verlangsamte seinen Herzrhythmus. Einundzwanzig, zweiundzwanzig … Bevor er tiefer ging, musste er noch ruhiger werden. Er stieß sich von der Felsspitze ab. Er konnte nicht sehen, wie weit er abgetaucht war. Die Tiefe spürte er nur an der Druckveränderung in seinen Ohren. Nach zehn Metern nahm der Umgebungsdruck um ein Bar zu. Durch die Komprimierung der Lunge und das Zusammendrücken des ganzen Körpers sank auch der Auftrieb seines Körpers. Er brauchte immer weniger Kraft, um nach unten zu kommen, und nach dreißig Metern würde er von selbst absinken. Von der Oberfläche kam kein Licht mehr durch. Im Schein der Tauchlampe trieben schwerelos abgerissenes Seegras, Inseln von Algen und Plastiktüten durch das grüne Universum wie unbewohnte Planeten auf einer unbestimmten Umlaufbahn. Ronan hielt sich mit wenigen Flossenschlägen über dem Graben. Die Strömung schob ihn weiter in den Trieux. Ungefähr fünf Meter unter ihm sah er die scharfen Konturen eines Flügels mit Triebwerken. Die Propeller waren beim Aufprall des Bombers abgerissen. Das Wrack der B-25 war jetzt unter ihm. Rumpf und Cockpit waren klar erkennbar. Der Schlamm hätte das Wrack schon längst völlig bedeckt, doch der Wechsel von Ebbe und Flut, der das Meer hin und her zog, verhinderte sein Verschwinden. Ein Grab, das sich gegen das Vergessen wehrte, dachte sich Ronan. Die Deutschen hatten den amerikanischen Bomber von einer Flakbatterie am Eingang des Trieux abgeschossen. Die Piloten und vier weitere Besatzungsmitglieder starben damals im Winter. Zwei Piloten konnten Fischerboote noch aus dem Wasser ziehen. Doch das kalte Wasser war zu dieser Jahreszeit so tödlich wie die deutsche Flak. Was der Aufprall nicht schaffte, erledigte die Kälte. Die Leichen der anderen Besatzungsmitglieder blieben festgeschnallt in ihren Sitzen am Grund, so lange, bis die Fische ihre Arbeit erledigt hatten. Nur ein junger Offizier überlebte. Er wurde beim Aufprall herausgeschleudert und konnte sich auf einen Felsen retten. Neben der Kirche stand heute ein Gedenkstein mit den Namen und Dienstbezeichnungen der Toten. Paul Albrights Name war nicht auf der Stele zu lesen, obwohl er nie in seine Heimat nach Oregon zurückgekehrt war.
Ronan spürte, wie sein Körper Sauerstoff verlangte. Sein Körper schrie ihn an, dass er auftauchen solle. Er ließ sich weiter absinken. Je enger die Schlucht wurde, desto schneller trieb ihn die Strömung tiefer in den Trieux. Die Konturen des Flugzeugs verschwanden aus seinem Sichtfeld. Ein Hummer suchte den Schutz eines Felsvorsprungs. Ein großes Tier mit mehr als vierzig Zentimetern. Aus seiner Deckung streckte es abwehrend seine Scheren in Ronans Richtung. Große Hummer hatte er schon seit Jahren nicht gesehen. Erst recht nicht im Flachwasser. Die Hummerexemplare, die Erwan seinen Gästen im Capelan servierte, waren noch Jungtiere. Im Flachwasser hatte ein Hummer kaum eine Chance, älter als drei oder vier Jahre zu werden. Sein Pech war es, als Spezialität auf den Speisekarten zu stehen, und weil sich sein Fleisch so gewinnbringend verkaufen ließ, jagten ihn Berufs- und Hobbyfischer gleichermaßen unerbittlich. Niemanden interessierte es, dass ein Hummer länger als eineinhalb Meter werden und mehr als zwanzig Kilogramm wiegen konnte. Am verblüffendsten war jedoch sein Alter. Die größten Hummer schätzte man auf über hundertvierzig Jahre. Der Hummer war ein Wunder der Evolution. Im Grunde alterte er nicht. Telomerase – ein Phänomen, bei dem Zellen sich verjüngten. Je älter ein Hummer wurde, desto stärker und fruchtbarer wurde er. Es gab Wissenschaftler, die glaubten, dass es in den Tiefen der Ozeane Hummer gab, die schon mehrere Tausend Jahre alt waren. Tiere von mehreren Metern, versteckt in der Finsternis der Tiefsee. Ihre Zellen erneuerten sich endlos, was dazu führte, dass sie kontinuierlich wuchsen. Einige Wissenschaftler nahmen an, dass der Hummer nicht an seinem Alter starb, sondern daran, dass sein Panzer nicht mehr mitwuchs. Die Erneuerung seines Außenskeletts kostete den Hummer zu viel Kraft, sodass sie schließlich in ihre Körper gepresst wurden und am Ende ihres Lebens an Krankheiten starben oder in ihrem eigenen Skelett zerquetscht wurden. Andere Wissenschaftler glaubten, dass der Wachstumsprozess ab einer kritischen Größe nur noch minimal sein würde und es somit Tiere gab, die ohne Schwierigkeiten Jahrtausende überdauern konnten.
Ronan ließ den Hummer hinter sich und schwamm langsam nach oben. Über ihm war schon der Spiegel der Wasseroberfläche. Drei, zwei Meter, dann tauchte er auf. Der Nebel war dichter geworden, so als wäre die gesamte Schöpfung ausgelöscht. Er trieb auf der Wasseroberfläche. Der gezackte Rücken eines Felsens zehn oder fünfzehn Meter vor ihm, dann lösten ihn die Schwaden auf, als wäre er nur eine flüchtige Illusion. Die Rückabwicklung der Evolution im Zeitraffer, bis nichts mehr blieb als weißes Rauschen. Am Ende erlosch auch das Rauschen.
Ronan orientierte sich an der Strömungsrichtung. Mit kräftigen Flossenschlägen steuerte er gegen die Wassermassen, wobei er einen Winkel von fünfundvierzig Grad einschlug, um gegen die Strömung anzuschwimmen. Die schwarzen Felsblöcke am Ufer zeichneten sich ab. Der Nebel schien sich zu verflüssigen und gab Meter für Meter Felsen frei, gelbrote Flechten kletterten wieder zurück in den Lauf der Evolution, dann kamen schlierige Algen in den Felsspalten, Gräserbüschel, dahinter Baumwurzeln, die zu den Eichen am Schluchtrand gehörten, einige Boote und Bojen. Ronan kraulte die restlichen fünfzig Meter zum Ufer. Als er mit den Händen den Sandboden berührte, drehte er sich auf den Rücken, zog seine Flossen aus und stieg aus dem Wasser. Flossen und Taucherbrille waren die einzigen Kleidungsstücke, die er getragen hatte.
Eine junge Frau stand neben seinem Handtuch. Sie trug die Uniform der Gendarmerie.
—
»Lieutenant Marie Blanc, Dienstnummer …«
»Sie sind die Neue«, sagte ihr der Mann vor ihr, der seinen Kopf hinter einem Stapel vorstreckte und dessen Name sie nur von der Internetseite der Gendarmerie Maritime von Penec kannte. Auf der Fahrt von Saint-Malo nach Penec hatte sie sich verschiedene Szenarien überlegt, wie sie sich vorstellen sollte. Ich bin Marie Blanc … oder nur Marie oder förmlicher Lieutenant Blanc. Ihre Versetzung hatte die Gendarmerie Maritime in Brest in einem Fax angekündigt. Man erwartete sie bereits. Sie malte sich aus, wie ein junger Anwärter sie zum Dienststellenleiter bringen würde. Capitaine Prad. Prad würde sie durch das Gebäude führen und den Kollegen vorstellen. Prad würde ihr einen leeren Schreibtisch zuweisen, auf dem ein Schild mit ihrem Namen stand. Von ihrem Platz aus hatte sie einen Blick aufs Meer. Vor ihren Augen sah sie, wie Prad sie in sein Büro zitierte und dass sie die Kollegen einzeln begrüßen würden. Sie hatte jedoch nicht mit einem Mann gerechnet, der ihr nicht einmal die Hand reichte und ihr das Gefühl gab, dass sie ihn bei seinem Mittagsschlaf störte. Die Neue. Er musterte sie von oben bis unten und hatte sie mit den Augen an- und ausgezogen.
»Können Sie mich bei Lieutenant Prad melden?«
»Noch nicht da.«
Die dreistündige Fahrt durch den dichten Nebel war angenehmer als das abgehackte Gespräch mit einem Mann, dem ganze Sätze zu anstrengend waren und den sie aus der Dienststellenbeschreibung unter dem Namen Loig Dagorn kannte. Dienstgrad, Dienstjahre, ein veraltetes Passfoto und die Funktion, was mehr oder weniger der Dienststelle entsprach, hatte sie offiziell herausfinden können. Etwas anderes war die Akte des Dienststellenleiters Ronan Prad. Seine Akte war unter Verschluss, und was sie vor ihrer Fahrt durch den Nebel über ihn erfahren konnte, bestand aus Gerüchten und Informationen, die sie in der Presse hatte finden können.
»Wo kann ich ihn finden?«
»Warten Sie hier auf ihn.«
»Ich bin drei Stunden lang im Schritttempo durch den Nebel gefahren, mit dem letzten Tropfen Benzin und ohne heute Morgen richtig gefrühstückt zu haben, ohne Kaffee, und das nur, weil ich in dieses … diese Stadt versetzt worden bin.«
»Sagen Sie ruhig Nest oder wie wir Bretonen Penec nennen: die Rose am Arsch der Welt.«
»Der Nebel macht einen fertig.«
»Gehört zur Nordküste der Bretagne wie die Stürme.«
»Wann kommt Capitaine Prad?«
»Sie müssen nicht auf ihn warten. Ich sage ihm, dass Sie hier sind.«
»Ich würde mich gerne selbst vorstellen.«
Loig Dagorn lehnte sich zurück, legte die Aufstellung seiner Überstunden beiseite und schaute Marie wie ein Fotograf an, der die beste Aufnahme für den Playboy suchte.
»Er weiß, wer Sie sind.«
»Sie wussten nicht einmal meinen Namen.«
»Bis ich mir Ihren Namen gemerkt habe, werden Sie schon befördert und woanders hin versetzt.«
»Vielleicht bleibe ich auch.«
Dagorn lächelte. Guter Witz, den er nicht weiter zu kommentieren brauchte. Niemand blieb freiwillig in einer Außenstelle der Gendarmerie Maritime, die jedes Jahr bei der Budgetplanung des Innenministeriums, dem die Gendarmerie unterstellt war, auf der Liste der überflüssigen Kostenstellen aufgeführt wurde. Dass Capitaine Prad mit dem Papierkram auf Kriegsfuß stand und die jährlichen Bedarfsformulare entweder nur flüchtig oder gar nicht ausfüllte, brauchte niemand zu wissen, erst recht nicht die Neue, deren Eifer auf Dagorn wirkte wie der zwanzigste Kaffee am Abend.
»Richten Sie sich erst einmal ein, führen Sie Telefongespräche … Rufen Sie Ihren Mann an, sagen Sie …«
»Ich bin nicht verheiratet.«
»Dann Ihren Freund oder Ihre Mutter.«
»Ich habe keinen Freund, meine Eltern sind tot …«
»Das tut mir leid … Ich meine nur, dass Sie sich erst einmal Zeit nehmen sollten, um anzukommen.«
»Ich bin angekommen.«
»Ich meine das im übertragenen Sinne. Ruhen Sie sich aus, schlafen Sie sich aus oder nehmen Sie eine Dusche.«
»Wollen Sie damit andeuten, dass ich eine Dusche brauche?«
»Hören Sie, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, als mich um Ihren Dienstplan zu kümmern …«
»… wie zum Beispiel die Liste Ihrer Überstunden zu erstellen.«
»Wenn Sie Ronan von seiner guten Seite kennenlernen möchten, dann sollten Sie einen Gang runterschalten und einfach mal machen, was man Ihnen sagt. Nur ein gut gemeinter Rat.«
»Was muss ich noch über Ihren Chef wissen?«
»Ich arbeite seit neuneinhalb Jahren mit ihm zusammen, und ich würde nicht behaupten, dass ich ihn wirklich kenne.«
»Sie meinen den Teil seiner Dienstakte, der unter Verschluss ist … seine Zeit beim Militär.«
»Sie wühlen gerne in Archiven …«
»Internet heißt das heute.«
»Wir sind hier in Penec, aber nicht hinterm Mond.«
Marie rümpfte die Nase und war zufrieden damit, sich nicht von diesem Rüpel, dem die Haare aus der Nase wuchsen, unterkriegen zu lassen.
»Noch ein guter Rat: Wühlen Sie nicht in der Vergangenheit von Kollegen, vor allem, wenn der Kollege Ihr Chef ist.«
»Ich bin gerne auf dem Laufenden.«
»Seien Sie einfach nett, nehmen Anzeigen von gestohlenen Hummerfallen oder Außenbordmotoren auf, gewöhnen Sie sich an den Kaffee aus dem Automaten, und lächeln Sie, wenn der Präfekt vorbeischaut.«
Wie konnte es anders sein. In einem Hinterwäldlernest gab es Hinterwäldler, die hinterwäldlerisch dachten und hinterwäldlerisch redeten. Marie Blanc hatte noch mehr Worte hinter ihrer Stirn wie »frauenfeindlich«, »Chauvinistenschwein«, doch sie nahm die Gelegenheit wahr und ging zum Kaffeeautomaten. Fünfzig Cent. Sie musste das Geldstück dreimal einwerfen, bis der Automat es behielt. Schwarz, mit Milch, ohne Zucker, extra Zucker. Sie drückte auf Schwarz und wartete, dass der Pappbecher sich füllte. Sie nippte an dem Becher. Gerade so, dass ihre Lippen den Geschmack erahnen konnten, der sie eher an aufgeweichten Karton und Plastik erinnerte als an Kaffee.
»Ich habe über die Sache mit Lieutenant Prads Frau gelesen«, sagte sie und stellte den heißen Becher auf den Tisch.
»Es gibt Dinge, die Sie nicht ansprechen sollten.«
»Es existiert ein Aktenvermerk. Segelunfall. Die Frau …«
»Der Unfall ist so ein Thema, das Sie lieber auslassen sollten.«
Dagorn suchte eine Formulierung, die sich besser anhörte, fand aber keine andere als: »Es sei denn, Sie wollen sich gleich von Anfang an als Arschloch vorstellen.«
»Verdrängung ist auch eine Form der Verarbeitung.«
»Nur ein gut gemeinter Rat.«
»Schon der zweite …«
—
Loig widmete sich wieder seiner Überstundenliste, die sein Leben mehr beeinflusste als irgendein Neuling, den ihnen die regionale Zentrale in Brest schickte. Die Mitteilung aus Brest lag sicherlich auf Ronans Schreibtisch, in einem der überfüllten Pappkartons, auf denen »unerledigt« stand, und wie immer hatte Ronan kein Wort darüber verloren, dass Brest eine junge Polizistin schickte. Er tippte Ronans Nummer auf dem grauen Diensttelefon, dessen mechanische Tasten sich nur schwer betätigen ließen, und die 8 ließ sich zwar drücken, sprang aber erst nach ungefähr drei Sekunden wieder zurück. Die Folge eines Kaffeetassenunfalls mit extra Zucker.
Das Geräusch des Verbindungsaufbaus, zweimal, dann brach die Verbindung ab. Loig rüttelte an dem Kabel. Der Wackelkontakt verschwand. Er wählte die Nummer noch einmal. Die Verbindung hielt, doch sobald er das Kabel losließ, war das Signal weg. Vor zwei Jahren hat er ein neues Telefon angefordert, genauso wie einen neuen Computer, der aus derselben Zeit wie das Telefon stammte. Die Bildschirme nahmen den Platz auf dem ganzen Schreibtisch ein, und der Monochrommonitor flimmerte so stark, dass man nicht länger als eine halbe Stunde davor sitzen konnte, ohne einen Augenkrampf zu bekommen. Aus Brest hieß es, dass ein neues Telefon nicht nötig sei, weil in Kürze die gesamte Dienststelle modernisiert werden würde. Neue Schreibtische, ergonomische Stühle und handgelenkschonende Tastaturen, Flachbildschirme und ein neues Zodiac mit zwei starken 150-PS-Motoren. Wie die meisten Anträge auf Austausch von defekten Geräten oder Neubeschaffung im Leeren verliefen, bekamen sie weder neue Büros noch neue Telefone.
Loig wählte Ronans Nummer auf seinem privaten Handy. Er wollte ihn vorwarnen, dass die Neue aus Brest angekommen war. Zur Verstärkung oder Verjüngung der Einheit. Dabei hatten sie in den vorgefertigten Containern, die ursprünglich provisorisch aufgestellt waren, bis der eigentliche Bau fertig sein sollte, noch nicht einmal einen Stuhl, geschweige denn einen Schreibtisch für die Neue. Der Anrufbeantworter sprang an. Er hatte der Neuen Ronans Adresse gegeben. Was er ihr nicht gesagt hatte, dass es die Adresse eigentlich nicht gab, nicht auf dem Land. Es wäre einfacher gewesen, wenn er ihr erklärt hätte, dass Prad auf einem Schiff wohnte, genauer gesagt auf einer siebzehn Meter langen Ketsch, die Ronan sich nur deshalb mit einem Gehalt eines Lieutenant leisten konnte, weil sie schon einmal auf Grund gelegen hatte, in zehn Meter Tiefe. Sie hatte einem Engländer gehört, der die Strömungen und den Tidenhub von dreizehn Metern vor der Nordküste der Bretagne unterschätzt hatte. Die Versicherung hatte sich gegen die Bergung entschieden, und so bekam Ronan die Mitteilung, dass sich drei Seemeilen vor Port Blanc in ungefähr zehn Meter Tiefe ein Wrack befand. Die Nightowl stellte kein Schifffahrtshindernis dar, weil sie nicht in einem Fahrwasser gesunken war, sondern zwischen zwei Felsspitzen am Grund lag. Jeder Skipper vermied solche Klippen, die bei einer Flut mit einem hohen Koeffizienten gerade dreißig oder vierzig Zentimeter mit Wasser bedeckt waren. Nur ein Engländer bringt so etwas fertig, spottete Loig damals. Roastbeef war der etwas abfällige Ausdruck für Engländern. Die natürliche Feindschaft zwischen Bretonen und Engländer fand sich in allerlei Treppenwitzen wieder. Die weniger ernst gemeinten Spötteleien schlugen allerdings in offene Feindschaft um, wenn es um Fischereirechte ging. Da kam es schon vor, dass sich englische und französische Fischkutter auf dem offenen Meer rammten und sich gegenseitig mit Leuchtpistolen beschossen.
Ronan hatte damals den Eigentümer ausfindig gemacht. Einen Millionär aus London. Ronan stellte ihm in Aussicht, dass er entweder aus sicherheitsrelevanten Gründen die Jacht bergen und er dafür zahlen müsse oder er trat das Eigentum an der Jacht ab und überließ ihm die Bergung. Es dauerte eine Woche, bis Taucher mit Luftkissen die Nightowl vom Grund holten, und noch zwei weitere Jahre, ehe sie wieder ihre Segel setzen konnte. Die Nightowl lag an einer Boje, gute fünfzig Meter im Trieux. Das waren die fünfzig Meter Abstand, die Ronan Prad von der Welt hielt. Es waren fünfzig Meter, in denen täglich Millionen Liter Wasser mit der Flut in eine schmale Felsspalte drängten, um dann sechs Stunden später mit derselben Kraft wieder ins offene Meer zu fließen, und dies lange bevor es auf diesem Teil der Erde überhaupt Menschen gab. Alles vergeht und kommt wieder, auf irgendeine Art, hatte Ronan gesagt, nachdem die Seenotrettung die Suche nach Camille aufgegeben hatte. Camille blieb auf See, wie Tausende Seeleute, die sich in die tückischen Gewässer der Bretagne gewagt hatten. Sie war jetzt ein Teil der salzigen See, sie war in dasselbe Element zurückgekehrt, aus dem alles Leben hervorging. Ronan redete nicht über Camilles Tod. Wenn es um Camille ging, dann war sie nicht tot, sondern verschollen. Sie konnte immer noch da draußen sein, sagte er, und auf eine mystische Art und Weise sprach Ronan über das Meer, wie er über Camille sprach. Für ihn waren sie zu einer Einheit verschmolzen, so wie an stürmischen Tagen die Linie des Horizontes mit dem Meer verschmolz. Loig konnte verstehen, dass Ronan nicht mehr in dem Haus wohnen wollte, in dem er mit Camille gelebt hatte, aber deswegen auf einen feuchten Kahn ziehen? Als einige Wochen nach Camilles Verschwinden der Chef der Gendarmerie Loig in sein Büro bestellte und er dort auf eine Psychologin traf, die ihn fragte, was Ronan für ein Mensch sei, da fiel ihm zunächst nichts ein. Was für ein Mensch?
Nun ja, im Abschlussbericht der Gendarmerie Brest stand der Verdacht, dass Camille mit Absicht in einen Sturm gefahren sei. Die Möglichkeit von Suizid wurde nicht ausgeschlossen. Selbst wenn dies stimmen sollte, so war dies die Entscheidung einer erwachsenen Frau. Die Tatsache, dass sie mit dem damaligen Offiziersanwärter Ronan Prad zusammenlebte, rief diese Psychologin auf den Plan, so als müsste ein Selbstmord nun ganz selbstverständlich eine Generaluntersuchung des Menschen nach sich ziehen, der mit ihr Bett und Teller teilte. Loig wusste nicht, ob die Psychologin dieselben Fragen auch Ronan gestellt hatte. Ronan durchschaute die Menschen. Es war schwierig, ihm etwas vorzumachen. Erst recht, wenn sie ihm mit irgendwelchen psychologischen Gesprächsprotokollen kamen. Hinter dem ganzen universitären Gehabe steckte nur Unsicherheit. Das war so ein Satz, den Ronan beiläufig äußerte, wenn ihn jemand mit Zitaten vollquatschte. »Geliehenes Wissen. Alles unverdaut.« Was für ein Mensch ist Ronan? Jemand, der Sie durchschaut, und zwar noch tiefer, als Sie selbst in sich sehen können.
Hätte Loig der Psychologin oder Seelenbetreuerin, wie er sie nannte, gesagt, was er wirklich über Ronan dachte, dann hätte ihn die Dienstaufsicht noch länger beurlaubt, und mit Sicherheit hätten sie ihn von der Gendarmerie Maritime in ein Pariser Büro versetzt. Denn Tatsache war, dass Loig nie begriffen hatte, wie eine Frau, die wochenlang an einer Statue oder einem Bild arbeiten konnte, immer ein Lächeln auf den Lippen hatte und für die noch das übelste Sauwetter ein echtes bretonisches Wunder war, es mit einem Typen aushalten konnte, der in der Geburt des Menschen das größte Unglück sah. Loig konnte nicht sagen, ob Ronan schon so auf die Welt gekommen war … Was meinen Sie mit so? Die Psychologin hatte ein Talent, ihm jedes Wort im Mund herumzudrehen. Aber sie war nett, hatte schöne Augen und riesige Titten, was ihm damals die ganze Fragerei leichter machte. Er war sozusagen ein Opfer ihrer Weiblichkeit. Anstelle von »so« hätte man viele Adjektive setzen können wie »nervig«, »immer zweifelnd«, »nie zufrieden«, was aber nur mit Worten verdeckt hätte, was Ronan in Wirklichkeit war: ein verdammter Nihilist. Die Psychologin wusste natürlich, was ein Nihilist war, aber sie hatte keine Ahnung, was es hieß, wenn man täglich mit einem zu tun hatte. »Man kommt leichter durch das Leben, wenn man die einfachen Dinge für die wesentlichen hält«, erklärte Loig der Psychologin, die ihren Stift auf ihren Block legte. Sie hielt es für unwichtig. So waren diese jungen Leute von der Universität. »Wenn ich am Abend nach Hause komme, dann freue ich mich über Noras Gemüseauflauf, und wenn der Nachbar noch selbst gemachten Cidre gebracht hat, dann ist so ein Moment wie eine Insel in einem Meer von Beschissenheit. Ich kann Ihnen aber auch versichern, dass ich Tage ohne Inseln kenne. Manchmal reichen auch schon die Hüften einer schönen Frau, die nur vorübergeht oder die aus dem Badezimmer kommt und ihr Kleid fallen lässt. Ich könnte jetzt auch noch von Autos reden oder Fußball … Ronan sieht diese Dinge durch eine Röntgenbrille, durch die zwar all das nicht verschwindet, aber er hat die Gabe, alles auf einen ekelhaften existenziellen Rest zu reduzieren. Ich glaube, so nennt er das. Ich hatte ihn einmal zu uns nach Hause eingeladen, er hatte gerade seinen Posten angetreten. Da stocherte er in der Gänseleberpastete und meinte, dass er nicht verstehen könne, wie Menschen ein Tier so lange quälen, bis es sterbenskrank sei, um es dann zu töten und die kranken Organe als Delikatesse feiern. Eine solche Gesellschaft wird nicht lange überleben. Und das erklärte er vor meiner Frau und meinen damals noch kleinen Töchtern. Es nützt auch nichts, wenn man ihm sagt, dass das jetzt unpassend sei, denn dann bekommt man zur Antwort: ›Die Wahrheit muss jeder ertragen.‹«
Fünfzig Meter kaltes Wasser oder einfach nur leerer Raum. Camilles Verschwinden hatte Ronan aus dem Zentrum gerissen, und jetzt drehte er sich um etwas Dunkles, das wahrscheinlich auch er nicht begreifen konnte.
Die junge Polizistin hatte sich Mühe gegeben, einen möglichst guten Eindruck zu machen. Sie hatte über Penec gelesen, hatte sich über die Einheit erkundigt, in die sie versetzt wurde. Verständlich, doch das machte sie für ihn nicht sympathisch. Er kannte diese Art von nervösem Übereifer junger Frauen. Karrieresüchtige Bissgurken, die alles machten, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. So wie sie ihn angesehen hatte, gehörte er zu den Hindernissen. Doch jetzt war sie hier, in Penec, dem Arsch der Welt. Von hier aus fuhr die Karriere direkt an die Wand aus bretonischem Granit. Davon gab es hier genügend.
Zumindest sah sie gut aus, was man ja heute nicht mehr offen sagen durfte, ohne als Sexist beschimpft zu werden. Keine Geschichten im Dienst. Das war so eine Faustregel, an die sich Loig eigentlich nur hielt, weil ihm bis jetzt die Gelegenheit fehlte. Niemand konnte ihm jedoch nehmen, wenn er Frauen in Gedanken auszog. Er hatte dabei eine beachtliche Fantasie entwickelt, sich anhand der Körperform und der Hautfarbe den nackten Körper vorzustellen. Gewisse Erfahrungswerte brauchte es natürlich. So verrieten die Augenbrauen meist die Farbe der Schamhaare, und wenn es über den Augen buschig war, war es dies auch zwischen den Beinen. Das waren Loigs kleine Intimstudien, die aus seiner Vorstellung einen regelrechten Körperscanner machten. Überraschungen gab es natürlich, denn in den seltensten Fällen rasierten sich Frauen auch die Augenbrauen, wenn sie sich die Schamhaare entfernten. Aber das waren Überraschungen, mit denen er leben konnte.
Die Neue war fleißig gewesen und hatte ihren zukünftigen Chef gegoogelt. Doch Ronans Vergangenheit befand sich nicht im Internet. Nicht einmal er, der mit Ronan schon fast zehn Jahre zusammenarbeitete, kannte dessen Akte und den Grund, warum das Innenministerium, dem die Gendarmerie unterstand, diese unter Verschluss hielt. Loig glaubte, dass es etwas mit Ronans Zeit beim Militär zu tun hatte, der Verwundung und der Zeit im Militärkrankenhaus in Brest. Er verbrachte dort fünf Monate. Das wusste Loig auch nur über tausend Ecken, und selbst ihr früherer Chef Bloomsday hatte keine Ahnung, was Ronan beim Militär gemacht hatte, doch er glaubte aus ebenso fragwürdigen Insiderkanälen gehört zu haben, dass Ronan in der psychiatrischen Abteilung des Militärkrankenhauses gewesen war. Einmal hatte Loig Ronan auf dessen Zeit vor der Gendarmerie angesprochen, was der nur mit einem Kopfschütteln quittierte. »Du musst nicht drüber reden«, sagte er zu Ronan, »aber du weißt … wenn du willst, dann kannst du mit mir reden.«
»Lass es, Loig.« Mehr gab es nicht von ihm.
Die Neue hatte abgesehen von ihrer penetranten Neugier einen Körper, den Loig gerne einmal in seiner natürlichen Beschaffenheit mit den Händen ertasten wollen würde. Sie war nervig, was den Grad der Beschissenheit mancher Tage noch steigern würde. Andererseits konnte sie auch ein wenig Pep in den Mief der schlecht beheizten Büros bringen. Lange blieb so eine Frau ohnehin nicht. Loig hatte den Bericht aus Brest auf Ronans Schreibtisch gefunden. Marie Blanc begann tatsächlich ihren Dienst heute, um neun Uhr. Der Akte war ein Bild angeheftet. Automatenpassfoto, das mit der Frau, die vor ihm gestanden hatte, wenig zu tun hatte. Das Foto sah aus wie eine Comiczeichnung. Marie Blanc, sechsundzwanzig Jahre alt, Abschlusszeugnis der École de Gendarmerie de Châteaulin … Die Frau hatte nur gute Noten und schien ihr Leben mit dem Sammeln von Diplomen zu verbringen. Loig fragte sich, was solch eine Überfliegerin bei der Gendarmerie Maritime in einem Nest wie Penec wollte. Es stand nicht explizit in dem Bericht, den das Hauptquartier in Brest ihnen zugefaxt hatte, doch es schien so, als hätte sie sich freiwillig nach Penec versetzen lassen.
—
Der Nebel war kälter als das Wasser. Zwei Delfine bogen ihren Rücken kurz aus dem Wasser. Ronan suchte flache Stellen auf dem schroffen Felsen, sprang über zwei Felsen und stand vor der Frau in Uniform. Er legte seine Flossen und Taucherbrille auf die Tasche.
»Ich bin Lieutenant …«
»Die Neue … ich weiß.«
Es schien sie nicht zu stören, dass er nackt vor ihr stand. Sie reichte ihm das Handtuch.
»Marie Blanc …«
»Was machen Sie hier? Schwimmen?«
»Ich habe Sie gesucht.«
»Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier bin?«
»Ihr Kollege … Monsieur Dogo … oder so ähnlich.«
»Dagorn.«
»Ich kann mir die bretonischen Namen nicht merken.«
»Dann sind Sie am richtigen Ort, mitten in der Bretagne.«
»Ich dachte, das ist im Finistère?«
»Es gibt viele Regionen in der Bretagne. Hier sind Sie im Trégor. Die Bretonen nennen es Bro-Dreger. Bro bedeutet Land auf Bretonisch.«
»Es gab keine Bretonischkurse auf der Polizeischule in Paris … und in Brest auch nicht.«
»Kein Wunder, dass die Lackaffen in Paris davon keine Ahnung haben.«
»Ist ja auch nicht so wichtig innerhalb der Gendarmerie …«
Ronan spürte, wie seine Haut prickelte, als Blut in die letzten Verästelungen seiner Kapillargefäße floss. Die Kälte im Wasser hatte das Blut nach innen zu den lebenswichtigen Organen gepumpt. Alles ins Innere, zum Herzen hin. Doch die zentralistische Organisation des Körpers war nichts im Vergleich zum Zentralismus in Frankreich. Für Pariser war Paris der Nabel der Welt, und der Rest der Welt, wozu auch der Rest von Frankreich gehörte, bestand bestenfalls aus Vororten.
»Lange bevor in dieser Gegend überhaupt Franzosen geschichtlich erwähnt wurden, gab es schon bretonische Stämme. Die Welt ist alt in der Bretagne. Überall sind Spuren davon, mehr als sechstausend Jahre alt, einige Forscher glauben, dass einige Megalithen vor zwanzigtausend Jahren entstanden sind.«
Marie Blanc lächelte entspannter. Als Ronan sich anzog, spürte er ihre Blicke auf seinem Körper. Ein paar Hundert Meter weiter ragten Felsen aus dem Nebel, die vor Tausenden von Jahren schon bewohnt waren. Zwischen dem kalten Granit, dem still fließenden Strom des Trieux, dem Nebel und Maries verborgenen Fantasien befanden sich nur ein paar Millimeter Stoff der Uniform. In Zeiten der Megalithen lägen sie vielleicht beide nackt auf dem Felsen, würden ihre Körper aneinanderpressen, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Ronan packte das nasse Handtuch und die Taucherbrille in seine Tasche. Die langen Tauchflossen klemmte er unter den Arm.
Ronan kannte jeden Stein, jede Ausbuchtung in den Felsen und stieg mit seinen Flipflops über die scharfkantigen Granitblöcke. Marie kletterte auf allen vieren und suchte nach dem schmalen Pfad, dem sie auf dem Hinweg gefolgt war.
»Es gibt nur diesen Weg«, sagte er und streckte ihr die Hand entgegen. Sie kroch weiter den Felsen auf allen vieren nach oben. Hätte Ronan auch gewundert, wenn sie sich hätte helfen lassen. Sie war stolz und stur. Loig hätte noch hinzugefügt: Zumindest sieht sie gut aus. Ronan hielt ihr erneut die Hand hin. Sie griff wieder nicht danach. Ihr Gesicht hatte keine weichen Züge, es wirkte hart und passte sich den strengen Linien der Uniform perfekt an. Ronan fielen die kräftigen Oberschenkel auf. Die großen Muskeln wölbten sich unter der Hose und spannten den Stoff. Die Neue aus Paris trieb Sport. Nur Klettern war nicht ihr Ding. Sie drehte sich wieder um und suchte nach dem Weg, den sie gekommen war. Das Meer hatte den flachen Zugang zu dem Felsplateau überflutet, was man nicht bemerkte, solange man auf den steilen Felskanten stand, da hier das Wasser nur in der Höhe stieg. Das Meer stieg bis zu zwölf Metern an. Wo sich Felsen und Buchten befanden, war nur noch Wasser. Wo sich Wege durch die Felsformationen schlängelten und verrottete Schiffswracks in den Gezeiten aufgetaucht waren, spülten Wellen Algen an einen Küstenstreifen, den es Stunden zuvor nicht gegeben hatte. Ihren Weg gab es nicht mehr, und Marie Blanc wäre nicht die Erste, die auf einem Felsen in der Bucht vor der Insel Bréhat vom Wasser eingeschlossen wurde.
Sie erreichten beide die oberste Felskante, über die sich die Wurzeln der Tannen wie erstarrte Tänzer über den Abgrund streckten. Unter ihnen der Nebel, unsichtbar das Rauschen der Wellen. Ronans Telefon surrte. Loigs private Nummer. Er hatte ihn zweimal angerufen. Nicht dringend, sonst hätte er es öfter versucht. Eine SMS.
Die Neue aus Brest ist da. Geiler Arsch. Hab sie zu dir geschickt.
»Ist was passiert … ein Einsatz?«
»Nein, aber das wird nicht auf sich warten lassen. Dagorn hat versucht, mich zu erreichen. Wollte mich wahrscheinlich vor Ihnen warnen.«
»Zu spät.«
Ein Tag beginnt in Penec
Marie Blanc hatte ihren Wagen neben ihm geparkt. Als sein Telefon wieder läutete, ging er ran. Er nickte zweimal.
»… verstanden. Ich kümmere mich darum.«
Normalerweise wäre Ronan noch in Erwans Bar vorbeigefahren, hätte einen kurzen Espresso getrunken und die ersten zwei Seiten des Télégramme gelesen. Ohne vor Ort zu sein, wusste Ronan, dass um acht Uhr fünfzehn Erwan die Plastiktische vor seinem Restaurant abwischte, bevor die ersten Frühaufsteher ihren Espresso mit einem Glas Wasser bestellten. Erwan Leclaech hatte das Catch22 von seinem Vater übernommen. Als Kind spielte er schon unter dem Tresen, während sein Vater selbst gebranntes Eau de Vie ausschenkte und dunkles irisches Bier zapfte. Andere Kinder lernten von ihren Vätern, wie man Köder zubereitete und die Angel richtig auswarf oder wie man den Krabben und Seespinnen die Scheren zuband, Erwan lernte so ziemlich alle Schimpfwörter und Flüche, die die französische und bretonische Sprache zu dieser Zeit besaß. Er ging selten zur Schule. Sein Klassenzimmer war der feuchte Geruch von Bier und Rauch. Mit zwölf rauchte er selbst Gauloises brunes ohne Filter. Als seine Zähne sich schwarz färbten, stieg er auf Filterzigaretten um. Erwan hatte sein Leben hinter einem Tresen verbracht, und er würde es auch hinter einem Tresen beenden. So viel stand fest. Nach dem Tod seines Vaters vergrößerte er die Räume, hängte ein paar moderne Bilder auf, die er bei Ikea gekauft hatte, und verlängerte auch die Terrasse zur Hafenseite. Da die Penecois – und darin unterschieden sie sich nicht von dem herkömmlichen Franzosen – mittags gerne im Restaurant aßen, stellte er einen Pizzabäcker ein, den er aus gastronomischen Gründen Giovanni nannte, weil ein italienischer Pizzabäcker mit süditalienischem Akzent viel echter klang. Auch wenn Giovanni in Wirklichkeit Redwanne hieß und aus Marokko kam.
Erwan blickte kurz auf, als er Ronan sah, mehr auch nicht. Als Wirt war Erwan Leclaech genau das Gegenteil seines Vaters. Er redete nicht mit seinen Gästen und war auch froh, wenn ihn niemand ansprach. Nicht mehr Worte als so viele, wie man zur Bestellung eines Biers benötigte. Wer Erwan nicht kannte, konnte den Eindruck haben, er hielt den Rest der Welt für einen dampfenden Haufen Mist. Insbesondere Touristen konnte er nicht leiden. Schon an der Tür, noch bevor sie irgendwas fragen konnten wie »Haben Sie auch glutenfreie Pizza oder ist das Bioschinken?«, erklärte er ihnen, dass es nur Pizza gebe und dass eigentlich schon alles voll sei. Mit etwas mehr Höflichkeit hätte er das Catch22 sicherlich gefüllt. Wer Erwan nicht kannte, der wusste natürlich nicht, dass er jeden beleidigte. Ronan hatte sich daran gewöhnt, seinen Espresso kommentarlos hingestellt zu bekommen. An manchen Tagen wirkte Erwan so erschöpft, dass, noch bevor Ronan sich auf seinen Stammplatz am Fenster setzte, von wo aus er die Masten der Jachten sehen konnte, er ihm nur zubrummte: »Ich hoffe, du willst nichts essen.« Worauf Ronan ihn dann fragte: »Hätte ich denn was bekommen?«
»Wenn du nicht gefragt hättest, vielleicht …«
Das war Erwans Humor. Ob es Humor war oder Verbitterung, das war bei Erwan schlecht zu unterscheiden. Wahrscheinlich hatte er sein eigenes Leben als Witz begriffen, ein Leben, das hinter einem Tresen stattfand und sich mit der Anzahl gezapfter Philomenn Spoum, Tourbé, Rousse oder Stout zu einem glanzlosen Finale abspulte, das dann auf dem Steinfriedhof Penecs sein Ende fand. So hatte er auch kein Verständnis dafür, dass andere ihr Leben als ernste Sache sahen. Sie hatten alle die Pointe eines Lebens nicht verstanden. Auf die Frage eines Gastes, der noch die Unverschämtheit besaß, zu sagen, dass er aus Paris komme und nur auf Durchreise sei, warum er denn keine Speisekarte habe, gab es nur unausgesprochene Sätze, die eine Mischung aus Flüchen und Beschimpfungen waren. »Was denken sich diese Kasper mit ihren dünnen Ärmchen eigentlich … dass ich ein Restaurant bin?«
»Zumindest kann man bei dir essen«, sagte Ronan.
»Du weißt genau, dass ich nur für mich koche. Seit ein paar Jahren koche ich ein wenig mehr, und das, was übrig bleibt, gibt’s dann.«
»Und die Pizza?«
»Wenn Giovanni nicht krank ist, dann gibt es Pizza, sonst nicht.«
Da Erwan für sich selbst kochte, machte er nicht mehr, als die Pflicht des Tages, sich zu ernähren, eben verlangte. Abgesehen von dem Übermaß an amann, wie die salzige Butter im Bretonischen hieß, warf Erwan das Gemüse in eine Metallschale, die er über einem offenen Gasherd anbriet. Und die Butter musste salzig sein. Der amann, der nicht salzig war, war eine Erfindung der Pariser feinen Pinkel. Ronans Verachtung für süße Butter zählte bei Erwan. Zumal er nicht unrecht hatte. Denn dass die Butter wieder süßer wurde, verdankte sie der gabelle. Der königlichen Salzsteuer im Mittelalter. Um einigermaßen über die Runden zu kommen, waren die Bauern gezwungen, das Salz wegzulassen. Die Bretonen hatten Glück. Sie entgingen dem königlichen Steuererfindergeist, weil zu dieser Zeit die Bretagne noch nicht dem französischen Staat einverleibt worden war. Für einen Bretonen war salzige Butter eine Frage der Identität, die sich in kulinarische Tradition fortgesetzt hatte.
Der Nebel vom Meer hatte sich in den schmalen Straßen Penecs festgesetzt. Ronan warf einen Blick zu den Tischen des Catch22. Stühle und Tische standen bereits unter dem Sonnenschirm. Keine Zeit für einen Espresso, dachte sich Ronan. Loig hörte sich ernst an. Fahr bei Morvan vorbei. Irgendetwas war passiert. Wenn einem Fischer etwas passiert ist, dann hieß das nichts Gutes.
Marie Blanc steuerte ihren himmelblauen Clio durch die schmalen Gassen. Auf dem Platz vor der Kirche standen bereits die Marktstände. Um diese Jahreszeit tummelte sich halb Penec zwischen Gemüseständen, dem Schweinemetzger, den Fischverkäufern und Gewürzhändlern. Dazwischen gab es Oliven, Gänseleberpastete und natürlich den bretonischen Cidre. Für einen Außenstehenden war die Anordnung der Stände ein zufälliger Verwaltungsakt. Ronan kannte die Querelen alter Familien, die sich seit Jahrhunderten bekriegten. Wie die Familie Oldecs und die Familie Marteau. Die Oldecs waren Schweinezüchter und warfen den Marteaus vor, ihnen Land gestohlen zu haben. Gerichtlich konnte der Streit gar nicht gelöst werden, weil das Stück Land gar nicht mehr existierte, sondern an der Steilküste östlich von Penec ins Meer abgebrochen war. Die Felsbrocken verschwanden im Meer, der Streit um sie nicht. Das war noch zu Zeiten Napoleons oder noch früher. Die Familien pflegten die Feindschaft so, wie sie ihre Familienwappen über dem Kamin polierten. Heute beschwerten sich die Marteaus über den Gestank des toten Schweins, das als Ganzes gegrillt auf der nördlichen Seite des Platzes angepriesen wurde, während die Oldecs sich über die Fliegen aufregten, die ihrer Meinung nach wegen des verdorbenen Gemüses kamen, das die Marteaus verkauften. Ronan hatte zum Glück nichts mit den Streitereien zu tun. Das war Aufgabe der Gendarmerie in Penec und nicht der Gendarmerie Maritime. Trotzdem erkannte er den zerbeulten Renault Trafic, der vor lauter Rost kaum mehr Farbe hatte und der mitten im Halteverbot stand. Er gehörte Gregor Troguidy. Früher verkaufte er Gemüse, inzwischen nur noch Honig und Gänseleberpastete. Dass er seinen Wagen da parkte, wo das rote Verbotsschild stand, war für Troguidy eine Sache des Prinzips. Er wartete nur darauf, dass die Gendarmerie auftauchte. Troguidys Geschäfte liefen schlecht. Verantwortlich machte er den französischen Staat, der mit immer neuen Steuern Kleinbauern wie Leibeigene behandelte. »Sag deinem Präsidenten, dass er selbst kommen soll«, hatte er den beiden Polizisten von der Police Municipale einmal zugerufen. Die beiden Polizisten versuchten erst gar nicht, Troguidy zu erklären, dass die Police Municipale nicht zur Gendarmerie gehörte, sondern Teil der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister unterstellt war. Noch in derselben Woche erhielt Troguidy Besuch von der Steuerbehörde, was er als Racheakt empfand und als staatliche Repressalie. Er hetzte seine beiden Hunde auf die Beamten. Dass man die Steuerbehörde nicht mit Hunden loswurde, bekam Gregor Troguidy schnell zu spüren. Der Procureur erließ einen Haftbefehl gegen den widerspenstigen Gemüsebauern und Imker. Die PSIG rückte an. Bekannt als die humorlose Brigade, die sich nicht lange mit Worten abgab, sondern erst den Knüppel zog und dann redete. Doch Gregor Troguidy hatte sich aus dem Staub gemacht, genauer gesagt, er war mit seinem 20-PS-Fischerboot unterwegs nach Bréhec. Warum er dorthin gefahren war, wusste Troguidy wahrscheinlich selbst nicht. Ronan wartete auf ihn am Hafen. Und Ronan war wohl der Einzige, der Troguidy überzeugen konnte, sich zu stellen, bevor ihn die PSIG fand.
Ronan erkannte nur den rostigen Trafic. Im Nebel bewegten sich Gestalten, die Kisten schleppten.
»Ganz schön was los«, sagte Marie Blanc und bog zur Ostseite des Hafens ab. Vor dem Hotel Le Goelo zogen Touristen Rollkoffer über das Pflaster, was sich anhörte wie Panzerketten auf einem Parkettfußboden.
—
Ein Ruck ging durch den Wagen. Ronan musste sich am Armaturenbrett abstützen. Ein paar Fußgänger waren, ohne auch nur einen Blick auf den Verkehr zu richten, auf die Fahrbahn getreten und flanierten in zelebrierter Langsamkeit über die Straße.
»Das gibt’s doch nicht«, sagte Marie und trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad, »die tun ja so, als gehöre ihnen die Straße.«
»Nicht nur die Straße …« Ronan ersparte sich einen Fluch und musste an die kurze Begegnung mit dem Bürgermeister im Wald denken. Jäger, was für Helden! Die würden sich wundern, wenn sich Tiere eines Tages bewaffnen und zurückschießen würden. Aber daran lag ja gerade der Reiz für die Jäger: Sie konnten gefahrlos töten, ohne selbst das Risiko einzugehen, als Opfer zu enden. Es sei denn, sie erschossen sich selbst.
»Der sieht aus wie der Mann auf den Plakaten«, sagte Marie und steuerte den Wagen rechts an der Gruppe vorbei.
»Kazav, der Bürgermeister.«
»Mit seiner Frau?«
»Nein, das ist seine Sekretärin, Lucky, eigentlich Lisbeth Ucki.«
»Sie sieht eher aus wie …«
»Eine in die Jahre gekommene Nutte«, vervollständigte Ronan ihren Gedankengang und musste an die Bildbeschreibungen im Louvre denken: »Dame in Männergruppe.« Mit einem Heiligenschein und einer langen blauen Schleppe und ohne High Heels und Minirock, aus dem eine tätowierte Schlange am Innenschenkel entlang kroch, hätte ihr Abbild ein Kunstwerk der Renaissance sein können. Der kleine stämmige Bürgermeister neben ihr sah aus wie ein vollgefressener Junge im Konfirmationsanzug, Lucky auf Stöckelschuhen wirkte wie von Wind geschütteltes Schilf, nach allen Seiten wankend. Alles an diesem Bild war falsch, dachte Ronan. Eine Fälschung, die so dick aufgetragen war, dass es niemandem auffiel.
»Und der Riese mit dem Buch in der Hand, hinter dem Bürgermeister?«
»Bert Leturc, ehemaliger Legionär. Offiziell Kazavs Leibwächter.«
»Und inoffiziell?«
»Kazavs Mann fürs Grobe.«
»Nicht einmal der Bürgermeister von Marseille hat einen Bodyguard.«
»Wenn Kazav dort Bürgermeister wäre, hätte er einen.«
»Sie verstehen sich nicht besonders mit dem Bürgermeister, oder?«
»Fahren Sie einfach vorbei, so dass er uns nicht sieht.«
»Muss ich da etwas verstehen?«
Durch den milchigen Morgennebel blitzten Kazavs Goldzähne. Er schüttelte die Hände einiger Fischer, die am Kai saßen und rauchten. Ronan hatte den Bürgermeister nicht so fett in Erinnerung. Die Bewohner Penecs erkannten Kazav nur anhand seiner Anzüge, seiner schwarz gefärbten Haare und seiner Mercedes-Limousine. Man hätte auch den Bäcker oder den Bestatter in diesen Anzug stecken können, es wäre keinem aufgefallen. Es war drei Monate her, dass er Kazav gesehen hatte, bei der Einweihung einer Festhalle. Es war ein heißer Tag gewesen, und Kazav hatte trotzdem seinen dicken Ledermantel getragen.
»Sie müssen nur weiterfahren.«
»Zurück zur Dienststelle?«
»Nein, zur Frau eines Fischers. Sie hat uns verständigt, weil ihr Mann nicht vom Fischen zurückgekommen ist.«
Ronan sah in den Rückspiegel, in dem Kazavs Gestalt zu einem dunklen Fleck verschwamm.
—
Loig hatte am Telefon nicht viel gesagt. Kannst du bei den Morvans vorbeifahren? Ihr Mann kam nicht nach Hause. Auf dem Land hätte man weniger Alarm geschlagen. Es konnte alles Mögliche geschehen sein. Zu lange gefeiert, ein Ehemann, der zur Abwechslung die Ehefrau eines anderen Ehemannes vögelte, oder einfach nur eine Reifenpanne. Es gab viele Gründe, warum jemand an Land einfach mal für zwölf oder zwanzig Stunden verschwand. Auf dem Meer war alles anders. Wenn Gael Morvan aufs Meer hinausfuhr, dann war er alleine. Wenn er nach Einbruch der Nacht überfällig war, dann war dies kein gutes Zeichen. Daran konnte auch der Pfarrer nichts ändern, den die Frauen der Fischer aufsuchten. Und die alten Witwen flüsterten vor den leeren Schreinen, auf denen die Namen ihrer Männer geschrieben waren, dass Gott das Land der Bretonen längst verlassen habe. Die Nachricht über das Verschwinden von Gaels Boot war zunächst eine von vielen Nachrichten, die bei Ronans Dienststelle eingingen. Ein guter Tag war ein Tag, an dem Loig Dagorn Zeit hatte, so zu tun, als würde er Kreuzworträtsel lösen, während er mit seinem zweiten Handy die Hotelreservierungen mit seinen Tinder-Gespielinnen organisierte und Ronan den verzweifelten Kampf gegen die französische Verwaltung führte, wenn er den Austausch der altertümlichen Telefonapparate beantragte.