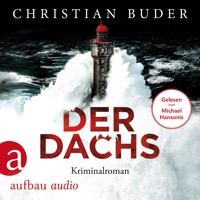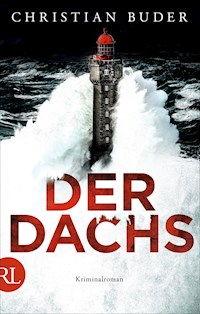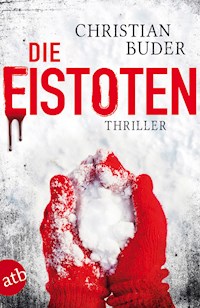9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Als der Pariser Archäologe Yann Schneider für zwei Tage zur Beerdigung seines Vaters auf seine bretonische Heimatinsel zurückkehrt, spürt er die Schatten seiner familiären Vergangenheit: Als Kind traumatisiert durch den Unfalltod seiner Mutter Abigale, muss er dreißig Jahre später erkennen, dass hinter dem Tod seiner Mutter andere Kräfte wirkten, als er immer annahm. Während ein fürchterlicher Sturm aufzieht, kommt Yann seiner eigenen Geschichte, seiner Wahrheit, seinem Schicksal auf die Spur und konfrontiert die Inselbewohner mit ihrer Vergangenheit und ihrer Schuld.
Ein packender, intensiver Roman um einen gewaltigen Sturm und ein jahrzehntealtes Liebesdrama mit tödlichen Konsequenzen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Ähnliche
Zum Buch
Als der Pariser Archäologe Yann Schneider für zwei Tage zur Beerdigung seines Vaters auf seine bretonische Heimatinsel zurückkehrt, spürt er die Schatten seiner familiären Vergangenheit: Als Kind traumatisiert durch den Unfalltod seiner Mutter Abigale, muss er dreißig Jahre später erkennen, dass hinter dem Tod seiner Mutter andere Kräfte wirkten, als er immer annahm. Während ein fürchterlicher Sturm aufzieht, kommt Yann seiner eigenen Geschichte, seiner Wahrheit, seinem Schicksal auf die Spur und konfrontiert die Inselbewohner mit ihrer Vergangenheit und ihrer Schuld. Ein beeindruckender Roman über die dunklen Mächte der Liebe.
Zum Autor
Christian Buder wurde 1968 in Memmingen geboren. Er studierte zuerst Betriebswirtschaft und dann Philosophie in Marburg, Paris und Chicago. Als freier Autor und Journalist schrieb Christian Buder Artikel für Die Zeit und andere Zeitschriften. Er lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Berlin. Als Original-Taschenbücher liegen seine Kriminalromane Die Eistoten und Der Tote im Moor vor. 2015 erschien von ihm das Sachbuch Schwimmen ohne nass zu werden. Wie man mit Philosophie glücklich wird. Das Gedächtnis der Insel ist sein erster Roman bei Blessing.
CHRISTIAN BUDER
DAS
GEDÄCHTNIS
DERINSEL
ROMAN
BLESSING
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Christian Buder
Copyright © 2017 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-20672-7V001
www.blessing-verlag.de
Für Manon, Félicie und meine Eltern
Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.
Friedrich Nietzsche
Wenn nun die Liebe nicht schön ist und das Gute aber notwendigerweise schön, dann folgt daraus, dass auch die Liebe nichts Gutes ist.
Platon
Kapitel 1
Früher gab es die Welt nicht. Sie endete an den letzten Felsen der Insel. Daran glaubte Yann, bis sein Vater ihn aufs Festland mitnahm. Von den schroffen Felsen am äußersten Ende der Bretagne konnte er bei gutem Wetter den Leuchtturm der Insel sehen. Sie blieben nie länger als ein paar Stunden auf dem Festland. Bis auf die Felsen an der Pointe du Raz und dem Hafen von Audierne existierten die Landmassen mit ihren Felsen, Hügeln und Häusern nur abstrakt in seinem Schulatlas. Als Kind wollte er Ozeanforscher werden, wenn es diesen Beruf überhaupt gab. Jemand, der sich mit Fragen beschäftigte, warum eine intelligente Spezies wie der Mensch sich ausgerechnet auf dem Festland entwickelte und nicht im Meer. Mit solchen Fragen beschäftigten sich aber weder Ozeanforscher noch sonst jemand, was Yann erst erfahren sollte, als er die Insel verlassen hatte, nach dem Sturm und der Dunkelheit, die seitdem nicht mehr aufgehört hatte. Yann gefiel die Dunkelheit. Sie legte sich über die Zeit nach dem Sturm, als die Welle aus dem offenen Meer stieg und seine Mutter tötete. Als der Sturm vorüber war, bauten die Bewohner ihre Häuser wieder auf und begruben die Toten, die das Meer nicht geholt hatte. Seine Mutter blieb verschollen.
In Paris bewohnte Yann ein Zweizimmer-Appartement im Zweiten Arrondissement. Die Küste war weit genug entfernt. Er ging über keine Brücken, und er machte einen Bogen um jede Pfütze. Bei Regen verließ er das Haus nicht. Als Archäologe im Louvre konnte er arbeiten, wann er wollte. Doch das Wichtigste war: Er arbeitete alleine in seinem Büro. Niemand, der ihm Fragen stellte, und keine Frau, in die er sich hätte verlieben können. Nur fern von der Küste war er sicher. Das dachte er jedenfalls bis heute.
Von den Inselbewohnern sagte man, dass sie weder zum Festland gehörten noch zum Meer. Seit Jahrhunderten hockten sie auf einem grauen Granitfelsen und harrten aus, als warteten sie auf ein Zeichen des Aufbruchs. Fragte man einen Bewohner der Insel, warum er nicht längst die Insel verlassen habe, bekam man keine Antwort. Wer auf dieser Insel geboren wurde, der kam nirgendwo an. Die kantigen Granitfelsen, das ewige Heranschlagen der Brandung, die Stürme, die selbst die Leuchttürme zum Wanken brachten, formten den wahren Charakter der Bewohner. Wer hier geboren war, hatte es in den Adern. Das Meer färbte seine Seele. Und selbst wer nur einige Monate oder Jahre auf der Insel verbrachte, spürte, wie er sich veränderte. Der Wind und das Meer hinterließen Narben. Kein Mensch lebte freiwillig auf der Insel. – Nicht freiwillig, daran musste Yann denken, als er das Ticket gekauft hatte. Freiwillig ist keiner geboren, und keiner konnte sich aussuchen, wohin er kam, wenn er das Licht der Welt erblickte. Yanns wissenschaftlicher Verstand verbot es ihm, Fragen zu stellen wie: Wer entscheidet, ob jemand in einem Vorort von Paris, in den Favelas von La Paz oder auf einer Insel, acht Kilometer vom Festland entfernt, geboren wurde? Pflanzen hatten den evolutionären Nachteil, an dem Ort bleiben zu müssen, an dem sie Wurzeln gefasst hatten. Menschen konnten wegziehen. Doch für die Bewohner der Insel war dies nicht so einfach. Sie hatten keine Wurzeln, die sie in die Erde graben konnten. Dafür trugen sie ihre Wurzeln auf eine unerklärliche Weise mit sich herum und blieben.
Yanns Vater war tot. Die Frau am Telefon hatte sich gar nicht erst angestrengt, auch nur künstlich mitfühlend zu wirken: »Gendarmerie Nationale, ich muss Ihnen leider mitteilen …« Mit diesen Worten begann die Nachricht vom Tod seines Vaters. Der Pater der Insel, Jean Baptiste Manois, hatte die Leiche von Mathieu Schneider beim frühmorgendlichen Spaziergang in dem nach fauligen Algen riechenden Hafenbecken entdeckt.
Das Meer schäumte. Am Horizont türmten sich dunkle Wolken. Yann hatte Glück gehabt. Er war einer der letzten Passagiere, die über die schwankende Brücke auf die Fähre kamen. Ein alter Matrose in grünem Ölzeug löste die Taue von den Stahlpollern und sprang auf das rostige Deck. Die anderen Passagiere hatten sich schon in den geschützten Innenbereich der Fähre begeben. Yann blieb an Deck. Die Gischt der Wellen schlug über die Reling, als die Fähre das offene Meer erreichte. Eine Stunde dauerte die Fahrt bis zur Insel. Die Wellen türmten sich wie schwarze Berge auf. Die Dieselmotoren schoben das Schiff gegen die Wassermassen, um dann wieder in ein Tal aus schwarzgrünem Wasser zu stürzen. Die Dünung war stärker geworden, als sie die Pointe de Lervily passiert hatten. Vor ihnen lag nun der offene Atlantik. Noch war der Wellengang nicht beunruhigend für jemanden, der auf einem Stück Felsen aufgewachsen war, der an seiner höchsten Stelle gerade einmal neun Meter aus dem Wasser ragte. Wieder ging die Gischt über den Bug und hinterließ an Deck schäumendes Wasser. Ein Matrose schlitterte über Deck und rief ihm zu, sich nach innen in den geheizten Aufenthaltsraum zu begeben. Aus Sicherheitsgründen. Yann nickte ihm zu und ließ seinen Blick zum Horizont schweifen, der eine bewegte Linie im Regen war. Durch die grauen Schleier leuchtete kurz das Licht des Leuchtturms der Insel auf. Der alte Matrose wankte auf ihn zu.
»Hier draußen ist es zu gefährlich. Eine größere Welle, und es fegt Sie von Bord. Die Leute glauben, dass die Wellen einem großen Schiff nichts antun können. Das Gefährliche an Wellen ist aber, dass sie nicht regelmäßig sind. Manchmal schieben sich drei oder vier Wellen übereinander, sie türmen sich zu riesigen Bergen auf, die mit einem Schlag zweihundert Meter lange Frachtschiffe versenken können.«
»Wenn man das Gesetz der Wellen kennen würde, dann würde man alles auf der Welt verstehen«, fuhr der Matrose fort. »Wir leben jahrelang in dem Glauben, dass das Regelmäßige uns umgibt und schützt. Als ob das Leben eine gleichmäßige Dünung wäre, und dann schaukelt sich etwas aus dem Gewohnten hervor. Und von einem Augenblick auf den anderen wird aus einem ganz normalen Leben ein Albtraum. Da überlegt jemand, ob er sich einen roten Wagen kaufen soll oder ob er heiratet oder nicht, und ein paar Stunden später findet man seine Leiche im Wasser. Irgendetwas bricht aus den gleichmäßigen Wellen heraus. Und mit einem Mal türmt sich ein Wellenberg auf, eine schwarzgrüne Wand. Niemand sieht das voraus. Ich bin mir sicher, dass der Mann, der von der Fähre gesprungen ist, auch nicht wusste, warum er sich umgebracht hat. Er war Arzt.«
»Woher wissen Sie, dass er auf der Fähre war?«
»Er stand auf unserer Passagierliste. Die Polizei sagt, der Mann sei von der Fähre gesprungen und die Strömung habe ihn in den Hafen der Insel geschwemmt. Das Meer schluckt nicht jeden Toten.«
»Nichts bringt mich dazu, über Bord zu springen, und keine Welle bekommt mich von Deck.«
Das Schiff sackte nach vorn in ein Wellental. Für einen Moment sah Yann den weißen Schaum auf dem schwarzen Wasser. Lichtreflexe von den Scheinwerfern. Yann hielt sich am Geländer der Eisentreppe fest. So stürmisch hatte er die See noch nie gesehen. Seine Mutter und sein Vater, beide starben im Meer. Vor dreißig Jahren sank das Segelboot, auf dem seine Mutter war, und jetzt war sein Vater auch im Meer gestorben. Die Wassermassen um die Fähre schienen ihm plötzlich unendlich. In jeder Minute starben Lebewesen in diesem Meer, andere wurden darin geboren. Seine Eltern waren nicht mehr als ein sterbender Wal oder eine tote Krabbe. Das Meer kümmerte sich nicht um die Toten. Die Vorstellung von der Gleichgültigkeit des Meeres beruhigte ihn.
Hatte sich sein Vater das Leben genommen? Warum hatte man ihm nichts davon gesagt? Die Polizistin hatte etwas von einem Unfall gesagt. Yann konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sein Vater sich das Leben genommen hatte. Er musste an die Riesenwellen denken, die aus dem Nichts kamen, alles zerstörten und ebenso unheimlich wieder verschwanden, wie sie gekommen waren.
Das Wasser hatte um diese Jahreszeit nicht einmal acht Grad. Sein Vater hatte über die Jahre unzählige Totenscheine ertrunkener Touristen und Fischer ausgestellt. Nur die Fischer wussten, dass eine Wassertemperatur von zehn oder zwölf Grad eine Todeszone war. Wer über Bord ging, war tot. Surfer und Badetouristen kannten die Gefahr nicht oder unterschätzten sie. Sie starben durch die Kälte, bevor die Strömung sie erfasste. Ein Erwachsener, erklärte ihm sein Vater, als er den Totenschein eines Touristen aus Deutschland ausstellte, schaffte es bei einer Wassertemperatur von zehn Grad Celsius gerade einmal sechs Sekunden lang, die Luft anzuhalten. Der Kältereiz auf der Haut ließ Herzfrequenz und Blutdruck extrem ansteigen. Viele Menschen starben schon beim Eintritt ins Wasser an Herzversagen. Ohne Neoprenanzug und Tauchermaske hatte man im kalten Atlantik zu dieser Jahreszeit keine Überlebenschance.
Der Matrose klammerte sich an die Befestigungsseile der Rettungsbojen, die unter dem Treppenaufstieg angebracht waren.
»Wenn das Schiff seitlich rollt«, rief er durch das Getöse aufprallender Wassermassen, »dann ist dies ein schlechtes Zeichen. Gleich wird der Kapitän mehr Fahrt machen, um das Schiff zu stabilisieren.«
Yann hielt sich fest und beobachtete die zerfurchte See. Der Matrose sagte, dass dies das Wetter der Selbstmörder sei. »Besser, Sie gehen rein.« Der Regen peitschte quer über das Deck. Der Leuchtturm der Insel kam näher. Aus dem warmen Innenraum drangen Stimmen. Der Matrose setzte sich neben ihn. Yann bot ihm eine Zigarette an. Der Matrose zog mit zittrigen Fingern eine Zigarette aus der Schachtel. Yann hielt ihm die Hände so hin, dass der Wind die Flamme seines Feuerzeugs nicht ausblies.
»Dies ist erst der Anfang des Sturms«, sagte der Matrose, »es soll ein Jahrhundertsturm werden. Noch schlimmer als der Sturm vor dreißig Jahren. Und wenn dann noch ein Kaventsmann aus dem Sturm kommt.«
Yann drehte dem Meer den Rücken zu, damit der Regen den Tabak seiner Zigarette nicht aufweichte. Vor dreißig Jahren, einen Tag vor seinem achten Geburtstag, hatte das Meer sich schwarz gefärbt. Er hatte es selbst gesehen, als noch kein Wind ging und dunkle Wolken wie ein flüssiges Gebirge vom Horizont aufstiegen. Er erinnerte sich an den Regen, die Wellen, die über die Hafenmauern brachen, und an den Wind. Erst später sollte er erfahren, dass seine Mutter auf der Segelyacht war, die Stunden nach dem Sturm vermisst wurde.
»Wer geht schon bei diesem Hundswetter auf eine Insel?«
»Wer zu einer Beerdigung muss.«
»Ich hoffe, Sie wollen nicht gleich zurück. Wenn Sie Pech haben, dann sitzen Sie die ganze Woche fest.«
»Vielleicht zieht der Sturm vorbei.«
Der Matrose schüttelte den Kopf. »Der Sturm kommt. Das melden sie im Radio. Die Leute an der Küste bringen sich in Sicherheit. Noch kein Sturm hat einen Bogen um die Insel gemacht.«
»Ich bleibe nur zur Beerdigung«, sagte Yann.
»Der Sturm entscheidet, wie lange Sie bleiben.«
»Ich bin nicht der Einzige.«
»Sie meinen die durchgeknallten Sturmtouristen? Sie wollen den Sturm fotografieren, auf der Insel. Die Préfecture hat wegen der Sturmwarnung schon Kinder evakuiert. Die Alten rühren sich nicht vom Fleck. Sind wie Bäume. Man verpflanzt sie nicht. Entweder sie widerstehen, oder sie fallen.«
Der Matrose drückte die Zigarette auf einer der nassen Planken aus.
»Beerdigung.« Der Matrose schüttelte den Kopf. »Mitten im Sturm.«
Die ersten Häuser und der Hafen tauchten aus dem Regen auf. Ihre dunklen Umrisse sahen aus, als hätte jemand nur flüchtig mit Bleistift Skizzen von Häusern auf grauer Wellpappe gezeichnet. Der Seemann stand auf und hatte Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht auf Deck zu halten.
Zur Beerdigung, hörte Yann sich selbst sagen, als müsste er sich an einen Traum erinnern. Vor zwanzig Jahren hatte er die Fähre in Richtung Festland genommen. Damals schwor er sich, niemals wieder zurückzukehren. Zwanzig Jahre hatte er nicht mehr mit seinem Vater gesprochen. Und seine Mutter lag auf dem Grund des Meeres. Das Meer hatte nichts Schönes. Es hatte seine Mutter verschluckt, als hätte es sie nie gegeben. Und sein Vater war ihr jetzt gefolgt.
Die Dünung der Wellen wurde etwas flacher. Die Strömung ließ die Wellen gegeneinander laufen. Die Motoren waren lauter als die flache Brandung im Hafen. Er hätte nicht hierherkommen sollen. Noch konnte er auf dem Schiff bleiben und wieder zurückfahren. Die Beerdigung konnte auch ohne ihn stattfinden. Sein Vater war tot. Und Rykel, sie musste damit fertigwerden, mit oder ohne ihn. Er konnte ihr nicht helfen. Yanns Vater hatte länger mit Rykel zusammengelebt als mit seiner Mutter. Keinen Tag würde er länger bleiben. Wer freiwillig auf diesem elenden Felsen im Meer lebte, dem war nicht zu helfen. Aber da war nicht nur der Sturm. Ein anderes Gefühl kroch langsam in ihn hinein, etwas Dunkles, das er an dem Tag berührt hatte, als seine Mutter nicht mehr nach Hause kam.
Die ersten Schritte waren die schwersten. Das Gehirn hatte sich auf den wankenden Boden auf dem Schiff eingestellt, sodass Yann das Gefühl hatte, die Quaimauer unter ihm würde schwanken. Mit ihm stiegen Touristen aus. Der Wind zerrte an ihren Windjacken, als sie ihre Ankunft fotografierten. Der Matrose, der Angst hatte, dass er über Bord sprang, legte die dicken Taue um die Poller.
Auf der Insel lebten 205 Menschen. Touristen zählten nicht, genauso wenig wie Möwen. Die Möwen kamen und gingen wie die Touristen. Durch den Tod seines Vaters schrumpfte die Bevölkerung auf 204. Die Anzahl der über Achtzigjährigen war um einiges höher als die Anzahl der Kinder. Nach einer Woche hatte man alles gesehen, und nach einem Monat kannte man jeden Stein auswendig. Von den alten Bewohnern sagte man, dass sie sogar die einzelnen Möwen wiedererkannten. Sie gaben ihnen Namen von Toten, weil sie glaubten, dass die Vögel verstorbene Inselbewohner waren. Kein Baum, kein Strauch hielt dem salzigen Wind stand. Bis auf stinkende Algen und wilde Arméries, die aus den Ritzen der verfallenen Steinmauern wucherten, wuchs nichts auf der Insel. Früher bauten einige Insulaner Kartoffeln an, vergeblich. Leben konnte auf dieser Insel nicht Fuß fassen. Alles, was hier lebte, kam nur flüchtig auf die Insel. Wie die Möwen oder die Muscheln, die aus dem Meer krochen und sich an die spitzen Felsen klammerten. Die Bewohner waren eine Spezies, die nicht so beharrlich wie Muscheln war, die sich an einer Ritze festsaugten, aber auch nicht so leicht davonflog wie die Möwen, für die die schroffen Felsen nur ein Landeplatz von vielen war. Mauerreste zwischen kniehohen Dornenhecken, mehr konnte der Mensch auf diesem kahlen Flecken im Meer nicht erreichen. Das Meer hat immer das letzte Wort, sagte sein Vater. Yann erinnerte sich an eine Sturmnacht. Die Wellen warfen sich über die Insel. Bis auf den Felsen mit der Kirche, dem höchsten Punkt auf der Insel, war überall Wasser. Es sah aus, als würde die Insel sinken. Auf der flachen Insel gab es keinen Schutz. Der Wind riss in dieser Nacht sogar eine Kuh mit ins Meer. Yann erinnerte sich an die Dunkelheit, den peitschenden Regen und das Donnern des Meeres, das die Fundamente der Häuser erschütterte. Sie wankten im Sturm, der gesamte Felsen schien von der Brandung aus den Fugen gerissen zu werden. Aber das war alles noch harmlos. Noch schrecklicher als die mörderischen Wellen, die Stürme, die sich wie dunkle Raubtiere in der Nacht über die Insel warfen, waren die immer selben Gesichter. Es war unmöglich, jemandem aus dem Weg zu gehen. Als Yann das erste Mal mit seinem Vater in Brest war, konnte er gar nicht fassen, wie viel verschiedene Menschen es gab. Kein Gesicht glich dem anderen. Stattdessen glichen sich die Gesichter der Insulaner immer mehr, je öfter man sie sah.
Die Fähre legte ab, und Yann ergriff das beklemmende Gefühl, das ein Gefangener haben musste, wenn sich die Türen schlossen. Yann stand noch am Hafen und schaute der Fähre hinterher. Sein Vater trieb also in der braunen Brühe des Hafenwassers, zwischen den bunten Fischerbooten und den Grünalgen. Die Polizistin hatte nicht gesagt, wie sein Vater gefunden worden war. Mit dem Kopf nach unten oder auf dem Rücken, die toten Augen in den Himmel gerichtet? Der Regen hatte die anderen Passagiere verscheucht. Yann blieb noch ein paar Minuten stehen. Der Wind drängte durch seine Regenjacke. Er spürte, wie der Wind nach seinen Knochen griff. Yann ließ den Hafen hinter sich und folgte dem Weg, der zum Haus seiner Eltern führte. Vor zweihundert Jahren hatte es ein Unbekannter auf den Felsspitz gebaut, auf dem auch der Leuchtturm stand. Es brauchte keine Architekten. Fischer bauten die Häuser mit den Steinen, die sie auf der Insel fanden. Das Erdgeschoss im Haus seiner Eltern sah aus, als wäre es Teil des Granitfelsens. Jemand hatte Löcher in den Fels geschlagen und eine Tür und Fenster eingesetzt.
Im Erdgeschoss brannte Licht. Rykel war zu Hause. Er hätte sie anrufen können, um ihr zu sagen, dass er kommt, nach all den Jahren. Doch was hätte er mit Rykel reden sollen? Sie war allein im Haus seiner Eltern. Seine Mutter lag auf dem Grund des Meeres, und sein Vater war vor zwei Tagen tot im Hafenbecken gefunden worden. Wer weggeht und wieder zurückkommt, der findet nicht mehr denselben Ort vor. Alles war in Bewegung und das, was wir kennen, eine Illusion. Yann ging ein Stück zurück und folgte dem Weg zum Hotel.
Das Hotel war nicht weit vom Leuchtturm. Besser er verbrachte die zwei Tage bis zur Beerdigung im Hotel.
»Wir sind belegt«, sagte eine raue Stimme. Sie gehörte Rose. Yanns Mutter hatte noch gelebt, als Rose schon die blauen Tischdecken auf die Plastiktische gelegt und festgeklammert hatte. »Sie kommen auch wegen des Sturms?«
»Von Stürmen habe ich genug«, antwortete Yann. »Ich bleibe nur zwei Tage.«
»Alles belegt. Sagte ich schon, Monsieur. Die haben alle im Voraus gebucht. Wegen des Jahrhundertsturms.«
»Ich bin hier zur Beerdigung meines Vaters.«
Rose schaute ihn an, dann setzte sie ihre Brille auf und knipste die Stehlampe am Tresen an.
»Yann? Ich habe dich gar nicht erkannt. Was machst du hier? Dich hätte ich am wenigsten erwartet. Für alle anderen hier brauche ich keine Brille. Die erkenne ich am Geruch. Und all die Touristen interessieren mich nicht. Wenn wir das Geld nicht bräuchten, würde ich keines dieser Landeier mit ihren Regenjacken und Fotoapparaten auf die Insel lassen. Aber wir haben hier sonst nichts. Entweder fahren unsere Männer zum Fischen raus, und wir Frauen flicken die Netze, oder wir vermieten Zimmer. Das ist alles, und das wird immer so bleiben.« Sie kam um den Tresen. »Jesus, Maria, bist du alt geworden. Graue Haare und einen fetten Kopf.«
»Pariser Leben. Nicht gerade gesund.«
»Ich war einmal in Paris. Der Gestank bringt einen um. Und was arbeitest du, um so graue Haare zu bekommen?«
»Archäologe, im Louvre.«
»Das alte Zeugs hat wohl auf dich abgefärbt.« Sie ging wieder zurück hinter den Tresen. »Warum willst du nicht im Haus deines Vaters übernachten?«
»Ich will lieber woanders wohnen.«
»Hast du Rykel gesagt, dass du kommst?«
Warum wollte er nicht im Haus seines Vaters wohnen? Warum nicht in seinem alten Kinderzimmer, von wo aus er den Leuchtturm sah? Das Haus, das mit dem Felsen verwachsen war. Das Haus, in dem sie jetzt wohnte, schon seit dem Tod seiner Mutter. Sie wollte seine Mutter sein, aber dafür hätte sie auf dem Grund des Meeres liegen müssen.
»Ich werde sie morgen auf der Beerdigung sehen.«
»Das war für uns alle ein Schock, als wir das hörten.«
»Wo haben sie ihn hingebracht?«
»In die Kirche. Sie haben den Sarg geschlossen. Ich hätte ihn gerne noch einmal gesehen, aber Rykel meinte, er habe schlimm ausgesehen. Die Gendarmerie ist noch da.«
»Ich möchte ihn sehen.«
»Da redest du am besten mit der Gendarmerie.« Rose kniff die Augen zusammen und machte ein Gesicht, als wollte sie jetzt jedes Wort einzeln verkaufen.
»Die können mir auch nicht mehr erzählen.«
»Rede mit ihr«, sagte Rose.
»Was soll ich mit der Gendarmerie reden?«
»Nein, mit Rykel.«
Yann nahm seinen Rucksack und wollte sich gerade verabschieden, als Rose seinen Arm packte.
»Du bleibst hier«, sagte sie so, dass jede Widerrede zwecklos schien. »Du wohnst in Jacques’ Zimmer. Er kann die paar Tage auch im Wohnzimmer auf der Couch schlafen.«
»Ich will euch nicht zur Last fallen.«
»Halt den Mund. Ich beziehe dir nachher das Bett neu, und Jacques lasse ich vor der Glotze.«
Ein Windstoß ließ die Fenster im Empfang erzittern, eine Tür knallte, und draußen flatterten blaue Tischdecken davon, Stühle und Tische kippten um.
»Das ist erst der Anfang«, sagte Rose, »ich habe kein gutes Gefühl mit diesem Sturm.«
Rose hatte Jacques auf die Couch verbannt. Als Yann die Insel verlassen hatte, um in Paris zu studieren, war Jacques noch Kapitän der Muette, die er von seinem Vater geerbt hatte. Yann hatte Jacques nur in Erinnerung, wie er auf dem Kutter arbeitete, in Gummistiefeln, mit wenig Worten. Vor fünf Jahren hatte es angefangen, meinte Rose. Er lief den Hafen in Douarnenez an und behauptete, er sei auf der Insel. Als ihm der Hafenmeister sagte, dass er sich im Hafen getäuscht habe, stieß Jacques ihn ins Wasser. Sie dachten, er hätte zu viel getrunken. Doch die Alkoholprobe ergab, dass er keinen Tropfen Alkohol im Blut hatte. Seit zwei Jahren erkennt er niemanden mehr. Nur montags, da ist sein Geist für Stunden klar. »Aber ich weiß nicht«, sagte Rose, »woran er sich da erinnert. Ich glaube ja, dass er überhaupt nicht mehr da ist.« Jacques saß auf dem roten Sofa, mit der Fernbedienung des Fernsehers in der Hand. Yann kannte den Fischer als stämmigen Mann, der nie viel sprach, aber wenn er etwas sagte, dann steckte in seiner Stimme immer eine Faust. Er war fünfundzwanzig Jahre älter als Rose. Rose kam vom Festland und arbeitete damals als Aushilfe auf dem Fischmarkt. Sie hatte ihre Jugend und bewohnte ein Zimmer mit zwei anderen Frauen, und Jacques hatte ein Boot und ein Haus. Rose zog einen alten Mann mit Haus, der auf ihr lag, einem Spinner vor, der nichts außer seiner Jugend hatte. Seit sie die Geschäfte führte, war Jacques nur noch ein Bewohner ihres Hauses. Den Kutter hatte sie verkauft und dafür ihr Haus zum Hotel ausgebaut. Yann hatte früher nie verstanden, warum Rose die Insel nicht mehr verlassen hatte. Sie war die rothaarige Schönheit der Insel, und sie hätte auf dem Festland vielen Männern den Kopf verdrehen können. Stattdessen entschied sie sich für einen maulfaulen Fischer in gelben Gummistiefeln. Rose jedoch hielt immer an der Vorstellung fest, dass sie nur auf der Durchreise war. »Es gibt immer ein Morgen und ein Anderswo«, sagte sie gerne an der Theke, wohl wissend, dass diese scheinbare Möglichkeit mit den Lebensjahren zur bloßen Floskel verkam. Jacques sprach niemals über Rose. Zu ihrer Hochzeit kam niemand aus ihrer Familie, sie hatte keine Freunde und keine Bekannten. Nur Jacques und die Fischer.
Das Donvor war die einzige Bar auf der Insel, die das ganze Jahr geöffnet hatte. Den Namen hatte Jacques gewählt. Chez Rose klang ihm zu sehr nach Paris und Nutten. Und das ging auch deshalb nicht, weil die Kirche nur zwei Straßen entfernt war. Außerdem war für Touristen ein bretonischer Name für eine Bar ansprechender.
Und so hieß das Hotel, das seine Zimmer über der Bar hatte, Hotel Donvor. Es war die letzte Entscheidung, die Jacques gegen den Willen seiner Frau getroffen hatte. Ein Holzschild über dem Eingang mit der Aufschrift Donvor war die kreative Hinterlassenschaft eines Mannes, den das Meer nicht umbringen konnte, der auf dem Land jedoch nicht lebensfähig war.
Die Kirche war offen. Drinnen roch es nach feuchten Steinen und nach Staub. Yann suchte nach dem Sarg seines Vaters, doch bis auf ein paar Blumen auf dem Altar hatte sich nichts verändert. Hinter dem Altar führte eine schmale Holztür in einen Raum. Darin zog sich der Pfarrer für die Messe um, und dort standen auch die Särge der Toten, bevor sie beerdigt wurden. Die Klinke war kalt, und Yann fühlte sich wie ein Eindringling. Das Gefühl verstärkte sich noch, als die Tür sich nicht bewegte. Er klopfte an die Tür. Das Echo seiner Schläge sprang unregelmäßig zwischen den kalten Mauern hin und her, bis nur noch der Wind von draußen zu hören war. Er wandte sich um, und eine Frau stand vor ihm. An ihrem Arm eine rote Binde: Gendarmerie Nationale.
Hätte der Priester die Leiche nicht im Hafen der Insel entdeckt und wäre Gwenn an ihrem freien Tag schon bei der Pointe du Raz zum Schwimmen im Wasser gewesen, dann hätte ihr Chef einen frisch beförderten Lieutenant auf den Fall angesetzt. Gwenn hatte ihren Neoprenanzug in ihrem Rucksack und stieg bereits über die kargen Grasnarben zu der schmalen Sandbucht zwischen den schwarzen Felsen, die messerscharf aus dem Meer ragten. Zwischen ihr und Commandant Argensons Schreibtisch mit dem Portrait des Präsidenten im Rücken lagen 270 Kilometer. Vier Stunden Fahrt. Sie roch die salzige Luft, und sie betrat das Vorzimmer zur Tiefe. So nannte sie den Moment, wenn sie an den Felsen stand und sie nichts anderes mehr hörte als die Brandung und den Wind. Sie war süchtig nach diesem Augenblick, wenn all ihre Gedanken nur noch wie das Wasser waren, das gegen Felsen schlug. Die ersten Wellen umkreisten ihre Knöchel. Das eiskalte Wasser betäubte die Nerven in ihren Füßen. Sie spürte die spitzen Kiesel kaum. Vor viereinhalbtausend Jahren standen an dieser Küste schon Menschen und ließen ihre Gedanken über den tänzelnden Schaumkronen wandern. Sie dachten sich eine Welt, die sie genauso wenig die Zukunft erahnen ließ wie Gwenn Tausende Jahre später. Jeder war in seiner Zeit gefangen. Das Handy surrte in ihrer Tasche. Sie werden dich nicht ohne Grund anrufen. Sie schaltete das Handy lauter und presste es gegen ihr Ohr.
»Wir haben da eine Leiche auf Ihrer Insel«, sagte Argenson. »Sie sind doch auf der Insel groß geworden. Nur ein Toter im Hafen. Wahrscheinlich ein Tourist.«
Warum konnte sie nicht einfach ihr Handy abschalten? »Du bist nichts anderes als ein Diener in blauer Uniform«, hatte ihr Vater gesagt, als sie zur Gendarmerie ging. »Du wirst Jahre damit verbringen, in der Hierarchie aufzusteigen, dein Leben wird vorbei sein, und was hast du mit deinem Leben getan?« Für ihren Vater hatte sie nicht nur die Insel verlassen, um zur Gendarmerie zu gehen. Sie hatte die bretonische Kultur und ihre Ahnen verraten. Die Bretonen gehörten so wenig zu Frankreich wie die Schotten oder Iren zu England, meinte ihr Vater, und er war fest davon überzeugt, dass es eines Tages wieder ein bretonisches Reich geben würde. Sobald ihr Vater das Wort bretonisch in den Mund nahm, redete er von Politik und großen Männern in der Vergangenheit. Das waren mehr Mythen als geschichtliche Fakten. Fakten interessierten ihren Vater nicht, es sei denn, sie passten in sein Weltbild. Gwenn war sich sicher, dass ihr Vater niemals ein Buch über die Bretagne gelesen hatte. Alles, was sie über den Ort wusste, an dem sie aufgewachsen war, hatte sie von ihrer Mutter. Gwenn erinnerte sich an die Spaziergänge mit ihrer Mutter, als sie auf den Felsen am äußersten Ende der Insel saßen und aufs Meer hinausblickten. Gwenn hatte immer den Eindruck, dass ihre Mutter diesen Ort aufsuchte, weil sie auf eine Antwort wartete, die aus der salzigen Leere, gefüllt mit Licht und Wind, eines Tages zu sehen wäre. Jahre später, nachdem ihre Mutter bereits erkrankt war, fand Gwenn alte Hefte aus ihrer Zeit in Paris. Erst nachdem sie die Hefte ihrer Mutter gelesen hatte, verstand Gwenn, warum ihre Mutter bei ihren Spaziergängen manchmal ihre Hände auf einen Felsen legte, die Augen schloss und still in sich hineinredete. Ihre Mutter hatte mehrere Jahre lang an spiritistischen Zirkeln teilgenommen, die sich zu den Nachfahren des selbst ernannten Druiden Allan Kardec zählten. Sie hatte das Buch der Geister gelesen und mit Randnotizen beschrieben. Ihre Mutter musste damals in dem Alter gewesen sein, in dem sie heute war. Ihre Mutter glaubte an Seelenwanderung und dass alles Teil eines Geistes sei. In ihren Aufzeichnungen redete sie von Seelen, die inkarniert in Menschen, Tieren und Pflanzen, aber auch in scheinbar nicht Lebendigem wie Felsen wohnten. Und dann gab es Geister, die herumirrten und manchmal von Menschen Besitz ergriffen. Ihre Mutter hatte damals nicht mehr Lebenserfahrung als sie heute. Dennoch lief sie nicht auf der Insel herum und redete mit Steinen. Steine reden nicht und hören nicht zu. Das Einzige, was auf dieser Welt zählte, war der Mensch, und der gehörte zu einer Spezies, der man nicht trauen konnte. Vielleicht ging sie deshalb zur Gendarmerie, weil sie dort weit weg von den Druiden war, die bei Vollmond Misteln schnitten und mit den Felsen sprachen.
»Wie lange warst du weg?«
Es dauerte einige Sekunden, bis Yann aus dem Gesicht der Frau die Züge des Mädchens lesen konnte, die sie einmal war. Ihr rundliches Gesicht war verschwunden. Wangenknochen und Kinn waren kräftiger. Dort, wo in seiner Erinnerung ein pummeliges Mädchen war, stand nun eine Frau mit drahtiger Figur und kräftigen Schultern. Eines war jedoch gleich, und daran erkannte er sie sofort: ihre nahezu wasserblauen Augen. Alles altert an einem Menschen. Nur nicht die Augen. Man sieht mit ihnen vielleicht schlechter, aber wer in die Augen eines Hundertjährigen blickt, der blickt in die Augen des Kindes, das er einmal war.
»Zwanzig Jahre.«
»Und dann gleich in der Kirche randalieren.«
»Ich habe angeklopft. Mein Vater ist hier.«
»Er macht dir nicht auf«, antwortete sie und zog einen Schlüssel aus ihrer Tasche. »Selbst wenn Tote hören könnten.«
»Ich möchte ihn noch einmal sehen.«
Gwenn ging um ihn herum und setzte sich auf die Altartreppe. In die Stille der Kirche mischte sich das Rauschen der Brandung.
»Dein Vater ist in einem sehr schlechten Zustand.«
»Er ist tot. Nichts kann seinen Zustand noch schlimmer machen.«
»Ich meine, sein Anblick ist nicht angenehm. Er trieb zwei Tage im Meer, dazu kommen noch der Tierfraß und die Schürfspuren.«
»Kann ich zu ihm, oder hat Madame Commissaire etwas dagegen.«
Gwenn schüttelte den Kopf.
»Madame Capitaine, Gendarmerie Nationale. Den Unterschied solltest du kennen.«
»Seit wann gehörst du zur Polizei?«
»Zur Armee. Die Gendarmerie gehört zur Armee.«
»Du hast meinen Vater gefunden?«
»Pater Manois hat ihn im Hafenbecken gefunden.«
»Du warst es, die mir den Tod meines Vaters mitgeteilt hat? Warum hast du nicht gesagt, dass du es bist?«
»Hätte es in diesem Augenblick etwas geändert?«
Gwenn streckte ihm aus der Hocke ihren Arm entgegen. »Hilf mir hoch.«
Yann griff ihren Arm, doch anstatt sie hochzuziehen, zog sie ihn zu sich. Sie hatte einen festen Griff. Yann stützte sich auf der Treppe ab, um nicht auf ihre Schenkel zu fallen.
»Du schuldest mir noch was, das weißt du.«